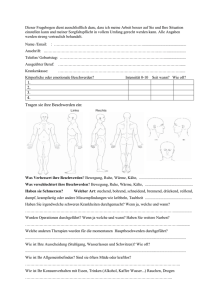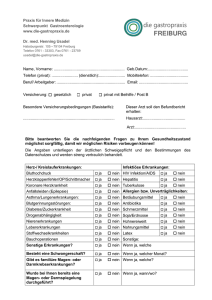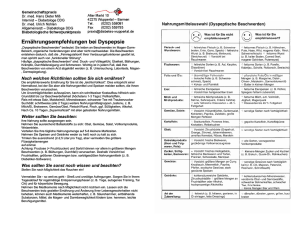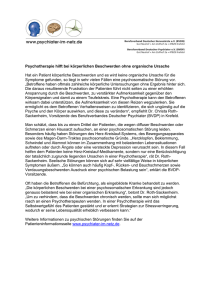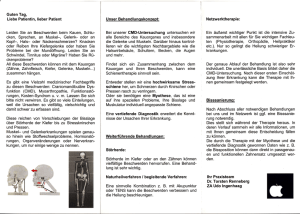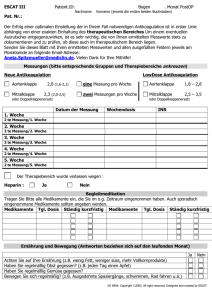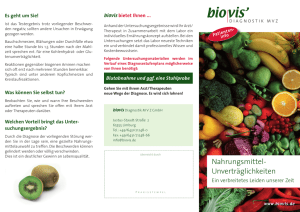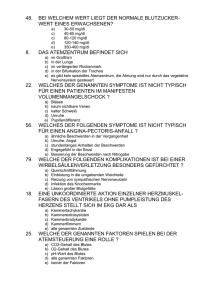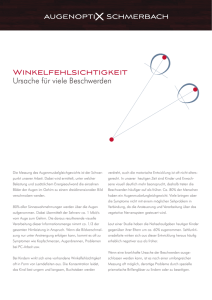Dokument 13.
Werbung

V. Diskussion 5.1 Diskussion der Ergebnisse 5.1.1 Geschlechtsverteilung Das starke Überwiegen des weiblichen Geschlechts mit 77,8% (35 Mädchen), im Gegensatz zum männlichen Geschlecht mit 22,2% (10 Knaben) unterscheidet sich deutlich von dem allgemeinen Geschlechterverhältnis der Patienten der Sehschule. Nach einer Untersuchung von 2001 ist das Geschlechterverhältnis der hiesigen Patienten mit 50,1% weiblichen Patienten und 49,9% männlichen Patienten fast ausgeglichen (DENNE 2002). Nimmt man dagegen Patienten psychosomatischer Einrichtungen, überwiegen erfahrungsgemäß im Kindesalter die Jungen und im Jugendalter die Mädchen (GONTARD 2008). Dies zeigt sich deutlich auch in der Altersverteilung unserer Patienten. Die männlichen Patienten sind zu 70% jünger als 12 Jahre und gelten somit als Kinder. Beim weiblichen Geschlecht ist das Verhältnis Kind zu Jugendlicher nahezu ausgeglichen. Berücksichtigen muss man bei dieser Betrachtung die starke Differenz der Fallzahlen pro Geschlecht. So kann die Altersverteilung der Jungen mit nur 10 Patienten als weniger aussagekräftig betrachtet werden, als die der Mädchen mit 35 Patienten. Die Tendenz der geschlechtskorrelierten Altersverteilung bestätigt aber die erfahrungsgemäße Geschlechtsverteilung von Kindern in psychosomatischer Betreuung. 5.1.2 Alter Die Altersverteilung ist breit gestreut und reicht vom jüngsten Alter mit 5 Jahren bis zum Alter von 19 Jahren. Die größte Gruppe der Patienten weist ein Alter zwischen 8 und 12 Jahren auf: Innerhalb des untersuchten Patientenkollektivs befinden sich 62,2% der Kinder (28 Patienten) in dieser Altersklasse. 48 Im Allgemeinen liegt das am häufigsten vorkommende Alter der jungen Patienten in der Sehschule der Uniklinik Homburg bei 2-3 Jahren (DENNE 2002). Krankheiten wie das frühkindliche Schielen führen zu diesem Altersgipfel. Weiterhin wird der Altersdurchschnitt der Sehschulpatienten gesenkt durch die Gruppe der Frühgeborenen, die sich seit ihrer Geburt aufgrund praematurer organischer Schäden in augenärztlicher Behandlung befinden. Es ist unter Berücksichtigung der Fragestellung der Arbeit schlüssig, dass das Altersmaximum der hier betrachteten Patienten um einige Jahre höher liegt. Immerhin dauert es einige Zeit, bis die Entwicklungsstufen der allgemeinen Entstehung einer psychosomatischen Störung durchlaufen sind. Diese reichen von der vorhandenen Grundstörung, der irgendwann auftretenden traumatisierenden Situation bis zur Somatisierung und schließlich eventuell zur Chronifizierung der Beschwerden (BRETHFELD 2007), was einige Jahre an Lebenszeit erfordert. Unter diesem Aspekt ist es dennoch erstaunlich, dass sich eine solche psychische Konversion schon in so jungen Jahren, wie bei den 5 bis 8 Jährigen manifestiert. 5.1.3 Visus Die häufigsten Gründe für eine verminderte Sehschärfe im Kindesalter sind die Amblyopie, die Konjunktivitis und andere entzündliche Augenerkrankungen wie Blepharitis, Hordeola gefolgt von Glaukom und Katarakt (KANSKI 2003). Keine dieser letztgenannten Erkrankungen wurde bei einem der 45 Patienten diagnostiziert. Ein Refraktionsbedarf wurde in 18 Fällen mittels einer Sehhilfenverordnung korrigiert, jedoch korrelierte die Stärke des subjektiven Visusabfalls nicht zu der ermittelten Refraktion. Der Visus mit einem Mittelwert aller erhobenen Sehschärfewerte beider Augen für die Ferne von 0,68 und für die Nähe von 0,73, liegt über den ermittelten Durchschnittswerten des gesamten Patientengutes der Sehschule mit einem Mittelwert von 0,59 (DENNE 2002). Dies ist ein Ausdruck dessen, dass Sehschulpatienten oft visuslimitierende Organerkrankungen haben. Unsere Patienten haben im Mittel eine normale bis leicht reduzierte Sehschärfe. Die Genauigkeit der Sehschärfenmessung kann durch Hilfsmaßnahmen, wie häufig aufeinander folgende Wiederholung der Messung, Visusmessung mit Heranführen der Sehzeichentafel an den Patienten und gegenteilig dazu das Heranführen des Patienten an die 49 Sehtafel (HAASE 2003), Preferential Looking-Tests (Teller, Cardiff) (KÄSMANN 2007) oder The closed Landoldt-Ring-Test (GRÄF 2001) untermauert werden. Somit kann auch bei stark subjektiv gefärbten Angaben des Patienten eine objektivierte Einschätzung der Sehschärfe durchgeführt werden, die gut auf die organischen Funktionsmöglichkeiten schließen lässt und die subjektiven Angaben des Patienten validiert oder auch falsifiziert. Eine wirklich objektive Visusmessung gibt es leider nicht. Die Durchschnittswerte der ermittelten Sehschärfe erstaunen angesichts der geschilderten Beschwerden. So klagen 32 der 45 Patienten über einen sie beeinträchtigenden Sehschärfeverlust. Innerhalb dieser Gruppe von 32 Patienten wurde allerdings bei 17 ein guter bis sehr guter Visus von 0,6 – 1,25 erhoben. 15 Patienten hatten auch bei der objektivierten Visustestung eine beeinträchtigte Sehschärfe (<0,6), davon war bei 2 Patienten eine Sehbehinderung schon im Vorfeld bekannt und nicht das aktuelle Problem. Die Erfassung dieser Kinder beruht auf den Werten für den Nahvisus gemittelt für beide Augen und dem Fernvisus gemittelt für beide Augen. Beide oder mindestens einer dieser Werte liegt bei diesen Kindern <0,6. Zur besseren Wertung muss man zwischen dem beidseits gemittelten Visus und den oft unilateral geschilderten Beschwerden differenzieren. Somit gab es 15 Kinder, die eine Sehschärfe <0,6 hatten und in Folge dessen über eine Beeinträchtigung klagten. Bei 8 dieser 15 Patienten wurde ein VEP gemacht, um die Sehschärfenangaben zu objektivieren (NAKAMURA 2001). 7 Untersuchungen kamen zu einem unauffälligen Ergebnis und auch die sonstigen Untersuchungen zeigten keinerlei Pathologie. In einem Fall konnte das angeordnete VEP aufgrund mangelnder Mitarbeit nicht durchgeführt werden. Somit konnte bei den 7 Kindern eine organische Erkrankung des visuellen Systems weitgehend ausgeschlossen werden (SAITOH 2001). Auch für eine eventuell bestehende Rindenblindheit wird das VEP in der Literatur als zuverlässiges Diagnosemittel genannt (BARTL 1974). Die übrigen 7 Patienten mit subjektiver Sehbeeinträchtigung wurden bis auf eine Patientin, die ein unauffälliges ERG hatte, nicht elektrophysiologisch untersucht. 4 von ihnen wurde eine Brille verordnet. Desweiteren erfolgte bei 2 dieser Patienten eine fachpsychologische Behandlung und einmal wurden Placebo-Augentropfen verordnet. 50 Der weitere Verlauf ist leider nur bei 2 dieser 7 Patienten bekannt, bei beiden besserten sich die Beschwerden durch die jeweilige Therapie (1x Brille, 1x Psychotherapie). Die ermittelten Werte für den Nahvisus mit einem Mittelwert von 0,73 fallen höher aus. Die 9 Patienten mit einem Nahvisus <0,3 waren in 5 Fällen unauffällig bei der Untersuchung der VEP und somit morphologisch-elektrophysiologisch ohne Auffälligkeiten. Die übrigen 4 Patienten wurden nicht elektrophysiologisch untersucht. Bei 2 der 9 Patienten lag eine deutliche Diskrepanz der Sehschärfetestung mit den übrigen Untersuchungsergebnissen vor, dies ist ein in der Literatur (HAASE 2003) (WHO 1992) (SCHEIDT 2002) u.a. oft zitiertes pathognomonisches Merkmal psychogener Sehstörungen. Eine Patientin leidet an einer rheumatischen Begleiterkrankung, die mit den Beschwerden in Verbindung gebracht werden konnte. Bei einem weiteren Patienten war die schlechte Sehschärfe nicht der Behandlungsgrund. Bei den 5 übrigen Patienten konnte keine Ursache des Visusabfalls festgestellt werden. Allerdings wurden bei allen 5 Kindern erhebliche seelische Probleme eruiert, bedingt bei 2 Kindern durch sexuellen Missbrauch in der Vorgeschichte, bei 2 Kindern durch Schulprobleme und bei einem Kind durch Scheidung der Eltern, die mit den Erkrankungsbeschwerden in Zusammenhang zu stehen schienen. 5.1.4 Morphologie des vorderen Augenabschnitts Erwartungsgemäß fiel bei der Beurteilung des vorderen Augenabschnitts die Zahl der pathologischen Fälle mit 4,4% (2 Patienten) deutlich geringer aus als die Zahl der organisch Gesunden mit 82,2% (37). Auch die 6 (13,3%) „grenzwertig“ beurteilten Patienten waren nicht organisch krank. Es bestanden lediglich kleinere Abweichungen von der Norm, die den Befund zwar auffällig, nicht aber automatisch pathologisch machten. Die „pathologischen“ Fälle waren zum einen eine Patientin (E.P., w, 15 J.) mit einseitigem Blepharospasmus, dessen Ursache in deutlichem Zusammenhang mit der psychischen Belastungssituation durch die Trennung der Eltern stand. Bei der selben Patientin bestand zudem eine Follikulitis. Eine weitere Patientin (M.M., w., 19 J.) litt an einer beginnenden Linsentrübung mit bandförmiger Keratopathie bei einer seit Jahren bestehenden chronischen Uveitis anterior und intermedia. Die angegebenen Beschwerden, eine Gesichtsfeldeinengung auf <10°, sowie eine massive Visusreduktion (Fernvisus 0,18, Nahvisus 0,06), waren aber deutlich stärker als der organische Befund vermuten ließ. Die Patientin litt außerdem an 51 mehreren Begleiterkrankungen (z.B. nicht insulinpflichtiger Diabetes mellitus, Pubertas praecox, hormonale Dysregulation, Z.n. Spina bifida), welche die Beschwerden jedoch auch nicht direkt erklären konnten. Bei der Untersuchung fiel eine deutliche Suggestibilität auf, eine verminderte Belastungsfähigkeit, sowie ein Overprotection seitens der Mutter. Diese Begleitkonstellation lenkte den Verdacht auf ein psychosomatisch gefärbtes Geschehen, die geschilderten Beschwerden konnten als Ausdruck der Überforderung erkannt werden. 5.1.5 Morphologie der Makula Das Ergebnis der Untersuchung der Makula zeigt, dass 42 (93,3%) der 45 Patienten einen unauffälligen Befund hatten. Die beiden als „grenzwertig“ beurteilten Patienten waren einmal oben genannte Patientin (M.M., w., 19 J.), deren Problematik im vorigen Abschnitt bei der Beschreibung des vorderen Augenabschnitts näher erläutert wurde. Bei ihr fiel eine etwas schlechtere Differenzierung der Makula auf, die aber noch keinen pathologischen Wert hatte. Bei einer weiteren Patientin (R.S., w., 8 J.) fiel ein Minikolobom auf. Die Stärke des angegebenen Visusabfalls passte aber auch hier nicht zum morphologischen Befund. In diesem Fall kann von einer „positiven Verstärkung“ ausgegangen werden. Der als leicht verschlechtert erlebte Visus, der zum Besuch beim Augenarzt führte, führte gleichzeitig zur Diagnose des Koloboms. Dies wiederum verstärkte das Krankheitsgefühl des Kindes, da der organische Befund den Visus durch psychogene Verstärkung noch schlechter erscheinen ließ, als er ursprünglich vom Augenarzt gemessen wurde. Das einzige Kind mit einem pathologischen Makulabefund war eine Patientin (C.M., w., 11 J.), die eine Makuladystrophie mit vorwiegender Zapfenbeteiligung sowie eine umschriebene Atrophie und Hyperpigmentierung des retinalen Pigmentblatts aufwies. Es bestand der Verdacht auf Morbus Stargardt. Jedoch korrelierte weder der Organbefund, noch die Elektrophysiologie zu den angegebenen Beschwerden (starker Visusabfall, Nachtblindheit, Gesichtsfeldeinschränkung auf R40°, L20°, sowie Farbsehstörung). Vielmehr bestand ein Zusammenhang zwischen dem Visusabfall und der Trennung der Eltern, was auf eine psychosomatische Verstärkung der Beschwerden hindeutete. Hier zeigt sich, wie wichtig es ist, in solch unklaren Fällen immer alle Möglichkeiten der Krankheitsursache zu hinterfragen um weder die psychische, noch die organische Seite außer Acht zu lassen. Es müssen beide in der Schwere ihrer Ausprägung gegeneinander abgewogen und in der Diagnostik berücksichtigt werden. 52 5.1.6 Morphologie der Papille/ Nervus opticus Bei der Untersuchung der Papille wurden keine pathologischen Befunde erhoben. Lediglich 2 Patienten (4,4%) fielen durch einen schrägen Eintritt des Sehnervs auf. Weder eine Optikusatrophie, als bedeutender Indikator für eine schwere Beeinträchtigung des visuellen Systems (HANSEN 1992), noch eine glaukomatös erhöhte Exkavation mit einer erhöhten CDR >0,4 wurden diagnostiziert. Auch andere Formen einer Pathologie der Papille waren in dieser Patientenpopulation nicht zu finden. Dies passt zu den allgemein- pädiatrischen Charakteristika unserer Patienten. So findet sich kein Patient mit zerebraler Lähmung, Hydrozephalus, Z.n. intraventrikulärer Blutung, bekannter peripartaler Asphyxie, kraniofazialer Dysmorphie, Hirntumor oder sonstiger neurologischer Auffälligkeit. Diese Patienten gelten als besonders anfällig für eine Optikusatrophie (MUGDIL 2000) (BLACK 1980). Auch Albinisten finden sich innerhalb dieses Patientenkollektives nicht wieder. Diese Patientengruppe ist eine weitere, die als besonders prädestiniert für pathologische Papillenveränderungen gilt (KÄSMANN 2000). Statistisch gesehen kommt eine patholgische Papillenveränderung im allgemeinen Patientengut der Sehschule Homburg bei etwa jedem 3.Patienten (bei 32,5%) vor (DENNE 2002). Dies würde bedeuten, dass bei gleicher allgemeiner Krankheitsverteilung in unserem Patientengut mindestens 14 Patienten an einer Optikusatrophie oder ähnlichem erkrankt sein müssten. Da dies nicht der Fall ist zeigt sich, dass unsere Patientengruppe seitens des Organbefundes nicht mit der allgemeinen Patientenpopulation der Kinderophthalmologie verglichen werden kann, sondern mehr der Normalbevölkerung entspricht. Dies wiederum unterstützte die Annahme der psychogen bedingten Visusminderung. 53 5.1.7 Morphologie der Peripherie des Augenhintergrundes Der Augenhintergrund, der in 44 (97,8%) der 45 Fälle ohne jegliche Auffälligkeit oder Pathologie war, zeugt wiederum von einem unauffälligen ophthalmologischen Status fast aller untersuchten Patienten. Lediglich der in einem Fall gefundene Fundus hypertonicus deutete auf ein pathologisches Geschehen hin. Bei diesem Patienten (H.-P.L., m., 13 J.) bestanden zeitweilig auftretende Doppelbilder als einzige Beschwerde. Allerdings gilt solch eine morphologische Veränderung nicht als Grund für eine Sehbeeinträchtigung oder für Diplopie (PACHE 2002). Die hypertone Netzhautgefäßveränderung wird von den Betroffenen meist nicht wahrgenommen. Eine hypertensive Retinopathie als seltene Maximalform, wie sie in diesem Falle nicht vorliegt, könnte durchaus mit einer verminderten Sehschärfe und Skotomen einhergehen (PACHE 2002). Doppelbilder werden in diesem Zusammenhang allerdings nicht beschrieben. 5.1.8 Gesichtsfeld Die Messung des Gesichtsfeldes lieferte bei 13 (28,9% der 45) der insgesamt 28 dokumentierten Untersuchungen ein unauffälliges Ergebnis. Die 5 Untersuchungen, die als „fraglich und widersprüchlich“ bezeichnet wurden, waren zum einen eine junge Patientin (A.Z., w., 11 J.), deren Pupillenreaktion während der Untersuchung auf ein normales Gesichtsfeld hindeutete, deren angegebenes Gesichtsfeld jedoch deutlich eingeschränkt war und die teils unklare Angaben machte. Bei 3 weiteren Patienten lagen ebenfalls sich zum Teil widersprechende Angaben vor, sowie wechselnde, nicht reproduzierbare Ausfälle. Bei der fünften Patientin (B.P., w., 8 J.) war eine deutlich kooperationsbedingte Einschränkung des Gesichtsfeldes auffällig. So weitete sich das Gesichtsfeld nach wiederholter Messung, als erweiterte Untersuchungsmethode bei Verdacht auf funktionelle Sehstörung (KÄSMANN 2007), von anfangs 10° auf 40° aus, zudem bestand eine auffällig lange Reaktionszeit. 54 Bei den 10 als pathologisch eingeordneten Befunden der Patienten (22,2% der 45) bestand 6 mal eine konzentrischen Einengung, für die bei ausreichender Mitarbeit kein morphologisches Korrelat zu finden war. Die Lichtreaktion und die Elektrophysiologie waren normal. Wenn man die Kontinuität eines durch eine psychogene Störung geprägten Untersuchungsbefundes aus Sicht des Patienten betrachtet, wird deutlich, dass ein unterbewusst simuliertes Röhren- Gesichtsfeld leichter aufrechtzuerhalten ist als ein Zentralskotom. Das Ausblenden der Peripherie ist leichter durchführbar und reproduzierbar als ein zentraler abgrenzbarer Ausfall und kommt somit erwartungsgemäß häufiger vor. Eine konzentrische Einengung ist eine häufig beschriebene subjektive Störung des Gesichtsfeldes, der sogenannte „Tunnelblick“ kann, wie in der Literatur beschrieben, psychisch ausgelöst werden (ROCKMANN 2007). Im übertragenen Sinne kann man in diesem Untersuchungsbefund eine deutliche psychische Komponente erkennen. Das Nichtwahrnehmen (-wollen) der weiteren Umgebung und der „starre“ Blick nach vorne kann nicht nur für ein visuelles, sonder ebenso für ein seelisches Ausblenden stehen. Einen ebensolchen Fall beschreiben V.BRETHFELD und R.KUNZE in einem Fallbeispiel im Rahmen ihres Artikels „Psychosomatik in der Augenheilkunde. Teil 1: Krankheitsentstehung“ (2007). Von den 10 Patienten (22,5% der 45), deren Gesichtsfeldtestung einen pathologischen Befund zeigte, klagten 3 Patienten über eine sie beeinträchtigende Gesichtsfeldeinschränkung als singuläre Beschwerde. 5 Patienten klagten neben den Gesichtsfeldbeschwerden gleichzeitig über eine sie beeinträchtigende verminderte Sehschärfe. Bei 4 von ihnen wurde auch tatsächlich ein schlechter Visus (<0,6) gemessen. 3 Kinder waren beidseitig betroffen, 1 Kind nur unilateral. Weitere 2 Patienten mit pathologischem Befund in der Gesichtsfeldtestung hatten keinerlei Beschwerden diesbezüglich. Bei einem von ihnen (S.T., w., 12 J.) wurde einseitig ein stark verminderter Visus gemessen, der das Kind jedoch nicht zu beeinträchtigen schien. Umgekehrt, bei den 13 Patienten die über Beschwerden seitens des Gesichtsfeldes klagten (Tabelle 10), hatten 8 auch einen als pathologisch angegebenen Befund. 55 Bei 3 wurde das Ergebnis der Testung als „fraglich und widersprüchlich“ eingestuft. Bei 2 Patienten lag laut Testung ein Normalbefund vor. Die Schwierigkeit bei der Gesichtsfelduntersuchung ist in erster Linie die starke Abhängigkeit von der Mitarbeit des Patienten. Die Angaben des Patienten können nicht sicher nachgeprüft werden. Die Möglichkeit der Beobachtung des Pupillenlichtreflexes, die mehrmalige Wiederholung des Procederes (KÄSMANN 2007), sowie die Aufnahme der ersten Augenbewegung nach Signalreiz (GRÄF 1999) sind Möglichkeiten zur Überprüfung der Patientenangaben. Allerdings ist bei mehrmaliger Untersuchung die Ermüdung des Patienten als eine große Fehlerquelle nicht außer Acht zu lassen. Sie zeigt sich oftmals in der typischen Ermüdungsspirale, die das Gesichtsfeld mit fortschreitender Testung immer enger werden lässt. Das sogenannte Spiral- Gesichtsfeld gilt zudem als ein typisch psychogen hervorgerufener Untersuchungsbefund (HAASE 2003). Insbesondere bei Kindern ist somit eine aussagekräftige Gesichtsfeldmessung oft sehr schwierig, da mangelnde Mitarbeit und Konzentration die Ergebnisse stark verfälschen. 5.1.9 Farbensehen Die häufigste Störung der Farbwahrnehmung, die Rot-Grün-Farbschwäche, die bei ca. 8-9% aller Männer und 05-0,8% aller Frauen vorkommt (x-chromosomal rezessiver Erbgang) (NEITZ 2000), wurde bei keinem Patienten diagnostiziert. 2 Kinder (4,4%) gaben eine „totale Farbenblindheit“ an. Bei einem Kind (S.S., w., 13 J.) wurde zunächst keine der Ishiharatafeln, inklusive der Prüfzahl, erkannt, was bereits den Verdacht auf eine funktionelle Störung aufkommen ließ. Die Prüfzahl konnte schließlich doch benannt werden. Sonst konnten keine Farben benannt oder unterschieden werden. Da es sich um ein 13 Jahre altes Mädchen ohne jegliche geistige Behinderung handelt, kann ein Unverständnis des Tests weitgehend ausgeschlossen werden. Bei beiden Kindern bestanden zudem psychische Auffälligkeiten die mit der Trennung der Eltern und bei dem einen Mädchen (S.S., w., 13 J.) mit zusätzlichen Schulproblemen in Zusammenhang zu stehen schienen. Bei beiden wurde eine psychologische Behandlung eingeleitet. 56 Die 5 „grenzwertigen“ Fälle (11,1%) lassen bei 2 Kindern, die unter einer Farbentsättigungswahrnehmung litten, eine leichte Rot-Grün-Schwäche vermuten, da es sich in beiden Fällen um eine Farbwahrnehmungsstörung im roten Bereich handelte. Es handelte sich um 2 Mädchen (S-P.S., w., 16 J.) (J.R., w., 12 J.), was untypisch ist. Die beiden weiteren als „grenzwertig“ beurteilten Patienten, die die Ishiharatafeln nur zum Teil erkannten, zeigten ein nicht zu klassifizierendes Muster des Nichterkennens und eine ungenaue Reproduzierbarkeit des Tests, so dass differentialdiagnostisch neben psychogenen Farbverkennungen eine mangelnde Mitarbeit oder Konzentration erwogen werden muss. Bei beiden bestanden zudem psychische Auffälligkeiten, die mit der Trennung der Eltern und bei dem einen Mädchen mit zusätzlichen Schulproblemen in Zusammenhang zu stehen schienen. Der letzte hinsichtlich der Farbwahrnehmung als „grenzwertig“ beurteilte Befund (A.Z., w., 11 J.) findet sich bei einem besonderem Krankheitsbild (siehe Einzelfallvorstellung 5.2.2.). Die Angabe der 11 jährigen Patientin, bei Traurigkeit nur noch Schwarz- und Grautöne sehen zu können, lässt an ein dissoziatives Geschehen denken. Eine dissoziative Störung (früher: hysterische Neurose) beschreibt ein sehr heterogenes psychisches Krankheitsbild mit Verlust der Integration bestimmter Ich-Funktionen oder wie in diesem Fall bestimmter körperlicher Funktionen. Dies wird als pseudoneurologische Störungen, oder Konversionsstörungen bezeichnet (ROHDE-DACHSER 2004), wobei jedwede Körperfunktion betroffen sein kann. Solch eine dissoziative sensorische Störung, wie sie auch als taktile Gefühlsstörung oder Hörstörung beschrieben wird (GRESS 2008), kommt nach schwersten psychischen Traumata vor. In der Anamnese dieser Patientin wurde bekannt, dass ein schwerer Missbrauch durch den Großvater (Vater des vor Geburt verstorbenen Kindsvaters) vorgefallen war. Daraus ergaben sich starke intrafamiliäre Konflikte, eine massive Overprotection seitens der Mutter und letztendlich auch sozial bedingte Probleme in der Schule in Form von Mobbing und Schulangst. Diese massive psychische Belastung kann durchaus Auslöser einer solch psychogenen Erscheinung sein, zumal außer einem kindlichen Schielsyndrom (alternierend, konvergierend), das durch Sehhilfenverordnung bereits bestmöglich korrigiert wurde, keine weiteren Begleiterkrankungen bekannt sind. Organisch gesehen und auch vom Ergebnis der normalen Farbtestung, war das Mädchen völlig altersentsprechend. Ein weiterer Punkt, der für ein dissoziatives Geschehen spräche, ist das nur sporadische Auftreten der Beschwerden, welches immer mit unangenehmen Gefühlen in Verbindung steht. 57 Zu diskutieren bleibt, wie es zur Konversion in Richtung der Augen kommt. Das ansonsten gesunde Kind, das außer in einer psychologischen kaum in ärztlicher Behandlung war, kannte als Körperschwachpunkt bisher aufgrund des frühkindlichen Schielens nur den okulären Bereich. Diese anlagebedingte Schwachstelle seitens der Augen birgt eine psychosomatische Reaktionsbereitschaft (BRETHFELD 2007). Dies kann durch die belastende Sozialgeschichte schließlich zur Somatisierung führen. Somit belegt dieser Fall die von V.BRETHFELD und R.KUNZE (2007) beschriebene Entstehungstheorie des Krankheitsgeschehens. 5.1.10 Stereosehen Pathologien der Stereopsis machen sich meist in Form von Diplopie, Suppression oder Konfusion bemerkbar. Auslöser hierfür sind vor allem Strabismus, Nystagmus und neurologische Blickparesen (KAUFMANN 1986). Die angewandten Tests wie TNO als Standardverfahren, Lang 1 und 2, Bagolini und Titmus liefern durch subjektive Angaben des Patienten und objektive Beobachtung der Blickbewegung durch den Untersucher annähernd genaue Angaben der Querdisparation in Bogensekunden (KANSKI 2003). Die 34 unauffälligen Patienten (75,6% der 45) hatten keine Probleme bei der Testdurchführung. Die 4 als „grenzwertig“ beurteilten Patienten (8,9% der 45) fielen in erster Linie durch mangelnde Mitarbeit und inkongruente Angaben auf. Diese Stereotests beinhalten die Schwierigkeit, dass die Objekte auf den Testkarten oft auch für zwei gesunde Augen nicht gleich so zu erkennen sind, dass sie benannt werden können. Kinder neigen dazu, zu behaupten sie würden nichts sehen, wenn ihnen nicht ganz klar ist, was sie sehen. So ist bei diesen Verfahren die Kontrolle der Blickbewegung und der Fixation auf die Karten ein wichtiges Untersuchungskriterium und die Genauigkeit des Tests hängt stark von der Beobachtungsgabe und Erfahrung des Untersuchers ab. 58 5.1.11 VEP Die Auswertung der VEP-Untersuchungen zeigt, dass alle 19 Patienten, bei denen eine Testdurchführung möglich war, einen unauffälligen Befund hatten. Die Bestimmung der VEP bewährt sich besonders in der Verlaufsdiagnose der Optikusneuritis bei Multipler Sklerose, der Chiasma-Kompression durch Tumoren, bei toxischer Optikusschädigung sowie bei okulokutanem Albinismus (MASUHR 2007). Es ermöglicht die Topodiagnostik des Sehnervs und des visuellen Cortex. Der Vorteil dieser Untersuchung liegt in der Nichtinvasivität, der Schmerzlosigkeit ihrer Durchführung und der fehlenden Strahlenbelastung (BACH 1996). Desweiteren ist die Untersuchung der VEP ein empfohlenes Procedere bei Verdacht auf eine funktionelle Störung (KÄSMANN 2007). Zu beachten ist allerdings, dass die elektrophysiologische Diagnostik nicht als einzige Untersuchungsmethode dient, vielmehr ist sie ein richtungsweisendes Hilfsmittel, auf das bei entsprechender Fragestellung zurückgegriffen werden kann und dessen Ergebnisse im Kontext mit den sonstigen klinischen Untersuchungsbefunden interpretiert werden müssen (BACH 1996). Ein unauffälliges VEP schließt eine Erkrankung des visuellen Systems also nicht gleich aus. Die Untersuchung der VEP kam bei unseren Patienten vor allem bei Beschwerdeangaben bezüglich des Gesichtsfeldes zum Einsatz. Von 13 Patienten, die über Ausfälle in diesem Bereich berichteten, und von denen 8 auch in der Perimetrie Gesichtsfelddefekte angaben, hatten 9 Kinder ein unauffälliges VEP. Weitere 10 Patienten, bei denen eine Untersuchung mittels VEP angeordnet wurde, klagten über eine Sehschärfenverschlechterung, die sich nur bei 7 von ihnen anhand der Visustestung bestätigte. Auch bei ihnen war das Ergebnis der VEP, insofern durchführbar, unauffällig. Im Kontext mit den übrigen zum Großteil unauffälligen morphologischen Untersuchungsergebnissen kann das VEP als Baustein zur Erhärtung der Verdachtsdiagnose der nicht- körperlichen, somit psychogenen Sehstörung dienen. Die Aussagekraft dieser Untersuchungsmethode alleine sollte allerdings nicht überschätzt werden. 59 5.1.12 ERG Ein unauffälliges ERG, wie es bei 5 der 7 elektrophysiologisch untersuchten Patienten erstellt wurde, spricht für eine intakte Funktion der retinalen Ganglienzellen und des retinalen Pigmentepithels. Eine Erkrankung, bei der eine ERG-Untersuchung besonders häufig zum Tragen kommt, ist die Retinopathia pigmentosa. Hierbei handelt es sich um eine Netzhautdystrophie mit Zerstörung der Photorezeptoren. Bei den beiden als pathologisch eingestuften Patienten dagegen handelt es sich zum einen um eine Patientin (C.M., w., 11 J.) mit einem Verdacht auf Morbus Stargardt. Auch diese Erkrankung, bei der es sich um eine autosomal-rezessiv vererbte Genmutation handelt, in Folge derer es zum Photorezeptorenuntergang durch intrazelluläre Anhäufung des all-transRetinals kommt, wird in erster Linie mittels ERG diagnostiziert (BECKER 2007). Untersuchungsbefund und Verdachtsdiagnose passen in diesem Fall zusammen, nicht aber der angegebene Visus, der deutlich unter dem zu erwartenden Befund liegt. Bei der anderen Patientin ist die Ursache der pathologischen Ergebnisse im ERG nicht gesichert. Es handelt sich um eine Patientin (M.M. w., 19 J.), die multimorbide von Geburt an unter verschiedensten Entwicklungsstörungen leidet. Die Begleiterkrankungen (z.B. Spina bifida, Pubertas praecox, NIDDM) wirken sich in der Regel nicht, bzw. nicht in so frühen Jahren, auf die Funktion der Netzhaut aus. Es kann allerdings zu einem pathologischen ERG auch durch unstete Fixation, „Danebenschauen“ und häufiges Blinzeln bei der Ableitung kommen. Dies wiederum entspräche einem mitarbeitsbedingten Artefakt, was nie ganz auszuschließen ist. 5.1.13 Beschwerden Die am häufigsten angegebene Beschwerde war erwartungsgemäß ein Visusabfall bei 32 Kindern (siehe Tabelle 10). Die Sehschärfe ist der Parameter, der vom Patienten selbst am besten tagtäglich kontrolliert werden kann, und bei dem eine Veränderung schnell merkliche Einschränkungen verursacht. Typisch für eine psychogene Visusreduktion ist, dass der morphologische Befund ohne pathologischen Befund ist, der durch reflektorische Testverfahren ermittelte Visus ohne pathologischen Befund ist, sowie dass sich durch Glaskorrektur keine Besserung erreichen lässt. 60 Dies äußerte sich genau so bei 15 dieser 32 Patienten, so dass entweder subjektiv eine sehr schlechte Sehschärfe angegeben wurde, die objektive Visusabschätzung aber einen Wert von 1,0 ergab, oder dass die Sehschärfeempfindung sich auch durch stärkste Korrektion und zum Teil selbst bei manipulativer Überkorrektion nicht veränderte. Bei 6 Patienten trat der Visusabfall ganz plötzlich auf und verschwand zum Teil auch wieder genauso. Ein solch plötzlicher Wechsel der Sehkraft spräche eher für Durchblutungsstörungen, eine Ablatio retinae, einen Glaukomanfall oder eine Neuritis nervi optici u.ä.. Dies wären jedoch Diagnosen, die untersuchungstechnisch greifbar und somit als Begründung für den Visusabfall gefunden werden könnten, was bei unseren Patienten nicht der Fall war. Weiterhin fiel bei überdurchschnittlich vielen Patienten auf, dass die Beschwerden mit einer psychischen Belastungssituation in Zusammenhang standen. So traten die Beschwerden überdurchschnittlich häufig im Zusammenhang mit solch einer Situation auf (z.B. Schulangst), oder bestanden anhaltend nach einer Belastungssituation (z.B. Missbrauch), die somit als Auslöser angesehen werden kann. Betrachtet man diese Verschiebung der Problematik von einer durch äußere Stressoren ausgelösten inneren Belastung auf eine körperliche Beschwerde, wird der Gedanke der Konversion wiederum deutlich. Kinder, die vernachlässigt werden, merken, dass ihnen im Krankheitsfall ein Mehr an Aufmerksamkeit und Zuwendung geschenkt wird. Kinder, die die Scheidung der Eltern miterleben, können zum einen unter Verlustängsten leiden, können zudem Angst davor, haben Partei ergreifen zu müssen, oder gehen aufgrund der Probleme der Eltern unter. Hier kann ein sich entwickelndes Krankheitsgeschehen zum einen als Hilferuf gesehen werden oder die Kinder selber unbewusst von den seelischen Konflikten ablenken, indem sie sich primär auf die vermeintliche Erkrankung konzentrieren. Hier soll auch die Patientin mit Blepharospasmus (E.P., w., 15 J.) genannt werden. Auffällig war die starke Korrelation der Beschwerden zum sich verschlechternden Elternverhältnis. Die Beschwerden zeigten nur dann eine deutliche Besserung, wenn die beiden getrennt lebenden Elternteile sich gemeinsam um ihre Tochter kümmerten. Hier liegt die Vermutung nahe, dass das Mädchen mit ihrer Krankheit versuchte, die Eltern zusammenzuhalten. Die Art der Beschwerden ist in vielen Fällen unspezifisch, wie ein einfacher Visusabfall. 61 Bei anderen Patienten ist die Beschwerdesymptomatik wiederum höchst bildhaft, wie unsere Patientin (A.Z., w., 11 J.) die bei Traurigkeit nur noch schwarz, weiß und grau sehen konnte (siehe Einzelfallvorstellung 5.2.2.). Bei 7 Kindern mit subjektiver Visusreduktion lebten die Eltern in Scheidung. Bei 15 weiteren bestanden Schulprobleme (6x bedingt durch die Mitschüler, 3x durch Lehrer, 3x durch Misserfolge und 3x lernbedingt), in 3 Fällen lag ein Missbrauchsfall vor und in jeweils 2 Fällen gab es in der Familie ein Geschwisterkind, das schwer erkrankt war. Auch diese Tatsache ist ein wichtiger Punkt, den es in der Anamnese zu beachten gilt, da durch unbewusste Nachahmung, als auch um Aufmerksamkeit wieder vermehrt auf sich zu lenken, eine psychogene Störung beim gesunden Geschwisterkind entstehen kann. Ähnlich sahen die Ergebnisse beim Gesichtsfeld aus, das mit 13 Fällen die zweithäufigste Beschwerdegruppe darstellt. Bei 6 Patienten fand sich ein problembelasteter familiärer Bereich (3x Elternscheidung, 2x Missbrauch,1x krankes Geschwisterkind), weitere 6 Patienten hatten ein Problem im schulischen Bereich (2x lernbedingt, 1x Lehrerprobleme, 1x Schulwechsel, 1x Misserfolge, 1x mitschülerbedingt). Es ist in der Literatur bereits beschrieben, dass Gesichtsfelddefekte Befunde sind, die sehr häufig einen signifikanten psychosomatischen Anteil haben können (BRETHFELD 2007), (HAASE 2003). Diese, bei 13 Kindern aufgetretene Problematik, kann im übertragenen Sinne ein Ausblenden des Wahrgenommenen auch auf psychischer Ebene bedeuten. Gesichtsfelddefekte können als ein „nicht sehen können“ einzelner Areale des Blickfeldes wie auch als ein „nicht sehen wollen“ einzelner Areale des Lebens gedeutet werden. Die an ebenfalls zweithäufigster Stelle aufgeführten Kopfschmerzen (13 Fälle) sind weniger als eigene psychosomatische Erkrankung zu sehen, sondern in unserem Fall vielmehr als Begleiterscheinung anderer Beschwerden. 20% aller Kinder haben bereits im Vorschulalter Kopfschmerzerfahrungen. Bis zum Ende der Grundschulzeit sind es sogar mehr als 50% (NEUHÄUSER 2007). Kopfschmerzen treten bei keinem unserer Patienten als Hauptbeschwerde auf, sondern werden von den Patienten selbst meist als Folge ihrer eigentlichen Erkrankung gesehen, z.B. 62 als Folge der Anstrengung des Sehens und Erkennens an der Tafel bei vorausgehendem Visusabfall. Da Kopfschmerzen ein sehr weit verbreitetes Beschwerdebild sind, die sich auch schon im Kindesalter oft als Maximalform im Sinne einer Migräne zeigen, kann ein genauer Zusammenhang mit den eigentlichen Beschwerdebildern schlecht hergestellt werden. Zwar ist der Zusammenhang von Augenerkrankungen und dem Auftreten von Kopfschmerzen bekannt, allerdings können sie genauso bei Hirntumoren, Neuralgien, nach Lumbalpunktion, medikamentenassoziiert, bei dentalen Erkrankungen (BURK 2005) oder bei ganz harmlosen Gegebenheiten wie dem Tragen eines Pferdeschwanzes oder Wetterumschwüngen auftreten. Für diese Arbeit interessant ist das Vorhandensein der in der Literatur speziell im Zusammenhang mit Kindern genannten Kopfschmerzform des Spannungskopfschmerzes, der als Begleiterscheinung psychogener Beschwerden auftreten kann und des psychogenen Kopfschmerzes (NEUHÄUSER 2007). In der Literatur ist außerdem ein Zusammenhang mit psychovegetativer Labilität und eine psychische Überlagerung der Beschwerden beschrieben, was bevorzugt bei pflichtbewussten und leistungsorientierten Personen der Fall sein soll (SCHMERZKLINIK BAD MERGENTHEIM 2008). Dies wird bei 2 unserer Patienten besonders deutlich: Ein Mädchen (A.W., w., 12 J.) klagte über einen plötzlichen und unerklärlichen Gesichtsfeldausfall zeitnah zur bevorstehenden Zeugnisvergabe. Das Mädchen besuchte zu diesem Zeitpunkt die 6. Klasse eines Gymnasiums. In Gesprächen wurde deutlich, dass es große Angst hatte sich in der Schule zu verschlechtern. Dieser Druck könnte Auslöser der psychosomatischen Reaktion sein. Die andere Patientin (R.S., w., 8 J.) litt unter enormen Versagensängsten nach dem Scheitern eines vorangegangenen Mathematiktestes. Die Beschwerdesymptomatik in Form eines Visusabfalls und einer starken Blendungsempfindlichkeit mit Schattensehen trat ein paar Tage vor der nächsten anstehenden Mathematikarbeit plötzlich auf. Doppelbilder, wie es bei 6 der 9 Patienten mit gestörtem Stereosehen der Fall war, treten insbesondere bei erworbenen Schielerkrankungen auf. Allerdings wurde bei keinem dieser 6 Kinder, die über Doppelbilder klagten, im Laufe der Untersuchung ein Hinweis auf eine Augenmuskelparese, einen erworbenen Strabismus oder einen sonstigen Grund für das Auftreten dieser Beschwerdeproblematik gefunden. 63 Bei einer Patientin (A.Z., w., 11 J.) wurde als Einzige ein frühkindliches Schielsyndrom diagnostiziert, jedoch litt sie nicht unter Doppelbildern. Eine psychogene Ursache von Doppelbildern, als eine Differentialdiagnose, wird beschrieben (BURK 2005). Bei den in 8 Fällen angegebene Schmerzen am/im Auge findet sich kein eindeutiger Zusammenhang mit der Grunderkrankung, außer im Falle der Patientin mit einem Blepharospasmus (E.P., w., 15 J.). Eine Blendungsempfindlichkeit (5 Patienten) kann, wie auch die anderen Beschwerden, vielfältige Ursachen haben. Diese reichen von jeglicher Entzündung am/im Auge, über intrakranielle Erkrankungen, bakterielle und virale Infektionen wie Tetanus, Pocken etc., aktinische Keratopathie durch übermäßige Sonnenbestrahlung, rheumatische Erkrankungen bis zu medikamentenbedingten Beschwerden. Nur bei einer der 5 Patienten lag als möglicher Grund eine rezidivierende Konjunktivitis vor, die zwar zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht ausgeprägt war, jedoch trotzdem in Zusammenhang gesehen werden kann. Bei den sonstigen beschriebenen Beschwerden handelt es sich um das Sehen abstrakter ZickZack Linien und Lichtflecken (S.H., w., 6 J.), (F.C., m., 8 J.). Solch ein Phänomen findet sich im Zusammenhang mit einer Katarakt, einer Makulopathie (BURK 2005) oder einer Migräne (MASUHR 2007). Diese und andere Gründe konnten bei den betroffenen Patienten jedoch ausgeschlossen werden. Die 4 Fälle mit Farbsehstörungen sind oben näher beschrieben (Punkt 5.1.9.). Von diesen 4 Kindern die über Probleme beim Farbensehen klagten, gaben nur 2 die Ishiharatafeln als pathologisch an. o Dauer der Beschwerden Die genaue Zeitdauer der Beschwerden ist schwer festzustellen. Darum kann bei diesem Punkt immer nur ein ungefährer Richtwert angegeben werden. Wichtiger als eine genaue Angabe von Tagen oder Wochen ist ohnehin die Kenntnis eines groben Zeitrahmens, um unterscheiden zu können ob es sich um eine Störung handelt, die über Jahre hinweg besteht, ein paar Wochen persistiert, oder nur an einem Tag aufgetreten ist. 64 Die Zeitdauer der Beschwerden vor der Erstvorstellung in der Kinderophthalmologie der Universitätsklinik als tertiäres Referenzzentrum beläuft sich zumeist auf mehrere Monate bis ein paar Tage. Eine Patientin (E.P., w., 15 J.) litt schon seit 2 Jahren unter einem Blepharospasmus und hatte eine Odyssee an Voruntersuchungen hinter sich (siehe Punkt 4.1.14.2.), bis sie vorgestellt wurde. Erst als auf diesem Wege die psychische Komponente der Beschwerden entdeckt wurde, besserten sich die Beschwerden unter einer eingeleiteten Psychotherapie im Laufe eines halben Jahres, bis sie schließlich ganz verschwanden. Bei 46,7% (21) aller vollständig auswertbaren Kinder bewegte sich die Dauer der Beschwerden in einem Zeitraum von weniger als einem halben Jahr. 6 Patienten (13,4 %) klagten über eine Dauer der Symptome von einem Jahr und mehr. Bei einem Patient hatten sich die Beschwerden gebessert, bei den übrigen 5 Patienten ist der aktuelle Stand der Beschwerden leider nicht bekannt. Bei diesen insgesamt 6 Patienten mit länger dauernden Beschwerden war auffällig, dass 2 von ihnen unter einem ADHS litten und bei einer weiteren Patientin die Verdachtsdiagnose eines ADS gestellt wurde. Sehstörungen sind eine bekannte Komorbidität, die bei einem ADHS neben etwaigen anderen psychischen und körperlichen Störungen auftreten können (NEUHAUS 2006). Allerdings ist zu beachten, dass Sehstörungen, wie auch Hörstörungen, Ursache der Symptome, wie Unkonzentriertheit, sein können, die schließlich zur Diagnose eines ADHS führen (KNÖLKER 2005). Eine sorgfältige Diagnostik ist daher umso wichtiger. Bei den 3 übrigen Patienten wurden als Beschwerdeauslöser zweimal Scheidungen der Eltern und einmal Schulprobleme eruiert. Die Beschwerden schienen durch diese Ereignisse ausgelöst worden zu sein und aufrecht gehalten zu werden. o Anlass der Beschwerden Bei den als Anlass der Beschwerden angenommenen Grundproblemen, die sich in Gesprächen herauskristallisierten und mit Kind und Familie angesprochen wurden, handelt es sich um Situationen, die sowohl unterbewusst, als auch offensichtlich zu einer psychischen Belastung des Kindes führten. Eine Relation zwischen Alter und Anlass war, außer bei den schulischen Problemen, die vorwiegend im Grundschulalter auftraten, nicht erkennbar. Allerdings ließ sich ein Anlass bei jüngeren Kindern schwieriger eruieren, als bei den älteren. 65 An erster Stelle stehen bei unserer Patientengruppe Probleme im familiären Bereich. Hierbei handelte es sich 9 mal um eine Scheidung der Eltern. Solch eine Trennung ist mit eine der am meisten angstauslösenden Erfahrungen, die Kinder erleben können (TÖBELMANN 2003). Für Kinder ist die Beziehung zu Mutter und Vater absolut unkündbar, und es ist für ein Kind sehr schwer, sich zwischen beiden Elternteilen zu entscheiden, um gegebenanfalls Partei zu ergreifen. Kinder können sich schlecht abgrenzen. Es wird in der Literatur berichtet, dass insbesondere kleine Kinder oft psychosomatisch reagieren, z.B. mit Schlafstörungen, Erbrechen, Bauchschmerzen und ähnlichem, während ältere Kinder und Pubertierende eher durch Risikoverhalten und auffälliges Beziehungsverhalten auf sich aufmerksam machen (LARGO 2004). Die möglicherweise positiven Aspekte einer Scheidung, wie Freundschaft der Eltern, die an die Stelle vorheriger ständiger Streitereien treten kann, sehen Kinder im Moment der Trennung meist nicht. Ein weiterer Grund für die Entwicklung einer psychosomatischen Störung ist der unbewusste Wunsch auf sich aufmerksam zu machen. Bei der familiären Umstrukturierung bleibt oft weniger Zeit für die Kinder, aus Gründen einer erforderlichen Mehrarbeit des nun alleinerziehenden Elternteils oder durch das Auftauchen eines neuen Partners. Die weiterhin aufgetretenen Probleme im direkten sozialen Umfeld und sonstige Anlässe werden in den folgenden Punkten genauer erläutert. Als zweithäufigsten Anlass sind bei 11 Kindern Schulprobleme zu sehen. Das Hauptalter der betroffenen Patienten fällt in die Zeit von 7-12 Jahren, also ein Beschulungsalter (RICHARTZ 2004), das geprägt ist von Einschulung, Umschulung und den entsprechenden Problemen, die diese mit sich bringen können. Hierdurch treten die Probleme in Zusammenhang mit der Schule und ihren Leistungsanforderungen in den Vordergrund. Durch Kränkungen, die von emotionalem oder intellektuellem Versagen ausgehen, können massive Ängste und Selbstwertprobleme mobilisiert werden, was bis hin zur Schulangst und Schulphobie führen kann (RICHARTZ 2004). Nicht alle Kinder verarbeiten solch eine einschneidende Veränderung ihres Umfelds, die deutlich gewachsenen, an sie gestellten Leistungsansprüche und die erforderliche Abnabelung von den Eltern und der gewohnten Umgebung gleich gut. 66 Psychosomatische Beschwerden als Folge solch einer Belastung sind in der Literatur als häufige Folge von Schulangst und Überforderung beschrieben (PIEHLER 2002). Diskutierbar ist zudem, dass gerade bei Schulproblemen das visuelle System angreifbar ist. Die Sehkraft ist gerade in der Schule unersetzlich und beim an die Tafel schauen fallen oftmals Sehschwächen auf, die vorher im normalen Alltag unbemerkt blieben. Genauso kann das visuelle System als Angelpunkt bei Schulproblemen unbewusst „genutzt“ werden. Zu den 6 Kinder, deren Beschwerdeanlass unter die Kategorie „Sonstiges" fällt, gehören die Kinder mit Rheuma, ADHS, bzw., Verdacht auf ADS, etc.. Diese Fälle werden im Punkt 5.1.14.1. Vor- und Begleiterkrankungen diskutiert. o Auslöser der Beschwerden Die bei unserer Patientengruppe als auslösende Situation anzusehenden Ereignisse sind oftmals recht banale Alltagssituationen, die bei nicht vorbelasteten Menschen höchstwahrscheinlich nicht zu einer Somatisierung führen würden. Dieses Muster beschreiben auch V.BRETHFELD, R.KUNZE 2007 (Psychosomatik in der Augenheilkunde, Teil 1: Krankheitsentstehung). Bei 24 Kindern (53,3%) bleibt der Auslöser unbekannt bzw. es besteht kein definitiver Auslöser. Bei 10 findet sich an führender Stelle eine Problematik im schulischen Bereich, dazu zählen unter anderem Probleme mit der Lehrperson, eine Einschulung bzw. ein Schulwechsel, Mobbing, die bevorstehende Zeugnisvergabe sowie Prüfungsangst. In allen Fällen zeigte sich eine ausgeprägte Schulangst. In diesem Falle sind Kinder angewiesen auf die Verarbeitung der Angst mit einer Vertrauensperson, an die sie sich wenden können, im Idealfall die Eltern. Ist dies nicht der Fall, ist eine Somatisierung der Angst umso wahrscheinlicher (TRÄBERT 2003). In 4 Fällen galten Grund- oder Vorerkrankungen als Auslöser. Hier fanden sich ganz unterschiedliche Krankheitsbilder, deren Begleiterscheinungen in ganz unterschiedlicher Art und Weise in Erscheinung treten können. Allen gemeinsam war allerdings die Tatsache, dass 67 die Stärke der Beschwerden nicht durch die jeweilige Vorerkrankung und ihr morphologisches Korrelat zu erklären war. Als Beispiel sei hier genannt eine leichte Kornealäsion (K.T., w., 12 J.), die von einer Verletzung durch ein Schulheft stammte. Die Behandlung erfolgte mittels antibiotischer Augentropfen. Die Beschwerden, die sich in Form von Verschwommensehen, schwarzen Dreiecken im Auge, Kopfschmerzen und Schwindel äußerten, waren bei guter Abheilung nicht nachvollziehbar. Auffallend war in diesem Fall eine große psychische Belastung durch nicht erwiderte Kontaktversuche zum in Scheidung lebenden Vater. Diese psychische Belastung durch die ständige Zurückweisung der 12 Jährigen war so groß, dass schließlich eine Psychotherapie begonnen wurde, in deren Verlauf die Beschwerden verschwanden. Man kann annehmen, dass die psychische Last die auf dem Kind lag, sich schließlich durch diese vermeintliche Überdramatisierung der Verletzung entlud. Durch die volle Konzentration auf die Beschwerden kann einerseits angenommen werden dass das Kind sich selbst unbewusst von den eigentlichen Problemen ablenkte, als auch dass das Kind auf sich aufmerksam zu machen versuchte. Ähnlich verlief es bei einem anderen Kind (L.S., m., 8 J.) bei dem durch einen Schlag mit dem Ellbogen ins Gesicht massive Sehverschlechterung und Doppelbilder auftraten. Alle Testergebnisse waren einwandfrei und ließen auf eine optimale Sehleistung schließen. Auch in diesem Fall litt der 8 Jährige sehr unter der Trennung seiner Eltern und auch hier führte eine kinderpsychologische Gesprächstherapie über wenige Monate zum Verschwinden der vorher anhaltenden Beschwerden. Eine weitere 7 jährige Patientin mit rheumatoider Arthritis (L.S., w., 7 J.) gab selbst an, dass ihr Sehschärfeverlust auf ihre Rheumaerkrankung zurückzuführen sei. Der Zusammenhang zwischen rheumatischer Erkrankung und intraokulärer Entzündung ist seit langem bekannt. Sie kann sehr wohl zu Affektionen im okulären Bereich führen, allerdings meist in Form einer Uveitis (LANGER 2006), wie sie in diesem Fall nicht nachzuweisen war. Gerade hier ist gut zu sehen, wie stark Kinder durch chronische vorbestehende Krankheiten belastet sein können und dass bei diesen Kindern, die oftmals erstaunlich gut über ihre Grunderkrankung und deren Auswirkungen Bescheid wissen, der psychogen- somatoforme Aspekt dann auch in diesem Bereich zur Ausprägung kommt. Bei 2 Kindern hingen die Beschwerden direkt mit dem sich verschlechternden Elternverhältnis zusammen. Eine Patientin (E.P., w., 15 J.) litt ab dem Zeitpunkt, zu dem sich 68 das Verhältnis der bereits getrennt lebenden Eltern erneut verschlechterte, an einem therapierefraktären einseitigen Blepharospasmus. Die Beschwerden waren nur dann deutlich gebessert, wenn beide Elternteile sich gemeinsam um das 15 jährige Mädchen kümmerten. Schließlich half eine psychologische Behandlung, sodass die Beschwerden gänzlich verschwanden. Weiterhin litt eine 13 Jährige (M.M., w., 13 J.) unter einer starken Myopie. Die Beschwerden waren aber auch hier deutlich stärker als aus den Messwerten zu schießen wäre. Ein Zusammenhang bestand auch hier mit den Streitigkeiten der Eltern und deren Streit ums Sorgerecht, da je schlechter das Verhältnis der Eltern, desto schlechter war auch die subjektiv erlebte und angegebene Sehstärke. Bei weiteren 2 Patienten begründeten sich die Beschwerden auf Probleme im Freundeskreis. Zum einen gab es einen Verlust des Freundeskreises durch einen Schulwechsel (S.S., w., 13 J.), zeitgleich trat eine starke Sehschärfenminderung auf. Zum anderen litt eine 16 Jährige (S.-P.S., w., 16 J.) nach der Trennung von ihrem Freund unter starkem Visusabfall, Farbsehstörungen und Schmerzen am Auge, ohne greifbare Pathologie. Nach einer erfolgten Psychotherapie waren die Beschwerden verschwunden. Bei einem Kind (G.M.B., w., 9 J.) führte eine Erkrankung der Großmutter zu starken Ängsten, Weinphasen auch in der Schule und objektiv plötzlich abgefallenem Visus. Es bestand eine starke Diskrepanz zwischen der Sehschärfenangabe und dem guten Binokularsehen. Es wurde neben einer augenärztlichen Behandlung auch eine Psychotherapie eingeleitet. Eine Wiedervorstellung zwei Monate nach der Therapieeinleitung erfolgte leider nicht. Ein häufiger Grund hierfür ist, dass bei gebesserter Beschwerdesymptomatik eine Wiedervorstellung dem Patienten selbst oder den Eltern nicht mehr notwendig erscheint. Die genauen Umstände waren in diesem Fall leider nicht zu eruieren. Bei einer Patientin (S.T., w., 15 J.) gingen die Beschwerden einher mit der beruflichen und familiären Überforderung der allein erziehenden Mutter. Es zeigte sich eine gewisse Vernachlässigung der 15 Jährigen, die seit ihrem 12.Lebensjahr raucht, sowie der jüngeren Geschwister, von denen eines wegen ausgeprägter Autoaggression in psychologischer Behandlung war. 69 Die Patientin gab unspezifische Beschwerden an von Gesichtsfeldeinschränkungen, über gestörtes Stereosehen bis hin zu Kopfschmerzen. Die Empfehlung einer psychologischen Behandlung wurde von den in Scheidung befindlichen Eltern nicht angenommen, jedoch führte die Behandlung mit Vitamin A Augentropfen bei der Patientin zu einer deutlichen Besserung, so dass eine Weiterbehandlung von ihr nicht für notwendig gehalten wurde. Angesichts der problematischen Familiensituation ist zu befürchten, dass die PlaceboTherapie nur kurzfristig helfen wird. Ein weiterer Fall (S.T., w., 12 J.) beschreibt eine 12 jährige Patientin, die nach einem Leben in mangelnden hygienischen Zuständen, Verwahrlosung und Vergewaltigung durch den Lebensgefährten der Mutter im Kinderheim lebte und neben anderen psychosomatischen Problemen wie Einnässen unter einer Gesichtsfeldeinschränkung litt, für die es weder ein morphologisches noch elektrophysiologisches Korrelat gab. 5.1.14 Anamnestische Evaluation 5.1.14.1 Vor- und Begleiterkrankungen Die bekannten Begleiterkrankungen der Patienten umfassen ein sehr weit reichendes Spektrum. An vorderster Stelle, mit 6 Patienten, stehen Allergien. Da sich allergische Reaktionen häufig in Form einer allergischen Rhinokonjunktivitis äußern (MOLL 2005), ist eine Augenbeteiligung in Folge dessen nicht unwahrscheinlich. Die Stärke und Art der angegebenen Beschwerden unserer Patienten weichen allerdings von denen einer Konjunktivitis ab. Zudem wurde eine Konjunktivitis bei keinem der Patienten diagnostiziert. Weitere 4 Patienten litten unter einer Migräne. Hierbei findet sich häufig eine visuelle Aura mit Photopsien, die ein Skotom nach sich ziehen können. Gelegentlich wird beschrieben, dass eine Hemianopsie bis zu dreißig Minuten nach Verschwinden des Flimmerns zurückbleiben kann (MASUHR 2007). Solche Beschwerden traten bei zwei der Patienten auf, jedoch war bei beiden weder eine Migräne bekannt, noch litten sie unter sonstigen Beschwerden, wie Kopfschmerzen, die in irgendeiner Art und Weise an eine Migräne denken ließen. 70 In 3 Fällen wurde eine Epilepsie bzw. ein Zustand nach Fieberkrampf diagnostiziert. Eine zunehmende Sehverschlechterung in Zusammenhang mit einem epileptischen Syndrom wird in der Literatur im Rahmen einer Juvenilen Neuronalen Ceroid-Lipofuscinose (JNCL) beschrieben (KOHLSCHÜTTER 1988). Hierbei handelt es sich um eine äußerst seltene erblich bedingte progredient neurodegenerative Stoffwechselerkrankung, die sich meist im 5.-6. Lebensjahr manifestiert. Es kommt dabei aufgrund eines bis heute noch nicht genau erkannten Mechanismus zu einer Ansammlung von lipofuscin-ähnlichem Lipopigment im neuronalen Gewebe und in Folge dessen zu einem Zelluntergang. Die Diagnose dieser Erkrankung wird gestellt durch die elektronenmikroskopische Untersuchung von Körperzellen (KOHLSCHÜTTER 1988). Die Kinder unserer Gruppe zeigten jedoch keine sonstigen progredienten neurologischen Veränderungen. Ossäre Erkrankungen in der Art wie sie bei 3 Kindern vorkamen können nicht mit den jeweils angegebenen Sehbeschwerden in Verbindung gebracht werden. Die in weiteren 2 Fällen beschriebenen rheumatischen Erkrankungen können sich dagegen sehr wohl in Form einer Uveitis (wie oben beschrieben) äußern. Die Symptome würden sich dann z.B. in Form eines Blepharospasmus, einer Photophobie oder dem Sehen von Schwebeteilchen äußern. Beide Kinder klagten jedoch über einen unspezifischen Sehschärfeverlust, ohne weitere Beschwerden. Die übrigen Begleiterkrankungen können, außer einem Pseudotumor cerebri, der mit Kopfschmerzen und Sehstörungen einhergeht (MASUHR 2007), nicht mit den angegebenen Beschwerden in Einklang gebracht und somit nicht als deren Auslöser angesehen werden. Man kann zur Problematik der bestehenden Begleiterkrankungen sagen, dass sich zum einen deren Symptome durch eine affektive Störung verstärken können und zum anderen sich durch psychische Probleme neue Symptome auf „gleichem Feld“ entwickeln können. Auch die Abheilung banaler Krankheiten scheint sich durch psychische Mitbeteiligung zu verzögern oder gänzlich auszubleiben. 71 5.1.14.2 Voruntersuchungen Das Aufzeigen der Voruntersuchungen, die aufgrund der Hauptbeschwerde, die zur Behandlung in der Sehschule führte, durchgeführt wurden, soll verdeutlichen, welche Vielzahl an Untersuchungen die Kinder teilweise über sich ergehen lassen mussten, bis eine organische Ursache endgültig ausgeschlossen werden konnte. Die zum Teil bis zu 8 durchgeführten Voruntersuchungen in einer Augenarztpraxis und die darauf folgende Überweisung an die Augenklinik des Universitätsklinikums Homburg beruhen höchstwahrscheinlich auf dem Mangel an körperlichen Befunden und dem Angebot an Spezialuntersuchungen in der Augenklinik Homburg, wie z.B. dem Erstellen von VEPs und ERGs. Weiterhin muss bei diesen Kindern, die schon im Vorfeld bei einem Augenarzt in Behandlung waren, beachtet werden, dass sich gerade durch diese Augenarzt-Vorerfahrung eine psychogene Störung im visuellen Bereich verstärken kann. Die in einem Fall durchgeführte Computertomografie birgt eine hohe Strahlenbelastung und sollte bei Kindern nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden. Verglichen mit einer konventionellen Schädel-Röntgenaufnahme ist die Strahlenbelastung bei einer CTUntersuchung des Kopfes etwa um den Faktor 50 höher (BFS 2005). Die in 3 Fällen durchgeführte MRT-Untersuchung kommt zwar ohne Strahlung aus, jedoch kann es hier zu langen Liegezeiten in der Untersuchungsröhre kommen (WETZKE 2007). Nicht zu vernachlässigen bleibt auch der Kostenaspekt dieser Untersuchungen. So beläuft sich ein CT des Schädels auf 50- 250 Euro, ein MRT- Schädel auf 100- 260 Euro (FRÜHWALD INSTITUT 2008) (FREUND 2006) (GOÄ 2002). Um diese Untersuchungen und somit auch deren Kosten zu vermeiden, bedarf es einer sorgfältigen klinischen Untersuchung und psychologischen Exploration. Solche „Hightech-Untersuchungen“ sind insofern mit Vorsicht zu betrachten, da sie eine Verfestigung der Somatisierung fördern können. Durch solch groß angelegte Untersuchungen erscheinen die Beschwerden den Patienten selbst dringlicher und dramatischer, als es eine einfache körperliche Untersuchung mit minimalem Geräteaufwand bewirken würde. 72 Allgemeine pädiatrische Untersuchungen mit nachfolgender Überweisung weisen den Kinderarzt als erste Anlaufstelle bei Beschwerden des Kindes aus. Bei 3 Patienten wurde bereits im Vorfeld ein Psychologe hinzugerufen. Bei einem Jungen, der in einer Pflegefamilie lebte (K.G., m., 12 J.), bei einem Mädchen (T.R., w., 9 J.) mit Schulproblemen und bei dem Mädchen, dessen Farbsinn verloren ging (A.Z., w., 11 J.) (Einzelfallvorstellung 5.2.2.) Auffällig ist, dass bei nur einem der vier Missbrauchsfälle eine kinderpsychologische Betreuung stattfand, die den Missbrauch erst ans Licht brachte. Erst durch die Symptomentwicklung der Kinder wurde über den Umweg der Augenklinik ein Psychologe aufgesucht. 5.1.14.3 Schulische Auffälligkeiten Etwa die Hälfte der Kinder (21 Patienten) berichteten über Probleme im schulischen Bereich, bzw. am Ausbildungsplatz. Schulabwehr zum Erlangen von Aufmerksamkeit kann dadurch begründet sein, dass die Schule von den meisten Eltern als wichtig angesehen wird und Leistungen und Misserfolge meist genauer verfolgt werden und auch besser messbar sind als andere Lebensbereiche des Kindes. Aus einer Umfrage an 1000 Mütter und Väter mit Kindern unter 18 Jahren ging hervor, dass etwa jedes 5. Kind heutzutage unter Schulstress leidet. Dies äußert sich in Form von Nervosität, Unkonzentriertheit, sowie psychosomatischen Beschwerden, unter anderem Bauchschmerzen (FORSA-INSTITUT 2008). Mit 6 Positivantworten am häufigsten vertreten waren Misserfolge im Schulunterricht. Hierzu zählen 3 Kinder, deren Noten sich verschlechtert hatten, im Zusammenhang damit litt 1 Kind unter der Erkrankung der Oma, bei einem anderen Kind gab es Differenzen mit den Lehrern und ein weiteres Kind wurde Opfer von Mobbing durch die Klassenkameraden und litt unter großer Schulangst. Wiederum 1 Kind (6. Klasse Gymnasium) hatte panische Angst vor einem drastischen Absinken der Schulnoten, nachdem sich seine Leistungen minimal verschlechtert hatten. 73 Bei 1 Jugendlichen war die Versetzung gefährdet und beim nächsten Kind führte das Versagen in einer Klassenarbeit zu einer pathologisch hohen Stressreaktion, so dass die Angst und Nervosität vor der nächsten Arbeit überhand nahmen und zu einer echten psychischen Belastung wurden. Eine einmal erlebte Fehlleistung kann zu massiven Versagensängsten in der Folge führen. 5 Kinder berichteten von Problemen seitens der Mitschüler, die sich zumeist in Form von Mobbing äußerten. Das Ausloten von Grenzen und das unterschwellige Bilden einer Rangfolge innerhalb einer Klasse kann häufig dazu führen, dass insbesondere schwächere Kinder die Leidtragenden sind. Aus solch konkurrierendem und missgünstigem Verhalten unter den Schülern, kann sich ein schulphobisches Verhalten entwickeln (SPECHT 2004). Bei weiteren 5 Kindern gab es Probleme mit den Lehrern. Gegenseitige Antipathie kann schon in frühen Jahren auftreten und kann das Lehrer-Schüler-Verhältnis negativ beeinflussen. Durch die klare Rollenverteilung sieht sich das Kind in der Rolle des Ausgelieferten und kommt gegen die Machtposition der Lehrperson nicht an. Auch überforderndes und abwertendes Lehrereverhalten gelten als einer der Gründe für die Entwicklung der Schulangst (SPECHT 2004). Eine Einschulung oder ein Schulwechsel, als ein für das Kind einschneidendes Lebensereignis (SCHLIEMANN 2007), birgt sowohl die potenziellen Probleme seitens der Mitschüler, die Situation einer Entwurzelung z.B. aus dem vertrauten Kindergarten, sowie die stärkere Abtrennung von den Eltern (PETERSEN 2006). Diese Problematik spielte bei ebenfalls 5 Kindern eine Rolle. Lernbedingte Probleme z.B. in Form einer Teilleistungsschwäche führen oft zu Misserfolgen. Dies war hier bei 2 Kindern der Fall. 5.1.14.4 Familiäre Besonderheiten Zu den familiären Besonderheiten zählen, wie bereits ausgeführt, vor allem die 9 Scheidungsfälle, wie sie bereits beschrieben wurden (5.1.13. Beschwerden, Anlass der Beschwerden). 74 Besonderer Schilderung bedürfen die 4 Missbrauchsfälle. Es handelt sich hierbei um einen Jungen und 3 Mädchen. In allen Fällen handelte es sich um Gewalt innerhalb der Familie, so durch die eigene Mutter, den Großvater oder den neuen Lebensgefährten der Mutter. Solch ein intrafamiliärer Fall von Missbrauch ruft komplexere Reaktionen der Opfer hervor als z.B. eine einmalige Tat durch einen Fremden, da eine vertrauensvoll eingegangene Beziehung bzw. eine seit Geburt bestehende Bindung durch Gewalt zerstört wird (ALDER 2005). Umfragen zufolge erleiden mehr als 2% der Bevölkerung bis zum jungen Erwachsenenalter eine Vergewaltigung, wobei Frauen 3-4 mal so häufig betroffen sind wie Männer (SPECHT 2004). Außerdem wird von 12% der Frauen zusätzlich von anderen Missbrauchsformen mit Körperkontakt berichtet. Als Folge hiervon werden nicht selten anhaltende, scheinbar unerklärliche psychosomatische Symptome beschrieben, sowie Depressionen, Ängste und Beziehungsstörungen (SPECHT 2004). Bei 2 Kindern (Ca.M., w., 8 J.) (Ch.M., w., 12 J.) wird von einem schwer erkrankten Geschwisterkind berichtet. Hierbei besteht immer das Problem, dass der gesunde Geschwisterteil weniger Aufmerksamkeit bekommt, auch wenn die Eltern sich bemühen dies zu vermeiden. Was älteren Kindern bereits durchaus verständlich erscheint und ein rücksichtsvolles Verhalten hervorruft, ist für Jüngere unverständlich und führt zu Eifersucht und dem Gefühl des Nichtbeachtetwerdens. Dies kann einerseits zur Ablehnung des kranken Geschwisters führen, andererseits zur Imitation oder Entwicklung einer eigenen Beschwerdesymptomatik, um die Aufmerksamkeit auf sich zu fokussieren. Vermehrt kommt es auch zu psychischen Problemen (PETERMANN 1986). Bei unseren beiden Patientinnen litt das kranke Kind des ersten Geschwisterpaares an einem okulokutanen Albinismus. Die Schwester entwickelte eine unklare Visusreduktion. Beim zweiten Geschwisterpaar litt die kleinere Schwester unter einem Ponsgliom. Die Familiensituation war dadurch sehr stark belastet und unsere Patientin klagte über Gesichtsfeldeinschränkungen, einen Sehschärfenverlust sowie Kopfschmerzen. Dies waren auch die ersten Symptome der Tumorerkrankung. Die Stärke der Symptomatik korrelierte auffällig deutlich zum Zustand der Schwester. Weitere 2 Patienten (I.T., w., 8 J.) (A.Z., w., 11 J.) litten unter einer Overprotection der Eltern. Solch ein Verhalten wirkt eher begünstigend auf ein vermehrtes Auftreten von 75 Erkrankungen. Auffallend war bei beiden Kindern, dass die Beschwerden teilweise nur von den Eltern beschrieben und von den Kindern erst im Nachhinein bestätigt wurden. Gerade bei Kindern besteht die Gefahr der Suggestibilität. Durch einen interrogativen Fragestil und durch Vermutungen der Eltern werden Kinder leicht beeinflusst und „bemerken“ dann erst das vermeintliche Problem. Zu beobachten war bei beiden eine auffällige Eltern/ Kind- Interaktion im Gespräch. So antworteten vorzugsweise die Mütter wenn Fragen an das Kind gestellt wurden. Die Mutter des 8 jährigen Mädchens schien alle bisher gestellten Diagnosen anzuzweifeln. Während des Gesprächs war die Mutter wortführend, während sich das Mädchen hinter ihr versteckt hielt. Bei dem 11 jährigen Mädchen verhielt sich die Mutter extrem kontrollierend. Sie schrieb ausführliche Berichte über die Probleme und Krankheiten ihrer Tochter und betonte auch im Beisein des Kindes, welch große Angst dieses vor dem Besuch beim Augenarzt hätte (siehe Einzelfallvorstellung 5.2.2.) Beim letzten Kind (M.H., w., 13 J.), bei dem die Pathogenese unter „sonstige Probleme“ fällt, handelt es sich um ein zweieiiges Zwillingspärchen, bei dem das 13 jähriges Mädchen vom Bruder stark eingeengt wurde. Die Beschwerden besserten sich, als beide Kinder auf getrennte Schulen geschickt wurden. Zweieiige Zwillinge verhalten sich genetisch wie zwei Geschwister, die in unterschiedlichen Jahren zu Welt kommen (STELDINGER 2005). Der Konkurrenzkampf wie er unter Geschwistern in gewissem Maße normal ist, ist in diesem Fall aber deutlich größer, weil beide Kinder zur gleichen Zeit in etwa auf dem selben Entwicklungsstand stehen und das gleiche erleben. 5.1.15 Therapie Als Grundsatz der Therapie gilt, vor allem bei Verdacht auf eine psychogene Störung, ein intensives anamnestisches Gespräch mit Versuch der Exploration, aber noch nicht der konfrontativen Aufdeckung. Hierbei wird die Möglichkeit der psychogenen Ursache angesprochen und der Familie und dem Kind Zeit gegeben dies zu realisieren. Betont werden muss die wichtige Information, insbesondere für die Eltern, dass das Kind die Situation genau so erlebt, wie es sie schildert, dass im seltensten Falle bewusste Simulation und Aggravation eine Rolle spielen. Das Kind „lügt“ nicht und ihm dürfen die Sehstörungen nicht vorgeworfen 76 werden oder es nicht ernst genommen werden. Dieses Verständnis der Eltern für die Zusammenhänge und das kindliche Erleben bei psychosomatischen Sehstörungen in Konfliktsituationen ist essentiell für den weiteren Verlauf. Wichtig ist das Gleichgewicht zwischen der Akzeptanz der visuellen Probleme des Kindes ( Vit A Augentropfen) und gleichzeitiger Aufdeckung möglicher Zusammenhänge mit Konflikten sowohl der Eltern als auch des Kindes. Die eingeleiteten Therapien waren bei 20 Kindern unterstützend augenärztlich. Dazu zählten allerdings keinerlei invasive Eingriffe oder das Verordnen starker Medikamente, sondern primär das Anpassen oder Nachkorrigieren einer Brille bei 18 Kindern. Bei 3 der 18 Kindern brachte diese eingeleitete Maßnahme als Monotherapie eine merkliche Besserung. Außerdem wurden bei insgesamt 16 Kindern Vitamin A-Augentropfen verordnet, deren primäre Wirkung der Ausgleich eines eventuell bestehenden Muscinmangels ist. Hier jedoch kamen die Vitamin A- Augentropfen als positive Verstärkung/ Placebo zum Einsatz, zeitgleich nachdem dem Kind bzw. der Familie der Zusammenhang zwischen Psyche und Auge verdeutlicht und Vitamin A als „Augenvitamin“ nahegebracht wurde. Diese Maßnahme wurde bei unseren Patienten gewählt, um den jungen Patienten einen „Ausweg“ zu bereiten (KÄSMANN 2007), der von 8 der so behandelten Patienten unbewusst in Anspruch genommen wurde. Bei 2 Kindern verschwanden die Beschwerden völlig, hierbei handelte es sich einmal um eine Monotherapie, das andere Kind bekam zusätzlich eine Sehhilfe. Bei 6 Kindern zeigte sich eine merkliche Besserung, die nach Aussage der Kinder den Augentropfen zugeschrieben wurde (hiervon 2 Patienten mit Placebo als Monotherapie, 3 weitere waren zusätzlich in psychologischer Betreuung, 1 Kind mit zusätzlicher Brille). Das fehlende Wiedervorstellen der übrigen 8 Patienten mit Placebo kann am ehesten als Besserung gedeutet werden, da viele Eltern eine Wiedervorstellung in diesem Falle nicht mehr für notwendig halten. Die Reaktionen auf den Fragebogen bestätigten dies. Ein Arztoder Klinikwechsel dagegen konnte nicht festgestellt werden. Bei 21 Kindern erfolgte letztendlich, wenn die Symptome persistierten, eine Psychotherapie, die ausnahmslos gute Erfolge zeigte. Hierbei wurden die Beschwerdeanlässe und –auslöser verarbeitet und die ophthalmologischen Beschwerden, die mehr oder weniger offensichtlich mit diesen in Zusammenhang standen, verschwanden meist vollständig oder besserten sich bis 77 zum Bestehen eines Minimums. Die Psychotherapie erwies sich, sowohl als Mono- als auch als Zusatztherapie zu anderen Maßnahmen, als Therapiekonzept mit dem höchsten Wirkungsgrad. Die Patientin, die Hilfe bei einem Heilpraktiker suchte, berichtete ebenfalls im Verlauf über eine deutliche Besserung ihrer Beschwerden. Die hier nicht näher bekannten angewandten Methoden werden aus medizinischer Sicht eher als fraglich angesehen. Außerdem erfolgte diese Behandlung zusammen mit anderen Therapieformen, wie etwa Psychotherapie. Nicht zu vernachlässigen bleibt auch bei der homöopathischen und anderen alternativen Therapien jedoch das erhöhte Maß an Zuwendung, das dem Patienten zuteil wird. Dieses erhöhte Maß an Zuwendung, verbunden mit oder ohne klinisch-evidenzbasierter Therapie, kann eine deutliche Besserung der Symptome bewirken. Auffallend bei allen Therapieformen war, dass vergleichbare minimale Maßnahmen zu einer deutlichen Besserung auch starker Beschwerden führten. Allein schon der ärztliche Kontakt, das Ernstnehmen ihrer Beschwerden sowie das Angebot einer Therapie schien den meisten Kindern zu helfen. In der Therapie psychosomatischer Störungen benötigt der Patient eine positive Erklärung seiner Beschwerden und das Gefühl, dass der Arzt diese Form der Erkrankung kennt (LAMPRECHT 2004). Das Ernstnehem der Beschwerden und die Zuwendung zum Patienten sind die beiden wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Therapie. 5.1.16 Verlauf und letzter Befund Der Behandlungserfolg blieb in 20 Fällen (44,4% der Kinder) unbekannt, beispielsweise beruhend auf mangelnder Rückmeldung bezüglich der Fragebögen. Da davon ausgegangen werden kann, dass viele Wiedervorstellungen auf Grund des Verschwindens der Symptomatik nicht mehr eingehalten werden, kann man sicher von mehr positiven Effekten als dokumentiert sind ausgehen. Tendenziell kann aber von einem bisher überwiegend positiven Verlauf gesprochen werden. Die völlige Beschwerdefreiheit von 9 Patienten wird von den Eltern und Patienten selbst primär als Heilung „von alleine“ angegeben, obgleich bei 6 Patienten eine kinderpsychologische Therapie erfolgte. 78 3 Kinder wurden ausschließlich psychologisch behandelt, während die anderen 3 zusätzlich augenärztlich behandelt wurden (2x Sehhilfe, 1x Augentropfen). 2 Patienten wurden mittels Placebo- Augentropfen behandelt, was die Beschwerden vollständig verschwinden ließ. Eine dieser Patienten hatte zwar zusätzlich eine Brille, der positive Effekt der Augentropfen schien laut ihrer Aussage aber im Vordergrund zu stehen. Eine Patientin mit Kopfschmerzen und Doppelbildern wurde mit Hilfe einer Brille beschwerdefrei. Bei 7 dieser Patienten sahen auch die Eltern den Zusammenhang zwischen Krankheit und Psyche und konnten durch ihre Unterstützung die Arbeit mit dem Kind positiv verstärken. Bei den 15 Patienten, deren Beschwerden sich gebessert haben, schreiben 6 Patienten diese Besserung der Placebotherapie mit Vitamin A- Augentropfen zu. Dies zeigt wiederum was für eine große Wirkung solch eine Placebo- Medikation bei psychogenen Störungen haben kann. 2 dieser Patienten erhielten die Placebo- Augentropfen in Monotherapie, weitere 4 wurden zusätzlich behandelt (siehe 5.1.15. Therapie). 6 Patienten, deren Beschwerden sich gebessert hatten, erhielten eine augenärztliche Behandlung. Hiervon wurde eine Patientin zusätzlich psychologisch betreut, die andere bekam zusätzlich Placebo. Bei 2 Patienten besserten sich die Beschwerden ausschließlich durch die psychologische Betreuung. Bei einer weiteren Patientin konnte ohne Therapie eine Besserung der Beschwerden (rezidivierendes Zick-Zack sehen, Lichtflecken) erzielt werden. Diese war allerdings nur einseitig am rechten Auge. Allerdings war bei ihr deutlich zu merken, dass die Fixation des Kindes auf die Augen nachgelassen hatte. Bei diesen 15 Kindern wurde die psychische Mitbeteiligung bei 8 Eltern erkannt und die Therapie in diese Richtung gefördert. Nur eine (L.D., w., 9 J.) der 45 Patienten klagt bis zum letzten Stand immernoch über unverändert starke Beschwerden, eine beidäugige unklare konzentrische Gesichtsfeldeinengung. Es handelt sich um ein Mädchen das unter einem ADHS leidet. Eine psychische Mitbeteiligung wird von den Eltern nicht gesehen bzw. abgelehnt. Im Gespräch wurde kein fassbarer Auslöser greifbar. 79 80