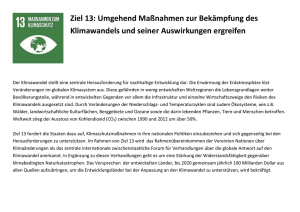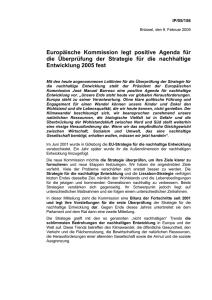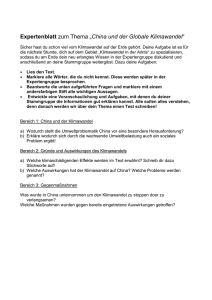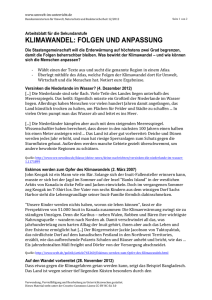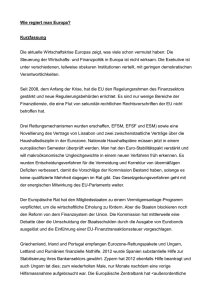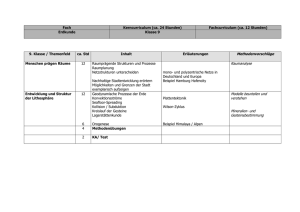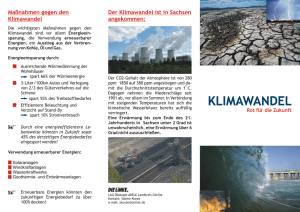Hin zu einem Europäischen Binnenmarkt für Strom und
Werbung

SPEECH/07/335 Andris Piebalgs Kommissar für Energie Hin zu einem Binnenmarkt für Strom und Gas Rede, VDEW-KONGRESS 2007 Berlin, 24. Mai 2007 Europäischen Meine sehr verehrten Damen und Herren, in meinem heutigen Beitrag möchte ich zunächst auf die Ursachen der energiepolitischen Herausforderungen eingehen, die sich für Europa und letztlich für die ganze Weltgemeinschaft in den nächsten Jahrzehnten stellen. Sie stehen im Mittelpunkt der Bemühungen um eine neue Energiepolitik für Europa. Diese Herausforderungen lassen sich meines Erachtens am besten unter dem subsumieren, was der niederländische Chemie-Nobelpreisträger Paul J. Crutzen als „Anthropozän“ bezeichnet hat. Gemeint ist damit die Tatsache, dass die Aktivitäten des Menschen erstmals in der Erdgeschichte die natürlichen Prozesse unseres Planeten tiefgreifend und nachteilig beeinflussen. Vor allem aufgrund des offensichtlich unstillbaren Durstes der Menschheit nach immer mehr fossiler Energie sind wir im Begriff, unser Klima unwiderruflich zu verändern. Die CO2-Emissionen im Energiesektor machen rund 80 % aller Treibhausgase aus. Mit der kontinuierlichen Steigerung unserer Nachfrage nach den knapper werdenden und immer wertvolleren Öl- und Gasressourcen gefährden wir zugleich die Stabilität unseres Wirtschaftssystems in gefährlichem Maße. Hinzu kommt, dass sich diese Ressourcen in den Händen immer weniger Akteure konzentrieren. Bei den zwei wichtigsten energiepolitischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, handelt es sich also um den Klimawandel und die Versorgungssicherheit. Doch unsere energiepolitischen Ziele beschränken sich nicht nur darauf. Letztlich lautet die Frage: Wie können wir diese Ziele in einer Weise erreichen, die die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärkt? Wie kann es uns gelingen, diese Herausforderungen in Chancen für Europa umzumünzen? Lassen Sie mich zunächst auf den Klimawandel eingehen. Zusammen mit der Bekämpfung der Armut und der Sicherung des Weltfriedens ist der Klimawandel vermutlich die größte globale Herausforderung unserer Zeit. Der Internationale Ausschuss zum Klimawandel (International Panel on Climate Change) wies in seinem Bericht vom 4. Mai dieses Jahres darauf hin, dass sich die Emissionen von Treibhausgasn seit 1970 um mehr als 70 % erhöht haben. Der stärkste Zuwachs in dieser Zeit ist auf den Energiesektor zurückzuführen. Dessen Emissionen sind um 145 % gestiegen. Die Experten des Ausschusses gehen davon aus, dass die CO2-Emissionen bis 2030 nochmals um 45 - 110 % zunehmen werden. Zwei Drittel dieses Anstiegs werden dabei auf die Entwicklungsländer entfallen. Dies ist nicht nur auf ein höheres Wirtschaftswachstum zurückzuführen, sondern auch auf den raschen Anstieg der Weltbevölkerung. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wird die Weltbevölkerung von heute rund 6,6 Milliarden Menschen auf rund 9 Mrd. im Jahr 2050 ansteigen und sich damit um fast 50 % erhöhen. Berücksichtigt man das prognostizierte Wohlstandsund Wirtschaftswachstum insbesondere in den Entwicklungsländern, bedeutet dies grob gesagt, dass die Weltwirtschaft bis 2050 voraussichtlich um das Vier- bis Sechsfache wachsen wird. 2 Bereits heute hat der Druck auf die Erde im Zeitalter des „Anthropozän“ zur Folge, dass die natürlichen Prozesse unseres Planeten einer enormen Belastungsprobe ausgesetzt sind. Die Entwicklung ist bereits alles andere als „nachhaltig“. Der Begriff der „Nachhaltigkeit“ gewinnt in diesem Kontext eine ganz andere Bedeutung. Wir müssen unser Verhalten ändern, wenn wir verhindern wollen, dass die Weltwirtschaft Grenzen erreicht, bei denen Umweltverschmutzung, Massenmigration, Klimawandel, Krankheiten und Artensterben zu einer wirklichen Gefahr für die Menschheit werden. Und mit dieser Veränderung unseres Verhaltens müssen wir in Europa beginnen, indem wir uns zum Klimaschutz verpflichten. Es ist gut dokumentiert, welche Folgen es hätte, einfach blind so weiterzumachen, wie bisher. In Europa begreifen die Menschen endlich, dass der Klimawandel jeden persönlich angeht. Er wird keineswegs nur einige entlegene Winkel der Erde betreffen. Durch den Klimawandel können sich die klimatischen Bedingungen in Europa grundlegend verändern; so droht Wasser in vielen Gegenden zu einem enormen Problem zu werden, ganz zu schweigen von den Auswirkungen, die eine weltweite Massenmigration auf unsere Lebensweise und unser Wirtschaftssystem hätte. Dabei müssen wir uns klar vor Augen führen, dass uns nur eine kurze Zeitspanne bleibt, um zu handeln. Wenn die Welt auch nur noch ein Jahrzehnt wartet, wird es zu spät sein. Unsere Kinder und Enkelkinder werden den Klimawandel als unser Erbe vorfinden und zu diesem Zeitpunkt absolut nichts mehr dagegen ausrichten können. Der Aushandlung eines wirksamen internationalen Übereinkommens über die Bekämpfung der globalen Erwärmung stehen enorme Schwierigkeiten im Wege. Ebenso gewaltig sind die Anstrengungen, die zur Lösung des Problems unternommen werden müssen. Zunächst werden die Industriestaaten die Hauptlast der Verringerung der Emissionen tragen müssen. Im Hinblick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit ist dies keineswegs unproblematisch. Da der Pro-KopfEnergieverbrauch in China mehr als zehnmal niedriger ist als in den USA, ist es jedoch nicht verwunderlich, dass zumindest in der Anfangsphase die Länder die Vorreiterrolle übernehmen müssen, die das meiste CO2 in die Atmosphäre ausstoßen und dadurch am reichsten sind. Doch wir befinden uns meines Erachtens an einem Wendepunkt. Es wird immer deutlicher, dass die Weltgemeinschaft gemeinsam handeln wird, um dieser Herausforderung zu begegnen. Es bleibt uns nur zu hoffen, dass nicht zu wenig getan wird und nicht zu spät gehandelt wird. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir erfolgreich sein werden, und zwar aus einem Grund, den wohl Jeffrey Sachs, der Direktor des Earth Institute der Universität Colombia, kürzlich in einer Vorlesungsreihe am besten erläutert hat. Sachs hat darauf hingewiesen, dass die Welt in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts durch internationale Zusammenarbeit bereits ein ähnliches Problem gelöst hat, nämlich das Problem der Fluorchlorkohlenwasserstoffe, der FCKW, die die Ozonschicht der Erde zerstören. Diese Wirkung der FCKW hatte übrigens auch Paul Crutzen entdeckt. Nach den Ausführungen von Sachs war ein fünfstufiger Prozess zur Lösung des Problems erforderlich. 3 Zunächst erkannte die Wissenschaft das Problem. In einem zweiten Schritt stellten die Interessengruppen – in diesem Fall die Hersteller von FCKW und Aerosolen – die Erkenntnisse der Wissenschaft öffentlich in Frage. Doch die Natur und die Gesetze der Physik gewinnen letztlich die Oberhand über die Interessengruppen. Im Falle von FCKW gab dabei ein Foto den Ausschlag, das die NASA vom Ozonloch aufgenommen hatte. So kam es drittens dazu, dass sich die Öffentlichkeit der Problematik bewusst wurde: Uns allen wurde klar, dass dieses Problem uns selbst anging und sich auf das Leben unserer Kinder und Enkelkinder auswirken würde. Und so wurde der Ruf nach Abhilfemaßnahmen laut. Daraufhin suchten die Wissenschaftler intensiv nach einer Lösung. So kam es dann, wie Sachs es formuliert, zur entscheidenden Phase, in der die zuvor skeptischen Unternehmen den Politikern zuraunten: „Es ist ok, Ihr könnt eine Übereinkunft schließen, wir kriegen das hin.“ Und danach wurde innerhalb kurzer Zeit eine internationale Übereinkunft erzielt. Die Debatte über den Klimawandel folgt dem gleichen Muster. Obwohl die globale Erwärmung bereits 1896 entdeckt wurde, zählt sie erst seit kurzem zu den unbestrittenen Erkenntnissen der Wissenschaft. Durch den Hurrikan Katrina, das Abschmelzen der Gletscher direkt vor unseren Augen sowie den statistisch relevanten und beunruhigenden Anstieg der Durchschnittstemperaturen hat es die Natur erneut geschafft, dass der Klimawandel heute von kaum jemandem mehr bestritten wird. So wächst jetzt allgemein die Erkenntnis, dass der Klimawandel tatsächlich Folgen für das eigene Leben hat. Nach der anfänglichen Skepsis gegenüber der Wissenschaft, die von den Interessengruppen noch verstärkt wurde, besteht also nunmehr weltweit zunehmend öffentliches Einvernehmen darüber, dass gehandelt werden muss. Die Wissenschaft ist dem gefolgt, und jetzt beginnt meines Erachtens die von Sachs ermittelte Schlussphase: Die ersten Unternehmen raunen den Politikern zu: „Es ist ok, Ihr könnt eine Übereinkunft schließen, wir kriegen das hin.“ Lassen Sie mich nun auf die zweite große energiepolitische Herausforderung eingehen, die Versorgungssicherheit mit Energie. Nach den Prognosen der Internationalen Energieagentur wird die Erdölnachfrage in den nächsten Jahren um 1,9 % pro Jahr steigen. Die Erdölreserven reichen zwar noch für mehrere Jahrzehnte, doch das heißt nicht, dass die Produktionskapazität unbegrenzt gesteigert werden kann. Die jetzigen Verbrauchsstrukturen haben in jedem Fall zur Folge, dass im Verlauf des nächsten Jahrzehnts nur noch wenige Staaten, darunter vorrangig OPECLänder, ihre Erdölförderkapazität erhöhen können. Dazu hat die Internationale Energieagentur festgestellt: „Es ist insbesondere unsicher, in welchem Maße die großen Öl- und Gasproduzenten in der Lage und gewillt sein werden, ihre Investitionen zu erhöhen, um die wachsende Nachfrage in der Welt zu decken.“ Diese Entwicklungen können ganz erhebliche Auswirkungen auf Europa haben. Sollte beispielsweise der Erdölpreis auf 100 USD pro Barrel im Jahr 2030 ansteigen, so würden sich die Energieeinfuhren einer EU der 27 um insgesamt rund 170 Mrd. € verteuern. Dies entspräche pro EU-Bürger einem jährlichen Anstieg um 350 €. Dabei würden im Rahmen dieses Vermögenstransfers nur in geringfügigem Maße zusätzliche Arbeitsplätze in der EU geschaffen. 4 Die einfache Antwort auf diese Entwicklungen muss lauten, dass wir, selbst wenn der Klimawandel kein Thema wäre, in jedem Fall unsere übermäßige Abhängigkeit von eingeführten fossilen Brennstoffen verringern sollten und verstärkt heimische Energieträger nutzen sollten, die überwiegend einen geringen Kohlenstoffgehalt aufweisen. Dies ist nichts anderes als eine vernünftige Antwort der EU auf die zunehmenden preisbedingten Energieversorgungsrisiken, die sich aus der wachsenden Nachfrage nach fossiler Energie ergeben. Dies sind die Schlüsselthemen, die die Kommission bei ihren Bemühungen um die Ausarbeitung einer neuen Energiepolitik angehen wollte. Dabei ging es um die Frage, wie wir diese Herausforderungen in eine Chance für Europa verwandeln können. Das Ergebnis sind eine Vision und ein konkretes Programm zur ihrer Umsetzung. Der Europäische Rat hat inzwischen vor allem dank der Bemühungen des deutschen Ratsvorsitzes sein Einverständnis dazu gegeben. Die Kommission hat diese Energie- und Umweltpolitik in ihrem Maßnahmenpaket vom zehnten Januar als „neue industrielle Revolution“ bezeichnet. Wenn die Welt, wie ich glaube, den Mut und die Entschlossenheit aufbringen wird, gegen die katastrophalen Folgen des Klimawandels gemeinsam vorzugehen, ist diese Bezeichnung nicht übertrieben. Sir Nicholas Stern weist in seinem bemerkenswerten Bericht über die wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels nach, dass die wirtschaftlichen Kosten der Bekämpfung der globalen Erwärmung im Vergleich zu den voraussichtlichen Kosten eines Nicht-Tätigwerdens nicht ins Gewicht fallen. Zum anderen unterstreicht er genau wie der Internationale Ausschuss zum Klimawandel, in welch starkem Maße wir den Energieverbrauch und die Energieproduktion ändern müssen, um eine Wirkung zu erzielen. Die EU ist sich darin einig, dass ein wirksames Tätigwerden beinhaltet, den Ausstoß von Treibhausgasen in den Industrieländern bis 2020 um 30 % zu drosseln. Im Vorgriff auf die Aushandlung einer entsprechenden internationalen Übereinkunft hat der Rat beschlossen, dass die EU sich einseitig zu einer Reduzierung um 20 % verpflichtet. Doch im Grunde gehen wir damit nicht weit genug. Im Grunde müssten wir bis 2050 eine Reduzierung um 60 % und mehr herbeiführen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein grundlegender Wandel erforderlich, ein Wandel hin zu Energieeffizienz, erneuerbaren Energien mit niedrigem Kohlenstoffausstoß und Kohlenstoff-Sequestrierung, ein Wandel, der wahrlich einer neuen industriellen Revolution gleichkommt. Wir wissen, dass dieses Ziel erreicht werden kann: Würden sich zum Beispiel alle EU-Länder der führenden Position Deutschlands und Dänemarks bei den erneuerbaren Energien anschließen, kämen wir auf die zur Erreichung unseres 20 %-Ziels erforderlichen Werte. Die KohlenstoffSequestrierung kann rentabel gemacht werden, und zwar zu vertretbaren Kosten von annähernd 20 EUR je sequestrierter Tonne CO2. 5 Das Wichtigste dabei ist jedoch, dass die Regionen der Welt, die jetzt in den Wandel, in Forschung und Entwicklung und in eine frühzeitige Umsetzung der neuen Generation von Technologien mit geringen oder keinen Kohlenstoffemissionen investieren, einen erheblichen Gewinn an künftiger Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit für sich verbuchen werden. Diese Regionen werden künftige Preisschocks besser bewältigen können, da sie in einheimische Energie mit niedrigem Kohlenstoffausstoß investiert haben, die zu stabilen Preisen erhältlich ist. Vor allem werden in diesen Regionen die „Microsofts“ der Zukunft entstehen. Dies ist die Vision Europas, die die Kommission mit einer Energie- und Umweltpolitik verfolgt, die ambitioniert an die Bewältigung der aktuellen Herausforderungen im Energiebereich herangeht. Auf der Tagung des Europäischen Rates im März haben die Staats- und Regierungschefs der Vision der Kommission von einer anderen Zukunft im Energieund Umweltbereich zugestimmt. Ferner wurde die verbindliche Verpflichtung auf die von mir bereits erwähnte 20 %ige Verringerung der Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 eingegangen. Ebenso wurde der Kommission die anspruchsvolle Aufgabe zugewiesen, dieses Ziel so umzusetzen, dass die Wettbewerbsfähigkeit Europas gestärkt wird. Dieser Herausforderung wollen wir uns alle im Kollegium stellen. Erstens: Die Kommission wird gegen Ende dieses Jahres ein überarbeitetes Emissionshandelssystem vorstellen, das über 2012 hinaus gelten soll. Es soll auch dahingehend weiterentwickelt werden, dass die 20 %ige Verringerung der Treibhausgasemissionen, zu denen der Rat Europa verpflichtet hat, erreicht wird. Außerdem wird die Kommission ihre Bemühungen um ein weltweites Klimaschutzabkommen fortsetzen, ja sogar deutlich intensivieren. Zweitens: Ich werde, ebenfalls bis Ende dieses Jahres, eine neue übergreifende Richtlinie für erneuerbare Energien vorlegen. So wird die im Europäischen Rat erzielte Einigung auf rechtsverbindliche nationale Zielvorgaben auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien konkrete Gestalt annehmen. Besagte Zielvorgaben wiederum werden gewährleisten, dass wir das im Rat vereinbarte Ziel einen 20 %igen Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix in der EU bis zum Jahr 2020 - erreichen. Das 20 % Ziel für den Anteil erneuerbarer Energien bis 2020 ist natürlich ein außerordentlich ehrgeiziges Ziel. Manche meinen, es sei unrealistisch. Wenn wir jedoch einen solchen Wert als „unmöglich“ betrachten, müssen wir auch akzeptieren, dass wir unseren Kindern und Enkeln die globale Erwärmung als Erbe hinterlassen. - 20 % sind – sofern die notwendige Entschlossenheit aufgebracht wird – machbar. Andere wiederum halten die Kosten für zu hoch. Ich dagegen bin der Meinung, dass es uns zu teuer zu stehen kommt, diesen Schritt zu unterlassen. Bei einem Ölpreis von 70 USD und einem CO2-Preis von etwa 20 EUR würde sich diese Initiative mehr oder weniger selbst tragen. Nicht nur aus diesem Grund ist diese Politik vernünftig: Sie ermöglicht es Europa zum einen, seine Versorgung im 21. Jahrhundert zu sichern. Zum anderen ist sie mit enormen kommerziellen Chancen für Europa verbunden. Die Nutzung technologiegetriebener einheimischer Energieträger schafft in Europa viele hochwertige Arbeitsplätze, etwas, was der Import von immer größeren Öl- und Gasmengen nicht bewirkt. 6 Gelingt es Europa, seine führende Position bei Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien zu behaupten und weiter auszubauen, ergibt sich ein riesiges Exportpotenzial. Wenn der Rest der Welt die Probleme des Klimawandels wirklich in Angriff nimmt, werden die in diesem Bereich tätigen Unternehmen tatsächlich die neuen „Microsofts“ der Zukunft sein. Drittens: Ab nächstem Jahr wird die Kommission damit beginnen, eine Reihe von Initiativen zur Energieeffizienz aufzulegen. Diese reichen von Mindestproduktnormen über eine bessere Kennzeichnung und bessere Baunormen bis hin zu effizienteren Verkehrssystemen in den europäischen Städten. Hier besteht ein enormes Potenzial nicht nur im Hinblick auf die Verringerung der Emissionen, sondern auch im Hinblick auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Europas. Viertens: Ende dieses Jahres wird die Kommission der Aufforderung des Europäischen Rates zur Ausarbeitung einer europäischen strategischen Initiative für Energietechnologie nachkommen. Diese Initiative ist ein grundlegender Baustein der neuen europäischen Energiepolitik und meiner Ansicht nach der Schlüssel dazu, dass aus der Herausforderung des Klimawandels und der Energiesicherheit ein Wettbewerbsvorteil für Europa wird. Wie alle industriellen Revolutionen wird der Erfolg beim Klimaschutz von der Technologie abhängen. Dies setzt eine neue Generation energieeffizienter Anlagen, Technologien für die Kohlenstoff-Sequestrierung und neue Werkstoffe voraus, die die Windenergie und die Fotovoltaik, um nur einige Beispiele zu nennen, kostengünstiger machen. Für Europa macht es keinen Sinn, beim Klimaschutz weltweit führend zu sein, aber keine führende Position bei der Entwicklung der nächsten Generation von Technologien mit niedrigen Kohlenstoffemissionen einzunehmen. Genau dies ist jedoch die Gefahr, vor der Europa mit seinem jetzigen Ansatz steht. In den ersten Jahren des Siebten Rahmenprogramms werden wird annähernd 250 Mio. EUR für erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Kohlenstoffsequestrierung bereitstellen. Bis 2013 werden diese Aufwendungen auf rund 450 Mio. EUR steigen. Andere verfolgen allerdings ehrgeizigere Pläne als wir. Dabei geht es nicht nur darum, mehr Geld aufzuwenden; wichtiger ist, dass es besser verwendet wird. Wir müssen die Koordinierung der in den Mitgliedstaaten und auf Gemeinschaftsebene betriebenen Forschung verbessern. Wir brauchen einen stärker zielgerichteten Ansatz, der die zentralen Ziele der EU festlegt und jedes einzelne geförderte Projekt und jede einzelne Maßnahme an diesen zentralen Zielen misst. Um hier Fortschritte zu machen, ist die Hilfe der Wirtschaft, insbesondere des VDEW und seiner Mitglieder, unerlässlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte diesen Teil meines Vortrags beenden, indem ich dem Beispiel von Jeffrey Sachs, dessen Vorlesungen ich eingangs erwähnte, folge und John F. Kennedy zitiere. Das Zitat stammt aus seiner Rede vom Juni 1963, als er der Kubakrise eine andere Wendung gab. In der Rede geht es um Frieden, in ihr werden aber auch die wichtigsten Herausforderungen unserer Generation angesprochen. 7 „Unsere Probleme sind von Menschen geschaffen, deshalb können sie auch von Menschen gelöst werden. Die Größe, die der menschliche Geist erreichen kann, bestimmt der Mensch selbst. Kein schicksalhaftes Problem der Menschheit liegt außerhalb der Reichweite des Menschen. Die menschliche Vernunft und der menschliche Geist haben oftmals das scheinbar Unlösbare gelöst - und wir glauben, dass sie dies erneut tun können.“ Damit hätte ich meine Rede eigentlich gerne beendet, verbunden mit der Bitte an Sie, die Bemühungen der Kommission zu unterstützen, um die EU zum Vorreiter der nächsten industriellen Revolution zu machen, und mit der Bitte um Ihren aktiven Einsatz in diesem Sinne. Dennoch denke ich, sie würden es mir nicht verzeihen, wenn ich nicht auf den Energiebinnenmarkt zu sprechen käme. Als die erste Elektrizitätsrichtlinie vor neun Jahren verabschiedet wurde, war sich die Europäische Gemeinschaft darüber im Klaren, dass ein wirklich vom Wettbewerb geprägter europaweiter Strom- und Gasmarktes nicht auf einmal geschaffen werden kann, sondern ein längerer Prozess ist. Dies hat sich in der Tat bewahrheitet. Es ist unbestritten, dass mit der zweiten Strom- und der zweiten Erdgasrichtlinie große Fortschritte gemacht wurden. Sie haben zu Energieregulierungsbehörden in allen Mitgliedstaaten geführt, zur rechtlichen Entflechtung der Übertragung und Fernleitung und ab Juli dazu, dass praktisch jeder Strom- und Gasverbraucher in der gesamten EU seinen Versorger frei wählen kann. Genauso unbestritten ist jedoch, dass viele unserer grundlegenden Ziele nicht erreicht worden sind. Wie die Sektoruntersuchung gezeigt hat, sind viele Märkte nach wie vor rein national ausgerichtet, gestaltet sich der grenzüberschreitende Handel schwierig und findet nur in begrenztem Umfang statt und haben viel zu wenige Verbraucher kaum oder überhaupt nicht die Möglichkeit, den Versorger zu wechseln. Bei der Entscheidung darüber, wie wir hier Abhilfe schaffen können, müssen wir stets einen grundlegenden Aspekt beachten. Bei dem Energiebinnenmarkt geht es um unsere Bürger. Wie können wir Ihnen konkrete Vorteile bieten – als Strom- und Gasabnehmern und als Beschäftigten von Unternehmen, für die Energie ein wichtiger, manchmal sogar ein ausschlaggebender Faktor ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit ist? Europa nimmt bereitwillig einen Wettbewerbsnachteil bei den Arbeitskosten und Sozialabgaben in Kauf, Europa kann es sich jedoch nicht leisten, die Kapitalkosten aufgrund überhöhter Energiepreise, die die Folge von Märkten mit mangelndem Wettbewerb sind, steigen zu lassen. Von dieser Maxime müssen wir uns leiten lassen, wenn wir darüber entscheiden, was jetzt zu tun ist,. Der Europäische Rat hat die Ansicht der Kommission, weitere Maßnahmen seien jetzt erforderlich, einstimmig gebilligt. Ich plane, solche Maßnahmen vor Jahresende, voraussichtlich im September oder Oktober, vorzulegen. Ich denke, dass in Bezug auf die meisten Gebiete, auf denen gehandelt werden muss, ein breiter Konsens besteht oder dass sich ein solcher Konsens zumindest abzeichnet. Deshalb werde ich mich auf zwei Fragen beschränken: auf die Entflechtung und die regionale Regulierung. 8 Wir wissen alle, dass es nach Auffassung der Kommission keine perfekte Lösung für die Probleme gibt, die aus der vertikalen Integration resultieren. Nach Ansicht der Kommission ist jedoch die Eigentums-Entflechtung der Übertragungsnetze das beste Konzept. Darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass es vernünftige und angemessene Lösungen für die Verfassungsbedenken gibt, die zuweilen gegen die Eigentums-Entflechtung vorgebracht werden, nämlich dass es sich dabei um eine Enteignung handeln würde. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, die in Betracht kommen, etwa eine „vertiefte“ Form eines unabhängigen Netzbetreibers in Verbindung mit dem Konzept eines regionalen Netzes. Dabei handelt es sich jedoch nur um die zweitbeste Lösung, die mit erheblichen Nachteilen verbunden ist: Sie macht eine ständige, umfassende Regulierung und einen sehr weit gehenden Rückgriff auf die gemeinschaftliche und nationale Wettbewerbspolitik erforderlich. Bei der endgültigen Lösung dieses Problems ist meiner Meinung nach auch die erforderliche Rechtssicherheit zu bedenken. Das Maßnahmenpaket, das die Kommission im Verlauf dieses Jahres vorlegen will, sollte das letzte sein. Es hat keinen Sinn, alle vier bis fünf Jahre den Versuch zu unternehmen, die Mängel vorheriger Rechtsvorschläge zu beheben. Dieser Grund sowie die Auffassung der Kommission, dass die Eigentums-Entflechtung der Übertragungsnetze die sauberste, einfachste und effizienteste Lösung ist, haben mich davon überzeugt, dass sich dieses Problem mit diesem Ansatz am besten lösen lässt. Was die regionale Regulierung betrifft, so bin ich der Meinung, dass wir keinen europäischen Regulierer brauchen. Was wir benötigen, ist eine Institution oder einen Mechanismus mit der Befugnis, einfache, schnelle und rechtsverbindliche Entscheidungen zu grenzüberschreitenden Fragen zu treffen wie der Zuweisung grenzüberschreitender Kapazitäten und den Entgelten für die grenzüberschreitende Übertragung. Das gegenwärtige, auf dem Ausschussverfahren („Komitologie“) beruhende System ist langsam und schwerfällig und hat nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht. Im Idealfall sollten die Regulierungsbehörden tätig werden, die in einer neuen Rechtsform gemeinsam handeln und ausgehend von Vorschlägen der Übertragungsnetzbetreiber verbindliche Entscheidungen treffen können. Die nationalen Regulierungsbehörden sollten weiter für die Regulierung der nationalen Märkte zuständig sein und zum Beispiel die Entgelte und die nationalen Netzcodes und Netzvorschriften festlegen. Wie bereits gesagt, gibt es viele andere Fragen, die in Angriff genommen werden müssen, um zu einem wettbewerblichen Binnenmarkt für Energie zu gelangen. Hierzu gehören die unabhängige und einheitlich effektive Regulierung auf nationaler Ebene, die zügige Entwicklung regionaler Märkte, verbesserte Vorschriften für die Netzsicherheit, besserer Verbraucherschutz und höhere Dienstleistungsstandards sowie ein besseres und äquivalentes Transparenzniveau. Bei diesen Fragen haben wir echte Fortschritte erzielt, wobei wir eng mit der Branche zusammengearbeitet haben, um die wirksamsten Lösungen zu finden. Von der Zusammenarbeit bei diesen Fragen, vor allem mit dem VDEW und Eurelectric, war ich beeindruckt. 9 Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, dieser kurze Überblick hat gezeigt, dass für die Bewältigung der drei Herausforderungen Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit das Gleiche gilt wie für die Aussage, dass in jeder Herausforderung eine Chance steckt. Für die EU besteht die wirkliche Herausforderung in den nächsten Monaten darin, dass sie den Mut aufbringt, ihre moralische Führung aufgrund ihrer Vorreiterrolle in einen Wettbewerbsvorteil für ihre Bürger zu verwandeln. Hierfür ist nicht nur die Zustimmung von Verbänden wie dem VDEW erforderlich, sondern auch, dass sie dabei eine führende Rolle spielen. Erinnern wir uns an Kennedys Worte: „Die menschliche Vernunft und der menschliche Geist haben oftmals das scheinbar Unlösbare gelöst – und wir glauben, dass sie dies erneut tun können.“ Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. 10