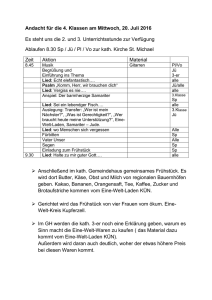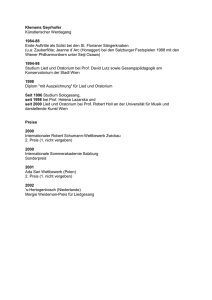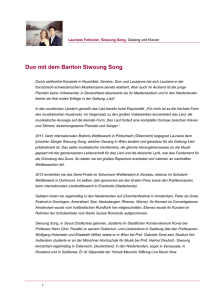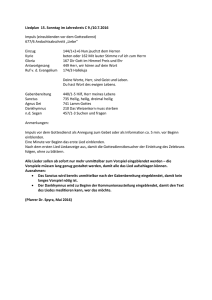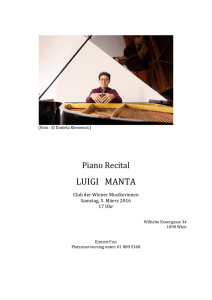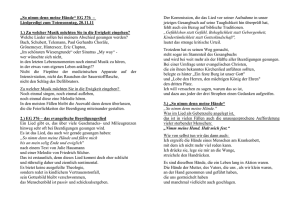Louise Farrenc (1804 – 1875) - Frankfurter Orchester Gesellschaft
Werbung

Louise Farrenc (1804 – 1875) „In den 1860er-Jahren genügte der bloße Name eines französischen Komponisten – noch dazu eines lebenden – auf einem Konzertprogramm, um das Publikum in die Flucht zu schlagen.“ So erinnert sich Camille Saint-Saëns an den damaligen Musikbetrieb, und Richard Wagner schreibt 1860 aus Paris an Mathilde Wesendonck: „Bedenken Sie, wie miserabel es mit aller französischen Kunst steht ... der Franzose ist aber auch nicht eigentlich musikalisch.“ In den Jahrzehnten nach der Revolution von 1789 – die Musik von Couperin und Rameau war längst von Hymnen und Chören, die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verkündeten, übertönt worden – gab es tatsächlich nur wenige französische Komponisten, die die große Tradition fortsetzten. Ausländische Musiker strömten nach Paris und gaben den Ton an: Rossini, Donizetti, Bellini, Meyerbeer, Jaques Offenbach und Richard Wagner, Chopin und Liszt, sie alle kamen, schrieben erfolgreiche Werke und wurden dann von den Franzosen sogar als „notre Rossini“, „notre Meyerbeer“ gefeiert. Die „Grand Opéra“ – eben nicht von Franzosen geschrieben – beherrschte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das französische Musikleben, und Kammermusik und Sinfonien wurden zwar gespielt, aber vorwiegend aus deutsch-österreichischer Produktion, d.h. von Haydn, Mozart und Beethoven. Vor knapp 20 Jahren hat nun die deutsche Musikforschung mit Engagement und Erfolg doch einen Namen aus dieser für Frankreich anscheinend wenig attraktiven Epoche herauspräpariert: Louise Farrenc, eine Zeitgenossin von Clara Schumann und Fanny Hensel geb. Mendelssohn. Louise Farrenc wächst in einer Künstlersiedlung an der Sorbonne auf, bekommt schon als Kind Klavierunterricht und beginnt als junges Mädchen ihre Studien bei Anton Reicha, der seit 1818 als Professor am Conservatoire Komposition lehrt. Kontinuierlich wächst ihr Werkkatalog, der am Ende 51 nummerierte Kompositionen verzeichnet: zunächst Klavierstücke, Lieder, dann Chormusik, Orchesterstücke, Kammermusik und schließlich drei Sinfonien. 1842 wird die sehr erfolgreiche Pianistin, Komponistin und Musikwissenschaftlerin, als einzige Frau auf diesem Posten, Professorin für Klavier an dem berühmten Pariser Institut (eine besondere Fußnote: Es dauert rund acht Jahre, bis sie auch das entsprechende Gehalt bekommt). Parallel zur Konzert- und Lehrtätigkeit arbeitet sie zusammen mit ihrem Mann an einer gigantischen Aufgabe: „Le Trésor des Pianistes“, einer 23-bändigen Anthologie von Klaviermusik des 16. bis 19. Jahrhunderts, in der zusätzlich zum Notentext jedes Stück mit historischen, biographischen und interpretatorischen Angaben versehen ist – eine richtungweisende Dokumentation für die Wiederbelebung und Aufführungspraxis Alter Musik. Dank ihrer professionellen Position und ihrer in Technik und Stil perfekt gearbeiteten Kompositionen wurden ihre Stücke immer in entsprechendem Rahmen gespielt. Die Uraufführung der 3. Sinfonie war dann allerdings ein besonderer Höhepunkt: Das Werk wurde innerhalb der Subskriptionskonzerte der Société des Concerts du Conservatoire Paris, die für ihre Beethoven-Aufführungen europaweit berühmt war, im April 1849 einem fachkundigen Publikum vorgestellt. Kommentar: „... ein starkes und mutiges Werk, in dem der Glanz der Melodien mit der Vielfalt der Harmonie wetteiferte.“ Nach einer kurzen Einleitung, die wie mit einer Frage beginnt, bereitet eine ständig intensiver und in sich schneller werdende Kreiselbewegung den Einsatz des markanten, von allen Streichern gespielten Hauptthemas vor: Nach klassischem Vorbild folgt ein Seitenthema, linear und leicht im Ton, von den Oboen gespielt: Im weiteren Verlauf des Satzes werden diese Elemente sehr kunstvoll in virtuosen Bläserpartien und Streicherabschnitten verarbeitet. Auch die Orchesterbesetzung – Streicher, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Clarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner und Pauken – entspricht ganz Haydnscher Tradition. Im Gegensatz zu ihrem Zeitgenossen Hector Berlioz, der sein Publikum immer wieder mit grandiosen Einfällen überrascht und auch irritiert, bleibt Louise Farrenc am klassischen Vorbild orientiert. Der 2. Satz beginnt mit einer wunderschönen Klarinettenmelodie über weichen Horn- und Fagott-Akkorden mit harmonisch eingefügten Paukentupfern und entwickelt sich bis auf einen kurzen dramatischen Ausbruch fein ziseliert im leisen Register. Der 3. Satz, ein Scherzo, gibt dem Konzertbesucher eine hörbare Vorstellung von französischem Esprit: Federleicht, mit hohem Tempo, beginnt das Streichorchester, elegant übernehmen die Bläser. Triller, Stakkati, weite Sprünge, hohe Lagen, das alles erzeugt ein Klangbild, das auch an Mendelssohn denken lässt. Im Trio – eigentlich sieht das Notenbild ganz simpel aus – zeigt Madame Farrenc, wie raffiniert sie spezifischen Bläserklang mit typischer Streichertechnik zu einem überraschenden Effekt kombiniert. Das Finale beginnt mit den Streichern und wie im 1. Satz auch wieder energisch im Unisono: Unmittelbar nach diesem 1. Thema, das zunächst stufenweise nach oben steigt, folgt sofort das 2., das sich in Synkopen abwärts bewegt: Aus diesem kontrastreichen Material entwickelt sich ein kurzweiliges Dialogisieren mit imposanten Tutti-Stellen und kammermusikalischen Einwürfen. Henri Duparc (1848 – 1933) Die Anregung zur Komposition der Sinfonischen Dichtung „Lénore“ geht – wie auch „Der Zauberlehrling“ seines Zeitgenossen Paul Dukas – von einer Textvorlage aus. Goethes Ballade, eine dramatische Geschichte aus Neugierde und Selbstüberschätzung, Machtrausch und Angst, Wut, Verzweiflung und einem überraschendem Happy End – von Dukas kongenial in eine musikalische Form übersetzt – wird zur Freude der Konzertbesucher immer wieder gespielt. Und Bürgers Ballade „Lenore“, eine dramatische Geschichte aus Liebe und Enttäuschung, Erwartung und Erfüllung, Grauen, Schrecken und einem tödlichen Ende – von Duparc ebenso genial in Musik übersetzt – ist fast unbekannt. Gottfried August Bürger veröffentlichte 1773 im Göttinger Musenalmanach, einer Zeitschrift, die mit großem Engagement die Werke aktueller Dichter und Schriftsteller des „Sturm und Drang“ herausbrachte, seine Ballade „Lenore“. Diese unheimliche Schauergeschichte wurde wegen ihrer Dynamik, ihrem dichterischen Schwung und ihrer mitreißenden Leidenschaft begeistert aufgenommen und machte ihn – heute gerade noch präsent durch „Die Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen“ – damals international bekannt. Kurz der Inhalt, eine Episode aus dem Siebenjährigen Krieg: Lenore, mit Wilhelm verlobt, wartet sehnsüchtig auf seine Rückkehr aus der Schlacht bei Prag, die Friedrich II. gegen die Österreicher sehr verlustreich gewonnen hat. Vergebens, Lenore ist verzweifelt: „Bist untreu, Wilhelm oder todt?“ Eines Nachts erscheint „Und außen, horch! ging’s trap trap trap, Als wie von Rosseshufen; Und klirrend stieg ein Ritter ab, An des Geländers Stufen; dann endlich der Geliebte, als Geist: „Muß heut noch hundert Meilen Mit dir in’s Brautbett eilen.“ Und damit beginnt ein gespenstischer Ritt: Wie flogen rechts, wie flogen links Gebirge, Bäum’ und Hecken! Wie flogen links, und rechts, und links Die Dörfer, Städt’ und Flecken! – Er endet mit einer grausamen Entdeckung: Ha sieh! Ha sieh! im Augenblick, Huhu, ein gräßlich Wunder! Des Reiters Koller, Stück für Stück, Fiel ab, wie mürber Zunder. Zum Schädel, ohne Zopf und Schopf, Zum nackten Schädel ward sein Kopf; Sein Körper zum Gerippe, Mit Stundenglas und Hippe. Duparc macht aus der mit 32 Strophen sehr langen Ballade ein knappes Drehbuch, reduziert die phantastische Vorgeschichte und das makabre Ende auf einen schmalen Textrahmen und stellt die 12 Zeilen, die den wilden Ritt beschreiben, in den Mittelpunkt. Lénore jammert um ihren im Kriege gefallenen Wilhelm. Wilhelm zu Ross als Geistererscheinung: Schön Liebchen schürzte, sprang und schwang Sich auf das Roß behende; Wohl um den trauten Reiter schlang Sie ihre Lilienhände. Wie flog, was rund der Mond beschien, Wie flog es in die Ferne! Wie flogen oben über hin Der Himmel und die Sterne! „Graut Liebchen auch? … Der Mond scheint hell! Hurrah! die Todten reiten schnell! Graut Liebchen auch vor Todten!“ „O weh! Laß ruhn die Todten!“ Die Geister verfolgen sie mit Geheul. Mit dem Schlage der Mitternachtsstunde wird Ross und Reiter zu Asche. Lenore stirbt. Nach dieser nun griffigen Textvorlage schreibt Duparc eine kunstvoll instrumentierte, eingängig illustrative Musik und beginnt das Stück mit einem wirklich jammervollen Motiv in den Celli, das mit immer neuen chromatischen Verrenkungen Lénores verzweifelte Situation beschreibt. Ein kurzes, gespanntes Atemholen, dann das Klappern der Pferdehufe, und ab geht der wilde Ritt, von zwei Posaunen im Fortissimo angeführt: Mit satten Farben legt Duparc die gespenstische Szenerie an: Rhythmisch betonte Streicherfiguren, Glissandi, Tremoli, weit gespannte chromatische Holzbläserskalen, schwergewichtige Blecheinwürfe, Tempowechsel, heftige Dynamik mit grellen Akzenten und verhauchten, chromatischen Seufzern lassen den Hörer kaum zu Atem kommen. Virtuos spielt das groß besetzte Orchester in an Wagner erinnerndem Tonfall auf. Und dann das Finale: ein gewaltiger Tutti-Akkord ... einsame Paukenschläge ... die Posaunen verkünden den Tod – und mit drei ganz leise gezupften Akkorden endet das Stück. Henri Duparc gehörte schon mit 20 Jahren zu den bekannten Komponisten Frankreichs. Als einer der ersten Schüler von César Franck, befreundet mit Camille Saint-Saëns, Ernest Chausson und Edouard Lalo – sie waren alle Mitglieder der 1871 gegründeten „Société Nationale de Musique“ – machte er schon früh mit kunstvollen Liedern und Kammermusik auf sich aufmerksam, und durch „Lénore“, 1875 uraufgeführt, wurde er mit einem Schlage berühmt. Heute sind nur wenige Werke von ihm erhalten, vieles hat er selber vernichtet, geblieben sind 17 Lieder, ein paar Klavierstücke, eine Cellosonate und glücklicherweise „Lénore“, neben zwei kleineren Orchesterstücken das wichtigste Werk. Ernest Chausson (1855 – 1899) „In meinem Poème wird nichts geschildert, es gibt keine Story, alles ist Gefühl“ – und so könnte sich der Hörer eigentlich entspannt zurücklehnen und genussvoll den hochromantischen Klängen lauschen, wenn es da nicht doch eine Geschichte gäbe ... Chausson, als Sekretär der Société Nationale de Musique ein geschätztes Mitglied der Pariser Gesellschaft, lud regelmäßig die künstlerische Elite in seinen Salon ein, und alle kamen: Musiker, Schriftsteller und Maler, auch Iwan Turgenjew, dieser „Mensch mit merkwürdiger Neigung zu außersinnlichen, parapsychologischen, magischen und abergläubischen Erfahrungswelten". Turgenjew war durch seine Gedichte, Novellen, Erzählungen und Romane bereits international bekannt und lebte seit vielen Jahren in Paris, um seiner Geliebten, der damals berühmten, aber leider verheirateten Sängerin Pauline Viardot nahe zu sein. In der Kurzgeschichte „Das Lied der triumphierenden Liebe“, die er kurz vor seinem Tod noch schreibt, macht er seine leidvollen Erfahrungen – die unglückliche Dreiecksbeziehung dauerte fast vierzig Jahre – zum Thema: In eine andere Zeit und auch an einen anderen Ort verlegt, spielt die mystische Liebesgeschichte im Ferrara des 16. Jahrhunderts. Die beiden Freunde Fabio und Muzio lieben Valeria, Fabio gewinnt und Muzio tritt enttäuscht eine Reise in den Orient an. Als er nach vier Jahren zurückkehrt, wird er vom glücklichen, aber noch immer kinderlosen Paar mit offenen Armen aufgenommen. Er verzaubert die beiden mit abenteuerlichen Reiseberichten und zeigt ihnen „Teppiche, Seidentücher, Gewänder aus Samt und Brokat, Waffen, Schalen, Schüsseln, mit Email verzierte Becher, goldene und silberne, mit Perlen und Türkisen besetzte Kostbarkeiten, Kästchen aus Bernstein und Elfenbein, geschliffene Flaschen, Gewürze, Räucherwerk, Fell wilder Tiere, Federn unbekannter Vögel und zahlreiche andere Gegenstände, deren Verwendungszweck geheimnisvoll und nicht zu erraten war.“ Von seinem Diener lässt er sich „seine indische Geige zu bringen, die den europäischen ähnelte, nur war sie mit einer bläulichen Schlangenhaut bezogen, besaß statt vier nur drei Saiten, und am äußersten Ende des dünnen, halbkreisförmig geschwungenen Rohrbogens funkelte ein feingeschliffener Diamant.“... „Als er mit dem letzten Lied begann, schwollen diese Töne an und vibrierten hell und stark. Eine leidenschaftliche Weise wurde von den breiten Bogenstrichen getragen und schien sich in ihren Schwingungen wie jene Schlange zu winden, mit deren Haut die Geige bespannt war.“ Und auf Fabios Frage nach dem Ursprung dieser faszinierenden Melodie antwortet Muzio: „Dieses Lied hörte ich zum erstenmal auf der Insel Ceylon. Im Volksmund heisst es ‚Das Lied der glücklichen, triumphierenden Liebe’.“ Eines Nachts sieht Fabio seine Frau im Schlaf aus dem Bett steigen und folgt ihr in den Garten, wo sie auf den ebenfalls schlafwandelnden Muzio trifft. Wutentbrannt sticht er ihn nieder. Das Ehepaar findet sein Glück wieder, und eines Tages, „an einem herrlichen Herbsttag, Valeria saß vor der Orgel, ihre Hände glitten über die Tasten ... Und plötzlich erklang, ohne ihren Willen, das ‚Lied der triumphierenden Liebe’, das Mucius einst gespielt hatte. In diesem Augenblick spürte sie zum erstenmal seit ihrer Heirat die zarten Regungen eines neuen, keimenden Lebens in sich ... Valeria fuhr zusammen ... Was bedeutet das? Ob etwa wirklich?“ Soweit Iwan Turgenjew, und nun zu Ernest Chausson: Sein Freund Eugène Ysaÿe, dem er 1890 schon das Konzert für Violine, Klavier und Streichquartett D-Dur op. 21 gewidmet hatte, bat ihn ein paar Jahre später, ein Konzert für Violine und Orchester zu schreiben. In seinem Tagebuch notiert Chausson, der natürlich Turgenjews Novelle kannte, er habe sein Hauptthema zum „Lied der triumphierenden Liebe“ mit einem befreundeten Geiger probiert. Mit der bis dahin üblichen dreisätzigen Form hatte Chausson allerdings große Probleme: „Ich weiß kaum, wo ich mit dem Konzert anfangen soll, eine wahre Herkulesaufgabe“, deshalb konzentrierte er das Stück auf einen Satz, der in seiner Urfassung von 1893 dann auch mit „Das Lied der triumphierenden Liebe“ überschrieben war. Durch mehrere Überarbeitungen – es gibt eine Fassung für Klavier und Violine und eine Kammermusikfassung – wurde auch der Titel reduziert: von zunächst „Poème symphonique“ auf schließlich „Poème“. Mit großem Erfolg spielte im Dezember 1896 Ysa e die Uraufführung des ihm gewidmeten Werks im Konservatorium von Nancy, und bis heute gehört es zum Repertoire der Geigenvirtuosen. Lento e misterioso, dunkel getönt mit leisen, tiefen Streichern und Bläsern beginnt das Stück, das uns für eine Viertelstunde in eine fantastische Klangwelt entführt. Nach einer zweimaligen Frage der Celli hebt sich aus einem lang gehaltenen Ton das erste Thema, „Valerias“ Thema, heraus, das anschließend vom Streichorchester wie mit einem Choral beantwortet wird. In einer ersten Solopassage stellt die Solovioline nach einer chromatischen Sequenz das Thema – diesmal mit kunstvollem Rankenwerk verziert – noch einmal vor, und das Orchester nimmt in einem impressionistisch anmutenden Satz Motive aus dem nun schon bekannten Thema auf. Das Poème wird weitergesponnen, schemenhaft taucht in der Solovioline das zweite Thema „Muzio“ auf und wird dann im Unisono von Solobratsche und Oboe komplett vorgestellt: Mit diesen beiden Themen, in immer neuen Verwandlungen, Umspielungen und oft auch nur angedeutet, mal in der Solovioline, mal auch im Orchester, schreibt Chausson die mythische Geschichte noch einmal neu. Turgenjew, der 1883 starb, hat „Das Lied der triumphierenden Liebe“ nie gehört. Édouard Lalo (1823 – 1892) Die „Société Nationale de Musique“ – eine sehr einflussreiche Institution in der so genannten „belle époque“ – vertrat den Anspruch, die „ars gallica“ zu neuem Leben zu erwecken, und leitete damit die fruchtbarste Periode der französischen Musikgeschichte ein. Édouard Lalo, Mitglied der Société, sah sich im erlauchten Kreis um César Franck bescheiden als Autodidakt, denn er war vorwiegend als Orchester- und Kammermusiker und als Lehrer tätig. 1875 überraschte er seine Kollegen dann doch mit seiner „Symphonie espagnole“, einem Konzert für den Violinvirtuosen Pablo de Sarasate. Im gleichen Jahr begann er die Arbeit an der Oper „Le Roi d´Ys“, eine gewaltige Anstrengung, die erst 13 Jahre später nach vielen geplatzten Terminen und Umarbeitungen mit einer ziemlich chaotischen, aber durchaus geglückten Uraufführung in der Pariser Opéra Comique beendet war. Im folgenden Jahr stand die Oper dort rund einhundert Mal auf dem Programm, ein großer Erfolg. Aus einer alten bretonischen Sage – es geht um den Untergang der verwunschenen Stadt Ys, die in der Bucht von Douarnenez gelegen haben soll – hat Édouard Blau, ein bekannter Theaterjournalist, Lyriker und Dramatiker, ohne komplizierte historische Verwicklungen ein einfach gebautes Libretto für die dreiaktige Oper „Le Roi d´Ys“ entwickelt: 1. Akt Nach kriegerischen Auseinandersetzungen mit dem feindlichen Prinzen Karnac bietet der König von Ys dem Sieger seine Tochter Margared zur Frau an, um den schon lange währenden Konflikt endlich friedlich zu beenden. Margared ist verzweifelt und beichtet ihrer Schwester Rozenn, dass ihr Herz noch immer an dem vor Jahren verschollenen Krieger Mylio hängt. Die Hochzeitsfeierlichkeiten sind bereits in vollem Gang, als Mylio tatsächlich wohlbehalten zurückkehrt. In aller Öffentlichkeit verweigert Margared den geforderten Hochzeitskuss, und der verschmähte Karnac, zuerst hofiert und dann missachtet, bebt vor Zorn. 2. Akt Margarete stellt fest, dass Mylio nicht sie, sondern ihre Schwester Rozenn liebt. Als der König davon erfährt, bietet er Mylio die Hand Rozenns unter der Bedingung an, Karnacs anrückende Armee abzuwehren. Mylio willigt ein, gewinnt die Schlacht und kehrt siegreich heim. Die gedemütigte Margared sucht blind vor Wut und Eifersucht den geschlagenen Karnac auf, um gemeinsam mit ihm die Vernichtung der Stadt zu planen. Margared will ihm die Schlüssel für die Schleusentore der Dämme geben, die die Stadt vor den Fluten schützen. 3. Akt Am Tag der Hochzeit Mylios und Rozenns kommen Margared Zweifel an ihrem Racheplan, doch Karnac kann sie von der Richtigkeit ihres Vorhabens überzeugen und bekommt die Schlüssel. In heller Verzweiflung verkündet Margared der Hochzeitsgesellschaft, dass die Stadt verloren ist. Mylio tötet Karnac, doch das Unheil nimmt seinen Lauf, denn die Schleusen sind geöffnet. Große Teile der Stadt sind bereits verwüstet und viele Bewohner ertrunken, da stürzt sich Margared, um Vergebung und Gnade flehend, ins tobende Meer. Mit einem mächtigen „Gloire à Dieu“ des Chors fällt der Vorhang. Diese Oper, eigentlich „Margared d'Ys", denn die Rolle des Königs beschränkt sich auf wenige kleine Auftritte, überzeugt durch klare Handlungsstrategie und eine sehr farbenreiche, dramatische Musikausgestaltung. Mit der Ouvertüre, die die wichtigsten Motive wie in einem Brennglas konzentriert, wird der Hörer in nur zehn Minuten auf das Kommende perfekt vorbereitet – allerdings nicht synchron zum Szenenablauf: Lalo beginnt die Ouvertüre mit dem Vorspiel zum 2. Akt: Wir befinden uns in dem Palast des Königs und nähern uns mit leisen Schritten dem dramatischen Geschehen: Trompetenfanfaren kündigen das nächste Bild an. In der Partitur spielt das Blech übrigens eine besonders wichtige Rolle: Zum ohnehin groß besetzten Orchester gehören 4 Trompeten, 4 Hörner, 3 Posaunen und eine Tuba, die mit dem immer wieder auftauchenden Triolenmotiv die einzelnen Abschnitte strukturieren: Zwischen lyrischen Teilen – da wird zum Beispiel das Duett Margared/Rozenn aus dem 1. Akt zitiert: – bricht immer wieder das Meermotiv mit einem eindrucksvollen Unisono von Streichern und Bläsern durch: Ganz überraschend erklingt ein Zitat aus Richard Wagners „Tannhäuser“, der Beginn des Pilgerchors, und mit einer Stretta im dreifachen Fortissimo endet die Ouvertüre zu „Le Roi d’Ys“.