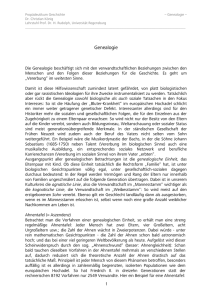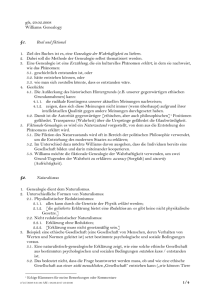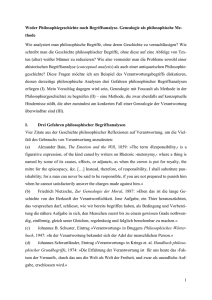MA-Arbeit_Gutachten
Werbung

1 Institut für Philosophie Univ.-Prof. Dr. Georg Stenger Professor für Philosophie in einer globalen Welt / Interkulturelle Philosophie Institutsvorstand An Universitätsstraße 7 (NIG) A-1010 Wien Herrn Kollegen Hans Rainer Sepp und Sekretariat T +43-1-4277-46451 F +43-1-4277-846451 [email protected] http://homepage.univie.ac.at/georg.stenger/ http://philosophie.univie.ac.at/interkultphil Präsident der Gesellschaft für interkulturelle Philosophie (GIP) Köln http://www.int-gip.de/index.html Betreff: Zweitgutachten für Herrn Marcus Hodec Wien, am 19.02.2016 Zweitgutachten zur Masterarbeit „Versuch einer literarischen Genealogie der Macht Justine – Der Prozess – Der Ekel von Herrn Marcus E. Hodec Anliegen und Ziel der Arbeit Die vorliegende Masterarbeit von Herrn Hodec versucht am Leitfaden einer „Typologie der Macht“ eine machtanalytische Sichtweise ins Feld zu führen, die sich als „methodische“ wie systematische Grundierung der genealogischen Zugänge von Nietzsche und Foucault versichern möchte. Erprobt wird dieses Vorhaben anhand einer spezifischen Analyse zu den Werken „Justine oder die Leiden der Tugend“ von Marquis de Sade, „Der Prozess“ von Franz Kafka und „Der Ekel“ von Jean-Paul Sartre, wobei es dem Vf. darauf ankommt, unter dem Vorzeichen machtanalytischer Diskursstrategien diese drei herausragenden Romane 2 sowohl intern wie in ihrer Abfolge jeweils spezifischer machtimprägnierter Stufen einer genalogischen Analyse zu unterziehen. Insbesondere auf drei Ebenen sieht Vf. sein Vorhaben virulent werden, die zugleich eine philosophiekritische Note beinhalten, insoweit man an einem rein begriffsphilosophischen Verständnis festhält. In der Ausarbeitung dieser Ebenen ist vermutlich die besondere Sprengkraft der vorliegenden Arbeit aufzufinden, insoweit diese über ihr internes Analyseanliegen hinaus eine Erweiterung und Vertiefung philosophischer Selbstverständigung insgesamt anstrebt: 1) Die Frage nach dem konstitutiven, ja sich wechselseitig erbringenden, evtl. gar ernötigenden Zusammenhang zwischen Philosophie und Literatur (hier Romanliteratur) 2) Leitende Begriffsscharniere wie „Subjekt(ivität)“, „Macht“, „Geschichte/Geschichtlichkeit“ u.a. werden nicht vorausgesetzt, weder als formale oder gar idealtypische Begrifflichkeiten, noch als Realitätsbestände oder gar als Ursprungsszenarien, sondern hinsichtlich ihrer genealogisch sich erbringenden und hervortreibenden Subjektkonstitution angefragt und im Wechselspiel zwischen „Tiefenhistorizität von Subjektivität“ (119) und „hypothetischer Machtgeschichte“ (7), die sich der Forderung nach der einen Wahrheit entzieht, aufzuweisen versucht. 3) Bei diesem Unterfangen steht jeder Roman gewissermaßen für eine bestimmte „Epoche“, die für eine je spezifische Stufe der Machtanalyse fruchtbar gemacht werden soll. Geschichtlichkeit ist in diesem Sinne nicht ohne ein genalogisches, sprich „historisch-genetisches“ Verfahren zu haben, was erst durch Foucaults Machtanalyse ihre auch philosophische Plausibilität erhält. (Vgl. Schlusskapitel 126ff.) Unter beständigem Rückgriff v.a. auf Martin Saar’s Arbeit „Genealogie als Kritik. Geschichte und Theorie des Subjekts nach Nietzsche und Foucault“ versucht Vf. die drei Romane anhand der Zuschreibungen „Realer Macht“ (Justine), “symbolischer Macht“ (Der Prozess) und „Imaginärer Macht“ (Der Ekel) zu erhellen. Er liest diese Romane aber nicht einfach unter diesen Begriffsrastern, sondern lässt diese Schritt für Schritt aus den literarischen Texten hervortreten, so dass dadurch der/die Roman/e wenn man so will mit „neuen Augen“ zum Vorschein kommt. Das intrinsische Verhältnis von Genealogie und Macht lässt jeglichen Sachverhalt, jede Aussage als jeweiliges „Gewordensein“ ersichtlich werden, was zum einen einen „unsystematischen“ (7, 3 passim), jedweder Systematik vorgängigen Denkgestus zum Vorschein bringt, zum anderen die potentielle Leserschaft selbst mit zum Hervorbringer dessen werden lässt, was Vf. unter einer „literarischen Genealogie der Macht“ anzielt. Durchführung und Beurteilung Scheint auf den ersten Blick der Vf. jeden Roman für sich selbst sprechen zu lassen – die Gliederung des Ganzen legt dies nahe, wenn „Justine“ (8-49), „Der Prozess“ (50-85), „Der Ekel“ (86-119) nacheinander abgehandelt werden, so erweist sich peu à peu, dass die Romane gleichsam ineinander verflochten werden dergestalt, dass die Macht selbst in ihrer genealogischen Ermächtigung im Spannungsfeld zwischen Macht und Moral „Grundpfeiler“ im Sinne von Dispositive ihrer selbst zu Tage fördert. Changieren in „Justine“ Moral und „reale Macht“ in den Verstrickungen zwischen „Starken“ und „Schwachen“, und zeigen diese in all ihrer Drastik Sinnstiftungspotentiale der Macht selbst, was zugleich fundamental an den Festen gesellschaftlicher, sittlich-moralischer wie rechtlich-sozialer Selbstverständigung rüttelt, so offeriert „Der Prozess“ den Kampf zwischen Macht und Ohnmacht, Schuld und Strafe, „Schuldner und Gläubiger“, Individuum resp. Subjekt und Gesetz, was den nicht aufzulösenden „Deutungskampf“ (56) zwischen Josef K. und dem Gesetz einerseits und zwischen J.K. und sich selbst in die „Scham“ als verinnerlichter und leiblich aufsässiger Schuld treibt. Kämpft bei Sade „das Menschliche“ noch mit den „starren Gesetzen der Natur“, denen es gerade ob seines moralischen Anspruchs nicht zu entfliehen vermag, so erscheint dieses Verhältnis bei Kafka jeglicher Grundlage, sprich „Realität“ entzogen, so dass eine „ständig atemraubende Unberechenbarkeit“ und „nicht kalkulierbare“ Schuld an der Irrealität der Macht des Lebens selbst zu zerbersten drohen. (Vgl. v.a. 58f.) „Reale Macht“ wird, wenn man so will, durch „symbolische Macht“ – Verinnerlichung des Gerichts > Schuldigwerden > Schlechtes Gewissen - um eine Stufe tiefer gelegt, was die Realität beschleunigt und aus den überhitzten Geschwindigkeitskurven ihrer selbst zu tragen beginnt. Mit „Der Ekel“ schließlich erscheinen jene Sade’schen wie Kafkaesken Züge auf eine Weise ins Innere und Innerste der Subjektivität selbst 4 eingezogen, sodass im Machtzentrum ihrer selbst ein „Nichts von Loch“ aufklafft, wo keine Stelle noch irgendetwas tragen könnte, geschweige denn ertragen könnte, weder sich, noch andere, weder den Menschen noch die Gesellschaft, weder die Natur noch die Moral, usw. Der objektivierte, sprich nach außen gewendete Ekel im Sinne eines „ich ekele mich vor diesem und jenem“ ist dabei nur das äußere Spiegelbild des in seiner Existenz radikal getroffenen, sprich auf sein „ex-istere“ hin losgelassenes Nichts. Der Protagonist Roquentin hat zu tragen, was nicht zu er-tragen ist, ist er doch nicht mehr nur Opfer, sondern Täter, und damit auch Kritiker der Macht. (vgl. 97ff.) Reale und symbolische Macht sehen sich unterwandert von jener „imaginären Macht“, welche die „körperliche Unterwerfung“ Justines und die „Ordnung des Sagbaren“ Josef K.s (119) in ein Widerfahrnis ihrer selbst treibt, der wiederum eine „objektrelative Subjektkritik“ (115) entspringt, die handeln und wirken kann, d.h. auch als gesellschaftlich und sozial verankertes Subjekt auftreten kann, obwohl oder gerade weil dieses Subjekt eher als eine Art „Disnegativ“ imaginärer Macht zugange ist. Mit den drei Romanen wird hier die Macht in ihrer sie selbst allererst hervorbringenden Genealogie gezeigt, was besonders deutlich hervortritt, wenn wie hier die Macht nicht vom Zentrum aus gesteuert ist – es wären die Leviathans von gestern und heute, es wären dogmatische und statische Machtverständnisse -, sondern eher als ihr eigener Randgänger in den Gestalten des „Sadistischen, Kafkaesken und Ekelhaften“ (112) an den Machtordnungen, Machtgenesen und Machtgenealogien selbst arbeitet und damit seine Wirksamkeit in Gang setzt. Vf. hat diese hier nur angedeutete Komplexität des genealogischen Machtschaffens und seiner Verschiebungen und Verlagerungen sehr plastisch herausgearbeitet, wozu auch ein Schuss sprachlicher Brillanz seinen Beitrag liefert. Ebenso erweist sich sein Bühnenbild-Narrativ als hilfreich, geht es doch mit der „Macht“ um ein sich-Öffnen und inBewegung-Bringen von Zuschreibungsräumen, die ansonsten als eigenständige Begriffsgröße ihre „Negativsemantik“ gegenüber den Umständen, dem Menschen wie der Welt behielte. Passend hierzu wird Nietzsches Schrift „Zur Genealogie der Moral“ an den markanten Stellen so eingeführt, dass deren Zitate wie eine Art Regieanweisung hinter der Bühne die Szene sowohl stützen und justieren als auch inne halten 5 lassen und zugleich forcieren. „Die Genealogie“ spricht nie „von oben herab“, wie es jeder Normativität zu eigen ist, sondern ihr „Also sprach Z. .....“ tönt aus dem „Off“ szenischer Werdeprozesse und deren konstitutiven Machtformierungen. Wollte man hier weiter „im Bild bleiben“, so fungiert Saar eher in der Position des Bühnenbildners, indes Foucault als Regisseur während der Bühnenproben in den hinteren Reihen sitzend den „Beobachter von außen“ gibt. Inspirierend, aber auch etwas schwerfällig wirken sich die Anordnungen und auch die Anzahl (13/11/11) der einzelnen, meist 2-3-seitigen Unterpunkte der Kapitel aus. Die Sachkonsequenz ist ebenso wenig ersichtlich wie die „Logik“ der aufgeführten Punkte. Nun könnte man sagen, es sei geradezu das Besondere des Szenischen, dass es in seiner Originarität austauschbar bleibt, und dennoch wird sich der Roman, will und soll er ein solcher sein, qua Roman dagegen sträuben. Die „ExkursKapitel“ wiederum, jeweils am oder gegen Ende der großen Kapitel platziert, sind weit mehr als bloße „Exkurse“, da sie, v.a. wie beim ersten (44-49: „Welche Farbe hat die Genealogie“), eine Zusammenführung und zugleich einen argumentativ klaren Metadiskurs zum genealogischen Verfahren selbst durchführen. Ich erwähne diesen Punkt auch deshalb, weil er dem sonstigen, an vielen Stellen deutlich zum Vorschein kommenden appellativen und auch suggestiv-thetischen Sprachstil eine wohltuende Argumentationskultur anempfiehlt. Als gewisses Desiderat ließe sich auch die ungebrochene Affirmation sowohl der Nietzsche’schen als auch Saar’schen Arbeit, die so etwas wie den Leitfaden bilden, anmahnen, was nicht selbst reflektiert erscheint, ganz im Unterschied etwa im Umgang mit den Arbeiten Ursula Pia Jauchs. Anders gesagt: man wird und ist gut unterrichtet darüber, was „Genealogie“ meint, aber man weiß nicht, ob es auch zur Genealogie selbst eine Distanz gibt, so wie sie diese selbst auf grundsätzliche Weise „lehrt“. Die ansonsten wohldosierte Einbindung der Sekundärliteratur läuft manchmal auch Gefahr, dass anhand der Zitate argumentiert wird, anstatt diese der eigenen Argumentation und Gedankenführung als Belege beizugeben. Sein ganzes Können und seine besondere Begabung, komplexe Sachverhalte prägnant zu fokussieren, zeigt Vf. in den drei Abschlusskapiteln „Fazit“ (4.1./120-122), „Genealogie als Text“ (4.2./123-125) und „Mit Foucault über Nietzsche hinaus“ (4.3./126-128). 6 Die dort zusammen- und ineinandergeführten Machtanalytiken gewinnen so über ihren „streng relationalen Charakter“ wir ihrer sowohl performativen wie „historisch-sozialen“ Dispositive in der Tat ihre „Topologie“ und damit jene ihr entsprechenden Gegenstände „sadistischer Körper“, „kafkaeskes Wissen“ und „ekelhaftes Subjekt“.(Vgl. 122) 4.2. macht Ernst damit, dass mit dem Lesen das „eigene Selbst“ selbst zum Thema der Lektüre wird, was wiederum – und dies wird mit allen drei Romanen gezeigt - „Wahrheit als politisches Thema“ fassbar werden lässt. 4.3. verleiht dem Roman jene philosophischen Weihen, die Literatur nun auch haben kann, ja vermutlich gar auf eine Weise, die der Begriffsphilosophie verborgen bleiben muss. „Der Roman ist die nicht-selbstreflexive Genealogie. Er weiß alles, nur nicht, dass er Teil seiner Geschichte ist.“ Mehr zu sagen wäre für diese Arbeit weniger. Abschließende Bewertung Die Arbeit von Herrn Hodec schlägt einen hohen Ton an, und dies von Anfang an. So etwas, zumal wenn gar Romane als Herausforderung für die Philosophie angesehen werden, kann leicht schief gehen, aber es kann auch gelingen, dann aber auf eine Art und Weise, dass es mutmaßlich philosophisches Neuland betritt. Obwohl nicht durchweg bestätigt – einzelne Punkte habe ich oben schon kritisch aufgelistet – kann man sagen, dass Vf. dies gelungen ist. Und dass dies schon im Rahmen einer MA-Arbeit möglich ist, lässt für weitere Ergebnisse Einiges erhoffen. Auch sonstige, für eine MA-Arbeit einschlägige Kriterien wie etwa das sinnvolle Heranziehen von und der Umgang mit Sekundärliteratur hat Vf. erfüllt. Bei allen vergleichsweise geringfügigen Desiderate und Monita bleibt festzuhalten, dass dem Vf. eine sehr gute Arbeit gelungen ist und er die mit der Themenstellung und dem Vorhaben verbundenen geradezu auf der Hand liegenden Klippen bravourös umschifft hat. Ich schlage für die vorgelegte Master-Arbeit von Herrn Hodec’s daher ohne jede Einschränkung die Note „sehr gut“ vor. Gesamtnote: „sehr gut“ (1) 7 Univ.-Prof. Dr. Georg Stenger Mit freundlichen Grüßen Univ.-Prof. Dr. Georg Stenger Professor für Philosophie in einer globalen Welt / Interkulturelle Philosophie Vorstand des Instituts für Philosophie