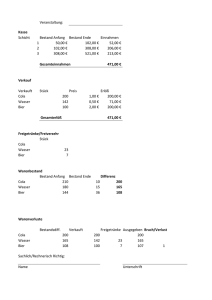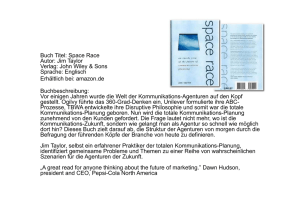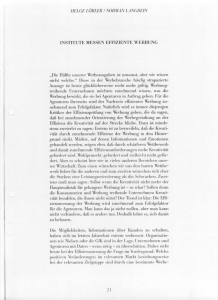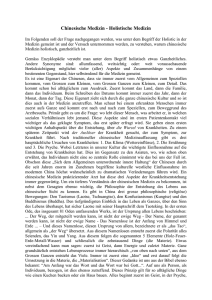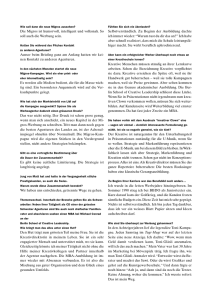Lesen
Werbung

MARKETING DONNERSTAG, 24. JULI 2008 | NR. 142 Hütchenspiele im US-Wahlkampf A merikaner lieben es übersichtlich, und so ist in alten Western made in Hollywood der Held zuverlässig am hellen Hut zu erkennen. Egal, wie der Plot läuft, der Kerl mit der schwarzen Kopfbedeckung ist fast immer der Bösewicht. Am Ende gibt es eine große Schlägerei, die der hell Behütete knapp gewinnt. Der Finsterling landet im Staub. Im richtigen Leben hat nun der dunkle Typ gewonnen. Auch im US-Wahlkampf gab es ein Scharfschießen PETER LITTMANN Partner der Markenberatung Brandinsider und Professor in Witten/Herdecke der demokratischen Bewerber Hillary Clinton und Barack Obama, aus dem der Dunkelhäutige siegreich hervorging. Unter den politischen Analysten kam das eine Lager zu dem Schluss, Hillarys Niederlage habe vor allem an ihrer wenig schlauen Wahlkampfstrategie gelegen. Das andere hingegen meinte, Barack habe eben den Krieg ums Image gewonnen. Demnach waren Design und Marketing ausschlaggebend, nicht Inhalte. Man könnte es auch so sagen: Offenbar ging es wieder um den schönsten Hut und nicht so sehr um den Kopf darunter. Vielen Deutschen wird es spätestens jetzt unbehaglich. „Verkaufen wie Zahnpasta?“ lautet die in diesem Kontext stets fallende Suggestivfrage, die nahelegt, dass Reklame und Marketing für Politik pfui sind. Das ist verständlich, wenn man weiß, dass Adolf Hitler das Wort „Führer“ markenrechtlich schützen ließ. Hakenkreuz, Uniformen und das Image der Partei wurden ebenso sorgfältig gestaltet wie die politische Propaganda aus dem Hause Goebbels. Nach 1945 waren offensive Wahlkämpfe entsprechend unmöglich, Konrad Adenauer setzte noch 1957 auf den Slogan „Keine Experimente!“, den er schon aus der Reichstagswahl von 1932 kannte. Noch 1960 schimpften deutsche Politologen „Wahlkampfentartung“, wenn Parteien an die Gefühle der Wähler appellierten, statt Sachinformationen zu liefern. Im gleichen Jahr gewann allerdings John Kennedy die US-Wahl, weil sein Gegner Richard Nixon in einem TV-Duell so „unrasiert“ und daher „finster“ ausgesehen habe. Die Zuschauer nahmen offenbar wahr: ein dunkler Hut! Folgerichtig siegte der mit dem hellen, was in der Politik gerne Charisma genannt wird, das klingt vornehmer. 2008 jedoch hat das Internet die Glotze als das Medium der Wahl abgelöst. John Edwards tauchte als Erster auf Youtube auf, Clinton verkündete ihre Kandidatur online, Obama schuf seine persönliche Version von MySpace mit „MyBarackObama“. Fast alle Websites sind in Weiß-RotBlau gehalten wie die amerikanische Fahne. Nur Veteran John McCain präsentiert sich unter einem militärisch wirkenden Stern mit gelben Streifen, die wohl an die Schulterstücke einer Uniform gemahnen sollen. Tatsächlich erinnern sie an den mit einem gelben Balken gebrandeten Auftritt des kanadischen Unternehmens McCain, das Tiefkühl-Pommes verkauft. Welche Marke werden die Amerikaner also kaufen im November? Wenn es stimmt, dass der künftige Chef der Supermacht vor allem „leader in the image war“ sein muss, wie die „International Herald Tribune“ nahelegt, hat McCain keine Chance. Obamas Slogan „Yes we can“ ist schon zur Redewendung geronnen, sein Auftritt ist durchgestylt wie der von Coca-Cola. Seine Gegner setzen auf die traditionelle Weisheit, immer gleich auszusehen, was den Wiedererkennungswert erhöht. Obama hingegen umarmt die Fraktalisierung des Web 2.0 und schneidet den Auftritt speziell auf die jeweils angesprochene Zielgruppe zu. Die Logik dahinter lautet: In der Kakofonie der Medien hören wir nur noch das, was uns persönlich anzusprechen scheint. Also gibt es nicht nur „Kids for Obama“ oder „Environmentalists for Obama“, sondern auch Auftritte für einzelne US-Bundesstaaten. Dank eines „O“ als Logo ähneln sie sich genug, um wiedererkennbar zu sein, sind jedoch im Stil ansonsten diversifiziert genug, um an die einzelnen Wählergruppen zu appellieren. Und die Inhalte? Ach, die Inhalte. Die sind nicht so sehr die Frage, auf das Hütchen kommt es an! [email protected] ACHTUNG, KAMPAGNE! Der, die, das Cola? Das Slogan sorgt für Irritation: „Das Cola von Red Bull“ prangt es auf Werbeplakaten, die derzeit viele deutsche Städte zieren. Das Cola? Was für ein Quatsch, die Cola heißt das, DIE Cola. Sollten die Marketingexperten des Getränkeherstellers tatsächlich nicht in der Lage sein, den treffenden Artikel für ihr neuestes Produkt zu finden? Oder ist es vielmehr so, dass sie sich mit einem bewusst falsch gewählten Artikel in ihrer Werbung von dem Platzhirsch Coca-Cola abgrenzen wollen? Das erinnert ein wenig an eine Bierreklame, die mit einem ähnlich schrägen Artikel bereits seit vielen Jahren höchst erfolgreich ist: König Pilsener bewirbt sein Gebräu mit „Das König der Biere“. Der König, wie es in der deutschen Sprache korrekt heißen würde, konnte das Unternehmen damals nicht schreiben, denn diese Überhöhung wäre irreführende Werbung und damit unzulässig gewesen. In der Brauerei selbst sieht man es allerdings anders: „Das König der Biere“ sei selbstverständlich grammatikalisch richtig. König sei die Marke, nicht die Person. Man könne auch sagen: Das König-Pilsener der Biere. Ein Erklärungsversuch, immerhin. Eines ist jedoch gewiss: Die Aufmerksamkeit, die eine Marke mit solchen schrägen Claims auf sich zieht, ist nicht gering. Im Übrigen sieht sich auch Red Bull grammatikalisch völlig im Recht. Denn in Österreich, dem Heimatland des Energiegetränks, sollen die Menschen an der Kasse tatsächlich „das Cola“ verlangen. bia Gummiparagrafen und Selbstzensur Das strenge chinesische Werbegesetz stellt die internationalen Agenturen vor große Probleme LU YEN ROLOFF | PEKING Das Plakat zeigt ein Meer aus Abertausenden Chinesen. Im Vordergrund klettern die Menschen übereinander und bilden mit ihren Körpern einen menschlichen Sprungturm, darauf steht der chinesische Turmspringer Hu Jia. Die Olympiakampagne des Sponsors Adidas appelliert in den U-Bahn-Stationen Pekings unverhohlen an das chinesische Nationalgefühl. Mit der Kreation gewann die Werbeagentur TWBA Shanghai im Juni als erste chinesischstämmige Agentur einen goldenen Löwen in Cannes: ein Meilenstein für die chinesische Werbebranche, die wie die Medienbranche durch die staatliche Zensur eingeschränkt wird. Der noch junge Werbemarkt in der Volksrepublik China, der mit 43 Mrd. US-Dollar Werbeausgaben immerhin der weltweit drittgrößte nach den USA und Japan ist, wird seit 1994 durch das Werbegesetz der State Administration of Industry and Commerce (SAIC) reguliert. Danach dürfen Werbungen weder nationale Flaggen, Embleme oder die Hymne der Volksrepublik China verwenden. Tabu sind zudem vergleichende Werbung und Superlative. Das Gesetz soll eine Irreführung der Bevölkerung verhindern – eine Reaktion auf Studien, nach denen Chinesen Werbesprüche sehr viel wörtlicher als die medienerfahreneren Kunden im Westen nehmen. Doch viele Paragrafen des Werbegesetzes sind schwammig formuliert und werden nur schrittweise durch konkretere Ausführungen ergänzt. „Das Gesetz befindet sich wie der Markt selbst in ständiger Veränderung“, sagt Zhihong Gao, Expertin für chinesisches Werberecht an der US-amerikanischen Rider University. Für Werbeagenturen erschwere dieser schnelle Wechsel allerdings die Orientierung. Besonders problematisch ist für internationale Werbeagenturen Artikel 3 des Werbegesetzes, nachdem Produktwerbung den „sozialistischen, kulturellen und ideologischen Entwicklungsprozess“ der Chinesen unterstützen und jede Bedrohung der „sozialen Stabilität“ vermeiden soll: Die vagen Formulierungen unterstehen der praktischen Auslegung durch die Chinese Advertisement Association (CAA). Der einzige Ver- Plakatwerbung des Getränkeriesen Coca-Cola zu den Olympischen Spielen 2008 in Peking: Im August startet das sportliche Großereignis, dessen herausragender Sponsor der US-Getränkekonzern mit dem rot-weißen Logo ist. Foto: action press MARKEN-ZEICHEN | 19 band der Werbewirtschaft in China genehmigt die Entwürfe der Agenturen und agiert als Zensurbehörde. „Wir lassen eine TV-Kampagne mehrfach durch die CAA prüfen“, berichtet Kathrin Guethoff, Kreativdirektorin der internationalen Netzwerkagentur Interone in Peking. „Zunächst die Storyboards, nach den Dreharbeiten das Rohprodukt und schließlich die ersten Ausstrahlungen der Kampagne.“ Die Änderungswünsche beträfen zumeist Details wie die geforderte Einblendung von chinesischen Untertiteln bei englischer Musik, doch durch die häufige Abstimmung fühlt sich die Deutsche „schon sehr eingeschränkt und kontrolliert“. Sie wirft der Kontrollinstanz Willkür vor: „Ich sehe zum Beispiel eine chinesische Shampoowerbung, in der ein dünnes Tuch an einem nackten Körper vorbeistreicht und frage mich: Wie haben die das durch die Zensur bekommen?“ Ein weiterer unberechenbarer Faktor sind die Konsumenten selbst. Auf Druck der Öffentlichkeit können bereits genehmigte Kampagnen zensiert werden, weiß Daniel Lim aus eigener Erfahrung. Als in Peking ansässiger Executive Director bei der Werbeagentur Saatchi & Saatchi betreute er 2003 die Kampagne, die zum Präzedenzfall für die kulturellen Probleme UNTERNEHMENSPRAXIS MO FAMILIENUNTERNEHMEN DI STRATEGIE MI RECHT & STEUERN DO MARKETING FR MANAGEMENT internationaler Agenturen im chinesischen Markt wurde. In dem Spot verneigten sich traditionelle chinesische Steinlöwen vor einem Landcruiser der japanischen Marke Toyota. Tausende Chinesen protestierte gegen die „Erniedrigung“ nationaler Symbole gegenüber der ehemaligen Besatzungsmacht. Die Regierung setzte die Kampagne daraufhin ab. Das gleiche Schicksal ereilte in den Folgejahren auch Kampagnen von McDonald’s, Nike und dem Farbhersteller Nippon. Auch hier waren Proteste von Chinesen in Internetforen und Blogs die Auslöser. „Die Regierung vermeidet alles, was größere Gruppen unzufrieden stimmt“, erklärt die Chinesin Conny Chan* die Ratio, nach der sie selbst die Zensurangelegenheiten einer großen Pekinger Werbeagentur regelt. Internationale Agenturen setzen angesichts der Restriktionen zunehmend auf Selbstzensur. „Gerade aus- ländische Kreative verzichten inzwischen auf den ironischen und humorvollen Umgang mit nationalen Symbolen wie Drachen, chinesischen Mythen und Helden“, erzählt Saatchi&-Saatchi-Werber Lim. Die Agenturen ließen lieber vorgreifend ihre Slogans und die gesamte Stoßrichtung der Kampagne absegnen, als das Risiko von millionenschweren Verlusten einzugehen. Beinahe jede Agentur beschäftigt für die Kommunikation mit der CAA eine hausinterne Zensurabteilung oder gibt diese Arbeit an externe Dienstleister. Zudem erhöhen große Agenturen wie Interone und die TWBA von Jahr zu Jahr den Anteil chinesischer Mitarbeiter, womit eine weitere Sinisierung der Werbebotschaften einhergeht. *Name geändert Die Redaktion dieser Seite erreichen Sie unter: [email protected] Ältere Kunden sind unzufrieden mit ihrer Bank Studie des Meyer-Hentschel-Instituts attestiert Bankhäusern fehlendes Engagement gegenüber Senioren CATRIN BIALEK | DÜSSELDORF Viele ältere Konsumenten fühlen sich anscheinend nicht als vollwertige Bankkunden. Zu diesem niederschmetternden Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Meyer-Hentschel-Instituts in Saarbrücken, das seit Mitte der 80er-Jahre das Konsumverhalten älterer Menschen erforscht und als Begründer des Seniorenmarketings gilt. Das Institut befragte in Kooperation mit der Internetplattform Feierabend.de, der nach eigenen Angaben größten deutschen Online-Community für Senioren, rund 890 Konsumenten. Deren Durchschnittsalter betrug 61 Jahre. Die Studie stellt fest: In der Betreuung ihrer älteren Kunden haben viele Banken offensichtlich noch nicht die Zeichen der Zeit erkannt. So wünschen sich 61,9 Prozent der befragten Senioren, von ihrer Bank als „vollwertiger Kunde“ behandelt zu werden. Erheblicher Nachholbedarf besteht nach dieser Untersuchung auch im Hinblick auf die Beratungsqualität der Bankhäuser: 78,5 Prozent der Befragten wünschen sich „Beratung, die absolut klar und verständlich ist“. „Es macht nachdenklich, wie gering offensichtlich das Engagement vieler Banken für ihre älteren Kunden ist“, sagt Gundolf Meyer-Hentschel, Gründer des Instituts und Initiator © Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an [email protected]. der Umfrage. Viele Banken hätten es bis jetzt versäumt, sich auf eine angemessene Betreuung der wachsenden Zahl älterer Kunden vorzubereiten. Auch die weiteren Kritikpunkte machen auf den Nachholbedarf der Geldinstitute aufmerksam: So wünschen sich 35,6 Prozent der Befragten mehr Diskretion bei der Abwicklung ihrer Bankgeschäfte und 24,2 Prozent mehr Freundlichkeit der Bankmitarbeiter. Aber auch an die Marketingabteilungen und Werbeagenturen richtet sich ein Teil der Kritik: 27,1 Prozent der befragten Senioren erwarten „besser verständliche Broschüren“. Und: 19,6 Prozent würden sich über mehr Sitzmöglichkeiten in den Bankfilialen freuen, 16,1 Prozent fordern besser lesbare Kontoauszüge und Überweisungsträger und 14,2 Prozent einfacher zu bedienende Geldautomaten. Im internationalen Vergleich gehört Deutschland zu den Ländern mit der ältesten Bevölkerungsstruktur: Das zahlenmäßige Verhältnis zwischen älteren und jüngeren Menschen wird sich in den nächsten Jahren drastisch verschieben. Bis zum Jahr 2050 werden die Menschen im Alter von 58 bis 63 Jahren zu den am stärksten besetzten Jahrgängen gehören. Dann wird es, so die Schätzungen, mehr als doppelt so viele ältere als junge Menschen geben.