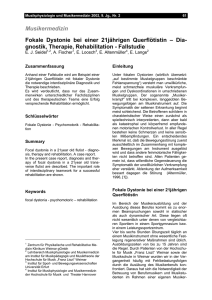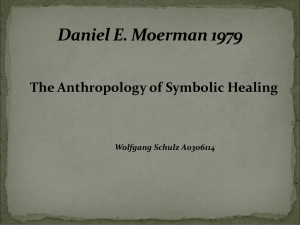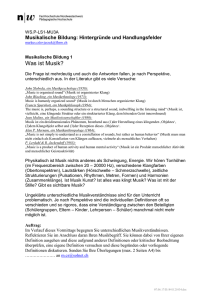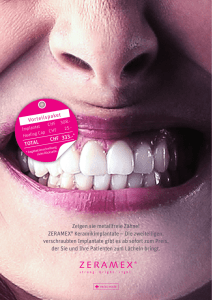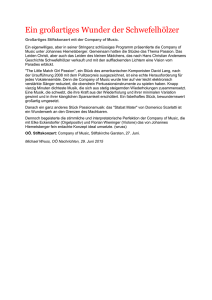Microsoft Office Word - Esch 42003
Werbung
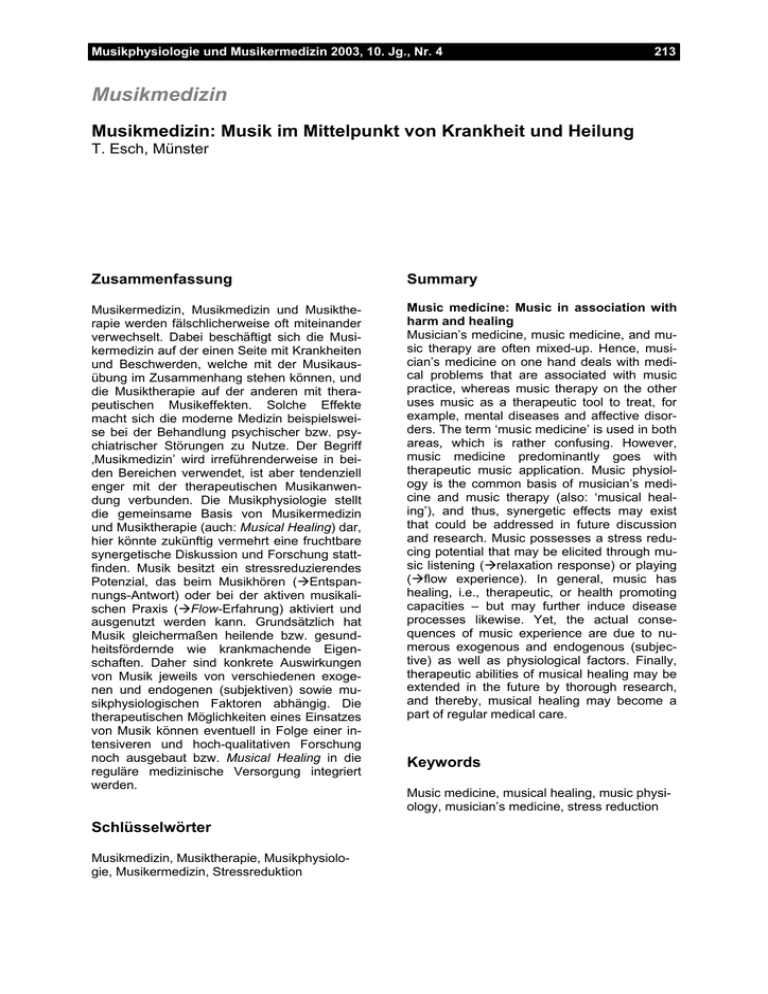
Musikphysiologie und Musikermedizin 2003, 10. Jg., Nr. 4 213 Musikmedizin Musikmedizin: Musik im Mittelpunkt von Krankheit und Heilung T. Esch, Münster Zusammenfassung Summary Musikermedizin, Musikmedizin und Musiktherapie werden fälschlicherweise oft miteinander verwechselt. Dabei beschäftigt sich die Musikermedizin auf der einen Seite mit Krankheiten und Beschwerden, welche mit der Musikausübung im Zusammenhang stehen können, und die Musiktherapie auf der anderen mit therapeutischen Musikeffekten. Solche Effekte macht sich die moderne Medizin beispielsweise bei der Behandlung psychischer bzw. psychiatrischer Störungen zu Nutze. Der Begriff ‚Musikmedizin’ wird irreführenderweise in beiden Bereichen verwendet, ist aber tendenziell enger mit der therapeutischen Musikanwendung verbunden. Die Musikphysiologie stellt die gemeinsame Basis von Musikermedizin und Musiktherapie (auch: Musical Healing) dar, hier könnte zukünftig vermehrt eine fruchtbare synergetische Diskussion und Forschung stattfinden. Musik besitzt ein stressreduzierendes Potenzial, das beim Musikhören (ÆEntspannungs-Antwort) oder bei der aktiven musikalischen Praxis (ÆFlow-Erfahrung) aktiviert und ausgenutzt werden kann. Grundsätzlich hat Musik gleichermaßen heilende bzw. gesundheitsfördernde wie krankmachende Eigenschaften. Daher sind konkrete Auswirkungen von Musik jeweils von verschiedenen exogenen und endogenen (subjektiven) sowie musikphysiologischen Faktoren abhängig. Die therapeutischen Möglichkeiten eines Einsatzes von Musik können eventuell in Folge einer intensiveren und hoch-qualitativen Forschung noch ausgebaut bzw. Musical Healing in die reguläre medizinische Versorgung integriert werden. Music medicine: Music in association with harm and healing Musician’s medicine, music medicine, and music therapy are often mixed-up. Hence, musician’s medicine on one hand deals with medical problems that are associated with music practice, whereas music therapy on the other uses music as a therapeutic tool to treat, for example, mental diseases and affective disorders. The term ‘music medicine’ is used in both areas, which is rather confusing. However, music medicine predominantly goes with therapeutic music application. Music physiology is the common basis of musician’s medicine and music therapy (also: ‘musical healing’), and thus, synergetic effects may exist that could be addressed in future discussion and research. Music possesses a stress reducing potential that may be elicited through music listening (Ærelaxation response) or playing (Æflow experience). In general, music has healing, i.e., therapeutic, or health promoting capacities – but may further induce disease processes likewise. Yet, the actual consequences of music experience are due to numerous exogenous and endogenous (subjective) as well as physiological factors. Finally, therapeutic abilities of musical healing may be extended in the future by thorough research, and thereby, musical healing may become a part of regular medical care. Schlüsselwörter Musikmedizin, Musiktherapie, Musikphysiologie, Musikermedizin, Stressreduktion Keywords Music medicine, musical healing, music physiology, musician’s medicine, stress reduction 214 T. Esch – Musikmedizin: Musik im Mittelpunkt von Krankheit und Heilung Einleitung Musik und Medizin – diese beiden Begriffe haben für viele Menschen wohl wenig miteinander gemeinsam. Entgegen der allgemeinen Auffassung, dass Medizin nur mit Krankheiten und deren Behandlung, Musik dagegen mit einem durchweg positiven Erleben und Wohlbefinden in Verbindung zu bringen ist, kann sich jenes Verhältnis auch in umgekehrter Weise offenbaren: Medizin wird heute vermehrt mit salutogenetischen bzw. gesundheitstheoretischen Aspekten assoziiert (Stichwort: Prävention) [7], während Musik durchaus krank machen kann. Dieses gilt nicht nur für die Beeinträchtigung des Hörvermögens infolge einer von Musik u. U. ausgehenden Lärmbelastung (Konzertveranstaltungen, Disco-Besuch, Walkman etc.), sondern ebenso und in besonderem Maße im Zusammenhang mit der Musikausübung (Stichwort: Musikerkrankheiten). Der Begriff und das medizinische Teilgebiet der Musikermedizin zeugen deutlich von einer solchen Korrelation. Musik und Medizin besitzen folglich sehr wohl Überschneidungen. Nun – in einer Fachzeitschrift für Musikermedizin muss auf die wachsende Bedeutung der Musikermedizin und das sich verbreiternde bzw. vertiefende Bewusstsein für krankmachende Einflüsse und medizinische Probleme, welche mit der Musikausübung in Verbindung stehen, nicht grundsätzlich näher eingegangen werden. Stattdessen wollen wir uns im Kontext der verkürzenden Frage, ob Musik „krank oder gesund“ macht, im wesentlichen dem letztgenannten Berührungspunkt zwischen Musik und Medizin zuwenden, d.h. das gesundheitsfördernde oder therapeutische Potenzial von Musik (ÆMusiktherapie) genauer analysieren. Dabei kommt es uns auch darauf an, die Musikphysiologie gewissermaßen als die Schnittmenge bzw. übergeordnete gemeinsame Basis von Musikermedizin und Musiktherapie herauszuarbeiten, um solcherart auf Gemeinsamkeiten zwischen beiden Feldern hinzuweisen. In der Folge können so vielleicht gegenseitige Ressentiments sowie unnötige – d.h. künstliche – und gelegentlich auch sachlich falsche Abgrenzungsbemühungen entschärft werden, während gleichzeitig die eindeutig zu unterscheidenden Bezugspunkte und Ansätze von Musikermedizin und Musiktherapie deutlich werden sollten. Um es klar zu sagen: Musikermedizin und Musiktherapie sind substanziell verschieden, besitzen aber dennoch sich z.T. überschneidende Fragestellungen, insbesondere im Bereich der Musikphysiologie, weswegen möglicherweise synergetische Effekte durch eine offene und fruchtbare Diskussion zu erzielen sind bzw. sichtbar und nutzbar gemacht werden können. Aus Sicht der Musi- kermedizin ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass in diesem Zusammenhang Begrifflichkeiten nicht durcheinander geraten. Aus jenem Grund wird im Folgenden hauptsächlich auf musiktherapeutische Ansätze erklärend eingegangen, da diese dem musikermedizinisch orientierten Auditorium möglicherweise nicht so geläufig sind. Schließlich ist eine begriffliche Abgrenzung hier gleichwohl nötig und unvermeidbar, denn z.B. der Terminus Musikmedizin wird in beiden Bereichen teilweise synonym (aber mit unterschiedlicher Intention) verwandt. So ist eine Verwirrung entstanden, welche auch in der jeweiligen Literatur fortlaufend tradiert wird. Musik als Heilmittel Der Mensch besitzt wahrscheinlich als einzige Spezies – neben der Sprache – ein zweites, sehr differenziertes phonetisches und klangvolles Kommunikationssystem: die Musik. Dabei verfügt praktisch jede menschliche Kultur über ihre eigene Musik. Die ersten Musikinstrumente wurden wohl vor über 35000 Jahren als primitive Knochenflöten, Maultrommeln und Schlaginstrumente konstruiert [2]. Bereits 4000 Jahre v. Chr. haben ägyptische Priester Klänge und Musik zur Heilung eingesetzt. Im Mittelalter gehörte die Musik zu den sieben Künsten, welche jeder zukünftige Arzt zu studieren hatte. Arabische Krankenhäuser beschäftigten Harfen- und Gitarrenspieler sowie Perkussionisten. Heute noch sind Musik und Bewegung unverzichtbare Bestandteile von Heilungszeremonien der australischen Aborigines, afrikanischer Stämme sowie traditionell lebender Völker in Südamerika. Die Geschichte der Musik mit ihren kommunikativen Elementen ist immer auch verbunden gewesen mit ihren Wirkungen auf Geist, Seele und Körper. Musik wurde und wird aber nicht nur zum sprachlichen, sondern eben auch zum emotionellen Ausdruck verwandt. Mithin besitzt die Musik eine starke Kraft, welche sich Heiler und Heilsuchende immer wieder zu Nutze gemacht haben. Trotz der langen Geschichte des Einsatzes von Musik zum Zwecke der Heilung hat sich die oben beschriebene, vormals generelle Anwendung musikalischer Heilmittel über die Zeit bedeutend gewandelt. In der intellektualisierten bzw. rationalistischen und informierten westlichen Welt unserer Tage haben Arzneien die Oberhand gewonnen und „Wissenschaft“ (ÆEvidenz) ist die entscheidende Messlatte geworden [7]. Eindrucksvolle pharmazeutische Entwicklungen und Inventionen konnten sich in „plazebokontrollierten, doppelt-verblindeten, randomisierten Studien“ behaupten. So „ver- Musikphysiologie und Musikermedizin 2003, 10. Jg., Nr. 4 staubte“ bzw. veraltete die Musica Humana zusehends und verschwand nahezu vollständig aus dem allgemeinen und medizinischen Bewusstsein – bis vor kurzem. Das moderne Konzept der Musik als therapeutisches Hilfsmittel entwickelte sich vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, als z.B. amerikanische Musiker in die Veteranen-Krankenhäuser gingen, um für verletzte amerikanische Soldaten zu spielen. Auch in Europa gab es eine ähnliche Tradition des Einsatzes von Musik in Hospitälern, hier insbesondere in christlichen Häusern. Die Popularität von Musik als Teil des Behandlungsregimes bei physischen und psychischen Beeinträchtigungen nahm in der Folge langsam zu, wenngleich mit unterschiedlichem Tempo in den verschiedenen Ländern und Regionen. Das erste universitäre Programm zur Ausbildung von professionellen Musiktherapeuten lief im Jahre 1944 in den U.S.A. an der Michigan State University an [10]. Gegenwärtig spielt Musik wieder eine wichtigere Rolle im allgemeinen medizinischen Zusammenhang. Verschiedene Curricula für Musiktherapie existieren und mehrere professionelle sowie nicht-professionelle MusiktherapieGesellschaften werben um Mitglieder. Dabei besteht Musiktherapie heute aus weit mehr als lediglich dem passiven Hören von Musik. Sie kann auch das Schreiben/Komponieren von Liedern, Liedtextinterpretationen, aktives Musizieren und Improvisieren sowie andere musikbezogene Aktivitäten beinhalten. In der sogenannten „rezeptiven Musiktherapie“ hören Patienten Musik, welche möglicherweise Erinnerungen und Assoziationen – ggf. mit Krankheitswert – zu wecken vermag. Derartige Inhalte können nun in einer anderen, geschützten oder einfach angenehmen Weise neu erlebt werden. Dagegen produzieren Patienten in der „aktiven Musiktherapie“ selbst musikalische Klänge und Phrasen, wozu sie beispielsweise auf Instrumenten ihrer Wahl improvisieren und solcherart neue Wege der Kommunikation beschreiten. Verborgene Gefühle und Emotionen sowie „Unausgesprochenes“ können jetzt vielleicht nach außen transportiert werden, die Musik – und auch einfache Rhythmen – dienen so eventuell als Ersatz-Vehikel, welches, vermeintlich unpersönlich und außenstehend, das Auftreten von (erneuten) Verletzungen bei einer „Offenbarung“ unwahrscheinlich erscheinen lässt. Auch kann die Musik schlicht ein unmittelbares und therapeutisch wertvolles Wohlgefühl hervorrufen oder ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Das Beherrschen musikalischer Techniken ist demnach nicht notwendigerweise Teil musiktherapeutischer Ansätze. Allerdings kommen beim Musizieren im Rahmen der aktiven Musiktherapie musikphysiologische Aspekte zum Tragen, die in gleicher 215 Weise auch Gültigkeit bei der professionellen musikalischen Praxis besitzen: Musikmedizin bzw. Musiktherapie und Musikermedizin liegen hier eng beieinander. Auch ohne musikalische Vorerfahrungen kommen demnach bei der therapeutischen Musikausübung Erfahrungen und Erkenntnisse der Musikphysiologie und Musikermedizin zur Anwendung. Für gesunde Menschen wird Musik/Musiktherapie oftmals als Bestandteil eines Stressmanagement-Programms oder in Verbindung mit körperlichen Übungen empfohlen. Dieses mag damit zusammenhängen, dass der Musik die Fähigkeit zuerkannt wurde, die Stresshormon-Ausschüttung bzw. das physiologische Stress-Niveau in stressreichen Situationen zu reduzieren [22]. Auch konnten wissenschaftliche Untersuchungen demonstrieren, dass Musik in der Lage ist, gerade in Konfrontation mit Stress (Stressoren), die Blutkonzentrationen von Endorphinen und Endocannabinoiden zu erhöhen, womit letztlich Gefühle von Entspannung und Wohlbefinden befördert werden [21,22]. Musik kann folglich sehr wohl als ein effektives Instrument zur Beruhigung und Stressreduktion in geeigneten Situationen eingesetzt werden. Jedoch hängt es offensichtlich von der individuellen Musikpräferenz und ggf. von musikalischen Vorerfahrungen (auch: Hörerfahrungen) ab, welche konkrete physiologische bzw. vegetative Situation mittels Musik erzeugt werden kann. Ebenso spielt sicher die momentane Verfassung des Musikhörenden eine Rolle [20]. Insbesondere im Bereich der professionellen oder semiprofessionellen Musikausübung kann durch das z.T. intensive Musikerleben möglicherweise eine starke vegetative Reaktion (angenehm oder unangenehm, je nach musikalischer Präferenz) hervorgerufen und u.U. auch erwartet werden: das Gegenteil von Stressreduktion kann die Folge sein [20]. In Hinblick auf Patienten und aktuelle medizinische Fragestellungen wird die Musiktherapie hauptsächlich zur Behandlung von neurotischen und psychotischen Störungen eingesetzt, d.h. bei geistigen und seelischen Erkrankungen, inklusive der Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen (siehe unten). Ein Ziel ist dabei, die Bewältigungskompetenz der Patienten zu erhöhen und die verhaltensabhängige bzw. mentale Fähigkeit zur besseren Entwicklung und Ausgestaltung der eigenen Persönlichkeit zu stärken [10]. Es ist somit nachvollziehbar, warum die Musiktherapie als professionelle medizinische Methode heute der kognitiven Verhaltenstherapie zugeordnet wird, mithin ein Werkzeug der psychosomatischen Medizin und Psychotherapie [10]. Allerdings muss festgestellt werden, dass die Wurzeln der Musiktherapie und ihre Möglichkeiten weit über die der originären Psychotherapie hinaus- 216 T. Esch – Musikmedizin: Musik im Mittelpunkt von Krankheit und Heilung reichen und dass der Terminus „Musiktherapie“ inzwischen Gefahr läuft, Musik im therapeutischen Kontext auf einen limitierten Ansatz einseitig zu reduzieren. Diese Entwicklung hat erst kürzlich stattgefunden, und es sollte daher nicht vergessen werden, dass verschiedene Ansätze existieren, welche Musik als Heilmittel in den Mittelpunkt stellen. Sie alle haben die gleiche Wurzel: Musical Healing (Heilung durch Musik) kann als ein eher allgemeiner Begriff bzw. Oberbegriff aufgefasst werden, welcher alle gesundheitsfördernden Eigenschaften und Fähigkeiten – eben das heilende Potenzial – von Musik zusammenfasst. Mit anderen Worten, Musiktherapie beschreibt heute eine Form des kognitiv-psychologischen bzw. verhaltenstherapeutischen Arbeitens, welche Musik u.a. als ein mögliches Element einsetzt, wohingegen Musical Healing den zugrunde liegenden Mechanismus, d.h. das Wesen bzw. den Kern der Musiktherapie, beschreibt. Es werden dabei allein die Musik und ihre Implikationen betrachtet. Letztlich sind jedoch beide Umschreibungen Teil eines Gesamtbildes. Wir werden uns im Folgenden hauptsächlich mit Musical Healing beschäftigen und diesen Terminus weiter verwenden, da wir möglichst wertfrei die physiologischen Konsequenzen von Musik innerhalb des medizinischen Kontexts – und hier insbesondere bei psychischen Störungen – analysieren wollen. Dabei hat sich der Begriff Musical Healing im amerikanischen Sprachgebrauch zwischenzeitlich etabliert [10]. Er ist aber nicht ohne Schwierigkeiten und Gefahr der Fehldeutung ins Deutsche zu übersetzen: Leider hat bei uns über die letzten 50 Jahre der Terminus „Heilung“ (bzw. „Heilen“, „Heiler“) im wissenschaftlich-medizinischen Bereich eine negative semantische Umdeutung erfahren. Wir bleiben daher vorerst bei der etwas sterilen amerikanischen Form und überlassen eine Übersetzung der Bezeichnung Musical Healing dem Leser. Die Bedeutung psychosomatisch-psychiatrischer Störungen scheint, zumindest in den westlichen Industrienationen, zuzunehmen [7,8], welches auch einer verbesserten Diagnostik bzw. einem gestiegenen Bewusstsein für psychische Probleme in der Bevölkerung geschuldet sein kann. Dieses ist einer der Gründe, warum wir uns nun ebenfalls auf jenes Gebiet konzentrieren. Auch spielen psychische Störungen und Funktionseinschränkungen (Depressionen und „Stimmungsprobleme“, Angst/Aufführungsängste, leistungsbezogene Probleme) im Bereich der (semi)-professionellen Musikausübung eine große Rolle [20]. So eignet sich dieser Komplex evtl. besonders gut, um musiktherapeutische Strategien und Ansatzpunkte dem musikermedizinischen Publikum näher zu bringen. Viele Menschen bzw. Patienten mit psychiatrischen oder psychischen Krankheiten und Störungen haben mit eingeschränkten Fähigkeiten zur Krankheitsbewältigung bzw. einer mangelhaften Coping-Kommunikation zu kämpfen. Zusätzlich kann auch die Qualität von Sozialisation (Æ„soziales Netz“) und sprachlichkommunikativem Ausdruck gemindert sein, welches dysfunktionales Verhalten sowie negative/unzweckmäßige kognitive und emotionelle Reaktionsmuster mit bedingen kann [4]. Therapeutische Musik (Musical Healing) bietet hier möglicherweise einen sinnvollen, nichtinvasiven Ansatz, um die beschriebenen Fähigkeiten und Einschränkungen günstig zu beeinflussen sowie das Verhalten positiv zu modifizieren [10]. So kann Musik eine Rolle bei moderaten bzw. funktionellen therapeutischen Lebensstilveränderungen spielen (auch im Rahmen von entsprechenden Programmen: Lifestyle Modification Programs) wie auch in der Behandlung schwerer psychiatrischer Erkrankungen und Beeinträchtigungen. Letzteren werden wir uns jetzt zuwenden. Musikanwendungen schen Störungen bei psychi- Das Hören einer Lieblingsmusik kann eine großartige Möglichkeit zum „Abschalten“ sein. Aber die wohltuenden und therapeutischen Möglichkeiten von Musik erschöpfen sich nicht allein in der Hilfe zum Entspannen am Ende eines geschäftigen Tages: Musical Healing kann Teil einer modernen Gesundheitsfürsorge sein (ÆMusikmedizin), welcher sich dem Gebrauch von Musik zur Verbesserung emotioneller, psychischer, physischer, funktioneller und/oder auch erzieherischer Funktionen und „Grundstimmungen“ verschrieben hat [10]. Musik kann somit bei einer Vielzahl von Ausgangslagen, Konditionen und in sehr unterschiedlichem Umfeld zum Einsatz kommen. Musik ist zusätzlich zur Standardtherapie inzwischen bei vielen psychiatrischen Krankheiten angewendet worden. Dabei war es jeweils das zentrale bzw. primäre Anliegen, das allgemeine Wohlbefinden, die Stimmung und ggf. den momentanen Zustand oder Schweregrad der behandelten Erkrankung mittels Musik günstig zu beeinflussen [11-16,18]. Positive Wirkungen konnten der Musikanwendung so insbesondere nachgewiesen werden bei - akuten und chronischen Schmerzsyndromen, Schmerzmanagement - Migräne - Hirnverletzungen (mit psychischen Folgeschäden), Koma, terminaler Pflege Musikphysiologie und Musikermedizin 2003, 10. Jg., Nr. 4 Schlaganfällen bzw. SchlaganfallResiduen - Morbus Alzheimer und anderen Demenz-Formen (Ægeriatrische Medizin) - Morbus Parkinson - Gehörproblemen (psychischen Ursprungs) - psychosomatischen Erkrankungen und Neurosen - akuten und chronischen Psychosen, Schizophrenie - Aggression, Angst, Depression und anderen affektiven Störungen - Aufmerksamkeitsdefizit-Syndromen, Verhaltensauffälligkeiten, Lernschwäche - Entwicklungsstörungen - Essstörungen - Suchterkrankungen - Insomnie (Schlafstörungen) - „Stresskrankheiten“ - Amnesie („Trauma-Medizin“) - Bewegungsstörungen - Autismus - Trauerbewältigung. Musik lässt sich in vielen medizinischen Situationen als therapeutisches Hilfsmittel einsetzen. Dabei wurde Musik traditionell mit der Behandlung geistiger bzw. seelischer Krankheiten in Verbindung gebracht und ist so erfolgreich zur Therapie von Angst oder Depression eingesetzt worden [10]. Außerdem konnten Funktionen bzw. Befinden bei Schizophrenie und Autismus gebessert werden. Weiterhin zeigt die Literatur, dass Musik u.U. Stimmung und Kognition zu bessern vermag [10]. Jedoch blieb es nicht bei rein psychiatrischen Indikationen (ausgeprägte geistig-seelische Krankheitserscheinungen), und es folgten über die Zeit mannigfaltige weitere Anwendungsgebiete. Im Bereich der klinischen Medizin haben zwischenzeitlich verschiedene Studien beispielsweise auf das analgetische und anxiolytische Potenzial von Musik hingewiesen und jenes auf verschiedene Weise erfolgreich therapeutisch eingesetzt und überprüft: Musik kann sich als hilfreich z.B. auf Intensivstationen (inklusive Stroke Units) und bei diagnostischen Prozeduren/Eingriffen wie Gastroskopien sowie bei größeren Operationen erweisen, und sie kann sinnvollerweise komplementär in präoder postoperativen Phasen eingesetzt werden, womit eine deutliche Einsparung von (u.a. analgesierenden) Medikamenten erzielt werden kann [22]. Außerdem kann Musik dazu beitragen, dass die Stresshormon-Produktion verringert wird und subjektive „Stress-Levels“ in klinischen – vermeintlich stressreichen – Situationen gesenkt werden [20-22]. Nach Schlaganfall ist es mit Hilfe von Musik eventuell möglich, Erholungsvorgänge zu beschleuni- 217 gen und die Neuroplastizität positiv zu beeinflussen bzw. ihre Ausnutzung zu verbessern [16,17]. Musikalische Vorerfahrungen des Patienten können diesen Prozess ggf. erleichtern. Nebenbei wird hier die vielschichtige Überschneidung der Bereiche Musik und Neurologie deutlich, weswegen heute auch der Begriff bzw. die „Gebietsbezeichnung“ Neuroscience of Music Verbreitung findet. Der Einsatz von Musik bei geriatrischen Patienten hat sich als besonders fruchtbares und dankbares Vorgehen herausgestellt. Dieses gilt sowohl für die rezeptiven als auch für aktive und aktivierende Elemente der therapeutischen Musikanwendung. Studien konnten zeigen, dass Musik Funktionen und Fähigkeiten geriatrischer Patienten verbessern helfen kann und Symptome nach Schlaganfall sowie bei Morbus Alzheimer und anderen DemenzFormen lindern kann (siehe oben). In diesem Zusammenhang wird vornehmlich das supportive und palliative Potenzial von Musik ausgenutzt. Hierbei prädestinieren die supportiven Eigenschaften von Musik bzw. Musikmedizin jene natürlicherweise für den Gebrauch in der Palliativmedizin und terminalen Pflege. Musik wird gut toleriert, ist günstig in der Applikation (i.d.R. begleitet von einer guten Compliance) und besitzt, wenn adäquat eingesetzt, praktisch keine Nebenwirkungen. Ebenso unterstützt die Musikanwendung Patienten darin, die Kontrolle über Bewegungsabläufe zurück zu erlangen sowie Gedächtnisfunktionen zu erhalten oder sogar zu verbessern. Selbstwertgefühl und soziale Interaktion können auf diese Weise auf einem höheren Niveau gehalten werden [11,15]. Musik kann also einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen leisten. Vergleichbar der Anwendung bei älteren Menschen kann Musik als therapeutisches Mittel auch zur Behandlung von jüngeren Patienten und Kindern hinzugezogen werden. Es scheint fast so, als könne bei Kindern nahezu jede gesundheitliche Einschränkung auf irgendeine Art durch Musik positiv beeinflusst werden – und sei es über die Vermittlung einer verbesserten Akzeptanz oder durch den spielerischen Umgang mit einem vorhandenen Defizit [10]. So kann Musik beispielsweise einschneidende (günstige) Verhaltensänderungen befördern, Hirnaktivitätsmuster nachhaltig verändern oder eindrucksvolle vegetative Reaktionen (wie z.B. das Erleben eines „Schauers“) auslösen [18]. Derartige Reaktionen können evtl. therapeutisch nutzbar gemacht werden. Kinder und Jugendliche scheinen besonders sensibel für Musik und musikalische Stimmungen zu sein: Studien mit Tieren (z.B. jungen Küken) konnten demonstrieren, dass eine Stimulation durch Musik deutliche Modifikationen des Verhaltens und messbare biochemische Veränderungen 218 T. Esch – Musikmedizin: Musik im Mittelpunkt von Krankheit und Heilung bedingen kann. Im Gehirn können sich beispielsweise die Neurotransmitter-Konzentrationen verschieben, insbesondere kann ein erhöhter Noradrenalin-Umsatz gemessen werden [18]. Allerdings können tierexperimentelle musikphysiologische Aussagen nicht automatisch auf den Menschen übertragen werden. Das führt uns zum nächsten Abschnitt, welcher sich genauer mit den möglichen physiologischen Grundlagen bzw. zugrunde liegenden Mechanismen von Musical Healing beim Menschen befasst. Musikphysiologie: Können therapeutische Musikeffekte erklärt werden? Alle bisherigen Versuche, die Physiologie musikalischer Heilungsprozesse präziser zu bestimmen, blieben in weiten Teilen spekulativ. Dieses mag an der Tatsache liegen, dass Musical Healing ein komplexes, multifaktorielles Phänomen ist, welches nicht einfach zu untersuchen ist. Außerdem – und obwohl inzwischen eine beeindruckende Anzahl wissenschaftlicher Untersuchungen zum Thema Musikphysiologie existiert und Musiktherapie als ein eigenständiges Berufsbild über das letzte Jahrhundert schließlich Anerkennung fand – bestehen noch immer viele strukturelle Schwierigkeiten. Forscher haben es gelegentlich an methodologischer Genauigkeit fehlen lassen, und zusätzlich trugen kulturelle Probleme bzw. Unterschiede dazu bei, dass eine allgemeine Effizienz und Gültigkeit musiktherapeutischer Prinzipien bisher nicht demonstriert werden konnte. Wissenschaftliche Kenntnisse über neurophysiologische und neurochemische Korrelate der musikalischen Erfahrung sind noch lückenhaft, und so wird der Einsatz von Musik als medizinische Therapieform oftmals noch damit begründet, dass die zu beobachtenden bzw. subjektiv empfundenen positiven Effekte der Musik allein ausreichten, um eine klinisch-medizinische Anwendung zu rechtfertigen – der Intuition gehorchend: „Wer heilt, der hat recht“. Man kann durchaus jener Argumentation folgen, jedoch bleibt das aus wissenschaftlicher Sicht vorrangige Problem bestehen: zugrunde liegende Mechanismen bleiben z.T. unerkannt, eine mit wissenschaftlicher Erkenntnis vorangetriebene Weiterentwicklung und Spezifizierung musiktherapeutischer Aspekte bleibt möglicherweise aus. Individuell-subjektive Effekte und allgemein gültige Prinzipien können nicht sicher voneinander unterschieden werden. Zu Unrecht besteht häufig auf Seiten der Erfahrungsheilkunde eine gewisse Abneigung gegenüber den Methoden und Resultaten der wissenschaftli- chen Forschung (und umgekehrt), obwohl hier ein „Wissensaustausch“ – letztlich zum Wohle des Patienten – oftmals Hilfestellung und Inspiration gleichzeitig sein könnte. Derartiges kann auch für Bereiche der Musikmedizin gesagt werden. Da kein generell akzeptierter Standard dafür existiert, wie, wann und wo Musik innerhalb medizinischer Rahmenbedingungen sinnvollerweise appliziert werden sollte, müssen wir zur Erklärung therapeutischer Musikeffekte nun musikphysiologische Informationen von verschiedenen Seiten zusammentragen. Musikausübung und Musikhören (Musikerleben) sind physiologisch nicht immer leicht auseinander zu halten. Auch haben beide einen zentralen Aspekt gemeinsam: sie sind „imMoment-Erfahrungen“, d.h. sie binden sofort und in hohem Maße die Aufmerksamkeit, und physiologische Veränderungen sind unmittelbar festzustellen. Solcherart kann sich das Gefühl einstellen, mit der Musik „zu fließen“ (ÆFlow-Erfahrung, siehe unten), eine Situation, die mit einer günstigen physiologischen Konstellation bzw. „Stimmung“ einhergeht und die mit Musik generell in Verbindung gebracht werden kann. Dabei steht am Anfang der „Eintritt“ von Musik in den Körper, welcher meist über die Ohren erfolgt. Nervenbahnen transportieren alsdann die Klang-/Lautinformation vom Ohr (Cochlearorgan) über den Cochlearnerven zum Hirnstamm. Dort wird die Musik „gefiltert“ und ihr Inhalt zum ersten Mal grob analysiert. Beispielsweise werden Tonhöhe (Stimmung?) und Richtung, aus welcher das „musikalische Geräusch“ gekommen ist, zugeordnet. Im weiteren Verlauf entscheidet der Thalamus, das „Tor zum Großhirn“ bzw. der „Pförtner des Bewusstseins“, über das folgende Schicksal der Musik innerhalb des Gehirns. Soll die Musik aktiv „gehört“ werden, d.h. wahrgenommen vom Bewusstsein und bearbeitet von den diversen zentralen bzw. kortikalen Musikzentren (die insbesondere im Temporallappen lokalisiert sind, wo auch der primäre auditorische Kortex gefunden werden kann) [1]? Danach vielleicht aktiv beantwortet in spezifischer/charakteristischer Weise? Oder wird die musikalische Nachricht ohne Konsequenz, d.h. „ungehört“, bleiben bzw. nur eine unbedeutende und transitorische z.B. passivemotionelle Reaktion hervorrufen? Die „Torwächter-Funktion“ (gating effect) des Thalamus ist wichtig für die Wertung eingehender musikalischer Informationen, und sie kann den Organismus bzw. sein zentrales Nervensystem (ZNS) – genauer: das Bewusstsein – vor überfordernden „Klangattacken“ schützen. Die primären Großhirnareale mit Zuständigkeit für das Hören (Perzeption und weitere Analyse: primärer auditorischer Kortex), evolutionsbiologisch jünger als tiefer gelegene Hirnstruk- Musikphysiologie und Musikermedizin 2003, 10. Jg., Nr. 4 turen wie Hirnstamm und Thalamus, von denen sie ihre primären Informationen bekommen, schicken Impulse und Nachrichten sekundär weiter in andere Gebiete des ZNS – v.a. in die assoziativen Felder und angeschlossenen Regionen, welche wichtig für die differenziertere Verarbeitung von Musik sind [19]. Dabei verarbeitet die rechte Hemisphäre, vereinfacht gesagt, grobe Struktur, „Färbung“ und Inhalt von Musik, wohingegen die linke eine feinere – mehr „analytische“ – Beurteilung vollzieht. Liegen beim Hörenden jedoch musikalische Vorerfahrungen vor, können selbst diese allgemeinen bzw. schematischen Zuordnungen ihre Gültigkeit verlieren [1,3,19]. In jedem Fall aber bestehen auf verschiedenen Ebenen der Informationsverarbeitung im Gehirn Querverbindungen zu tiefer gelegenen Strukturen, insbesondere auch zum limbischen System, u.a. zuständig für Emotionen [3,21]. Wenn eine angenehme Musik erklingt, werden zentralnervöse physiologische Motivationsund Belohnungsmechanismen aktiviert. Solche Mechanismen können auch eine erhöhte Endocannabinoid-Ausschüttung einbeziehen (siehe unten). So wird die gehörte Musik schließlich verbunden – konditioniert und gespeichert – mit positiven Gefühlen (Ælimbisches System). Jener emotionalisierte Gedächtnisinhalt kann auch somatische Zeichen – z.B. körperliche Sensationen, welche die Gefühle ggf. begleiten – enthalten. Eine positive bzw. angenehme „Gefühlstönung“ (Stimmung), u.U. gekoppelt an ein positiv korrelierendes Körpererleben, wird auf diese Weise mit der musikalischen Hörerfahrung assoziiert [21]. In Bezug auf die Evolution und unsere biologische Herkunft können uns die beschriebenen Körpersensationen an die Bedeutung sowie Vorteile von Musik für frühe Hominiden erinnern: Musik hat sich eventuell ausgehend von den Trennungsschreien entwickelt, welche sich zum Zwecke des Kontaktserhaltes zwischen Mutter und Säugling schon in den ersten Lebensstunden einstellen [3]. Tatsächlich repräsentieren autonom-vegetative Körperreaktionen, wie sie durch das Musikhören hervorgerufen werden können (z.B. die „Gänsehaut“), wahrscheinlich einen ursprünglich durchaus sinnvollen biologischen Atavismus. Wenn eine Mutter beispielsweise ihren Säugling ruft, richten sich die feinen Härchen auf der Körperoberfläche des Kindes auf und halten es dieserart warm und geschützt. Daneben kann Musik Gefühle der sozialen Zugehörigkeit und Unterstützung, der Nähe, des Schutzes sowie der Gemeinschaft erzeugen. Derartige Gefühle haben ein außerordentlich positives physiologisches und gesundheitlich-therapeutisches Potenzial [7,9]. Ohne Frage sind Musik und Gefühle eng mit einander verzahnt. In diesem Kontext haben 219 Gefühle ggf. auch die Funktion, einen positiven Glauben bzw. eine positive Einstellung zur Musik oder zu einem Klangerlebnis (einer Lautinformation) zu bekräftigen, so dass rationale Gedanken die Stärke des Glaubens, d.h. der musikalischen Konditionierung, nicht wesentlich gefährden können [21]. Solche Konditionierungen – Beziehungen zwischen Gefühl und Musik bzw. Information – können u.U. für therapeutische Musikanwendungen nützlich sein. So kann Musik ein geeignetes Instrument sein, um eine emotionelle Reaktion – und damit eine limbische Aktivierung – auszulösen und auf diese Weise z.B. Erwartungen zu erfüllen, ohne dass rationale Informationsprozesse einbezogen werden (müssen). Dabei stellt die Perzeption von Musik einen im gegenwärtigen Moment eingebetteten Vorgang dar, obwohl Musikverarbeitung und nachfolgend ausgelöste Reaktionen auch – und wesentlich – Erfahrungen aus der Vergangenheit widerspiegeln (wie z.B. ein erworbenes/übernommenes Glaubensgebäude). Positive wie negative Lebenserfahrungen fließen in die Musikbeurteilung bzw. in das konkrete Musikerleben mit ein. Hinsichtlich der Frage nach spezifischen Hirnstrukturen, welche an der Verarbeitung verschiedener Arten von Musik beteiligt sein können, kann festgestellt werden, dass subjektiv wohlklingende Musik z.B. Areale im Frontallappen aktiviert (offenbar links mehr als rechts). Ein Wohlgefühl kann diesen Prozess begleiten. Zusätzlich „erwacht“ der Gyrus cinguli. Dagegen können unangenehme Laute oder Klänge parahippokampale Areale und den Mandelkern (Amygdala) aktivieren – Regionen, die eng mit Gefühlen von Angst und Furcht in Beziehung stehen [3,21]. Es ist an dieser Stelle jedoch wichtig zu betonen, dass die Entscheidung darüber, ob Musik als angenehm oder unangenehm empfunden wird, d.h. über die subjektiv beurteilte musikalische Qualität, nicht nur von individuellen, sondern auch von kulturellen Faktoren und sozialen Hintergründen abhängt. Davon unberührt bleibt die Tatsache, dass die Musikverarbeitung ohne Frage eine subjektive Leistung ist. Die Beteiligung der Amygdala an musikassoziierten physiologischen Vorgängen unterstreicht noch einmal einen wichtigen Aspekt der Musikerfahrung: Der Mandelkern – wie Hypothalamus, Hypophyse und (andere) Teile des limbischen Systems – ist eine Struktur, die zum autonom-vegetativ-emotionellen Integrationssystem gezählt wird [19,21]. Hier sind autonomes Nervensystem und Emotionen miteinander verdrahtet. Zusätzlich sind sympathische Aktivität und Stresshormon-Produktion in autoregulatorische Regulationskreisläufe eingebunden. So wird die Verbindung von Musik mit Emotionen, mit Stimmung und Affekt, Neu- 220 T. Esch – Musikmedizin: Musik im Mittelpunkt von Krankheit und Heilung rotransmitter- und Stresshormon-Produktion, autonom-vegetativen Funktionen sowie dem Verhalten abermals deutlich. Dabei kann der Einfluss von Musik auf vitale Funktionen wie Atmung, Respirationsrate, Blutdruck und kardiale Auswurfleistung/Herzfunktion (als Folge der beschriebenen vegetativ-emotionellen Integration) auch eine veränderte Selbst- oder Körperwahrnehmung bedingen, ein anderes Bewusstsein bzw. wechselnde Geisteszustände [10]. Der Einsatz von Musik hat sich als geeignet erwiesen, um das Stress-Niveau von Patienten in unterschiedlichen klinischen Situationen zu senken (s.o.). Studien haben dabei Musik der Ablenkung durch verbale Interaktionen gegenüber gestellt bzw. Musik in ihrer physiologischen Konsequenz eindeutig von verbalen Interventionsstrategien und Mechanismen abgegrenzt [10]. Das stressreduzierende Potenzial von Musik kann gut mit anderen Stressreduktions-Techniken kombiniert werden, wie sie zum Beispiel im Rahmen eines professionellen Stressmanagements gebräuchlich sind [9,21,22]. So stellt die Kombination von Musik und Entspannungsverfahren eine einleuchtende und physiologisch günstige Strategie zur Stressbewältigung dar [21]. Können positive Effekte von Musik auf molekularer Ebene erklärt werden? Wie bereits beschrieben, so kann Musik beispielsweise den Noradrenalin-Umsatz verändern. Auf diese Weise vermag Musik, die peripheren Instrumente und Effektoren der physiologischen Stress-Beantwortung (stress response), d.h. die Stresshormone Adrenalin/Noradrenalin und Cortisol, direkt zu beeinflussen. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass der oben dargestellte neuronale Übertragungsweg vom Hörorgan/Hörnerven zum Kortex u.a. von Stickstoffmonoxid (NO) übermittelt wird bzw. NO an der Informationsübertragung beteiligt zu sein scheint [21]. Stickstoffmonoxid ist ein Molekül, welches als Signaltransmitter eine enge Beziehung zu den autonomen Regulationssystemen besitzt. Es ist wohl auch für viele der physiologischen Effekte im Zusammenhang mit dem Musikerleben und der Musikverarbeitung mit verantwortlich [20,21,23]. Insbesondere ist NO mit der Endocannabinoid- und Endorphin-Ausschüttung (bzw. -Signalübertragung) assoziiert, weswegen hier u.U. eine physiologische Verbindung von Musik zu Wohlgefühlen und Entspannungszuständen gesehen werden kann – beides regelmäßig zu beobachten beim Musikhören [21,23]. Weiterhin antagonisiert NO die Noradrenalin- bzw. Stresshormon-Aktivität [5]. Kürzlich wurde diskutiert, ob NO außerdem eine Schlüsselfunktion bei der „EntspannungsAntwort“ (relaxation response) besitzt, dem physiologischen Gegenspieler der biologischen Stress-Antwort (stress response). Jene Entspannungs-Antwort ist ein natürliches Instrument zur Stressreduktion bzw. –bewältigung, welches jedem menschlichen Organismus prinzipiell zur Verfügung steht und das u.a. durch Techniken wie Yoga und Meditation willentlich aktiviert werden kann [9]. Geht die Stress-Antwort z.B. mit einem erhöhten Energie- und Sauerstoffverbrauch, mit erhöhter Herzfrequenz und Respirationsrate sowie angehobenen Blutdruckwerten einher, so zeigt die Entspannungs-Antwort eine gegenteilige Physiologie: der Metabolismus ist reduziert. Allgemein kann dazu festgestellt werden, dass repetitive – aber zeitgleich nicht „einschläfernde“ oder lediglich passiv ablenkende – Tätigkeiten bzw. Aktivitäten, welche die Aufmerksamkeit binden und auf diese Weise den Geist fokussiert, wach und im Moment „verwurzelt“ halten (wie Musik!), über eine Minimierung von Alltagsgedanken das Potenzial besitzen, die Entspannungs-Antwort auszulösen [9]. Dieser physiologische Mechanismus verfügt offenbar über eine Reihe gesundheitsfördernder Eigenschaften und ist daher eine wichtige „Zutat“ moderner Stressreduktions-Strategien geworden [9]. Während Musik ebenfalls mit positiven therapeutischen bzw. gesundheitsfördernden Effekten assoziiert wird und daneben auch die Fähigkeit zur Stressreduktion besitzt (s.o.) – und während die NO-Autoregulation offensichtlich eine Rolle bei der Entspannungs-Antwort, der Musikverarbeitung und in der Stressphysiologie spielt (wahrscheinlich unter Einbeziehung von Endocannabinoid-Wirkungen) –, scheinen die zunächst unterschiedlichen Phänomene „Musik“ und „Entspannungs-Antwort“ auf physiologischer Ebene viele Gemeinsamkeiten zu besitzen [5,10,23]. Musikverarbeitung und Stressreduktion könnten u.U. auf ähnlichen Mechanismen beruhen, wobei eine therapeutische Funktion vielleicht gerade bei psychischen Krankheiten und Störungen ausgenutzt werden könnte [5,6,9]. Dieses könnte dann daran liegen, dass einige psychiatrische und neurodegenerative Krankheiten Verbindungen zur Stress(patho)physiologie aufweisen [6]. Allerdings sind die letztgenannten Folgerungen hypothetisch und bleiben bis zur endgültigen Klärung durch notwendige Forschungsarbeiten spekulativ. Musik und Rhythmus sind nicht synonym. Und dennoch, Rhythmus ist eines der wichtigsten, d.h. essenziellen, strukturierenden Elemente von Musik: Die zeitliche Struktur von Musik, gewährleistet bzw. geprägt von der musikalischen Rhythmik, ist das entscheidende Element, welches Musik mit spezifischem motorischen Verhalten verbindet. Dabei ist das motorische System offenbar besonders sensitiv für einen rhythmischen auditorischen Input. Jene Sensitivität mag durch evolutionäre Prozesse Musikphysiologie und Musikermedizin 2003, 10. Jg., Nr. 4 entstanden sein, denn Rhythmus stellt gewissermaßen eine Urform von Musik dar. Rhythmische Impulse werden außerdem auch von tiefen Hirnstrukturen bzw. über unterbewusste Mechanismen verarbeitet, welche eng und z.T. reflektorisch an das motorische System gekoppelt sind [10]. So haben einige der basalen auditiv-motorischen Weckreaktionen ihren Ursprung wahrscheinlich in adaptiven Vorgängen und physiologischen Prozessen, welche von der Biologie zum Zwecke der Verbesserung der individuellen Überlebenschancen eingesetzt wurden: Verhaltensstrategien wie das (über)lebenswichtige „Kampf-oder-Flucht-Verhalten“ (fight-or-flight reaction – entspricht auf physiologischer Ebene der Stress-Antwort) werden beispielsweise über plötzliche Klangbzw. Lautereignisse aktiviert und können demgemäss eine evolutionsbiologisch alte – aber unverzichtbare – Verbindung von „Musik“ (Rhythmus, Klang) und individuellem Überleben aufzeigen [24]. Solche wichtigen „alten“ Verbindungen können eventuell auch mit der tiefen und oft unbemerkten (instinktivintuitiven) Wirkung von Rhythmik auf unsere Gefühle und das Verhalten in Beziehung stehen. Musical Healing vermag möglicherweise, eben diese Verbindungen anzusprechen und für die Behandlung – z.B. von psychischen Beeinträchtigungen – nutzbar zu machen. Daneben erhöht der repetitive Charakter von Rhythmik bzw. rhythmischen Bewegungen die Fähigkeit/Wahrscheinlichkeit einer Aktivierung der Entspannungs-Antwort. Musik und Rhythmus, anders als verbale Kommunikation, können außerdem Patienten vielleicht noch erreichen, wenn kein anderer – z.B. kognitiver – Zugang mehr möglich ist. Musik kann sinnstiftend wirken und ein Gefühl von Einheit bzw. „Ganzheit“ vermitteln. Das ist einer der Gründe, warum Musik oftmals bei spirituellen Praktiken eingesetzt wird [10]. Allerdings haben gerade psychiatrische Patienten u.U. Schwierigkeiten, den Körper als Ganzes zu empfinden. Musik kann hier ggf. besonders hilfreich sein, wobei jedoch nicht alle Arten von Musik gleich gut geeignet zu sein scheinen. Die beste Art von Musik in diesem Zusammenhang ist offenbar eine Mischung aus bekannten Elementen, welche Sicherheit vermitteln, und unbekannten, die Neugier und Aufmerksamkeit wecken. Solcherart kann eventuell eine emotionelle Rigidität, wie sie bei psychiatrischen Krankheiten häufig gesehen wird, aufgebrochen werden, worauf Gefühle von Traurigkeit, Angst, Wut oder sogar Freude leichter zum Ausdruck gebracht werden können. Tatsächlich wurde in der Romantik Musik als ein wirksameres Instrument zum emotionellen Ausdruck angesehen, als „Wörter jemals sagen könnten“ [10]. Konsequenterweise hat Felix Mendelssohn-Bartholdy auch eine seiner 221 noch heute populären Klaviersammlungen „Lieder ohne Worte“ benannt – ein Titel, der gezielt auf die Ablehnung von musikalischen Textbüchern bzw. Liedtexten hinweisen sollte [3]. Musik wurde demzufolge lange als Medium des Unaussprechlichen angesehen, welches auch den subjektiven Charakter des musikalischen Erlebens unterstreichen sollte. Erst seit kurzem – und hier insbesondere in der PopMusik heutiger Tage – sind Text und Musik regelmäßig miteinander verschmolzen und in dieser Einheit dennoch, ja vielleicht sogar „betont“, in der Lage, tiefe Gefühle hervorzubringen. Therapeutische Musikeffekte beruhen auf sehr unterschiedlichen physiologischen und psychologischen Mechanismen. Musik ist ein komplexes Phänomen, und so sind auch die therapeutischen Möglichkeiten und Konsequenzen des Einsatzes von Musik im medizinischen Kontext sehr vielschichtig. Trotzdem scheinen „standardisierte“ musikphysiologische Übertragungswege bzw. molekulare „Übersetzungen“ der bekannten oder zu beobachtenden musiktherapeutischen Effekte zu existieren, d.h. das subjektive Musikerleben besitzt wahrscheinlich – neben individuell-spezifischen Reaktionsmustern – z.T. unspezifische physiologische Entsprechungen. Solche musikphysiologischen Übertragungswege, welche z.B. Stickstoffmonoxid-, Endocannabinoid- oder EndorphinSignale einschließen können, können vielleicht gerade wegen ihres eher allgemeinen Charakters gut mit Musik angesprochen bzw. über diese aktiviert werden. Positive Auswirkungen auf Heilung und Gesundheitsförderung können so regelmäßig beobachtet werden. Sicher wird die Musikphysiologie in den kommenden Jahren noch zahlreiche weitere molekulare und neurochemisch-physiologische Korrelate der Musikerfahrung entdecken sowie wissenschaftstheoretische Erweiterungen der modellhaften Vorstellungen von der Musikverarbeitung befördern. Außerdem wird die Musikphysiologie helfen, musiktherapeutische Effekte eindeutig als solche zu identifizieren und möglicherweise dazu beitragen, dass jene in größerem Umfang – im Rahmen praktischklinischer Musikanwendungen – zur Heilung, auch bei allgemeineren medizinischen Indikationen, eingesetzt werden. Schlussfolgerungen und Ausblick Musik ist ein komplexes Phänomen. Musikhören und Musikausübung unterscheiden sich dabei in vielerlei Hinsicht. Allerdings sind die physiologischen und emotionellen Reaktionen, welche Musik jeweils auszulösen vermag, sehr wohl vergleichbar und u. U. gleichermaßen 222 T. Esch – Musikmedizin: Musik im Mittelpunkt von Krankheit und Heilung bedeutend für die Milderung von Krankheitssymptomen. Es darf jedoch nicht verschwiegen werden, dass Musik auch krank machen kann, welches insbesondere infolge einer „Überdosierung“ von Musik zu beobachten ist. Solche „Überdosierungen“ werden häufig, aber nicht ausschließlich, im Zusammenhang mit dem professionellen Musizieren gesehen. Durch Musik werden potenziell alle Sinne aktiviert. Das ist wahrscheinlich eine der Ursachen, weshalb Musical Healing – als Ausdruck des Heilungsvermögens von Musik – auf einer tiefen und z.T. unterbewussten Ebene arbeitet und sich dazu vielschichtiger bzw. komplexer Mechanismen bedient. Obwohl die professionelle Musikausübung – gerade im Bereich der klassischen Orchesterliteratur – wesentliche Kennzeichen einer stressreichen Arbeitserfahrung besitzt (geringer Freiheitsgrad, d.h. limitierte Möglichkeiten der Eigeninitiative und Kontrolle, in Verbindung mit einem hohen Anspruch sowie einer intensiven Belastung = high demand, low control), beinhaltet sie doch ein zentrales Element des modernen Stressmanagements: Musik – sowohl ihre Ausübung als auch das passive Erleben – bindet die Menschen an den Moment. Dabei lässt Musik ohne Frage nur wenig Raum für alltägliche Gedanken und Sorgen – ein Umstand, der stark an die Flow-Erfahrung bzw. -Bedingungen erinnert, wie sie von Csikszentmihalyi in den 1970er Jahren erstmals beschrieben worden sind. Jener Zustand des selbstvergessenen „mit der Musik Fliessens“ (gekoppelt an eine hohe Aufmerksamkeit bzw. die nahezu vollständige Absorption des Bewusstseins von einem „fesselnden“ musikalischen Fokus) scheint darüber hinaus auch in engem Bezug zur biologischen EntspannungsAntwort (relaxation response) zu stehen, dem natürlichen Instrumentarium zur physiologischen Stressreduktion. Musik hat die Fähigkeit, positive Emotionen auszulösen und Stress zu reduzieren. Ähnlich verhält es sich mit der Entspannungs-Antwort (s.o.). Daneben konnte gezeigt werden, dass Stress eine Rolle bei zahlreichen Krankheiten spielt, darunter auch psychiatrische und neurodegenerative Erkrankungen. So kann Musik bzw. Musical Healing letztlich ein wirksames Mittel sein, um z.B. Patienten mit psychischen oder psychiatrischen Störungen zu behandeln – vergleichbar den bisherigen Erfahrungen mit dem klinisch-therapeutischen Gebrauch der Entspannungs-Antwort (d.h. dem gezielten Auslösen der physiologischen EntspannungsAntwort zur Unterstützung von Heilung und Gesundheit). Außerdem kann Musik auch selbst dazu dienen, die Entspannungs-Antwort zu aktivieren. Die einzige Voraussetzung ist al- lerdings, dass ein Patient eine grundsätzlich positive Einstellung mitbringt und offen für Musik im Allgemeinen ist. Musikalische Vorerfahrungen – oder gar ein „Expertenwissen“ – sowie konkrete Fähigkeiten der Musikausübung sind nicht notwendig. Auf molekularer Ebene sind offenbar Stickstoffmonoxid-, Endocannabinoid- und Endorphin-Wirkungen an musikphysiologischen Vorgängen bzw. musiktherapeutischen Effekten beteiligt. Ähnliche molekulare Übertragungswege und Aktivierungsmuster scheinen auch bei der Entspannungs-Antwort und der physiologischen Stressreduktion eine Rolle zu spielen. Demnach sind physiologische Überschneidungen von Musikverarbeitung und Stressbewältigung möglich. Allerdings ist die konkrete individuelle Reaktion auf Musik, d.h. die subjektive physiologische Konsequenz des Musikerlebens, stark von der spezifischen musikalischen Vorerfahrung und individuellen Musikpräferenz abhängig. Professionelle Musiker können beispielsweise untereinander – und im Vergleich zu musikalischen Laien – völlig unterschiedliche physiologische Reaktionsmuster bei/nach Musikkontakt generieren. Musikperzeption und -verarbeitung sind subjektive Leistungen. Das macht eine wissenschaftliche Untersuchung musikphysiologischer Phänomene mitunter schwierig. In diesem Zusammenhang wird ein Problem der bisherigen Forschung auf dem Gebiet der therapeutischen Musik deutlich: Die Methoden und das Design verfügbarer Studien lassen oftmals zu wünschen übrig. Hier muss noch vieles aufgearbeitet und ggf. verbessert werden, qualitativ hochwertige wissenschaftliche bzw. klinische Arbeiten werden dringend benötigt. Dennoch kann bereits jetzt festgestellt werden, dass die Physiologie der Musikverarbeitung nicht nur interessant ist, sondern auch weit in die therapeutisch-praktische Medizin (ÆMusiker- und Musikmedizin, Musical Healing) sowie die theoretische Medizin (ÆNeuroscience of Music) hineinreicht. Die Musikphysiologie kann in diesem Kontext auch als ein Oberbegriff aufgefasst werden, welcher große Bereiche der Musik- bzw. Musikermedizin subsumiert (Abbildung 1). So wird auch deutlich, dass die gelegentlich scharf geführte Auseinandersetzung zwischen Musikermedizin und Musiktherapie z. T. künstlich, d.h. ohne wesentliche Substanz, und in weiten Bereichen unnötig ist. Musikphysiologie und Musikermedizin 2003, 10. Jg., Nr. 4 MUSIKPHYSIOLOGIE MUSIK- THERAPIE MEDIZIN MUSIKERMEDIZIN Abbildung 1: Die übergeordnete Bedeutung der Musikphysiologie für Musik- und Musikermedizin. Musik kann die Leistungsfähigkeit (Performance) verbessern. Dieses hat nicht nur eine Bedeutung für Musikhörende, sondern ebenfalls für Musiker selbst: Musik kann – z.B. über die Initiierung eines Flow-Zustandes – die Aufführungsqualität verbessern. Allerdings scheint hier die richtige Dosis von Musik entscheidend für den Erfolg zu sein (s.o.). Ist die musikalische Praxis zu intensiv oder überfordernd, so wird eine u.U. ungünstige Stressphysiologie aktiviert. Ist sie dagegen unterfordernd, werden ggf. keine Heilungsprozesse oder Leistungssteigerungen, d.h. kein kreativer Flow-Zustand, hervorgerufen. Grundsätzlich gilt jedoch, dass Musik bzw. Musical Healing bei einem breiten Spektrum von Fragestellungen und medizinischen Problemen eingesetzt werden kann. Dieses kann von therapeutischen Musikanwendungen – z.B. im Rahmen leichter psychischer Beeinträchtigungen oder auch ernsterer psychiatrischer Erkrankungen – über Aspekte der Leistungssteigerung und Aufführungsqualität bis hin zur Musikermedizin reichen. Insbesondere das stressreduzierende Potenzial von Musik kann – bei adäquatem therapeutischem Einsatz – auch für Musiker von großem Nutzen sein. Allen praktischen Effekten ist dabei schließlich gemeinsam, dass sie auf musikphysiologischen Prozessen und sich z. T. überschneidenden Mechanismen der Musikverarbeitung beruhen. Macht Musik nun gesund oder krank? Die Beantwortung dieser verallgemeinernden Frage sollte sich erübrigen, denn es handelt sich beim Musikerleben um einen subjektiven Vorgang. Die Konsequenzen von Musikeinwirkungen sind sehr individuell und so hat Musik prinzipiell das Potenzial, Prävention/Heilungsprozesse und Krankheitserscheinungen gleichermaßen zu befördern. Das konkrete Ergebnis hängt von einer Reihe subjektiv-endogener und exogener Faktoren ab, daneben spielen Zeitpunkt und Dauer (ÆDosis) der Musikeinwirkung sowie Art der Musik eine Rolle. Eine allgemeine Aussage über subjektive Musikeffekte, seien sie heilsam oder krankheitsför- 223 dernd, ist von außen und ohne Kenntnis der individuellen Situation i.d.R. nicht möglich. Die Musik(er)medizin stellt ohne Frage eine integrative bzw. integrierende Medizin und Wissenschaft dar. Grabenkämpfe innerhalb von Teilbereichen der Musikphysiologie sollten nach Möglichkeit unterbleiben. Stattdessen sollte an jene Stelle eine fruchtbare Diskussion treten, welche letztlich allen Beteiligten und Vertretern, v.a. aber den Patienten, zugute kommt: Was für Musiktherapie oder therapeutische Musikanwendung gilt, ist in vieler Hinsicht auch bedeutend für den (semi)-professionellen Umgang mit Musik, d.h. für Musikausübung und Musikermedizin. Zukünftige Forschung – gerade auf dem Gebiet der Musikphysiologie – kann daher vielleicht beiden Disziplinen helfen und so ggf. auch dazu beitragen, dass Musical Healing Teil einer regulären, ganzheitlichen medizinischen Versorgung wird. Und dennoch: Bei allen Gemeinsamkeiten haben Musiktherapie und Musikermedizin grundverschiedene Zielsetzungen, Zielgruppen und Aufgabenstellungen. Sie dürfen nicht miteinander verwechselt werden. Literatur 1 Altenmueller E. How many music centres are in the brain? Ann N Y Acad Sci 2001; 930 2 Altenmueller E. From Laetoli to Carnegie: Evolution of the brain and hands as prerequisites of music performance in light of music physiology and neurobiology. In: Hickmann E, Eichmann R (eds). Archaeology of early sound production and tonal scales. Deutsches Archaeologisches Institut, Berlin, 2002 3 Altenmueller E. Apollo in uns: Wie das Gehirn Musik verarbeitet. Musikphysiol Musikermed 2002; 9: 15-24 4 Covington H. Therapeutic music for patients with psychiatric disorders. Holist Nurs Pract 2001; 15: 59-69 5 Esch T, Stefano GB, Fricchione GL, Benson H. Stress-related diseases: A potential role for nitric oxide. Med Sci Monit 2002; 8: RA 103-118 6 Esch T, Stefano GB, Fricchione GL, Benson H. The role of stress in neurodegenerative diseases and mental disorders. Neuroendocrinol Lett 2002; 23: 199-208 224 T. Esch – Musikmedizin: Musik im Mittelpunkt von Krankheit und Heilung 7 Esch T. Gesund im Stress: Der Wandel des Stresskonzeptes und seine Bedeutung für Prävention, Gesundheit und Lebensstil. Gesundheitswesen 2002; 64: 73-81 8 Esch T, Gesenhues S. Terminologie, Klassifikation und rationelle Diagnostik depressiver Störungen. Psycho 2002; 28: S21-27 9 Esch T, Stefano GB, Fricchione GL. The therapeutic use of the relaxation response in stress-related diseases. Med Sci Monit 2003; 9: RA23-34 10 Esch T. Musical healing in mental disorders. In: Stefano GB, Bernstein S, Kim M (eds). Musical Healing. Medical Science International, Warsaw-New York, 2003 11 Gregory D. Music listening for maintaining attention of older adults with cognitive impairments. J Music Ther 2002; 39: 244-64 12 Hayashi N, Tanabe Y, Nakagawa S et al. Effects of group musical therapy on inpatients with chronic psychoses: A controlled study. Psychiatry Clin Neurosci 2002; 56: 187-93 13 Larkin M. Music tunes up memory in dementia patients. Lancet 2001; 357: 47 14 Levin YaI. ‘Brain music’ in the treatment of patients with insomnia. Neurosci Behav Physiol 1998; 28: 330-5 15 Lou MF. The use of music to decrease agitated behaviour of the demented elderly: The state of science. Scand J Caring Sci 2001; 15: 165-73 16 Magee WL, Davidson JW. The effect of music therapy on mood states in neurological patients: A pilot study. J Music Ther 2002; 39: 20-29 17 Munte TF, Altenmueller E, Jancke L. The musician’s brain as a model of neuroplasticity. Nat Rev Neurosci 2002; 3: 473-478 18 Panksepp J, Bernatzky G. Emotional sounds and the brain: The neuroaffective foundations of musical appreciation. Behav Processes 2002; 60: 13355 19 Parsons L. Exploring the functional neuroanatomy of music performance, perception, and comprehension. Ann N Y Acad Sci 2001; 930: 211-231 20 Salamon E, Bernstein S, Kim SA, Kim M, Stefano G. The effects of auditory perception and musical preference on anxiety in naïve human subjects. Med Sci Monit 2003; 9: CR396-399 21 Salamon E, Kim M, Beaulieu J, Stefano GB. Sound therapy induced relaxation: Down regulating stress processes and pathologies. Med Sci Monit 2003; 9: RA96-101 22 Spintge R. Some neuroendocrinological effects of socalled anxiolytic music. Int J Neurol 1985-86; 19-20: 186-96 23 Stefano GB, Esch T, Cadet P, Zhu W, Mantione K, Benson H. Endocannabinoids as autoregulatory signaling molecules: Coupling to nitric oxide and a possible association with the relaxation response. Med Sci Monit 2003; 9: RA 6375 24 Thaut MH, Kenyon GP, Schauer ML, McIntosh GC. The connection between rhythmicity and brain function. IEEE Eng Med Biol Mag 1999; 18: 101-8 Korrespondenzadresse Dr. med. Tobias Esch Sertürnerstr. 13 48149 Münster E-Mail: [email protected]