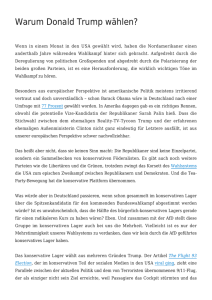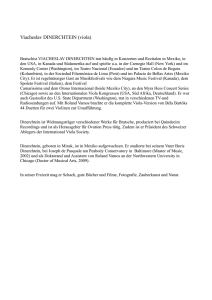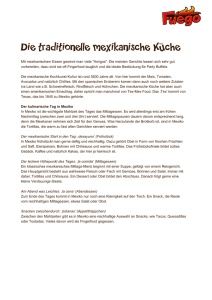So kann Deutschland von Trumps Protektionismus profitieren
Werbung

WIRTSCHAFT BAUSATZ-LÖSUNG DER AUTOFIRMEN So kann Deutschland von Trumps Protektionismus profitieren Von Nikolaus Doll, Philipp Vetter | 22.01.2017 Macht Donald Trump seine Zoll-Drohung wahr, brauchen die deutschen Autobauer schnell eine neue US-Strategie. Ein Ausweg zeichnet sich bereits ab. Im Vorteil wären die großen Mutterwerke in Deutschland. Donald Trump hatte seinen Amtseid kaum zu Ende gesprochen, da veröffentlichte sein Stab die „America First Foreign Policy“ des neuen Präsidenten auf der Internetseite des Weißen Hauses. Das Motto „Amerika zuerst“ sagt klar, welche Regeln künftig für die Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten gelten. Es wird ungemütlicher für die Handelspartner – zum Beispiel für Deutschland und seine exportorientierte deutsche Automobilindustrie. Die Geschwindigkeit, mit der das Team Trump den neuen Handelskurs benennt, zeigt, dass der Präsident keineswegs beabsichtigt, sich von den Drohungen vor dem Amtsantritt zu distanzieren. „Präsident Trump ist fest entschlossen, Nafta neu zu verhandeln“, heißt es auf der Internetseite. Nafta heißt das Freihandelsabkommen der USA mit Mexiko, das bislang hohe Strafzölle auf Importe aus dem mittelamerikanischen Land ausschließt. Doch genau die hat Trump immer wieder angekündigt. Vereinbarungen werden Trump nicht hindern Ob per Tweet oder Interview mit der „Bild“-Zeitung, der neue US-Präsident forderte Autobauer wie BMW mehrfach auf, ihre Fahrzeuge nicht in Mexiko, sondern in den USA zu produzieren. Andernfalls, so drohte Trump, werde er eine Einfuhrabgabe von 35 Prozent verhängen. BMW will ein Werk in Mexiko bauen, Mercedes tut es gerade mit dem Partner Nissan, VW und Audi produzieren dort schon längst. Das Gros der in Mexiko gebauten Autos soll in die USA gehen, aber mit den angedrohten Strafzöllen wären sie dort nicht mehr bezahlbar – also praktisch unverkäuflich. In seinem nun veröffentlichten Strategiepapier macht Trump klar, dass ihn auch bereits geschlossene internationale Vereinbarungen wie Nafta nicht daran hindern werden. „Wenn unsere Partner eine Nachverhandlung ablehnen, die amerikanischen Arbeitern einen fairen Deal verschaffen, wird der Präsident sie darüber informieren, dass die Vereinigten Staaten beabsichtigen, sich aus Nafta zurückzuziehen.“ „Der Mann ist kein Papiertiger“ Die USA können das theoretisch, eine Freihandelszone kann aufgekündigt werden. Das müsste in Verhandlungen geklärt werden. Weitere Handelshürden müssten mit der WTO diskutiert werden. Auch dabei könnten die Vereinigten Staaten ihren Standpunkt nach Verhandlungen mindestens in Teilen durchsetzen. Das dauert, ist aber möglich. Den Autobauern, um eine Branche zu nennen, bleibt also eine Galgenfrist. Und die sollten sie nutzen. „Man muss Donald Trump ernst nehmen, sehr ernst“, sagt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. „Der Mann ist kein Papiertiger“ Bislang reagieren die deutschen Autobauer gar nicht oder trotzig auf den TwitterTsunami Trumps und seine Zolldrohungen. Anders als die US-Autobauer oder die asiatischen Hersteller, die umgehend große Investitions- und Jobaufbau-Programme für die USA angekündigt hatten. VW, Audi oder Mercedes wollen sich gar nicht zu den Trump-Plänen äußern, bei BMW heißt es, man halte an den Mexikoplänen fest. Bausätze könnten die Lösung sein Doch wenn die Zollmauer kommt, braucht die Branche einen Plan B, denn die Autoproduktion ist in den USA einfach zu teuer. Mexikanische Bandarbeiter bekommen sogar deutlich geringere Löhne als ihre Kollegen in China. Gerade die deutschen Hersteller müssen ihre an sich schon hohen Kostenstrukturen durch eine kostengünstige Produktion in Mexiko kompensieren. Geht das nicht, wäre die realistischste Alternative, für den US-Markt auf Autobausätze zurückzugreifen, eine sogenannte CKD-Produktion in den USA. CKD bedeutet „Completely Knocked Down“, dabei werden Autos für bestimmte Märkte als vorgefertigte Bausätze angeliefert und im Bestimmungsland nur noch montiert. Das Verfahren gibt es seit vielen Jahren, die Autobauer greifen darauf zurück, wenn sich auf einem Markt eine eigene Produktion nicht lohnt, wenn die Verhältnisse instabil sind und man Flexibilität will. Oder um hohen Einfuhrzöllen zu begegnen. Denn bei CKD-Autos werden nur die Zölle auf Teile fällig, nicht aufs ganze Auto. Chance für die großen Mutterwerke Bei CKD-Fertigungen kommen die Hersteller schnell auf die gewünschten Stückzahlen, wobei sich die Investitionen in Grenzen halten. Sie müssen vor Ort keinen Karosseriebau oder Lackierstraßen aufbauen, können sich also die beiden größten Kostentreiber sparen. Und auch neues Personal müssen sie nur in sehr begrenztem Umfang aufbauen. Dafür profitieren die Standorte, an denen die großen Mutterwerke stehen, in diesem Fall also die Regionen in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen, also dort, wo Volkswagen, Audi, BMW und Mercedes maßgeblich entwickeln und produzieren. Dort würden die CKD-Autos für den US-Markt voraussichtlich zu einem großen Teil vormontiert. Das heißt, bestehende Werke würden noch besser ausgelastet, neue Kapazitäten müssten geschaffen werden, auch die Zulieferer würden dort profitieren. Damit hätte der Standort Deutschland am Ende einen spürbaren Vorteil von Trumps Antifreihandelspolitik. Und die USA hätten das Nachsehen. Das befohlene Jobwunder würde ausbleiben – und Trump könnte mit keinem Gesetz etwas dagegen tun. Für die deutsche Autoindustrie wäre das ein Paradigmenwechsel. „Verpackungsstation“ im Duisburger Hafen Seit Jahren stockt sie nämlich die komplette Produktion von Autos im Ausland auf. Inzwischen werden nur noch etwa 5,5 Millionen Autos von insgesamt rund 13,5 Millionen pro Jahr hierzulande gefertigt, also 40 Prozent. Tendenz weiter schrumpfend. Seit der Jahrtausendwende hat sich die Auslandsfertigung der deutschen Autohersteller fast verdoppelt. Und seit der Eröffnung des BMW-Werks Leipzig 2005 wurde in Deutschland keine einzige neue Produktionsstätte für Automobile mehr in Betrieb genommen. Für eine CKD-Fertigung im Ausland hatte aber zuletzt auch Audi investiert. Die Ingolstädter hatten im Duisburger Hafen eine „Verpackungsstation“ für Autoteile eingerichtet, die dann per Schiff und Container nach China und Indien gehen. Das heißt auch Nordrhein-Westfalen könnte von der Trump-Politik profitieren. Ein Strafzoll hätte gravierende Folgen Reagieren müssen die deutschen Hersteller auf Trumps Drohungen in jedem Fall. Denn sie sind in den USA längst nicht so erfolgreich, wie es scheint. Die Auswirkungen eines möglichen Strafzolls wären gravierend. „Die bereits seit drei Jahren rückläufigen Marktanteile der deutschen Autobauer würden in eine Talfahrt treten“, prognostiziert Dudenhöffer. Ohnehin verlieren die deutschen Hersteller in den USA laut Rechnungen des CAR Center Automotive Research der Universität Duisburg-Essen an Boden. Der Marktanteil habe 2016 nur noch bei 7,3 Prozent gelegen, noch 2011 waren es 8,6 Prozent. Dudenhöffer sieht eine CKD-Fertigung als einzigen Ausweg aus dem TrumpDilemma. „Es werden einige Arbeitsplätze im Verkaufsland geschaffen, das ist eine politische Botschaft“, sagt Dudenhöffer. „Es bleiben aber gleichzeitig Kostenstrukturen überschaubar.“ Auch BMW plant ein Werk in Mexiko Verlierer dieser Strategie wäre natürlich Mexiko, wo dann deutlich weniger Autos gebaut würden. Denn die meisten Autos, die in Mexiko gefertigt werden, verkaufen die Hersteller in die USA. Lediglich sieben Prozent der Fahrzeuge werden von Mexiko aus nach Europa, Asien, Afrika oder Australien geliefert, rechnet CAR vor. 2016 wurden in Mexiko demnach insgesamt mehr als 3,45 Millionen Autos produziert, doch nur gut 1,6 Millionen wurden auch im Land verkauft. 93 Prozent des Produktionsüberschusses von 1,85 Millionen Fahrzeugen wird laut CAR in die USA exportiert und würde dann mit den Strafzöllen belegt. Am stärksten betroffen wäre Nissan, dessen Produktionsüberschuss bei fast 445.000 Autos lag, Volkswagen und Audi produzieren in Mexiko über 174.000 Autos mehr, als sie im Land verkaufen. BMW produziert bislang nicht in Mexiko plant dort aber ein Werk, in dem ab 2019 3er-Modelle gefertigt werden sollen. Transportkosten machen die Autos teurer Doch auch die amerikanischen Autobauer stellen in Mexiko zum Teil deutlich mehr Fahrzeuge her, als sie dort verkaufen. Bei General Motors beträgt der Überschuss mehr als 385.000 Autos, bei FiatChrysler sind es über 367.000 und bei Ford mehr als 288.000. Einen Nachteil hätte die CKD-Fertigung natürlich: Durch die Transportkosten würden die deutschen Fahrzeuge in den USA etwas teurer. „Aber das verkraften die Amerikaner“, schließlich würden durch Trumps protektionistische Autopolitik insgesamt auch neue Jobs in den USA entstehen. Die deutschen Hersteller drängt Dudenhöffer zur Eile: „Wer zu spät mit seiner Planung für CKD-Montagen in USA beginnt, verliert weiter Marktanteile. Trump ist ein Mann, der schnelle Deals liebt“