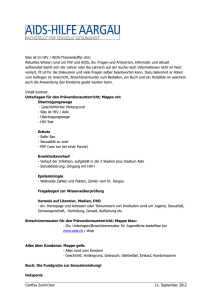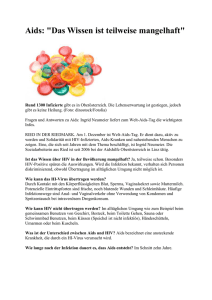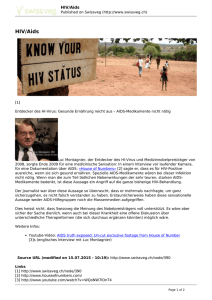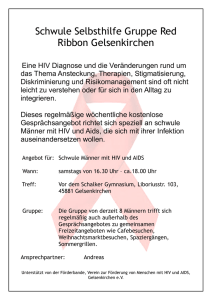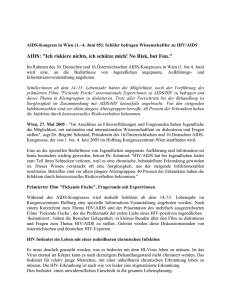Psychotherapie bei HIV und Aids Sinnvolles
Werbung

PP W I S S E N S C H A F T Psychotherapie bei HIV und Aids Sinnvolles Zusatzangebot Psychotherapie kann die Begleiterscheinungen von HIV/Aids erträglicher machen und trägt zur Therapiecompliance bei. D ie Aids-Gefahr ist nicht gebannt. Nach Angaben des Robert KochInstituts,Berlin,sterben in Deutschland jährlich 600 Menschen an der Immunschwächekrankheit. 38 000 Menschen sind aktuell mit dem HI-Virus infiziert, 5 000 sind an Aids erkrankt, 2 000 infizieren sich jährlich neu. 50 Prozent der Neuinfektionen kommen durch homosexuelle Kontakte, 18 Prozent durch heterosexuelle Kontakte und neun Prozent durch Drogenkonsum mit verseuchten Spritzen zustande. Diese Zahlen waren in den letzten Jahren relativ konstant. Das könnte sich aber schon bald ändern. Denn einerseits haben Problembewusstsein und Präventionsverhalten in der Bevölkerung deutlich nachgelassen, zum anderen wird das Virus immer häufiger durch Flüchtlinge, Asylbewerber und Prostituierte aus Hochprävalenzländern, vor allem aus afrikanischen und osteuropäischen Staaten, aber auch durch „Sextouristen“ eingeschleppt. Die Zahl derer, die sich auf diesem Wege infiziert haben, stieg im letzten Jahr um zwei Prozentpunkte auf 23 Prozent an. Zunehmend als chronische Erkrankung gehandhabt In den nächsten Jahren ist in Deutschland mit einer Zunahme der HIV-Infektionen zu rechnen. Das Gesundheitswesen wird sich aber nicht nur darauf, sondern auch auf eine längere Behandlungsdauer bei HIV-Infizierten und Aids-Patienten einstellen müssen. Lag die Überlebenszeit zu Beginn der Epidemie bei etwa zwei Jahren, so bricht heute nur bei der Hälfte der HIV-Infizierten ohne antiretroviral medikamentöse Behandlung innerhalb 280 von zehn Jahren Aids aus. Es gibt auch Betroffene, die 20 Jahre mit dem Virus leben. Sie werden als Langzeitüberlebende (long time survivors) bezeichnet. Die erhöhte Lebenserwartung bewirkt, dass HIV/Aids vom Gesundheitssystem zunehmend als chronische Krankheit gehandhabt und damit auf eine Stufe mit Krebs oder Rheuma gestellt wird. Behandlungsformen werden vielfältiger. Während man sich vor einigen Jahren noch fast ausschließlich darauf konzentrierte, Folgekrankheiten und Schmerzen zu bekämpfen, geht es heute auch darum, den Ausbruch der Krankheit hinauszuzögern und eine hohe Lebensqualität zu erhalten. Dafür werden hauptsächlich Medikamente eingesetzt und kombiniert, die die Vermehrung des HIV verhindern. Wie bei anderen chronischen Krankheiten, so spielen auch bei HIV/Aids psychosoziale Faktoren eine wesentliche Rolle für den Verlauf. HIV/Aids belastet die Betroffenen nicht nur körperlich, sondern auch psychisch sehr stark. Die Diagnose „HIVinfiziert“ oder „Aids-erkrankt“ löst meistens Schockzustände oder Unwirklichkeitserleben aus. Danach stellen sich Depressionen, Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle, Wut und Selbstmordabsichten ein. Die Betroffenen sind verunsichert und fühlen sich isoliert. Sie grübeln viel, hadern mit dem Schicksal, neigen zur Hypochondrie und ängstigen sich vor Erkrankung, Schmerzen und Tod. Ganz besonders fürchten die Betroffenen, diskriminiert und ausgestoßen zu werden. Darüber hinaus stellen sich oft psychosomatische Begleiterscheinungen ein wie Schlaflosigkeit oder Kopfschmerzen. Solche Reaktionen werden von den Charakteristika der Erkran- kung ausgelöst und verstärkt. Denn HIV/Aids stellt eine massive Bedrohung dar. Die Symptome und auch die Kriterien, wann Aids ausbricht, sind zudem nicht eindeutig. Die Betroffenen erleben dadurch einen starken Kontrollverlust. Wechselwirkung von Nerven, Hormon- und Immunsystem Psychotherapeutische Angebote, die helfen, Ängste zu bewältigen und Kontrolle zu erlangen, scheinen daher angebracht. Auf die Frage, ob Psychotherapie bei Viruserkrankungen etwas bewirken kann, gibt das neue Forschungsgebiet der „Psychoneuroimmunologie“ eine klare Antwort: Nerven-, Hormonund Immunsystem stehen in enger Wechselwirkung. Zum Beispiel aktivieren oder hemmen emotionale Stressfaktoren, wie Einsamkeit oder Verlusterlebnisse, die Produktivität bestimmter Neurotransmitter und Hormone. „Sie schwächen die Immunreaktionen und lösen eine Überreaktion der Hypothalamus-Hypophyse-Nebennierenrinden-Achse aus“, erklärt der Psychotherapeut Dr. Armin Bader aus Bochum. Solche Prozesse führen zu körperlichen Krankheiten und spiegeln sich in psychischen Befindlichkeiten wie Depressionen wider. Das Wissen um das komplexe Zusammenspiel von physischen, psychischen und sozialen Faktoren ermöglicht es, mental auf das Immunsystem einzuwirken. Psychotherapie kann dazu beitragen, dass die Begleiterscheinungen erträglich und die Gesundheit der Betroffenen stabilisiert werden. Dabei haben sich vor allem kognitiv-behaviorale Verfahren bewährt, aber auch Hypnotherapie und humanistische Therapien. PP Heft 6 Juni 2004 Deutsches Ärzteblatt W I S S E N S C H A F T Wie wirksam tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und Psychoanalyse sind, ist nicht bekannt, da diese Verfahren äußerst selten bei HIV/Aids eingesetzt werden. Für diese Erkrankung gibt es keine Standardpsychotherapie. Sie erfordert von Psychotherapeuten ein flexibles, interdisziplinäres, schulenübergreifendes, oft auch unkonventionelles Vorgehen. Welche Methoden dabei angewendet werden, hängt immer vom Einzelfall ab, zumindest aber vom Krankheitsfortschritt, körperlichen Zustand, Lebensumständen und von der geistigen und seelischen Verfassung des Patienten.Therapeuten müssen sich darauf einstellen, dass in der Arbeit mit dieser Patientengruppe die Grenzen zwischen Therapie, Seelsorge und Sterbebegleitung verschwimmen. Oft bleibt keine Zeit, um Konflikte zu bearbeiten. Manchmal müssen – noch dringender – die Angehörigen beraten werden. Der Therapeut muss bereit sein, sein gewohntes Setting zu verlassen und den Patienten zu Hause oder im Krankenhaus aufzusuchen. Zudem hat er sich mit der Homosexualität, Drogensucht oder Promiskuität seiner Patienten auseinander zu setzen. Er muss auch wissen, dass die Belastung durch HIV/Aids vorhandene psychische Störungen verstärkt und dass mit Aids hirnorganische Veränderungen einhergehen. Konfrontation mit Schmerzen, Verfall und Tod Besonders belastend für Therapeuten ist die Konfrontation mit Schmerzen, Verfall und Tod der Patienten. Unvorbereitet laufen sie Gefahr, psychische und professionelle Probleme zu bekommen. Dazu zählen beispielsweise Überidentifizierung, rigide Abgrenzung, Sinnlosigkeitsgefühle, Verlustängste, Empathieprobleme, Angst vor Ansteckung und negative Gegenübertragungen. Der unstete, unvorhersehbare Verlauf der Erkrankung macht es nötig, Therapieziele und -formen immer wieder kurzfristig zu ändern. Unmittelbar nach der Diagnose ist meistens eine Krisenintervention angezeigt, um psychisch zu stabilisieren und Ängste zu reduzieren. Mittelfristig kann daran gearbeitet werden, das Bewältigungsverhal PP Heft 6 Juni 2004 Deutsches Ärzteblatt ten zu verbessern, neue Lebensziele zu finden und sich soziale Unterstützung zu suchen. Langfristig kann angestrebt werden, dass sich ein Patient mit seinem Schicksal versöhnt. Er wird dadurch Kontrollüberzeugungen zurückgewinnen und ein sinnhaftes Leben führen können. „Wichtig ist auch, durch Psychoedukation die Therapiecompliance der Patienten zu erhöhen“, erklärt der Psychologe Prof. Dr. Neil Schneiderman, University of Miami. Denn die medikamentöse Behandlung ist nur erfolgreich, wenn Arzttermine und Medikationszeitpläne strikt eingehalten werden. Besonders wichtig ist auch die Stressbewältigung, weil sich Stress unmittelbar auf die Immunparameter auswirkt. Entspannungsverfahren, Imaginationsübungen sowie kognitive Restrukturierung können Betroffene in die Lage versetzen, konstruktiv mit Stress umzugehen. Sie können selbst dazu beitragen, das Immunsystem zu stabilisieren und damit die Lebenserwartung zu erhöhen. Psychotherapie ist ein sinnvolles Zusatzangebot zur medizinischen Behandlung, jedoch nicht das einzige: Auch Sport, Selbsthilfegruppen, gesunde Ernährung und Körperpflege tragen zu einem positiven Lebensgefühl bei und fördern die Gesundheit. Die Effekte von nichtmedikamentösen Maßnahmen sind schon mehrfach wissenschaftlich nachgewiesen worden. Dennoch sollten die Erwartungen nicht zu hoch gesteckt werden. Nicht immer bewirkt psychisches Wohlbefinden eine dauerhafte Immunstabilisierung und medizinische Gesundheit. Inwieweit Psychotherapie künftig ergänzend zur medizinischen Behandlung eingesetzt wird, hängt weitgehend von der Bereitschaft der Ärzte ab, Betroffene auf das bestehende Angebot aufmerksam zu machen. Ein intensiver Austausch zwischen Ärzten, Patienten und Psychotherapeuten steht Dr. phil. Marion Sonnenmoser noch aus. Literatur Deutsche AIDS-Hilfe e.V. (Hrsg.): Psychotherapie bei Aids. Berlin/Wiesbaden: Ullstein Mosby 1996. Bock J et al.: Eurovihta-Projekt – zielgruppenspezifisches Interventionsprogramm für Betroffene bei der Verarbeitung von HIV als chronische Erkrankung. Psychother Psych Med 2003; 53: 310–318. Schneiderman N,Antoni MH, Ironson G:Verhaltensmedizin bei HIV-Infektion. Psychotherapeut 2003; 48: 342–347. PP Referiert Psychische Erkrankungen Kulturelle Unterschiede M ehrere Repräsentativerhebungen aus den Neunzigerjahren in westlichen Ländern zeigten, dass die Vorstellungen der Bevölkerung über psychische Erkrankungen von den Wissensbeständen der Psychiatrie teilweise erheblich abweichen. Ob es sich dabei um ein kulturspezifisches Phänomen handelt, wollten Forscher von der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie der Universität Leipzig wissen. Sie präsentierten 745 Einwohnern der Stadt Nowosibirsk (Sibirien) Symptome von Schizophrenie und Depressionen anhand von Fallvignetten. Die russischen Befragten identifizierten schizophrene Symptome häufiger als Ausdruck einer psychischen Erkrankung als depressive Symptome. Die schizophrene Störung wurde vorwiegend als Folge von psychosozialem Stress und biologischen Einflüssen gesehen, während für depressive Störungen hauptsächlich psychosozialer Stress als Ursache ausgemacht wurde. „Zur Behandlung wurde am häufigsten Psychotherapie empfohlen“, sagen die Forscher. Für den Fall, dass keine Behandlung erfolgt, wurde die Prognose beider psychischer Störungen ungünstig eingeschätzt, mit Behandlung hingegen günstig. Die Forscher verglichen die Daten aus Russland mit aktuellen Daten aus Deutschland und entdeckten viele Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Anders als in der deutschen besteht beispielsweise in der russischen Bevölkerung eine starke Tendenz, psychische Störungen als selbstverschuldet zu betrachten, hervorgerufen etwa durch einen Mangel an Willensstärke oder durch einen unmoms ralischen Lebenswandel. Angermeyer M, Kenzine D, Korolenko T, Beck M, Matschinger H: Vorstellungen der Bewohner der Stadt Nowosibirsk über psychische Erkrankungen. Psychiat Prax 2004; 31: 90–95. Prof. Dr. Matthias Angermeyer, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Universität Leipzig, Johannisallee 20, 04317 Leipzig, E-Mail: [email protected] 281