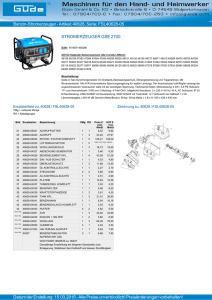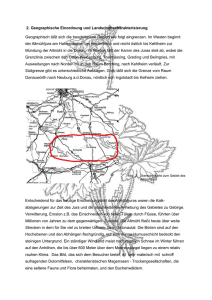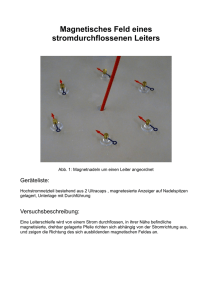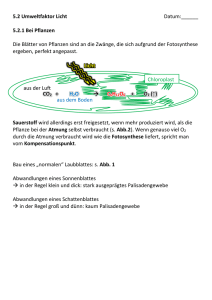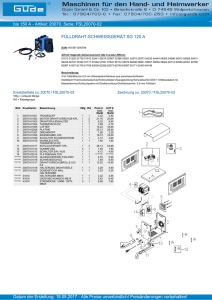Vorbildliche Bauten
Werbung

Baubeispiele Gutes Bauen stellt Identität her! 194 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel 5. Vorbildliche Bauten im ländlichenRaum 195 bAubEiSPiELE Abb. 392: Einfamienhaus und Gastronomie in Heimbach, Stadt Heimbach Foto: ISL Abb. 393: Einfamilienhaus und Atelier Böttger in Kronenburg, Gemeinde Dahlem Foto: Johannes Böttger Düren Aachen Euskirchen Roetgen Heimbach Monschau - Mützenich Monschau - Widdau Monschau - Höfen Nettersheim Nettersheim - Marmagen Belgien Rheinland-Pfalz Dahlem - Kronenburg LEADER-Regionsgrenze Abb. 394: Lage der Best-Practice-Beispiele in der nordrhein-westfälischen Eifel Darstellung: ISL in Anlehnung an Karte Tim-Online, siehe Abbildungsverzeichnis 196 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Beispiele 5 vORBiLDHAFTE, gEBAuTE BEiSpiELE im LÄNDLiCHEN RAum Die folgenden Kapitel zeigen vorbildliche, ge- Bei den Instandsetzungen sowie An- und Um- baute Beispiele und städtebauliche Gebäude- bauten der zumeist ehemaligen Wohn- und Wirt- ensembles zum Thema Planen, Bauen und schaftshöfe, wurden vorbildlich helle Wohnräume Gestalten in der Region Eifel NRW in den Ka- in der alten Gebäudehülle geschaffen oder ein tegorien: Umbau für eine Büro- und touristische Nutzung realisiert. Für die Grundrisse der historischen 5.1. Beispiele: Instandsetzung Wirtschaftshöfe lagen andere Nutzungsanforde- 5.2. Beispiele: An- und Umbau rungen sowie energetische und baukonstruktive 5.3. Beispiele: Neubau Zwänge zugrunde, die durch geschickte Planung 5.4. Beispiele: städtebauliche Ensembles für heutige Wohnansprüche verändert wurden. Durch die Erhaltung und Neunutzung der histo- Durch die Initiative Baukultur Eifel, ein unab- rischen Haustypen wird auch der Dorfgrundriss hängiges Gremium von Fachleuten aus der und Kulturlandschaftraum gewahrt, für neue Nut- Region, wurden diese Best-Practice-Beispiele zungen müssen Kompromisse zwangsläufig ak- ausgewählt und als vorbildliche Beiträge zur re- zeptiert werden. Die vorbildlichen Beispiele des gionalen Baukultur der Eifel NRW bewertet. Sie Neubaus zeichnen sich besonders durch eine sollen als Anregung und Inspiration gesehen hohe Angepasstheit und Neuinterpretation regi- werden, sich über regionaltypische Baukultur zu onaltypischer Bauformen und Materialverwen- informieren und überdies Ansprechpartner und dungen sowie durch einen sensiblen Umgang Fachleute aus der Region zu benennen. und eine gelungene Einfügung in das Ortsbild und den Landschaftsraum aus. 197 bAubEiSPiELE Abb. 395: Gartenansicht des Gebäudes mit Bauerngarten Foto: Guido Bourgeret, 2010 Abb. 396: Straßenansicht vor dem Umbau Foto: Guido Bourgeret Ein altes Bauernhaus kann im innenraum auch ganz modern gestaltet werden. Abb. 397: Straßenansicht des Eckgrundstückes, das Gebäude liegt geschützt hinter regionaltypischen Buchenhecken Foto: ISL 198 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel 5.1. BEiSpiELE: iNSTANDSETZuNg Abb. 398: Lage des Einfamilienhauses in Höfen, Stadt Monschau Darstellung: ISL Einfamilienhaus in Höfen (Monschau) Das hier vorgestellte Einfamilienhaus, ein Das traufständige Gebäude liegt auf einem reetgedecktes Fachwerkhaus, ist ein heraus- großzügig zugeschnittenen Grundstück. Der ragendes Beispiel für ein saniertes Baudenkmal Eingangsbereich wird durch einen kleinen Bau- eines historischen Haustyps der Region, dem erngarten und eine mit Kopfstein gepflasterte Eifeltyp. Von außen wurde das Gebäude restau- Hoffläche, dem ehemaligen Wirtschaftshof des riert und im Innenbereich neu und modern ge- Gebäudes, gestaltet. Das Grundstück wird, wie staltet. Die Bauweise ist ein Holzfachwerk mit im Monschauer Heckenland üblich, durch me- tragenden Balken aus Eichenholz. Dies macht terhohe Buchenhecken zum Garten und zum das Gebäude zu einem interessanten Vorbild für Straßenraum vor Wind und Blicken geschützt. den Umgang mit historischer Bausubstanz in der Ein schlauer Schutz gegen die starken West- Eifel NRW. winde bildet neben den Buchenhecken auch das zur Wetterseite tiefgezogene Dach mit einer Es liegt im landschaftlich reizvollen Dorf Höfen, Neigung von ca. 50°. Die kleinen Nebenräume einem Ortsteil der Stadt Monschau. Das Dorf unter der tiefgezogen Dachfläche wurden als zeichnet sich durch freistehende Gebäude aus, Abstell- und Nebenräume genutzt und dienten die im Wechselspiel mit offenen Hofflächen eine auch als zusätzliche thermische Pufferzone, lockere Bebauungsstruktur im Straßenraum die die Wohnräume von der kalten Außenwand schaffen. Auffällig sind in Höfen, wie in vielen der Wetterseite abrückte. So ist der Grundriss Dörfern im Umkreis, die meterhohen Buchen- als ein 1 1/2 - raumtiefes Gebäude zu erklä- hecken, die einst zum Schutz der Gebäude ge- ren, wobei der rechteckige Grundriss des Ge- gen die starken Westwinde angelegt wurden und bäudes ein Grundrissverhältnis von 1:3 (Breite noch heute das Straßenbild von Höfen prägen. zu Länge) aufweist. Es gibt nur ein Vollgeschoss Höfen liegt in einer Höhenlage, oberhalb der Per- und das ausgebaute Dachgeschoss. Die gerin- lenbachtalsperre. gen Dachüberstände des ungleichschenkligen 199 Baubeispiele 200 Abb. 399: Innenraumansicht des Wohnbereiches Foto: Guido Bourgeret, 2010 Abb. 400: Gebäudeschnitt 1:200 Darstellung: ISL Abb. 401: Grundriss EG 1:200 Darstellung: ISL Abb. 402: Grundriss OG 1:200 Darstellung: ISL Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Abb. 403: Schrägluftbild des denkmalgeschützen Gebäudes mit Garten Foto: Guido Bourgeret, 2010 Abb. 404: Modernes Badezimmer Foto: Guido Bourgeret, 2010 Satteldachs zeichnen den Eifeltyp aus, so auch und auch die Holzklappläden der Holzsprossen- der schlicht ausgebildete Ortgang. fenster mit einem dunkelgrünen (Russischgrün) Schutzanstrich versehen. Einen schönen Kon- Die Belichtung des Dachgeschosses erfolgt über trast bilden die weißen Holzsprossenfenster in zwei Dachgauben in Reihung auf beiden Seiten weißen Fensterlaibungen. Die Fassadengliede- des Gebäudes. Es handelt sich um Rundbo- rung besticht durch die klare Anordnung der in gengauben, einer Achse stehenden Fensterformate im Ver- sogenannte Fledermausgauben, die typisch für eine Dacheindeckung aus Reet hältnis 2:1, die die Belichtung der Innenräume sind. Der gemauerte Kamin aus Ziegelmauer- sicherstellen. Aber auch quadratische Fenster- werk ist nur in der Dachfläche sichtbar. Bei der formate, welche üblicherweise nur bei kleinen Fassadengestaltung sind alle außenliegenden Gebäuden verwendet wurden, sind in diesem Holzbauteile, wie Fachwerkbalken, die ca. 2 m Wohnhaus zu sehen. hohen Holzverschalungen auf den Längsseiten GPS-Koordinaten: 50.537533 N 6.253717 O Kreis: StädteRegion Aachen Gemeinde/Stadt: Stadt Monschau Anschrift: Triftstraße 7, 52156 Höfen Bauherr: Elke und Guido Bourgeret Abb. 405: Gartenansicht des Gebäudes Foto: Guido Bourgeret, 2010 201 bAubEiSPiELE Abb. 406: Neu neben Alt, Gaststätte gegenüber der Kirche St. Clemens, Heimbach, Stadt Heimbach Foto: ISL Aus einer Baulücke wurde ein Ort mit Aufenthaltsqualität! Abb. 407: Gesamtansicht des umgenutzten Gebäudes zu Gastronomie mit Außenbereich Foto: ISL 202 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel 5.2. BEiSpiELE: ANuND umBAu Abb. 408: Lage des Wohnhauses und der Gaststätte in Heimbach, Stadt Heimbach Darstellung: ISL Wohnhaus und Gaststätte in Heimbach Das historische Fachwerkgebäude mit ehe- Das Gebäude wurde in der Vergangenheit mehr- maligem Weinlokal im Erdgeschoss liegt an der fach umgebaut. Zuerst nach dem Wiederaufbau Teichstraße, gegenüber der Wallfahrtskirche St. und der Beseitigung von Kriegsschäden nach Clemens in der Heimbacher Altstadt. Die Stadt dem zweiten Weltkrieg und dann durch Umbau- Heimbach, bekannt als ein anerkannter Luft- maßnahmen des Erdgeschosses für eine gastro- kurort im Kreis Düren, geht in ihrer heutigen nomische Nutzung. Dabei kam es teils zu starken städtischen Ausprägung auf die Burg Henge- Eingriffen in die Bausubstanz, wie z.B. durch den bach zurück. Gründungsgrund des Ortes war Einbau von Stahlträgern im Erdgeschoss. Die sicherlich die Nähe zur Burg, dem fränkischen gesamte Fassade des Gebäudes bestand aus Herrschaftssitz und die vorteilhafte Tallage im einem regelrechten Materialmix aus Mauerwerk, Flusstal der Rur. Heute ist Heimbach neben der Putz, Fassadenbekleidung aus Schieferplatten benachbarten Rurtalsperre ein beliebtestes Nah- und horizontaler Holzverschalung. erholungsgebiet. Aufgrund massiver Schäden am Fachwerk Das Objekt Teichstraße 12 verfügt über zwei konnte dieses nicht freigelegt gezeigt werden, Vollgeschosse und ein Satteldach und steht weswegen das gesamte Gebäude mit einer traufständig zum Straßenraum. Im Zuge der Sa- Holzverschalung, auch zu einer besseren Däm- nierung mehrerer Gebäude in der Teichstraße mung des Gebäudes, versehen wurde. Die kubi- wurde das Nachbargebäude aufgrund massiver stische Erscheinung des Gebäudes wurde noch Feuchteschäden abgerissen. Durch den Wegfall durch die graue Dacheindeckung und die in die dieses Gebäudes entstand an der Giebelseite Traufe integrierte Dachrinne verstärkt. ein kleiner seitlicher Taschenplatz. Dieser ermöglicht jetzt eine Erschließung über die Giebel- Der Außenbereich liegt unmittelbar gegenüber seite und schafft einen neuen Außenraum für die des Treppenaufganges zur St. Clemens Kirche Gastronomie. und schafft somit ein interessantes städtebau- 203 Baubeispiele Abb. 410: Platzgestaltung für Außengastronomie Foto: ISL 13.60 Abb. 409: Farblich akzentuierter Eingang Foto: Bernward Sutmann 8.84 Abb. 411: Grundriss EG 1:200 Darstellung: ISL 204 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Abb. 412: Straßenperspektive Teichstraße Foto: Bernward Sutmann Abb. 413: Gebäude vor der Sanierung Foto: Bernward Sutmann liches Gefüge. Der kleine Taschenplatz wird Fachwerkhäuser in der Teichstraße neu interpre- besonders im Sommer durch die Gastronomie tiert. Es setzt einen besonders gelungenen Ak- genutzt, soll aber langfristig auch öffentlichen zent in der Fassade. Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Die Rückwand des Nebengebäudes wurde in der- Das Beispiel zeigt sehr anschaulich, wie in selben Holzverschalung der Fassade gestaltet. Altstadtsituationen, nach Abriss von baufäl- Bepflanzungselemente sorgen für die sanfte ligen Bauten, städtebauliche Chancen für den Abgrenzung zum Straßenbereich und schaffen Straßenraum entstehen und so neue Außenräu- dadurch einen Hofcharakter. me gestaltet werden können. Vorbildlich wurden hier zwei Grundstücke einer neuen, gemein- Ein besonders schönes Detail ist das kleine qua- samen Nutzung zugeführt und schaffen jetzt ei- dratische Fenster im Dachgeschoss, das mit sei- nen neuen Stadtraum. Das Objekt wurde durch ner roten, hervorstehenden Fenstereinfassung den Holzbaupreis 2008 ausgezeichnet. die ochsenblutroten Fenstereinfassungen der GPS-Koordinaten: 50.634069 N 6.479661 O Kreis: Kreis Düren Gemeinde/Stadt: Stadt Heimbach Anschrift: Teichstraße 12, 52396 Heimbach Planer: Dipl.-Ing. Bernward Sutmann Bauherr: Manfred Jäger 205 Baubeispiele Abb. 414: Fernwirkung der Gaststätte in der Teichstraße Foto: ISL Abb. 415: Schlichte Ergänzung im Straßenraum Foto: ISL Abb. 416: Ansicht Nord 1:200 Darstellung: ISL 206 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Abb. 417: Blick über die Dachlandschaft, das Gebäude fügt sich mit Farbe und Dachform ein Foto: ISL Abb. 418: Ansicht Ost 1:200 Darstellung: ISL Abb. 419: Ansicht Ost Foto: ISL 207 bAubEiSPiELE Abb. 420: Wohngebäude mit Ergänzung im Straßenraum von Kronenburg Foto: siehe Abbildungsverzeichnis Abb. 421: Der Bruchsteinbau vor der Restaurierung Foto: siehe Abbildungsverzeichnis Der Zwischenraum wurde zum neuen Essbereich des Wohnhauses. Abb. 422: Ansicht des Einfamilienhauses und Ateliers Foto: Johannes Böttger 208 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Abb. 423: Lage des Ateliers und Einfamilienhauses in Kronenburg, Gemeinde Dahlem Darstellung: ISL Atelier und Einfamilienhaus in Kronenburg (Dahlem) Der Umbau zum Wohnhaus mit Atelier ist ein vor- mehr und mehr als Künstlerstandort manifestiert. bildliches Beispiel, wie ein vom Abriss bedrohter Die Baulücke zur angrenzenden Scheune wurde historischer Bau einer neuen, zeitgemäßen durch einen komplett verglasten, zweigeschossi- Nutzung zugeführt werden kann. Innerhalb der gen Raum geschlossen, der als Wohnraum ge- Ringmauer des Ortes Kronenburg, zugehörig zur nutzt wird. Sicht- und Sonnenschutz können über Gemeinde Dahlem, befindet sich das Gebäude eine Lamellenfassade aus Lerchenholz reguliert im historischen Ortskern direkt unterhalb der ver- werden. Das Wohnhaus wurde in seiner Orga- fallenen Burg Kronenburg. Es liegt im Burgbering, nisation als Zweiraumgrundriss beibehalten, je- eine der beiden ältesten Straßen in Kronenburg. doch durch neue Ebenen und eine Galerie neu strukturiert. Im Dachgeschoss befindet sich das Durchschreitet man das Stadttor, liegt das Ge- Atelier, welches über eine Glasfuge in der Dach- bäude an einer Straßengabelung. Das kleine fläche belichtet wird. bäuerliche Anwesen stand seit den 80er Jahren leer und war baufällig. Die Kubatur und die Fas- Die Außenräume des Gebäudes, die Dach- sadengestaltung des ehemaligen Wohnhauses terrasse über dem modernen Anbau und die aus verputztem Bruchstein wurden aus Gründen ummauerte Hoffläche hinter dem Gebäude, ver- des Denkmalschutzes bei der Umbaumaßnahme vollständigen das Atelier zu einem gelungenen saniert, der Innenraum wurde jedoch aufgrund Ensemble. Hier wurde insgesamt ein sensibler des schlechten baulichen Zustandes größtenteils Umgang mit der Bausubstanz bei einer dennoch entkernt und neu geplant. zeitgemäßen Anpassung an die Bedürfnisse der neuen Bewohner geschaffen. Der Umbau des historischen Wohnhauses sieht eine Nutzung als Atelier mit integriertem Wohnraum vor. Dies zeigt auch die jüngste Entwicklung des gesamten Ortes Kronenburg, der sich 209 Baubeispiele Abb. 424: Detailansicht Anschluss Glasfassade an Mauerwerk Foto: Johannes Böttger Abb. 425: Innenraumansicht Anbau Foto: Johannes Böttger Abb. 426: Grundriss EG 1:200 Darstellung: ISL Abb. 427: Grundriss OG 1:200 Darstellung: ISL Abb. 428: Grundriss DG 1:200 Darstellung: ISL 210 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Abb. 429: Dachausbau mit Lichtband im Dach Foto: Johannes Böttger Abb. 431: Schnitt A-A 1:200 Darstellung: ISL Abb. 430: Eingangsbereich Foto: Johannes Böttger Abb. 432: Schnitt B-B 1:200 Darstellung: ISL GPS-Koordinaten: 50.364114 N 6.476883 O Kreis: Kreis Euskirchen Gemeinde/Stadt: Gemeinde Dahlem Anschrift: Burgbering 21, 53949 Dahlem (Kronenburg) Planer: Dipl.-Ing. Ulrich Böttger Bauherr: Ulrich und Hetta Böttger 211 bAubEiSPiELE Abb. 433: Neubau an denkmalgeschüztem Fachwerkbau Foto: ISL Anbauten schaffen neue Aufenthaltsqualitäten im Straßenraum! Abb. 434: Anschlussstelle Neubau an denkmalgeschüztem Fachwerkbau Foto: ISL 212 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Abb. 435: Lage des Wohn- und Geschäftshauses in Nettersheim, Gemeinde Nettersheim Darstellung: ISL Wohn- und Geschäftshaus in Nettersheim Die unter Denkmalschutz stehende Hofanlage einen neuen Winkelhof bildet. An der Ostseite in der Gemeinde Nettersheim, bestehend aus wurde das ehemalige Wohnhaus im Baukörper einem Wohnhaus und verlängert und durch einen weiteren, im Winkel Nebengebäuden, war lange Zeit unbewohnt an einem zentralen Ort angeschlossen Anbau ergänzt. in Nettersheim. Die Gemeinde Nettersheim entschied sich daher die Hofanlage aus dem 19. Das Scheunentor wurde in Teilen erhalten, durch Jhd. zu erwerben und zu einem Wohn- und Ge- Fensterelemente ergänzt und dient nun als schäftshaus umzubauen. Um den dreieckigen Schaufenster für eines der Ladenlokale. Auch Vorplatz städtebaulich besser zu fassen, wur- das Fachwerk des ehemaligen Nebengebäudes de die Hofanlage seitlich um zwei Anbauten und die verputzte Bruchsteinfassade des ehe- ergänzt. Heute befinden sich im Erdgeschoss maligen Wohnhauses wurden saniert. Die bei- Ladenlokale, Cafés und eine Postfiliale, im Ober- den Anbauten sind in ihrer Fassadengestaltung geschoss werden Büro- und Praxisräume ge- unterschiedlich ausgebildet. Während der im nutzt. Insgesamt wird die ehemalige Hofanlage Winkel angebaute Baukörper in Holzständerbau- von den Anwohnern der Gemeinde gut ange- weise errichtet und mit horizontaler Holzverscha- nommen und hat sich zu einem neuen Treffpunkt lung versehen wurde, ergänzt der giebelseitige in Nettersheim etabliert. Anbau mit zurückhaltender Farbwahl und Ausbildung der Fassadengestaltung mittels einer Die Zweigeschossigkeit und die Dachform des Glasfuge die bestehende Bausubstanz. Der Satteldaches der Hofanlage wurden in den An- Winkelanbau ist über zwei als Schaufenster bauten aufgenommen, die Fassadengestaltung ausgebildete Erker an das Hauptgebäude an- der Anbauten der bestehenden Hofanlage ange- gegliedert. Die Fenster sind schmal und länglich lehnt. An der Westseite wurde das verwitterte ausgebildet, die Formensprache resultiert aus Nebengebäude entfernt und ersetzt durch einen der Breite der Ausfachung der Holzständerbau- Neubau, der nun mit dem ehemaligen Wohnhaus weise. 213 bAubEiSPiELE Abb. 437: Blick in den modernen Anbau Foto: ISL 12.34 Abb. 436: Übergang zum sanierten Innenraum des Altbaus Foto: ISL 5.34 1.01 Abb. 438: Grundriss EG 1:200 Darstellung: ISL 214 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Abb. 439: Ansicht Nord-Ost 1:200 Darstellung: ISL Dieses Gebäudeensemble wurde aufgrund der GPS-Koordinaten: 50.492678 N 6.628333 O gelungenen Transformation einer historischen Kreis: Kreis Euskirchen Bausubstanz in einen mit neuer Nutzung ver- Gemeinde/Stadt: Gemeinde Nettersheim sehenen Standort in der Gemeinde Netters- Anschrift: Steinfelder Straße 2, 53947 Nettersheim heim ausgewählt und wurde zudem bei dem Planer: Dipl.-Ing. Peter Pütz landesweiten Wettbewerb „Nachhaltige Stadt- Bauherr: Gemeinde Nettersheim entwicklung NRW“ 1998 ausgezeichnet. Abb. 440: Ansicht Nord-West 1:200 Darstellung: ISL 215 Baubeispiele Abb. 441: Anbau aus Holzständerwerk Foto: siehe Abbildungsverzeichnis Abb. 442: Fernwirkung der Biologischen Station mit baulicher Ergänzung Foto: ISL Abb. 443: Straßenansicht des Anbaus und Winkelhofes der Biologischen Station Foto: ISL 216 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Abb. 444: Lage der Biologischen Station in Nettersheim, Gemeinde Nettersheim Darstellung: ISL Biologische Station und Literaturhaus in Nettersheim Die denkmalgeschützte Winkelhofanlage aus der in dem Gebäude seinen Sitz gefunden hat. dem 19. Jhd. ist seit 1993 im Besitz der Gemein- Neben Büroräumen beherbergt der Grundriss de Nettersheim. Die attraktive Lage des Gebäu- ein Foyer und verschiedene Ausstellungsräume, des in der vom Wandel geprägten Steinfelder die die Arbeit der Biologischen Station für die Straße legte den Erhalt und eine Umnutzung der Öffentlichkeit zugänglich machen. Gestalterisch Bausubstanz nahe. heben sich die beiden Gebäudeteile in ihren Fassaden voneinander ab. Das Fachwerk der Die Anlage besteht aus einem traufständigen, historischen Gebäudeteile wurde saniert, der in von Stallgebäude Holzständerbauweise errichtete Anbau mit grau und einem giebelständigen Haupthaus, die lasiertem Holz verschalt. Die Fensterrahmen des gemeinsam im Winkel einen Hof bilden. Beide Neubaus wurden rot gestrichen in Adaption der Baukörper sind zweigeschossig, in Fachwerk- ochsenblutroten Fenstereinfassungen des Fach- konstruktion errichtet und mit Satteldächern im werkbaus. Auf diese Art und Weise entsteht ein 45° Winkel gedeckt. Neben dem Erhalt des vor- stimmiges Gesamtbild. Die Fensterformate sind handenen Winkelhofs wurde die Anlage durch in beiden Gebäudeteilen klein gehalten, nur das einen winkelförmigen Erweiterungsbau ergänzt. Foyer ist, zum Garten hin, durch einen Winter- Dieser besteht aus einem zweiten giebelstän- garten großzügig belichtet. der Straße abgerückten digen Bau, der in Größe und Proportion an das historische Wohnhaus angelehnt ist und wird mit Das Projekt zeigt insgesamt wie durch die ge- dem Bestand über einen traufständigen Bau ver- lungene Restaurierung der denkmalwerten Hof- bunden. So entsteht zur Straße eine zweite Hof- anlage und einer modernen Erweiterung ein fläche, die als Eingangsbereich für die bauliche neuer Ort für die Biologische Station und das Erweiterung dient. Der Innenbau des Komplexes Literaturhaus und damit ein neuer, attraktiver An- wurde nach den Bedürfnissen des Vereins „Bio- laufpunkt in der Gemeinde Nettersheim geschaf- logische Station Kreis Euskirchen e.V.“ gestaltet, fen werden konnte. 217 Baubeispiele Abb. 445: Gartenansicht Biologische Station Foto: ISL Abb. 446: Grundriss EG 1:200 Darstellung: ISL 218 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel GPS-Koordinaten: 50.492822 N 6.628381 O Kreis: Kreis Euskirchen Gemeinde/Stadt: Gemeinde Nettersheim Anschrift: Steinfelder Str.10, 53947 Nettersheim Planer: Dipl.-Ing. Peter Pütz Abb. 447: Innenansicht des Wintergartens Foto: ISL Abb. 448: Schnitt A-A 1:200 Darstellung: ISL Abb. 449: Ansicht Nord-West 1:200 Darstellung: ISL 219 bAubEiSPiELE Abb. 450: Das Holzkompetenzzentrum Foto: ISL Bauliche Ergänzungen schaffen Platz für Anforderungen und Nutzer - das gebäude wächst mit! Abb. 451: Anbau des Holzkompetenzzentrums Foto: ISL 220 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Abb. 452: Lage des Holzkompetenzzentrums in Nettersheim, Gemeinde Nettersheim Darstellung: ISL Holzkompetenz- und Naturschutzzentrum in Nettersheim Das Naturschutzzentrum Eifel existiert seit dem gebot beinhaltet ein Foyer mit Informationsstand, Jahr 1989 im Ortskern von Nettersheim. In einem einen Museumsshop und ein kleines Café. Das leerstehenden Winkelhof, bestehend aus einem Obergeschoss schafft Raum für weitere Büro- Haupthaus mit angrenzendem Nebengebäude, und Aufenthaltsräume für Mitarbeiter. wurde in einer ersten Umbaumaßnahme ein Ort für eine naturkundliche Ausstellung mit dazu- Im Jahr 2002 wurde das Gebäudeensemble gehörigen Labor- und Büroräumen geschaffen. erneut erweitert, um den Sitz des Holzkompe- Das Zentrum wurde bereits nach kurzer Zeit tenzzentrums in direkter Nachbarschaft zu der überregional bekannt und zum beliebten Ziel für bereits gut angenommenen Einrichtung zu reali- Wanderer, Seminarbesucher und Touristen, die sieren. Das Zentrum arbeitet zusammen mit dem das vielfältige Angebot der Naturerlebnispäda- Regionalforstamt gogik wahrnahmen. Die bestehenden Räumlich- dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW und der keiten reichten schon bald nicht mehr aus, um Gemeinde Nettersheim. Hocheifel-Zülpicher Börde, den wachsenden Besucherzahlen gerecht zu werden. Das erste Bauvorhaben beinhaltete die Erweiterung um einen langgestreckten zweige- Die erste Erweiterung fand 1995 statt. Der Win- schossigen kelbau wurde an der Nordseite des Gebäudes die Verwaltungs- und Nebenräume des Holz- angebaut und erzeugt mit dem Bestand ein har- kompetenzzentrums aufnimmt und einen aus monisches Gesamtbild. Der zweigeschossige der Anbau wurde passend zum Konzept der Ausstel- Mehrzweckraum in Holzständerbauweise, der lung in ökologischer Bauweise aus einer Holz- als Ausstellungs- und Seminarraum dient. Der ständerkonstruktion errichtet, mit Schilfmatten Verwaltungsbau nimmt sich mit seiner weiß ver- verschalt und einer Mischung aus grobem Lehm putzten Fassade und der dunklen Dachfläche und Holzspänen ausgefacht. Das neue Rauman- sehr zurück, wobei der Ausstellungsraum durch Flucht Baukörper mit Satteldach, herausgedrehten der quadratischen 221 Baubeispiele Abb. 453: Fassade, holzverschalt Foto: ISL Abb. 454: Außenfassade und Platz Foto: ISL Abb. 455: Außenansicht Foto: ISL Abb. 456: Außenansicht Foto: ISL Abb. 457: Außenansicht und Eingangsbereich Foto: ISL 222 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Abb. 458: Innenansicht Foto: ISL seine Form und Funktion im Mittelpunkt der Anla- zum aktiven Dorfleben und zur Stärkung der ge steht. Die Holzkonstruktion wurde in Fassade Dorfgemeinschaft bei. und Dach sichtbar gelassen und zeigt eine neue Interpretation eines historischen Fachwerkbaus. Die vielen Erweiterungsschritte zeigen die nach- Die beiden Gebäudeteile sind durch ein einge- haltige Planung des Gebäudes, welches bei schossiges Foyer untereinander und mit dem erhöhtem Platzbedarf durch weitere Gebäude- Naturschutzzentrum verbunden, sodass ein zu- teile vielfach an- und umgebaut werden konn- sammenhängendes Gesamtensemble entsteht. te. Diese Flexibilität spricht auch für historische Bauernhäuser, die ebenfalls an veränderte Le- 2005 wurde ein weiterer Anbau als Verwaltungs- benssituationen angepasst werden konnten und bau angefügt. Dieser Baukörper schließt im stellt so in einem größeren baulichen Maßstab rechten Winkel an das bestehende Verwaltungs- ein interessantes Beispiel regionaler Bauweise gebäude an, bildet einen Winkelhof um den in heutiger Zeit dar. Mehrzweckraum und gibt der gesamten Anlage, bestehend aus Holzkompetenzzentrum und Naturschutzzentrum, einen gelungenen baulichen Abschluss. Das Gebäudeensemble ist besonders in seiner Funktion als überregional bedeutsame Ein- GPS-Koordinaten: 50.490019 N 6.628031 O richtung vorbildlich. In Nettersheim hat sich das Kreis: Kreis Euskirchen Zentrum zu einer gut angenommen Anlaufstelle Gemeinde/Stadt: Gemeinde Nettersheim entwickelt. Durch zahlreiche öffentliche Veran- Anschrift: Römerplatz 12, 53947 Nettersheim staltungen, Ausstellungen zu regional relevanten Planer: Dipl.-Ing. Peter Pütz Themen und Feste trägt die Einrichtung auch Bauherr: Holzkompetenzzentrum Rheinland 223 12.82 11.12 56.65 9.36 56.65 Abb. 459: Grundriss EG 1:500 Darstellung: ISL 224 11.12 9.36 Baubeispiele 12.82 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Abb. 460: Grundriss OG 1:500 Darstellung: ISL Abb. 461: Ansicht West 1:500 Darstellung: ISL Abb. 462: Ansicht Ost 1:500 Darstellung: ISL Abb. 463: Ansicht Nord 1:500 Darstellung: ISL 225 bAubEiSPiELE Abb. 464: Der Anbau ordnet sich in seiner Proportion dem Haupthaus unter Foto: ISL Abb. 465: Straßenansicht des Einfamilienhauses Foto: ISL Durch Ergänzungen des Altbaus wird eine neue Hofatmosphäre geschaffen. Abb. 466: Straßenansicht des Einfamilienhauses Foto: ISL 226 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Einfamilienhaus in Roetgen Das Einfamilienhaus liegt am Ortsrand von Roet- Wohnräume angeordnet, unter der Abschlep- gen und zeigt, wie durch einen modernen Anbau pung befanden sich kleinere Wirtschaftsräume, eine gelungene Erweiterung des begrenzten im Dachgeschoss lagen einst die Schlafzimmer. Wohnraums in einem historischen Fachwerk- Diese Grundrissaufteilung wurde bei der Sa- gebäude geschaffen werden kann. nierung des Gebäudes beibehalten, jedoch durch den Anbau erweitert. Im ehemaligen Wohnraum, Das historische Fachwerkgebäude steht giebel- neben der Eingangstür, liegen die Wohnküche, ständig zur Straße und wurde einerseits zum unter der Abschleppung ein Wirtschaftsraum Garten verlängert und zusätzlich durch einen und ein Arbeitsplatz. Das Wohnzimmer der Fa- winkelförmigen Anbau ergänzt. Gemeinsam milie befindet sich nun im Anbau und gestaltet mit dem Bestand bildet das Ensemble eine dadurch den gesamten Wohnraum großzügiger. umschlossene Hoffläche. Diese dient als Ein- Das Schlafzimmer im Obergeschoss des Altbaus gangsbereich und Stellplatz, kann aber auch als wird durch eine Ankleide und ein Badezimmer in Spielfläche genutzt werden und schafft so eine der Dachschräge ergänzt. Schnittstelle zwischen öffentlich und privat sowie eine Begegnungsfläche für Hauseigentümer und Der Neubau beinhaltet die Kinderzimmer mit ei- Nachbarn. genem Badezimmer. Der zweigeschossige Anbau ist ebenfalls auf der hofabgewandten Seite Der vorhandene Bestand des historischen abgeschleppt. Die Gebäudeteile werden durch Fachwerkgebäudes ist ein eineinhalb raum- einen eingeschossigen Baukörper, die Erweite- tiefes, rung des Wohnraums, miteinander verbunden. zweigeschossiges Fachwerkgebäude mit zur Westseite abgeschlepptem Satteldach. Der Haustyp ist in der Region sehr typisch und Die drei Gebäudeteile unterscheiden sich in ihrer wird auch als Eifeltyp bezeichnet. Zur seitlich Fassadengestaltung. Während der Altbau ein- gelegenen Hoffläche waren ursprünglich die deutig durch das restaurierte Fachwerk besticht, 227 bAubEiSPiELE Ansicht Ost Abb. 468: Ansicht Süd-West 1:500 Darstellung: ISL Abb. 467: Ansicht Nord-West 1:500 Darstellung: ISL Ansicht West Ansicht Süd Ansicht West Ansicht Ost Abb. 469: Ansicht Süd-Ost 1:500 Darstellung: ISL Ansicht Nord Ansicht Nord 9.66 5.46 B 11.07 Abb. 470: Ansicht Nord-Ost 1:500 Darstellung: ISL A B 12.66 A C C Ansicht Süd Abb. 471: Grundriss EG 1:200 Darstellung: ISL 228 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Schnitt 1-1 Abb. 472: Schnitt B-B 1:200 Darstellung: ISL Schnitt 2-2 zeichnen sich die Anbauten durch Bruchsteinmauerwerk und grau lasierte Holzverschalung aus. Einheitlich in allen Gebäudeteilen sind die stehenden und kleinen Fensterformate aus dem historischen Gebäude übernommen. Zum Garten hin öffnet sich der Wohnraum mit großzügigen Fensterelementen. Im Altbau wurden die historischen Sprossenfenster saniert, im Neubau wurden Holzrahmenfenster eingesetzt. Abb. 473: Schnitt A-A 1:200 Darstellung: ISL Schnitt 1-1 Auffällig sind die bodentiefen Fensterflügel, die den mittleren Gebäudeteil als Nebeneingang zur Hoffläche öffnen lassen und damit eine flexible Nutzung der Hoffläche schaffen. Bei einem Bewohnerwechsel oder Veränderung der Lebenssituation der Eigentümer könnte der Anbau so auch als separat erschlossene Einliegerwohnung genutzt werden. Die Multifunktionalität, die sich GPS-Koordinaten: k.A. in dieser neu geschaffenen Hofanlage abzeich- Kreis: StädteRegion Aachen net, entspricht in bemerkenswerter Weise einer Gemeinde/Stadt: Gemeinde Roetgen Weiterführung der einst so wandelbaren Gebäu- Planer: Dipl.-Ing. Karl-Heinz Severich de. Die Chancen der historischen Bausubstanz Bauherr: Karl-Heinz Severich u. Kathrin Stärk werden geschickt durch neue Anbauten genutzt. Schnitt 2-2 229 bAubEiSPiELE Abb. 474: Ansicht des Einfamilienhauses vom Grundstück aus Foto: ISL Schlichter Baukörper, einfaches Satteldach! Abb. 475: Straßenansicht des Einfamilienhauses Foto: ISL 230 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel 5.3. BEiSpiELE: NEuBAu Abb. 476: Lage des Einfamilienhauses in Mützenich, Stadt Monschau Darstellung: ISL Einfamilienhaus in Mützenich (Monschau) Das Einfamilienhaus liegt hinter Buchenhecken 45° Winkel geneigte Satteldach sind ebenfalls etwas zurückgesetzt von der Straße und passt nach dem Vorbild des historischen Langhauses sich somit gut in das Siedlungsbild von Mütze- errichtet. In der Dachfläche dienen kleine, gut in- nich, zugehörig zur Stadt Monschau, ein. Das tegrierte Dachflächenfenster der Belichtung des am Rande des Ortes gelegene Baugrundstück Obergeschosses. ermöglicht einen weiten Blick in die offene Kul- Das Gebäude verfügt straßenseitig über zwei turlandschaft. Die angrenzenden Gebäude sind Vollgeschosse, das Erdgeschoss ist rückseitig ebenfalls Neubauten, die meist giebelständig in in das Gelände eingegraben. Die Erschließung einer lockeren Struktur auf großen Parzellen an- erfolgt seitlich über das erste Obergeschoss. geordnet sind. Die Zufahrt zum Wohnhaus ist mit Auffällig sind die beiden großzügigen Fenster- Bruchsteinmauern eingefasst, einem in der Eifel öffnungen an den Giebelseiten des Gebäudes, häufig verwendeten Baumaterial. die zur Belichtung der dahinter liegenden zweigeschossigen Wohnräume dienen. Die Neben- Das Grundstück ist zur Straße hin leicht ab- räume werden über Fensterbänder in den Lang- schüssig. Diese topographische Gegebenheit seiten belichtet, im Obergeschoss befinden sich wurde bei dem Entwurf genutzt um eine Gara- Arbeitsräume mit Anschluss zum Wohnzimmer ge mit ebenerdiger Zufahrt im Gebäude zu in- über eine Galerie. tegrieren. Auf diese Art und Weise entsteht ein einfacher Baukörper, der ohne Nebengebäude und Anbauten auskommt. Das Gebäudevolumen ist dem historischen Bautyp des einraumtiefen Langhauses nachempfunden, einem in der Ei- GPS-Koordinaten: 50.556681 N 6.206744 O Kreis: StädteRegion Aachen Gemeinde/Stadt: Stadt Monschau fel weit verbreiteten Gebäudetyp. Der lange und Anschrift: Reichensteiner Straße 76, 52156 Monschau (Mützenich) schmale Bau steht giebelständig zur Straße. Planer: Dipl.-Ing. Paul Link Die Ausrichtung des Gebäudes sowie das im Bauherr: Dr. Reinhard Jonen 231 Baubeispiele Abb. 477: Ansicht Süd-West 1:200 Darstellung: ISL Abb. 478: Grundriss EG 1:200 Darstellung: ISL Abb. 479: Schnitt A-A 1:200 Darstellung: ISL 232 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Abb. 480: Schnitt B-B 1:200 Darstellung: ISL Abb. 481: Innenraumansichten Foto: ISL Abb. 482: Grundriss OG 1:200 Darstellung: ISL Abb. 483: Ansicht Süd-Ost 1:200 Darstellung: ISL 233 bAubEiSPiELE Abb. 484: Straßenansicht Foto: Elmar Paul Sommer, 2010 Nutzen Sie ihren garten als Bauerngarten und pflanzen Sie regionale Pflanzen an. Abb. 485: Nordansicht des Haus Sommer Foto: Elmar Paul Sommer, 2010 234 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Abb. 486: Lage des Haus Sommer in Widdau, Stadt Monschau Darstellung: ISL Einfamilienhaus in Widdau (Monschau) Widdau liegt in zehn minütiger Entfernung zur Die Erschließung des Wohnhauses erfolgt Stadt Monschau. Der Landschaftsraum ist be- über die Giebelseite. Das Nebengebäude aus sonders prägnant durch regionaltypische meter- Natursteinmauerwerk hohe Buchenhecken geprägt, die aufgrund der schließt das Wohngebäude über eine vorge- windexponierten Plateaulage der meisten Dörfer lagerte Hoffläche an die Straße an. um die ge- den Gebäuden als Windschutz dienen. Diese wünschte Wohnfläche zu erzielen, musste das Region wird daher auch als Monschauer He- Gebäude bei der maximal möglichen Breite von ckenland bezeichnet. Widdau zeichnet eine lo- 6 m mit einer Länge von 18 m in das Grundstück ckere Bebauungsstruktur der Gebäude auf gro- geplant werden. Der daraus entstandene lange ßen Parzellen in überwiegender Hanglage aus. und schmale Baukörper und die einraumtiefe Or- in Trockenbauweise ganisation des Grundrisses entsprechen in ihrer Das 2007 fertiggestellte Einfamilienhaus liegt in Proportion dem eifeltypischen Langhaus. Zwei- der Veilchenstraße. Das großzügige Grundstück geschossig ausgebaut und mit einem im 45° wird von der Straße aus über die Schmalseite er- Winkel geneigten Satteldach, nimmt der Baukör- schlossen und öffnet sich in Hanglage zu einer per die historischen Merkmale dieses Typus auf. großen Obstwiese. Die Stellung der Nachbar- Der geringe Dachüberstand trägt zusätzlich zur gebäude und der schmale Zuschnitt der Parzelle klaren Formensprache des Gebäudes bei. Die begünstigten eine zurückgesetzte giebelständige Hanglage des Gebäudes ermöglicht die Nutzung Gebäudepositionierung. Der alte Baumbestand des Kellergeschosses. Die daraus entstehende des Grundstücks wurde in die Neuplanung ein- Dreigeschossigkeit des Gebäudes ist vom Stra- gebunden. Von der Straße aus gesehen nimmt ßenraum nicht sichtbar. sich der Baukörper durch die zurückgesetzte Lage im Hang und die Einfriedung durch Buchenhecken sehr zurück. 235 Baubeispiele Abb. 487: Nordansicht des Schuppens aus Natursteinmauerwerk Foto: Elmar Paul Sommer, 2010 A A Abb. 488: Fernwirkung Südansicht Foto: Elmar Paul Sommer, 2010 A' 5.99 5.99 B C C 14.74 14.74 B' B B C A A A' Abb. 489: Grundriss EG 1:200 Darstellung: ISL 236 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Abb. 490: Grundriss OG 1:200 Darstellung: ISL Abb. 491: Gartenansicht Foto: Elmar Paul Sommer, 2010 Abb. 492: Fassade im Bau Foto: Elmar Paul Sommer, 2006 Die Konstruktion besteht aus einem Holzständerwerk mit kleinen Öffnungen zur Straße und besitzt eine großzügige Verglasung zum Garten. Im Erd- und Kellergeschoss sind die Fensterformate stehend ausgebildet, im Obergeschoss liegend. Die Fassade ist mit einer hellblau lasierten Holzverschalung versehen und schafft so einen Kontrast zu dem Natursteinmauerwerk des Nebengebäudes. Vorbildlich im energetischen Sinne ist ebenfalls die Beheizung des Gebäudes durch eine Holzpelletheizung zu Abb. 493: Schnitt C-C 1:200 Darstellung: ISL benennen. GPS-Koordinaten: 50.560269 N 6.301689 O Kreis: StädteRegion Aachen Gemeinde/Stadt: Stadt Monschau Anschrift: Veilchenstraße 15, 52156 Monschau Baukosten: 260.000 Euro Planer: Dipl.-Ing. Elmar Sommer Abb. 494: Schnitt B-B 1:200 Darstellung: ISL Bauherr: Dipl.-Ing. Elmar Sommer 237 bAubEiSPiELE Begrenzen Sie ihren garten mit Buchenhecken und schaffen so einen Übergang zum Landschaftsraum. Abb. 495: Gebäudeansicht 1:200 Darstellung: ISL Abb. 496: Gebäudeansicht 1:200 Darstellung: ISL 238 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Abb. 497: Schnitt A-A 1:200 Darstellung: ISL Abb. 498: Gebäudeansichten 1:200 Darstellung: ISL 239 bAubEiSPiELE Abb. 499: Historisches Scheunengebäude aus Marmagen als Ideengeber zur Verwendung von Holz und Bruchsteinfassade im Neubau Foto: Georg Poensgen Ehrlich zweigeschossig gebaut! Abb. 500: Straßenansicht des Einfamilienhauses Foto: Thomas Koculak, 2010 240 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Abb. 501: Lage des Einfamilienhauses in Marmagen, Gemeinde Nettersheim Darstellung: ISL Einfamilienhaus in Marmagen (Nettersheim) Das freistehende Einfamilienhaus fällt beson- Formal bildet er den Mittelpunkt des Gebäudes, ders aufgrund seiner modernen, jedoch ört- der eine besondere Stellung als Aufenthaltsraum lich angepassten Fassadengestaltung auf. Im einnimmt. Ortskern von Marmagen, der geprägt ist durch zweigeschossige, im Wechsel von trauf- und gie- Im Obergeschoss befinden sich die Schlaf- und belständigen Gebäuden mit dunkel gedeckten Wohnräume mit Balkon zum Gartenbereich. Die Satteldächern, scheint das Gebäude zunächst beiden Geschosse sind in unterschiedlichen deplatziert. In der lockeren Anordung der Gebäu- Materialien ausgebildet. Das Sockelgeschoss de im Dorfgrundriss von Marmagen zeigt es aber besteht aus Bruchsteinmauerwerk, das Ober- dennoch bemerkenswert eine Neuinterpretation geschoss ist in Holzkonstruktionsbauweise er- von historisch verwendeten Baumaterialien und richtet und mit einer Holzverschalung verkleidet. schafft so einen besonderen Brückenschlag zur Diese Kombination der Materialien wurde im historischen Bausubstanz. Ortskern von Marmagen regional häufig verwendet und ist für das Einfamilienhaus neu inter- Es verfügt über zwei Vollgeschosse, wobei das pretiert worden. Es entsteht ein eindrucksvoller Erdgeschoss einen winkelförmigen Sockel aus- Kontrast zwischen einem massiv wirkenden So- bildet über den das rechteckige Obergeschoss ckelgeschoss und einem leicht wirkenden Ober- zur Straße und zum Garten hin auskragt. Das geschoss. Erdgeschoss besteht aus einem Baukörper, zurzeit als Architekturbüro genutzt, der über die Der Grundriss kann flexibel an die Bedürfnisse Schmalseite von der Straße aus erschlossen der Bewohner angepasst werden. So könnte im wird. Das angebaute Wirtschaftsgebäude steht Erdgeschoss im Bedarfsfall eine zweite Woh- im rechten Winkel dazu und beinhaltet Garage nung entstehen oder beide Geschosse könnten und Nebenräume. Der Winkelhof grenzt über zu einen großen Wohnhaus zusammengefasst eine seitliche Hoffläche an den Straßenraum an. werden. 241 Baubeispiele Abb. 502: Nord-Ostansicht des Einfamilienhauses Foto: Georg Poensgen, 2010 Abb. 503: Grundriss EG 1:200 Darstellung: ISL 242 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Abb. 504: Gartenansicht mit großen Fensterflächen Foto: Georg Poensgen, 2010 Abb. 505: Gestaltung des Außenbereiches Foto: Georg Poensgen, 2010 Die Belichtung des Gebäudes erfolgt über großzügige Fensterflächen zum Hof und Garten, der Sockel ist zur Straße und Nordwestseite durch kleine stehende Fensterformate durchbrochen. Das Obergeschoss zeigt im Kontrast dazu horizontale Fensterbänder. Das Gebäude wird als vorbildlich bewertet aufgrund seiner modernen, flexibel nutzbaren Grundrisse und durch die Verwendung von ortstypischen Materialien, die einen starken Ortsbezug herstellen und den regionalen Charakter des Ortes weitertragen. GPS-Koordinaten: 50.478433 N 6.584369 O Kreis: Kreis Euskirchen Gemeinde/Stadt: Gemeinde Nettersheim Anschrift: Zum Rott 13, 53947 Nettersheim Baukosten: 235.000 Euro Planer: Dipl.-Ing. Georg A. Poensgen Bauherr: Dipl.-Ing. Georg A. Poensgen 243 bAubEiSPiELE Prüfen Sie Ihr Bauvorhaben auch in einem dreidimensionalen Kontext, lassen Sie sich ein modell im 1:50 maßstab bauen! Abb. 506: Ansicht Nord-West 1:200 Darstellung: ISL Abb. 507: Grundriss OG 1:200 Darstellung: ISL 244 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Abb. 508: Innenansicht Wohnküche Foto: Georg Poensgen, 2012 Abb. 509: Innenansicht Treppenhaus Foto: Georg Poensgen, 2012 Abb. 510: Ansicht Süd-West 1:200 Darstellung: ISL 245 bAubEiSPiELE Abb. 511: Straßenzug in Breinig, Stadt Stolberg Foto: ISL Einheitlichkeit in material und Farbe schafft Zusammenhalt. Abb. 512: Ansicht des denkmalgeschützen Straßenraumes Alt Breinig, Stadt Stolberg Foto: ISL 246 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel 5.4. BEiSpiELE: STÄDTEBAuLiCHE ENSEmBLES Straßenzug Alt-Breinig in Breinig (Stolberg) Breinig liegt südöstlich von Aachen im Bereich wonnen. Aufgrund der Nähe zu Stolberg und der des Vennvorlandes und ist seit 1972 zu Stolberg Gewinnung zugehörig. Alt-Breinig zeichnet sich besonders wuchs Breinig im 19. Jhd. stetig. Hammerwer- durch den städtebaulichen Ensemblewert und ke, verarbeitende Betriebe wie die „Zinkhütten“, den behutsamen Erhalt der historischen Bau- Bergbaubetriebe und Steinbrüche prägten die substanz aus. Der gesamte Straßenzug Alt- Umgebung stark. Breinig wurde überwiegend Breing steht daher unter Denkmalschutz und ist von Bergarbeitern bewohnt und auf kleineren, als besonders regional typischer Ort durch die länglichen Grundstücksparzellen wurde Land- Arbeitsgemeinschaft Historische Ortskerne in wirtschaft für den Eigenbedarf betrieben. von zahlreichen Bodenschätzen, Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. In den 60er Jahren begann ein verstärkter Trend Der Ortskern entstand aus einer römisch-kel- zum Auszug aus der maroden Bausubstanz tischen Ansiedlung. Eine römische Straße, die des Ortskerns in umliegende Neubaugebiete, von Nordfrankreich über Belgien nach Köln wodurch großer Leerstand zu befürchten war. führte, ging an dem Ort Britiniacum – so lautete Dieser Entwicklung wurde ab 1980 entgegen- der galloromanische Name für Breinig - vorbei. gewirkt, indem etwa 90 Bauten im historischen Breinig wurde 1303 erstmals urkundlich erwähnt, Ortskern konsequent und detailgetreu restauriert allerdings konnte durch archäologische Unter- und saniert wurden. suchungen die frühgeschichtliche Existenz des Ortes bewiesen werden. In der Umgebung wur- Die Gebäude des historischen Ortskerns sind de schon in römischer Zeit Blei und Zink abge- überwiegend mit lokalem Bruch- und Blaustein baut. Beispielsweise waren am Schlangenberg aus dem nah gelegenen, heute stillgelegten Hunderte von Erzarbeitern beschäftigt. Heute ist Steinbruch „Schomet“ gebaut worden. Dies zeigt es ein Naturschutzgebiet. An der Breinigerheide deutlich auf, wie die lokalen Bezüge von Bau- wurde ebenfalls in kleinen Mengen Eisenerz ge- materialien den Straßenraum geprägt haben 247 Baubeispiele Abb. 513: Einheitlichkeit in Baukonstruktion und Farbwahl Darstellung: ISL Abb. 514: Straßenraum Alt Breinig, Stadt Stolberg Darstellung: ISL Abb. 515: Orthofoto von Breinig, Stadt Stolberg Quelle: siehe Abbildungsverzeichnis 248 Informationen zum Planen, Bauen und Gestalten - Baukultur in der nordrhein-westfälischen Eifel Abb. 516: Darstellung des Straßenraumes Darstellung und Foto: ISL und noch bis heute prägen. Die Pfarrkirche St. Barbara wurde im 19. Jhd. im „Nazarener Stil“ nach Plänen von Johann Peter Cremer errichtet. Beachtenswerte Bauwerke sind ebenfalls die alten Gutshöfe, wie das Gut Stockem und das Gut Rochenhaus. Heute ist der historische Ortskern ein vitaler und belebter Wohnstandort. Eingebettet in die idyllische Umgebung, geprägt durch Viehwiesen und Waldflächen, renaturierte Bachläufe sowie ehemalige Steinbrüchen mit schroffen und moosbewachsenen Klippen, wird Breinig durch den lokalen Tourismus stark gefördert. Vgl. http://www.hist-stadt.nrw.de/Stadtkerne/portait.php?stadt=49 am 10.11.2011 Abb. 517: Der Dorfgrundriss zeigt eine eindeutige Entwicklung entlang der Straße Quelle: siehe Abbildungsverzeichnis 249