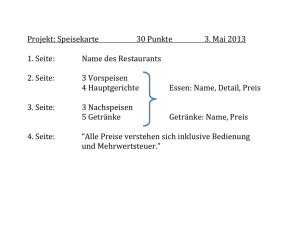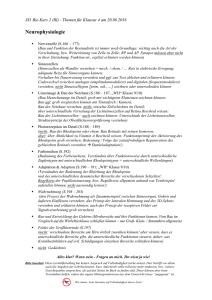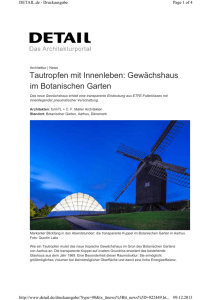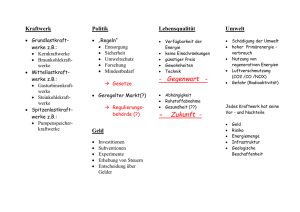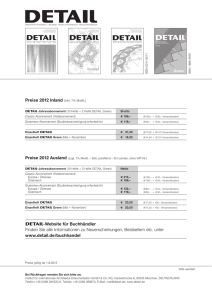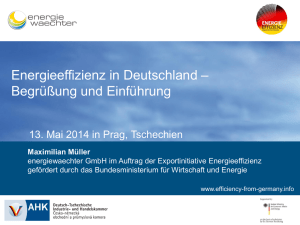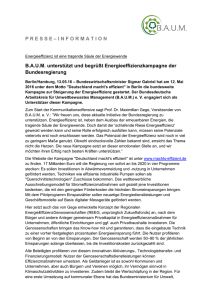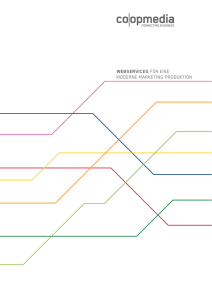Page 1 of 3 DETAIL.de - Architekturportal und Architekturzeitschrift
Werbung

DETAIL.de - Architekturportal und Architekturzeitschrift mit Informationen und tage... Page 1 of 3 Home » Green » Themen-Dossiers » Nachhaltige Wohnkonzepte NACHHALTIGE WOHNKONZEPTE Der Energiegewinner: „Kraftwerk B“ in Bennau [29.10.2009] In Bennau (Kanton Schwyz) steht eines der ersten Plusenergiehäuser der Schweiz. Im Jahresdurchschnitt erzeugt das Mehrfamilienhaus mit dem programmatischen Namen „Kraftwerk B“ mehr Energie, als es für Heizung, Warmwasser und Haushaltstrom benötigt. Auch gestalterisch kannten die Entwurfsverfasser, Grab Architekten aus Altendorf, keine Berührungsängste mit moderner Technik: Mehr als 370 Quadratmeter Photovoltaikzellen und Solarkollektoren sind in die Gebäudehülle integriert und wurden so zum entwurfsbestimmenden Element. Die Voraussetzung, in der Ortsmitte von Bennau ein PlusEnergiehaus zu realisieren, waren ideal: Mit 1200 kWh pro Quadratmeter und Jahr erhält der Ort ungewöhnlich viel Sonneneinstrahlung; ferner erlaubte das Grundstück die Realisierung eines Neubaus mit großer, unverschatteter Südfassade. Um die thermische Speicherwirkung zu maximieren, entschieden sich Grab Architekten für eine Stahlbetonkonstruktion mit vorgehängter Holzelement-Fassade. Das Gebäudevolumen ist kompakt, Fassade und Dach sind mit einer 50 Zentimeter dicken Wärmedämmung versehen. Für ein angenehmes, gesundes Innenraumklima sorgen eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung und schadstofffreie Materialien in den Innenräumen. 150 m2 Sonnenkollektoren in der Südwestfassade liefern jährlich 30 000 kWh Wärmeenergie, die 220 m2 umfassende, dachintegrierte Photovoltaik-Anlage produziert pro Jahr 28 000 kWh Strom. Beide sind in die Gebäudehülle integriert, nicht nachträglich darauf appliziert. Besonders deutlich wird dies an der Südwestfassade, die durch eine geschossweise leicht versetzte Abfolge von Sonnenkollektoren und gebäudehohen Passivhausfenstern mit überdämmten Rahmen (U-Wert 0,5 W/m²K) gegliedert wird. Nach Berechnungen der Architekten amortisiert sich die Energie, die zum Herstellen der Solartechnik aufgewendet wurde, binnen eineinhalb Jahren. Ein effizientes Haustechnik-Konzept mit zentralem Speicher und Holzöfen in den Wohnungen tragen das ihre dazu bei, dass mehr Energie zur Verfügung steht, als in den sechs 5 ½-ZimmerWohnungen sowie der Loftwohnung im Attikageschoss verbraucht wird. So verzichteten die Architekten auf einen großen Saisonalspeicher: Statt dessen wird die überschüssige Wärme in den Sommermonaten in das Heizsystem des benachbarten 15Familienhauses eingespeist, der elektrische Strom fließt ins Netz. Die Planung all dieser Maßnahmen bedingte eine Projektierungsphase mit intensiver Abstimmung sämtlicher beteiligten Fachleute. Hierzu arbeiteten Grab Architekten mit dem Planungsbüro Intep-Integrale Planung zusammen, das die materialökologische und bauphysikalische Beratung übernahm und den Antrag für die Zertifizierung nach MINERGIE-P-ECO bearbeitete. Der Sprung zum Plus-Energie-Haus glückte schließlich jedoch nur, weil auch die Mieter miteinbezogen sind. In der pauschalen Monatsmiete von 2600 Schweizer Franken sind die Energiekosten mit eingerechnet – allerdings nur, wenn man sich auf einen vernünftigen Verbrauch beschränkt. Sobald man das Energiebudget überschreitet, wird es teuer. Damit die Mieter den Stand ganz einfach überprüfen können, wurde eigens für das Haus ein Display entwickelt, das in jeder Wohnung den jeweiligen Verbrauch an Strom, Wasser und Heizenergie anzeigt. Gespräch mit Josef Grab http://www.detail.de/artikeldrucken_kraftwerk-b-bennau-grab-architekten_24281_De... 2010-03-12 DETAIL.de - Architekturportal und Architekturzeitschrift mit Informationen und tage... Page 2 of 3 Mit dem Kraftwerk B in Bennau haben Sie als Architekt und Bauherr das erste Plus-Energie-Mehrfamilienhaus der Schweiz realisiert. Welche Rolle spielen dabei die Mieter? Ein Plusenergiehaus setzt eine integrale Zusammenarbeit voraus, die nicht einfach beendet ist, wenn das Gebäude steht. Die Bewohner müssen mitziehen. Wir haben extra für das Kraftwerk B Displays entwickelt, die es den Mietern ermöglichen, ihren Energieverbrauch laufend zu überprüfen und auch zu steuern. Das lohnt sich deshalb, weil im pauschalen Mietpreis die Kosten für den Energieverbrauch enthalten, gleichzeitig aber limitiert sind. Allerdings funktioniert dieses System natürlich nur mit Bewohnern, die eine hohe Sensibilisierung für das Thema Nachhaltigkeit mitbringen. Es stimmt schon: Die Mieter dieses Hauses sind handverlesen. Ist konsequente Nachhaltigkeit auch wirtschaftlich, oder braucht es dafür nach wie vor viel Idealismus? Wir haben mit 15% Mehrkosten abgeschlossen. Zu einem kleinen Teil sind sie auf die Mieten überwälzt, zu einem großen Teil tragen wir sie selbst, indem wir statt mit der üblichen Bruttorendite von 6% mit einer solchen von lediglich 4.5% rechnen. Der immense Projektierungsaufwand, den wir getrieben haben, ist da allerdings nicht mit eingerechnet. Wirtschaftlich ist deshalb so ein Unterfangen nur, wenn man es in einem größeren Rahmen sieht. Oder anders gesagt: Das Know-How, das wir uns mit dem Kraftwerk B erworben haben, muss uns etwas wert sein! Mit solchen Objekten kann man heute kein Geld verdienen, aber das wird sich ändern, sobald die Vernunft Fuß gefasst hat: In 10 Jahren ist das, was wir gemacht haben, Usus. Sonst atmen wir bald nicht mehr, und in 30 Jahren geht uns außerdem das Öl aus! Wie wichtig sind die städtebauliche Einordnung und die Gestaltung? Verlieren sie an Bedeutung, wenn es um Nachhaltigkeit geht? Das Kraftwerk B liegt ja an prominenter Stelle inmitten von Bennau, nämlich direkt neben der Kirche. Es war dementsprechend wichtig, die städtebauliche Situation in unsere gestalterischen Überlegungen mit einzubeziehen. Wir mussten den Entwurf auch der Denkmalpflege vorlegen. Aber die Gestaltung muss in jedem Fall stimmen, und zwar bis ins Detail! Beim Kraftwerk B war mein Ziel die makellose Integration der Sonnenkollektoren, Photovoltaik-Anlagen und zugehörigen Rohre in die feingliedrigen Hüllen von Fassade und Dach – wie bei einem Auto, wo alles in die Karosserie integriert ist. Das war allerdings äußerst schwierig und bedingte einen gewaltigen Zusatzaufwand, weil es auf diesem Sektor nur eine begrenzte Anzahl Normprodukte gibt. Es ist deshalb von zentraler Bedeutung, dass die industrielle Fertigung im Bauwesen vorangetrieben wird. Text: Cornelia Bauer/Jakob Schoof Interview: Cornelia Bauer, Intep – Integrale Planung GmbH Übersicht der Dossiers zum Thema "Nachhaltige Wohnkonzepte" Teil 2: Energieeffizienz im großen Maßstab Teil 3: „Make It Right House“ in New Orleans Teil 4: Nachhaltiges Wohnen für jedermann Teil 5: Suburban, energieeffizient und von Bill Dunster Teil 6: Ein Leichtbau fürs Mittelmeerklima Teil 7: Grüne Oase in der Stadt Teil 8: Licht, Luft und Energieeffizienz Teil 9: Dicht, energieeffizient und aussichtsreich: Wohnsiedlung Marilunden in Stavanger http://www.detail.de/artikeldrucken_kraftwerk-b-bennau-grab-architekten_24281_De... 2010-03-12 DETAIL.de - Architekturportal und Architekturzeitschrift mit Informationen und tage... Page 3 of 3 Link-URL: http://www.detail.de/artikel_kraftwerk-b-bennau-grab-architekten_24281_De.htm http://www.detail.de/artikeldrucken_kraftwerk-b-bennau-grab-architekten_24281_De... 2010-03-12 DETAIL.de - Architekturportal und Architekturzeitschrift mit Informationen und tage... Page 1 of 2 Home » Green » Themen-Dossiers » Nachhaltige Wohnkonzepte NACHHALTIGE WOHNKONZEPTE Dicht, energieeffizient und aussichtsreich: Wohnsiedlung Marilunden in Stavanger [10.12.2009] Kulturelle und sportliche Großereignisse geben vielen Städten Anlass, über das Tagesgeschäft hinaus neue städtebauliche Entwicklungen anzustoßen. Nicht immer gelingt das Vorhaben. In Europas Kulturhauptstadt von 2008, dem norwegischen Stavanger, trägt jetzt jedoch das Projekt „Norwegian Wood“ erste sehenswerte Früchte. Grafik: nonconform architektur/Eder Biesel Arkitekter Die Reihenhaussiedlung „Marilunden“ im Süden von Norwegens viertgrößter Stadt ist ein österreichisch-norwegisches Kooperationsprojekt: Geplant wurde sie von nonconform architektur vor ort aus Wien sowie Eder Biesel Arkitekter aus Stavanger, realisiert im Rahmen des Projekts „Norwegian Wood“, das die Potenziale zeitgenössischen, energiesparenden Holzbaus in Norwegen sichtbar machen will. Insgesamt 14 Projekte vom Einfamilienhaus bis zur Holzbrücke entstanden oder entstehen noch in Stavanger und Umgebung, begleitet von Forschungsvorhaben zu Holzbaukonstruktionen und deren industrieller Fertigung. Foto: Eder Biesel Arkitekter Foto: Eder Biesel Arkitekter Die zehn Wohnhäuser stehen auf einem nach Westen abfallenden Baugrundstück in einem der südlichen Viertel der Stadt. Über zwei durchgehenden, halb ins Gelände eingegrabenen Betonriegeln erheben sich jeweils fünf zweigeschossige Baukörper aus Holz, die die Wohngeschosse enthalten. Zwischen den beiden leicht gekrümmten Häuserzeilen entsteht ein verkehrsberuhigter Freibereich für die Anwohner. Das Entwurfsziel der Architekten war eine fein austarierte Balance aus Dichte und Auflockerung: Terrassen über dem Sockelgeschoss verbinden die Häuser miteinander, doch die Höhenstaffelung am Hang sowie die Zwischenräume zwischen den einzelnen Häusern erlauben aus allen Wohnräumen den Blick ins Tal. http://www.detail.de/artikeldrucken_marilunden-stavanger-nonconform-architektur-e... 2010-03-12 DETAIL.de - Architekturportal und Architekturzeitschrift mit Informationen und tage... Page 2 of 2 Grafik: Eder Biesel Arkitekter Die Obergeschosse kragen zu beiden Richtungen weit über den Sockel aus. Dennoch gelangt die tief stehende Abendsonne von Westen bis in die Untergeschosse, die von den Wohnungen abgetrennt und separat als Einliegerwohnungen oder Büros genutzt werden können. Im Osten entsteht unter der Auskragung ein wettergeschützter Stellplatz fürs Auto. Zwei der drei Etagen sind mit dem Rollstuhl erreichbar und wurden barrierefrei eingerichtet. Die Wohnanlage wurde nach der norwegischen Energieklasse „A“ ausgeführt, der fordert, dass der Heizwärmebedarf unter 45 kWh/m2a und der Gesamtenergiebedarf unter 75 kWh/m2a liegen muss. Außenwände und Dach bestehen aus einer Holzrahmenkonstruktion mit eingeblasener Holzfaserdämmung. Fenster mit Dreischeiben-Isolierverglasung und überdämmten Rahmen sowie bis ins Fundament hinein kerngedämmte Betonwände im Untergeschoss tragen ebenfalls zum geringen Energiebedarf bei. Beim ‚Blower-Door-Test’ erreichten die Gebäude einen Luftwechsel von weniger als 0,1/h. Zum Gebäude-Energiekonzept gehören eine mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung sowie Luft/Wasser-Wärmepumpen auf dem Dach jedes Hauses, die warmes Wasser in eine Fußbodenheizung einspeisen. Foto: nonconform architektur Alle für den Bau der Häuser verwendeten Materialien – darunter die Fassadenverkleidung aus Kiefernholz - wurden im Rahmen des „Norwegian Wood“-Projekts auf ihren Energieverbrauch bei Produktion und Transport sowie ökologische Materialeigenschaften hin überprüft. Zeichnung: Eder Biesel Arkitekter Zeichnung: Eder Biesel Arkitekter Link-URL: http://www.detail.de/artikel_marilunden-stavanger-nonconform-architektur-eder-bieselarkitekter_24685_De.htm http://www.detail.de/artikeldrucken_marilunden-stavanger-nonconform-architektur-e... 2010-03-12 DETAIL.de - Architekturportal und Architekturzeitschrift mit Informationen und tage... Page 1 of 3 Home » Green » Themen-Dossiers » Nachhaltige Wohnkonzepte NACHHALTIGE WOHNKONZEPTE Ein Leichtbau fürs Mittelmeerklima [24.11.2009] E3 - dieses Kürzel steht für „Edificio Energeticamente Efficiente“. Der Neubau des Mailänder Architekturbüros Atelier2 unterschreitet nicht nur die strengsten derzeit in Italien gültigen Energiestandards um den Faktor 10, sondern ist mit seiner – trotz Leichtbaukonstruktion – hohen thermischen Speichermasse auch auf die hohen Temperaturschwankungen des norditalienischen Klimas abgestimmt. Das Doppelhaus E3 steht im historischen Kern des zu Bergamo gehörenden Ortes Colognola, in der Einflugschneise zum Flughafen Orio al Serio. Neben hoher Energieeffizienz war daher auch ein exzellenter Schallschutz der Gebäudehülle vonnöten. Dennoch entschieden sich die Architekten für eine auf den ersten Blick eigenartig anmutende Leichtbau-Hybridkonstruktion: Im Inneren des Gebäudes ist unter Gipskarton- verkleidungen ein Stahltragwerk verborgen; im Süden dagegen, wo sich das Gebäude über Loggien, Terrassen und Wintergärten ins Freie öffnet, wurde diesem eine sichtbare Holzkonstruktion vorgestellt. E3 erreicht mit seinem Heizenergieverbrauch von 6 kWh/m²a als erstes Gebäude in der Lombardei den Gold-Standard im Gebäudezertifizierungssystem der Bozener Agentur KlimaHaus. Maßgeblich hierzu trägt eine hoch gedämmte Gebäudehülle mit durchschnittlichem U-Wert von 0,21 W/m²K bei. Während das Dach einen eher traditionellen Aufbau mit Ziegeldeckung erhielt, wurden in den Außenwänden nicht weniger als fünf Schichten unterschiedlicher Dämmstoffe kombiniert: von innen nach außen je 80 Millimeter Polyester und Mineralwolle, 60 Millimeter Holzfaser- dämmplatte, weitere 60 Millimeter Mineralwolle und schließlich 40 Millimeter expandiertes Polystyrol. Die Architekten begründen diese Vielschichtigkeit mit dem Wunsch nach einem akustisch optimierten Wandaufbau. Die Fassaden bestehen aus einer Innen- und einer Außenschale, die sich weitgehend frei voneinander bewegen können, um thermisch bedingte Zwängungen zu vermeiden. Dies ist auch notwendig: Die Fassaden sind dahingehend optimiert, dass die Phasen- verschiebung im Temperaturverlauf zwischen Außenluft und innerer Wandoberfläche mehr als zehn Stunden beträgt. Mit anderen Worten: Spät abends, wenn die Sonne längst untergegangen ist, strahlt die Wandoberfläche die meiste Wärme in den Innenraum ab; tagsüber http://www.detail.de/artikeldrucken_e3-bergamo-atelier2_24258_De.htm 2010-03-12 DETAIL.de - Architekturportal und Architekturzeitschrift mit Informationen und tage... Page 2 of 3 bleibt sie dagegen angenehm kühl. Zur Erhöhung der thermischen Masse im Gebäude tragen einerseits die massiven Geschossdecken bei – eine Verbundkonstruktion aus Stahltrapezblechen und Stahlbeton. Zweitens wurden bei diesem Gebäude erstmals in Italien Gipskartonplatten mit integriertem PCM-Latentwärmespeicher („SmartBoard“ von Knauf mit PCM von BASF) verbaut. Sie fanden in den Trennwänden zwischen den beiden südseitigen, zweigeschossigen Wintergärten und den dahinter liegenden Wohnräumen Verwendung. Mit einer Stärke von nur 15 Millimetern erreichen sie die thermische Masse von 9 Zentimetern Beton oder einer 12 Zentimeter starken Ziegelwand. Beheizt wird das Gebäude mit einem Gas-Brennwertkessel, der von dachintegrierten Solarkollektoren unterstützt wird und sein Warmwasser in eine Fußbodenheizung (Vorlauftemperatur zwischen 28 und 40 °C) einspeist. Um die Energieeffizienz des Neubaus von Atelier2 bewerten zu können, lohnt ein Blick auf die italienische Gesetzgebung, die weitgehend von den einzelnen Regionen bestimmt wird. Die strengsten Standards setzt diesbezüglich Südtirol, wo neu errichtete Wohnbauten – ähnlich wie in Deutschland – maximal 70 kWh/m2a Heizenergie verbrauchen dürfen. Diesen Wert unterschreitet E³ um mehr als das Zehnfache. zur Galerie Übersicht der Dossiers zum Thema "Nachhaltige Wohnkonzepte" Teil 1: Der Energiegewinner: „Kraftwerk B“ in Bennau Teil 2: Energieeffizienz im großen Maßstab Teil 3: „Make It Right House“ in New Orleans Teil 4: Nachhaltiges Wohnen für jedermann Teil 5: Suburban, energieeffizient und von Bill Dunster http://www.detail.de/artikeldrucken_e3-bergamo-atelier2_24258_De.htm 2010-03-12 DETAIL.de - Architekturportal und Architekturzeitschrift mit Informationen und tage... Page 3 of 3 Teil 7: Grüne Oase in der Stadt Teil 8: Licht, Luft und Energieeffizienz Teil 9: Dicht, energieeffizient und aussichtsreich: Wohnsiedlung Marilunden in Stavanger Teil 10: Vorfertigung trifft Energieeffizienz: Konzepte aus den USA Link-URL: http://www.detail.de/artikel_e3-bergamo-atelier2_24258_De.htm http://www.detail.de/artikeldrucken_e3-bergamo-atelier2_24258_De.htm 2010-03-12 DETAIL.de - Architekturportal und Architekturzeitschrift mit Informationen und tage... Page 1 of 3 Home » Green » Themen-Dossiers » Nachhaltige Wohnkonzepte NACHHALTIGE WOHNKONZEPTE Energieeffizienz im großen Maßstab [30.10.2009] Viel hilft viel: Österreichs bislang größte Passivhausanlage soll 2010 in Innsbruck fertiggestellt werden. Im Lodenareal entstehen gegenwärtig 354 Miet- und 128 Eigentumswohnungen mit einem prognostizierten Heizwärmebedarf von weniger als 10 kWh je Quadratmeter und Jahr. Foto: Jakob Schoof Der Masterplan für das Areal ist denkbar einfach, aber schlüssig: Drei Gebäudekomplexe aus je 2 L-förmigen Baukörpern am Zusammenfluss von Sill und Inn bilden trotz der Größe des Gesamtvorhabens überschaubare Nachbarschaften. Zwei Baublocks mit Mietwohnungen errichtet die Neue Heimat Tirol, für den dritten Gebäudekomplex mit den Eigentumswohnungen zeichnet das Projektmanagement-Unternehmen Zima verantwortlich. Die Pläne für die Neubauten stammen von team k2 architects und der Architekturwerkstatt dinA4 aus Innsbruck sowie dem Büro Architekturhalle Wulz-König aus Telfs. Der für den österreichischen Energieausweis errechnete Heizwärmebedarf der vier Mietwohngebäude liegt bei 7 kWh/m2a. Damit spart die Anlage aufgrund ihrer erheblichen Größe gegenüber einem gleich großen Niedrigenergiegebäude rund 680 Tonnen CO2 jährlich ein. Rechnet man mit einem Belegungsgrad von durchschnittlich 2 Personen je Mietwohnung, wäre dies immerhin rund eine Tonne je Bewohner. http://www.detail.de/artikeldrucken_lodenareal-innsbruck-team-k2-architects-archite... 2010-03-12 DETAIL.de - Architekturportal und Architekturzeitschrift mit Informationen und tage... Page 2 of 3 Foto: Jakob Schoof Jede Wohnung verfügt über eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung, deren Zuluft über das Grundwasser unter dem Gelände (Temperatur 9-13 °C) vorkonditioniert wird. Die Heizwärme für die Mietwohnungen stellen ein Pelletsheizkessel (etwa 80 % des Jahresenergiebedarfs ohne Solaranlage) sowie ein Gas-Brennwertkessel bereit. Zusätzlich versorgt eine 1.050 m2 große thermische Solaranlage die Anlage mit Warmwasser. Sie liefert nach Berechnungen der Haustechniker jährlich 367.500 kWh Wärmeenergie pro Jahr. Beheizt werden die Wohnungen über Fußbodenheizungen, wobei aufgrund des niedrigen Heizwärmebedarfs lediglich die Randzonen vor den Fassaden mit Heizleitungen versehen wurden. Um die erforderlichen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten zu gewährleisten, wurden die Außenwände mit bis zu 30 Zentimetern, das Dach mit bis zu 45 cm sowie Wände und Decken der Tiefgarage mit bis zu 26 Zentimetern Dämmstoff versehen. Auch zur Kosteneffizienz des Neubaus macht die Neue Heimat Tirol Angaben: Das gesamte Bauvorhaben soll rund 52 Millionen Euro kosten. Gegenüber einem Neubau im Niedrigenergiestandard (Heizwärmebedarf 35 kWh/m2a) sind dies Mehrkosten von rund 5 Millionen Euro, also 11 Prozent. Davon werden rund 7 % über einen nicht rückzahlbaren Zuschuss der Tiroler Wohnbauförderung abgedeckt. Die verbleibenden Zusatzkosten von rund 4 Prozent können laut Neue Heimat Tirol „auf Grund niedrigster Energiekosten in kürzester Zeit abgefedert werden.“ Der Energiebedarf für die Heizung liegt bei den Neubauten um 80 % niedriger als bei einem Niedrigenergiegebäude, der Bedarf für Warmwasser wird durch die thermische Solaranlage auf etwa die Hälfte reduziert. http://www.detail.de/artikeldrucken_lodenareal-innsbruck-team-k2-architects-archite... 2010-03-12 DETAIL.de - Architekturportal und Architekturzeitschrift mit Informationen und tage... Page 3 of 3 Foto: Jakob Schoof Foto: Jakob Schoof Um die wichtigsten Detaillösungen für den Neubau auf ihre Praxistauglichkeit hin zu überprüfen, wurde bereits 2008 eine Musterwohnung hergestellt und im Blower-Door-Verfahren „auf Herz und Nieren“ getestet. Mit einem Luftwechsel von n50=0,38 lag das Ergebnis deutlich unter dem für Passivhäuser erforderlichen Wert von 0,50. zur Galerie Übersicht der Dossiers zum Thema "Nachhaltige Wohnkonzepte" Teil 1: Der Energiegewinner: „Kraftwerk B“ in Bennau Teil 3: „Make It Right House“ in New Orleans Teil 4: Nachhaltiges Wohnen für jedermann Teil 5: Suburban, energieeffizient und von Bill Dunster Teil 6: Ein Leichtbau fürs Mittelmeerklima Teil 7: Grüne Oase in der Stadt Teil 8: Licht, Luft und Energieeffizienz Teil 9: Dicht, energieeffizient und aussichtsreich: Wohnsiedlung Marilunden in Stavanger Link-URL: http://www.detail.de/artikel_lodenareal-innsbruck-team-k2-architects-architektengruppe-wulzkoenig_24279_De.htm http://www.detail.de/artikeldrucken_lodenareal-innsbruck-team-k2-architects-archite... 2010-03-12 DETAIL.de - Architekturportal und Architekturzeitschrift mit Informationen und tage... Page 1 of 2 Home » Green » Themen-Dossiers » Nachhaltige Wohnkonzepte NACHHALTIGE WOHNKONZEPTE Grüne Oase in der Stadt [01.02.2010] Ein Projekt wider den komplizierten Nachhaltigkeitsdiskurs: Für Anne Thorne Architects stand das „Einfache und Vernünftige“bei der Planung der Wohnanlage Angela Carter Close in London im Vordergrund. Die neun Häuser bestehen aus FSC-zertifiziertem Holz , wurden mit rezykliertem Zeitungspapier gedämmt und erreichen so den britischen EcoHomes „Excellent“ Standard. Die Wohnanlage „Angela Carter Close“, benannt nach einer britischen feministischen Schriftstellerin, liegt nur Meter von der vielbefahrenen Brixton Road entfernt im Süden Londons. Die neun Häuser und der Gemeinschaftsbereich mit Spielplatz besetzen den grünen Innenhof eines mit Straßenblocks, dessen Ränder mit viktorianischen Doppel- und Reihenhäusern bebaut sind. Ein nachhaltiger Aspekt der neun Neubauten springt direkt ins Auge: die Fassadenverkleidung aus britischem Esskastanienholz. Sie stammt wie die gesamte Holzkonstruktion der Häuser aus FSC-zertifiziertem Anbau und mach den Angela Carter Close damit zum zweiten FSC-zertifizierten Wohnprojekt in Großbritannien überhaupt. Die zwei- und dreigeschossigen Häuser wurden aus vorgefertigten Holzrahmenelementen errichtet; die Außenwände sind mit 19,5 Zentimetern rezykliertem Zeitungspapier gedämmt. Die Außenverschalung der Fassaden ist diffusionsoffen, so dass Feuchtigkeit aus dem Foto: David Spero Inneren der Fassaden jederzeit entweichen kann. An den individuell gestalteten Fassaden wechseln sich Putzflächen mit Holzverschalung ab. Die Dächer mit je 30 Zentimetern Dämmstärke sind sämtlich begrünt; die Architekten zählten hier mindestens 32 unterschiedliche Pflanzenarten. Foto: David Spero Foto: David Spero Regenwassertonnen, wassersparende Armaturen und eine 50% wasserdurchlässige Pflasterung der Freiflächen sind kleine, aber wirkungsvolle Einzelmaßnahmen, die zur Nachhaltigkeit des Projekts beitragen sollen. Die größeren Häuser besitzen darüber hinaus thermische Solarpaneele zur Warmwasserbereitung. Küchen und innen liegende Bäder werden passiv entlüftet – auch dies ein Schritt, der den Stromverbrauch in den Gebäuden senkt. zur Galerie Übersicht der Dossiers zum Thema "Nachhaltige Wohnkonzepte" Teil 1: Der Energiegewinner: „Kraftwerk B“ in Bennau Teil 2: Energieeffizienz im großen Maßstab Teil 3: „Make It Right House“ in New Orleans Teil 4: Nachhaltiges Wohnen für jedermann http://www.detail.de/artikeldrucken_angela-carter-close-london-anne-thorne-architect... 2010-03-12 DETAIL.de - Architekturportal und Architekturzeitschrift mit Informationen und tage... Page 2 of 2 Teil 5: Suburban, energieeffizient und von Bill Dunster Teil 6: Ein Leichtbau fürs Mittelmeerklima Teil 8: Licht, Luft und Energieeffizienz Teil 9: Dicht, energieeffizient und aussichtsreich: Wohnsiedlung Marilunden in Stavanger Teil 10: Vorfertigung trifft Energieeffizienz: Konzepte aus den USA Link-URL: http://www.detail.de/artikel_angela-carter-close-london-anne-thorne-architects_24024_De.htm http://www.detail.de/artikeldrucken_angela-carter-close-london-anne-thorne-architect... 2010-03-12 DETAIL.de - Architekturportal und Architekturzeitschrift mit Informationen und tage... Page 1 of 3 Home » Green » Themen-Dossiers » Nachhaltige Wohnkonzepte NACHHALTIGE WOHNKONZEPTE Nachhaltiges Wohnen für jedermann [10.11.2009] Modular, preisgünstig und perfekt an warme Klimazonen angepasst soll es sein – das 100.000-Euro-Haus, das der italienische Architekt Mario Cucinella als Konzeptstudie vorgelegt hat. Photovoltaik und Windenergie machen das Gebäude CO2-neutral im Betrieb. Rendering: Mario Cucinella Architects Gebäudetechnik Die „Casa 100 K €“ von Mario Cucinella Architects soll nicht allein energieeffizient zu beheizen, beleuchten und zu kühlen sein. Vielmehr wollten die Architekten mit ihrem Konzept Lösungen für alle drei Kriterien der Nachhaltigkeit anbieten: die wirtschaftliche (das Haus kostet nur 1000 Euro je Quadratmeter und seine Betriebskosten sind langfristig negativ), die soziale (die Wohnungen sind perfekt an die Bedürfnisse der Bewohner anpassbar) und die ökologische (das Haus ist CO2-neutral zu betreiben). Anders als die bislang in Italien üblichen Wohnbauten basiert das Gebäude auf nahezu 100prozentiger Vorfertigung: Ein außenliegendes Skelett aus Betonfertigteilen (optional auch als Stahlkonstruktion herzustellen) bildet das Tragwerk; die Ausfachungen werden in Leichtbauweise mit Faserzementverkleidung oder aus Glaspaneelen hergestellt. Weit ausladende Südbalkone, Terrassen und Laubengänge erweitern den Wohnraum ins Freie; die Nordfassaden sind dagegen weitgehend geschlossen. Basisvariante des Hauses ist ein viergeschossiger Wohnblock mit 22 Wohnungen unterschiedlicher Größe und Typologie. Gemeinsam ist diesen ihre Orientierung am Tragwerksraster von 7,5 x 12 Metern und die Tatsache, dass sie sich über die gesamte Gebäudetiefe erstrecken, was die natürliche Querlüftung begünstigt. Davon abgesehen, ist jedoch Vielfalt Trumpf: Es gibt eingeschossige und Maisonnette-Wohnungen, solche mit Erschließung über innen liegende Treppenhäuser oder über Laubengänge. Klimakonzept Sommer http://www.detail.de/artikeldrucken_100-000-euro-haus-konzeptstudie-mario-cucinell... 2010-03-12 DETAIL.de - Architekturportal und Architekturzeitschrift mit Informationen und tage... Page 2 of 3 Klimakonzept Winter Mario Cucinella Architects Maximal 600 Quadratmeter Photovoltaik-Zellen können in die Dachhaut jedes dieser Wohnblocks integriert werden. Sie werden unter anderem zum Antrieb einer Wärmepumpe genutzt, die die Gebäude beheizt. Darüber hinaus tragen Windkraft-Rotoren und thermische Solarpaneele zur Energieversorgung der Gebäude bei. Die Architekten haben berechnet, dass die „Casa 100 K €“ damit zumindest für gemäßigte und subtropische Klimazonen einen Energieüberschuss erwirtschaftet. Er reicht von 0,7 kWh/m²a für den Standort Chicago bis zu 20,75 kWh/m²a für San Francisco. Rendering: Mario Cucinella Architects Übersicht der Dossiers zum Thema "Nachhaltige Wohnkonzepte" Teil 1: Der Energiegewinner: „Kraftwerk B“ in Bennau Teil 2: Energieeffizienz im großen Maßstab Teil 3: „Make It Right House“ in New Orleans http://www.detail.de/artikeldrucken_100-000-euro-haus-konzeptstudie-mario-cucinell... 2010-03-12 DETAIL.de - Architekturportal und Architekturzeitschrift mit Informationen und tage... Page 3 of 3 Teil 5: Suburban, energieeffizient und von Bill Dunster Teil 6: Ein Leichtbau fürs Mittelmeerklima Teil 7: Grüne Oase in der Stadt Teil 8: Licht, Luft und Energieeffizienz Teil 9: Dicht, energieeffizient und aussichtsreich: Wohnsiedlung Marilunden in Stavanger Teil 10: Vorfertigung trifft Energieeffizienz: Konzepte aus den USA Link-URL: http://www.detail.de/artikel_100-000-euro-haus-konzeptstudie-mario-cucinella_24257_De.htm http://www.detail.de/artikeldrucken_100-000-euro-haus-konzeptstudie-mario-cucinell... 2010-03-12 DETAIL.de - Architekturportal und Architekturzeitschrift mit Informationen und tage... Page 1 of 3 Home » Green » Themen-Dossiers » Nachhaltige Wohnkonzepte NACHHALTIGE WOHNKONZEPTE Suburban, energieeffizient und von Bill Dunster [17.12.2009] Schon 2002 realisierte Bill Dunster mit dem Wohnkomplex BedZED in Beddington bei London ein Pilotprojekt für nachhaltiges Wohnen, das bis heute in Großbritannien unerreicht blieb. Nun haben er und sein Büro ZEDfactory ein neues Bausystem für suburbane Einfamilienhäuser vorgestellt: RuralZED soll auch bei Bebauungsdichten um die 50 Wohneinheiten pro Hektar CO2neutrales Wohnen ermöglichen. Nachdem das Konzept RuralZED im vergangenen Jahr erstmals öffentlich vorgestellt wurde, entstehen derzeit in Upton bei Northhampton die ersten Reihenhäuser dieses Typs. ZED steht für „zero energy development“ – wobei die vollständige Autonomie von fossilen Energieträgern mit RuralZED auch Schritt für Schritt erreichbar ist. Denn RuralZED verknüpft niedrige Energieverbräuche mit einem ausgesprochen marktkonformen Ansatz: Zum einen wurden die Gebäude für eine Bebauungsdichte von 50 Wohneinheiten je Hektar konzipiert, die in Großbritannien in rund 70 Prozent aller Wohngebiete üblich ist. Zweitens können potenzielle Bauherrn auch nach und nach auf den Nullenergie-Standard aufrüsten. Damit entspricht RuralZED genau der Vorgehensweise des in Großbritannien gültigen Code for Sustainable Homes: Er definiert für Wohnbauten eine Skala von sechs „Levels“, wobei Level 6 der strengste ist und – neben Standards für Baumaterialien, Wasserverbrauch und andere Kriterien - einen CO2-neutralen Gebäudebetrieb einfordert. Level 3 soll ab 2010, Level 6 voraussichtlich ab 2016 für alle neuen Wohngebäude verpflichtend werden. RuralZED wird in Varianten für alle Stufen von 3 bis 6 angeboten – mit Option zum späteren Upgrade. Das Gebäude versteht sich als Bausatzhaus, mit einem Gebäudekern in Leimholz-Rahmenbauweise, an und auf den unterschiedliche Dachformen, Fassadenverkleidungen, gebäudetechnische Installationen und ein südseitiger Wintergarten appliziert werden können. Anders als bei vielen herkömmlichen Fertighäusern soll RuralZED so exakt an Lage und Sonneneinstrahlung angepasst werden. Es gibt Varianten für freistehende, Doppel- oder Reihenhäuser sowie für West/Ost- und Nord-Südausrichtung. Sogar eine Variante auf Stelzen für überschwemmungsgefährdete Gebiete ist verfügbar. In der Grundvariante besitzt RuralZED ein – wahlweise begrüntes - Flachdach. Daneben sind zwei Satteldachformen erhältlich: eine symmetrische für die Bildung harmonisch proportionierter Gebäudeensembles (vor allem bei giebelständigen Häuserzeilen) und eine asymmetrische mit vergrößerter Südseite zur optimalen Sonnenenergienutzung. Als Dacheindeckungen werden hier Ziegel, Stehfalzbleche http://www.detail.de/artikeldrucken_ruralzed-upton-bill-dunster_24265_De.htm 2010-03-12 DETAIL.de - Architekturportal und Architekturzeitschrift mit Informationen und tage... Page 2 of 3 oder ebenfalls ein Gründach angeboten. Bei Gebäuden mit Nord-Süd-Ausrichtung kann auf der Südseite ein zweigeschossiger Wintergarten angefügt werden. Alle Anund Aufbauten sind unbeheizt: Die Dämm- und Dichtungsebene liegt bei allen Bauweisen in den Hüllflächen des zentralen Gebäudekerns. Holzfenster, Kalkputz ohne Anstrich, holzverkleidete Fassaden und die optionalen Gründächer tragen dazu bei, dass RuralZED auch hinsichtlich der Baumaterialien die Anforderungen von „Level 6“ erfüllt. Um die thermische Speicherfähigkeit der Häuser zu erhöhen, wird der tragende Holzrahmen (Holzquerschnitte 200x300 Millimeter, Spannweiten bis 4,80 Metern) vorzugsweise mit massiven Füllmaterialien versehen: Betonfertigteile oder Terrakotta-Elemente mit gewölbter Deckenuntersicht für die Geschossdecken, Betonfliesen oder großformatige Betonpaneele für den Erdgeschossfußboden. Auch die Wände werden mit 50 Millimeter starken Betonfertigteilen verfüllt und mit 300 Millimeter Mineralfaser gedämmt. Ab Level 4-Standard erhält RuralZED ein passives Entlüftungssystem mit in den Wänden montierten Entlüftungsrohren. Sie leiten die Luft zu einer zentralen Ablufteinheit mit Wärmetauscher und charakteristischer „Windmütze“ auf dem Dach. Diese richtet sich in Richtung des Windes aus und entfaltet so eine Sogwirkung, die die Entlüftung unterstützt. Auf diese Weise entfallen elektrische Ventilatoren, die pro Jahr immerhin rund 500 Kilowattstunden Strom verbraucht hätten. Die Heizwärme für das Haus stellt ein Holzpellet-Heizkessel zur Verfügung, dessen Verbrauch sich laut Architekten „deutlich im Rahmen der in Großbritannien pro Einwohner verfügbaren Biomasse“ bewegt. Er wird durch Vakuumröhren-Solarkollektoren auf dem Dach unterstützt, so dass er im Sommer fast „auf Null“ heruntergefahren werden kann. Auf eine Wärmepumpe verzichteten die Architekten – sie verbraucht ihrer Ansicht nach zu viel wertvollen elektrischen Strom, der besser anderweitig im Haus eingesetzt werden kann. Denn ein RuralZED-Haus nach „Level 6“ des Code for Sustainable Homes benötigt immerhin 21 Photovoltaik-Paneele zur Deckung seines kompletten Strombedarfs. Anspruchsvoll, aber machbar, ist sogar der Bau von Plus-Energiehäusern vom Typ RuralZED. Hierzu wird auf das Dach eine Windturbine montiert – die Tragstruktur des Gebäudes ist so ausgelegt, dass sie die entsprechenden Lasten aufnehmen kann. Jedoch hängt die Wirtschaftlichkeit einer solchen Option von den jeweiligen Windverhältnissen vor Ort ab. Die reinen Baukosten der RuralZED-Häuser sind vom Ausstattungsstandard abhängig. Für ein Level-6-Haus muss laut Architekten mit rund 1850 britischen Pfund (rund 2050 Euro) je Quadratmeter Bruttogeschossflächen gerechnet werden. Erschließungs- und Grundstückskosten sind hierbei nicht eingerechnet. http://www.detail.de/artikeldrucken_ruralzed-upton-bill-dunster_24265_De.htm 2010-03-12 DETAIL.de - Architekturportal und Architekturzeitschrift mit Informationen und tage... Page 3 of 3 Übersicht der Dossiers zum Thema "Nachhaltige Wohnkonzepte" Teil 1: Der Energiegewinner: „Kraftwerk B“ in Bennau Teil 2: Energieeffizienz im großen Maßstab Teil 3: „Make It Right House“ in New Orleans Teil 4: Nachhaltiges Wohnen für jedermann Teil 6: Ein Leichtbau fürs Mittelmeerklima Teil 7: Grüne Oase in der Stadt Teil 8: Licht, Luft und Energieeffizienz Teil 9: Dicht, energieeffizient und aussichtsreich: Wohnsiedlung Marilunden in Stavanger Teil 10: Vorfertigung trifft Energieeffizienz: Konzepte aus den USA Link-URL: http://www.detail.de/artikel_ruralzed-upton-bill-dunster_24265_De.htm http://www.detail.de/artikeldrucken_ruralzed-upton-bill-dunster_24265_De.htm 2010-03-12