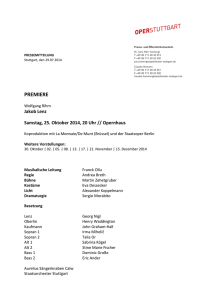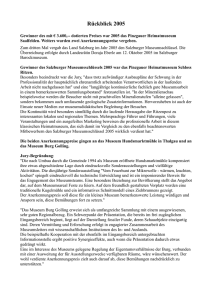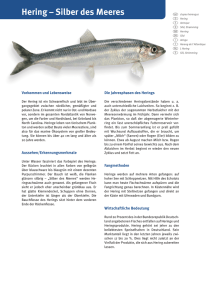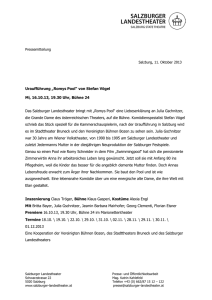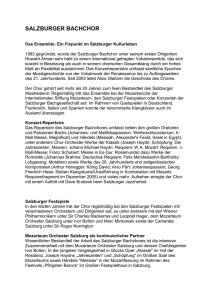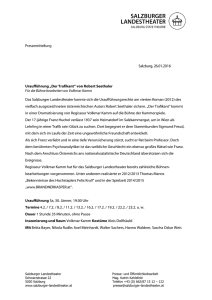Stuttgarter Zeitung
Werbung

KULTUR 11 STUTTGARTER ZEITUNG Montag, 31. Juli 2017 | Nr. 174 Unterhaltsam, komisch und mit Anspruch Das Premierenwochenende bei den Salzburger Festspielen Die Großregisseurinnen Andrea Breth und Karin Henkel haben die diesjährige Schauspielsaison mit Pinters „Geburtstagsfeier“ und Hauptmanns „Rose Bernd“ eröffnet. John Eliot Gardiner hat in der Opernsparte derweil seine Monteverdi-Trilogie vollendet. A uf nichts ist mehr Verlass, auch nicht auf die Salzburger Festspiele, Abteilung Schauspiel. Unter der Leitung von Sven-Eric Bechtolf dümpelte das Sprechtheater des größten europäischen Sommerfestivals zuletzt träge vor sich hin. Kaum eine Inszenierung, die über die Routine eines gehobenen Stadttheaters hinausreichte, kaum ein Schauspieler, der sich mit seiner Leistung ins Gedächtnis eingebrannt hätte – und die einzig verbliebene Exklusivität neben den stolzen Preisen: der Termin zur Sommerzeit, wenn überall sonst Theaterferien sind. Fünf, sechs Jahre ging das so, ohne jeglichen frischen Wind, ein schleichender Untergang des Schauspiels, der auch dem neuen Führungsteam nicht verborgen bleiben konnte: Mit einer „Salzburger Dramaturgie“ will die vom Intendanten Markus Hinterhäuser berufene Schauspielchefin Bettina Hering wieder Leben in die Bude bringen – und dieses Leben ist weiblich. Christian Doll inszeniert „Don Camillo und Peppone“ auf der Haller Treppe. Von Tanja Kurz Theater Wenn Männer zu sehr lügen E Frauenpower an der Salzach – das Sprechtheater freut sich über eine gelungene Trendwende. Von Roland Müller Schauspiel Eine Party mit Hindernissen In der bald hundertjährigen Festspielgeschichte ist Hering die erste Frau an der Spitze des Schauspiels. Um diese GenderRevolution aber gleich zum Einstand perfekt zu machen, hat sie drei der vier Großproduktionen in die Hände von Geschlechtsgenossinnen gelegt. Der Salzburger „Jedermann“, eiserner Bestand der Lustbarkeiten, ist unter der Regie von Michael Sturminger zwar männlich geblieben, davon abgesehen aber blasen ab sofort Frauen zur Attacke: Athina Rachel Tsangari mit Wedekinds „Lulu“ in zwei Wochen und schon jetzt Andrea Breth mit Harold Pinters „Geburtstagsfeier“ und Karin Henkel mit Gerhart Hauptmanns „Rose Bernd“. Drei moderne Klassiker, in denen es um männliche Machtstrategien geht, die programmatisch dem weiblichen Sezierblick unterworfen werden: Just das ist die auf inhaltliche Vernetzungen jeglicher Art zielende, Schauspiel und Oper umfassende neue „Salzburger Dramaturgie“. Als Theorie geht sie im vorliegenden FeminismusFall schon mal auf. Und in der Praxis? Mehr oder weniger, immerhin. Ihre Liebe zu Pinter hat Breth vor drei Jahren entdeckt, als sie am Münchner Resi seinen „Hausmeister“ inszenierte. Sprache, die nicht mehr der Verständigung dient, sondern als Folterinstrument eingesetzt wird: Dieses Lebensthema des englischen Dramatikers meißelt sie auch aus der 1958 uraufgeführten „Geburtstagsfeier“ Eine grandiose Akteurin: die Schauspielerin Lina Beckmann in Gerhart Hauptmanns „Rose Bernd“ heraus. Die Story ist überschaubar: Meg und Petey führen eine heruntergekommene Pension in einem Strandbad, in der sich als einziger Gast seit Jahren Stanley Webber einquartiert hat. Ihre in Alltagsritualen erstarrte Menage à trois – Zeitung lesen, Cornflakes essen, übers Wetter reden – wird gestört, als sich zwei weitere Gäste einfinden, Goldberg und McCann. Begeistert schließen sie sich Megs Plan an, für Stanley eine Geburtstagsparty auszurichten, gegen dessen ausdrücklichen Willen. Doch Widerstand ist zwecklos. Stans Vernichtung nimmt ihren Lauf. „Die Geburtstagsfeier“ ist zwar ein Klassiker des absurden Theaters, aber mit sechzig Jahren Abstand zur Uraufführung muss man sagen: Das Stück ist vorhersehbarer und geschwätziger, als es sogar seinem genuinen Thema, eben der Perversion der Sprache, gut tut. Ins Salzburger Landestheater hat sich Breth nun von ihrem Bühnenbildner, dem an der Stuttgarter Kunst- DIE NEUE SCHAUSPIEL-CHEFIN DER FESTSPIELE: BETTINA HERING drei Töchter – übernahm Hering 2012 das Landestheater Niederösterreich in St. Pölten und führte es zu neuen Höhen. Foto: Getty Vita Anthropologie, Philologie, Kunst: Diese Trias bestimmt das Theater der 1960 in Zürich geborenen Bettina Hering. Nach dem Abitur reiste sie anderthalb Jahre um die Welt, bevor sie in ihrer Heimatstadt bei Peter von Matt, dem Popstar unter den Professoren, Germanistik studierte. Nach Regieassistenzen bei Einar Schleef und Hans-Jürgen Syberberg sowie eigenen Regiearbeiten und Babypausen – zusammen mit dem Schauspieler Markus Hering hat sie Bettina Hering Pioniertat Seit dieser Saison leitet die 57-jährige Hering das Schauspiel der Salzburger Festspiele. Sie ist die erste Frau auf diesem Posten und beerbt hier renommierte Theatermänner wie Peter Stein, Frank Baumbauer, Jürgen Flimm, Martin Kusej, Thomas Oberender und – zuletzt – Sven-Eric Bechtolf. rm akademie lehrenden Martin Zehetgruber, einen Frühstücksraum bauen lassen, der Stans Schicksal vorwegnimmt und sich widerstandslos einer anderen Gewalt ergibt, der Naturgewalt. Sanddünen mit Grasbüscheln sind in die Pension am Meer eingewandert, eine erste Irritation der leicht ins Albtraumhafte gerückten Szenerie, der weitere folgen. Immer wieder unterbricht Breth nicht nur den Bewegungsfluss ihrer merkwürdigen Pensionisten, um sie hernach in Zeitlupe agieren zu lassen, sondern auch den gesamten Handlungsfluss des Dramas: Abruptes Dunkel setzt harte Schnitte, bevor dann unter Scheinwerfern ein neues, grotesk eingefrorenes Figurentableau erscheint, das einige Sekunden zum Auftauen braucht. Mit solchen Tricks verwandelt Breth die mit dem Wiener Burgtheater koproduzierte „Geburtstagsfeier“ in eine effektsichere Gespenstersonate. Das Ensemble hilft ihr dabei, allen voran Nina Petri als geistig beschränkte, aber erotisch bedürftige Meg sowie Roland Koch als Goldberg und Oliver Stokowski als McCann, zwei elegante graue Herren, die im Auftrag einer ominösen „Organisation“ den Stanley des Max Simonischek einem Kreuzverhör aussetzen, das zum Psychohorror wird. In sich zusammengesunken, schweißnass und willenlos spielt sich der anfangs herrische Simonischek in feinen Abstufungen zum menschlichen Wrack herunter, das sich der Vergehen, die es nie begangen hat, schuldig fühlt. Allein: All die von Breth und ihren Spielern aufgebotene Kunstfertigkeit kann die Schwächen des Stücks und die Längen der Bedeutung schindenden Inszenierung nicht wettmachen. Am Ende: erlesene Langeweile im Landestheater, ganz anders als auf der Perner-Insel in Hallein, wo eine an- Foto: dpa dere Großregisseurin eine Großtat vollbringt und den Naturalismus von Hauptmann rehabilitiert. Im Rußstaub der Unterwelt Karin Henkel inszeniert „Rose Bernd“, die 1903 uraufgeführte Tragödie, in der das titelgebende Bauernmädchen sein außerehelich gezeugtes Kind erwürgt. Hauptmann klagt in seinem Schauspiel aber nicht die Kindsmörderin an, sondern die Männerwelt, deren mal offene, mal verdeckte Tyrannei die verzweifelte Rose ins grässlichste aller Verbrechen drängt. Verblüffend schon das Bühnenbild: Statt Wiese, Feld und Wohnstuben breitet sich der Schacht eines Kohlebergwerks aus, den Schauplatz des Dramas von der bäurischen Oberwelt komplett in die verrußte Unterwelt der Malocher verlegend. „Future is a fucking Nightmare“ steht auf dem Vorhang, der den Chor der Kirchgänger und Dorfbewohner von Rose Bernd trennt – und dass sich die Zukunft des von triebhaften Männern begehrten Mädchens tatsächlich als moderner Albtraum in Gothic entpuppt, ohne der Textvorlage weitere Gewalt anzutun, ist das Kunststück der ergreifenden, auch den schlesischen Dialekt nicht unterschlagenden Aufführung. Herausragend in der Titelrolle: Lina Beckmann, die Rose mit einer psychosozialen Intensität spielt, als stamme sie nicht von Hauptmann, sondern vom bis heute unerreichten Horváth. Grandios! Henkel, Breth, Hering: Frauen blicken anders auf die Welt als Männer. Nimmt man alles in allem, ist das neue Salzburger Schauspiel auch deshalb wieder ein Versprechen. in hölzernes Sternenzelt, Ochs und Esel, Maria, Josef (samt nachgereichtem Jesuskind) und die Engel nehmen Aufstellung. Dann singen sie da oben „Venite Fedeli“ (Nun freut euch, ihr Christen) – und freudig stimmen die da unten ein. Der hübsche friedvolle Auftakt ist freilich Satire, denn in Christian Dolls zweistündiger Inszenierung wird mit großer Hingabe und viel Körpereinsatz provoziert, gebrüllt, beleidigt und zur Not auch gekämpft, dass die Zuschauer am Premierenabend nur so ihren Theaterspaß haben. Mit Gerold Theobalts Stück „Don Camillo und Peppone“ nach dem 1948 erschienenen Roman von Giovannino Guareschi hat der neue Intendant eine Komödie entdeckt, die wie gemacht ist für die Haller Treppe. Die Stufen vor der Kirche St. Michael sind ein ziemlich unschlagbarer Spielort, spielen Guareschis Geschichten doch überwiegend in einem Gotteshaus. Die Hauptdarsteller sind nicht Fernandel und Gino Cervi aus der legendären Fünfziger-Jahre-Verfilmung, aber sie sind nah dran. Gunter Heun als erzkonservativer (aber im Grunde der katholischen Soziallehre verpflichteter) Priester Don Camillo und Dirk Schäfer als kommunistischer Die Bühne vor (aber im Grunde tief- der Kirche ist gläubiger) Bürger- ideal meister Peppone bilden ein kongeniales für die zwei Streitpaar „feindlicher Helden. Brüder und brüderlicher Feinde“ (Guareschi). Ihrem Kampf um die Deutungshoheit im Dorf kann einzig der wunderbar lakonisch aufspielende Jesus (Dirk Weiler) Einhalt bieten, der hin und wieder vom hölzernen Kreuz am Turmeingang in die Niederungen der menschlichen Existenz hinabsteigt. Im solide aufspielenden und gesangsstarken Ensemble hinterlässt vor allem Silke Buchholz als Peppones Frau Ariana einen nachhaltigen Eindruck. Starke Charaktere, pointenreiche Dialoge und originelle Regieeinfälle mit allerlei Theaterzauber fügen sich hier zu einem mehr als nur unterhaltsamen Theaterabend. Dem dient auch der mitreißende italienische Sommerabendsoundtrack aus Italian Classics, Kirchenliedern, kommunistischen Schlachtliedern, Perkussion und selbst geschriebenen Arien wie Instrumentalstücken von Dominik Dittrich. Er und seine Kollegen der Hamburger Band Tante Polly, Benjamin Leibbrand und Sebastian Strehler, begleiten das Geschehen, treiben die Handlung voran und treten auch als Komparsen in Erscheinung. Etwa im Match zwischen den Peppone- und Don-Camillo-Anhängern – ein wahres Kabinettstückchen. Wer hätte gedacht, dass sich die Treppe sogar in ein Fußballfeld verwandeln lässt! Vorstellungen 29., 30. Juli, 1. bis 4., 13., 15. bis 20. sowie 22. August, jeweils 20.30 Uhr Infos zu weiteren Vorstellungen unter salzburgerfestspiele.at // Stars and Stripes Ein bockiger Gast Der Himmel auf Erden John Eliot Gardiner lässt bei Monteverdis Werken die Sänger glänzen und leitet so abgeklärt wie leichtfüßig. Von Susanne Benda Oper ie ganze Welt ist in der Oper. „Weißhaarig und schlotternd wird man zum wandernden Friedhof der eigenen Knochen“, singt die Amme (Tenor). „Vernunft ist ein strenger Maßstab für den, der gehorcht, nicht für den, der befiehlt“, singt Seneca, der Philosoph. „Ich spüre ein gewisses Etwas, ein wohliges Kitzeln; sag du mir, liebe Dame, was das denn ist!“, singt der Page, als sei er Mozarts Cherubino. „Ich schaue dich und will dich haben, umfange dich und fessle dich“, singen Poppea und Nero. Claudio Monteverdis Oper „L’Incoronazione di Poppea“ schließt mit einem Stück, das zwar mutmaßlich nicht vom Komponisten selbst stammt, aber eines der schönsten Liebesduette der Musikgeschichte ist, gesättigt mit allem, was Musik sinnlich macht: Sekundreibungen, Vorhalte, viele Halbtonschritte in zwei Gesangslinien, die sich ineinanderwinden. Das Publikum in der Salzburger Felsenreitschule genießt ganz still, und bei dieser Musik fragt keiner mehr danach, ob die Dame sich zur Macht emporgeschlafen und ob der Monarch seine Alte rausgeschmissen hat, um eine Neue haben zu können. D Monteverdi hat auch nicht nach der Moral von der Geschicht’ gefragt. So wie später Mozarts Musik wertet auch die seine nicht, sondern will allen Menschen auf der Bühne nahe sein, sogar den Intriganten, Gaunern und Bösewichten, den Freiern der Penelope, ja sogar einem dicken Mann, der einfach nur essen und trinken will. Sie kleidet jeden, der da ist, mit eigenen Farben, Rhythmen und Melodien aus, hoch sensibel und manchmal voller Witz, und sie ist immer ganz im Augenblick. Wer die drei überlieferten Opern Monteverdis – „L’ Orfeo“, „La Incoronazione di Poppea“, und „Il ritorno d’Ulisse in patria“ – hört, der begibt sich zurück zu den Wurzeln der Gattung – und spürt die Zeitlosigkeit, die Modernität und die Größe von Monteverdis Gestaltung. Dem „Ulisse“ wie der „Poppea“ hört man an, dass es hier nicht mehr um Repräsentation geht, um Helden der Geschichte, in denen der adlige Auftraggeber sein eigenes Abbild sah, sondern um Ideen eines demokratischen Miteinanders. Zum 450. Geburtstag des Komponisten 2017 tourt John Eliot Gardiner, einer der noch amtierenden Doyens der historischen Aufführungspraxis, mit den drei überlieferten Opern Mon- teverdis durch die Lande – in einer trans- ein! Dabei ist John Eliot Gardiner, auf portablen Produktion, die szenisch vor al- einem Hocker vor den Musikern sitzend, lem (von ihm selbst und von Elsa Rooke) keineswegs ein Mann fürs Spektakuläre. Etliche Dirigenten der Alten Musik zaufreundlich Arrangiertes bietet. Das nennt sich dann „halbszenisch“, bern viel mehr bei der Begleitung der lanarbeitet mit Licht, farbigen Kostümen und gen, zwischen Rezitativischem und Ariovielen Gesten der Sänger, die sich auch zwi- sem changierenden Gesangsstrecken, schen den Instrumenten bewegen. Zuwei- rauen das Continuo-Spiel auf, reizen Kontlen sieht man Hilfloses, manchmal schlich- raste in Farbgebung, Tempi und Dynamik te Verdoppelungen des Textes, gelegentlich wirkungsvoll aus. Nicht so der 74-jährige Brite: Er leitet vermisst man – vor allem bei den Verwandlungsszenen im „Ulisse“ – eine Bühnenma- die beiden Dreistünder, denen er hier und schinerie. Immer wieder aber entstehen da dezent kurze Passagen aus Monteverdis auf diese Weise auch sehr schöne, dichte Madrigalbüchern einfügt, zum Abschluss Dialoge zwischen den Vokalsolisten und seiner Monteverdi-Trilogie mit einer Abgeklärtheit, einer GelassenChitarronen, Lauten, Cembaheit, einer federnden Leichlo, Orgel, Streichern und exo- Das ist weit tigkeit und einer Neigung zu tischen alten Blasinstrumen- mehr als nur Feinem und Leisem, deren ten wie Dulcian und Cornetti. halbszenisch Schönheit einen, wenn man Zwei Blockflötistinnen sitsich einlässt, schauern mazen auch dabei – und es gehört inszeniert – auf chen kann vor Glück. zu den sehr skurrilen Momen- der Bühne wird Leider ist Gardiners Monten der Aufführung, wenn sie sogar gestrickt. teverdi-Chor am zweiten und im „Ulisse“ bei ihren langen dritten Abend in Salzburg Pausen zwischendurch zu stricken beginnen. Unter den zahlreichen nurmehr als kleines Ensemble dabei, aber exzellenten Sängern sind ungemein prä- wer den Wechselgesang von Himmels- und sente Darsteller, welche die Nähe zum Or- Meereschor, verteilt auf die jetzt unbechester nutzen. Hana Blazíková, Krystian leuchteten Galerien der Felsenreitschule, Adam, Gianluca Buratto, Lucile Richardot, in Salzburg gehört hat, klanglich bedeckt, Kangmin Justin Kim, Carlo Vistoli, Anna fast ätherisch, der weiß: dass es einen HimDennis, Robert Burt: Was sind das alles für mel auf Erden geben kann – zumindest für Sänger, und wie viel Theater bringen sie die Ohren. „Ich glaube nicht“, eröffnete Präsident John F. Kennedy am 29. April 1962 eine Tischrede im Weißen Haus, „dass wir in der langen Geschichte dieses Hauses je zu einem einzelnen Anlass eine solche Ballung von Genie und Lebensleistungen beieinander hatten.“ Das Lob galt den Nobelpreisträgern aller Sparten aus der westlichen Hemisphäre, die er zum Dinner eingeladen hatte. Auf so eine Idee käme Trump nie, so bleiben ihm Frechheiten wie jene des Schriftstellers William Faulkner erspart. Der in Oxford, Mississippi, Lebende hatte die Einladung abgelehnt und das Journalisten gegenüber so begründet: „Liebe Zeit, das sind einhundert Meilen, das ist ein weiter Weg zum Abendessen.“ Allerdings war Faulkner Quartalssäufer. Vielleicht hatte er nur Angst, es käme wieder zu Episoden wie jener in New York, wo er Termine mit schmerzhaften Verbrennungen hatte durchstehen müssen, weil er betrunken in den Heizstrahler des Hotelbadezimmers gekippt war. Oder er fürchtete, auf seine Erlebnisse im Ersten Weltkrieg angesprochen zu werden, die er einst erfunden hatte – als unbelehrbarer Bruchpilot war er nicht über die Ausbildung hinausgekommen. Diese Aufschneiderei immerhin hätte Trump gefallen. tkl Kontakt Kulturredaktion Telefon: 07 11/72 05-12 41 E-Mail: [email protected]