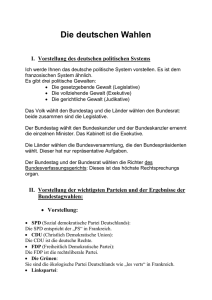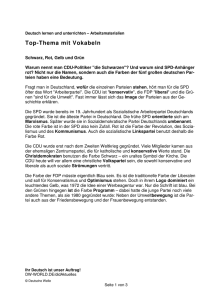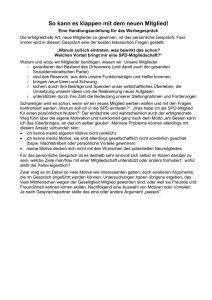Bodenhaftung suchen
Werbung
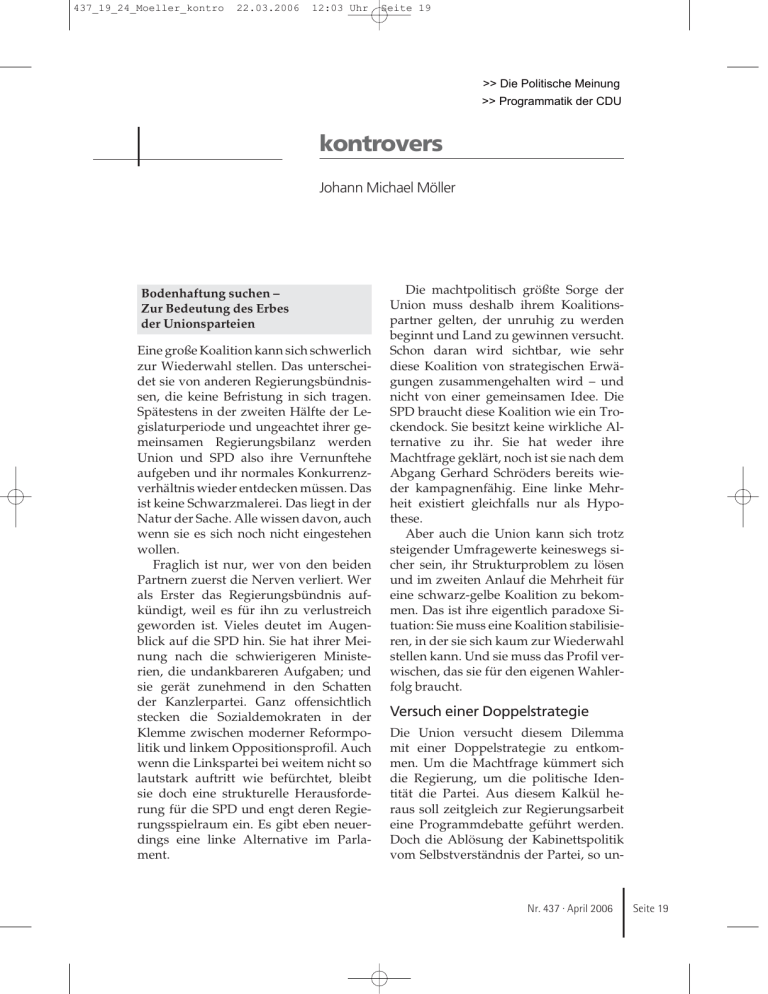
437_19_24_Moeller_kontro 22.03.2006 12:03 Uhr Seite 19 >> Die Politische Meinung >> Programmatik der CDU kontrovers Johann Michael Möller Bodenhaftung suchen – Zur Bedeutung des Erbes der Unionsparteien Eine große Koalition kann sich schwerlich zur Wiederwahl stellen. Das unterscheidet sie von anderen Regierungsbündnissen, die keine Befristung in sich tragen. Spätestens in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode und ungeachtet ihrer gemeinsamen Regierungsbilanz werden Union und SPD also ihre Vernunftehe aufgeben und ihr normales Konkurrenzverhältnis wieder entdecken müssen. Das ist keine Schwarzmalerei. Das liegt in der Natur der Sache. Alle wissen davon, auch wenn sie es sich noch nicht eingestehen wollen. Fraglich ist nur, wer von den beiden Partnern zuerst die Nerven verliert. Wer als Erster das Regierungsbündnis aufkündigt, weil es für ihn zu verlustreich geworden ist. Vieles deutet im Augenblick auf die SPD hin. Sie hat ihrer Meinung nach die schwierigeren Ministerien, die undankbareren Aufgaben; und sie gerät zunehmend in den Schatten der Kanzlerpartei. Ganz offensichtlich stecken die Sozialdemokraten in der Klemme zwischen moderner Reformpolitik und linkem Oppositionsprofil. Auch wenn die Linkspartei bei weitem nicht so lautstark auftritt wie befürchtet, bleibt sie doch eine strukturelle Herausforderung für die SPD und engt deren Regierungsspielraum ein. Es gibt eben neuerdings eine linke Alternative im Parlament. Die machtpolitisch größte Sorge der Union muss deshalb ihrem Koalitionspartner gelten, der unruhig zu werden beginnt und Land zu gewinnen versucht. Schon daran wird sichtbar, wie sehr diese Koalition von strategischen Erwägungen zusammengehalten wird – und nicht von einer gemeinsamen Idee. Die SPD braucht diese Koalition wie ein Trockendock. Sie besitzt keine wirkliche Alternative zu ihr. Sie hat weder ihre Machtfrage geklärt, noch ist sie nach dem Abgang Gerhard Schröders bereits wieder kampagnenfähig. Eine linke Mehrheit existiert gleichfalls nur als Hypothese. Aber auch die Union kann sich trotz steigender Umfragewerte keineswegs sicher sein, ihr Strukturproblem zu lösen und im zweiten Anlauf die Mehrheit für eine schwarz-gelbe Koalition zu bekommen. Das ist ihre eigentlich paradoxe Situation: Sie muss eine Koalition stabilisieren, in der sie sich kaum zur Wiederwahl stellen kann. Und sie muss das Profil verwischen, das sie für den eigenen Wahlerfolg braucht. Versuch einer Doppelstrategie Die Union versucht diesem Dilemma mit einer Doppelstrategie zu entkommen. Um die Machtfrage kümmert sich die Regierung, um die politische Identität die Partei. Aus diesem Kalkül heraus soll zeitgleich zur Regierungsarbeit eine Programmdebatte geführt werden. Doch die Ablösung der Kabinettspolitik vom Selbstverständnis der Partei, so un- Nr. 437 · April 2006 Seite 19 437_19_24_Moeller_kontro 22.03.2006 12:03 Uhr Seite 20 kontrovers vermeidlich sie jetzt erscheinen mag, ist riskant. Denn sie geht zu Lasten der demokratischen Legitimation und Willensbildung. Das war doch das eigentliche Problem der Regierung Schröder: dass er seine Partei auf seinem Reformkurs nicht mitnehmen konnte, dass er per Dekret zu regieren versuchte, top down, wie man heute sagt, und dadurch immer mehr den Boden unter den Füßen verlor. Nicht anders erging es der CDU mit ihrem Reformprogramm. Sie hat nicht einsehen wollen, dass volkwirtschaftliche Rezepte noch keine Politik sind und jede Reform auch ihre Mehrheit braucht. An diesem Umstand ist die Partei im Wahlkampf gescheitert und nicht an einer unreifen und verängstigten Bevölkerung. Der Union ist es nicht gelungen, eine Mehrheit der Wähler von der Richtigkeit ihrer Politik zu überzeugen, weil sie die materiellen Zumutungen nicht mit einer Vision verbinden konnte und das Opfer nicht mit einem höheren Sinn. Als Antwort auf das Wahldebakel hat man lieber den Reformkurs revidiert, als darüber nachzudenken, wie er mehrheitsfähig hätte werden können. Das ist zwar der bequemere Weg, aber nicht der richtige. Wettstreit der Ideen Es ist deshalb naiv zu glauben, dass ausgerechnet zwei Parteien, die an der sozialen Frage gescheitert sind, jetzt in einer großen Koalition einen harten Reformkurs einschlagen werden. Weil sie im Wahlkampf eine politische Antwort auf den gesellschaftlichen Wandel schuldig geblieben sind, müssen sie das jetzt dringend nachholen. Und damit kommt die jeweilige politische Farbe ins Spiel. Denn es gibt keine Reformpolitik, die nur in der Sache verfährt, die losgelöst wäre vom Bild der Gesellschaft, von Werten und Traditionen, von Überzeugungen und Interessen. Man mag den neuen SPD-Vorsitzenden Matthias Plat- Seite 20 Nr. 437 · April 2006 zeck ob seiner ungeklärten machtpolitischen Rolle belächeln, aber seine auffallend reife Rede auf dem Karlsruher Parteitag im November letzten Jahres hat das Problem präzise benannt: Die SPD will keine Reformpolitik an und für sich; sie will eine sozialdemokratische Reformpolitik, die sich an den Traditionen der Partei, ihren Werten und ihren Utopien orientiert und eine eigene, linke Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung darstellt. Platzeck hat das offen ausgesprochen: Es geht ihm nicht um das Regieren um des Regierens willen. Es geht ihm nach wie vor um die große sozialdemokratische Idee der gleichen Freiheit für alle. Wer dies für politische Lyrik hält, hat nicht begriffen, dass eine freiheitliche Gesellschaft auch aus dem Wettstreit ihrer Ideen lebt. Wie aber sieht die christlich demokratische Antwort auf diese Herausforderung aus? Worin besteht die besondere Antwort einer christlichen Partei auf die drängenden Fragen der Zeit? Im Postulat der Selbstverantwortung oder dem Prinzip der Subsidiarität? Es fällt den politischen Beobachtern auf, wie „eigentümlich bestimmt“, aber auch wie merkwürdig abstrakt die Rede vom christlichen Menschenbild in der CDU neuerdings ist, als ob dies eine selbstverständliche, nicht mehr näher zu erläuternde Voraussetzung ihrer Politik sei. Das bedeutet entweder die völlige Sinnentleerung solcher Formeln oder eine wachsende Scheu, auch die Konsequenzen des christlichen Menschenbildes auszusprechen. Was heißt christlich für die Genforschung, die Sterbehilfe, das Familienbild oder den sozialen Zusammenhalt? Im Grunde hat die CDU eine ähnliche Säkularisierung durchlaufen wie die sie umgebende Gesellschaft. Der Verweis auf ihr christliches Erbe hat etwas Optionales, ja Beliebiges, das immer seltener noch aus eigenem Erleben schöpft und 437_19_24_Moeller_kontro 22.03.2006 12:03 Uhr Seite 21 kontrovers immer weniger aus bewusster Religiosität. Humus der Partei Wer weiß denn heute wirklich noch, welche Glaubensformen, Überlieferungen und Milieus den Humus dieser Partei einst ausmachten? Wie wichtig es ehedem war, die katholischen und evangelischen Traditionen zusammenzuführen, das politisch zersplitterte bürgerliche Lager zu einen, den rechten Rand einzubinden? Der Neuanfang der CDU nach dem Krieg begann doch nicht auf der tabula rasa. Aber die CDU, die einmal eine große überzeugende Antwort auf die deutsche Katastrophe war, ist merkwürdig geschichtsblind geworden, gerade zu ahistorisch, auch sich selbst gegenüber. Das wird manchmal blitzartig deutlich. In der Hohmann-Affäre etwa, in der die CDU geradezu hilflos reagierte. Dass sie selbst in den Katakomben des Widerstandes begründet wurde, dass es der christliche Glaube war, der vielen Männern und Frauen aus ihren Reihen die Kraft gab, einem mörderischen Regime zu widerstehen, daran musste die CDU selbst erst mühsam wieder erinnert werden. Neue Selbstvergewisserung Wir schütteln heute befremdet den Kopf, wenn wir das frühe Ahlener Programm von 1947 lesen, das noch den Geist einer untergegangenen Epoche atmet. Aber auch die große Hoffnung der frühen Union, den Weg zur „Wiederverchristlichung“ unserer Gesellschaft zu bereiten, ist uns heute fremd geworden. Stattdessen hat das lieblose Bild des frühen Wahlvereines überlebt, der sich „auf einen Fundus von Moralvorstellungen und ein einigermaßen homogenes Milieu stützen konnte“, wie es Thomas Schmid in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung formulierte, von dem nicht mehr viel übrig geblieben ist. Der Fundus der alten Wertvorstellungen wirkt aufgezehrt, das Milieu ist in Auflösung begriffen, und die Partei, die jahrzehntelang ohne Programmdiskussion auskam, braucht zur Selbstvergewisserung plötzlich eine Wertedebatte. Welche Zuschreibung gilt aber noch: die einer christlichen Partei, einer bürgerlichen, einer konservativen? Ist sie sozial oder liberal? Die verschiedenen Traditionsstränge der Union stehen längst nicht mehr gleichwertig zur Verfügung. Das christliche, das marktwirtschaftliche und das konservative Erbe sind in höchst unterschiedlicher Verfassung. Das Christliche ist heute vor allem in seiner sozialen Ausprägung präsent, in der Tradition der katholischen Soziallehre und dem Bekenntnis zum Sozialstaat. Doch die Verbindung beginnt sich offensichtlich aufzulösen, sowohl durch die Krise des überbordenden Sozialstaates als auch durch die unverkennbare Emanzipation des Religiösen aus seiner gesellschaftspolitischen Umklammerung. Nicht erst seit dem Weltjugendtag in Köln erleben wir eine Rückkehr der Religion und des religiösen Bewusstseins, wie es noch vor Jahren unvorstellbar war und natürlich auch eine Antwort auf die Herausforderungen durch die islamische Welt darstellt. Mit Verblüffung registriert der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte, dass diese „Religionsanfälligkeit“ nicht nur die Verlierer von Modernisierungsprozessen kennzeichnet, „sondern auch die Gewinner“, die zwar merken, dass ihr Wohlstand wächst, aber nicht ihr Glücksempfinden. Verbindung sozialer und liberaler Ideen Parteipolitisch aber hat die Union von dieser Entwicklung kaum profitieren können. Im Gegenteil. Die dezidierte Hinwendung der Parteiführung zu liberalen und marktwirtschaftlichen Positionen stand dem sogar entgegen. Das Wahldebakel vom 18. September 2005 hat je- Nr. 437 · April 2006 Seite 21 437_19_24_Moeller_kontro 22.03.2006 12:03 Uhr Seite 22 kontrovers doch die drängende Frage aufgeworfen, wie eine zeitgemäße Verbindung sozialer und liberaler Ideen heute überhaupt noch aussehen könnte. Programmatisch gelingt diese Verbindung über das Ideal der Freiheit. Aber nur wenn dies auch die Freiheit zur Verantwortung meint. Doch wie sieht die Wirklichkeit aus? Die zentrale Herausforderung aller Politik ist der erbarmungslose Wettbewerbsdruck auf die sozialstaatlichen Gesellschaften der westlichen Welt. Schelskys nivellierte Mittelstandsgesellschaft war das Idealbild ausgeglichener Verhältnisse ohne nennenswerte Unterschiede und bei größtmöglicher Teilhabe an der gesellschaftlichen Wertschöpfung. Mit der Nachkriegszeit und der bipolaren Weltordnung ist dieses Gesellschaftsmodell historisch geworden. Die Unterschiede wachsen dramatisch, die sozialen und räumlichen Disparitäten nehmen zu, die Verteilungsspielräume beängstigend ab. Es gibt wieder eindeutige Gewinner und eindeutige Verlierer. Vielleicht steht ganz am Ende dieser Entfesselung des Kapitalismus wieder eine Periode der Harmonisierung der sozialen Verhältnisse. Aber auf dem Weg dorthin bleiben Millionenheere von Modernisierungsverlierern zurück. Sie kann, sie darf die Politik nicht ignorieren. Aber keiner weiß heute genau, wie mit ihnen umzugehen ist. Der amerikanische Weg der Working Poor ist so wenig befriedigend wie das europäische Modell der sozialstaatlichen Alimentierung. Und weiterhin zu hoffen, dieses Problems mit Wachstumsraten Herr werden zu können, ist frivol. Alle Bildungsoffensiven und Innovationscluster werden nichts daran ändern, dass eine bestimmte Form von Arbeit schneller abwandert, als sie substituiert werden kann. Und dass für einen Teil der Menschen in den Industriegesellschaften die einfache Arbeit ausgeht. Im Grunde ist es erschreckend, wie sehr sich die Öffentlichkeit an diesen Pro- Seite 22 Nr. 437 · April 2006 zess schon gewöhnt hat und wie halbherzig nach Lösungen gesucht wird. Sozialer Kitt der Zukunft Die perforierte Gesellschaft beginnt Normalität zu werden, räumlich wie sozial. Und sie verlangt nach anderen Lösungsmodellen als der alten Wachstumsphilosophie. Karl-Rudolf Korte spricht sogar von einer „Präventivstrategie gegen die Desintegration“ der Gesellschaft. Denn die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft ist nur die eine Seite des Problems. Die andere aber ist der soziale Zusammenhalt, die Frage also, worin der soziale Kitt einer Gesellschaft in Zukunft besteht. In der alten Wohlstandsverheißung, dem Wohlstandspatriotismus der Bonner Jahre mit Sicherheit nicht. Dafür verläuft der globale Umverteilungsprozess zu rasant. Wie es sich überhaupt als Irrtum erweist zu glauben, Gesellschaft vor allem materiell begründen zu können. Das war eine Illusion, die sich selbst in Zeiten wachsender Verteilungsspielräume nur mühsam aufrechterhalten ließ. In der Union wird daher die Idee einer „solidarischen Leistungsgesellschaft“ diskutiert, die uns auch als „aktive Bürgergesellschaft“ entgegentritt. Wieder fällt der abstrakte Ton auf, das Chiffrenhafte. Natürlich heißt Solidarität, „Verantwortung füreinander zu übernehmen“ als „wichtiger Weg zur Sinnfindung für das eigene Leben“, wie es der CSU-Politiker Alois Glück formuliert. Aber ein solcher Imperativ, der auf eine Anthropologie der Nächstenliebe vertraut, wirkt reichlich konstruiert und lebensfern. Bürgerliches Erbe Die Union sollte sich besser um ihr bürgerliches Erbe und ihren bürgerlichen Anspruch kümmern. Denn was heißt es heute noch, eine bürgerliche Partei zu sein, wenn das Wirtschaftsbürgertum zur FDP und das Bildungsbürgertum zu den Grünen abzuwandern droht? Es gibt in der Uni- 437_19_24_Moeller_kontro 22.03.2006 12:03 Uhr Seite 23 kontrovers on keinen selbstverständlichen Anspruch auf Bürgerlichkeit mehr. Und der Diskurs darüber findet eher im linken Milieu statt. Dort sieht man die Renaissance des Bürgertums als überfällige Antwort auf den „Rückbau des gewohnten Sozialstaates“, der nach den Worten des Hallenser Historikers Manfred Hettling in eine fundamentale Ordnungskrise führt, wenn die Stabilität unserer Gesellschaft weiterhin nur „auf sozialstaatlichen Leistungen und individuellen Konsummöglichkeiten“ beruht. Dieses neue Interesse an Bürgerlichkeit ist keineswegs nur sozialpolitischer Natur. Es entspringt dem Bedürfnis einer jüngeren Generation, der untergegangenen Welt des alten Bürgertums nachzuspüren und dem zivilisatorischen Modell, das sich damit verband. Das ist keine arrivierte Pose grüner Neubürger, sondern eine Operation am offenen Leib der eigenen Geschichte. Mithin eine geistige Enttrümmerungsarbeit, die zu erstaunlichen Bekenntnissen führt. So prognostiziert der Soziologe Heinz Bude die Wiederkehr von Familienstolz, bürgerlichem Eigensinn und Gemeinschaftsverpflichtung. Also genau das, was auch Alois Glück für seine solidarische Leistungsgemeinschaft fordert, in der es nicht nur um Begriffe wie Leistung, Solidarität und Subsidiarität geht, sondern auch um „Heimat, Vaterland und Patriotismus“. (Siehe auch seinen Beitrag in dieser Ausgabe, Seite 9.) Psychischer Gezeitenwechsel Schon seit längerem geistert durch die Union eine Debatte über Patriotismus. Aber sie wird eben nicht von denen geführt, die sie immer gefordert haben, von den christlich konservativen Parteien, sondern von denen, die sie lange für obsolet hielten: von den Linken. Der Bremer Historiker Paul Nolte spricht inzwischen schon von einer linken Aneignung der deutschen Nationalgeschichte, von ihrer Bemächtigung durch ein Gefühl für die eigene Herkunft, das den deutschen Linken traditionell eher fremd war. Das ist eine bemerkenswerte Verkehrung der alten Fronten. Die verlorenen Söhne und Töchter von achtundsechzig finden nach Hause zurück und besetzen das Feld der nationalen Geschichtspolitik; sie ringen mit der Frage nach der kollektiven Identität und versöhnen sich mit ihrer Republik. Wie ein psychischer Gezeitenwechsel erschien das dem Historiker HansUlrich Wehler. Im Gegenzug dazu fühlen sich die christlich konservativen und liberalen Kreise plötzlich heimatlos gemacht. Das Wendejahr 1989 und der Fall der Mauer waren eigentlich ihr großer historischer Triumph gewesen. Aber sie wohnen der Berliner Republik seither auffallend missmutig, fast randständig bei. Kein Wunder also, dass auch die Unionsparteien ihr eigenes Stichwort Patriotismus bis heute nicht mit Inhalt und Leben füllen konnten. Der historischen „Rückerkundung des eigenen Lebens“, die in den letzten Jahren zum herausragenden Motiv in der deutschen Literatur und im deutschen Film geworden ist, können sie nur einen dürren „Patriotismus der Zukunftsgestaltung“ (Paul Nolte) entgegensetzen, der in der Regel in jenen geschichtslosen Reformismus mündet, der ihrem Denken heutzutage eigen ist. Konservatives Erbe Auch das konservative Erbe hat in diesem Denken keinen großen Stellenwert. Mit diesem dritten wichtigen Traditionsstrang nach dem christlichen und dem marktwirtschaftlichen tut sich die CDU besonders schwer. Sie hat auch kaum noch Repräsentanten für ihn. Er sei gar kein Konservativer, hat selbst Wolfgang Schäuble im letzten Bundestagswahlkampf öffentlich bekannt. Und viele in seiner Partei werden ihm beipflichten. Sie halten „konservativ“ für ein unzulässiges Etikett des politischen Gegners. Nr. 437 · April 2006 Seite 23 437_19_24_Moeller_kontro 22.03.2006 12:03 Uhr Seite 24 kontrovers Dabei war es gerade das Konservative in der Union, das zu Beginn des Bundestagswahlkampfes die Gemüter erhitzte. Nie zuvor hat eine junge, ideologisch ungebundene Generation die Union so beharrlich und so wohlmeinend nach ihrem konservativen Wesen befragt wie im Frühsommer des letzten Jahres. Aber die Union schwieg beharrlich und entzog sich einer gesellschaftlichen Debatte. Keine Spur von „konservativen Tugenden“, keine Spur von Sympathie für das „gute Alte, das Gewordene, Traditionelle“, beklagte Jens Bisky damals in der Süddeutschen Zeitung. Dieselbe Sorge trieb schon den Journalisten Eckhard Fuhr in seinem Buch über die Berliner Republik als Vaterland um. Auch er verdächtigte die Union, den Wirtschaftsstandort Deutschland durch „brachiale Traditionszertrümmerung“ fit machen zu wollen für den globalen Wettbewerb. Die bürgerlichen, die christlich demokratischen Parteien seien es heute, die sich von ihrer Geschichte, ihrer Tradition, ihrer Kultur, ihren Leitbegriffen verabschiedet hätten. Eine Verlustgeschichte. Denn ihr Erfolg nach dem Krieg bestand doch gerade darin, Herkunft und Zukunft, Tradition und Partizipation miteinander verbinden zu können, weshalb sie im Stande war, wesentlich heterogenere Teile der deutschen Bevölkerung zu repräsentieren als etwa die SPD. Die Union war die „aktive Kraft“ (Frank Bösch) dieses Integrationserfolges und nicht nur ihr Resultat. Warum reduziert sie aber heute die Erinnerung an ihre eigene Erfolgsgeschichte? Warum verkürzt sie ihre Reformpolitik um die entscheidende Frage, was diese deutsche Gesellschaft denn in Zukunft zusammenhalten soll, nachdem der Wohlfahrtspatriotismus Adenauer’scher Prägung ausgespielt hat? Die SPD ist daran gescheitert, dass ihren einzelnen Reformanstrengungen kein gesellschaftlicher Entwurf zu Grunde lag. Aber sie war zumindest auf dem Wege, dies zu erken- Seite 24 Nr. 437 · April 2006 nen. Die Union läuft Gefahr, denselben Fehler zu wiederholen. Und sie kann sich dabei nicht auf die Zwänge der großen Koalition herausreden. Bodenhaftung suchen Die Renaissance aller großen Themen der Union findet derzeit außerhalb ihrer Parteigrenzen statt: die Wiederkehr des Religiösen, die Rückgewinnung des Bürgerlichen und die Rehabilitierung des Konservativen. Die Union nimmt davon kaum Notiz. Sie präsentiert sich als geschichtslos ubiquitäre Partei und beklagt ihre gesellschaftliche Erosion, den Umstand, dass ihr nur noch ein Viertel der Wahlberechtigten die Stimme gibt. Dabei hat ihr der Historiker Michael Stürmer schon 1985 ins Stammbuch geschrieben, dass nur die Zukunft gewinnt, „wer die Erinnerung füllt, die Begriffe prägt und die Vergangenheit deutet“. Auch wenn es immer wieder bestritten wird: Sie existieren noch, die Stammwähler und die Kernmilieus der Parteien, die ihnen Bodenhaftung geben. Und es kommt noch eine neue Generation hinzu, die wieder eine politische Heimat sucht, mit der sie sich identifizieren kann. Matthias Platzeck und weite Teile der SPD wissen das. Sie verstehen sich immer noch als links und als Nachfahren der großen deutschen Arbeiterbewegung. Es wäre ein verhängnisvoller Irrtum der Union zu glauben, durch beliebige Öffnung gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen und Strömungen den historischen Integrationserfolg nach dem Krieg wiederholen zu können. Im Gegenteil: Mit einem „hohlen Bekenntnis zum christlichen Menschenbild“, das hat die Parteivorsitzende Merkel ihrer Partei ins Gesicht gesagt, werde die CDU nicht durchkommen. Sie muss es mit ihrem Erbe und ihrem Selbstverständnis schon ernst meinen. Die große Koalition hat ihr ein machtpolitisches Moratorium verschafft. Es wird kürzer sein, als die meisten jetzt meinen.