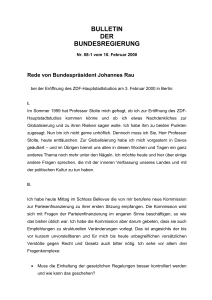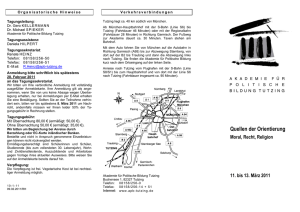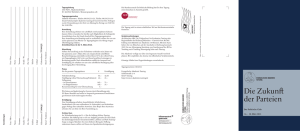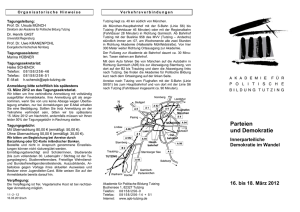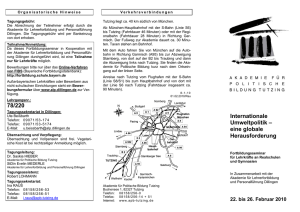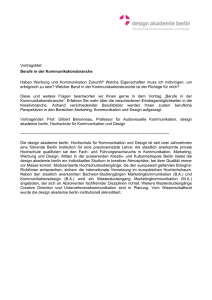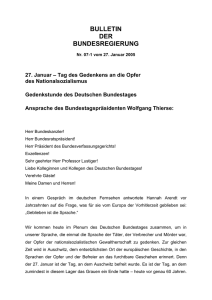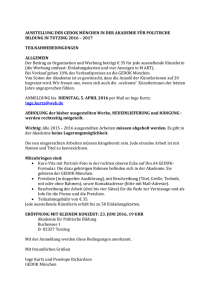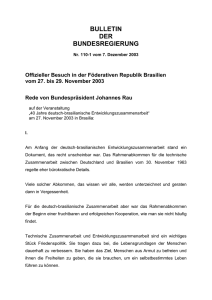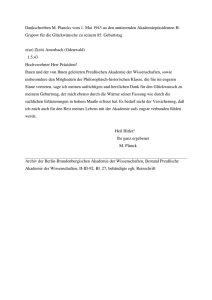bulletin - Bundesregierung
Werbung

BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG Nr. 07-1 vom 3. Februar 2000 Rede von Bundespräsident Johannes Rau auf dem Jahresempfang der Evangelischen Akademie Tutzing am 19. Januar 2000: I. Ich freue mich darüber, hier zu sein. Die Akademie Tutzing hat zu dem guten Ruf viel beigetragen, den die kirchlichen Akademien in unserem Land haben. Debatten in den kirchlichen Akademien haben in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik immer wieder starke geistige und politische Akzente gesetzt. Hier kann man neue Gedanken ausprobieren oder auch an alte, vielfach vergessene Gedanken erinnern. Man kann offen miteinander streiten – gerade weil hier ein Begriff noch mit Leben gefüllt wird, der manchen etwas altmodisch vorkommen mag, der aber vielleicht gerade heute an der Zeit ist: Ich meine den Begriff der „Bedächtigkeit“. Ich will nicht lange über diesen Begriff philosophieren. Ich assoziiere damit Sorgfalt und Umsicht, Ruhe und Unaufgeregtheit, Selbstbewusstsein und Reflexion, Distanz und Klarheit. Bedächtigkeit sollte nicht verwechselt werden mit Leidenschaftslosigkeit, noch viel weniger mit Desinteresse an praktischem Engagement oder an konkretem Handeln. Sie ist vielmehr von starkem Interesse am Handeln geprägt – aber eben am reflektierten Handeln, an einem Handeln, das seine Bedingungen kennt und seine Folgen bedenkt. Bedächtigkeit in diesem Sinne ist vielleicht der auf den Begriff gebrachte Satz des Apostels Paulus: „Prüfet alles, das Beste behaltet“. Sie ist ein Alternativprogramm zu den Aufgeregtheiten, zu den schnellen Schlagzeilen, die uns tagtäglich die Welt und die Ereignisse präsentieren und deuten wollen – und die eben wegen dieser Schnelligkeit eine extrem kurze Haltbarkeit haben und den Blick auf die Wirklichkeit, auf Ursachen und Hintergründe eher vernebelt. Bulletin Nr. 07-1 vom 3. Februar 2000 / Bpräs. – Rede Jahresempfang Ev. Akademie Tutzing -2- Denken Sie nur daran, wie uns fast ein Jahr lang der mediale Wirbel um den sogenannten Jahrtausendwechsel in Atem halten sollte! Die Tür zum vergangenen Jahr ist mit einem solchen Knall zugeschlagen worden, dass man fast fragen kann, ob hier nicht ganz alte, archaische Muster von der Vertreibung der bösen Geister wieder aufgetaucht sind. Ein bisschen schien es mir so, dass man doch nicht so ganz ohne Ängste und Befürchtungen in das geht, was einem durch Einreden oder eigenes Empfinden wie ein neues Zeitalter vorkommt. Vielleicht ist das ganz normal. Jedes Überschreiten einer Grenze, und sei sie, wie der Kalender, von Menschen gemacht, bringt neben Hoffnungen und freudigen Erwartungen auch Ängste mit sich. Vielleicht kann man sich dem am besten mit einer gewissen Bedächtigkeit stellen. Ich will das heute versuchen. II. Was bedeutet der von manchen als „Zeitenwende“ empfundene Datumswechsel für unsere Gesellschaft? Wir schauen zurück auf das zwanzigste Jahrhundert – und wir tasten uns vorsichtig in eine neue Zeit vor. Der Blick zurück hat seine spezifischen Schwierigkeiten. Zwar hatte noch keine Generation die Möglichkeit, einen so kundigen Blick auf die Vergangenheit zu werfen wie die unsere. Das ist vielleicht das bedeutendste Erbe des vorletzten, des neunzehnten Jahrhunderts, das den Aufstieg der historischen Wissenschaften brachte und uns eine Kenntnis von der Geschichte beschert hat, die geschichtlich ohne Beispiel ist. Dazu kommt, dass durch zwei Erfindungen des zwanzigsten Jahrhunderts, den Film und das Fernsehen, auch die bewegten Bilder und Szenen unseres Jahrhunderts bewahrt geblieben und jederzeit abrufbar sind. Die schon gar nicht mehr überschaubaren Rückblicksendungen fast aller Fernsehsender haben uns das in den letzten Monaten gezeigt. Alle großen Ereignisse, aber auch viele Nebensächlichkeiten, haben sich in unser visuelles Gedächtnis eingeprägt. Wenn wir ein bestimmtes Ereignis oder eine bestimmte Szene des letzten Jahrhunderts in Erinnerung rufen, sehen wir automatisch die bewegten Bilder, die wir davon kennen. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Erinnerungen und Assoziationen, auch an die gleichen Bilder. Das gilt übrigens nicht nur für die öffentlichen und kollektiven Ereignisse, das gilt auch für unser ganz privates Leben: Durch Fotografie und Video Bulletin Nr. 07-1 vom 3. Februar 2000 / Bpräs. – Rede Jahresempfang Ev. Akademie Tutzing -3- sind die meisten zu liebevollen Bild-Dokumentaristen ihres eigenen Lebens geworden. Wir sind auf eine noch nie da gewesene Weise Archivare unserer eigenen Zeit. Das Quellenmaterial für einen Rückblick auf das Jahrhundert ist also erdrückend. Aber das enthebt uns nicht der entscheidenden Frage: In welcher Weise geht uns das jetzt und weiterhin noch an? Was bleibt? III. Wenn wir zurückschauen auf das zwanzigste Jahrhundert, dann tun wir das nicht wie Briefmarkensammler auf ein abgeschlossenes Sammelgebiet, das man vollständig haben will. Für die meisten Menschen sind Erinnerungen ein wichtiger Bestandteil ihrer Persönlichkeit. Aber bei der Beschäftigung mit der Vergangenheit muss es immer auch um die Fragen gehen: Was können wir für die Zukunft behalten, ja: was müssen wir mitnehmen, was dürfen wir nicht vergessen? Was muss Bestandteil nicht nur der privaten Erinnerung bleiben? Was sollte im kollektiven Gedächtnis aufbewahrt werden? Die einschneidendste Erfahrung für uns Deutsche, aber auch für ganz Europa und weite Teile der ganzen Welt war der Zweite Weltkrieg, der durch den deutschen Nationalsozialismus ausgelöst wurde, und der Mord an den europäischen Juden, die organisierte Massenvernichtung von Sinti und Roma und die anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Diese Zeit bleibt der dunkelste Schatten auf dem vergangenen Jahrhundert und wir alle sind auf die eine oder andere Weise davon geprägt. Noch verbindet uns mit diesen Ereignissen auch die mündliche Überlieferung von Zeitzeugen, die Erzählung in der Familie oder im Freundeskreis. Noch! Denn was für uns ältere oder mittelalte Zeitgenossen noch ganz selbstverständlich ist, wird bald nicht mehr sein. Wer heute zehn Jahre alt ist, für den werden das, wenn sein historisches oder politisches Bewusstsein erwacht, alles Geschichten aus dem letzten Jahrhundert sein. Wir dürfen die psychologische Bulletin Nr. 07-1 vom 3. Februar 2000 / Bpräs. – Rede Jahresempfang Ev. Akademie Tutzing -4- Schwelle, die der Wechsel der Zahlen von der 19 zur 20 bedeutet, nicht unterschätzen. Welche Gedanken haben sich Menschen im Jahre 1920 über Ereignisse von 1830 oder 1845 gemacht? Die Erfahrungen des eigenen Lebens überdecken schnell die Erinnerungen der vorherigen Generation. Dazu kommt, dass historische Ereignisse neu eingeordnet und neu bewertet werden. Das gilt zum Beispiel für den Ersten Weltkrieg, der bei unseren Nachbarn heute noch ganz anders und viel lebendiger im Bewusstsein ist als bei uns. Das ist auch ein Zeichen für die ganz unterschiedlichen Prägungen der – wenn man so sagen kann – kollektiven Gedächtnisse innerhalb der europäischen Völkerfamilie. IV. Kann es sein, dass das, was uns heute noch als immer wieder aufgerufener Bezugspunkt der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts gilt, schon bald ein Ereignis unter anderen sein wird? Ein Ereignis aus dem letzten Jahrhundert, dessen Daten im Schulunterricht gelernt werden wie die der Krönung Karls des Großen oder der Entdeckung Amerikas? Ich glaube, dass uns allen bei diesem Gedanken nicht wohl ist. Aber das genügt nicht. Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass Erinnerungen an geschichtliche Ereignisse nur für eine kurze Zeit lebendige Erinnerungen sind. Wenn wir uns dessen bewusst und darin einig sind, dass die Erfahrung des Nationalsozialismus eine für unser Selbstverständnis entscheidende Erfahrung ist und bleiben soll, wenn sie weitergegeben werden soll, dann müssen wir sehr genau darauf sehen, wie wir das in Zukunft bewerkstelligen können. Auch wenn in naher Zukunft kein Täter und kein Opfer mehr leben wird, darf der Blick nicht verloren gehen für das historische Exempel, das der Nationalsozialismus war und bleibt. Was zuerst daraus zu lernen ist, und was auch für die Zukunft von Bedeutung bleibt: In einem zutiefst ungerechten, verlogenen, gewalttätigen, in einem totalitären System ist es für den Einzelnen immer schwer, ja oft unmöglich, ohne Schuld zu bleiben. Es gibt politische und wirtschaftliche Systeme, in die der Einzelne immer schuldhaft verwickelt wird, wenn er nicht zu den wenigen Helden gehört. Das heißt: Der Appell an die Anständigkeit des Einzelnen, an die individuelle Wertorientierung verliert nie seinen Sinn. Immer kann der Einzelne auf die Stimme seines Gewissens hören und bleibt frei, das Gute oder das Böse zu tun. Aber Bulletin Nr. 07-1 vom 3. Februar 2000 / Bpräs. – Rede Jahresempfang Ev. Akademie Tutzing -5- individuelle Moral reicht nicht aus, sonst besteht die Gefahr, dass die Anständigen letztlich die Dummen oder sogar die Opfer sind. Darum brauchen wir ein intaktes und gerechtes Gemeinwesen. Wir brauchen Institutionen, die dem Recht und der Gerechtigkeit verpflichtet sind. Das Adorno-Wort: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“ ist in dieser Zuspitzung nicht richtig. Aber es weist darauf hin, dass nur die gemeinsame Arbeit an einem guten Gemeinwesen die individuelle Moral strukturell so schützt und stützt, dass es nicht von Nachteil ist oder gar lebensgefährlich, nach moralischen Grundsätzen zu handeln. „Glücklich das Land, das keine Helden braucht“, sage ich mit Bert Brecht. Ein zweites, das daran anschließt: Im Nationalsozialismus waren nahezu alle Lebensbereiche und alle Institutionen von einem schleichenden Gift der moralischen Verwahrlosung durchdrungen. Wenn die Dämme einmal gebrochen sind, entwickelt sich offenbar alles zu seinen schlechtesten Möglichkeiten hin. Angefangen bei den absurden Versuchen einer „deutschen Physik“ waren beispielsweise die akademischen Wissenschaften nicht nur für jeden Widersinn offen. Sie waren auch so frei, sich durch die rassistische Ideologie jede Erlaubnis zu menschenverachtendem Denken und Handeln zu holen. Ob Medizin oder Rechtswissenschaft, ob Geschichte oder Biologie, ob Germanistik oder Pädagogik, alle Disziplinen waren verseucht von dieser Ideologie. Ob die Schulen, ob die Heil- und Pflegeanstalten für Behinderte, ob die Gerichte, ob die Ministerien, das Militär oder die Polizei: Überall setzte sich nicht nur der Rassismus und die ideologische Verblendung durch – es war eben auch möglich, wenn nicht sogar geboten, dass sich niedrigste Instinkte durchsetzten. V. Dabei sollten wir uns viel stärker als bisher darüber klar werden, dass der Nationalsozialismus keine im strengen Sinne reaktionäre Bewegung war. In manchen, in entscheidenden Momenten sogar war er überaus jung und modern. Keine deutsche Regierung war im Durchschnitt jünger als die Hitlers. Für aufstrebende Technokraten boten sich schnelle Karrierechancen. Dem wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt wurden alle Türen geöffnet. Die modernen Medien, Film und Radio, wurden begriffen, intensiv weiterentwickelt und in Dienst gestellt. Das deutsche Straßen- und Schienensystem war das modernste der Welt, die Kriegsführung war es sowieso. Es war eine irregeleitete und missbrauchte Bulletin Nr. 07-1 vom 3. Februar 2000 / Bpräs. – Rede Jahresempfang Ev. Akademie Tutzing -6- Moderne: Eine rein technisch verstandene Moderne, eine Moderne minus Aufklärung, minus Menschenrechte, minus Pluralismus. Auch die medizinischen Experimente und die Idee der Selektion von „lebensunwertem Leben“ und von Behinderten gehören zum Missbrauch der Möglichkeiten, die die Moderne in sich trägt. Fortschritt und Barbarei schließen sich nicht aus. Auch das hat der Nationalsozialismus gelehrt. Wir müssen begreifen – und ich sage das, ohne falschen Alarm zu schlagen –, dass manches, was den Nationalsozialismus ausgemacht hat, nicht nur ein abgeschlossener historischer Abschnitt ist, sondern eine Möglichkeit des Menschen bleibt. Was einmal wirklich war, kann wieder möglich werden – wenn auch sicher nicht in dem Sinne, dass die Geschichte sich eins zu eins wiederholt. Ich begreife es jedenfalls als Warnung, wenn sogar so besonnene und unaufgeregte Denker wie der Tübinger Ethiker Dietmar Mieth zu dem Schluss kommen, manches, was durch die moderne Medizin möglich wird, etwa die vorgeburtliche Selektion, sei der mögliche Weg in den „individuellen Faschismus“. Die Herrschaft über das Leben, über die Formen des Lebens und die Gestalt des Lebens, die Entscheidung über „lebenswert“ und „lebensunwert“ – all das ist nicht weit entfernt von Züchtungsphantasien. Sie haben nicht nur in brutalen, jeder Beschreibung spottenden Experimenten Gestalt angenommen, sondern sind auch in hochseriösen, akademischen Kommissionen und Institutionen vorgedacht worden. Das gilt übrigens nicht nur für das nationalsozialistische Deutschland. Auch die „scientific community“, so zeigen uns die Erfahrungen aus dem Dritten Reich, ist alles andere als ein sicherer Schutz vor solchen Herrschaftsphantasien und ihrer Gestaltwerdung. VI. Die vielleicht wichtigste Lehre aus den Erfahrungen zwischen 1933 und 1945 ist der kleine/große Satz am Anfang unseres Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. So sicher, wie dieser Satz für sich selber stehen kann, so sicher ist auch, dass erst die Erfahrungen, auf Grund derer er formuliert worden ist, alle seine Dimensionen zum Leuchten bringen. In diesem Satz kristallisiert sich der antitotalitäre Grundkonsens der Bundesrepublik. Um ihn in seiner ganzen Tiefe zu verstehen, dürfen wir die historischen Erfahrungen nicht vergessen, gegen die er Bulletin Nr. 07-1 vom 3. Februar 2000 / Bpräs. – Rede Jahresempfang Ev. Akademie Tutzing -7- gerichtet ist: Die Erfahrungen mit einer Ideologie und mit einer totalitären Praxis, vor der Albert Schweitzer einmal mit den Worten gewarnt hat: „Man darf nie einen Menschen einem Zweck opfern.“ Diese Erfahrungen und die Konsequenzen, die wir daraus gezogen haben, sind es wahrlich wert, dass wir sie in die Zukunft mitnehmen. Manche sprechen vom „kurzen zwanzigsten Jahrhundert“ – und meinen damit, dass es eigentlich nur von 1914 bis 1989 gedauert habe. Das sei die Zeit des großen europäischen Bürgerkrieges gewesen, der unter dem Zeichen der Ideologien des Imperialismus, des Faschismus und des Kommunismus gestanden habe. Das ist eine interessante These. Manche behaupten, mit dem Jahre 1989 sei das Jahrhundert der Ideologien zu Ende gegangen. Das sehe ich nicht so. Das ist eher selber ein Stück Ideologie. VII. Ohne groß intellektuell aufzutrumpfen, ohne Anspruch auf kulturelle Meinungshoheit, aber mit dem Anspruch auf weltweite Geltung haben sich inzwischen vielerorts ein Denken und eine Haltung etabliert, die man durchaus als neue Ideologie kennzeichnen kann. Ich meine den Anspruch, alle Lebensbeziehungen, alle Interessen der Gesellschaften und Staaten den Gesetzen des Marktes zu unterwerfen. Für die wirtschaftliche Welt ist der Markt unverzichtbar. Aber nun scheint der unbeschränkte, globalisierte Markt das letzte und einzig übriggebliebene Heilsversprechen zu sein, das nach den politischen Desastern des letzten Jahrhunderts übriggeblieben ist. Seine Herrschaft droht alles zu verschlingen, was bisher Gewicht und Bedeutung hatte: Kulturelle und regionale Identität, nationale Souveränität, religiöse und weltanschauliche Überzeugungen und Wertorientierungen. Die Ökonomie, der Wettbewerb scheint das einzige Koordinatensystem zu sein, das über Wert und Unwert von Ideen und Plänen, von Projekten und Orten bestimmt – auch über den Wert und Unwert von Menschen. Es wird manchmal so getan, als gebe es keine anderen tauglichen Maßstäbe mehr für das Zusammenleben der Menschen als die ökonomische Rationalität. Dieses Denken und eine Praxis, die sich daran orientiert, trägt Züge von totalitärer Ideologie, die lebensgefährlich ist für Demokratie und soziale Stabilität. Eine Ökonomie, die sich verselbständigt und alle Bulletin Nr. 07-1 vom 3. Februar 2000 / Bpräs. – Rede Jahresempfang Ev. Akademie Tutzing -8- gesellschaftlichen Bindungen und Verpflichtungen abstreift oder leugnet, wirkt innerhalb der Gesellschaft zerstörerisch. Die Globalisierung führt dazu, dass das Wirtschaften räumlich schrankenlos wird. Es darf aber nicht frei von Bindungen und Verpflichtungen sein. Besonders gefährlich sind Ideologien, die sich als solche nicht wahrhaben wollen. Sie propagieren einen Zustand oder eine Tendenz als normal oder „ohne Alternative“, obwohl durchaus andere Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens denkbar sind. Mit Gustav Heinemann halte ich das Wort „zwangsläufig“ für eine atheistische Kategorie. Aller Ideologie, auch der der Herrschaft des bindungslosen Marktes, liegt – bewusst oder unbewusst – ein Menschenbild zugrunde. Viele der im neunzehnten Jahrhundert wurzelnden und im zwanzigsten zur Geltung gekommenen Ideologien versprachen den „Neuen Menschen“ und versuchten ihn zu bilden oder heranzuziehen. Auch die Ideologie einer Modernisierung um ihrer selbst willen und um fast jeden Preis schafft das Bild eines neuen Menschen. Es ist der Mensch, der den Gesetzen des Marktes perfekt angepasst ist. Die neuen Werte heißen „Flexibilität“, „Mobilität“ und „Durchsetzungsfähigkeit“. Individuelle „Wettbewerbsfähigkeit“ soll am besten vom Grundschulalter an gelernt werden. Diese neuen Werte des neuen Menschen konkurrieren auffällig mit den tradierten Werten und Tugenden, die unsere Gesellschaft nach ganz überwiegender Auffassung zusammenhalten sollen: Mitmenschlichkeit, Beständigkeit, Treue, Verlässlichkeit, freiwilliges bürgerliches Engagement, die Balance zwischen freier Selbstentfaltung des Einzelnen und der Bereitschaft zur Solidarität. Tatsächlich sind diese Werte nicht nur im Bereich von Familie und Freundschaft unverzichtbar, nicht nur im Bereich der lokalen und kommunalen Beziehungen, sondern auch im Wirtschaftsleben selbst. Auch dort müssen zum Beispiel Vertragstreue und Verlässlichkeit regieren – wenn nicht der eine des anderen Wolf werden soll. Arbeitsfreude und Motivation lassen sich durch finanzielle Anreize allein nicht fordern und fördern. Es ist gewiss verständlich und oft auch richtig, wenn angesichts zu großer bürokratischer Regelungswut der Ruf nach „Deregulierung“ laut wurde. Wo es aber weniger feste Regeln gibt, da ist umso mehr Selbstverantwortung und Disziplin nötig, und, um es etwas altmodisch zu sagen, auch um so mehr „Pflichtgefühl“. All das sind Werte und Tugenden, die der Markt nicht produzieren, ohne die er aber nicht funktionieren kann. Und wir brauchen und wir wollen ja einen funktionierenden Markt als Gestaltungsprinzip der Wirtschaft. Bulletin Nr. 07-1 vom 3. Februar 2000 / Bpräs. – Rede Jahresempfang Ev. Akademie Tutzing -9- Dazu kommt, dass es in einer Gesellschaft, die nur noch das Marktprinzip anerkennt, keinen Platz gibt – sagen wir es einmal in der entsprechenden Sprache – für die „Unproduktiven“ und die „Konsumschwachen“. Eine Gesellschaft, die sich nur noch nach den Gesetzen des Marktes formiert, würde nach den Prinzipien von Selektion und dem Überleben des Stärkeren oder des Anpassungsfähigeren funktionieren. Es gibt dann keinen Platz mehr für die Behinderten und unheilbar Kranken, für die Armen und weniger Intelligenten, für die Schwachen und Hilflosen. Nicht nur das: Es liegt sogar in der paradoxen Logik der Gegenwart, dass wir zwar angeblich auf Zukunft und Wachstum ausgerichtet sind, dass sich aber gleichzeitig diejenigen, die sich trauen und zutrauen, ein Kind oder gar mehrere Kinder zu erziehen, schon heute oft wie gesellschaftliche Außenseiter und ökonomische Idioten vorkommen müssen – trotz mancher Bemühungen des Staates, diesen Zustand zu verbessern. VIII. Wenn sich ein Gemeinwesen nicht völlig den Gesetzen des Marktes ausliefern will, dann braucht es nicht nur Sinnressourcen, die sich aus anderen Quellen speisen. Es muss sich vor allem Institutionen geben oder erhalten, die Gerechtigkeit fördern, die Solidarität und Freiheit des Andersdenkenden und Anderslebenden schützen und die sich um Hilfe für Schwächere kümmern. Institutionen, die nicht nur auf die Gegenwart orientiert, sondern strukturell auch um die Zukunft der Kinder und der nachfolgenden Generationen besorgt sind – also öffentliche und staatliche Institutionen. Heute, so scheint es mir, hat der Staat die Aufgabe, die Freiheitsrechte und die sozialen Rechte, die in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten erkämpft worden sind, zu bewahren und zu verteidigen, damit nicht schrankenlose wirtschaftliche Freiheit zu individueller Unfreiheit und zu sozialen Verwüstungen führt. Diese Aufgabe des Staates ist in der globalisierten, die nationalen Grenzen aufweichenden Welt sicher neu zu definieren. Eines aber gilt unverändert: Ein Gemeinwesen, ein Staat, der sich nicht zum Ziel setzte, Gerechtigkeit zu schaffen, wie immer sie im konkreten Fall aussieht, wäre nichts anderes als eine gemeine Räuberbande, ein „latrocinium“, wie es schon Augustinus im vierten Jahrhundert gesagt hat. IX. Bulletin Nr. 07-1 vom 3. Februar 2000 / Bpräs. – Rede Jahresempfang Ev. Akademie Tutzing - 10 - „Gerechtigkeit erhöht ein Volk“: dieser Satz aus dem Alten Testament bleibt für mich – und ich hoffe für uns alle – gültig. Was aber jeweils „gerecht“ ist, was für alle, für eine Gemeinschaft, für ein Gemeinwesen, richtig ist, das wird immer umstritten sein – und das muss nach dem öffentlich ausgetragenen Streit immer neu entschieden werden. Dafür hat sich in der Geschichte – bis heute – kein besseres Modell ergeben als eine Gesellschaft, in der nicht nur wenige die Chance haben, aus ihrem Leben etwas zu machen. Dazu gehört ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat; ein Staat mit Gewaltenteilung – und mit Verfahrensregeln, nach denen sich unterschiedliche Interessen organisieren und miteinander in Wettstreit gehen können. Ich kann bis heute keine bessere Institutionalisierung des gesellschaftlichen Pluralismus erkennen als ein System konkurrierender Parteien. Die Parteien sind im Staat wichtig, aber sie sind nicht der Staat. Daran werden wir durch die Ereignisse der vergangenen Tage und Wochen nachdrücklich erinnert. Die bis heute bekannt gewordenen Verstöße gegen die gesetzlichen Regeln zur Parteienfinanzierung sind atemberaubend. Alle, die für vollständige Aufklärung sorgen und für die sich daraus ergebenden Konsequenzen eintreten, tun ihre Pflicht. Ich sage das hier auch als jemand, der in den vergangenen Wochen selber Gegenstand öffentlicher Vorwürfe, wenn auch anderer Art und Qualität, geworden ist. Ich habe mich zur Aufklärung verpflichtet. Der Landtag von Nordrhein-Westfalen wird die von mir zugesagte detaillierte Stellungnahme in den nächsten Tagen bekommen. Mein Vorvorgänger im Amt, Richard von Weizsäcker, hat den Parteien einmal „Machtvergessenheit“ und „Machtversessenheit“ vorgeworfen. Ich habe ihm damals widersprochen. Ich war und bin davon überzeugt, dass es ohne funktionierende demokratische Parteien keine lebendige Demokratie gibt. Die jüngsten Ereignisse zeigen allerdings, wie wichtig es ist, dass gerade die Parteien mit ihrer politischen Macht sich an Recht und Gesetz halten. Wer politische Macht durch Wahl und auf Zeit innehat, der muss die Grenzen achten, die Recht und Gesetz der Machtausübung setzen. Die Tatsache, dass dagegen massiv verstoßen worden ist, darf aber nicht dazu führen, dass die Politik und die Parteien insgesamt unter Pauschalverdacht gestellt werden. Wir sollten nicht vergessen, dass es in der Bundesrepublik Deutschland fast zwei Millionen Männer und Frauen gibt, die sich in politischen Parteien engagieren. Viele von ihnen setzen viel Zeit, großes Bulletin Nr. 07-1 vom 3. Februar 2000 / Bpräs. – Rede Jahresempfang Ev. Akademie Tutzing - 11 - Engagement und eine gehörige Portion Idealismus ein, weil sie unser Land nach ihren Vorstellungen mitgestalten wollen. Zehntausende von Frauen und Männern tun als gewählte Vertreterinnen und Vertreter in Bezirksvertretungen, in Gemeinderäten und Stadträten ehrenamtliche Arbeit. X. Im Zusammenhang mit der Gestaltung der Parteienfinanzierung denken manche jetzt auch über Rechtsänderungen nach. Diese Diskussion ist nötig. Ich warne aber vor der Illusion, die Lösung aller Probleme liege in der Änderung von Gesetzen. Durch den Ruf nach neuen Gesetzen kann manchmal fast der Eindruck entstehen, es liege an den Gesetzen, dass sie nicht eingehalten werden. Tatsächlich helfen aber auch neue Gesetze wenig, wenn die Loyalität gegenüber Recht und Gesetz nicht über allem steht. Hier helfen nur unbedingter Rechtsgehorsam, Staatsklugheit und bessere Einsicht, wie Professor Hans-Peter Schneider das vor wenigen Tagen geschrieben hat. Für alle, die besondere Verantwortung für unser Gemeinwesen und für die Institutionen unseres Staates tragen, und für alle, die die politisch Verantwortlichen kritisch begleiten, wünsche ich mir das, was man in England „common sense“ nennt: Wir dürfen die Institutionen nicht zerstören – weder dadurch, dass die Parteien sie usurpieren, noch dadurch, dass ihnen pauschal jegliche Glaubwürdigkeit abgesprochen wird. Professor Michael Stürmer hat vor wenigen Tagen davor gewarnt, moralische Aufgeregtheit allein schon für eine demokratische Tugend zu halten. Es genügt tatsächlich nicht, das Gute und Richtige zu wollen. Wir brauchen auch geeignete Organisationsgrundsätze und Organisationsformen dafür. Gerade wenn reinigende Kräfte und wenn Erneuerung notwendig sind, sollten wir nicht vergessen, dass kein politisches System darauf besser vorbereitet ist als die parlamentarische Demokratie. Die Parteien selber wissen ganz genau, dass sie – auch wenn die Parteifinanzen in Ordnung gebracht sein werden – in Vielem nicht auf der Höhe der Zeit sind. In allen Parteien stellen sich viele selber kritische Fragen: Wie kann es gelingen, neue Attraktivität für Menschen zu gewinnen, die sich weniger für Tagesordnungen und mehr für Projekte interessieren? Wie kann es gelingen, überkommene Rituale zu überwinden? Wie können die Parteien den Anteil der Selbstbeschäftigung verringern und sich stärker dem zuwenden, was die Menschen wirklich umtreibt? Die Parteien müssen darauf Antworten geben. Sie müssen deutlich machen, dass sie nicht um ihrer selbst willen und nicht für alles da sind, sondern für Bulletin Nr. 07-1 vom 3. Februar 2000 / Bpräs. – Rede Jahresempfang Ev. Akademie Tutzing - 12 - alle. Politisch engagierte und aktive Frauen und Männer müssen sie mit Leben erfüllen. Antworten auf diese Fragen sind dringend. Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, dann erkennen oder erahnen wir, was uns drohen kann, wenn demokratische Institutionen unglaubwürdig und damit nicht mehr akzeptiert werden. Das Gemeinwesen so zu gestalten, dass es so gerecht, so freiheitlich und so solidarisch wie möglich ist, das bleibt eine Aufgabe nicht nur für Politik und Staat. Das bleibt eine Aufgabe, an der sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger beteiligen sollten. Wer nicht selber handelt, wird behandelt. Darum sage ich allen: Mischen Sie sich in die öffentlichen Angelegenheiten ein. Es sind Ihre Angelegenheiten. * * * * *