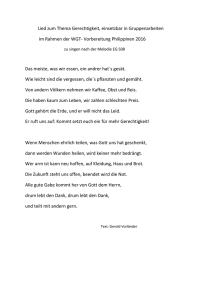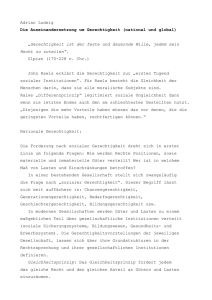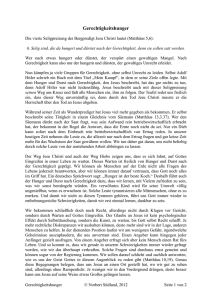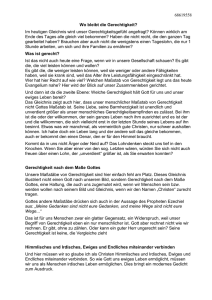Gerechtigkeit als Respekt, in: Berliner Debatte INITIAL, Jg. 12, Heft3
Werbung

Gerechtigkeit als Respekt, in: Berliner Debatte INITIAL, Jg. 12, Heft3, 2001, S. 28-37. Heinz Bude Gerechtigkeit als Respekt. Sozialmoralische Folgen von Ungerechtigkeit durch Exklusion Es dürfte kein Zweifel bestehen, daß wir uns nicht mehr in der glücklichen Wohlstands- und Wohlfahrtsperiode des Nachkriegskapitalismus befinden, in der sich für eine inklusive „Mehrheitsklasse“ (Ralf Dahrendorf 1992) die Steigerung individueller Optionen mit der Ausgestaltung kollektiver Anrechte verband. Beschreibungsformeln wie „postfordistische Regulationsweise“ (Michel Aglietta 2000), „Netzwerkgesellschaft“ (Manuel Castells 1996) oder „flexibler Kapitalismus“ (Richard Sennett 1998) kennzeichnen eine neuartige Formation der Gesellschaftsverhältnisse, wo der Kapitalismus sozialen Ballast abwirft und gleichzeitig organisatorische Kontrolle zurückgewinnt. Man erlebt auf der einen Seite, wie neue Quellen des Wachstums erschlossen und andere Formen des Erfolgs experimentiert werden, und erfährt auf der anderen Seite, daß gesellschaftliche Globalisierungsprozesse bisher nicht bekannte soziale Verwerfungen mit sich bringen. In diesem Zwiespalt zerbricht die soziale Vernunft, an die wir uns in einer „langen Nachkriegszeit“ gewöhnt hatten. Gewachsenes Sozialeigentum wird zugunsten individueller Dispositionsgewinne aufs Spiel gesetzt. Im herrschenden Verständnis moralischer Ökonomie werden die Aussichten auf kurzfristige Investitionserfolge an die Stelle des Versprechens auf langfristige Solidaritätsgewinne gesetzt. Ein auf unbedingte Effizienz und Egalität rekurrierendes Kundenverhältnis triumphiert über organisierte und koordinierte Produzentenverhältnisse (Rainer Hank 2000). Vor allem wird der Staat nicht mehr unbedingt als Verwalter des Gemeinwohls angesehen. In den Wohlfahrtsbilanzen einer jüngeren „postsozialstaatlichen“ Generation (Lutz Leisering 2000a) findet das Staatsversagen heute genauso wenig Gnade wie früher das Marktversagen. Diese driftende Entwicklung bildet den Hintergrund für eine neue Wahrnehmung des Problems der sozialen Gerechtigkeit. Wer heute an einer bloßen Gleichheitsmoral als Grundlage eines Begriff sozialer Gerechtigkeit festhält, gerät schnell in den Ruf eines partikularistischen Besitzstandswahrers und mechanistischen Glücksmaximalisten. Die Reduktion der Gerechtigkeitsfrage auf den Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit in ihrer bisherigen institutionellen Exekutierung in einem System wohlfahrtsstaatlicher „Versorgungsklassen“ (M.Rainer Lepsius 1990) macht einen blind für die neuen Spaltungen innerhalb der alten Ungleichheiten. Allerdings ist, was das sozialphilosophische und sozialpolitische Denken angeht, alles andere als klar, wie ein aus dem Bewußtsein „komplexer Gleichheit“ (Michael Walzer 1992) kommender Begriff „komplexer Gerechtigkeit“ zu entwickeln wäre. Dazu will ich im folgenden aus der Sicht der soziologischen Exklusionsforschung einen Beitrag leisten, indem ich einen gleichermaßen kontextualistischen wie absolutistischen Begriff sozialer Gerechtigkeit vertrete. Kontextualistisch insofern, als historisch wechselnde Bezugsprobleme als konstitutiv für die Auffassung sozialer Gerechtigkeit angesehen werden; und absolutistisch insofern, als für einen vom Respekt für den einzelnen ausgehenden Begriff sozialer Gerechtigkeit plädiert wird, der auf die Definition sozialer Normen und öffentlicher Güter zielt und sich nicht in der Umverteilung von Ressourcen erschöpft. Im Zentrum eines solchen Begriffs des sozialen Gerechtigkeit stehen Interpretationen und Maßnahmen, die dem einzelnen das Gefühl vermitteln, daß er/sie nicht nur wählen, sondern auch gewählt werden kann. Ein Raum des Respekts entsteht dadurch, daß der einzelne die Möglichkeit hat, zu einem Angebot ja und nein zu sagen, und daß er/sie sich durch diese existentielle Möglichkeit als jemand hervorbringt, auf der/die man rechnen und mit dem/der man etwas unternehmen, verwirklichen und zustandebringen kann. Das Selbstseinkönnen des einzelnen ist die Voraussetzung seiner lebendigen, auf Reziprozität angelegten gesellschaftlichen Teilhabe. Was man in der angelsächsischen Diskussion, schwer übersetzbar, als „agency“ bezeichnet, wird dann zum Maßstab eines Begriffs der Gerechtigkeit als Respekt. 1. Verteilungsgerechtigkeit im Wohlfahrtsstaat Robert Castel (2000) hat zuletzt in seiner Linien langer Dauer verfolgenden Untersuchung über die „Metamorphose der sozialen Frage“ herausgearbeitet, wie durch das Institut der sozialstaatlichen Pflichtversicherung aus einer herumtreibenden Population von Lohnarbeitern eine mit bürgerlichen Sicherheiten ausgestattete Klasse von Staatsbürgern wurde. Am französischen Fall läßt sich gewissermaßen in republikanischer Reinkultur studieren, wie die zivilisatorische Symbiose von National- und Sozialstaat die Auftrittschance für eine eigene Klasse von Arbeitern schafft, die im Recht auf Arbeit das Gegenstück zum Eigentumsrecht verteidigen. Der Clou von Castels Rekonstruktion besteht darin, daß entgegen der am britischen Fall dargelegten Ansicht von Edward P. Thompson (1987) weniger der ursprüngliche Lernprozeß einer Bewegung, als der Einbezug in die Emergenz des Staates aus unwürdigen Lohnarbeitern stolze Arbeiter gemacht hat. Die Welt der Arbeiter, sowohl was ihre historische Rolle als auch was ihren kulturelle Einheit anbelangt, ist zumindest ebensosehr als Teil der Nation wie aus dem gemeinsamen Gefühl der Ausbeutung und Unterdrückung entstanden. Die Frage der sozialen Gerechtigkeit war daher von Anfang an auf den Staat und seine Institutionen gerichtet, die überhaupt erst eine Vorstellung davon vermittelten, was gesellschaftliche Teilhabe für eine anerkannte Großgruppe bedeutete. Ein Blick auf die deutsche Sozialgeschichte fügt der Genealogie Castels insofern Wesentliches hinzu, als die Form der „negativen Integration“ (Günter Roth 1963) der Sozialdemokratie im Kaiserreich verdeutlicht, wie der Klassenkampf als Verfassungskampf gesellschaftliche Geltung gewann. Der Beitrag der Sozialdemokratie zur Identitätspolitik der Arbeiterbewegung ist nämlich in einer doppelten Leistung zu sehen: Einerseits gelang es ihr, die einzelnen mit der Industrialisierung und Urbanisierung aufkommenden sozialen Probleme wie Arbeitsdisziplin, Entlohnungsmaßstäbe, Wohnungsversorgung zu einem allgemeinen Klassenkonflikt zu aggregieren, der den unterschiedlich betroffenen Teilgruppen von Lohnarbeitern den Begriff einer einheitlichen Klasse vermittelte; andererseits wurde dieser identitäre Klassenkampf aufgrund des versperrten Zugangs zu den zentralen Arenen der politischen Herrschaft zum revolutionären Verfassungskampf stilisiert. Was die sozialdemokratische Arbeiterkultur nach innen integrierte, wurde von der sozialdemokratischen Partei nach außen in Stellung gebracht. Der typische Klassenkonflikt unter der Form der „negativen Integration“ war daher nicht primär Ausdruck von Verteilungskämpfen, sondern von Verfassungskämpfen, die auf die politische Beteiligung der „organisierten Interessen“ der Arbeiterklasse zielten. In dem Maße, wie sich der bürgerliche Staat für die Partei der Arbeiter öffnete und sich die SPD von einer Weltanschauungs- und Milieupartei (Theodor Geiger) zu einer Allerwelts- und Volkspartei (Otto Kirchheimer) entwickelte, verlor der Klassenkonflikt seinen Charakter als Verfassungskonflikt und desaggregierte sich in eine Vielzahl sozialstaatlich kodifizierter Verteilungskonflikte. Das Gerechtigkeitsproblem betrifft dann nicht mehr den verwehrten Anerkennungsanspruch als Klasse oder Kollektiv, sondern den ungleichen Zugang einzelner Personengruppen oder Problemkategorien zu staatlich garantierten öffentlichen Gütern, die doch allen Staatsbürgern in gleiche Weise zugute kommen sollen. Die hier angerissene Transformation moderner Staatlichkeit von den bürgerlichen Freiheitsrechten des 18. Jahrhunderts, den politischen Bürgerrechten des 19. Jahrhunderts und schließlich zu den sozialen und ökonomischen Wohlfahrtsrechten des 20. Jahrhunderts (T.H. Marshall 1950) veranschaulicht die historisch sich wandelnden Kontexte für die jeweilige Auffassung des Gerechtigkeitsproblems. Was als kollektiver Anspruch auf gleiche Anerkennung innerhalb eines nationalen Raumes des politischen Respekts begann, endete mit den individuellen Ansprüchen auf die gleiche Verteilung von Gütern innerhalb eines sozialstaatlichen Raumes öffentlicher Versorgung. Es ist das Ergebnis einer langen Geschichte der Wohlfahrtsstaatlichkeit, daß heute die Bedeutung von Besitz und Einkommen für die Bestimmung der Lebenslage nicht mehr ohne die Filter öffentlicher Versorgungschancen bewertet werden kann. Allerdings erlaubte allein die Verstaatlichung der sozialer Frage die Verwandlung von kollektiven Ungerechtigkeitserfahrungen (Barrington Moore 1982) in politische Gerechtigkeitsbegriffe und institutionelle Anrechtsgarantien. Sonst wäre reiner Protest geblieben, was des Ausgleichs durch Verfahren bedarf. Aber erkauft wurde dieser Rationalisierungsgewinn durch die Dominanz der Ressourcenverteilung über die Durchsetzung des Anerkennungsanspruchs. Das hat den Trittbrettfahrer als Laus in den Pelz des Wohlfahrtsstaats gesetzt (Mancur Olson 1968). Denn dadurch wurden unter der Hand private Zuteilungen als Kompensation für öffentliche Benachteiligungen gerechtfertigt. Dieser Zwiespalt zwischen dem politischen Ursprung und der bürokratischen Bewerkstelligung belastet seitdem die moralische Rechtfertigung des Wohlfahrtsstaats. Wie Mitnahmeeffekte von Förderungsprogrammen und Transferleistungen unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten zu beurteilen sind, ist zu einer immer wieder aufbrechenden Scheidelinie zwischen linken und rechten Befürwortern und rechten und linken Verächtern des Wohlfahrtsstaats geworden (Albert O. Hirschman 1992). Doch die heutigen Legitimationsprobleme wohlfahrtsstaatlich implementierter Vorstellungen sozialer Gerechtigkeit resultieren aus dem Umstand, daß die entscheidenden Vorausssetzungen für den Ausbau der Wohlfahrtssysteme in der Nachkriegszeit nach und nach entfallen sind: Der materielle Ressourcenüberschuß durch den Nachkriegsboom, der den institutionell tief greifenden wohlfahrtstaatlichen Expansionsschüben der sechziger Jahre zugrundegelegen hat, ist schon seit dem legendären Ölpreisschock von 1973/74 nicht mehr vorhanden (Knut Borchardt 1990); die Standardisierung des Lebenszuschnitts durch das „male breadwinner“-Modell und das Vollerwerbsverhältnis hat sich im Zuge der achtziger Jahre als „Normalitätsfiktion“ (Wolfgang Bonß und Wolfgang Plum 1990) entpuppt; die für die Entwicklung eines „koordinierten Kapitalismus“ nicht zu unterschätzende ideologische Systemkonkurrenz zwischen dem sozialistischen Wohlfahrtsstaat im Osten und dem sozialdemokratischen im Westen hat sich seit 1989 erübrigt; vor allem jedoch hat sich die traumatische Erfahrung der Weltwirtschaftskrisen der frühen und späten zwanziger Jahren und die daraus folgende Angst vor einem katastrophischen Marktversagen in der Erfahrung der nach dem Zweiten Weltkrieg geborenen Generationen jetzt endgültig verflüchtigt. Der „jungen Generation“ von heute sind greifbare individuelle Optionen wichtiger als prinzipielle soziale Rechte (Heinz Bude 2001). Nachdem noch in den siebziger und achtziger Jahren eine kulturalistisch gefärbte Skepsis gegenüber den bedrohlichen und zerstörerischen Folgen einer wohlfahrtsstaatlichen Herstellung sozialer Gerechtigkeit vorgeherrscht hatte, die in neoidealistischer Manier auf das Partizipationsdefizit (Jürgen Habermas 1985), in neoaristotelischer Manier auf das Praxisdefizit (Charles Taylor 1988) und in neonietzscheanischer Manier auf das Authentizitätsdefizit (Michel Foucault 1977) einer Agentur zur Verbesserung von Lebenslagen abhob (dazu insgesamt Christoph Menke 2000), ist die Kritik heute ökonomisch härter und politisch drängender geworden. Der Wohlfahrtsstaat wird vor allem aus zwei Gründen als Quelle von Ungerechtigkeiten zweiter Ordnung kritisiert: Der eine betrifft die nachlassende Erwerbsneigung, die immer weniger Erwerbstätige für immer mehr NichtErwerbstätige aufkommen läßt, die sich aufgrund staatlicher Transfereinkommen eines akzeptablen Lebensstandards erfreuen können, ohne den Kräften des Marktes ausgesetzt zu sein. Wohlfahrtsstaatliche „Dekommodifizierungsregimes“ neigen, so Wolfgang Streeck (1998), dazu, wachsende Teile der Bevölkerung aus dem Markt zu nehmen, um sie dann auf Kosten der Allgemeinheit zu alimentieren. So gerät die schlichte Tatsache in Vergessenheit, daß durch private ökonomische Aktivitäten überhaupt erst Wohlstand, Beschäftigung und die steuerlichen Grundlagen für öffentliche Ausgleichs- und Befriedungsprogramme geschaffen werden. Der zweite, damit zusammenhängende Kritikpunkt zielt auf die von Wohlfahrtsstaaten gezüchtete „Abhängigkeitskultur“, die den Versorgten den Anreiz nimmt, etwas für sich selbst zu tun, und sie damit zu ewigen Bittstellern macht und zu ständigen Offenbarungseiden zwingt. Was einst als neoliberale Ideologie gebrandmarkt wurde, ist heute zur Selbstverständlichkeit einer aufgeklärten Linken geworden (Anthony Giddens 1998). Exklusion ist der Titel für die Wahrnehmung neuer Problemlagen und für die Suche nach anderen Angriffspunkten einer Politik der sozialen Gerechtigkeit. Es geht um Ausgrenzung durch stillgestelltes Arbeitsvermögen und um Mißachtung durch erlernte Hilflosigkeit. 2. Das Phänomen der Exklusion Der Exklusionsbegriff gehört mit dem der Polarisierung oder dem der underclass zu einer Gruppe von Begriffen, mit denen seit der Mitte der neunziger Jahre Prekarisierungsphänomene in der Gegenwartsgesellschaft herausgestellt werden. So hat in der Sozialberichtserstattung der Europäischen Union der Exklusionsbegriff sich an die Stelle des früher verwendeten Armutsbegriff gesetzt (Ernst-Ulrich Huster 1997). Es handelte sich zuerst um politische Begriffe, von denen sich zumindest die Sozialwissenschaften in Deutschland überfahren fühlten (Rudolf Stichweh 1997). Armutsforscher, Sozialstrukturanalytiker und theoretische Soziologen mußten sich plötzlich mit Begriffsbildungen und Problemanzeigen beschäftigen, die in ihren eigenen Gesellschaftsbeschreibungen noch gar nicht vorkamen. Pierre Bourdieu (1997) war einer der ersten, der sich in Gestalt einer wilden Ethnographie des Schicksals der Untauglichen und Unerwünschten angenommen hat. Aber mit einiger Verspätung zur amerikanischen, französischen und britischen Diskussion sind jetzt auch bei uns Phänomensicherung und Begriffsklärung in vollem Gange. Das Bemerkenswerte am Exklusionsbegriff besteht darin, daß er eine Verbindung zwischen Rand und Kern der Gesellschaft herstellt (Lutz Leisering 2000b). Die methodische Voraussetzung dafür hat die Verzeitlichung der Ungleichheitsforschung durch die Umstellung von Herkunft auf Karriere geschaffen. Wohin das Leben führt, ergibt sich nicht mehr so ohne weiteres daraus, woher man kommt. Zwar läßt sich die Karriere als endogener Kausalzusammenhang konzeptualisieren, bei dem sich spätere Ereignisse aus den Bedingungen, Entscheidungen, Ressourcen und Erfahrungen vorangegangenen Ereignisreihen erklären (Karl Ulrich Mayer und Hans-Peter Blossfeld 1989), aber die Geschichte ist nach vorne für kontingente Zusammenballungen von biographischen „Lebensereignissen“ und historischen „Periodeneffekten“ (Paul Baltes 1979) gleichwohl offen. Weil im Lebenslauf als Institution (Martin Kohli 1985) der Erwerbszusammenhang der Karriere den Determinationszusammenhang der Herkunft überlagert, richtet sich die Aufmerksamkeit auf kohortenspezifische Anschlußselektionen von Familie, Bildung, Beschäftigung und Versorgung. Schon der Kohortenbegriff bricht mit der Vorstellung eines stetigen Fortkommens, indem er das Augenmerk auf Gewinner- und Verlierergenerationen auf den Arbeitsmärkten und im Sozialstaat richtet. Aber im Ganzen ging es trotz „Armutspassagen“ und „Warteschleifen“ doch um „Reichstumsungleichheiten“ (Peter A. Berger und Stefan Hradil 1990, S. 16) mit sozialem Netz und doppeltem Boden. Der Exklusionsbegriff wendet nun den Blick von regelbaren Unregelmäßigkeiten zu existentiellen Gefährdungen gesellschaftlicher Teilhabe. Der Kontingenzspielraum im Lebenslauf wird nicht mehr allein als Bedingung der Steigerung von Inklusionschancen, sondern zugleich als eine der Mehrung von Exklusionsrisiken gesehen. Wo die „Risikogesellschaft“ der achtziger Jahre noch die Freiheit der Wahl feierte, wächst in einer „Kultur des Zufalls“ um unsere Jahrhundertwende die Angst, nicht mehr gewählt zu werden. Wenn sich im allgemeinen Bewußtsein der Existenz als Karriere die Gewißheit, daß man sich im Prinzip in einem kollektiven Fahrstuhl nach oben befindet, durch das Gefühl ersetzt wird, daß immer auch alles schief gehen kann, dann lassen sich die Probleme von Ausgrenzung und Ausschluß nicht länger auf Randgruppen projezieren, sondern werden als Gefährdungen im Kern der Gesellschaft wahrgenommen. Jeder kennt jemanden, dem es trotz guter Bildung und früher Beschäftigungserfolge nicht gelungen ist, seinen Weg zu finden und seine Sache zu machen. Was als Beginn einer lebenslangen Linie rationierten Statuserwerbs aussah, brach mit einem Mal ab und kam nicht wieder ins Gleis. In solchen Fällen enthüllt die Logik der Wahl ihre teuflische Doppelgesichtigkeit: Wer nicht mehr gewählt wird, der verliert schließlich die Fähigkeit, sich selbst zu wählen. Solche Exklusionskarrieren weisen drei charakteristische Merkmale auf: Sie vollziehen sich erstens als Serie von Anerkennungsverlusten, bei der die Grenzen zwischen den verschiedenen Lebensbereichen zusammenbrechen. Defizite in der Kreditwürdigkeit schlagen sich als solche in der Arbeitsfähigkeit nieder, Urteile über den Wohnort müssen als solche über die Diszipliniertheit der Lebensführung hingenommen werden, das nicht mehr ganz frische Aussehen wird als Ausdruck reduzierter Vermögen und Antriebe aufgefaßt. Der einzelnen muß es sich schließlich gefallen lassen, daß alles, was er/sie tut oder läßt, auf einen bestimmten Mangel zurückgeführt wird. Sie organisieren sich zweitens um bestimmte Umschlagspunkte, die eine Vorgeschichte des Fortkommes und Werdens von einer Hauptgeschichte der Vergeblichkeit und des Verfalls trennen. Es zeigen sich Brüche, Schwellen und Stufen, die eine Drehung vom Gefühl des Handelns in ein Gefühl des Erleidens markieren. Daraus resultiert drittens eine Wende von kontinuierlichen zu diskontinuierlichen Unterscheidungen in der Selbsteinstufung und im Sozialkontakt. Vor die graduelle Differenz von oben nach unten schiebt sich die existentielle von drinnen und draußen. Man fühlt sich aus der Welt der Chancen verbannt und in eine Welt des Ausschlusses geworfen. Die drei Merkmale veranschaulichen eine Logik der Vereinzelung, die nur schwer in ein kollektives Verständnis geschweige in kollektives Handeln überführt werden kann. Exklusionsprozesse folgen einem „negativen Individualismus“ (Robert Castel 2000), der selbst soziologischen Kollektivkonstruktionen Grenzen setzt. Man kann zwar eine Logik des Verlaufs von Exklusionsprozessen identifizieren, aber es fällt schwer, den davon betroffenen Individuen und Familien einen bestimmtem sozialen Ort zuzuweisen. Natürlich gibt es spezielle Risokogruppen wie die von der Armutsforschung immer wieder herausgestellten Gruppen der weiblichen Alleinerziehenden, der arbeitslosen Jugendlichen in „sozialen Brennpunkten“, der Rentner mit geringer Altersversorgung, der Migranten mit problematischem Legalitätsstatus, der Langzeitarbeitslosen, der Personen in verdeckter Armut, die im Prinzip einen Sozialhilfeanspruch haben, diesen aber aus irgendwelchen Gründen nicht geltend machen, und schließlich die Gruppe derer mit „ungewöhnlichen Arbeits-, Lebens- und Wohnsituationen“, die sowieso aus den gängigen Erhebungen herausfallen. Aber das Brisante und Irritierende am Exklusionsphänomen ist seine soziale Entgrenzung. Es gehört zur Erfahrung des sozialen Wandels unserer Gegenwart, daß man im Prinzip von jeder Stufe der sozialen Leiter abrutschen kann. Die Augenärztin, die wegen Überschuldung ihre vor zwei Jahren eröffnete Praxis wieder schließen mußte; der Friseurmeister in der Lebensmitte, dem keine andere Chance blieb, als sich selbständig zu machen, aber sich dann auf dem spiegelglatten Bürgersteig das Bein brach; der illegal beschäftigte Bauarbeiter aus der Ukraine, der mit nachgewiesenen 0,7 Promille Alkohol im Blut in einen Verkehrsunfall mit erheblicher Schadensumme verwickelt war; die 38jährige Web-Designerin, deren Beziehung nach der Geburt des ersten Kindes in die Brüche ging und die dadurch ihr haltendes Milieu verlor; oder der Fondsmanager mit mehreren losen Wohnsitzen, welcher der Fusion zweier Großbanken zum Opfer fiel – sie alle bevölkern die transversale Klasse der Überflüssigen (Heinz Bude 1998), die einen scharfen Schnitt quer durch unser wohlfahrtsstaatlich abgefedertes System sozialer Ungleichheit legt. Nicht ungleiche Verteilung von Vermögen, Einkommen und Versorgungsleistungen ist hier das Problem, sondern die schleichende Abkoppelung von den gesellschaftlichen Anerkennungssystemen. Die Überflüssigen drohen aus der öffentlichen Aufmerksamkeit und sozialen Beachtung überhaupt herauszufallen und im sozialen Aus zu landen. Die Exklusionsforschung ist stark in der Rekonstruktion von biographischen Erleidenskurven und handlungslogischer Fallen, aber sie ist schwach in der Erklärung der Ursachen und der Relevanz dieser Tatbestände. Das hängt vermutlich mit ihrer Herkunft aus einer gesellschaftstheoretisch zurückhaltenden, aber moralisch ambitionierten Randgruppenforschung zusammen. Dabei muß man die Gründe für das Hervortreten des Exklusionsphänomens nicht lange suchen. Sie liegen zunächst in der seit zwanzig Jahren anhaltenden Dynamisierung der Arbeitsmärkte, die in der Zunahme von Teilzeitarbeit, „kapazitätsorientiertvariabler Arbeitszeit“ und ungeschützter Beschäftigungsverhältnisse zum Ausdruck kommt. Hinter dieser Ausbreitung von „Nichtnormalarbeitsverhältnissen“ steckt nicht nur die wachsende Erwerbsbeteiligung der Frauen, sondern stärker noch die enger werdende Koppelung zwischen Produkt- und Arbeitsmärkten unter den Bedingungen eines durch „schöpferischen Zerstörung“ sich selbst revolutionierenden Kapitalismus. Hatten 1970 noch 84 Prozent aller abhängig Beschäftigten in der alten Bundesrepublik eine unbefristete Vollzeitstelle, so waren dies 1995 nur noch 68 Prozent. Im dem selben Zeitraum ist die Zahl der befristeten Vollzeitstellen leicht von 4 auf 5 Prozent angestiegen, zugleich hat sich jedoch der Anteil der Teilzeitbeschäftigten von knapp 5 auf über 10 Prozent verdoppelt. Noch stärker ist in letzter Zeit die Gruppe der ausschließlich geringfügig Beschäftigten von knapp 6 auf mehr als 13 Prozent gewachsen sowie der Anteil der Quasi-Selbständigen, der 1970 noch bei einem halben Prozent und 1995 schon bei 2 Prozent der Erwerbstätigen lag. Viel dramatischer stellen sich die Verhältnisse dar, wenn nicht allein im Querschnitt die Zahl der Stellen in Rechnung stellt, sondern im Längsschnitt die Entwicklung der Arbeitsverhältnisse einzelner Erwerbspersonen über einen längeren Zeitraum verfolgt. Da zeigt sich, daß schon bei einem Beobachtungszeitraum von über 5 Jahren nur noch ein Drittel der ins Auge gefaßten Population in den achtziger Jahren in einem dauerhaften Vollzeitbeschäftigung stand. Die meisten anderen pendelten dagegen zwischen Beschäftigung, Nichtbeschäftigung und Wiederbeschäftigung hin und her (Wolfgang Bonß 2000, S. 339f). In dem Maße wie dieses Wechselverhalten zur arbeitsgesellschaftlichen Normalität wird, machen sich natürlich auch andere Sortierungs- und Auslesemechanismen geltend: Es geht jetzt um die Fähigkeit zur Terminierung von berufsbiographischen Erwartungen und betrieblichen Bindungen und zum Wechsel zwischen Tätigkeitsbereichen und Arbeitsverhältnissen. Daß die Fähigkeit dazu nicht allein von beruflichen Qualifikationen und kognitiven Kompetenzen abhängt, liegt auf der Hand. Verlangt werden so wenig greifbare Dinge wie psychosoziale Teamfähigkeit, biographische Risikotoleranz und intrinsische Motivationsbereitschaft. Dazu ist man nicht in jeder Lebenssituation und unter allen Umständen in der Lage. Deshalb können momentane biographische Schwäche- oder kritische lebenszyklische Übergangsphasen oder einfach nur unglückliche Ereignisverkettungen einen Prozeß der „Abweichungsverstärkung“ in Richtung auf eine marginalisierte Position des einzelnen im Wettbewerb auf den Arbeitsmärkten in Gang setzen. Als ein weiterer Grund für eine wachsende Exklusionsanfälligkeit ist die Wandel in der funktionalen Struktur der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zu nennen. Damit ist die Durchsetzung von sozialkoordinativen und systemanalytischen Tätigkeitsformen in allen Wirtschaftsbereichen und Industriesektoren gemeint. In der Regel muß man beides können: Die neuen Kommunikationsformen und die neuen Kommunikationstechnologien beherrschen. In direkten Fertigungsfunktionen waren in Deutschland 1997 nur noch 26 Prozent der Beschäftigen tätig, während bereits 28 Prozent den höheren Dienstleistungen von Forschung und Entwicklung, Organisation und Verwaltung sowie den unternehmensbezogenen Transaktionstätigkeiten von Datenverarbeitung, Marketing, Rechtsberatung und Finanzierung nachgingen. Nach funktionalen Tätigkeitskategorien erbrachten insgesamt 74 Prozent aller Beschäftigten eine wie auch immer geartete Dienstleistung, ob sie auf dem Papier nun als Facharbeiter, Sachbearbeiterin oder Bedienungskraft angestellt waren (vgl. zu dieser „funktionalen“ im Unterschied zur „sektoriellen“ Betrachtungsweise Stefan Krätke und Renate Borst 2000, S.54ff). Daran kann man den Wandel von „konkreten“ zu „abstrakten“ Produktionsfunktionen in der sogenannten Wissens- und Kommunikationsgesellschaft erkennen. Es entsteht eine allumfassende „Dienstklasse“, die sich nach der Auffassung von Robert. B. Reich (1996, S. 191ff) in „routinemäßige Produktionsdienste“, „kundenbezogenen Dienste“ und „symbolanalytische Dienste“ gliedert. Auf der Strecke bleiben diejenigen, die mit dieser neuartigen Informalisierung und Informatisierung der Arbeit nicht zurechtkommen, weil ihre Fähigkeit, Anweisungen entgegenzunehmen und auszuführen, und ihre Bereitschaft, Zuverlässigkeit und Loyalität zu zeigen, nichts mehr gilt. Die ganzen Rand- und Fülltätigkeiten in der herkömmlichen Fabrikproduktion wie Magazinbetreuung, Gebäudeaufsicht oder Fahrbereitschaft fallen weg oder werden fremdvergeben. Wer dann nicht über eine gepflegte äußere Erscheinung und über die Fähigkeit zu unverbindlicher Freundlichkeit und unangestrengter Höflichkeit verfügt, die einem immer noch einen Job als Kassierer, Krankenpfleger oder Gärtner sichert, hat schnell beruflich ausgedient und wird sozial ausgemustert. Die vom Kapitalismus der dritten Art (Luc Boltanski und Ève Chiapello 1999) geforderte Flexibilität auf den Arbeitsmärkten und Abstraktion des Arbeitsvermögens findet seinen normativen Ausdruck in dem neuen Qualifikations- und Performationsideal der „Employability“ oder „Beschäftigungsfähigkeit“ (Rosabeth Moss Kanter 1994). Darin liegt der dritte Grund für die schärfer werdende Unterscheidung zwischen denen, die dazugehören, und denen, die überflüssig sind. Es geht dabei im Prinzip um die Umstellung von der „Kollektivbetrieblichkeit“ auf die „Individualbetrieblichkeit“ (Götz Briefs) der Arbeit. Beschäftigungsfähigkeit wird als Fähigkeit des einzelnen zur Verwertung seiner eigenen Arbeitskraft gefaßt (Susanne Blancke, Christian Roth und Josef Schmid 2000). Der einzelne muß nicht nur für seine vielseitige Einsetzbarkeit durch lebenslanges Mitlernen im organisatorischen und technologischen Wandel selbst sorgen, er muß darüberhinaus seine Leistungs- und Wertschöpfungsfähigkeit im Blick auf sich wandelnde Arbeitsmärkte immer wieder zur Darstellung bringen und im Zweifelsfall durch einen Stellenwechsel unter Beweis stellen. Man muß also nicht nur sein Können pflegen, sondern auch das Können seines Könnens präsentieren können. Wer bei diesem die ganze Person in Anspruch nehmenden Selbstverwertungswettbewerb wiederum nicht mithalten kann, erweckt bald den bemitleidenswerten Eindruck eines Zuspätkommenden oder Zurückgebliebenen. Man kann jetzt genauer bestimmen, woraus Exklusionsgefahren erwachsen und worin sie bestehen: Die Arbeitsmarktdynamik erzeugt eine individuelle Verwundbarkeit jenseits der standardisierten Lebenskrisen und Existenzsrisiken von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Behinderung und Alter. Denn im Wechsel zwischen Beschäftigung, Nichtbeschäftigung und Wiederbeschäftigung wächst die Bedeutung „nicht-normativer Lebensereignisse“, die einem zufälligerweise ein Fenster öffnen oder einen fatalerweise auf Grund laufen lassen. Was die Flexibilisierung an Autonomiegewinn für den einzelnen gewährt, ist nicht ohne die Konditionierung für Zufälle zu haben. Aber wenn man überraschende Gelegenheiten nur noch als sinnlose Schicksalsschläge aufzufassen vermag, können daraus Dynamiken der sozialen Degradierung und des existentiellen Rausfallens entstehen, die einen aus der Mitte über den Rand hinaus ins Nichts führen. Die menschlichen Kosten der Kommunikations- und Wissensgesellschaft lassen sich nicht auf den „funktionalen Analphabetismus“ der Älteren reduzieren, denen die neuen Informationstechnologien ein Buch mit sieben Siegeln sind. Viel schärfer können die Anforderungen ans Verhalten in den „elastischen Spinnennetzen“ (Reiner Franzpötter und Christian Renz 2000) der neuen Welt der Arbeit wirken. Man bekommt zwar höhere Verantwortung übertragen, steht aber immer zur Disposition. Wer unter den Bedingungen von flachen Hierarchien, horizontaler Kommunikation und „total quality management“ nach eindeutigen Anweisungen verlangt, auf zertifizierte Statusansprüche pocht oder kumulative Senioritätsrechte in Anspruch nimmt, wirkt nur als Störfaktor und wird von der Betriebsorganisation über lang oder kurz ausgeschieden. Schließlich zieht das Lebensführungsideal des Individualbetriebs einen Strich zwischen denen, die aktiv sind oder sich doch aktivieren lassen, und denen, die sich von anderen durchziehen und selbst hängen lassen. Wo die einen den Zusammenhang von Selbstkontrolle und Kontrolle durch den Markt akzeptieren, kennen die anderen nur Fremdanklage und Staatsversorgung. So produzieren die Autonomen und Produktiven ihre Entbehrlichen und Überflüssigen. 3. Eine Politik des Respekts Das Phänomen der Exklusion stellt heute die eigentliche Herausforderung für eine moralisch treffende und politisch gebotenen Reformulierung des Problems der sozialen Gerechtigkeit dar. Zwar hat in der Sozialphilosophie der „Why-Equality?“-Debatte schon die nötige Kritik an einer bloßen gleichheitsmechanistischen und glücksmaximalistischen Führung des Begriffs der Verteilungsgerechtigkeit gebracht (vgl. als Überblick und Zusammenfassung Angelika Krebs 2000), aber die seit Avishai Margalits „Politik der Würde“ (1996) anhaltende Diskussion über eine gleichermaßen effiziente und würdige Wohlfahrtsstaatlichkeit hat die Sicherheit in den Phänomenen noch nicht erreicht. Hier ist der Anschluß zwischen sozialphilosophischer Gerechtigkeitstheorie und soziologischer Exklusionsforschung noch herzustellen. Ein entsprechendes Problembewußtsein ist auf beiden Seiten vorhanden (siehe Michael Walzer 1993 auf der einen und Volker H. Schmidt 2000 auf der anderen Seite). Ein gemeinsamer Ausgangspunkt könnte sich aus einer doppelten Denkbewegung ergeben: einerseits aus der Rückkehr zum einzelnen in seiner Menschlichkeit und andererseits aus der Wiedergewinnung des Begriffs eines sozialpolitischen Republikanismus, der eine Vorstellung der Vermittlung von persönlicher Freiheit und gesellschaftlicher Teilhabe besitzt. Aus der Sicht der Exklusionsforschung ist der Blick auf den einzelnen Fall wichtig, weil nur in der Konkretion einer Lebensgeschichte die Logik einer Entkoppelung zu erkennen ist. Die Überflüssigen bilden eine virtuelle Klasse, die Zuläufe aus allen möglichen gesellschaftlichen Zonen hat. Gemeinsam ist den Angehörigen dieser deterritorialisierten Population die panische Frage, ob sie wirklich noch dazugehören oder nicht schon längst abgeschrieben sind. Da kann auch keine soziologische Rekonstruktion Beruhigung bringen, indem sie dem individuellen Schicksal eine typische Schablone verpaßt. Man muß sich im Gegenteil der Negativität im einzelnen stellen, um seine gesellschaftliche Bedingtheit herauslesen zu können. So wendet sich der Soziologe in seinem Fall dem Menschen zu, der aus speziellen Gründen in diese singuläre Lage geraten ist. Selbst im kleinen Elend sind dann Spuren großen sozialer Verschiebungen zu entdecken, die das Individuum trotz seiner „unaussprechlichen Einzelheit“ zu einem Teil des Ganzen macht. Andererseits ist aus Sicht der Gerechtigkeitstheorie der Rückgang auf den einzelnen nötig, um so eine wichtige Unterscheidung wie die zwischen herablassendem Mitleid und verpflichtendem Mitgefühl treffen zu können (vgl. Elizabeth S. Anderson 2000, S.142f). Mitgefühl kommt aus dem kreatürlichen Impuls der Tröstung und entwickelt sich aus dem Wissen um das Leiden eines anderen. Im Gegensatz dazu wird Mitleid durch den Vergleich zwischen den Umständen des Beobachters und den Umständen des von ihm Bemitleidenden erweckt. Im Mitgefühl öffnet man sich für die schwierige Situation eines anderen, im Mitleid versichert man sich der traurigen Unterlegenheit des anderen. Mitgefühl fordert den anderen heraus, indem man sich ihm unterstellt, Mitleid klassifiziert des anderen, um ihm nach den zur Verfügung stehenden Mitteln zu helfen. In diesem Sinne dient Mitleid der Kompensation von Benachteiligungen, Mitgefühl dagegen der Aktivierung von Selbstseinkönnen. Wenn die neuere Gerechtigkeitstheorie darlegt, daß Forderungen nach gleicher Verteilung mit den Ansprüchen auf gleiche Anerkennung vereinbar sein müssen (etwa Axel Honneth 1992), dann versucht sie, Vorstellungen von einem Raum sozialer Teilhabe zu entwickeln, in dem der einzelne sich mit seinen persönlichen Wünschen und Bedürfnissen einen „generalisierten anderen“ vor Augen führt, der ihm einen Begriff seiner selbst verleiht. In dieselbe Richtung geht der im Blick auf das Phänomen der Exklusion entwickelte Begriff einer Politik des Respekts. Respekt arbeitet mit der kontrafaktischen Unterstellung einer Reziprozität des Austauschs. Wiewohl der mit dem Gefühl seiner Überflüssigkeit Kämpfende über die entsprechenden „capabilities of functioning“ (Amartya Sen 1992) nicht verfügt, um sich den harten Wettbewerbsbedingungen unserer Gegenwartsgesellschaft zu stellen, nimmt eine Politik des Respekts die Adressaten einer Wohlfahrtshilfe oder eines Transfereinkommens in der Weise ernst, daß staatliche Leistungen an individuelle Gegenleistungen gebunden werden. Es geht um einen von der Allgemeinheit finanzierten Vorgriff auf Zukunft für die, die mit einer Vergangenheit schlechter Ausgangsbedingungen und verpaßter Gelegenheiten hadern. Die auf der Basis der Bedarfsgerechtigkeit gewährte Unterstützung wird an den Maßstäben einer vorweggenommenen Leistungsgerechtigkeit gemessen, damit nicht einfach nur Anrechte auf Verteilung gesichert sind, sondern immer auch Ansprüche auf Anerkennung eingelöst werden können. Eine Politik des Respekts richtet sich zuerst an die Ignorierten und Beleidigten und rechnet mit der prinzipiellen Fähigkeit aller Menschen, sich selbst wiederaufzurichten. Sie ist in dem Sinne absolutistisch, als es ihr letztlich darauf ankommt, ob der einzelne ein gutes Leben führen kann, und nicht, wie sein Leben im Vergleich zu dem Leben anderer aussieht. So könnte es gelingen, den strukturell Ausgesteuerten und persönlich Entmutigten wieder zu einem Gefühl für ihr eigenes Leben zu verhelfen, ohne ihnen eine außengeleitete Aktivierungsethik überzustülpen, die doch nur der Selbstvergewisserung derer dient, die nichts zu befürchten haben. Literatur Aglietta, Michel (2000), Ein neues Akkumulationsregime. Die Regulationstheorie auf dem Prüfstand, Hamburg. Anderson, Elizabeth, S. (2000), Warum eigentlich Gleichheit? In: Krebs, Angelika (Hrsg.), Gleichheit oder Gerechtigkeit. Texte der neuen Egalitarismuskritik, Frankfurt am Main, S. 117-171. Baltes, Paul (Hrsg.) (1979), Entwicklungspsychologie der Lebensspanne, Stuttgart. Berger, Peter A. und Hradil, Stefan (1990), Die Modernisierung sozialer Ungleichheit – und die neuen Konturen ihrer Erforschung, in: dies. (Hrsg.), Lebenslagen, Lebensläufe, Lebensstile, Sonderband 7 der Sozialen Welt, Göttingen, S. 3-25. Blancke, Susanne, Roth, Christian und Schmid, Josef (2000), Employability („Beschäftigungsfähigkeit“) als Herausforderung für den Arbeitsmarkt, Arbeitsbericht der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg, Stuttgart. Boltanski, Luc und Chiapello, Ève (1999), Le nouvel esprit du capitalisme, Paris. Bonß, Wolfgang und Plum, Wolfgang (1990), Gesellschaftliche Differenzierung und sozialpolitische Normalitätsfiktion, Zeitschrift für Sozialreform 36, S. 692-715. Bonß, Wolfgang (2000), Was wird aus der Erwerbsgesellschaft?, in: Ulrich Beck (Hrsg.), Die Zukunft von Arbeit und Demokratie, Frankfurt am Main, S. 327-415. Borchardt, Knut (1990), Zäsuren in der wirtschaftlichen Entwicklung. Zwei, drei oder vier Perioden, in: Martin Broszat (Hrsg.), Zäsuren nach 1945, München, S. 21-33. Bourdieu, Pierre u.a. (1997), Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft, Konstanz. Bude, Heinz (1998), Die Überflüssigen als transversale Kategorie, in: Peter A. Berger und Michael Vester (Hrsg.), Alte Ungleichheiten – neue Spaltungen, Opladen, S. 363-382. Bude, Heinz (2001), Generation Berlin, Berlin. Castel, Robert (2000), Die Metamorphose der sozialen Frage. Eine Chronik der Lohnarbeit, Konstanz. Castells, Manuel (1996), The Rise of the Network Society, Malden/Oxford. Dahrendorf, Ralf (1992), Der moderne soziale Konflikt. Essay zur Politik der Freiheit, Stuttgart. Foucault, Michel (1977), Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt am Main. Franzpötter, Reiner und Renz, Christian (2000), Neue Formen der Erwerbsarbeit, Beschäftigungsfähigkeit und soziale Sicherung, Arbeitsbericht der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg, Stuttgart. Giddens, Anthony (1998), The Third Way. The Renewal of Social Democracy, Cambridge. Hank, Rainer (2000), Das Ende der Gleichheit oder Warum der Kapitalismus mehr Wettbewerb braucht, Frankfurt am Main. Habermas, Jürgen (1985), Die Krise des Wohlfahrtsstaates und die Erschöpfung utopischer Energien, in: ders., Die Neue Unübersichtlichkeit, Frankfurt am Main. Hirschman, Albert, O. (1992), Denken gegen die Zukunft. Die Rhetorik der Reaktion, München. Honneth, Axel, (1992), Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Frankfurt am Main. Huster, Ernst-Ulrich (1997), Armut in Europa – ausgewählte Ergebnisse des Armutsobservatoriums der Europäischen Union, in: Irene Becker und Richard Hauser (Hrsg.), Einkommensverteilung und Armut. Deutschland auf dem Weg in die VierfünftelGesellschaft?, Frankfurt am Main/New York, S. 199-230. Kohli, Martin (1985), Die Institutionalisierung des Lebenslaufs, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 37, S. 1-29. Krätke, Stefan und Borst, Renate (2000), Berlin. Metropole zwischen Boom und Krise, Opladen. Krebs, Angelika (Hrsg.) (2000), Gleichheit oder Gerechtigkeit. Texte der neuen Egalitarismuskritik, Frankfurt am Main. Leisering, Lutz (2000a), Wohlfahrtsstaatliche Generationen, in: Martin Kohli und Marc Szydlik (Hrsg.), Generationen in Familie und Gesellschaft, Opladen , S. 59-76. Leisering, Lutz (2000b), „Exklusion“ – Elemente einer soziologischen Rekonstruktion, in: Felix Büchel u.a. (Hrsg.), Zwischen drinnen und draußen. Arbeitsmarktchancen und soziale Ausgrenzungen in Deutschland, Opladen, S. 11-22. Lepsius, M. Rainer (1990), Soziale Ungleichheit und Klassenstrukturen in der Bundesrepublik Deutschland, in: ders., Interessen, Ideen und Institutionen, Opladen, S. 117-152. Mayer, Karl Ulrich und Blossfeld, Hans-Peter (1989), Die gesellschaftliche Konstruktion sozialer Ungleichheit im Lebensverlauf, in: Peter A. Berger und Stefan Hradil (Hrsg.), Lebenslagen, Lebensläufe, Lebensstile, Sonderband 7 der Sozialen Welt, Göttingen, S. 297318. Margalit, Avishai (1996), Politik der Würde. Über Achtung und Verachtung, Berlin. Marshall, T. H.(1950), Citizenship and Social Class, Cambridge. Moore, Barrington (1982), Ungerechtigkeit. Die sozialen Ursachen von Unterordnung und Widerstand, Frankfurt am Main. Moss Kanter, Rosabeth (1994), Employability and Job Security in the 21 st Century, Demos. Heft 1, Special Employment Issue. Olson, Mancur (1968), Die Logik des kollektiven Handelns, Tübingen. Reich, Robert B. (1996), Die neue Weltwirtschaft. Das Ende der nationalen Ökonomie, Frankfurt am Main. Roth, Günter (1963), The Social Democrats in Imperial Germany, Totowa. Schmidt, Volker H. (2000), Ungleichheit, Exklusion und Gerechtigkeit, Soziale Welt 51, S. 383-400. Sen, Amartya (1992), Inequality Reexamined, New York. Sennett, Richard (1998), Der flexible Mensch, Berlin. Stichweh, Rudolf (1997), Inklusion/Exklusion, funktionale Differenzierung und die Theorie der Weltgesellschaft, Soziale Systeme 3, S. 123-136. Streeck, Wolfgang (1998), Einleitung: Internationale Wirtschaft, nationale Demokratie?, in: ders. (Hrsg.), Internationale Wirtschaft, nationale Demokratie. Herausforderungen für die Demokratietheorie, Frankfurt am Main, S. 11-58. Taylor, Charles (1988), Wesen und Reichweite distributiver Gerechtigkeit, in: ders., Negative Freiheit? Zur Kritik des neuzeitlichen Individualismus, Frankfurt am Main. Thompson, Edward, P. (1987), Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse, Frankfurt am Main. Walzer, Michael (1992), Sphären der Gerechtigkeit. Ein Plädoyer für Pluralität und Gleichheit, Frankfurt am Main. Walzer, Michael (1993), Exclusion, Injustice, and the Democratic State, Dissent 40, S. 55-64.