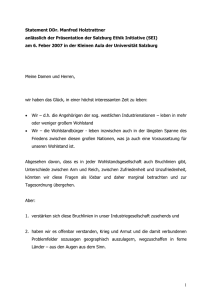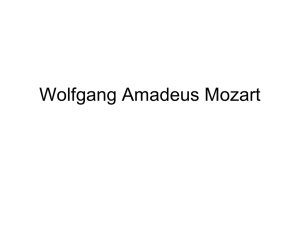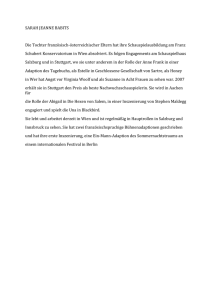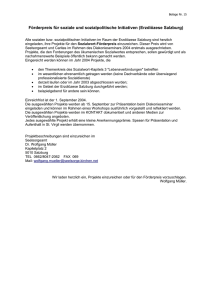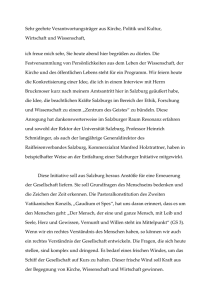Leselampe Salz - Salzburg 2016
Werbung

Norbert Niemann Cosy 12 Ich habe mich selber darüber gewundert, dass sich mir ausgerechnet dieses Thema, dieses Gebäude, dieser Anblick sofort aufgedrängt hat, nachdem ich zu „Salzburg von außen“ eingeladen worden war. Und ich weiß noch immer keine Antwort auf die Frage, warum ausgerechnet der Eindruck eines Verlagshauses und der Eindruck der Stadt Salzburg in meinem Innern zu einer solchen Einheit verschmolzen sind, dass ich augenblicklich gewusst habe, ich würde, wollte ich über Salzburg schreiben, zwangsläufig über das Anwesen des Cosy Verlags schreiben müssen. Erst recht habe ich keine Ahnung, ob das überhaupt etwas miteinander und nicht vielmehr nur mit mir, mit meiner Art von Wahrnehmung nicht einmal speziell dieser Stadt, sondern vielleicht der Welt im Allgemeinen zu tun hat. Aber wenn doch: Was? Jedenfalls habe ich es während der vergangenen dreißig Jahre, also seit ich am Chiemsee lebe und immer wieder nach Salzburg, als der nächstgelegenen größeren Stadt mit einem ansprechenden Kulturangebot, gefahren bin, kein einziges Mal versäumt, sowohl beim Hinein- als auch beim Hinauskommen die Fassade, den Garten, das Ensemble des Cosy Verlags zu studieren. Immer über die Landstraße, die Thomas-BernhardFahrradroute von Traunstein nach Freilassing kommend, also stets die unerfreuliche Autobahn-Maut umgehend, empfing mich kurz nach Passieren der lange geschlossenen, aber mit freundlich durchwinkenden Beamten besetzten, später offenen, zwischenzeitlich wieder und demnächst wohl erneut ganz geschlossenen und wahrscheinlich mit weniger freundlich durchwinkenden Beamten besetzten österreichischen Grenze linker Hand dieser zweistöckige Betonflachbau, auf dessen Dach unübersehbar die großen weißen Lettern zu lesen sind. Und verabschiedete mich später wieder, diesmal natürlich rechter Hand, bei der Ausreise. Jedes Mal dachte oder sagte ich, je nachdem, ob SALZ 165 | ich allein oder mit anderen im Auto saß, manchmal sogar schon auf der Salzach-Brücke: „Wie es wohl dem Cosy Verlag geht?“ Es wurde geradezu meine fixe Begrüßungsformel für Salzburg, während meine Abschiedsfloskel zwar gleichfalls stets die gleiche blieb, doch mit der Zeit gewisse semantische Verschiebungen erfuhr. Nie hatte ich recherchiert, was der Cosy Verlag eigentlich verlegt, erst jetzt, anlässlich dieses Beitrags, bin ich ins Internet gegangen, habe es herausgefunden und bin unverzüglich zu dem Schluss gekommen, dass es immer noch genauso wenig zur Sache tut wie in all den Jahren davor, als ich nicht den blassesten Schimmer davon hatte. Immer war es mir nur darum gegangen, die unten von einer braunen, beige gesprenkelten Klinkeroptik gefliesten, oben von einem rundum laufenden Fensterband zwischen zwei gleichfalls rundum laufenden Betonplattenbändern beherrschten Fassade und den von einem Kiesweg durchschnittenen Rasenstreifen des Vorgartens nach irgendwelchen Zeichen der Veränderung abzusuchen. Und selbstverständlich keine zu finden. Denn genaugenommen war es das, wonach ich suchte, wenn auch keineswegs mit Bewusstsein und Absicht. Genauer gesagt, nur bei meiner Ankunft interessierte mich die scheinbar vollständige Unveränderlichkeit im Aussehen des Verlagshauses inklusive Vorgarten. Beim Verlassen hingegen fesselte mich eher Neugier auf Sensationen. Normalerweise fuhr ich bei Tageslicht in die Stadt ein und erst nachts wieder aus ihr heraus, was bedeutete, dass sich nur auf der Heimfahrt Rückschlüsse auf das Innenleben des Gebäudes ziehen ließen, insofern dort eben noch Licht brannte oder nicht. Es brannte aber immer eins, und zwar nur ein einziges links oben in der Ecke, verlässlich zu jeder Nachtzeit, die gelegentlich auch sehr spät sein konnte. Daher sagte oder, je nachdem, dachte ich im Vorbeifahren jedes Mal: „Ah, im Lektorat wird noch gearbeitet.“ www.leselampe-salz.at Es war ein Running Gag. In gespannter Erwartung fuhr ich allein oder zu mehreren auf die Grenze zu, um – wie immer – das Zimmer des offenbar ohne Schlaf auskommenden Lektors hell erleuchtet vorzufinden und meinen Spruch aufzusagen. Jedoch muss ich zugeben, dass der Gag im Lauf der Zeit mehr und mehr ins Sarkastische kippte. Nacht für Nacht, Jahr um Jahr blieb im linken oberen Eckzimmer dieses Gebäudes, in dem sich um diese Zeit natürlich längst kein Mensch mehr aufhielt, das Licht eingeschaltet. Die Gestalt des über einem Berg von Manuskripten brütenden Lektors hatte sich aber längst als Fiktion in meinem Kopf festgesetzt. Und es war eben diese Fiktion, die an Stelle des immer gleichen Anblicks allmählich ihren Charakter veränderte. Zuerst stellte ich mir, passend zum Verlagshaus mit dem Verlagsnamen in einer runden lässigen Siebziger Jahre-Schrift auf dem Dach seiner selbstbewussten Siebziger Jahre-Architektur, einen leicht verwahrlosten Mann mittleren Alters in Cordhosen und Strickjacke vor, der, je nachdem, wie weit die Stunden bereits vorgerückt waren, eine halb oder doch schon ganz geleerte Flasche Zweigelt und einen gut gefüllten Aschenbecher neben sich, zwar erschöpft, manchmal auch verzweifelt, doch stets passioniert und gewissenhaft mit dem Korrekturstift übers Papier gebeugt dasaß. Nach und nach verwandelte sich die Person in einen Herrn in Anzug und Krawatte, der noch immer rauchend und trinkend, aber voller Verachtung die trotz seines ins Enorme gesteigerten Tempos niemals niedriger werdenden Stapel nach Maßgabe einer beiliegenden oder auswendig gelernten Prüfliste mit groben Strichen beackerte beziehungsweise über die Schulter hinweg in den Rachen eines Reißwolfs beförderte. Als nächstes spaltete und multiplizierte sich die Figur zu einer Gruppe gemischtgeschlechtlicher junger Mitarbeiter, die nach dem Dress-Code von Bankangestellten gekleidet waren. Sie saßen SALZ 165 unter Rauchmeldern vor ihren Monitoren und ließen irgendwelche Programme über irgendwelche Dateien laufen. „Ah“, dachte oder sagte ich immer im gleichen Ton, „im Lektorat wird noch gearbeitet“ – und doch setzte der Satz jedes Mal die Betonung anders, so dass er sich böser und böser anhörte. Zuletzt schrumpfte mein fiktionales Lektorat wieder auf eine einzige, einsame Gestalt, die sich auf Mindestlohnbasis die Nächte in der Rolle eines Korrektors um die Ohren schlug, der nichts weiter zu tun hatte, als regungslos dazuhocken und als lebende Attrappe seinen Posten einzunehmen. Eines Nachts schließlich – ich kann nicht mehr sagen, wie lange das her ist, zwei, drei Jahre vielleicht – war plötzlich alles finster im Haus. Und ist es seither geblieben. „Jetzt hat er sich aufgehängt“, sagte ich damals und meinte meinen ausgedachten Verlagslektor. Später sagte oder dachte ich gar nichts mehr. Dafür habe ich auf einmal bei den Anfahrten, im Tageslicht, den Eindruck, einer Art Metamorphose des Baus samt Vorgarten beizuwohnen. Das Areal wirkt seit neuestem, als würde es zunehmend verstauben. Obwohl andererseits von Staub gar nicht die Rede sein kann. Vielmehr ist es, als zögen sich sukzessive jene Substanzen gleichsam nach innen, in die tieferen Schichten der Beton- und Fliesenflächen, sogar ins Erdreich unter dem noch immer regelmäßig gemähten Rasen zurück, die einst für die Deutlichkeit der Konturen, der Farben zuständig gewesen waren und dem Gebäude, gleichgültig gegenüber dem, was hinter seinen Fassaden vor sich ging, eine Aura von Unerschütterlichkeit verliehen hatten. Genau damit – so scheint es – ist es nun won möglich vorbei. | www.leselampe-salz.at 13