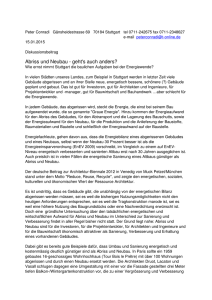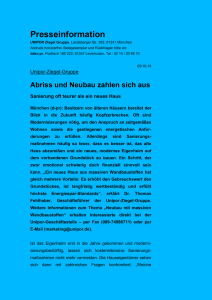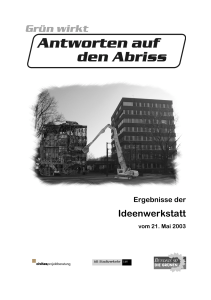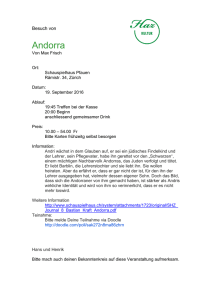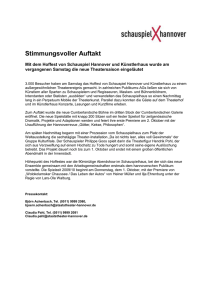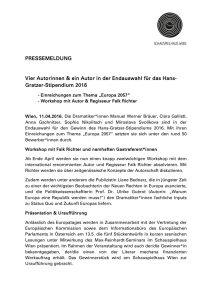„Abrissunternehmen Moderne“.
Werbung

Der folgende Artikel aus der Süddeutschen Zeitung wurde leider nicht in elektronischer Form veröffentlicht. Daher stellen wir ihn als Abschrift zur Verfügung. Er erschien am Donnerstag, 18. Februar 2010 auf Seite 13 unter der Überschrift: „Abrissunternehmen Moderne“. Prominente Bauten der Nachkriegsmoderne stehen kurz vor ihrer Zerstörung - trotz Denkmalschutz und Nachhaltigkeitsgebot __________________________________________________________________________ „Weg mit dem hässlichen Koloss!“ Wenn es um Architektur und Städtebau der Nachkriegsmoderne geht, dann werden Stammtisch-Parolen in die Gazetten gegrölt. Rosthaufen, Affenfelsen, Elefantenklo: Schon die Spottnamen signalisieren Unverständnis und Abscheu. Als Fremdkörper bekämpft oder lieblos zernutzt, werden die gealterten Gebäude endgültig als hässlich abgeschrieben. Jetzt, wo auch die immobilienwirtschaftlich forcierte „Renaissance der Stadt“ Harmonie und Kleinteiligkeit, Simse und Erker propagiert, scheint die Zeit der Revanche gekommen zu sein. Jetzt heißt es, die als Mörder der alten Städte diffamierten Architekten für ihren Fortschrittsglauben zu strafen, indem man ihre Werke eliminiert oder entstellend dekoriert. Dabei richtet sich die Aggression einer weitgehend uninformierten, instrumentalisierten Öffentlichkeit nicht gegen die schlechte massenbewältigende Stangenware des Bauwirtschaftsfunktionalismus, sondern gegen Denkmale, deren architektonische Qualität, städtebauliche Integrität, soziale Verantwortung und historische Bedeutung attestiert sind. So gerät auch die „akademische“ Denkmalpflege ins Schussfeld der Stadtverbesserer. Jüngst sprach der ehemalige Berliner Senatsbaudirektor Hans Stimmann der Nachkriegsmoderne wieder jede Denkmalwürdigkeit ab. Widerspruch kommt von unerwarteter Seite. Dass die Architektenschaft ihre verunglimpften Lehrer verteidigt, war noch zu erwarten. Aber die vielumworbenen „kreativen Klassen“, Künstler, Fotografen, Theaterleute, entdecken im totgesagt Maroden große Kunst. Die Berliner Oliver Elser und Andreas Muh stellen ihre Funde verblassender und verkannter Schönheit der „Restmoderne“ unter der Adresse urbanophil.net zur Diskussion. Eine nachgeborene Studentenschaft beginnt sich für die ästhetischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen der ungewohnt freizügigen Stadtanlagen zu interessieren, Räume, in denen der Weg noch nicht von Marktstrategen bis in den letzen Winkel vorprogrammiert wurde. Oft kaschieren die Städte ihr mangelndes Selbstbewusstsein und ihren Größenwahn mit blendend neuen Fassaden, für die die vernachlässigten Nachkriegserstlinge ihren prominenten Platz räumen müssen. „Großes denken“ wollen etwa die Festspielhausfreund unter Vorsitz von Monika Wulf-Mathies in Bonn. Der 250-jährige Geburtstag Ludwig van Beethovens soll in einem neuen Festspielhaus gefeiert werden. Die alte Beethovenhalle von Siegfried Wolske, 1959 vom scheidenden Bundespräsidenten Theodor Heuss und Amtsnachfolger Heinrich Lübke eingeweiht, scheint zu bescheiden und mittlerweile zu schäbig. Die Bonner Großunternehmen Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG und Deutsche Postbank haben 140 Millionen Euro und einen hochkarätigen Wettbewerb gestiftet. Juriert wurden nur solche Entwürfe, die die Erhaltungsforderungen der Denkmalpflege ignorierten: Zaha Hadid, Hermann&Valentiny, Arata Isozaki und Richard Meier. Hadids „Kristall“ gilt allgemein als Favorit. Bonn will am Rhein Sydney spielen und der Elbphilharmonie Konkurrenz machen. Studenten des Kunsthistorischen Instituts waren es, die mit ihrer „Initiative Beethovenhalle“ ein öffentliches Nachdenken über Qualität, Identität und Geschichte bewirkten. Der Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch und sein Stadtdirektor Volker Kregel brachten daraufhin einen alternativen Bauplatz für den HadidSolitär ins Gespräch: Neben der Telekom-Zentrale, wo das Landesbehördenhaus steht. Auch möchte die Stadtspitze eine Bürgerbefragung durchführen. Aber soll eine Stimmmehrheit über das Schicksal eines Bauwerks entscheiden, das im Namen der Öffentlichkeit bereits als Denkmal geschützt wird? Wie artikuliert sich öffentliches Interesse? Gabi DolffBonekämper, eine der profundesten Denkmaltheoretikerinnen und Expertin für Architektur der Moderne betont, dass sich um Denkmale in jedem Fall „nur“ Erbengemeinschaften bilden. Wenn sich Studenten und Musiker, Denkmals-, Heimat- und Geschichtsvereine für die alte Beethovenhalle stark machen und das bestehende Denkmalrecht öffentlich affirmativ bekräftigen, welche Legitimität hat dann eine Bürgerbefragung? Köln steuert auf eine ähnliche Befragung zu, Anlass sind die Neubaupläne für das Schauspielhaus. Waren schon die Proteste gegen die Vernichtung des Joseph-HaubrichForums und damit eines guten Stücks Kölner Westkunst-Avantgarde mit einem jahrelang offenen Bauloch quittiert worden, so zeigt sich die Stadtpolitik auch jetzt uneinsichtig. Das Ensemble von Schauspielhaus und Oper, 1957 bis 1962 nach Plänen von Wilhelm Riphahn realisiert, soll groß herausgeputzt und umgestaltet werden. Da hilft keine Eloge von Peter Zumthor, der vor Ort und vor Publikum schwärmend beschrieb, wie „überlegt“, „bis ins Detail fein durchdacht“ und „großzügig“ die Öffentlichkeit bildende Gesamtanlage sei. Da helfen keine Fotos von Albrecht Fuchs und Candida Höfer, die die Sichtbetonwangen der Werkstattpylone streicheln, das zurückhaltend elegante Schauspielfoyer umgarnen und die Charaktere der Bühnenräume würdigen. Abgedruckt ist all das in „Liebe Deine Stadt“, einer buchkünstlerisch überzeugenden Dokumentation des Wirkens von Merlin Bauer, einem österreichischen Konzeptkünstler, der eine öffentliche Auseinandersetzung mit der Kölner Nachkriegsarchitektur anregte (Greven Verlag). Half alles nichts: Kurz vor Weihnachten entschied sich der Stadtrat, dass das Schauspielhaus und die terrassenförmigen Werkstatttrakte nebst Gastronomie bald schon der Vergangenheit angehören sollen, während die Oper restauriert wird. Zuletzt hatte die Schauspielintendantin Karin Baier Einspruch erhoben und für eine Sanierung des bestehenden Gebäudes plädiert. Der Riphahn-Bau habe eine Biographie und eine Aura, die jeder Neubau sich erst einmal verdienen müsste (siehe SZ vom 17. Februar). Oft sind es die Vertreter der Öffentlichkeit, die Parlamente, die sich freizügig über das prinzipielle Erhaltungsgebot ihrer Denkmalschutzgesetze hinwegsetzen. Obwohl die Schuldenberge landauf landab erdrückend sind, obwohl überall vom Sparen gesprochen wird, können sich viele Politiker nicht von großmaßstäblichen Zukunftsprojekten verabschieden. Die vernachlässigten Nachkriegsbauten denkmalgerecht zu reparieren, halten die Repräsentanten für nicht finanzierbar. Aber die Millionensummen für den Neubau werden als Konjunktur- und Imageprogramm schöngeredet. So will der Niedersächsische Landtag noch in diesem Monat entscheiden, ob der 1957-1962 von Dieter Oesterlen rücksichtsvoll an das teilzerstörte Leineschloss gefügte Plenarsaal einem gläsernen Neubau weichen soll. Die Abgeordneten wollen raus aus der „Bunkersituation“. Ein erster Architekturwettbewerb zeigte, dass der konzentrierte Saal elegant umgebaut werden kann. Die Sieger Kai Koch und Anne Pansen wollten sie Rückwand des Saals zum Innenhof öffnen. Kostenpunkt: 21 Millionen Euro. Das schien dem Bauherrn zu teuer, er ließ die Granitfassaden des Denkmals reinigen und das Gebäude dämmen. 2009 wurde ein neuer Wettbewerb für einen größeren Plenarsaal und mehr Parkplätze ausgeschrieben. Kostenrahmen: 45 Millionen Euro. Unabdingbar: Abriss des Alten Plenarsaals. Soeben entschied sich die Jury für einen Glastempel mit Säulenvorhang von Eun Young Yi aus Köln. Damit scheint der Abriss des Plenarsaals besiegelt. Wohlgemerkt: Der Aufwand wird für vier Plenarsitzungen eines Parlaments betrieben, das kleiner werden soll. Nachhaltig ist das nicht. Wie baut man Vorurteile ab? Wie öffnet man die Augen für die Qualitäten der Bauten und Stadtanlagen, die der jungen Demokratie ihr Gesicht gaben, die dem Wohlstand einer rasant wachsenden, zunehmend mobilen und international orientierten Gesellschaft eine neue Heimat, Bildung und Vollbeschäftigung versprachen? Forschung und Bestandsaufnahme wie an der TU Berlin oder München sind das eine. Exzellente Fotografien, davon ist DolffBonekämper überzeugt, können für den Kunstanspruch sensibilisieren. Außerdem sollte man jenen Gehör schenken, die in den diffamierten Gebäuden wohnen und arbeiten. Die Bewohner der die Stadtautobahn überbrückenden Terrassenanlage an der Schlangenbader Straße in Berlin fühlen sich dort wohl. Und die Studenten der Weimarer Bauhausuniversität sehen überhaupt nicht ein, dass diese sorgfältig geplante Parkarchitektur der DDR-Moderne einem neuen Bauhausmuseum weichen soll. In Frankreich, berichtet die Denkmalpflegerin Dolff-Bonekämper, bekämen herausragende Architekturen des 20. Jahrhunderts eine Plakette - bevor sie Denkmale werden. Das erzeugt Aufmerksamkeit und Diskussion, auch unter den Denkmalpflegern, die, politisch unter Druck, selbst mit Vorurteilen belastet, zögerlich neue Denkmale und Ensembles ausweisen. Bevor die Großprojekte der sechziger und siebziger Jahre zur Disposition gestellt werden, mahnt Ute Hassler, die zusammen mit Catherine Dumont d‘Ayot an der ETH Zürich eine Tagung zu „Bauten der Boomjahre“ ausgerichtet hat: „Wir könnten gezwungen sein, die Großmaschinen immer weiter zu betreiben, weil die Ersatzinvestition für Abriss und Neubau kaum jemals von einer Generation finanzierbar sein wird.“ Ganz zu schweigen von den Bauschuttbergen, die die Umwelt über Generationen hinaus belasten werden. Das sagt zwar wenig über die architektonische Qualität und den Denkmalwert der Objekte - macht aber deutlich, dass mehr als bisher über intelligente, energieminimierende Umbauten als über Abriss nachgedacht werden muss. Sind erst einmal der Beton saniert, die Metallfassaden gereinigt, alle Schadstellen repariert, die Haustechnik erneuert, wird der miesgeredete „Klotz“ nicht selten zur bewunderten Skulptur. IRA MAZZONI