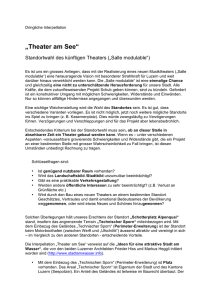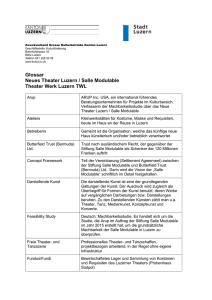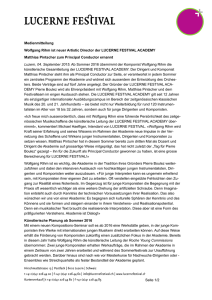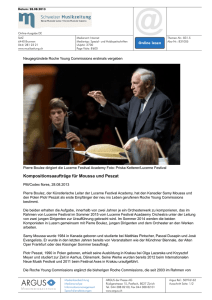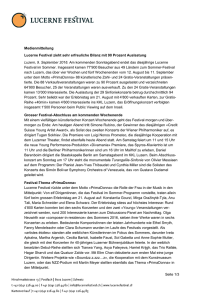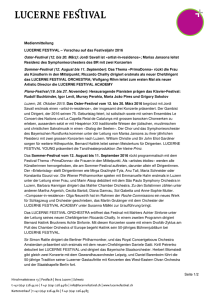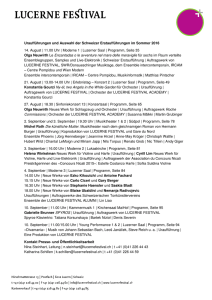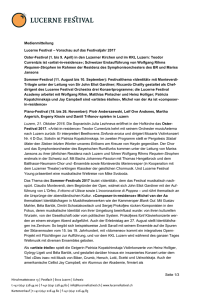NeuöZürcörZäitung
Werbung

Neuö Zürcör Zäitung Samstag/Sonntag, 8./9. August 2009 Nr. 181 SB 1 SONDERBEILAGE LUCERNE FESTIVAL Sandstein (Antelope Canyon, USA). «Natur» – so heisst das Thema, das sich Lucerne Festival für seine Sommerausgabe 2009 gegeben hat. Nichts Natürlicheres als das, möchte man meinen. Tatsächlich sind Natur und Musik (oder Natur P. FRISCHKNECHT / BLICKWINKEL und Kunst ganz allgemein) in vielfältigster Weise miteinander verbunden – nicht zuletzt durch das Moment der Struktur, das hier wie dort waltet. In ihrer Entwicklung über die Jahrhunderte hinweg ist die Beziehung indessen von ausserordentlicher Vielschichtigkeit und Komplexität. Weshalb in den knapp siebzig Konzerten der kommenden sechs Wochen wieder manche Entdeckung zu machen sein wird. Musik ist Genuss Das Lucerne Festival Orchestra gehört zu den eindrucksvollsten Klangkörpern der Welt. Erstklassige Musiker unter der Leitung von Maestro Claudio Abbado überzeugen in ihrem Spiel durch unnachahmliche Intensität und Brillanz. Nestlé, das führende Unternehmen für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden, freut sich, Ihnen diesen Höhepunkt des Konzertjahres 2009 als Sponsor des Lucerne Festival Orchestra präsentieren zu dürfen. www.nestle.com <wm>10CAsNsjY0MDAx1TWwMLI0sAQAEodn9w8AAAA=</wm> Photo: Lucerne Festival <wm>10CD2LSwqAMAwFT9TwEluT2GU_qyKi4v2PYnHhYmAYmDFyInyUtt_tzAzEFGDi8GyitNoUlriQa9IMBQvgGyNC1GymfwilhgvowAOmo_YXyort_mAAAAA=</wm> Neuö Zürcör Zäitung LUCERNE FESTIVAL Samstag/Sonntag, 8./9. August 2009 Nr. 181 Natur in der Musik? Das Äussere und das Innere «Musik und Natur» – das Thema, das die diesjährige Sommerausgabe von Lucerne Festival bestimmt, liegt verdächtig nahe. Musik ist in der Natur, man muss nur der Amsel zuhören; und Natur ist in der Musik, wovon zahllose Stücke im Geist von Beethovens «Pastorale» künden. Indessen, ganz so einfach sind die Beziehungen zwischen dem in der Schöpfung Gegebenen und dem von Menschenhand in künstlerischer Absicht Geschaffenen doch nicht. Zwischen den (durchaus unterschiedlich ausgelegten) Prinzipien der Nachahmung, wie sie im 18. Jahrhundert galten, und den Ideendramen der spätromantischen Sinfonischen Dichtung liegen Welten und Wege, denen ein erster thematischer Block dieser Sonderbeilage nachzugehen sucht. Und heute – oder: im 20. und 21. Jahrhundert? Spielt da die Natur in der Musik noch eine Rolle? Gewiss, Arnold Schönberg wünschte sich, dass seine zwölftönigen Lineaturen dereinst so natürlich wirkten, dass sie von jedermann auf der Strasse nachgepfiffen werden könnten. Wer jedoch an Nono, Stockhausen und Boulez denkt oder auch an Klaus Huber und Heinz Holliger, assoziiert weder Abendrot noch die Nöte eines Helden. Im Gegenteil, nach dem Zweiten Weltkrieg und als Folge davon hat sich die Vorstellung einer reinen, ganz und gar in sich selbst verankerten und ausschliesslich auf strukturelle Vorgänge zielenden Musik verbreitet. Die Idee der absoluten Musik stellte nicht nur die Frage, ob Musik – zumal Instrumentalmusik, wie sie bei Lucerne Festival dominiert – überhaupt einen Inhalt haben könne, sie verneinte sie zugleich, und zwar radikal. Damit tat sie nichts prinzipiell Neues, wenn man sich an die durch den Wiener Musikkritiker Eduard Hanslick im späten 19. Jahrhundert so nachhaltig geschürten Debatten um die Musik als «tönend bewegte Form» erinnert. Aber sie spitzte das Thema zu und führte einen Begriff ein, der heute Allgemeingut ist. Um ihn und überhaupt um die Frage nach einem möglichen Inhalt von Musik dreht sich weiter hinten ein zweiter Schwerpunkt der Beilage. Ein Thema hat die Musik allerdings ohne Zweifel. Es ist der Raum. Der Aspekt des Räumlichen ist geradezu ein Parameter der Musik geworden, das lehrt der Blick in die Geschichte. Und welche Bedeutung diesem Aspekt zuwachsen kann, zeigt sich in Luzern, wo mit der Salle modulable ein gutes Jahrzehnt nach der Eröffnung des KKL von Jean Nouvel noch einmal ein neuer Saal geplant ist, der ungewohnte räumliche Dimensionen erschliessen soll. Woher stammt die Idee der Salle modulable? Wie ist sie entstanden, und aus welchem ästhetischen Umfeld kommt sie? Diese Fragen stellt ein dritter thematischer Schwerpunkt ins Zentrum der Beilage. Herausgearbeitet wird dort, in welchem Mass das Konzept einer Salle modulable auf den Komponisten und Dirigenten Pierre Boulez zurückgeht, der eben nicht nur geraten hat, die Opernhäuser in die Luft zu sprengen, sondern auch Alternativen entwickelt hat. Der – natürlich angeregt durch Denkansätze, die in der Luft lagen – schon früh das räumliche Denken in sein Schaffen integriert hat. Und der schon in den 1960er Jahren den Gang durch die Institutionen angetreten und einiges bewirkt hat. Mag sein, dass sich seine Visionen in Luzern erfüllen. Peter Hagmann Musik und Natur – ein vielschichtiges Verhältnis im Wandel der Zeiten INHALT Natur und Kunst, Kunst und Natur Ohne Natur keine Kunst, aber auch: ohne Kunst keine Natur. Denn Natur entsteht zusammen mit SB 4 dem Widerschein der Kunst. Musik im Raum Musik schafft Raum, entfaltet sich im Raum, erweitert den Raum. Der Blick in die Geschichte SB 5 lässt spannende Beziehungen erkennen. Boulez und seine räumlichen Visionen Die Idee der Salle modulable geht auf den jungen Pierre Boulez zurück. Schon in den frühen sechziger Jahren arbeitete er in diese Richtung. SB 6 Eine Salle modulable für Luzern Kommt sie wirklich, die Luzerner Salle modulable? Es lässt sich mit gutem Grund annehmen. SB 7 Die Arbeiten gehen planmässig voran. Nichts als reine Musik Die Musik erzähle nichts, genüge vielmehr ganz sich selbst – so die Idee der absoluten Musik. Heute ist von ihr nur mehr der Begriff übrig. SB 8 Musik und ihre Geschichten Sie kann sehr wohl erzählen. Erst hat die Musik den Naturlaut nachgeahmt. Später fühlten sich SB 9 die Komponisten als Dichter. Verantwortlich für diese Beilage: Peter Hagmann (hmn.) Natur und Struktur hmn. Natur kennt ebenso die hochgradige Ordnung wie die vom Menschen geschaffene Kunst. Das zeigen die Sandsteinformationen auf den Bildern zu dieser Beilage. Die Auswahl besorgte unser Bildredaktor Christian Güntlisberger. SB 3 Von Ernst Lichtenhahn Musik hat seit je und in einer primären Weise mit Natur zu tun; sie kommt aus der Natur, orientiert sich an ihr und geht doch eigene Wege – in immer wieder anderer Art. Eine komplexe Beziehung. Die Natur als Umwelt und Lebensraum hat den Menschen seit je dazu herausgefordert, in Tönen auf sie zu reagieren. Die Fiedelspielerin der Tuareg in der südlichen Sahara, nach der Bedeutung ihrer Stücke befragt, verweist auf das Auf und Ab der Sanddünen; ihre Kollegin mit der Trommel beherrscht eine Unzahl von Rhythmen, die die Bewegungsarten des Kamels wiedergeben, und der flötende Hirte schätzt den hauchenden, nach unseren westlichen Vorstellungen «unsauberen» Ton seines einfach gebauten Instruments, weil so sein Spiel den Wind einzufangen vermag. ZWEI ARTEN DER MUSIKBETRACHTUNG Das Naturelement wird nicht nur tönend abgebildet, es muss sich gleichsam der Verfügungsgewalt des Musikers unterwerfen. Das gilt für unzählige nichtwestliche Gesellschaften, für die Herder einst die Bezeichnung «Naturvölker» prägte. Doch auch in der Kunstmusik der westlichen Kultur begegnen uns auf die Natur bezogene Werke allenthalben: Vivaldis und Haydns «Jahreszeiten», die «Alpensinfonie» von Richard Strauss, «La mer» von Debussy, «Déserts» von Edgard Varèse, um nur einige der Kompositionen zu nennen, die auf dem Programm von Lucerne Festival im Sommer 2009 stehen. Sich musikalisch mit Naturphänomenen auseinanderzusetzen, erscheint als ein ursprüngliches Bedürfnis, naheliegend und einleuchtend. Indes sind die Beziehungen von Musik und Natur so vielfältig und wurden im Laufe der Geschichte so kontrovers und leidenschaftlich diskutiert, dass jeder Schein von Evidenz längst verschwunden ist. Um die Zusammenhänge zwischen Musik und Natur aufzuzeigen, boten sich von der Antike über das Mittelalter bis in die Neuzeit zwei Erklärungsmuster an. Das eine geht von dem Grundsatz aus, dass es die Aufgabe aller Künste sei, die Natur nachzuahmen, und dass die Musik, als deren eigentliche Erscheinungsform bis weit ins 18. Jahrhundert hinein die wortgebundene, die Vokalmusik galt, solche Nachahmung vor allem durch die klangliche Verlebendigung der Worte und der darin angezeigten menschlichen Affekte und Leidenschaften bewerkstelligen solle. Dem anderen Erklärungsmuster liegt die mathematische Berechnung der Intervallverhältnisse zugrunde, wonach die bei jedem Ton mitschwingenden Obertöne die Naturgegebenheit der harmonischen Ordnung erwiesen, die zudem ihre Entsprechung in den Umlaufbahnen der Planeten fänden. Auf dem Programm von Lucerne Festival steht (am 12. September) ein Werk aus dem französischen Barock von Jean Fery Rebel mit dem Titel «Les Eléments, symphonie nouvelle». Im ersten Satz, überschrieben «Le cahos», wird die Erschaffung der Welt musikalisch dadurch geschildert, dass zu Beginn in einem kühnen Cluster alle Töne der Tonart d-Moll zugleich erklingen, dass dann in der Reduktion auf einen einzigen Ton die Erde hervortritt, ehe sich die Tonart festigt, mäandernde Flötenmelodien das Wasser, lang gehaltene, von Piccolo-Kadenzen überlagerte Akkorde die Luft und brillante Geigenpassagen das Feuer anschaulich machen. NACHAHMUNG UND FUNKTIONALITÄT Beide Betrachtungsarten kommen hier zu ihrem Recht: in der erst allmählich entstehenden harmonischen Ordnung die eine, im klangmalerischen Abbilden der Naturphänomene die andere. Nur dass sich diese Abbildung hier, in einem Stück reiner Instrumentalmusik, nun eben nicht an einem Text und an menschlichen Affekten orientieren konnte, sondern lediglich an der unbelebten und – sofern in andern Werken etwa Vogelstimmen mit ins Spiel gebracht wurden – an der aussermenschlichen Natur. Diese Orientierung war zu jener Zeit und zumal in Frankreich geradezu unerlässlich für die Instrumentalmusik, wollte sie sich nicht dem Verdacht der Bedeutungslosigkeit aussetzen, den Fontenelle in der Frage formulierte: «Sonate, que me veux-tu?» So steht es denn etwa für den Abbé Dubos in seinen damals viel gelesenen «Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture» fest, dass instrumentale Sätze vor allem dazu taugten, in Opernouverturen und -zwischenspielen recht deutliche Naturschilderungen zu geben. Gewiss, die Komponisten jener Zeit entwickelten im Klangmalerischen grosse Fertigkeiten und stellten sich zumal im Bereich der Blasinstrumente immer reichere Möglichkeiten bereit, mit den Orchesterfarben eindrücklich und spektakulär zu spielen. Das setzt sich fort bis in die Revolutionsmusik mit ihren Schlachtsinfonien, bis zur «Symphonie fantastique» von Hector Berlioz (Konzert vom 2. September), und findet seinen Nachklang noch in Webers «Freischütz» (27. August). Zugleich aber droht die Gefahr der Veräusserlichung; die Musik rückt in die Nähe der damals hochentwickelten Theatermaschinen, als perfektes Mittel, Bühneneffekte zu erzeugen, oder sie verkümmert zur Postkartenidylle oder zur Jahrmarktsattraktion von der Art jener gerade in Luzern lange Zeit so beliebten Orgelgewitter (als Beispiel hierzu: Sigismund Ritter von Neukomms «Konzert am See, unterbrochen von einem Donnerwetter» im Orgelrezital vom 5. September). Denn nicht immer konnte die Klangmalerei in der Vorstellung die geistige Vertiefung und Verinnerlichung erlangen, wie sie etwa in Händels «Israel in Egypt» dadurch ermöglicht wird, dass es der Gott Abrahams selber ist, welcher die zehn Plagen über das Land schickt und – eindrücklich geschildert in der Chorpassage «But the waters overwhelmed their enemies» – die Truppen des Pharao in den Fluten des Roten Meers versinken lässt (Konzert vom 26. August). SPIEGEL INNERER BEWEGUNGEN Das Unbehagen gegenüber einer bloss äusserlichen Naturschilderung wuchs in dem Masse, als die moderne Instrumentalmusik, wie sie in den Sinfonien Haydns, Mozarts und Beethovens zutage trat, immer deutlicher erkennen liess, welche inneren Mittel einer rein musikalischen Gestaltung zur Verfügung standen. Unter diesem Eindruck verfasste Johann Jacob Engel, Hauslehrer der Brüder Humboldt und einer der bedeutendsten Vertreter der Berliner Aufklärung, seine Schrift «Über die musikalische Malerei». Darin schlägt er vor, die Instrumentalmusik, deren Stärke doch darin liege, die Empfindungen und Bewegungen der Seele auszudrücken, solle nicht bloss – quasi objektiv – die Aussenseite abmalen, sondern die durch das Naturerlebnis ausgelösten inneren Bewegungen in Töne bringen, da das Verhältnis der Musik zum Abgebildeten ja ohnehin eine überhöhte, «transzendentelle» Ähnlichkeit sei. Durch Engels Vorschlag wurde wahrscheinlich Beethoven dazu angeregt, über die Stimme der ersten Violine der sechsten Sinfonie, der «Pastorale», die Bemerkung zu setzen: «Mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei». Auch in die Frühromantik gingen solche Ansichten ein, nur dass hier die Kritik an der musikalischen Naturnachahmung mitunter geradezu in Verachtung umschlug, so wenn Schelling in seiner «Philosophie der Kunst» behauptet, nur «ein ganz verdorbener und gesunkener Geschmack» könne «das Malende» in der Musik gut finden und sich am Blöken der Schafe in Haydns «Schöpfung» ergötzen. Die positive Seite formuliert Novalis, wenn er sagt, der Musiker nehme die Töne aus sich selber und nicht der geringste Vorwurf von Nachahmung könne ihn treffen. Und E. T. A. Hoffmann bringt beide Seiten zusammen, indem er in seiner Rezension von Beethovens fünfter Sinfonie alle Kompositionen, die bestimmte Begebenheiten schildern wollen, als «lächerliche Verirrungen» abkanzelt und betont, die Musik erschliesse dem Menschen «eine Welt, die nichts gemein hat mit der äussern Sinnenwelt, die ihn umgibt». Dennoch liegt es Hoffmann fern, die Natur aus der Musik zu verabschieden, und keinesfalls geht es ihm darum, die Musik auf die «tönend bewegte Form» zu reduzieren, wie Hanslick es später versuchen wird. Dazu sind allein schon die Schilderungen, die er vom Werdegang seines Kapellmeis- ters Kreisler gibt, viel zu eindrücklich. Hoffmann beschreibt, wie Kreisler schon als Knabe aus der Natur, aus verschlungenen Moosgeflechten etwa, Töne heraushörte und wie er später, nachdem er sich ins Räderwerk des kompositorischen Handwerks begeben hatte, diese ursprüngliche Divinationsgabe erst allmählich zurückgewann. Damit richtet sich der Blick auf die innere Transformation äusserer Eindrücke, die sich beim Komponieren vollzieht, und zugleich auf den Verweischarakter des musikalischen Kunstwerks. Solche Verwandlungsprozesse treten in Werken aus jüngerer Zeit, über deren Intentionen wir durch die Komponisten oft besser unterrichtet sind, meist klarer hervor als in älteren Werken, auch wenn die Wege letztlich immer verborgen bleiben. Als Beispiel sei «Déserts» von Edgard Varèse (Konzert vom 29. August) erwähnt: Nicht um lautmalerische Abbildung der Wüste geht es hier; Musik und Titel lassen sich eher auf einen gemeinsamen Nenner bringen durch Stichwörter wie unendliche Weite, Befreiung aus den Zwängen einer verrotteten Zivilisation, Ursprünglichkeit. Das entspricht der unerhört zukunftsgerichteten Klangwelt dieses Werks ebenso wie Varèses damaligem Gefühl, in der Wüste Westamerikas so etwas wie ein Zuhause gefunden zu haben. DAS OFFENE KUNSTWERK An wen richtet sich Beethovens Notiz «Mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei»? Klingt mir die «Pastorale» anders, wenn ich mir nicht Wachtel und Kuckuck, sondern den empfindenden Komponisten vorstelle? Und die Information, dass Richard Strauss seiner «Alpensinfonie» ursprünglich den Titel «Der Antichrist» geben wollte, wodurch das Werk als Auseinandersetzung mit Nietzsche in die Nähe von «Also sprach Zarathustra» rückt (Konzerte vom 30. August und 6. September): Verändert sie das Hören? Oder die Herdenglocken in Mahlers sechster Sinfonie (24. August): Begrüsse ich sie als ein Stück unverstellter Natur, oder erkenne ich in ihnen das gebrochene Herbeizitieren eines Intakten, das so nicht mehr sein kann? Umberto Eco hat eine Poetik des «offenen Kunstwerks» entwickelt, ausgehend von Kompositionen Berios und Pousseurs, die dem Interpreten Freiräume lassen und eigentlich eher «Möglichkeitsfelder» als abgeschlossene Werke sind. Für die im vorliegenden Text erwähnten Kompositionen trifft dies nicht zu; sie haben allesamt festgelegte Strukturen und eindeutigen Werkcharakter. Richtet sich der Blick jedoch auf die Rezeption, darauf, wie diese Werke je gehört und gedeutet werden, so verwandeln sie sich gleichfalls zu «Möglichkeitsfeldern». Das gilt für jede Rezeption, vielleicht aber für die Musik, die auf die eine oder andere Art Natur zu ihrem Gegenstand hat, in besonderer Weise. Ins Hören mischen sich unweigerlich die eigenen Naturvorstellungen, und sie bestimmen Wirkung und Auffassung entscheidend mit. Gerade angesichts der starren Apodiktik, mit der über solche Werke immer wieder geurteilt wurde, dürfte es angebracht sein, auch diesen Aspekt zu bedenken. Prof. Dr. Ernst Lichtenhahn lehrte Musikwissenschaft an der Universität Zürich und lebt in Basel. SB 4 Samstag/Sonntag, 8./9. August 2009 Nr. 181 LUCERNE FESTIVAL Neuö Zürcör Zäitung Die Blindheit sehen machen Natur und Kunst heute – eine Beziehung innerer Komplizenschaft Von Martin Seel ein Gefühl der Naturgebundenheit aller kulturellen Praxis, aller gesellschaftlichen Organisation und mit ihr aller Technik mit. Ihr wohnt ein Keim der Bejahung der Grenzen aller Kultur und somit wenigstens ein Hauch ökologischer Demut inne. Auch wo ihr Gegenüber nicht in erster Linie Naturlandschaft ist, führt sie uns ins Offene unserer naturverhafteten historischen Welt hinein. Aus Gründen wie diesen hat Adorno in seiner «Ästhetischen Theorie» dem «Kultus grossartiger Landschaft» widersprochen, einem, wie er sagt, «amusischen Verhalten», in dem der menschliche Geist nur wieder die eigene Grossartigkeit feiert. Die abstrakte Grösse der Natur wird hier zum «Reflex des bürgerlichen Grössenwahns, des Sinns für Rekord, der Quantifizierung, auch des bürgerlichen Heroenkults.» Adorno erhebt hier gegen einen Narzissmus der Naturbegeisterung Einspruch, der die Erfahrung von Landschaft im eigenen Herrschergestus erstickt. Ein solcher Abstand von aller Selbstbeweihräucherung ihres und unseres Könnens charakterisiert die gegenwärtige Auseinandersetzung der Kunst mit Natur. Darin entfaltet sie ihre Macht und Magie. Sie verwandelt das kulturelle Drinnen in ein metaphorisches Draussen und das natürliche Draussen in eine metaphorisches Drinnen. Ohne Natur keine Kunst, aber auch: ohne Kunst keine schöne Natur – da diese nicht einfach ist, sondern erst im Widerschein der Kunst entsteht. Ein dialektischer Versuch. Zur Selbstverständlichkeit wurde, so lässt sich in Abwandlung eines berühmten Satzes von Theodor W. Adorno sagen, dass nichts, was die Natur betrifft, mehr selbstverständlich ist. Längst ist es ins allgemeine Bewusstsein gedrungen, dass wir in einem Zeitalter zunehmender ökologischer Krisen leben. Mit diesem Bewusstsein aber hat es eine eigentümliche Bewandtnis. Mit jeder bedrohlichen Meldung flammt es auf, um sich bald darauf wieder einem unruhigen Halbschlaf zu überlassen. Dabei gibt es verstörende Umstände genug, die geeignet wären, sich die ungewisse Zukunft der nicht-menschlichen wie der menschlichen Natur ungeschönt vor Augen zu führen. Was aber haben diese ungemütlichen Erinnerungen mit der Kunst zu tun? Durchaus viel – denn sie haben mit ihrer Ungemütlichkeit zu tun. Wo sich die neuere und neueste bildende Kunst mit Phänomenen der Natur befasst, lotet sie die vielfältigen Irritationen des modernen Naturverhältnisses und Naturverständnisses durch verstörende Darbietungen aus. DOPPELTE VORBILDLICHKEIT «Zur Selbstverständlichkeit wurde, dass nichts, was die Kunst betrifft, mehr selbstverständlich ist» – so lautet der zu Beginn abgewandelte erste Satz von Adornos «Ästhetischer Theorie» aus dem Jahr 1970. Die beiden Sätze aber, die Abwandlung und das Original, gehören zusammen. Die Einsicht, dass sie zusammengehören, ist ihrerseits alles andere als selbstverständlich. Sie stellt vielmehr das Ergebnis eines langen historischen Prozesses dar. Denn erst im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts hat sich die Erkenntnis einer inneren, jedoch stets heiklen und spannungsreichen Komplizenschaft zwischen Kunst und Natur durchgesetzt – angetrieben durch vielfältige Entwicklungen der künstlerischen Produktion und begleitet von einer zunehmend sensiblen theoretischen Reflexion. Die klassische Formulierung der Wechselwirkung von ästhetischer Natur und ästhetischer Kunst freilich war schon knapp zweihundert Jahre vorher geglückt. In § 45 seiner «Kritik der Urteilskraft» aus dem Jahr 1790 schreibt Immanuel Kant: «Die Natur war schön, wenn sie zugleich als Anzeige Tschaikowsky-Sinfonieorchester des Moskauer Rundfunks | Vladimir Fedoseyev, Leitung | Claire Huangci, Klavier | Vilde Frang, Violine Kunst aussah; und die Kunst kann nur schön genannt werden, wenn wir uns bewusst sind, sie sei Kunst, und sie uns doch als Natur aussieht.» Worum es Kant hier geht, ist – schon damals – die Auflösung der Frage, wer denn nun das Vorbild ästhetischer Wahrnehmung und Herstellung sei: die freie Natur oder die freie Kunst. Kants Lösung liegt in der These einer doppelten Vorbildlichkeit der Natur für die Kunst und der Kunst für die Natur. Die Gegenwart ästhetisch wahrgenommener Natur ist ein Vorbild der inneren Lebendigkeit des Kunstwerks, die Imagination des Kunstwerks dagegen ist ein Vorbild einer intensiven Wahrnehmung der Natur. Die gegenseitige Befruchtung von ästhetischer Kunst und ästhetischer Natur kommt zustande, wenn Natur unter anderem wie gelungene Kunst und Kunst unter anderem wie freie Natur wahrgenommen werden kann, ohne dass die Differenz zwischen Kunst und Natur dabei ausgelöscht wird. Nicht die im Schein der Kunst wahrgenommene Natur, nicht die im Schein der Natur wahrgenommene Kunst, den Dialog zwischen Kunst und Natur erhebt Kant zur Norm eines ungezügelten ästhetischen Bewusstseins. Aber stets ist dies unser Dialog. Er vollzieht sich in der Produktion wie in der Betrachtung von Kunst, sobald wir uns spürend darauf einlassen, wie wenig selbstverständlich uns unsere Natur eigentlich ist. Vor allem die bildenden Künste partizipieren an diesem Dialog auf eine herausragende Weise. In der Vielfalt ihrer Genres und Formen erzeugen sie ganz verschiedenartige Reaktionen auf unsere Reaktionen gegenüber der Natur. Ob es sich um Malerei, Fotografie, Video oder Plastik handelt, oder ob es Installationen sind, die einige ihrer Verwandten ins eigene Gefüge integrieren – sie alle lassen sich beunruhigen von dem ungesicherten und verletzlichen, sowohl von innen wie von aussen gefährdeten Verhältnis, das gegenwärtige Gesellschaften und Kulturen zu der Naturseite ihrer Existenz unterhalten. Was die Auseinander- setzung der Kunst mit ihrem Gegenpart antreibt, ist das individuelle wie kollektive Selbstverhältnis des heutigen Menschen, der sich an jedem zufälligen Winkel der Welt und in der Anschauung jedes einzelnen künstlichen oder unbehandelten Dings inmitten eines globalen Spiels übergreifender sozialer und natürlicher Kräfte weiss – oder doch wissen kann. Wo die künstlerische Gestaltung dieses Kräftespiel auf die eine oder andere Weise in Szene setzt – so kann man mit nur wenig Übertreibung sagen –, erforscht sie den Landschaftscharakter unserer Beziehungen zur Natur: Aspekte des Umstands, dass wir uns in unserem Tun und Lassen in Sphären bewegen, von denen wir wissen, dass sie den Horizont unserer Wahrnehmungsfähigkeit immer auch übersteigen. EIN HAUCH ÖKOLOGISCHER DEMUT Im klassischen Verständnis ist Landschaft diejenige Zone, in der die Erfahrung des Naturschönen kulminiert. Jedoch ist die Erfahrung von Landschaft keineswegs an Schauplätze weitgehend unberührter oder parkähnlich inszenierter Natur gebunden; sie kann sich beliebig einer Vergegenwärtigung domestizierter und städtischer Areale öffnen. Ohnehin ist daran zu erinnern, dass beinahe alle heutigen Landschaften, auch diejenigen weit am Rand der Zivilisation, nie nur Natur sind, sondern immer auch, obzwar in ganz unterschiedlichem Mass, Legierungen von Natur und Kultur darstellen. Zugleich aber ist das Gefüge jeder Landschaft, selbst dasjenige im Raum einer grossen Stadt, allein durch den Einfluss von Wind und Wetter, immer auch ein Zustand und Geschehen der Natur. Eine jede, wie geprägt und umstellt sie von den Werken des Menschen auch sein mag, bietet dem ästhetischen Sinn ein im Ganzen ungelenktes Schauspiel der Fülle und Veränderung. Zugespitzt kann man deshalb sagen, dass Natur die Natur der Landschaft ist. Anders gesagt: In der Erfahrung von Landschaft, wo immer sie sich zutragen mag, schwingt VERWEIGERUNG DES ÜBERBLICKS Diese Verwandlungen erlauben es der Kunst, auf vielfältige Weise an die Grenzen ihrer und unserer Natur zu gehen. Die Malerei lässt im Binnenraum ihrer Flächen Bezüge sichtbar werden, die mit dem Aussenraum – sowohl des Bildes selbst als auch der Bildmotive – stillschweigend korrespondieren. Die Fotografie stellt darüber hinaus das Rätsel, was jenseits der Ausschnitte ihrer Aufnahmen lag. Das künstlerische Video verweigert das Heimischwerden in einer erzählten Welt. Skulptur und Objektkunst lassen keinen eindeutigen Standpunkt gegenüber ihren Gestaltungen zu. Die Kunst der Installation stülpt in ihrem Bezirk das Antlitz der äusseren Welt nach innen und das der Inneren nach aussen. Alle diese Künste führen vor, was sich uns entzieht. Sie schaffen Orte der Ortlosigkeit gegenüber unseren scheinbar vertrauten Orten. Sie bringen in ihrem Erscheinen die unsichtbaren Seiten des menschlichen Weltverhältnisses ans Licht. Darin liegt ihre zentrale Reminiszenz an des Menschen undurchsichtige Stellung in und zu den vielfältigen Dimensionen von «Natur». Denn auch ihr, der Natur, sieht man oft genug nicht an, wie sie auf uns wirkt und was wir mit ihr bewirken. Es ist dieses im Kern gesellschaftliche Verhältnis, auf das die künstlerische Bildpolitik der Natur reagiert. Auf dem Weg einer Bildstörung unterbricht sie jede selbstgewisse Handhabung der Differenz von Natur und Kultur. Wie in der entfesselten Erfahrung von Landschaft führt sie vor Augen, dass sich jede noch so grosse Weitsicht in einer Unschärfe verliert, die nur die Kehrseite unserer Klarheit ist. Sie verweigert den Überblick am nachdrücklichsten dort, wo wir meinen, einen Überblick zu haben. Nicht nur die Natur geht über unseren Horizont, auch die Kunst kann ihn überschreiten. In den besten Fällen lässt sie uns unsere Blindheit sehen. Prof. Dr. Martin Seel lehrt Philosophie an der Universität Frankfurt a. M. Junge Interpreten – grosse Komponisten ORPHEUM Extrakonzert zur Förderung junger Solisten |19. August 2009 | 19.30 Uhr | Tonhalle Zürich Künstlerische Leitung: Howard Griffiths Programm: Edvard Grieg: Auszüge aus «Peer Gynt» <wm>10CAsNsjY0MDAx1TWwMLG0tAAAEVPJdA8AAAA=</wm> <wm>10CD2LQQ6AIAwEXwTZFgrUHgVOxBg1_v8pogcPm0wms2OYeHxb23a1wwiI4lCiajGS5EMMSU1eykqGzIEBXUhYeFZT_QfXqjuBDtwgv9f-AL5Lq2FgAAAA</wm> Edvard Grieg: Konzert für Klavier und Orchester, a-Moll, op. 16 Sergej Prokofjew: Konzert für Violine und Orchester Nr. 1, D-Dur, op. 19 Peter I. Tschaikowsky: Fantasie-Ouvertüre zu «Romeo und Julia» Vorverkauf: Ticketcorner via 0900 800 800 (max. Fr. 1.19/min), übers Internet: www.ticketcorner.com, sowie bei allen Ticketcorner-Vorverkaufsstellen. Tonhallekasse 044 206 34 34, BiZZ 044 221 22 83, Jecklin Musikhaus 044 253 76 76, Jelmoli City 044 220 44 66, Migros City 044 221 16 71, Musik Hug 044 269 41 00 sowie bei der Orpheum Stiftung 044 381 12 22 Orpheum Stiftung zur Förderung junger Solisten, Zürich. www.orpheum.ch Chaos und Ordnung «Les Eléments», eine «Symphonie de danse» von Jean Fery Rebel Von Rudolf Bossard «L'introduction à cette Simphonie étoit naturelle; C'étoit le Cahos même, cette confusion qui régnoit entre les Elemens avant l'instant ou, assujettis à des lois invariables, ils ont pris la place qui leur est prescrite dans l'ordre de la nature.» Diese Erklärung zu «Chaos», dem ersten Satz seiner Symphonie nouvelle «Les Eléments», formulierte Jean Fery Rebel in der Vorrede zum Erstdruck, der um 1738 in Paris erschien. Das Naturverständnis, das hier zum Ausdruck kommt, stützt sich auf kosmogonische Vorstellungen, die in der Antike wurzeln, und verrät zugleich seine Verankerung im Denken der Aufklärung: Chaotisch hatten die Elemente gewirkt, bevor sie den Platz bezogen, den ihnen die unveränderlichen Gesetze der Natur vorschrieben. In der Musik von «Chaos» hat Rebel den allmählichen Wandel vom Chaos zur Ordnung überaus plastisch in Töne gesetzt. EIN FRÜHER CLUSTER Wer war Jean Fery Rebel? 1666 als Wunderkind in eine Musikerdynastie hineingeboren, machte er rasch Karriere, vorab als Geiger und Orchesterleiter. Lange war er Mitglied der 24 Violons du Roi, denen er ab 1717 vorstand. Zwischen 1718 und 1733 leitete er das Orchester der Académie royale de musique. 1747 starb er in Paris. Sein Œuvre umfasst musikdramatische Werke, vor allem jedoch Instrumentalmusik. Mit über 70 Jahren komponierte Rebel «Les Eléments», sein letztes Werk. Dabei handelt es sich um eine Symphonie de danse. Diese Bezeichnung betrifft allerdings nicht «Chaos», den Eröffnungssatz; getanzt wird erst in den neun Sätzen, die auf «Chaos» folgen. Ursprünglich war das Werk getrennt. Die Tanzsätze wurden 1737 aus der Taufe gehoben; ein Jahr später erlebte «Chaos» die erste Aufführung. Im Druck fügte Rebel «Chaos» und die Tanzsätze zu seiner «Symphonie nouvelle» zusammen. Das Werkganze lässt sich als Suite verstehen, «Chaos» fungiert dabei als Prolog. Zu Beginn von «Chaos» wartet Rebel mit einem spektakulären Effekt auf: Da bricht im Forte ein krass dissonanter Akkord aus, wahrlich chaotisch. Das Chaos besitzt aber das Potenzial zur Ordnung. In Rebels Tontraube, die aus allen sieben Tönen der Harmonisch-Moll-Skala besteht, werden zwei Akkorde miteinander verschränkt, die an sich aufeinander folgen müssten im Sinne eines Kadenzschrittes. Der eine Teil des Doppelakkords ist ein verminderter Septakkord der VII. Stufe; die Auflösung läge im andern Teil, dem d-Moll-Tonika-Akkord. Mit andern Worten, aus dem Chaos muss Ordnung entstehen, indem aus dem Miteinander ein Nacheinander wird. Zu einem Zwischenziel auf seinem Weg gelangt der Komponist am Ende des ersten der sieben ineinander übergehenden Abschnitte des Satzes: Vier strenge d-Moll-Akkorde markieren diese Zäsur. Der Dur-Dreiklang, musikalisches Abbild göttlicher Harmonie, verbietet sich einstweilen, denn das Ziel ist noch nicht erreicht. So sind die Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer, die ab dem zweiten Abschnitt des Chaos-Satzes das Geschehen bestimmen, zwar voneinander getrennt, sie gebärden sich aber noch chaotisch-un- gezügelt und versuchen, einander zu übertrumpfen. Dabei werden sie mittels klar identifizierbarer musikalischer Muster vorgeführt. Dem chaotischen Wirken der Elemente entsprechend verläuft die Musik sprunghaft. Dies manifestiert sich besonders in abrupten Wechseln der Tonart («confusion de l'harmonie»). Vom Chaos zeugen zudem jene Forte-Tremoli in den Streichern, die sich bereits im ersten Abschnitt dem Ohr eingeprägt haben; mit roher Gewalt stürzen sie jeweils herein. Erst im siebten Abschnitt kehrt Ordnung ein, die Elemente werden nunmehr gebändigt und voneinander entflochten («débrouillement»). Jetzt ist es an der Zeit, dass das Dur – nach ersten Ansätzen im fünften Abschnitt – sich endgültig gegen das Moll durchsetzt. UNTERWERFUNG DER NATUR Auch in etlichen der neun Tanzsätze sind die Elemente gegenwärtig: So repräsentieren in der eröffnenden Loure die Streicher die Erde und die Flöten das Wasser; in der darauf folgenden Chaconne entwickelt sich eine fröhliche Feuer-Musik über ostinaten Bassfiguren. In «Ramage» (Vogelgezwitscher) findet die Luft ihre Umsetzung; ohne Bassfundament musizieren Piccolo-Flöten und Violinen. Dabei offenbart sich eine stilisierte Natur; die Vögel singen strikt im Dreiertakt. Rebel hat mithin ein musikalisches Pendant geschaffen zur französischen Gartenarchitektur der Epoche: Nachahmung der Natur fordert deren Unterwerfung unter die Gesetze der Raison. Der Musikwissenschafter Dr. Rudolf Bossard lebt in Luzern. Neuö Zürcör Zäitung LUCERNE FESTIVAL Samstag/Sonntag, 8./9. August 2009 Nr. 181 SB 5 Klänge in Bewegung Musik und Raum, Musik im Raum – von der Mehrchörigkeit zu Karlheinz Stockhausen und Luigi Nono Von Daniel Ender Die Musikwissenschafterin Gisela Nauck unterscheidet in ihrer umfassenden Studie «Musik im Raum – Raum in der Musik» drei Aspekte, die sich durch die Gestaltung des räumlichen Klangs veränderten. Nicht nur wurde die Trennung der traditionellen Zeitkünste Musik, Dichtung und Theater sowie der Raumkünste Malerei und Architektur in Frage gestellt, sondern es begannen mit der räumlichen Komponente der Kompositionen «individuelle Klangtopologien die musikalische Gestalt einer Komposition unmittelbar mitzuformen». Schliesslich entstand durch die räumliche Verteilung von Schallquellen eine neue Hörsituation, weil die traditionelle Trennung zwischen Bühne und Auditorium aufgehoben wurde. Selbst wenn sie nicht im Raum erklingt, schafft Musik stets Raum. Im Lauf der Geschichte ist das von den Komponisten ganz verschieden genutzt worden, heute steht der Raum im Zentrum dieser Kunst. Wenn sich Tamino und Papageno gegen Ende des ersten Akts der «Zauberflöte» aus den Augen verlieren, hilft ihnen nur noch die Musik. Die schlichten Tonsignale ihrer Instrumente, mit denen sie sich erkennen und wiederfinden, weisen dabei weit in die Urgeschichte zurück: Als die Menschen einst damit begannen, einander über weite Entfernungen zuzurufen und diese Rufe zu stilisieren, entstanden archaische musikalische Muster. Man muss nicht gleich die Herkunft der gesamten Tonkunst in diese Verständigungsmittel hineinprojizieren, wie es der Philosoph und Wegbereiter der modernen Musikpsychologie Carl Stumpf versuchte, um sie als eine der wichtigsten Wurzeln aller Musik zu begreifen. UMFASSENDE VERRÄUMLICHUNG DER RAUM ZWISCHEN DEN TÖNEN Von den Wechselgesängen des gregorianischen Chorals bis zu avantgardistischen Klängen der Gegenwart gibt es kaum Musikwerke, denen nicht – mehr oder weniger offensichtlich – Dialoge einander antwortender Elemente eingeschrieben sind. In den Musikformen aller Zeiten und Völker spielten solche Abfolgen von Zuruf und Antwort eine wesentliche Rolle. Auch als sich die afrikanischen Sklaven in den Vereinigten Staaten mit den Spirituals ihre eigene Ausdruckswelt schufen, spiegelte sich im Call-ResponsePrinzip die Überwindung räumlicher Distanz durch musikalische Kommunikation wider. Die Beziehungen zwischen Raum und Musik sind so komplex, wie es die vielfältige sprachliche Verwendung des Begriffs «Raum» nahelegt. So kann er nicht nur den physischen Ort bedeuten, an dem Musik erklingt, sondern musikalische Vorstellungen bis in innerste Strukturen begleiten: Nachdem die mittelalterliche Musiktheorie damit begonnen hatte, die Intervalle als «Raum zwischen den Tönen» zu begreifen, gelang Guido von Arezzo im 11. Jahrhundert jene entscheidende Neuerung, auf die sich die Notenschrift bis heute stützt. Seit der Benediktinermönch und Erfinder der Solmisation räumliche Vorstellungen zu Hilfe nahm, um das Tonsystem in Form von Linien zu repräsentieren, haben die Metaphern «hoch» und «tief» das Sprechen über Musik begleitet. Dabei entstand freilich eine begriffliche Unschärfe, die sich bis in die Gegenwart auswirkt. Denn lange ging es bei räumlichen Wortbildern über Musik weniger um die Bewegung der Töne durch einen realen als um jene durch einen nur imaginierten Raum. QUER DURCH DIE KATHEDRALEN Dies sollte sich im 16. Jahrhundert entscheidend ändern, als die venezianische Schule rund um Andrea und Giovanni Gabrieli systematisch damit begann, mehrchörige Musik zu komponieren. Nachdem schon die beiden Orgeln der Basilika von San Marco auf einander gegenüberliegenden Emporen zum Wechselspiel genutzt worden waren, lag es nahe, dieses Muster auf die Vokalmusik zu übertragen. Die Mehrchörigkeit erlaubte es, das neue Raumempfinden der Renaissance, das mit der Erforschung der Planetenbewegung und der Erkundung der perspektivischen Malerei einherging, auch musikalisch auszudrücken. Bis zu vier Chöre konnten im Kirchenraum verteilt werden. Ihre unterschiedliche Besetzung und die Kombination mit Instrumenten führten zu wirkungsvollen Wechseln in der Klangfarbe, zu dynamischen Abstufungen, Echoeffekten sowie, nicht zuletzt, zur Entwicklung des barocken Prinzips konzertierender Musik. Dass dabei erstmals in der Geschichte nicht nur für die spezifischen Möglichkeiten bestimmter Räume komponiert wurde, sondern der räumliche Aspekt auch einen konstitutiven Aspekt in der Erfindung musikalischer Fakturen bildete, blieb indes ein Sonderfall, an den erst wieder Musiker des 20. Jahrhunderts anknüpfen sollten. Denn die enge Verbindung zwischen Architektur und Musik ging offenbar dadurch wieder verloren, dass sich die Komponisten darauf verlegten, die anhand konkreter Raumverhältnisse ersonnenen mehrchörigen und konzertierenden Musizierweisen innerhalb musikalischer Verläufe wie im Concerto grosso des Barock und im Solokonzert der Klassik auszutragen. Im Lauf des 19. Jahrhunderts scheint dann allerdings ein geschärftes Bewusstsein für den Raum und seine akustische Eignung entstanden zu sein. Einen Kulminationspunkt stellt diesbezüglich das Festspielhaus von Bayreuth dar, das als idealer Aufführungsort von Wagners Musikdramen konzipiert war – mit einer Akustik, die sich für andere Musik weit weniger eignet, aber Massstäbe für die Balance zwischen Klang und Raum setzte. Von da war es nur ein weiterer Schritt zu den komponierten Raumklängen, etwa zu der gesteigerten Sensibilität für räumliche Momente im Werk Mahlers mit seinen Fernorchestern und minuziösen Spielanweisungen, die selbst die Richtung festlegten, in die etwa die Schalltrichter der Bläser zeigen sollten. Erst nach 1950 gelang allerdings eine «Wiederentdeckung der Funktion des Raumes», wie es Karlheinz Stockhausen in Anspielung an die Mehrchörigkeit der Renaissance formulierte. In seinem «Gesang der Jünglinge» für fünf rund um den Hörer im Raum verteilte Lautsprechergruppen unternahm er es erstmals, die Ausrichtung des Schalls und die Bewegung des Klangs durch den Raum aktiv zu beeinflussen. Dass die neuen Möglichkeiten der elektronischen Musik per se ein verändertes Raumverständnis mit sich bringen mussten, lag auf der Hand, so dass Stockhausen vom Raum als einem «fünften Parameter» in der Komposition sprach, den er neben der Tonhöhe, der Dauer, der Klangfarbe und der Dynamik als eigenständige Ebene der Erfindung behandeln wollte. Pierre Boulez sah in der Elektronik zwar ebenfalls einen entscheidenden Schritt und hielt fest, dass es in der Musikgeschichte nur selten eine radikalere Entwicklung gegeben habe; anders als Stockhausen sprach er jedoch vom Raum als einer «fünften Dimension», die weniger eine substanzielle als vielmehr eine verdeutlichende Funktion für die «Anordnung von Strukturen» habe. Wenn sich wesentliche Exponenten der seriellen Musik in der Theorie nicht ganz einig waren, liegt das an der Vielschichtigkeit des Phänomens. Dezidiert «die Regeln des kollektiven Hörens erneuern und eine wechselseitige Beziehung zwischen Komponist, Hörer und dem neuen Musikstil herstellen» wollte auch Luciano Berio, als er in seinem «Allelujah II» fünf Orchestergruppen um das Publikum im Raum verteilte. Während Iannis Xenakis in «Metastaseis» eine ähnlich bahnbrechende neue Gruppierung der Orchesterinstrumente realisierte, schlug er zugleich den Bogen zurück in die Geschichte, indem er Strukturen dieses Werks als mathematische Grundlage für die Architektur des Philips-Pavillons bei der Brüsseler Weltausstellung 1958 verwendete. Ebenfalls auf die Musik des 16. Jahrhunderts bezog sich der Venezianer Luigi Nono, auch wenn er sich von ihr deutlich absetzen wollte: «Die Pingpong-Auffassung, bei der die Musik von rechts nach links und von links nach rechts wechselt, ist meiner Musik fremd. Ich setze den Klang räumlich zusammen durch die Benutzung verschiedener, im Raum getrennter Ausgangspunkte.» Nono bewerkstelligte dies mit Hilfe des «Halaphons» von Hans Peter Haller, das die Bewegung der Klangquellen im Raum ermöglichte und die elektronische Musik in seinen späten Kompositionen so berückend macht. Seien es die visionären Werke der seriellen Musik, theatralische Experimente, die Klangfarben und Obertonharmonien, die von den französischen Spektralisten auskomponiert und in den Raum projiziert wurden, oder die unzähligen, bis in die jüngste Gegenwart immer wieder neuen Klanginstallationen, Klangskulpturen und Performances: Die umfassende Verräumlichung ist vielleicht die wesentlichste Tendenz der jüngsten Musikgeschichte quer durch ihre stilistische Vielfalt und lässt neue Musik – trotz ihrer angeblichen Sperrigkeit – als überaus sinnlich erscheinen. Der Musikwissenschafter und Musiker MMag. Daniel Ender lebt als Publizist in Wien. Warme Klänge aus dem hohen Norden Die finnische Komponistin Kaija Saariaho Von Theo Hirsbrunner Unter den zahlreichen musikalisch Hochbegabten, die in den letzten Jahren aus Finnland gekommen sind, ragt die Komponistin Kaija Saariaho besonders hervor. Unvergesslich bleibt ihre Oper mit dem Titel «L'amour de loin», die an den Salzburger Festspielen 2000 uraufgeführt wurde. Die Geschichte um den Troubadour Jaufré Rudel, der die Gräfin Clémence von Tripoli allmählich zu lieben beginnt, ohne sie gesehen zu haben, der über das Meer zu ihr fährt und schliesslich in ihren Armen das Leben aushaucht, hatte etwas menschlich tief Berührendes, nicht nur wegen des zauberhaften Soprans von Dawn Upshaw, sondern auch wegen einer zart einschmeichelnden, träumerischen Musik, die erstmals in der Musikgeschichte die spektrale Kompositionstechnik in der Oper anwandte. OBERTONWELTEN Um diesen frühen Erfolg zu erklären, lohnt es sich, einen Blick auf Saariahos Studien und ihre mannigfachen Begabungen zu werfen. 1952 in Helsinki geboren, zeigte sie schon bald neben dem Komponieren Neigungen zum Malen und Zeichnen. Sie studierte Wassily Kandinskys theoretische Schriften und versuchte, deren Prinzipien auf die Musik anzuwenden. Noch heute beginnt der Entwurf eines neuen Werks oft mit einer Zeichnung. Die optische und die akustische Sphäre gehen zwanglos ineinander über. In Freiburg i. Br. wurde Saariaho Schülerin von Brian Ferneyhough und Klaus Huber, ohne sich je stark von ihnen beeinflussen zu lassen oder das Bedürfnis zu empfinden, sich von ihnen scharf abzugrenzen. Ein Konflikt zwischen der jüngeren und der älteren Generation fand nicht statt. Kaija Saariaho ging ihren Weg und fand erst in Paris bei Gérard Grisey und Tristan Murail Vorbilder, denen sie bis zu einem gewissen Grad folgte. Sie studierte die spektrale Technik, die darin besteht, nicht mit Tönen, sondern ganz einfach die Töne selbst zu komponieren: aus nur leise gehörten Obertonschwingungen, die eine Aura um den in sich ruhenden Klang bilden. Dazu gehörte eine genaue Analyse mit der Hilfe von Computern, wie sie im Institut de recherche et de coordi- nation acoustique/musique, in dem von Pierre Boulez gegründeten Ircam in Paris, zur Verfügung stehen. Wissenschaftliche und künstlerische Arbeit durchdringen sich auf eine zuvor kaum geahnte Weise. Der Tatsache bewusst, dass ein durch den Computer generierter Ton nie dieselbe Lebendigkeit ausstrahlen kann wie der Ton eines von menschlicher Hand gespielten Instruments oder die menschliche Stimme selbst, schafft Saariaho doch eine Verbindung von traditionellen Klangquellen mit der Maschine. Die Komponistin musiziert mit dem Computer und gewinnt der atonalen Musik ein von Werk zu Werk unterschiedliches, sehr prägnantes Profil ab – nicht zuletzt aus dem einfachen Grund, weil ihre Stücke auch literarisch tief inspiriert sind, durch Saint-John Perse zum Beispiel oder durch den Klang der alten provenzalischen Sprache. Lucerne Festival, wo sie diesen Sommer als Komponistin in Residenz eingeladen ist, präsentiert eine ganze Reihe jener gemischten Stücke. Entstanden aus genuin musikalischer Intuition und technischem Know-how, sind sie der Beweis für die Lebensfähigkeit der Musik auch im Zeitalter des Internets. Weit davon entfernt, die moderne Technologie zu verschmähen, schafft Kaija Saariaho eine Klangwelt aus Charme und Mysterium, die man lange nicht für möglich hielt, die unter den Händen dieser Komponistin jedoch wie von selbst gelingt. sich bringt, seinen Vater, den Vergewaltiger, zu töten. Alt und schwach und blind geworden, erweckt der ehemalige Wüstling nur Mitleid. Der Rache von Generation zu Generation, die in der Sage von den Atriden unerbittlich ihr Werk tut, wird Einhalt geboten im Namen einer milden, verzeihenden Humanität. Obwohl «Adriana Mater» nicht ein so durchschlagender Erfolg wurde wie «L'amour de loin», strahlt sie doch ein überlegenes Ethos aus, das über Saariahos Arbeit zu Simone Weil weiterleuchtet. Als Composer in Residence bei Lucerne Festival ist die immer noch in Paris lebende Kaija Saariaho längst keine Anfängerin mehr. Sie hat vielmehr schon wichtige Etappen des Erfolgs hinter sich und wird ihrem Publikum eine Reihe von kostbaren musikalischen Erfahrungen vermitteln können. Der Musiktheoretiker und Musikwissenschafter Dr. h. c. Theo Hirsbrunner lebt in Bern. Anzeige ETHISCHE MUSIK Während ihre Oper «L'amour de loin» in der Inszenierung von Peter Sellars nach der Uraufführung in der Salzburger Felsenreitschule in Paris, in Bern, Santa Fe und Helsinki nachgespielt wurde, dachte sie, ermutigt durch den Intendanten Gerard Mortier, schon an ein weiteres Werk, das an der Opéra Bastille in Paris im Jahr 2006 gegeben werden sollte. «Adriana Mater» erzählt von einer Frau, die während eines Bürgerkriegs vergewaltigt wird, sich aber entschliesst, das dabei empfangene Kind auszutragen; sie entdeckt mit Freude, dass ihr Sohn, zum Mann herangewachsen, nicht als Totschläger taugt, da er es nicht über <wm>10CAsNsjY0MDAx1TWwMDEztAQAsq5LwA8AAAA=</wm> <wm>10CEXKMQqAMBBE0RNlmVmyq3FLk1RBRMX7H0Wxsfjwij9GmOBrbdvVjiCQLWHOzhI0kwIPVQqhgYmuQFnoL0zd479Tq-kEOnCDstf-AG715wBdAAAA</wm> SB 6 Samstag/Sonntag, 8./9. August 2009 Nr. 181 Neuö Zürcör Zäitung LUCERNE FESTIVAL Eine Idee, ihre Genese und ihre Geschichte Musik im Raum – das Konzept der Salle modulable im Schaffen des Komponisten und Dirigenten Pierre Boulez Von Luisa Bassetto Im Grundsatz geht die Idee der Salle modulable auf Pierre Boulez zurück. Sie ist in der Musikgeschichte des späteren 20. Jahrhunderts, aber auch ganz direkt im Schaffen des Komponisten verankert. Die Anfänge des ambitionierten und innovativen Projekts reichen bis in die siebziger Jahre zurück – und nun scheint tatsächlich die Zeit gekommen, da es verwirklicht wird. Dank der Initiative von Michael Haefliger, dem Intendanten von Lucerne Festival, und dank der Unterstützung durch eine Reihe von Mäzenen wird in Luzern eine Salle modulable entstehen – ein Raum, dessen Konfiguration, wie die Bezeichnung andeutet, in ganz unterschiedlicher Weise gestaltet werden kann. Ein Ort mit einer solchen Technologie wird den verschiedensten Anforderungen von Komponisten und Regisseuren genügen können, und zugleich wird er zu einer Schmiede werden können, in der neue Ideen zur Verteilung des Klangs und der szenischen Aktion im Raum entwickelt werden. Ziel des Projekts von 1968 war eine tiefgreifende Reform der beiden nationalen Opernbühnen, des Théâtre de l'Opéra im Palais Garnier und der Opéra-Comique, denen damals Georges Auric als Direktor vorstand. Allein, nach der berühmten Fernsehansprache von General de Gaulle, dem Aufflammen der Studentendemonstrationen und der mit ihnen verbundenen Streikwelle gab Jean Vilar am 30. Mai 1968 dem damaligen Kulturminister André Malraux seine Demission als Direktor des TNP bekannt; die übrigen Mitglieder der Projektgruppe unterstützten Vilars Vorgehen, und das Projekt kam zum Stillstand. Boulez nahm die dort diskutierten Ideen später in reduzierter Form wieder auf, als er im Espace de projection des Institut de recherche et de coordination acoustique/musique (Ircam) mit einer Art Salle modulable experimentieren konnte. Es war dieser Denkansatz, den Mitterrand ein gutes Jahrzehnt später für die Opéra-Bastille in Paris wiederaufnahm. Im Frühjahr 1982 setzte Jack Lang, Kulturminister der Regierung Mauroy, eine Kommission ein, die unter dem Vorsitz von Maurice Fleuret, dem Directeur de la Musique et de la Danse im Kulturministerium, zu definieren hatte, was das sei: «un théâtre d'opéra moderne et populaire». Die Mitglieder der Kommission wa- WURZELN IN PARIS Die Idee eines neuen Theaterraums für Luzern beschäftigte Michael Haefliger schon seit einiger Zeit, den definitiven Anstoss erhielt sie jedoch durch ein Zusammentreffen mit Pierre Boulez, der Haefliger von seinen und Patrice Chéreaus Vorschlägen für eine Salle modulable erzählte, die ins Gebäude der Opéra-Bastille in Paris hätte aufgenommen werden sollen. Diese Vorschläge, die damals Papier blieben, bilden ein zentrales Element des Luzerner Projekts. Doch wie hat sich die Idee einer Salle modulable in der Opéra-Bastille entwickelt, und warum ist sie nicht zur Verwirklichung gelangt? Während seines ersten Septennats, 1981–1988, nahm der französische Präsident François Mitterrand ein altes Projekt von Pierre Boulez und Jean Vilar auf; es stammte aus dem Jahre 1968 und skizzierte den Bau eines neuen Theaters in Paris. An dem Projekt von 1968 beteiligt waren neben Boulez und Vilar – der damals das Théâtre National Populaire (TNP), das ehemalige Théâtre du Palais de Chaillot, und das Festival von Avignon leitete – auch der Choreograf Maurice Béjart und Ernest Fleischmann, Direktor des London Symphony Orchestra, der ab 1969 in gleicher Position beim Los Angeles Philharmonic tätig war. Anzeige R AU M F Ü R B E G E G N U N G E N <wm>10CAsNsjY0MDAw1DWyMDQyNQYAuyRL4A8AAAA=</wm> UND PREISGEKRÖNTE RÄUME FÜR FITNESS & SCHÖNHEIT, <wm>10CEXKIQ6AMBBE0RN1M7PttsBKKKpBAOEEBM39FQSD-Or91twEX2Nd9ro6ATBoR7XoCSbRklumaHYULQr0A0sEs77yz6FOYQNm4ADlPq8HM0o5dlwAAAA=</wm> KONGRESSE, FAMILIENFEIERN, KULINARISCHE HÖHEPUNKTE ODER EINFACH FÜR EINZIGARTIGE MOMENTE VOR, WÄHREND UND NACH DEN KONZERTEN. ren sich einig in der Notwendigkeit, den grossen Saal der Opéra-Bastille mit einer Reihe ergänzender Spielstätten zu umgeben, insbesondere einem kleinen Saal à l'italienne und einem experimentell ausgerichteten Raum für zeitgenössische Stücke. Im Reglement für den Wettbewerb, der 1983/84 für die Errichtung des Baus durchgeführt wurde, erschien bereits der Ausdruck «Salle modulable» für jenen Ort, der eine veränderbare Raumkonfiguration ermöglichen sollte. Wenige Monate nach der Einweihung der Opéra-Bastille am 13. Juli 1989 sprach Mitterrand den Wunsch aus, dass auch ihre Salle modulable, von der bloss eine äussere Hülle stand, weil die Entscheidungen über ihre technische Einrichtung noch nicht gefällt worden waren, vollendet werden möge. Die Eröffnung dieser Salle modulable war für die Saison 1991/92 vorgesehen, doch wurde das Projekt, das damals Pierre Bergé als dem Präsidenten der Opéra-Bastille anvertraut war, aus finanziellen Gründen nie realisiert. Die Ernennung von Bergé an die Spitze der Pariser Oper erzeugte enorme Spannungen; sie führte zur Entfernung von Daniel Barenboim und zu den Rücktritten von Boulez und Patrice Chéreau, welche die Eröffnungsproduktion hätten leiten sollen. Heute wird das, was die Salle modulable hätte werden sollen, als «Salle Rolf Liebermann» für Orchesterproben verwendet. Die von November 1989 stammende Projektbeschreibung für eine Salle modulable an der Opéra-Bastille stellt im Detail die verschiedenen Aspekte dieses Saals vor und ist damit fundamental für das Verständnis dessen, was in Luzern geplant ist. Im Wesentlichen sieht sie einen architektonisch neutralen Saal vor, der sowohl räumlich als auch, und durchaus davon unabhängig, akustisch modifiziert werden kann. Die Akustik, das heisst die Nachhallzeit, wird entweder durch die Veränderung des Raumvolumens oder aber durch Modifikationen an den schallschluckenden Materialien auf den Wänden beeinflusst. Die Wände sind mit Paneelen bedeckt, die eine absorbierende und eine reflektierende Seite aufweisen. Der Saal selbst bietet eine Vielfalt räumlicher Dispositionen – je nach der Art der Produktion oder nach der Zahl der Besucher, die zwischen 400 und 1200 variieren kann. Eingerichtet werden kann zum Beispiel eine frontale Disposition mit einer Bühne und einem Orchestergraben für traditionelle Operninszenierungen, aber auch ein Amphitheater mit Spielfläche in der Mitte. Selbst in zwei autonome, akustisch voneinander abgeschirmte Teile kann der Saal getrennt werden. Der Boden besteht aus 55 Elementen, die mit Hilfe von Motoren auf die verschiedensten Höhen ausgefahren werden können. Die Decke enthält eine Vielzahl technischer wie akustischer Elemente; zudem ist sie mit einer tragenden Konstruktion versehen, die über die ganze Fläche reicht und zum Beispiel Züge und Beleuchtungskörper aufnimmt. So hätte die Salle modulable, integriert in den Komplex der Opéra-Bastille, zur Entwicklung von Synergien zwischen dem traditionellen Opernbetrieb und eher experimentell ausgerichteten Produktionen beitragen können. DAS HISTORISCHE UMFELD 1 Nacht ab CHF 523.– / € 327.– pro Person inkl. Frühstücksbuffet, Afternoon Tea und Massage Exklusive Angebote unter www.palace-luzern.ch/arrangements Haldenstrasse 10, CH-6002 Luzern, Telefon +41 (0)41 416 16 16, [email protected] Der Wunsch von Komponisten und Theaterleuten nach einem flexiblen Raum ergibt sich aus den ästhetischen Strömungen des 20. Jahrhunderts. Ende der 1950er Jahre hatte Pierre Boulez die Gelegenheit, Werke zu dirigieren, die in besonderer Weise mit der Verräumlichung des Klangs arbeiten – unter ihnen die «Gruppen» von Karlheinz Stockhausen (Köln 1958), die «Rimes pour différentes sources sonores» von Henri Pousseur und «Allelujah II» von Luciano Berio (beide Donaueschingen 1959). Die Erfahrung als Dirigent schlug sich bei Boulez wiederum in zahlreichen Werken mit räumlicher Komponente nieder, zum Beispiel in «Poésie pour pouvoir» (1958), «Pli selon pli» für grosses Orchester (1957–62), Domaines für Klarinette und sechs Instrumentengruppen (1961–68), später dann in «Répons» (1981), «Dialogue de l'ombre double» (1985) oder «Anthèmes II» (1997). Schliesslich wurde die Frage der Verräumlichung von Boulez im Rahmen der Darmstädter Ferienkurse für neue Musik 1960 einer detaillierten Analyse unterzogen, die drei Jahre später unter dem Titel «Penser la musique aujourd'hui» erschien. Entscheidend war für Boulez aber auch die Erfahrung im Theater. Zehn Spielzeiten lang, zwischen 1946 und 1955, hat Boulez als Musikdirektor in der Truppe von Jean-Louis Barrault mitgewirkt. Unter den Autoren, denen Boulez in der Folge besondere Aufmerksamkeit schenkte, fanden sich Antonin Artaud und Paul Claudel, die beide dem «Vergnügungstheater» westlicher Provenienz das rituelle Theater östlicher Herkunft entgegensetzten; wie im japanischen NoTheater sollte da eine Dichtung im Zentrum stehen, die nicht nur aus Worten, sondern ebenso aus Raum und Bewegung gebildet sein sollte, auf dass alle Ausdrucksmittel auf das einzige Ziel eines Ritus hinsteuerten, in dem die Essenz des Lebens selbst abgebildet wäre. Auch Jean Genet bewunderte Boulez, insbesondere die bildnerischen Elemente in seinem Theater; Genet hatte er auch als Librettisten für seine bis heute nicht geschriebene Oper auserwählt. Und nicht zuletzt ist an das berühmte «Spiegel»-Interview von 1967 zu erinnern, in dem Boulez empfahl, die traditionellen Opernhäuser, in denen moderne Opern nicht in geeigneter Form zur Aufführung gebracht werden könnten, in die Luft zu sprengen. EINE KOMPOSITION ALS QUELLE Eine besonders interessante Quelle für die Entwicklung der theatralischen Vorstellungen von Boulez in jenen Jahren, aber auch für seine Ideen zur Aufstellung der Musiker im Raum stellt das unvollendete Stück «Marges» dar, eine Komposition für Schlagzeugensemble, an der Boulez von 1961 bis 1968 arbeitete. Die Skizzen zu dem Werk, die in der Paul-Sacher-Stiftung Basel aufbewahrt werden, lassen das Bemühen erkennen, das Ensemble in verschiedenen Arten zu positionieren und mit der Verteilung der Klangerzeuger im Raum zu arbeiten, um so zu einer allerdings abstrakten musikalischen Inszenierung zu kommen. Das Räumliche bildet einen ganz wesentlichen Teil in der Konzeption von «Marges». Der Komponist verwendet viel Mühe darauf, eine optimale Lösung für die Verteilung der Klangquellen im Raum zu entwickeln. Unter den Lösungsansätzen findet sich auch einer, der die Instrumentalisten durchgehend den Wänden entlang aufstellt, um dem Klang die Möglichkeit zu geben, sich in einer besonderen Weise im Raum zu entfalten. Was sich hier, in «Marges», nur im Ansatz findet, werden andere Kompositionen von Boulez später aufnehmen und weiterentwickeln. Zum Bau der Salle modulable in der Opéra-Bastille ist es nicht gekommen. Das Projekt stand aber am Puls der Zeit. In jenen Jahren wurden nämlich andernorts ähnliche Denkansätze verfolgt – und sogar verwirklicht. Die Berliner Philharmonie, zwischen 1960 und 1963 nach einem Entwurf von Hans Scharoun erbaut, wäre hier etwa zu nennen. Tatsächlich nimmt in diesem fünfeckigen Saal das Orchesterpodium einen Platz in der Mitte ein, während sich das Publikum darum herum verteilt. Zu erwähnen wäre auch der Pavillon der Bundesrepublik Deutschland an der Weltausstellung von Osaka (1970), der auf Anregungen von Karlheinz Stockhausen basierte und der mit fünfzig Lautsprechern versehen war, die den Klang von überallher aufs Publikum projizieren konnten. In Paris gab es immerhin den bereits erwähnten Espace de projection im Ircam, der 1974 bis 1977 nach Entwürfen von Renzo Piano und Richard Rogers konstruiert und 1978 eröffnet wurde. Die Beweglichkeit der Seitenwände, des Bodens und der Decke ermöglicht die unterschiedlichsten räumlichen Dispositionen. Ebenfalls in Paris steht die Salle de la Villette in der Cité de la Musique, eine Art Salle modulable, die von Christian de Portzamparc entworfen und 1995 eröffnet worden ist. Nicht zu vergessen ist endlich der eben erst eingeweihte neue Saal der Musikuniversität Graz, der alle Merkmale einer Salle modulable aufweist. Übersetzung aus dem Italienischen: hmn. Die Musikologin Luisa Bassetto lebt und wirkt in Treviso. Neuö Zürcör Zäitung LUCERNE FESTIVAL Samstag/Sonntag, 8./9. August 2009 Nr. 181 SB 7 Der lange Weg vom ersten Traum zur gebauten Wirklichkeit Kommt sie, die Salle modulable in Luzern? Keine Frage, sagt einer, der es wissen muss Von Peter Hagmann Ende August werden zwei Jahre vergangen sein seit jener überraschenden Medienkonferenz, an der Michael Haefliger, der Intendant von Lucerne Festival, zur allgemeinen Verblüffung bekanntgab, dass in Luzern eine Salle modulable gebaut werden soll und dass dem Vorhaben von privater Seite der Betrag von 100 Millionen Franken zugesprochen worden sei. Der Bau solle eine Idee aufnehmen, die auf den (an der Medienkonferenz anwesenden, sichtlich zufriedenen) Komponisten und Dirigenten Pierre Boulez zurückgeht. Das Projekt strebe keine Konkurrenz zum Kulturund Kongresszentrum Luzern (KKL) an, es ziele vielmehr auf die Erschliessung neuer künstlerischer Dimensionen für Lucerne Festival wie die Stadt Luzern und ihre Kulturinstitutionen. AUFWENDIGE PROJEKTORGANISATION Seither herrscht nicht Schweigen im Walde, aber auch nicht gerade ein üppiger Informationsfluss – während die öffentliche Diskussion über den Sinn des Projekts, über seine Möglichkeiten und Grenzen sowie die Chancen seiner Verwirklichung voll im Gang ist. Michael Haefliger, der Initiant des Unternehmens, bestätigt im Gespräch, dass er sich dessen bewusst sei. Das Projekt der Umsetzung zuzuführen, sei nun einmal enorm aufwendig und erfordere letzte Sorgfalt – aber jetzt sei Land in Sicht. Bis Ende 2009 oder Anfang 2010 sollten das Betriebskonzept mit dem Finanzierungsmodell, das Leitbild zur Identität und zur Programmstruktur sowie die Frage des Standorts geklärt sein. Inzwischen hat der Stadtrat von Luzern für Herbst 2009 auch einen Planungsbericht zuhanden des Stadtparlaments in Aussicht gestellt. Vorangetrieben werden die Arbeiten und Abklärungen durch die Stiftung Salle modulable, die den Zweck hat, das neue Gebäude zu errichten und zu betreiben. An diesen Arbeiten beteiligen sich neben der Stiftung auch Stadt und Kanton Luzern sowie alle grossen Kulturinstitutionen auf dem Platz. Unter der Leitung von Michael Haefliger als Delegiertem der Stiftung und mit dem 40-jährigen Luzerner Juristen Jost Huwyler als Projektleiter werden unter Beizug auswärtiger Experten die Evaluationen und Machbarkeitsstudien durchgeführt. Sind diese Vorarbeiten abgeschlossen, wird die Stiftung gemeinsam mit Stadt und Kanton Luzern im Geist der Public-Private Partnership eine Projektierungsgesellschaft gründen, die dann die eigentliche Errichtung des Baus an die Hand nimmt. Auch in der Projektierungsgesellschaft wird Jost Huwyler, der in Luzern bestens vernetzt ist und eben jetzt bei der Erweiterung des Verkehrshauses, früher aber im Team um Thomas Held beim Bau des KKL Erfahrungen gesammelt hat, die führende Position einnehmen. Unter den beratenden Unternehmen ist vorab die Firma Actori aus München zu nennen, die für eine Studie zum dortigen Opernhaus auch für Zürich tätig war. Im Vordergrund der öffentlichen Diskussionen steht aus verständlichen Gründen nicht die Idee an sich, sondern die Frage des Standorts. Drei Grundstücke, so erklärt Haefliger, hätten sich als geeignet herauskristallisiert. In den kommenden Monaten würden nun für alle drei Standorte Machbarkeitsstudien durchgeführt, damit dann die Wahl getroffen werden kann. hen. Die Aufgabe des alten, vielen Besuchern lieben Theaters ist natürlich keine einfache Angelegenheit. Auf der anderen Seite zeigt das Beispiel des Luzerner Sinfonieorchesters, das, seit es im KKL auftritt, einen beispiellosen Höhenflug vorweist, dass ein neues Haus durchaus zu einem künstlerischen Aufbruch führen kann. DER CAMPUS-GEDANKE Eine ganz wesentliche Erweiterung, so Haefliger, hat das Projekt dadurch erfahren, dass die Musikhochschule Luzern ihr lebhaftes Interesse an dem neuen Haus geäussert hat. Ihren ohnehin geplanten Neubau wird die Hochschule in unmittelbarer Nachbarschaft zur Salle modulable erstellen, um von deren Infrastruktur profitieren zu können. Umgekehrt sieht der Neubau der Musikhochschule einen Kammermusiksaal für fünf- bis sechshundert Personen vor, den Lucerne Festival für seine Programme allenfalls nutzen könnte – da wäre denn ein altes, dringendes, auch im KKL nicht wirklich eingelöstes Desiderat erfüllt. Damit wird die Salle modulable nun allerdings zum Teil eines Campus, auf dem möglicherweise eine einheitliche architektonische Handschrift herrscht, vor allem aber die gegenseitige Durchlässigkeit. Studierende könnten da – und wo gibt es das sonst? – den besten Vertretern ihrer Berufe begegnen, mit ihnen, zum Beispiel im Rahmen von Produktionen für Lucerne Festival, zusammenarbeiten und so am Ende gar selber zu Festspielkünstlern werden. Damit verbunden ist aber auch der Gedanke, dass an diesem Ort, wo eine Ausbildungsstätte und eine prononciert auf die Zukunft ausgerichtete Produktionsstätte aufeinandertreffen, alle Berufe unterrichtet werden sollten, die im Bereich von Musiktheater und Konzert anfallen – dass es also auch Regie, Bühnenbild, Bühnentechnik zu vermitteln gälte. Und hier könnte, so sieht es Haefliger, auch auf die Kompetenzen anderer Hochschulen im Raum Luzern zurückgegriffen werden. ERÖFFNUNG 2014? Vor allem aber ist damit gesagt, dass die Salle modulable eine produzierende Institution werden soll. Die Verbindung mit der Stadt und dem regionalen Umfeld soll in keiner Weise tangiert werden. Durch die neuen Möglichkeiten sollen Bereiche innovativer künstlerischer Äusserung erAnzeige Sie denken an Hingabe. Wir auch an Höchstleistung. <wm>10CAsNsjY0MDQx0TUytTQxMgUA87MOhQ8AAAA=</wm> <wm>10CEXKuw2AMAwFwIliPTs2wbjMp4oQAsT-oyDRUFx3c4YRPrXvdz-DwapJzFUsFi7klmM1UHYNFCkC-MYsEGPW-HeqLV3AAB4wHW28A7cky10AAAA=</wm> STAGIONE UND REPERTOIRE Was aber soll die Salle modulable genau? Zum einen soll sie Lucerne Festival als weiterer Spielort dienen, der sich für Musiktheater und inszenierte Konzerte eignet. Er plane nicht, darauf legt Haefliger besonderen Wert, die Salzburger Festspiele durch luxuriöse Aufführungen von Werken des gängigen Repertoires zu konkurrenzieren. In der Salle modulable sollen vielmehr neue Horizonte erkundet werden; sollen Werke gespielt werden, die spezielle Anforderungen an den Raum stellen, oder solche, die verschiedene Disziplinen wie Musik, Live-Elektronik und Video miteinander verbinden. Natürlich gibt es längst Vorstellungen zu Stücken und Interpreten, aber hierzu ist Haefliger nichts zu entlocken. Er werde, das immerhin bestätigt er, mit Interpreten zusammenarbeiten, die sich vom Ort und von der Vision anstecken liessen. Und natürlich wäre es sein Wunschtraum, auch da Claudio Abbado und Pierre Boulez im Boot zu haben. Doch nicht nur die Stagione des Festivals, auch Repertoire und Ensemble sollen in der Salle modulable ihren Platz haben. Angesprochen ist damit das Luzerner Theater, das, so Haefliger, in der Salle modulable mit ihren Nebenräumlichkeiten und Werkstätten wesentlich bessere Arbeitsbedingungen vorfände; es soll daher sein Stammhaus in der Innenstadt aufgeben, nicht aber seinen Auftrag der kulturellen Grundversorgung übers Jahr hinweg und nicht seine Struktur. Darum sei in der Salle modulable auch die ganz konventionelle Raumdisposition mit einer Guckkastenbühne und einem Orchestergraben vorgese- schlossen werden, die der Salle modulable, den in ihr vertretenen Institutionen und der Stadt Luzern eine Ausstrahlung weit über die Region hinaus sichern könnte. Nicht als Konkurrenz etwa zum Opernhaus Zürich, sondern als willkommene Ergänzung zu seinem Angebot. Gegenüber früheren Ankündigungen hat sich der weitere Zeitplan etwas verschoben. Wenn die Projektierungsgesellschaft Anfang 2010 offiziell ihre Arbeit aufnimmt, geht es rasch auf den Architekturwettbewerb zu. Haefligers Vorstellung gemäss soll hier sowohl ein geladener als auch ein offener Wettbewerb durchgeführt werden; selbstverständlich müssten Spitzenarchitekten dabei sein, es müsse aber auch geprüft werden können, ob nicht in jüngeren Büros noch ganz andere Ideen vorhanden seien. Auf den Architekturwettbewerb 2010 folge im Jahr darauf der politische Prozess mit den notwendigen Abstimmungen – und wenn alles gut verlaufe, könne 2012 mit dem Bau begonnen werden. Die Bauzeit werde wohl gegen zwei Jahre umfassen, danach müsse das Haus überhaupt erst in Betrieb genommen werden. Mit der Eröffnung, so sagt Michael Haefliger heute, sei also frühestens 2014 zu rechnen. Location © KKL Luzern www.kkl-luzern.ch Tatsächlich sichtbar ist noch nichts, doch auf konzeptioneller Ebene nimmt die Salle modulable in Luzern zusehends Konturen an. Eine Begegnung mit dem Initianten Michael Haefliger. Leidenschaft und Engagement für die klassische Musik diese Werte verbinden uns als Resident Sponsor mit Lucerne Festival. Gemeinsam fördern wir künstlerische und musikalische Vielfalt. Die Credit Suisse Foundation zeichnet zudem herausragende Leistungen junger Talente aus. Für neue Impulse in der Klassik bedanken wir uns bei Andriy Dragan, dem diesjährigen Preisträger des Prix Credit Suisse Jeunes Solistes. www.credit-suisse.com Neue Perspektiven. Für Sie. SB 8 Samstag/Sonntag, 8./9. August 2009 Nr. 181 LUCERNE FESTIVAL Nicht mehr als «tönend bewegte Form»? Musik ohne Inhalt – oder: Die Idee der absoluten Musik in Werden und Vergehen Von Wolfgang Fuhrmann Die Idee der absoluten Musik besagt, dass es zum Wesen der Musik gehöre, «losgelöst» von allem Weltbezug zu existieren. Von «Musik» im eigentlichen Sinne lasse sich folglich nur bei der reinen Instrumentalmusik sprechen. Ein musikalisches Kunstwerk an und für sich komme ohne einen vertonten Text, einen dramatischen Kontext oder ein zugrundeliegendes Programm aus, all das gehöre zum Bereich des «Aussermusikalischen». Dementsprechend gebe es – so die strikteste Version dieser reinen Lehre – auch keinen musikalischen Ausdruck; keine Stimmung oder Emotion sei in Musik kommunizierbar. Wo sich dennoch der Eindruck einstelle, die Musik sei «heiter» oder «traurig», da handle es sich um ein rein metaphorisches Sprechen, um blosse Etiketten, die der Musik aufgeklebt würden. Das musikalische Kunstwerk, so die Vertreter der Idee der absoluten Musik, bilde einen sinnvollen Zusammenhang ganz und gar in und durch sich selbst und sei daher auch nur aus sich selbst zu begreifen: Eine Klaviersonate von Beethoven oder eine Sinfonie von Brahms sind nur und restlos als formale Zusammenhänge deutbar. Im eigentlichen Sinne über Musik sprechen lasse sich nur anhand des Notentexts und mit den Fachausdrücken der musikalischen Theorie und Analyse: Wer nicht von Tonika und Dominante zu künden weiss, die Sonatenhauptsatzform oder den doppelten Kontrapunkt nicht erkennen kann, der gehört nicht zum inneren Kreis der wahrhaft musikalisch Sachverständigen und kann sich Musik nur mit laienhafter Sinnlichkeit nähern, ohne tiefere ästhetische Einsicht allein auf «Reiz und Rührung» bedacht, wie Kant gesagt hätte. DEUTSCH-ÖSTERREICHISCH Freiheit und Scheitern Jörg Widmann: Komponist, Klarinettist Von Marco Frei Wenn man Jörg Widmann mit Kategorien konfrontiert, um sein kompositorisches Schaffen einzuordnen – oder um ihn einfach zu provozieren –, wird er etwas nervös. «Einmal wurde Hans Werner Henze gefragt, wo man denn heute stehe. ‹Jeder woanders›, antwortete er. Das finde ich sehr schön. Der Freiheitsbegriff ist für mich äusserst wichtig, weil er Unabhängigkeit meint. Deswegen heisst auch ein Werk von mir ‹Freie Stücke›. Es ist 2002 entstanden – zu einer Zeit, als ich mich freigeschwommen hatte.» Kann, soll Musik mit Natur etwas zu tun haben? Eine Sinfonie zum Beispiel, sie habe weder Inhalt noch Bedeutung, stehe vielmehr ganz für sich selbst – das meint der Begriff der «absoluten Musik». Unverkennbar handelt es sich hier um eine von Experten formulierte Theorie, mit der ein grosser Teil unter den Musikfreunden in den Status des harmlosen Banausen versetzt wird. Und es handelt sich – auch das nicht unwichtig – um eine Theorie, die vor allem der Tradition der deutschösterreichischen Sinfonik und Kammermusik zugutekommt. In Italien, dem Land der Oper, hätte sie wohl kaum formuliert werden können, und auch in Frankreich hatte man noch bis ins 20. Jahrhundert hinein ein viel unverkrampfteres Verhältnis zu «aussermusikalischen» Bezügen. Aber auch in Deutschland war die Idee der absoluten Musik nicht unumstritten: Gerade aus einer Polemik darüber, was Musik eigentlich sei oder sein solle, ist diese Idee formuliert worden, und Polemik begleitet sie bis heute. Die Idee der absoluten Musik kann man als die Rechtfertigung des bürgerlichen Konzertlebens begreifen; ihre architektonischen Denkmäler sind die Konzerthäuser, die einzig zu dem Zwecke gebaut wurden und werden, Musik hören zu lassen. Es war zwar kein Bürger, sondern ein Adliger, nämlich der französische Aufklärer Michel-Paul Guy de Chabanon, der in seinen 1779 in Paris erschienenen «Observations sur la musique et principalement sur la métaphysique de l'art» gegen die herrschenden Vorstellungen seiner Zeit die These vertrat, die Musik sei «die Kunst, einen Ton auf den anderen folgen zu lassen, gemäss geregelten Bewegungen, und den annehmlichen Tonstufen gemäss, die die Folge der Töne dem Ohr angenehm machen». Chabanon wendet sich gegen die herrschende Nachahmungsästhetik: Die Nachahmung von «aussermusikalischen» Klängen (etwa einem Gewitter oder Vogelgezwitscher) sei nicht Sache der Musik. Und Musik sei auch nicht, wie es Rousseau, Herder und andere behauptet hatten, der Sprache verwandt, sie sei nicht aus dem «Schrei der Leidenschaft» hervorgegangen; auch wenn sie Gefühle darstelle, müsse sie notwendigerweise – und eben aus musikalischen Ursachen – Kontraste liefern und damit das Bild der Leidenschaft verzeichnen. Chabanon wurde zu seiner Zeit zwar beachtet, durchschlagende Wirkung hatte er aber nicht. Vor allem die Idee von Musik als «Sprache der Empfindungen» blieb bis ins 19. Jahrhundert vorherrschend, und die Gewohnheit, sich bei Instrumentalmusik passende Geschichten auszudenken, war weit verbreitet. Das gilt gerade für die Musik Joseph Haydns, den wir (wie auch schon seine Zeitgenossen) als den Begründer der (klassischen) Instrumentalmusik ansehen. Es ist kein Zufall, dass zu den beliebtesten Werken Haydns Stücke gehören, die Titel tragen und dadurch mit sprachlichen Vorstellungen verbunden sind: Weder die Bezeichnung «Militärsinfonie» noch «Die Uhr» für Haydns Sinfonien in G-Dur Hob. I:100 und D-Dur Hob. I:101 stammen vom Komponisten, aber sie benennen hörbare Eigenheiten der Musik, den Einsatz von Schlagzeug und marschhaften Themen im ersten Werk, das Ticken der Begleitung im langsamen Satz des zweiten. Und auch wenn die Bezeichnung «Jupiter-Sinfonie» für Mozarts letztes Werk dieser Gattung eine verlegerische Erfindung ist, so findet sie doch für dessen prachtvolle Klangentfaltung mit dem Neuö Zürcör Zäitung DISPARITÄT ALS PRINZIP «herrscherlichen» Instrumentarium von Pauken und Trompeten und die kontrapunktische Tour de Force des Finales eine so bündige Chiffre, wie es der nüchternen Benennung Sinfonie in C-Dur, KV 551, nicht gelingen könnte. Assoziationen wie diese haften ebenso wie Anekdoten oder biografische Details den Werken an. Keine dieser Bezeichnungen umschreibt ein konkretes Programm, so wie etwa Berlioz' «Symphonie fantastique» oder «Eine Alpensinfonie» von Richard Strauss als Programmmusik verstanden werden können. Dennoch verändern solche Assoziationen die Wahrnehmung der Stücke: Welcher Programmheftautor dürfte es je unterschlagen, dass Richard Wagner Beethovens Siebte Sinfonie die «Apotheose des Tanzes» genannt hat? Es war ein junger k. u. k. Ministerialbeamter namens Eduard Hanslick, der 1854 mit seiner Abhandlung «Vom Musikalisch-Schönen» am entschiedensten gegen die Ansicht Stellung bezog, dass Musik in dieser Weise auf Aussermusikalisches bezogen sein solle, wobei Hanslick zu diesem «Aussermusikalischen» auch und insbesondere die Gefühle rechnete. Man muss allerdings genau hinsehen, um Hanslick nicht misszuverstehen: Die Schrift entstand, lange bevor er als Musikkritiker zum prominentesten aller WagnerGegner wurde. Sie versteht sich, wie ihr Untertitel sagt, als «Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst». In einem Satz gesagt: Hanslick will die Musikästhetik wegführen von der stereotyp wiederholten Behauptung, die Musik habe Gefühle darzustellen bzw. zu erregen, hin zu einer Untersuchung der «specifisch musikalischen» Formbildungen, in denen allein das Musikalisch-Schöne zu finden sei. Dabei redete Hanslick keineswegs einer «Gefühllosigkeit» der Musik das Wort. So präzisierte er es zumindest 1873. Da aber hatte sich schon eine Flut von Polemiken über seine Schrift ergossen, die den musikalischen Gefühlsausdruck verteidigten. HEILIGER BEZIRK Hanslicks Thesen haben im 19. Jahrhundert niemals Deutungshoheit errungen. Zu einer breitenwirksamen Ideologie wurde die Idee der absoluten Musik erst im 20. Jahrhundert. Schon die Neue Sachlichkeit der Zwischenkriegszeit hatte sich von der Gefühlsästhetik abgewandt, und Igor Strawinsky verkündete, Musik sei «ihrem Wesen nach unfähig, irgend etwas ‹auszudrücken›». Nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, und nicht zufälligerweise in Deutschland, wandten sich junge Komponisten und Musikwissenschafter, die von der ideologisch aufgeladenen «Weltanschauungsmusik» des Nationalsozialismus genug hatten, ganz im Sinne Hanslicks den «specifisch musikalischen» Formbildungen zu. Die Komponisten – vor allem die Vertreter serieller Musik wie Pierre Boulez oder Karlheinz Stockhausen – erreichten dies durch eine entschiedene Abkehr von allen musikalischen Prinzipien, die Körperhaftigkeit, Gestalt- oder Gestenbildung und Spannung oder Lösung impliziert hätten, aber auch durch eine Kompositionstechnik, die alle herkömmlich «sprachlichen» Mittel auflöste. Die Musikwissenschafter blendeten entschieden all das aus, was nunmehr als «aussermusikalisch» empfunden wurde, und erhoben den Notentext zur einzig relevanten Bezugsgrösse. Nun erst entstand jene Ideologie des autonomen Kunstwerks und der absoluten Musik, die dann auf die Musik der klassisch-romantischen Ära zurückprojiziert werden konnte. Einer ihrer rigidesten, aber auch scharfsinnigsten Vertreter, Carl Dahlhaus, hat mit seinem Buch «Die Idee der absoluten Musik» gleichsam deren Genealogie, Begründung und Rechtfertigung zugleich verfasst. Die absolute Musik schien der heilige Bezirk und Rückzugsort, in dem man sich unbefleckt von kulturellen, nationalen oder politischen Fragen einzig dem Spiel der Töne hingeben konnte. ABSCHIED VOM REINHEITSGEBOT Heute ist die Idee oder Ideologie der absoluten Musik von neuen Generationen von jüngeren Komponisten (wie Kaija Saariaho oder Jörg Widmann, die ihren Stücken gerne bildhafte Titel geben und auch in der Farbigkeit und dem Gestenreichtum ihrer Musik vielfältige Assoziationen zulassen) wie auch von Musikwissenschaftern wieder unter heftigen Beschuss genommen worden. Deutlicher wird heute aber auch, was die Rede von der absoluten Musik neben ihren unleugbaren Verbohrtheiten an Positivem zu bieten hatte. Sie zwang dazu, Werke in ihren formalen Eigentümlichkeiten zu betrachten, ihre Konstruktion zu analysieren, statt sie vorschnell mit Interpretationen zu befrachten. Zu erkennen ist aber auch der eigenartige Bezug, den die Idee der absoluten Musik zu den politischen Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts unterhielt – sei es in der radikalen Abwendung von allem Weltbezug wie in der (westlichen) Nachkriegsmusik, sei es in ihrer Funktion eines Schutzes vor politischer Vereinnahmung. In Thomas Manns Roman «Der Zauberberg» ist es der Aufklärer und Humanist Settembrini, der die reine, textlose Musik als «politisch verdächtig» charakterisiert: als «das halb Artikulierte, das Zweifelhafte, das Unverantwortliche, das Indifferente». In der politischen Realität sind es oft genug die autoritären oder totalitären Machthaber gewesen, denen die reine Musik als verdächtig erschien, die von den Komponisten politische Kantaten, Massenchöre, «Volkslieder» forderten. Die Komponisten wiederum nutzten, wenn sie denn instrumental komponieren durften, den Freiraum der wortlosen Unbestimmtheit, um sich den Vereinnahmungen zu entziehen – der Fall Schostakowitsch bietet hinreichend Beispiele dafür. War die Wortlosigkeit der Instrumentalmusik in der Frühromantik ein Zeichen des Unendlichen über aller Sprache gewesen, so wurde sie im 20. Jahrhundert zum Rückzugsort dort, wo zu sprechen tödlich gewesen wäre. Heute, in einer entideologisierten und umso unübersichtlicher und unfassbarer gewordenen Zeit, sind die Reinheitsgebote der absoluten Musik scheinbar nicht mehr aufrechtzuerhalten. Umso notwendiger wäre es, sie als Herausforderung und Denkansporn in Erinnerung zu behalten. Denn die Trennung zwischen Musikalischem und Aussermusikalischem ist, ob man es wahrhaben will oder nicht, noch immer der Angelpunkt des Musiklebens, wie wir es kennen. Der Musikwissenschafter Dr. Wolfgang Fuhrmann lebt in Dübendorf bei Zürich. Dieses Ensemblewerk zählt zu den Kompositionen Widmanns, die bei Lucerne Festival erklingen. In diesem Jahr ist der deutsche Komponist, Klarinettist und Hochschulprofessor Composer in Residence. Und vielleicht muss man nachvollziehen, dass Widmann ein Kind der Freiheit ist, um sein Denken und seine Arbeitsweise zu verstehen. 1973 in München geboren, wuchs er in einer Zeit auf, in der Richtungsstreitereien und Dogmendenken in der westlichen neuen Musik der Vergangenheit angehörten. Mit dem Ende des Kalten Krieges erlosch auch der ästhetisch-stilistische Disput zwischen Ost und West. «Es ist ein positives Phänomen, dass es heute nicht mehr Gruppen, Cliquen und Ideologien gibt wie früher», sagt Widmann; deswegen bedeutet für ihn Komponieren, Disparates zusammenzusetzen. «Dinge zusammensetzen, die womöglich gar nicht zusammengehören: Das trifft auf meine Musik im Besonderen zu.» Schon seine Ausbildung verrät diese Haltung: Bei so unterschiedlichen Komponisten wie Henze, Wolfgang Rihm, Wilfried Hiller und Heiner Goebbels hat er studiert, und so treffen sich in seinen Werken Avanciertes und Tradiertes, Geräuschhaftes und Melodiöses, Expressives und Verschwiegenes. Die Selbstverständlichkeit, mit der Widmann unterschiedliche Stile zusammenfügt, irritiert zuweilen. «Es kommt aber nie postmodernistisches Allerlei heraus», beschwört er, und auch das Zitathafte weist er von sich. Das ist durchaus glaubwürdig; in einer Zeit, in der Vielfalt herrscht, ist Widmanns Haltung konsequent. Für sich ausgeschlossen hat er bis heute die Arbeit mit rein elektronischen Mitteln. «Bisher habe ich auch elektronisch Klingendes immer mit Menschen erzeugt – so in allen Werken, die bei Lucerne Festival zu hören sind. Es sind ‹Naturstücke›, was auch auf das diesjährige FestivalMotto ‹Natur› verweist.» Denn für Widmann ist die Erweiterung von Spieltechniken von zentraler Bedeutung, was auf seine Tätigkeit als Klarinettist verweist. DEMONTAGEN DES SOLISTEN In diesem Sinn betrachtet sich Widmann durchaus als Virtuose, und deshalb sieht er für sich die Integration von Live-Elektronik künftig als verstärktes Experimentierfeld. «Mir ist es wichtig, einen Menschen auf der Bühne zu sehen, der einen Ton hervorbringt. Es langweilt mich, wenn ich von etwas beschallt werde; jemand soll zu mir sprechen, und nicht es.» So verwundert nicht, dass Widmann – im Gegensatz zu manch anderen Komponisten der Gegenwart – die Gattung des Solokonzerts keineswegs meidet. Bei Lucerne Festival steht die Uraufführung eines Oboenkonzerts an, mit dem Widmann den 70. Geburtstag des Schweizer Oboisten und Komponisten Heinz Holliger würdigt. «Das Werk ist eher suitenartig, ich möchte erstmals in der Konzertform die Mehrsätzigkeit probieren.» Sonst aber spielt das Scheitern in Widmanns Solokonzerten eine wesentliche Rolle: Vielfach wandelt sich der Solist zum gescheiterten Helden, so etwa im Trompetenkonzert «ad absurdum» von 2006. Immer mehr verliert sich der Solist hier in aberwitzigem Tempo, und wenn er nicht mehr spielen kann, löst ihn eine Drehorgel ab. «Das Scheitern des Solisten – darüber mache ich mich lustig, aber liebevoll. Wenn ich ein Konzert schreibe, geht es um Leben oder Tod, Gelingen oder Scheitern. Es geht um alles. Beim Konzert für Holliger geschieht das aber spielerischer.» Das Scheitern ist überhaupt ein wesentliches Merkmal in Widmanns Schaffen. Schon in seinem Musiktheater «Das Gesicht im Spiegel» (2003) wird das Scheitern von zwischenmenschlicher Kommunikation entlarvt, womit Widmann eine Brücke zum absurden Theater von Eugène Ionesco schlägt. Und vielleicht interessiert er sich deshalb für das Scheitern, weil es so eng mit der Freiheit verbunden ist: «Freiheit ist nur im Reich der Träume», das wusste schon Friedrich Schiller. Dr. Marco Frei, Musikwissenschafter und Publizist, München. Anzeige Neue Konzertreihe Zürich Tonhalle l Zürich • Grosser o Saal 7 Abonnementskonzerte 2009/10 9 GROSSE S INTERPRE E TEN Mits i uko k Uchida, a Cecilia Bartoli, t Grigory r Sokolov, v Tölzer Knabenchor, r Sol Gabetta, Vess e elina Kasarova, r Andrá d s Schiff, Giovanni Antonini u.a. CAsNsjY0MDAx1TWwMDAytwAAKQZ9aQ8AAAA=</wm> <wm>10 <wm>10CD3KMQ6AIBBE0RNBZlbAXbcUqIgxarz_UTQWFr95-WN4jvha23a1wwmkHKCQWZ05RTNzUqOImToKVABbWAhOypf-P7QaTqADNxj32h9HwT-jXwAAAA==</wm> In Zusammenarbeit miti Tonhalle l - Gesellschaft Zürich i ---- ------------------------------------------------------------------------------------------- Bestelle l n Sie das Saisonprog r gramm: Tel. 071 791 07 70 • Fax 071 791 07 72 info@hochulil - konzert.ch www.h w ochuli l - konzer n t.ch Neuö Zürcör Zäitung LUCERNE FESTIVAL Samstag/Sonntag, 8./9. August 2009 Nr. 181 SB 9 Zwischen Vogelgezwitscher und Weltliteratur Musik mit Inhalt – oder: Vom Nachahmen mit Klängen zur Programmmusik Von Ellen Taller In früheren Zeiten hat selbst die reine Instrumentalmusik gerne nachgeahmt, Natur oder Krieg zum Beispiel. Im 19. Jahrhundert ist das weiterentwickelt worden: zur Programmmusik. Unerhört waren seinerzeit die Klänge, mit denen die 1737 entstandene Ballettsuite «Les Elements» von Jean Fery Rebel begann: «Alle Noten der Oktave zu einem einzigen Klang vereint» sollten das Chaos der Schöpfung darstellen. Aussermusikalisches mit musikalischen Mitteln wiederzugeben und solche Tonmalerei für programmatische Inhalte einzusetzen, war im Barock weit verbreitet, später aber, in der Klassik, weit weniger von Bedeutung. Wenn einige Sinfonien von Joseph Haydn Titel tragen, stammen sie von Zeitgenossen, denen spezielle Charakteristika eines Themas oder eines Satzes auffielen. Ganz anders sah es Ludwig van Beethoven mit seiner sechsten Sinfonie. «Kein Mensch kann das Land so lieben wie ich», meinte er euphorisch, und zweifellos beruht die «Pastorale» auf seiner tiefen Verbundenheit mit der Natur. Tonmalerische Einzelheiten trug er während der Arbeit am zweiten Satz bereits in frühen Skizzen ein; vom «Murmeln der Bäche» schrieb er und, um die richtige Klangfarbe zu finden: «je grösser der Bach je tiefer der Ton». Ausser den Satzüberschriften hielt er detaillierte programmatische Hinweise für das Publikum jedoch nicht für notwendig. Und wie ein Motto heisst es in den Stimmabschriften: «Mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei», eine Formulierung, auf der Beethoven bei der Drucklegung bestand. INSTRUMENTALES DRAMA Eine Sinfonie mit konkretem Inhalt zu verknüpfen, das gelang 1830 Hector Berlioz exemplarisch mit seiner «Symphonie fantastique». Die «Episode de la vie d'un artiste», so der Untertitel, ist stark durch biografische Hintergründe geprägt. Berlioz verehrte die irische Schauspielerin Harriet Smithson, die als Shakespeare-Interpretin in Paris Triumphe feierte und den jungen Komponisten nicht beachtete. Das Programm seiner Sinfonie stellt denn auch einen Künstler vor, der sich hoffnungslos in eine Frau verliebt. Die Angebetete wird durch ein musikalisches Thema verkörpert, das als «idée fixe» im ganzen Werk gegenwärtig ist, denn wie die Geliebte dem Künstler nicht aus dem Sinn geht, so bleibt «ihr» Thema in allen fünf Sätzen präsent. Die Bedeutung der «Symphonie fantastique» beschränkt sich nicht nur darauf, dass Berlioz in einem rein instrumentalen Stück eine Geschichte erzählte; auch in der Instrumentierung eröffnete er neue Wege. Er stellte ein riesiges Orchester zusammen und verwendete eine ungewöhnlich breite Palette von Klangfarben. So sollen im zweiten Satz, dem Ball, die erste und die zweite Harfe mindestens verdoppelt werden; ein «al meno 2» zeigt die schier unersättliche Lust auf den Klangrausch. Die Instrumente werden in neuen Spielmöglichkeiten eingesetzt, die Dynamik wird ins Extrem getrieben. Die «Symphonie fantastique» war revolutionär und polarisierte die Zeitgenossen. Franz Liszt gehörte zu den begeisterten Anhängern, Felix Mendelssohn Bartholdy dagegen urteilte vernichtend und fand, dass sein Kollege einfach «unbegreiflich schlecht komponiert». Die emotionale Sprengkraft der Sinfonie war epochal, und noch 1912 wirkte sie auf Debussy als «fiebrig erregte[s] Meisterwerk romantischen Feuers». Der Klaviervirtuose Franz Liszt hegte grosse Ambitionen, nachdem er sich als junger Mann aus dem Konzertleben zurückgezogen hatte. Er wollte Werke komponieren, «welche die Tätigkeit des Fühlens und Denkens gleichzeitig in sich tragen». Die Musik sollte sich mit der Weltliteratur verbinden und dadurch mit den grössten Texten auf gleicher Ebene stehen. Sinfonische Dichtung nannte er denn auch die neue Gattung; die Komponisten bezeichnete er als Dichter, Tondichter oder als «Dichter unter den Komponisten». Dieser wurde zum Intellektuellen, und seine gesellschaftliche Stellung, seine Funktion wie die Rolle der Musik überhaupt gewannen durch den literarischen Anspruch an Bedeutung. «MUSIK DER ZUKUNFT» Liszt hatte kein geringeres Ziel als «die Erneuerung der Musik durch ihre innigere Verbindung mit der Dichtkunst». Wie Richard Wagner verstanden die Komponisten im Umkreis von Liszt ihre Werke als «Musik der Zukunft». Um sie von ihrem traditionellen Umfeld abzugrenzen, gab der Musikwissenschafter Franz Brendel der Bewegung den Namen «Neudeutsche Schule». Mit den Traditionalisten, die wie Johannes Brahms Verfechter der absoluten Musik waren und den Musikkritiker Eduard Hanslick auf ihrer Seite hatten, kam es zum erbitterten «Musikstreit», der in den damaligen Musikzeitschriften ausgetragen wurde. Helden stehen im Mittelpunkt der sinfonischen Dichtungen, das Individuum in seiner Not wie in seinem Glanz, ergreifende Vorfälle, Geschichten und Gemälde. Als sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts viele Komponisten auf die Charakteristika ihres Landes fokussierten, eine eigene Tonsprache fanden und die sogenannten nationalen Schulen entstanden, wurde die sinfonische Dichtung zu einer zentralen Gattung, da sie insbesondere durch den literarischen Anzeige GALERIE GLOGGNER LUZERN SWITZERLAND A N NA H M E Z U R K U N S TAU K T I O N H E R B S T 2 0 0 9 <wm>10CAsNsjY0MDAx1TWwMDUyMQUAZdk_Cw8AAAA=</wm> <wm>10CEWLMQ6AIBAEXwRZljtzeiVCRYxR4_-fIqGxmMw007trxKTU46mXJ0A0wJSinimRycBZAFZzGISjtjTErHnx_whlDzfQgBeM594-7G_t1WEAAAA=</wm> ALBERT ANKER (1831-1910) „Portrait d’une fillette“ - 1872 Oel a/Lwd., 37 x 34 cm HOCHBÜHLSTRASSE 1 CH-6003 LUZERN FON +41 (0)41 240 22 23 FA X + 4 1 ( 0 ) 4 1 2 4 0 8 2 8 2 w w w. g l og g n e r a u k t i o n e n . c h [email protected] Bezug dem Nationalen besonders nahe steht. «Mein Vaterland» von Smetana, «Eine Nacht auf dem Kahlen Berge» von Mussorgsky oder «Pohjolas Tochter» und die «Karelia-Suite» von Sibelius gehören zu diesen Werken. Liszt selbst hatte betont, dass das Programm dem Publikum einen Wegweiser für das Verständnis der Kompositionen abgebe. Wie stark gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Programmmusik im Konzertleben positioniert war, wie sehr das Publikum solche wegweisenden Erklärungen erwartete, zeigen unter anderem Gustav Mahlers Erfahrungen mit inhaltsbezogenen Angaben. Seine erste Sinfonie nannte er bei der Uraufführung eine «Symphonische Dichtung in zwei Teilen», ohne hier weitere Details bekanntzugeben. Verschiedene Äusserungen in Briefen und der biografische Hintergrund mit zwei unglücklich verlaufenen Liebesgeschichten lassen in der Tat eine programmatische Absicht vermuten. Nachdem die Uraufführung nur mässig erfolgreich gewesen war, entschloss sich Mahler, ein Programm anzugeben, «um das Verständnis der D-Dur zu erleichtern». Auch für die zweite und die dritte Sinfonie hatte er detaillierte Programmentwürfe. Doch bemerkte er nach einer Aufführung der vierten Sinfonie, die Hörer seien durch die Programme schon so «korrumpiert [. . .], dass sie kein Werk mehr einfach und rein musikalisch aufnehmen können». Schliesslich gab er für seine weiteren Sinfonien keine Titel mehr bekannt. PROGRAMM CONTRA MUSIK? Richard Strauss, Mahlers Zeitgenosse, ging ganz andere Wege. Nach einem ersten Schritt in Richtung Programmmusik mit «Aus Italien», seiner in vier Sätzen angelegten «Symphonischen Phantasie», in der er persönliche Reiseeindrücke klangmalerisch festhielt, wandte er sich konsequent der sinfonischen Dichtung zu. Wenn in der Romantik vorab das Heldenhafte im Zentrum stand, decken die Tondichtungen von Strauss eine breite Ausdruckspalette ab. Nach dem überschwänglichen, von Temperament und Lebensfreude überbordenden «Don Juan» zeichnet er mit «Tod und Verklärung» das Sterben und die Erlösung eines Todkranken nach. Sprühenden Witz bringen «Till Eulenspiegels lustige Streiche» mit einem riesigen und hochvirtuos eingesetzten Orchesterapparat. Während Tills Streiche sehr plastisch mitgeteilt werden, hat das Programmatische im «Zarathustra» hauptsächlich eine inspirierende Funktion. «Frei nach Nietzsche» fügte Strauss dem Titel ausdrücklich hinzu. In den Skizzen hatte er wohl zahlreiche Bemerkungen zur kompositorischen Arbeit eingetragen. Die Kapitelüberschriften von Nietzsches «Zarathustra» notierte er in der Partitur erst nachträglich über den einzelnen Abschnitten. Den Impuls erhielt Richard Strauss von Nietzsches Werk, er komponierte aber nicht entlang einer Textvorlage. Die brillante Orchestrierung der «Alpensinfonie» schliesslich – eine Bergbesteigung, vom Sonnenaufgang über das Gewitter bis zur Heimkehr – wirkt gerade als Gegenbeispiel zu Beethovens Anspruch, «mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei» zu sein. Nachdem die Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der absoluten Musik und der Programmmusik während Jahrzehnten für heisse Köpfe gesorgt hatten, wurde mit dem beginnenden 20. Jahrhundert die Abgrenzung generell weniger relevant, da beide Kategorien als selbstverständlich galten. Auch das «Prélude à l'aprèsmidi d'un faune», das Claude Debussy nach Ver- sen von Stéphane Mallarmé komponiert hat, seine «Images pour orchestre», in denen eine englische Herbstlandschaft, das spanische Ambiente und der Ausbruch des Frühlings nachgezeichnet werden, dann auch «La Valse» von Maurice Ravel – eine «Apotheose auf den Wiener Walzer» – gehören zu den programmatischen Orchesterwerken. Wie ein roter Faden zieht sich die Bedeutung der Natur durch die Jahrhunderte, als Vorbild und Inspirationsquelle: «Nichts ist musikalischer als ein Sonnenuntergang! Für den, der mit dem Herzen schaut und lauscht, ist das die beste Entwicklungslehre» (Debussy). «EIN REST MYSTERIUM BLEIBT IMMER» Von entscheidender Bedeutung ist, ob der Komponist ein Programm bekanntgibt. Für Schumann ging bereits Beethoven mit den Erläuterungen zu seiner sechsten Sinfonie zu weit: «Schon bei der Pastoralsinfonie beleidigte es ihn, dass ihm Beethoven nicht zutraute, ihren Charakter ohne sein Zutun zu erraten.» Zum mitgelieferten Programm von Berlioz' «Symphonie fantastique» meinte er gar: «Solche Wegweiser haben immer etwas Unwürdiges und Charlatanmässiges. Jedenfalls hätten die fünf Hauptüberschriften genügt.» Bezeichnenderweise distanzierten sich die Komponisten oft von dem anfangs gegebenen Programm, als würde die Musik durch Erklärungen schliesslich doch an Ausdruckskraft und Bedeutung verlieren. Hier war sogar für Strauss das Programm zwar ein Garant dafür, «dass die Musik nicht in reine Willkür sich verliere und ins Uferlose verschwimme», schliesslich wollte aber auch er seine Werke primär als Musik verstanden wissen, denn «mehr als ein gewisser Anhalt soll auch für den Hörer ein solches analytisches Programm nicht sein. Wen es interessiert, der benütze es. Wer wirklich Musik zu hören versteht, braucht es wahrscheinlich gar nicht.» Gustav Mahler wandte sich explizit dagegen, dass jedes Kunstwerk erklärbar und somit fassbar sei: «Es gibt, von Beethoven angefangen, keine moderne Musik, die nicht ihr inneres Programm hat. – Aber keine Musik ist etwas wert, von der man dem Hörer zuerst berichten muss, was darin erlebt ist. [. . .] Ein Rest Mysterium bleibt immer – selbst für den Schöpfer!» Dr. Ellen Taller lebt als Musikwissenschafterin und Musikerin in Küsnacht bei Zürich. Anzeige <wm>10CAsNsjY0MDAx1TWwMDG0tAAAqQLaeg8AAAA=</wm> <wm>10CD3KMQ6AIAxG4RPR_LU0UjtKmQgxarz_USQODm_58np3JXztMe44nYGsCSWzFV8AyiLOZqTFHCvrNNsYChGVSf-doqYLaMADpqO2F6hi4bZdAAAA</wm>