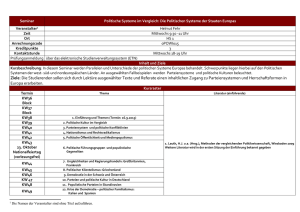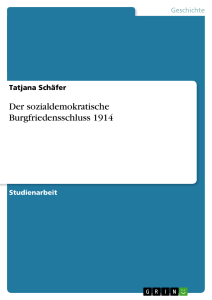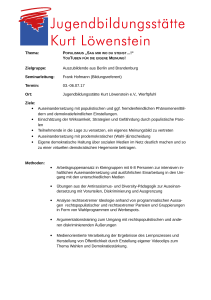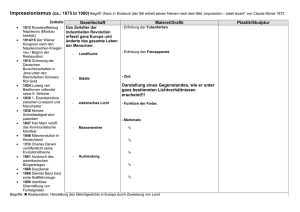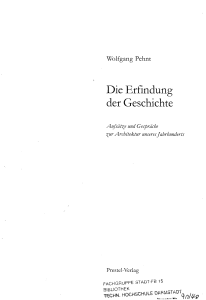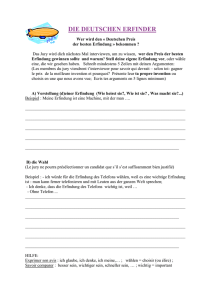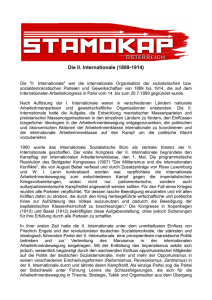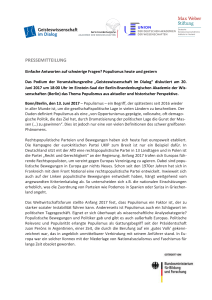Wir haben keine andre Zeit als diese
Werbung

Die populistische Verführung (gesellschaftspolitische oder finanzielle) Folgekosten entstehen. Allerdings gibt es auch genügend Beispiele – aktuell etwa Ungarn oder Polen –, die sichtbar machen, dass durch rechtspopulistische Parteien der bisherige demokratische Grundkonsens vor allem dann massiv infrage gestellt werden kann, wenn es keine oder eine nur schwache Opposition gibt. Die Anbiederung an rechtspopulistische Parteien bzw. die Übernahme von deren Themen und die damit verbundene Verschiebung der politischen Mitte nach rechts hat bislang dem Erfolg rechtspopulistischer Parteien nicht wirklich geschadet. Wenn diese Parteien scheitern, dann meist an der Inkompatibilität von (rechtpopulistischer) Rhetorik und (politischer) Praxis. Reinhold Gärtner ist Professor am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck. Seine Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind: Österreichs politisches System; Politische Bildung; Rechtspopulismus. Aktuelle Publikation: Basiswissen Politische Bildung (2016, new academic press). [email protected] Jasmin Siri »Wir haben keine andre Zeit als diese« Soziale Medien und der Populismus »Many people have said I’m the world’s greatest writer of 140 character sentences.« (Donald Trump) »Ich habe in den letzten Wochen meinen Medienkonsum eingeschränkt, um geistig gesund zu bleiben«, formulierte ein Freund neulich auf den Punkt, was vermutlich viele von uns fühlen – oder mitfühlen können. Ermüdung und Unwohlsein empfinden viele, die sich der Politik in den sozialen Medien widmen. Denn dort prasselt eine Vielfalt von Themen und Meinungen ungefiltert auf uns ein. Es ist bemerkenswert, mit welch rasanter Geschwindigkeit sich in den letzten Jahrzehnten ein Medienwandel vollzogen hat, der mit der Erfindung des modernen Computers in den 50er Jahren seinen Anfang nahm und spätestens in diesem Frühjahr angesichts eines nur scheinbar besinnungslos twitternden US-Präsidenten im allgemeinen Bewusstsein der politischen Kultur verankert ist. Und in der Tat können die Tweets Donald Trumps als die Manifestation dessen gelten, was der Medientheoretiker Marshall McLuhan uns bereits in den 60er Jahren mitteilte, nämlich dass ein Medienwandel die ganze Gesellschaft und jeden Einzelnen erfasst – es verändert sich unsere Wirtschaft, unsere Bildung, unser Alltag – und eben auch unsere Politik. Was also hat sich verändert? Ein paar Beispiele. Erstens: Die Erfindung des Computermediums hat Konsequenzen für ältere Medien wie TV, Radio und Zeitung. Nachrichten beispielsweise lassen sich auch anhand programmierter News- N G | F H 5 | 2 0 17 27 Die populistische Verführung feeds abrufen. Unterhaltung im weniger anspruchsvollen Segment bietet die Vielfalt der YouTube-Channels an. Die Mediennutzung zerfällt in fragmentierte Öffentlichkeiten, frühere Medienereignisse (wie: Wetten, dass ..?) wird es zukünftig nicht mehr geben. Aufgrund des ökonomischen Drucks in den Redaktionen gibt es weniger (gut bezahlte) Fachjournalist/innen mit den entsprechenden negativen Konsequenzen für die Qualität von Recherche und Berichterstattung. Zweitens: Die Tatsache, dass Medieninhalte in sozialen Medien häufig nach Algorithmen sortiert werden, die darauf achten, dass uns der Inhalt gefällt, führt dazu, dass wir weniger über die wissen, die wir als die »Anderen« im politischen Spektrum bezeichnen. Leider ist Grundlage dieser Sortierung nicht eine demokratische Idee, sondern ein Geschäftsmodell, das davon ausgeht, dass wir uns öfter auf einer Plattform aufhalten werden, wenn uns die Inhalte gefallen. Ähnlich einem Club mit »harter Tür« wird der Inhalt vorsortiert und das, was mir laut meinen Nutzungsgewohnheiten nicht gefällt, ausgeblendet. Für die demokratische Kultur hat dies Konsequenzen, denn diese braucht (noch) die Idee einer gemeinsamen Öffentlichkeit, eines Raumes, in dem relevante Themen und Kritik ausgetauscht werden. Und drittens scheint die Medienevolution mit einem Anstieg des Erfolgs populistischer Politikangebote in Europa einherzugehen. Lassen wir mal die Frage beiseite, ob dem eine Kausalbeziehung, ein sozialhistorischer Zufall im Sinne einer Gleichzeitigkeit oder rein sachliche Gründe, wie Politiken der Unsicherheit zugrunde liegen. Empirisch können wir sehen, dass sich Populismus und Computermedium in einer spezifischen und oft erfolgreichen Konstellation verbinden. Dies scheint mir weniger in der Praxis populistischer politischer Kommunikation begründet als durch zwei andere Faktoren: Erstens brauchen neue politische Gruppen schnellen und einfachen Zugang zur Öffentlichkeit bzw. zu den Teilöffentlichkeiten. Dazu kommt ein zweiter Grund für die Nutzung alternativer Medien, nämlich dass populistische Politik die Kritik des Mainstreams (auch den der Medien) für sich beansprucht. Und drittens – und dies scheint mir am wichtigsten – kann man an der erfolgreichen Kampagne von Donald Trump beobachten, dass eine neue populistische Performance entsteht, die gut damit leben kann, nur zur eigenen Klientel zu sprechen. Tweets wie der folgende mögen sich für sachpolitisch versierte Praktiker albern lesen. In der Timeline von Trump und angesichts seiner fleißigen Bedienung des Mediums wirken sie als charismatische Ansprache der als »forgotten people« geframten (v. a. weißen) Unter- und Mittelschicht. Am 24. März 2016 um 8:52 Uhr Ortszeit twitterte er: »Just announced that as many as 5000 ISIS fighters have infiltrated Europe. Also, many in U.S. I TOLD YOU SO! I alone can fix this problem.« Populistische Akteure nutzen also die sozialen Medien und sie nutzen sie erfolgreich, vielleicht auch erfolgreicher als »alte« Parteien wie CDU/CSU, SPD oder DIE GRÜNEN. Diese sind freilich aber auch weniger auf diese Medien angewiesen und haben sie lange auch weniger ernst genommen. Durch die Unmittelbarkeit der Netzkommunikation und die Möglichkeit mitzulesen, was »die Anderen« schreiben, wird daher auch oft das Thema hate speech (Hassrede) diskutiert. Und in der Tat: Man braucht nicht lange, um in Netzoberflächen (wie übrigens auch andernorts in 28 N G | F H 5 | 2 0 17 Die populistische Verführung der Gesellschaft) hasserfüllte, gemeine und lästerliche Kommentare zu finden. Ist das die »Schuld« von Google und Facebook? Natürlich nicht. Könnten die Konzerne stärker in die Pflicht genommen werden? Vermutlich ja. Aber eigentlich geht diese Diskussion um die aktuellen ökonomischen Player – wie auch jede zensorische Fantasie eines »Wahrheitsministeriums« oder eines »Abwehrzentrums für Desinformation« – an der gesellschaftlichen Realität insofern vorbei, dass wir uns in einer durch den Medienwandel evozierten kulturellen Schocklage befinden, die nur die Zeit und ein Prozess kollektiven Lernens heilen kann. Von den bisherigen Entwicklungen und Krisendiskursen – denken wir an die Erfindung des Buchdrucks oder des Fernsehens – lässt sich hierfür viel lernen. Es gibt keine einfachen Gegenstrategien gegen Hass im Netz und es gibt auch keine (bzw. keine demokratische) Möglichkeit, das Netz so zu kontrollieren, dass sich die schlechten Seiten der Menschen dort nicht manifestieren. Weder lässt sich Hass verbieten, noch ist es möglich, »Wahrheit« (abseits knallharter Lügen und Verleumdungen, die das Recht bereits kennt und behandeln kann) justiziabel zu machen. Und selbst wenn es so wäre: Wer entscheidet denn, was Wahrheit ist? Eine Regierung? Das Innenministerium, Abteilung Wahrheit? Eine von der Regierung beauftragte Gruppe von Experten? Die »Mehrheit«? Die demokratiepolitischen Gefahren solcher Eingriffe in die Meinungs- und Informationsfreiheit liegen auf der Hand und wir müssen nicht einmal die Tiefen philosophischer Diskussionen über den mehr als prekären Wahrheitsbegriff aufsuchen, um dies festzustellen. Die Erfindung des Computers ist von seinen Wirkungen und seinem Schockmoment für die Gesellschaft vergleichbar mit der Erfindung des Buchdrucks. Auch dieser erzeugte Sinnkrisen, Euphorie, Kritik, Angst. Und es hat hunderte Jahre gedauert, diesen Schock zu bearbeiten. Das Internet ist das neue »Übermedium« einer Gesellschaft, die auf dieses Medium nicht eingerichtet war – wie könnte sie es auch? Medienevolutionen kommen zwar auf Ansage, jene, die sie untersuchen, weisen uns früh darauf hin, und doch ist kaum zu prognostizieren, wie der Medienwandel Gesellschaften wirklich und im Betrieb verändert und formt. Eine sozialdemokratische Antwort Wenn wir nun fragen, was eine sozialdemokratische Antwort auf die soeben skizzierten Herausforderungen sein kann, so wird sie nicht lauten können, in den Chor der Entzweiung und Moralisierung einzustimmen, die sich in den Echokammern der politischen Lager artikuliert. So ärgerlich und unschön sich Hass im Netz auch darstellt: Wichtiger als die Bearbeitung von Symptomen und Affekten wäre die Frage, wer das Netz kontrolliert, ob wir es okay finden, dass ökonomische Interessen durch selektive Algorithmen in die politische Kommunikation eingreifen und ob und wie alle Bürgerinnen und Bürger Zugang zum Netz haben. Hier könnte man die Frage nach Facebook und Google (und ihren handfesten Interessen) viel grundlegender und als Allmendeproblem diskutieren. Eine moderne sozialdemokratische Antwort wird auch nicht lauten können, den einfachen juristischen Lösungen der Autoritativen, mithin der Zensur, das Wort zu reden. Das Strafrecht regelt bereits alle relevanten Bereiche der Internetkriminalität. N G | F H 5 | 2 0 17 29 Die populistische Verführung Das deutsche Problem ist diesbezüglich die Strafverfolgung und die Bereitstellung von ausreichend Expertise in den Strafverfolgungsbehörden. Die Sozialdemokratie hatte immer auch eine autoritäre Note, oft zum Leidwesen ihrer linksintellektuellen Sympathisanten und manchmal zeigt sie sich in den Diskussionen über das Netz nur zu deutlich. Doch zugleich war die Stärke der Sozialdemokratie auch immer neue Technologien nicht zu verdammen, sondern sich zu fragen, wie man sie für die Ansprache der Bürgerinnen und Bürger nutzen kann. Man muss nicht technikeuphorisch sein, um die Chancen zu sehen, die soziale Medien für Partizipation und Kommunikation bieten. In der Landes- und Kommunalpolitik wurde dies bereits vielfach diskutiert und ausprobiert. Wenn wir den Medienwandel ernst nehmen und modern umsetzen wollen, so gilt es vieles im System des Politischen zu überdenken: Ist es noch zeitgemäß, Wahlen auf Papier und in Wahllokalen stattfinden zu lassen oder wäre eine häufigere und technisch vermittelte Beteiligung möglich? Der Physiker Dirk Helbing schlug in der Fachzeitschrift Medienkorrespondenz so etwas wie eine Beteiligungsapp vor. Ist es noch zeitgemäß, vor allem auf Organisationsformen der Interaktion unter Anwesenden zu setzen (etwa Ortsvereine von Parteien)? Auch zu dieser Frage gibt es in der webaffinen Bubble der Sozialdemokratie viele Ideen und Konzepte. Und zuletzt: Sollten Demokratinnen und Demokraten nicht, wenn wir doch wissen, dass wir dem Hass (auch im Netz) nicht mit Zensur beikommen werden, versuchen, sich auch mit den »Hatern« in sozialen Medien auseinanderzusetzen oder müssen wir uns an dieses Grundrauschen des Hasses gewöhnen und den Umgang damit lernen? Dies sind nur einige der Fragen, zu denen sich die Sozialdemokratie eine Meinung bilden sollte. »Wir haben keine andre Zeit als diese, die uns betrügt mit halbgefüllter Schale. Wir müssen trinken, denn zum zweiten Male füllt sie sich nicht«, dichtete einst Mascha Kaléko. Eines ist jedenfalls sicher: Auch wenn es uns nicht gefällt, wie sich die Evolution der Medien gestaltet, selbst wenn wir der Bonner Republik und ihren klaren Strukturen mit Gatekeepern nachtrauern wollten, so haben wir – mit dem Diktum der Dichterin – doch keine andere Zeit als diese, um sie zu gestalten. Wenn die Sozialdemokratie diese Chance nicht ergreift, so werden es andere politische Bewegungen sicher tun. Die Renaissance reaktionärer Politiken in Europa und ihrer modernen medienpolitischen Strategien macht dies mehr als deutlich. Jasmin Siri ist zurzeit Vertretungsprofessorin für politische Soziologie an der Universität Bielefeld. Sie forscht zu Politik, Parteien und Digitalisierung. [email protected] 30 N G | F H 5 | 2 0 17