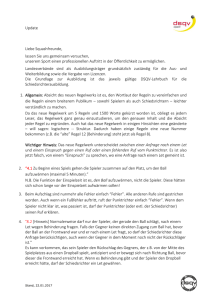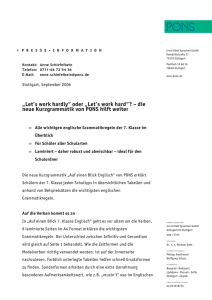SWR2 Essay
Werbung
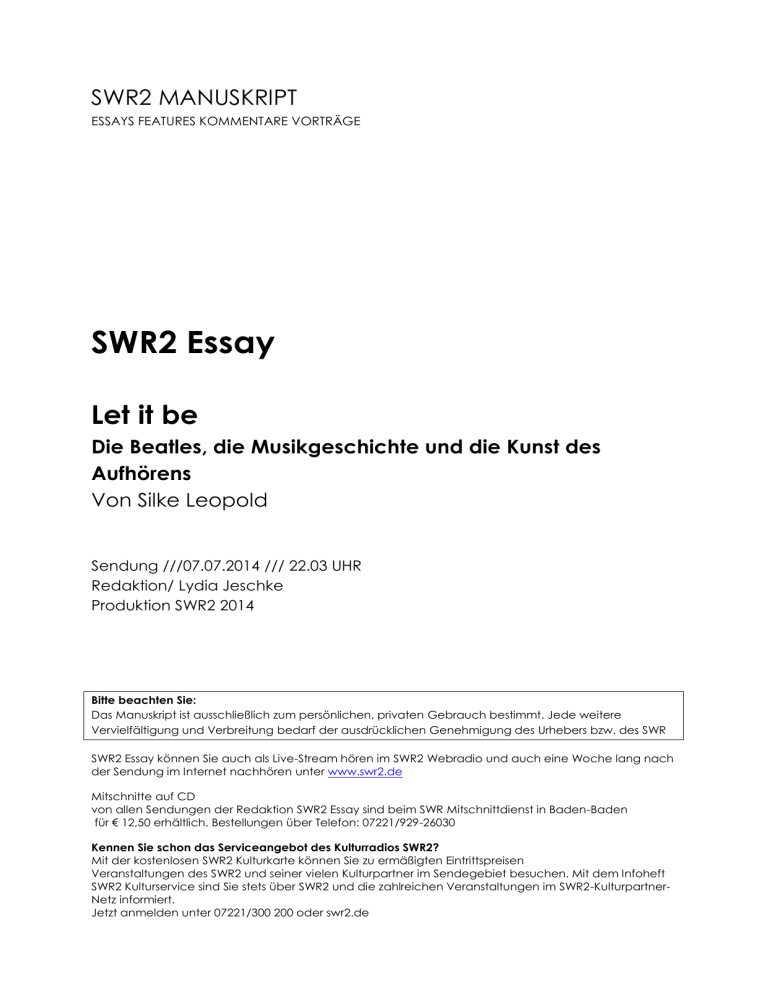
SWR2 MANUSKRIPT ESSAYS FEATURES KOMMENTARE VORTRÄGE SWR2 Essay Let it be Die Beatles, die Musikgeschichte und die Kunst des Aufhörens Von Silke Leopold Sendung ///07.07.2014 /// 22.03 UHR Redaktion/ Lydia Jeschke Produktion SWR2 2014 Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR SWR2 Essay können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio und auch eine Woche lang nach der Sendung im Internet nachhören unter www.swr2.de Mitschnitte auf CD von allen Sendungen der Redaktion SWR2 Essay sind beim SWR Mitschnittdienst in Baden-Baden für € 12,50 erhältlich. Bestellungen über Telefon: 07221/929-26030 Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2-KulturpartnerNetz informiert. Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de Musik 1: John Lennon / Paul McCartney: “Let it be” The Beatles LC 0299 Parlophone, Best-Nr. TOCP-51123 4:03 Sprecher: Let it be nimmt in der Beatles-Mythologie einen sagenumwobenen Platz ein. Aufgenommen wurde es im Januar 1969 – da war die Welt der Beatles zumindest nach außen noch in Ordnung. Aber der Song blieb bis März 1970 unveröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt, als Let it be als Single auf den Markt kam, dachte Paul McCartney, der Urheber des Songs, bereits intensiv darüber nach, die Beatles zu verlassen, was er dann nur einen Monat später, Anfang April, auch wirklich in die Tat umsetzte. Als titelgebender Song des allerletzten Albums, das die Beatles herausbrachten, erschien Let it be dann nach der Trennung der Gruppe im Mai 1970. Let it be wurde auf diese Weise zum symbolgeltränkten Dokument der Trennung der Fabulous Four und des Abschieds von einer musikalischen Welt, die sie fast ein Jahrzehnt lang entscheidend mitgestaltet und auf Dauer verändert hatten. Anfang 1969 war dieser Song zunächst nichts anderes als eines jener schlichten Lieder, mit denen die Beatles musikalisch wieder an den Balladenton etwa von Misery 1963, Yesterday 1965 oder Michelle ebenfalls 1965 anknüpfen wollten. Allerdings war Let it be kein Liebeslied mehr, sondern textlich an jenen neuen quasireligiösen Ideen geschult, mit denen die Beatles ihre Songs in der letzten Phase ihres Daseins zu so etwas wie pantheistischen Bekenntniswerken umfunktioniert hatten. John Lennon sprach dem Song in späteren Interviews zwar jegliche Nähe zu religiösen oder gar christlichen Untertönen ab, und tatsächlich war mit „Mother Mary“ nicht die Jungfrau Maria, die Muttergottes, gemeint, sondern Paul McCartneys eigene früh verstorbene Mutter, die ihn bisweilen im Traum heimsuchte. Aber die Wahrnehmung religiöser Untertöne im Text ist dennoch mehr als nur eine Fehldeutung, wie John Lennon es glauben machen wollte. Let it be ist voll von Bibelzitaten. Zitat englisch: „When I find myself in times of trouble” Zitat deutsch: „Wenn ich mich in Zeiten der Sorge befinde“ – Sprecher: Diese erste Textzeile von Let it be zitiert relativ unverhohlen den ersten Vers des 10. Psalms, der in der King‟s Bible, der bis heute verbindlichen englischen Übersetzung, so heißt: Zitat englisch: “Why standest thou afar off, o Lord? why hidest thou thyself in times of trouble?” Zitat deutsch: „Herr, warum trittst du so ferne, verbirgest dich zur Zeit der Not?“ Sprecher: Später heißt es dann in Let it be: 2 Zitat englisch: „And when the broken hearted people living in the world agree” – Zitat deutsch: „Und wenn die Menschen in der Welt, die gebrochenen Herzens sind, zustimmen“ Sprecher: Das Bild von den „broken hearted people“ spielt auf das Lukas-Evangelium des Neuen Testaments an, genauer gesagt auf die Predigt Jesu in Nazareth, wie sie in Lukas 4, Vers 18 erzählt wird. Dort lauten die Jesu Worte: Zitat englisch: “The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised.” Zitat deutsch: "Der Geist des Herrn ist bei mir, darum, dass er mich gesalbt hat; er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollten, und den Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen.“ Sprecher: In der letzten Strophe von Let it be heißt es schließlich: Zitat englisch: “And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me.” Zitat deutsch: „Und wenn die Nacht voll Wolken ist, so ist da doch ein Licht, das auf mich scheint.“ Sprecher: Für diese Verse des Songs gibt es mehrere Referenzen in der King‟s Bible, zunächst das Johannes-Evangelium des Neuen Testaments, Kapitel 1 Vers 5: Zitat englisch: “And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.” Zitat deutsch: „Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen.“ Musik2: Georg Friedrich Händel: „Halleluja“ aus: „Messias“ Amsterdam Baroque Choir Amsterdam Baroque Orchestra Leitung: Ton Koopman Eigenproduktion des SWR Ausschnitt: 1‟ Sprecher: Der Beatles-Song spielt aber auch noch auf die Lichtmetaphern des Propheten Jesajas an, die über die Bibel hinaus in der englischen Musikkultur ihren festen Platz hatten, weil Georg Friedrich Händel sie in seinem Messias-Oratorium einer großen Bassarie zugrundelegte: 3 Zitat englisch: “The people that walketh in darkness have seen a great light. And they that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined.” Zitat deutsch: „Das Volk das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht; und über die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.“ Sprecher: Es bleibt nicht bei den textlichen Anspielungen, wenn man nach religiösen Untertönen in Let it be fahndet. Auch musikalisch gibt es durchaus Assoziationen, die in Richtung Kirchenlied verweisen, allen voran der Klang der Orgel, der sich ab der zweiten Strophe zum Klavier gesellt, oder auch das glockenartige, blecherne Gebimmel im Schlagzeug und eine charakteristische harmonische Wendung, von der noch die Rede sein wird. Kein Wunder also, wenn Let it be aus der Rückschau der Ereignisse in Zusammenhang mit der Auflösung der Popgruppe wie ein Vermächtnis anmutet, wie ein musikalisches Testament, dem es erst nach dem Ableben der Gruppe vergönnt war, das Ohr der Öffentlichkeit zu erreichen. Neben den Bibelzitaten ist wohl auch diese Rolle als Abgesang für ein Missverständnis verantwortlich, das diesen Song mit einer Opernarie Georg Friedrich Händels, der Auftrittscavatina „Ombra mai fu“ aus Serse, dem sogenannten Largo von Händel verbindet. Ein Gutteil seiner Tantiemen spielt Let it be nämlich weltweit als Begräbnismusik ein. Websites wie Funeralhelper oder TranquilityCremation, aber auch deutsche Sites wie „Rostock Seebestattungen“ listen Let it be zwischen Swing low sweet chariot und Time to say good bye im musikalischen Angebot auf. Allerdings ist diese Konnotation als Musik des Abschieds keineswegs verbindlich. Sir Paul McCartney, von der Queen geadelt, hätte Let it be wohl kaum in ihrer Gegenwart zu ihrem 60. Thronjubiläum 2012 aufführen können, wenn damit auch nur der Hauch eines Verdachts hätte aufkommen können, dies sei eine versteckte Aufforderung zum Rücktritt oder gar Endgültigeres. Let it be ist eben auch eine Huldigung an die Mutter, und sei sie die Mutter der Nation, die den Mühseligen und Beladenen das Licht zu bringen imstande ist. Let it be ist längst ein Klassiker geworden, und wie alle Klassiker hat es sich aus den Kontexten gelöst, die für seine Entstehung verantwortlich waren, wie Greensleeves, wie Händels Largo, wie Schuberts Gebet einer Jungfrau und viele andere derartige Lieder, die man mitzusingen imstande ist, ohne zu wissen, wo sie eigentlich herkommen und wann sie entstanden. Nun könnte man mir leicht vorwerfen, ich würde aus der Vogelperspektive der Nachgeborenen Dinge zusammenwerfen, die nichts miteinander zu tun haben. Wie hätten die Jungs aus den bildungsfernen Liverpooler Arbeiterquartieren die Bibel so genau kennen oder gar mit Händels Messias in Kontakt kommen können? Dieses Argument wäre nicht nur in Zusammenhang mit den Beatles eine gängige, tatsächlich auch von ihnen selbst betriebene Stilisierung, sondern würde auch zeigen, wie zementiert die Mauern zwischen einer vermeintlichen musikalischen Hochkultur und den Niederungen angeblich banaler Popmusik bis heute sind. Dass Paul McCartney und George Harrison auf dieselbe, sehr ambitionierte Schule gingen, bleibt dabei ebenso unbeachtet wie die Tatsache, dass sich Paul McCartney und John Lennon ausgerechnet auf dem Gartenfest einer Liverpooler Kirchengemeinde kennenlernten. Gar so bildungsfern, gar so bibelfern können die Jungs, die bald 4 danach als ebenso begnadete wie kalkulierte Bürgerschrecks Karriere machten, dann doch wohl nicht gewesen sein. Was hat Let it be, was andere Popsongs nicht haben? Es gehört laut dem Popmusikmagazin Rolling Stone zu den erfolgreichsten Songs der Geschichte überhaupt, und der britische Beatles-Forscher Ian McDonald vertrat sogar die Meinung, dass die Popularität dieses Songs seine künstlerische Qualität bei weitem überrage. Vielleicht sind es gerade die Schlichtheit, die Lakonik des Anfangs und des Schlusses, die diesen Song zu einem er berühmtesten und erfolgreichsten weltweit gemacht haben. Let it be hat alle Qualitäten jenes virtuellen Volkstons, den sich die Komponisten des späteren 18. Jahrhunderts ausdachten, als sie das Volkslied erfanden. Da wäre zunächst die absolut schematische, an keiner Stelle aufgebrochene Viertaktperiodik zu nennen, die Volksliedern eigen ist – man denke etwa an Der Mond ist aufgegangen. Da ist die fast bestürzend simple Harmonik, bestehend aus nicht viel mehr als den Akkorden der C-Dur-Kadenz, also C – F – G – C, an wenigen Stellen lediglich erweitert um eine kurze Passage in parallelem A-Moll. Da ist fernerhin die fast durchgängig pentatonische Melodie, die die Halbtonschritte und damit die spannungsgeladenen Leitton-Wirkungen vermeidet. Nur „fast“ durchgängig allerdings, denn das gehört zu den raffinierten Abweichungen und verborgenen Botschaften, die nicht über den Text, sondern allein über die Musik vermittelt werden: Der einzige Halbtonschritt, der dann doch erklingt und genau jene Spannung erzeugt, die der Pentatonik fremd ist, ist dem Wort „words“ vorbehalten: „speaking words of wisdom“. Jedesmal wenn diese Worte der Weisheit, also „Let it be“, angesprochen werden, erklingt das F und damit der Halbtonschritt e-f, der die Pentatonik der Melodie unterbricht. Deutlicher kann man dieses Wort kaum hervorheben. Musik 3: John Lennon / Paul McCartney: „Let it be“ (s. Musik 1) Ausschnitt: 0„25 Sprecher: Und auch die Harmonik ist zwar simpel, bringt aber durchaus eigene Farben ins Spiel. Denn die Kadenz erklingt nicht in ihrer authentischen Version Subdominante – Dominante – Tonika, die dem Leitton eine prominente Rolle zuweisen und jene Spannung erzeugen würde, die die pentatonische Melodie eben gerade vermeiden möchte. Die Kadenz erklingt stattdessen in der plagalen Version Dominante – Subdominante – Tonika, und zwar durchgängig. Diese plagale Kadenz, auf der der gesamte Song basiert, wird umgangssprachlich auch Kirchenschluss genannt, weil er die Jahrhunderte harmonischer Entwicklungen und Veränderungen vor allem in der Kirchenmusik überdauert hat. Ihn umgibt nicht nur die Aura des Religiösen, sondern auch die Aura des Altertümlichen, weit in die mythische Vorzeit Zurückreichenden. Wenn Claudio Monteverdi seine Marienvesper mit einem plagalen Amen ausklingen lässt, so ist er, im Jahre 1610, noch ganz bei sich und bei der liturgischen Musik. Wenn Georg Friedrich Händel das prächtige, triumphale Hallelujah aus dem Messias plagal enden lässt, so hängt er dieser herrscherlichen, für das Theater und nicht für die Kirche konzipierten Musik ein Mäntelchen christlicher Demut um. Und wenn Wolfgang Amadeus Mozart das Gebet des kretischen Königs Idomeneo an den Gott Neptun „Accogli o re del mar“ mit einer plagalen Kadenz ausklingen lässt, holt er die Kirche gar auf die Opernbühne und in den heidnischen Kontext des IdomeneoLibrettos hinein. 5 Musik 4: Wolfgang Amadeus Mozart: „Accogli o re del mar“ aus: „Idomeneo“ Christoph Strehl (Tenor)(Arbace, Vertrauter des Königs) Sinfonietta des Dänischen Rundfunks, Kopenhagen Leitung: Adam Fischer LC 02213 Dacapo, Best.-Nr. 6.220586-89 2„36 Sprecher: Genug der musikalischen Analyse. Erzählte Musik ist wie ein erzähltes Mittagessen, hat Grillparzer gesagt. Und es fragt sich ohnedies, ob so etwas Simples wie Let it be überhaupt analysefähig ist. In seinem Studienbuch Analyse lernen hat Clemens Kühn 1993 einem Kapitel den provokanten Titel gegeben: „Stücke, die nichts hergeben“. Darin kommt er dann natürlich darauf zu sprechen, dass es sich in jedem Fall lohnt, genauer hinzuschauen, aber es findet sich dort doch auch der bemerkenswerte Satz: „Es ist nicht Aufgabe von Analyse, bescheidene Musik ganz toll zu finden oder – zu machen.“ Ich würde diesen Satz gern ergänzen: Es ist aber Aufgabe von Musikwissenschaft, danach zu fragen, was sich hinter dieser vermeintlichen Bescheidenheit verbirgt und warum wir überhaupt glauben, zwischen bescheidener und weniger bescheidener Musik unterscheiden zu können. Tatsächlich bietet Let it be auf den ersten Blick wenig, was einen Musikwissenschaftler alter Schule interessieren könnte. Wer die Originalität des musikalischen Materials und die Dichte des Satzes als die zentralen Kriterien ansieht, die darüber befinden, ob ein Stück es wert ist, sich damit zu beschäftigen, wer das musikalische Werk als eine in sich geschlossene, unveränderbare Größe, als das berühmte „opus perfectum et absolutum“ betrachtet, das jeden Musikwissenschaftler vom ersten Semester an begleitet, wer darüber hinaus die Partitur als den zentralen Gegenstand des Faches ansieht und nicht so sehr das klingende Ereignis der Aufführung, der wird bei den Beatles im Allgemeinen und bei Let it be im Besonderen nicht fündig werden. Abgesehen von den simplen musikalischen Strukturen, die vielleicht „nichts hergeben“, hätte der Musikwissenschaftler alter Schule schon Schwierigkeiten bei der Frage, womit er sich überhaupt beschäftigen soll. Die Beatles haben ihre Songs nicht „komponiert“, sondern im Probenraum oder im Studio erfunden. Einen alleinigen Urheber gibt es in der Regel nicht, weil alle vier an der Entstehung der Songs in veränderlichen Anteilen irgendwie mitgewirkt haben. Let it be etwa, das wohl hauptsächlich von Paul McCartney stammt, und von dem sich John Lennon später sogar distanzierte, trägt wie so viele andere Songs das Copyright Lennon/McCartney. Es gibt keine Notate, sondern bestenfalls später, im Nachhinein erstellte schriftliche Versionen, entweder als Gerüst aus Melodie und Akkorden zum Nachspielen, oder als mühselige, aber getreuliche Dokumentation all dessen, was in der jeweiligen Aufnahme erklingt, mit allen Overdubs, allen technisch einmontierten Instrumenten und Tierstimmen wie Hähnen, Hunden oder Katzen. Aber selbst von den produzierten Schallplatten, den sogenannten „original recordings“, gibt es keine „Fassung letzter Hand“, sondern oft mehrere Versionen, im Falle von Let it be mindestens drei, die sich signifikant unterscheiden. Was also wäre überhaupt der Gegenstand, über den der Musikwissenschaftler Aussagen zu treffen hätte? Weil diese Fragen nicht befriedigend zu beantworten sind, neigt die Musikwissenschaft dazu, Zäune zu errichten, nicht nur traditionell seit ihrer Gründung 6 zwischen den drei Teilfächern historische, systematische und ethnologische Musikwissenschaft, sondern seit einiger Zeit auch zwischen Musikforschung und Popmusikforschung. Institutionell führt das dazu, dass es Akademien für Popmusik oder Lehrstühle für Popmusikforschung gibt, personell dazu, dass sich die einen nicht für die Beatles und die anderen nicht für Mozart interessieren – nicht zu sprechen von den wechselseitigen Idiosynkrasien und Werturteilen. Das aber schadet, so meine ich, nicht nur der Popmusikforschung in ihrer historischen Ahnungslosigkeit, sondern auch der etablierten Musikforschung, die nicht wahrhaben will, dass die Musikgeschichte ganz ähnliche Fragen aufwirft und ganz ähnliche Methoden erfordert, wie man sie an der Popmusik diskutieren kann. Blickt man heute in ein einschlägiges Lexikon wie den Sachteil des Riemann-Lexikons von 1967, dann kann man aus der Distanz eines halben Jahrhunderts nur noch den Kopf schütteln. Über Popmusik heißt es da: Zitat: Popmusik. Seit 1960 international verbreitete Variante afro-amerikanischer Musik, die im Kontext der Ausbildung jugendlicher Subkulturen entstand. Sprecher: 1967, als dieses Lexikon erschien, waren die Beatles auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und hatten mit Sgt. Pepper‟s Lonely Hearts Club Band gerade das wegweisende Konzeptalbum veröffentlicht. Und afro-amerikanisch war es ganz sicher auch nicht. Gerade die Beatles taten viel dazu, ihre Songs nicht nur in der globalen Popkultur, sondern auch in der europäischen Musik- und Literaturgeschichte zu verankern, unterstützt von ihrem hochgebildeten Produzenten George Martin, auf den die bekannten Streichquartett- und Cembalo-Arrangements zurückgehen. Ihre Texte spielen auf William Blake ebenso an wie auf Lewis Carroll. Sie reagierten gleichsam seismographisch auf viele musikalische und kulturelle Zeitströmungen wie etwa die Entwicklung der elektronischen Musik oder das wachsende Interesse an fernöstlicher Kultur, und wenn sie auch nicht als deren Erfinder gelten können, so trugen sie doch entscheidend dazu bei, manche dieser Zeitströmungen aus dem Versteck der Exklusivität zu holen und zu einer Massenkultur zu machen. Zäune errichtet die Musikwissenschaft neuerdings auch zwischen der Kompositionsgeschichte und der Kulturgeschichte – zwischen denen, die sich mit den Noten beschäftigen und denen, für die das Umfeld der Werke im Focus steht, als ob es sich hierbei um einen Gegensatz handelte und nicht das eine wie das andere für das Verständnis der Musik unabdingbar wäre. Dass das musikalische Kunstwerk der alleinige oder auch nur der hauptsächliche Gegenstand der Musikwissenschaft sei, ist schon seit längerem nicht mehr selbstverständlich. Das „imaginäre Museum der musikalischen Werke“, wie Carl Dahlhaus es 1985 nannte, führt nur noch ein Schattendasein. Der Boom der Historischen Aufführungspraxis seit den 1960er Jahren hat ebenso wie die Beschäftigung mit der zeitgenössischen AvantgardeMusik aus denselben Jahren dazu geführt, dass das klingende Ereignis neben der schriftlichen Partitur immer stärker ins Blickfeld der Musikwissenschaft rückte. Inszenierungsforschung und Tanzforschung haben in den letzten Jahrzehnten das Ihrige getan, das klassische Themenspektrum der Musikwissenschaft aufzubrechen und zu erweitern. Wer sich aber mit der musikalischen Avantgarde beschäftigte, schaute selten auf die Popmusik, und umgekehrt. Dabei hätte es gerade in den 1960er Jahren, dem 7 Jahrzehnt der Beatles, eine Vielzahl von parallelen Entwicklungen und sogar Überkreuzungen zwischen Alter Musik, Neuer Musik und Popmusik zu konstatieren gegeben. Die Wiederentdeckung der Kastratenstimmen verbunden mit dem Aufstieg der Countertenöre und das exzessive Falsettieren in der Popmusik wie etwa bei den Beach Boys oder den Beatles verlaufen zeitlich exakt parallel. Die rasante Entwicklung der Aufnahmetechnik lockte Musiker aller Couleur seit der Mitte der Sechziger Jahre weg von der Bühne und in die Studios – die Beatles ebenso wie Glenn Gould. Lange vor Frank Zappa ließen sich die Beatles von der elektronischen Musik Karlheinz Stockhausens inspirieren und reihten ihn sogar auf dem Plattencover von St. Pepper‟s Lonely Hearts Club Band ein. Die zunehmende Politisierung der Musik seit der Mitte der Sixties findet zeitgleich in der Avantgarde wie bei den Beatles statt, teilweise mit denselben musikalischen Mitteln; und auch die transkulturellen Aktivitäten, die wir derzeit so feiern, waren hier wie dort in den Sechzigern präsent. Genügend Stoff also, die Zäune zu öffnen und nicht nur verstärkt über die Gleichzeitigkeit derartiger musikalischer Phänomene nachzudenken, sondern auch in einem historischen Längsschnitt nach den Wurzeln zu suchen, die Popsongs wie Let it be mit musikalischen Phänomenen früherer Jahrhunderte verbinden. Mein Plädoyer zielt daher auf Integration statt Segregation. Popmusikforschung mag ohne Musikgeschichte auskommen, ebenso wie Historische Musikwissenschaft ohne Popmusik – sinnvoll ist beides nicht. Denn die Musikgeschichte besteht keineswegs nur aus Werken im perfekten und absoluten Sinne, sondern auch aus unzähligen anderen Phänomenen, die sich an Popsongs wie Let it be studieren lassen. Dazu ist es nötig, sie zu kontextualisieren und zu historisieren. Popmusik ist eben kein eigenes Feld, das unabhängig von der Musikgeschichte betrachtet werden könnte, und es ist möglich und nötig, sie in einer musikhistorischen Genealogie zu verorten, die weit zurückreicht. Einige Punkte möchte ich kursorisch ansprechen, um dann bei einem konkreten Beispiel etwas länger zu verweilen. Das betrifft zunächst den Bereich des Populären als einer Kategorie, die sich von dem Anspruchsvollen abzugrenzen pflegt. Hochkultur versus musikalisches Souterrain, um es in den Worten meines Lehrers Carl Dahlhaus zu sagen – das scheint hier die Frage zu sein, und die verbindet sich mit dem Argument gegen eine Massenkultur, die um der allgemeinen Verständlichkeit willen nichts mehr für Kenner bietet. Derartige „niedere“ Musik, Musik für die einfachen Menschen oder solche, die sich gern bisweilen als einfach gaben, hat es freilich immer gegeben. Nehmen wir Let it be mit seinen religiösen Untertönen: Musik 5: Trad.: „Greensleves“ Mitgleider des La Cetra Barockorchester, Basel Leitung: Andrea Marcon LC 00173 Deutsche Grammophon, Best.-Nr. 4790079 Ausschnitt: 0„50 Sprecher: Was wäre das anderes als jene Straßengesänge namens Lauda aus dem 13. und 14. Jahrhundert, anderes als jene Canzonette spirituali wie etwa „Bisogna morire“, mit denen religiöse Bruderschaften im 17. Jahrhundert um Aufmerksamkeit für die Endlichkeit des irdischen Daseins warben, anderes als Der Mond ist aufgegangen, das ja auch ein religiöses Lied ist? Die Berührungsängste der Musikwissenschaft vor dem sogenannten Popolaren, wie Leopold Mozart es nannte, reichen weit zurück, 8 und selbst die, die bereit waren, sich damit wissenschaftlich auseinanderzusetzen wie Dahlhaus, tat dies unter dem durchaus negativ konnotierten Begriff „Trivialmusik“ und bezogen auf das 19. Jahrhundert. Musikalische Massenphänomene hat es aber auch schon in vergangenen Zeiten gegeben – man denke etwa an das erwähnte Greensleeves oder den Ballo del Granduca, der im 17. Jahrhundert in ganz Europa verbreitet war. Es scheint, als ob der historische Abstand die musikalischen Gegenstände adeln würde – angemessen ist dies nicht. Nehmen wir zweitens die Idee von Komponieren versus Improvisieren und, damit verbunden, den Zeitpunkt der schriftlichen Notierung. Lange Jahrzehnte hat sich die Musikwissenschaft primär mit der schriftlichen Überlieferung von Musik, mit der Partitur beschäftigt und intensiv etwa die Frage diskutiert, wann die sogenannte Urfassung oder eher die letzte Version, die sogenannte Fassung letzter Hand Gegenstand der Forschung zu sein habe und warum. Dass dabei ganze Bereiche der Musik aus dem Blickfeld der Forschung fallen mussten, wurde gleichsam billigend in Kauf genommen. Von Opern etwa gibt es streng genommen nur dann eine Fassung letzter Hand, wenn die Oper nicht mehr gespielt wurde, weil jede Aufführung Veränderungen mit sich brachte. Und die Geschichte der musikalischen Improvisation lässt sich vor der Erfindung der Tonaufzeichnungen zwar nur sehr unvollkommen dokumentieren, lässt aber angesichts der schriftlichen Dokumente, die wir darüber aus vergangenen Jahrhunderten besitzen, auf ein ähnliches Verfahren schließen wie bei den Song-Notaten der Beatles: Vieles von dem, was wir als Komposition behandeln, ist in Wahrheit aufgeschriebene Improvisation – Orgelpräludien aus dem 15. Jahrhundert ebenso wie größere Passagen in Mozarts Klavierkonzerten, Ostinatovariationen des 17. Jahrhunderts ebenso wie Franz Liszts Lied- oder Opernparaphrasen. Und selbst die Notate wie der erwähnte Gerüstsatz aus Gesangsmelodie und Instrumentalbass ohne Rücksicht auf das, was bei der Aufführung bzw. der Aufnahme sonst noch alles hinzugefügt wurde, haben ihre Entsprechungen in der älteren Musik, denn was sind die Überlieferungen der Opern eines Monteverdi, eines Francesco Cavalli anderes als genau dieses, nämlich ein rudimentäres Dokumentieren im Nachhinein, das mit den differenzierten Klangwirkungen der Aufführung nur noch wenig zu tun hatte? Wer heute eine Cavalli-Oper aufführen will, muss sich dieselben Gedanken machen wie eine Band, die anhand der Songbooks einen Beatles-Song wieder aufführen will. Damit erreichen wir, drittens, ein Problem aller Vokalmusik, nämlich die Art der Deklamation, verbunden mit der Art der Notation. Anders als ein Instrument, das sich dem mathematischen Diktat der ganzen, halben, Viertelnoten einer Komposition leichter unterwerfen kann, bleibt textgebundene Musik in der Aufführung rhythmisch immer unexakt, weil das Sprechen zum Singen hinzutritt. Die Musikgeschichte hat sich dieses Phänomen zunutze gemacht, indem sie sich den Unterschied zwischen cantar parlando und parlar cantando, also zwischen sprechend Singen und singend Sprechen zu Rezitativ und Arie anverwandelt hat. Was wir in den Noten lesen, kann aber niemals das sein, was wir zu hören bekommen. Die kleinen Irregularitäten bei der Textdeklamation entsprechen der aufgeschriebenen Gesangsmelodie in keinster Weise. Notation und Interpretation klaffen weit auseinander, deutlich zu hören auch in Let it be, dessen rhythmisch völlig freie Deklamation über dem schematischen Rhythmus der Begleitung keine Notationsweise mit Synkopen und Überbindungen exakt aufzeichnen kann. Der Versuch, diese freie musikalische Deklamation in exakter Notation wiederzugeben, scheitert grandios – und wirft ein Licht auf die wahrscheinliche Interpretation von Vokalmusik der Vergangenheit, die doch 9 mathematisch so exakt in unserer gängigen Notation dokumentiert ist. Monteverdis Orfeo, Bachs Evangelist oder Wagners Hans Sachs dürften sich in ähnlicher Weise von der notierten Musik entfernt haben. Die Arbeitsweise der Beatles wirft viertens auch grundsätzliche Fragen über die Kompositionsweise auf, die weit in die Geschichte zurückreichen – auch in der Vergangenheit gab es nicht nur das stille Kämmerlein des Originalgenies, sondern auch die Gemeinschaftsarbeit, bei der am Ende nicht mehr zu klären war, wer wen wann wozu inspiriert hatte. Das betrifft die symbiotische Zusammenarbeit zwischen Textdichter und Komponist wie etwa im Falle Da Pontes und Mozarts ebenso wie die nach außen hin eher asymmetrische musikalische Partnerschaft von Fanny und Felix Mendelssohn. Und selbst bei den ureigensten Fragen einer Musikwissenschaft als philologischer Disziplin gibt es fünftens interessante Parallelen zu dem Umfeld der BeatlesPhilologie: Wer die gerade einmal wieder aktuelle Diskussion um die richtige Wiedergabe von Operntexten jenseits der Partitur verfolgt, der erlebt dort nichts anderes als was die Darstellung der Beatles-Songtexte in den zahllosen Internetforen charakterisiert. In beiden Fällen steht die Frage im Vordergrund, ob gesungene Texte zu metrisch korrekten Strophen zusammengefasst werden sollen oder Wort für Wort aufgeschrieben, wie sie gesungen werden, mit allen Wiederholungen, die die Vertonung so mit sich bringt, ob also, um ein zugegebenermaßen drastisches Beispiel zu nennen, in der Textedition von Mozarts c-Moll-Messe stehen sollte: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, oder: Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, eleison Kyrie eleison, eleison, eleison, eleison, eleison und so fort. Blickt man etwa auf die verschiedenen Textdarstellungen von Let it be in den zahllosen Internetforen, dann findet man genau dasselbe Problem, für das es keine Lösung, sondern nur begründete Entscheidungen gibt. Ich habe einmal durchgezählt: Die Textdarstellung allein des Schlusses von Let it be schwankt zwischen 34 und 73 Wörtern, je nachdem ob jedes Oh und Yeah dokumentiert wird, und jede Wiederholung des Refrains. Und schließlich zeigt sich sechstens auch an Let it be ein Problem, dem sich jedes Strophenlied zu stellen hat – ganz gleich, ob es sich um ein mittelalterliches Minnelied, einen Lutherchoral oder eine Ballade aus dem 19. Jahrhundert handelt – den Umgang mit den immer neuen Textstrophen bei gleichbleibender strophischer Melodie. Was wird aus dem textausdeutenden Halbtonschritt der „words of wisdom“, wenn er in der zweiten und dritten Strophe auf andere Wörter trifft? All das rührt an Grundfragen der Musikwissenschaft, von denen jede einzelne einer längeren Betrachtung wert wäre. Und natürlich heischt eine solche Betrachtung nach einer Antwort auf die Frage, warum derartige Grundfragen ausgerechnet über einen Popsong eingebracht werden sollten. Gibt es nicht genügend weniger triviale Musik, an der diese Phänomene diskutiert werden können? Tatsächlich tut sich die Musikwissenschaft schwer, das Grundsätzliche auch im Trivialen zu suchen. Die Berührungsängste sind groß; und es ist vielleicht sogar nicht einmal Zufall, dass der Sammelband „Studien zur Trivialmusik des 19. Jahrhunderts“ im Jahre 1967 herauskam, also just in der Dekade entstand, in der die Beatles die musikalische Welt nicht nur der Jugendkulturen, sondern auch der Intellektuellen eroberten. In seinem Vorwort verwies der Herausgeber Dahlhaus sogar auf den „Kunstbegriff der romantischen Theorie“, der für die Ausgrenzung der vermeintlich niederen oder auch nur funktionalen Musik verantwortlich sei, und zitierte einen Autor, für den es eine 10 „unselige Anmaßung“ war, Trivialmusik nach Kriterien zu beurteilen, die von Kunstwerken abstrahiert waren. Auch Dahlhaus selbst bezeichnete die Musikwissenschaft als nicht zuständig für triviale Musik, wohlgemerkt die des 19. Jahrhunderts, und stellte sie der poetischen, Originalität voraussetzenden Musik gegenüber. Trivialmusik, so Dahlhaus, sei an die Gegenwart gebunden, und er fügte hinzu: Zitat: „Sein Wesen zeigt das Triviale in dem Augenblick, in dem es seine Daseinsform, die Aktualität, verliert.“ Sprecher: Umgekehrt könnte das allerdings auch heißen: Klassiker, die das Stadium der Zeitgebundenheit, der Aktualität, überwunden haben, können trivial nicht mehr sein. Das gilt auch für die Beatles. Und deshalb möchte ich mich jetzt mit einer siebten Frage beschäftigen, die ein grundsätzliches Problem jeder Musik beschreibt und sich auch in Zusammenhang mit Let it be stellt – die Frage nach der Schlussbildung. Die Kunst des Aufhörens ist ein schwieriges Geschäft, nicht nur, aber auch und besonders in der Musik. Das richtige Timing ist von entscheidender Bedeutung, die Frage, ob man sich, wie Joseph Haydn in seiner Abschiedssinfonie, allmählich aus dem musikalischen Zusammenhang herausschleicht oder ob man, wie Beethoven in seiner V. Sinfonie, mit einer Serie immer neuer Schlussakkorde eine Zäsur zwischen dem Klang des musikalischen Werks und der Stille danach nach Art eines Dampfhammers in die Wahrnehmung der Zuhörer rammt. Es gibt abrupte und nicht endenwollende Schlüsse, beiläufige und pointierte, laute und stille, wehmütige und froh gestimmte. Und sie sind wichtig für das Verständnis nicht nur dieses Schlusses, sondern auch für das Verständnis der gesamten Komposition. „Finis est principalissima pars cantus“ - das Ende ist der hauptsächlichste Teil der Melodie – so hat es ein Musiktheoretiker zu Beginn des 14. Jahrhunderts formuliert. Der Zuhörer muss auf den Schluss vorbereitet werden, muss wissen, wann das Stück zu Ende ist. Nur dann bekommt der Schluss jene Funktion, die das Framing, die Rahmung des musikalischen Ereignisses als einer besonderen Form der künstlerischen Erfahrung, vollendet. Für den Popsong stellt sich die Frage nach dem Aufhören noch in einer besonderen Weise, ist ihm doch die gern genutzte Möglichkeit des Fadeout, des Ausblendens eigen – ein Aufhören, dass sich dem Entschluss aufzuhören verweigert und die Technik erledigen lässt, was die Musik selbst nicht zustande bringt. „Hey Jude“ etwa, nur kurz von „Let it be“ entstanden, endet mit einem Fadeout von vollen 2 Minuten. Da ist die Schlussbildung von „Let it be“ von anderem Schlag, und ich erlaube mir noch einige wenige analytische Bemerkungen, bevor ich dann selbst zum Schluss komme. Ich habe den Begriff des Framing, der in der Kulturanthropologie, namentlich der Ritualforschung, so gefeiert wird, mit Bedacht gewählt. Denn Let it be wird von einer Reihe von Klavierakkorden eingerahmt, die zu Beginn die Voraussetzungen für den gesungenen Part schaffen, den gesamten Song dann strukturieren und stützen und am Schluss das Ende markieren. Diese Akkordprogression mit dem bereits erwähnten plagalen Schluss zieht sich wie ein Ostinato durch das gesamte Stück. Und sie enthält ein kleines melodisches Detail, nämlich die vier absteigenden Noten a-g-f-e in der Oberstimme der rechten Hand des Pianisten am Schluss, die im 11 Verlauf des Songs große Wirkung entfalten werden: Musik 6: John Lennon / Paul McCartney: „Let it be“ (s.Musik 1) Ausschnitt: 0„20 Sprecher: Diese vier absteigenden Noten wurzeln in einer musikalischen Formel, die auf eine mehr als vierhundertjährige Geschichte zurückblickt und eine deutliche Konnotation besitzt – sie wurzeln in nichts Geringerem als dem sogenannten Lamentobass, den Claudio Monteverdi einst als instrumentale Ostinatoformel im „Lamento della Ninfa“ erfunden hatte, und der sich über Jahrhunderte hinweg den Status eines Emblems für Klage und Trauer, für Abschied erworben hatte, bei Bach und Mozart, Schubert und Bruckner gleichermaßen präsent und auch in der Popmusik ebenso gern verwendet wird wie der walking bass, ebenfalls eine Erfindung Monteverdis. Dieses absteigende Tetrachord erklingt nun alle vier Takte, es markiert das Ende jeder Textstrophe sowie jedes Refrains; und es entfaltet eine besondere Wirkung vor dem instrumentalen Zwischenspiel und ganz am Ende. Dort nämlich werden drei absteigende Tetrachorde hintereinander zu einer neun Töne langen absteigenden Melodie zusammengestaucht: Musik 7: John Lennon / Paul McCartney: „Let it be“ (s. Musik 1) Ausschnitt: 0„20 Sprecher: Im Verhältnis zu einem zweiminütigen Fadeout, aber auch zu diversen apotheotischen Schlusswirkungen in anderen Songs mutet dieser Schluss kurz und knapp, wenn auch gut vorbereitet an, und er bleibt dennoch irgendwie in der Luft hängen. Ein Ritardando ist nötig, um deutlich zu machen, dass der Song hier wirklich zu Ende ist und nicht etwa in die nächste strophische Runde geht. Es ist hier gewiss nicht der Ort, eine Geschichte des Schlusses in der Musik zu entwerfen. Dennoch sei ein kurzer Blick auf die unterschiedlichen Konzepte des Aufhörens erlaubt. Im Mittelalter musste ein Musikstück mit einem perfekten Schluss enden, alles andere wäre undenkbar gewesen. Und noch zu Zeiten, als die Rhetorik sich der Musik bemächtigte, war der Punkt am Ende des Satzes auch für die Musik verbindlich – und nicht einmal das Ziel der Komposition. Johann Mattheson schrieb hierzu in seinem Vollkommenen Kapellmeister im Jahre 1739: Zitat: „Wie nun der Punkt alles beschließet, so soll dessen Betrachtung auch den Anmerckungen dieses Haupt-Stückes anitzo ein Ziel setzen. Und ob er gleich unter den Einschnitten der Klangrede der grösseste ist, fällt doch in der Melodie das wenigste dabei zu beobachten vor. Denn man hat weiter nicht zu thun, als an dem Ort, wo der Punct (in der Rede) befindlich ist, eine förmliche Cadentz, eine rechte vollkommene Clausel, und letztlich einen gäntzlichen Endigungs-Schluss im Hauptton anzubringen.“ Sprecher: Die Kadenzharmonik, der dreiteilig zyklische Sonatensatz lebten von dem Grundvertrauen in eine Rückkehr in die Haupttonart, egal wie weit man sich im Mittelteil davon entfernte. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts aber ging diese 12 Gewissheit verloren, und das Beschließen einer Komposition wurde in dem Maße problematischer, in dem die präfigurierten Formen als Modelle verschwanden. Nun musste sich jeder Komponist seine eigenen Gedanken darüber machen, wie er sein Stück zu Ende brachte. Dabei wurde die Erkenntnis immer wichtiger, dass das Aufhören etwas anderes als ein Schluss ist. Musik 8: Salvatore Sciarrino: „Vanitas“ Sonia Turchetta, Sopran Rocco Fillippini, Violoncello Andrea Pastalozza, Klavier Myto Records, Best.-Nr. MCD 1015 Ausschnitt: 0‟45 Sprecher: Ein Extrembeispiel wäre etwa das Ende von Salvatore Sciarrinos Vanitas von 1981 – ein vier Minuten langes Abwärtsglissando auf dem Cello, schnurstracks, aber doch schier endlos gedehnt ins Nichts abgleitend wie das irdische Leben. Von einem formellen Schluss, von einem Punkt kann hier nicht die Rede sein, eher schon von einem Aufhören, hinter dem sich durchaus noch ein Weitermachen, eine Öffnung in eine andere Welt, ein neuer Anfang in einem anderen Zustand verbergen kann. Eigentlich war es Zufall, dass Let it be der letzte Song der Beatles werden sollte. Aber es zeigte sich, dass er sich bestens eignete, das Aufhören zu markieren, es mit einer besonderen Aura zu umgeben. Mit ihm hörten die Beatles als Gruppe auf zu existieren. Paul McCartney hatte einen guten Zeitpunkt für das Aufhören gefunden, bevor der innere Zerfall der Marke Beatles sich auch hörbar auf ihre künstlerische Produktion auswirkte. Allerdings war Let it be zwar ein Aufhören, aber kein Schluss. Jeder der Fabulous Four startete danach eine erfolgreiche Solokarriere. Wie müssen wir also das Ende von Let it be verstehen? Ist es ein simpler Schusspunkt? Oder lebt der Song von einer Kunst des Aufhörens, die weniger Gewissheit vermittelt als man von einem Ende erwarten dürfte? Von einer förmlichen Kadenz, einer vollkommen Klausel einem gänzlichen Endigungs-Schluss kann bei der plagalen Kadenz von Let it be nur bedingt die Rede sein. In Zeiten der klassischen Kadenzharmonik, die von der Leitton-Spannung und der gleichsam erlösenden Ankunft in der Grundtonart lebt, ist dem plagalen Schluss immer auch etwas Offenes, nicht ganz Aufgelöstes, Fragendes eigen, eine Ahnung davon, dass dies noch nicht das Ende gewesen sein kann. Die plagale Kadenz ist musikalisch nicht minder offen als die Aussage des Textes: Das Sich Anheimgeben an das, was nicht zu ändern ist, die Trauer darüber, dass die Welt so ist, wie sie ist, Neugier, was da kommen wird, wenn man die Dinge geschehen lässt, Vertrauen darauf, dass es gut sein wird. Muss es sein? Es muss sein! Lass es geschehen. Lass es zu. Das ist im Song nicht anders als im Leben. Musik 9: John Lennon / Paul McCartney: „Let it be“ The Beatles (remastered version) LC 0299 Parlophone, Best-Nr. 2438072 13 3:50 Literaturangaben: Carl Dahlhaus, Vorwort, in: Studien zur Trivialmusik des 19. Jahrhunderts, hrsg. von Carl Dahlhaus, Regensburg 1967, S. 11. Clemens Kühn, Analyse lernen (Bärenreiter Studienbücher zur Musik 4), Kassel 1993, S. 186 Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister 1739. Faksimile-Nachdruck hrsg. von Margarete Reimann, Kassel 1954, S. 195. Riemann Musiklexikon, Sachteil hrsg. von Hans Heinrich Eggebrecht, Mainz 1967, S. 1008. 14