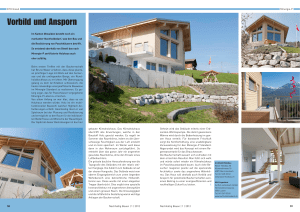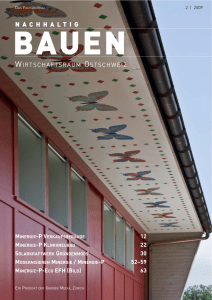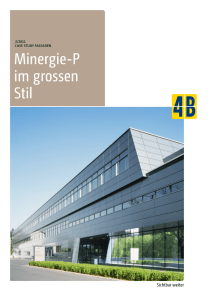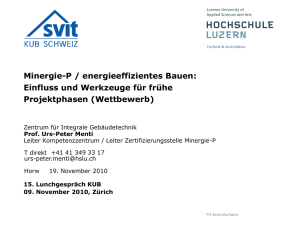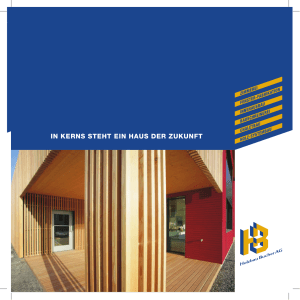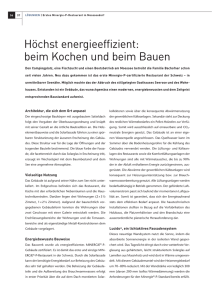nachhaltig Bauen
Werbung

DAS FACHJOURNAL ACHJOURNAL 32 || 2010 2009 N AC H H A LT I G BAUEN IM K A N TO N Z Ü R I C H MINERGIE-P-ECO WOHNÜBERBAUUNG SUNNYWATT 13 MINERGIE-P-ECO GESCHÄFTSHAUS «ESSLINGER DREIECK» 23 MINERGIE-P MODERNISIERUNGEN 52 / 60 / 63 SOLARSTROM VOM EIGENEN DACH 56 EIN PRODUKT DER GERBER MEDIA, ZÜRICH Inhalt Fachbeiträge Titelbild: Minergie-P-ECO Geschäftshaus «Esslinger Dreieck» Impressum Herausgeber Gerber Media Rütihofstrasse 9, 8049 Zürich Telefon 044 341 16 41 www.gerbermedia.ch Grafik / Layout Andreas Merz Ahornstrasse 15, 5442 Fislisbach Telefon 056 535 01 48 [email protected] Redaktion Gerber Media www.gerbermedia.ch 4 Mehr Wohnkomfort und Lebensqualität 56 Solarstrom vom eigenen Dach 72 Entwicklung Minergie im Kanton Zürich Objektvorstellungen 6 Minergie-P DEFH Kilchberg 13 Minergie-P-ECO Wohnüberbauung SunnyWatt 23 Minergie-P-ECO Bürogebäude «Esslinger Dreieck» 28 Minergie-P MFH Speerstrasse Zürich Gastautoren Markus Kägi Regierungsrat, Vorsteher der Baudirektion Kanton Zürich Präsident BPUK 34 Minergie-P EFH Ettenhausen (Wetzikon) Franz Beyeler Geschäftsführer MINERGIE 52 Minergie-P Modernisierung Bertschikon Fotos Fotostudio André Huber Klosterstrasse 40, 5430 Wettingen www.fotohuber.ch 60 Minergie-P Modernisierung Segantinistrasse Zürich Druck EFFINGERHOF AG Storchengasse 15, 5201 Brugg www.effingerhof.ch Gedruckt auf FSC Papier (Rohstoff: Frischfasern aus nachhaltiger Forstwirtschaft) Bleichung: efc Einzelverkaufspreis CHF 14.– Rechte: Copyrights bei Gerber Media, 8049 Zürich. Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Verlages. NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 42 Minergie-P EFH Andelfingen 46 Minergie-P EFH Wildberg 63 Minergie-P Modernisierung Birmensdorferstrasse Zürich 68 Minergie Neubau Kleintierklinik Zürich Rubriken 40 Innovationen, Redaktionelle Partner 76 Innovationen, Ingenieure und Planer 77 Führende Unternehmen im Kanton Zürich 1 KANTON ZÜRICH «Im nachhaltigen Bauen steckt ein Gedanke, der aufs Ganze gerichtet ist.» Markus Kägi Regierungsrat, Vorsteher der Baudirektion Kanton Zürich Präsident BPUK Der Kanton Zürich macht seinem Ruf als «Millionenkanton» wieder einmal alle Ehre: In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres sind bei uns über eine Million Quadratmeter beheizte Nutzfläche in MinergieQualität zertifiziert worden. Damit wird eine Erfolgsgeschichte weitergeschrieben, die nicht nur von beeindruckenden Zahlen berichtet, sondern auch von einer bemerkenswerten Entwicklung in qualitativer Hinsicht. Das Erlebnis des guten Wohnens ist für den Menschen zweifellos auch eine Frage von Kilowattstunden und Franken und Rappen, entscheidender ist aber wohl der Komfort und das Leben in einer gesunden Umgebung. Dazu kommt die Gewissheit, mit seinem Entscheid für Minergie etwas für die Umwelt und die Zukunft zu tun. Minergie gewährt ein Behagen, das nicht auf der Verneinung der Umweltprobleme und einer Abschottung von der Wirklichkeit beruht, sondern im Gegenteil auf der entschlossenen Haltung, etwas gegen Klimaerwärmung und Energieverschleiss tun zu müssen und tun zu können. Wer in einem Minergie-Gebäude wohnt oder arbeitet, lebt nicht auf einer Insel, sondern offenen Auges mitten in unserer heutigen Welt mit ihren ganz spezifischen Herausforderungen. Anhand des Erfolgs des Minergie-Standards lässt sich zeigen, dass nachhaltiges Bauen mehr bedeutet als eine Summe von Einzelmassnahmen und einen Katalog von Vorteilen – so eindrücklich dieser Katalog auch sein mag. Im nachhaltigen Bauen steckt ein Gedanke, der aufs Ganze gerichtet ist. Das ist ein riesiger Fortschritt gegenüber eiNACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 ner Vergangenheit, in der mit der Überzeugung gebaut wurde, die Ressourcen seien unerschöpflich und es sei statthaft, Lebensqualität einseitig auf der Basis der Verschwendung zu realisieren. Nun wäre es aber verfehlt, das nachhaltige Bauen nur als Konzept der Zukunft zu verstehen. Vor den besagten verschwenderischen Zeiten lagen andere, in denen das Wissen um die Beschränktheit der Ressourcen durchaus vorhanden war und das Bauen prägte. Nur dass dieses Bewusstsein zu gänzlich anderen baulichen Lösungen führte: kleinen geheizten Kammern etwa, die an eiskalte Säle grenzten – für jede heutige Energiefachperson ein Gräuel, aber immerhin ein Konzept, das mit vergleichsweise wenig Energie auskam. Manche Zeugen jener Zeiten stehen noch, und sie stellen einen beträchtlichen kulturellen Wert dar. Wenn wir ihnen zugestehen, auf ihre Weise im Sinn und Geist des nachhaltigen Bauens realisiert worden zu sein, dann schulden wir ihnen auch deswegen Respekt. Von Ersatzneubauten zu reden, schliesst sich in diesen Fällen von selbst aus. Wenn wir mit unserer heutigen Auffassung von Nachhaltigkeit auf ein Gebäude wie das Kloster Rheinau mit seinen fünfhundert Zellen zugehen, um es einer neuen Nutzung zuzuführen, dann stehen wir vor einer grossen Herausforderung. Wir können aber davon ausgehen, dass das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit keineswegs bedeutet, dass wir alles einreissen und neu bauen müssen – und dabei auch noch gleich eine neue Gesellschaft erfinden –, sondern vielmehr, dass wir an Vergangenes anschliessen und unsere Kritik auf jene Epochen konzentrieren können, in denen der Sinn für die Ganzheit der Lebenszusammenhänge und die Verantwortung für die Zukunft von geringer Bedeutung waren. ■ 3 EDITORIAL Mehr Wohnkomfort und Lebensqualität Der Kanton Zürich ist sozusagen die Heimat des fortschrittlichen Baustandards Minergie: Seine «Väter», Ruedi Kriesi und Heinz Uebersax, stammen beide aus dem Kanton Zürich. Es kann daher nicht erstaunen, dass Minergie im Kanton Zürich besonders gut vertreten ist: Allein im laufenden Jahr 2010 wurden hier bereits eine Million QuadratFranz Beyeler, meter nach Minergie zertifiziert. Geschäftsführer Insgesamt stehen im Kanton ZüMINERGIE rich 4453 Gebäude, die das Minergie-Zertifikat tragen – und es werden immer mehr. Dazu trägt insbesondere die gute und enge Zusammenarbeit von Minergie mit der Baudirektion des Kantons Zürich bei. Im zürcherischen Opfikon steht mit dem «Portikon» das derzeit grösste Minergie-P-Geschäftsgebäude. Nur gerade 500 Meter weiter findet sich das Geschäftsgebäude Leo- nardo, seinerzeit grösstes Minergie-Gebäude. Auch punkto Minergie-Modernisierungen schrieb der Kanton Zürich Geschichte: Im Jahr 2002 erhielt das ehemalige SwissairGebäude auf dem Balsberg nach umfassender Modernisierung das Minergie-Zertifikat. Ein viel beachtetes Projekt ist auch die Ersatzneubausiedlung Brunnenhof beim Bucheggplatz: Sie wurde vom Architektenbüro Gigon/Guyer als erste Minergie-Eco-Wohnsiedlung der Stadt Zürich realisiert – im Auftrag einer Wohnbaugenossenschaft, die Wohnungen für kinderreiche Familien anbietet. Letzteres ist ein gutes Beispiel dafür, dass Minergie im wahrsten Sinne des Wortes für alle da ist: Es ist weder ein exotischer Baustandard für Öko-Freaks noch ein Luxus für gut Betuchte. Minergie lässt sich mit relativ wenig zusätzlichem (finanziellem) Aufwand realisieren, ganz besonders im Neubau. Oft berichten Bauherren und Architekten gar, dass Förderbeiträge die Mehrkosten für den Standard aufgewogen hätten. Schützenhilfe erhalten Bauherren derzeit insbesondere durch das Gebäudeprogramm, das Anfang 2010 von Bund und Kantonen lanciert wurde. V.l.n.r.: Franz Beyeler, Geschäftsführer MINERGIE übergibt das Minergie-P Zertifikat ZH-036-P an die Macher des «Portikon»: Kai Bender, Geschäftsführer Acron AG, Dr. Ralf Bellm, VR-Präsident, Hochtief Development Schweiz AG und Daniel Moll, CEO Erne AG. 4 NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 Die Wohnsiedlung Brunnenhof in Zürich wurde nach dem fortschrittlichen und ökologischen Baustandard MINERGIE-ECO neu erstellt. Die 72 Wohnungen der «Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien» bieten mehrköpfigen Familien viel Raum und Komfort bei tiefem Energieverbrauch. MINERGIE-ECO ZH-004. Ein Minergie-Gebäude bietet mehr Lebensqualität bei deutlich tieferem Energieverbrauch, verglichen mit einem konventionell erstellten Gebäude (Baujahr älter als 2008). Es zeichnet sich aus durch bessere Werterhaltung und Wirtschaftlichkeit und ist langfristig günstiger im Betrieb, vor allem wegen des effizienten Heizsystems und der fortschrittlichen Gebäudetechnik. Vom Standard profitieren Besitzer und Bewohner der Gebäude gleichermassen wie die Umwelt. Zudem ist Minergie auch Wirtschaftsförderung: Dank dem Standard wurden innerhalb von zwölf Jahren rund 2,1 Milliarden Franken zusätzlich investiert – notabene in die Nachhaltigkeit und den Wohn- und Arbeitsplatzkomfort. Auch im Kanton Zürich verdienen Gewerbetreibende mit Minergie gutes Geld: Hier gibt es schweizweit die meisten Minergie-Fachpartner, nämlich rund 250 von insgesamt zirka 1300 Betrieben. Architekten, Planer, Bauausführende und Hersteller profilieren sich dank Minergie als fortschrittliche Unternehmer und sprechen eine anspruchsvolle, aufgeschlossene und qualitätsbewusste Kundschaft an. In Zukunft erst recht. ■ ZH-036-P Bürogebäude Portikon in Opfikon. Den Namen «PORTIKON» erhielt das MINERGIE-P Gebäude in Abwandlung des Ortsnamens «Opfikon» und «Port». Das rührt von historischen Plänen her, einen Zeppelin-Hafen, oder Port, zu erreichen. Für rund 800 Arbeitsplätze wurde auf einer Nutzfläche von 16 790 Quadratmetern ein ebenso angenehmer wie nachhaltig gestalteter Arbeitsraum geschaffen. NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 5 KILCHBERG Luxuriös und ökologisch wohnen Die Lage in Kilchberg ist fantastisch: Am Rande des Baugebietes, unverbaubar am Ende einer Moräne, welche der Linth-Gletscher liegen liess, mit See- und Alpenpanorama. Der Neubau ersetzt ein bescheidenes Einfamilienhaus aus den dreissiger Jahren. 6 NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 MINERGIE-P Die Bauträgerin, Frau Anita Ilse Geiger, die Jahrzehnte in diesem Haus gelebt hat, entschloss sich vor drei Jahren ins Altersheim zu ziehen und beauftragte ihren Sohn Thomas Geiger einen Neubau zu organisieren, der zeitgemässen, familienfreundlichen Wohnraum bietet. Thomas Geiger wählte die Zusammenarbeit mit archipel – Planung und Innovation für das Projekt. NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 Das Grundstück erlaubte eine Verdichtung. Der Wunsch der Bauträgerschaft, hohe Wohnqualität mit einem minimalen ökologischen Fussabdruck zu schaffen, führte zum Programm: zwei Wohnungen mit einer nicht verschwenderischen Grösse, die vom Garten und der Aussicht profitieren, dauerhafte wertige Materialien, eine ausgefeilte Gebäudetechnik mit minimalen Verbräuchen – 7 KILCHBERG MINERGIE-P luxuriös und ökologisch wohnen an der Nidelbadstrasse. Das Doppelhaus vermittelt mit seiner Geometrie zwischen den verschiedenen Richtungen des heterogenen baulichen Umfelds. Die Reihenhäuser treten zugunsten einer grosszügigen Gestalt nicht als solche in Erscheinung. Eine geschindelte, geschwungene Holzfassade umfasst sie. Eine Lasur mit einem gold-metallischen Pigment überzieht die Schindeln und verweist mit einem Augenzwinkern auf das Privileg der Lage an der Silberküste. ■ Nachhaltig bauen Die hohen ökologischen Anforderungen bestimmten die Konzeption, Detaillierung und technische Ausstattung des Projekts. Das kompakte Volumen, ohne Vorsprünge fügt sich mit minimalem Aushub ins Gelände. Der betonierte Sockel ist rundum gedämmt (XPS-Perimeterdämmung). Die oberirdischen Aussenwände sind vorfabrizierte Holzelemente. Ihre Fertigung im Werk ermöglichte die schwierige Geometrie mit unterschiedlichen Radien. Sie dienten geschossweise als «verlorene Schalung» für die betonierten Decken. Die Holz-Metall-Fenster sind dreifach verglast und mit einem textilen Sonnenschutz beschattet. Die zweischalige Trennwand aus Beton teilt die beiden Häuser; die restlichen inneren Wände sind nichttragende Leichtbauwände. Grosse zentrale Schachtzonen erschliessen Bäder und Küchen. Die Zuluft und das thermoaktive Bauteilsystem (TABS) sind in den Decken einbetoniert. Die dicken Decken (26 cm) haben keine Unterlagsböden. Sie dienen als Speichermasse und führen im Winter die benötigte Wärmeenergie ins Gebäude und kühlen es im Sommer. In den Untergeschossen und Bädern bildet ein fugenloser, eingefärbter Hartbetonboden im Verbund mit der Betondecke den Fertigbelag. In den Obergeschossen ist es ein Eichenparkett. Die Einbauten, Tür- und Fenstereinfassungen, Sockel und Abdeckungen sind aus dauerhaften und natürlichen Materialien: massiver Eiche und Kunststein. Jedes Haus verfügt über eine autonome Haustechnik, Erdwärmesonden liefern das ganze Jahr ein konstantes Temperaturniveau. Im Sommer kühlt es über die TABS im Free Cooling (kein Betrieb der Wärmepumpe) das Gebäude, im Winter sichert eine Wärmepumpe das Temperaturniveau der TABS und des Warmwassers. In die Attikawand eingelassene Vakuumröhrenkollektoren unterstützen das System bei der Erzeugung des Warmwassers. Die Häuser sind jeweils mit einer individuell bedienbaren Lüftung mit Wärmerückgewinnung ausgestattet. Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach deckt im Jahresverlauf den gesamten Stromverbrauch der haustechnischen Anlagen, der Heizung, Lüftung und der Warmwasserproduktion. Die NullHeizenergiehäuser sind Minergie-P-zertifiziert. Bauherrschaft Thomas Geiger Hardturmstrasse 269 8005 Zürich 8 Architektur archipel - Planung und Innovation GmbH Hardturmstrasse 261 8005 Zürich Tel: 044 563 86 80 www.archipel.ch HLK-Ingenieur hässig sustech gmbh Ingenieurbüro Weiherallee 11a 8610 Uster Tel. 044 940 74 15 www.sustech.ch NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 9 ELEKTRIZITÄTSWERKE DES KANTONS ZÜRICH Mehr Stromeffizienz im Mehrfamilienhaus Mehrfamilienhaus-Eigentümer und -Bewohner profitieren vom neuen EKZ Umwelt-Förderprogramm «Stromeffizienz im Mehrfamilienhaus». Ausgangslage ist eine energetische Beurteilung der an den Allgemeinstrom angeschlossenen elektrischen Verbraucher. Förderaktionen motivieren zum Ersatz ineffizienter Geräte und Installationen. In der Schweiz werden jährlich rund 60 Terawattstunden oder 60 Milliarden Kilowattstunden (KWh) Strom verbraucht, Tendenz steigend. Der zunehmende Verbrauch 10 hebt die Stromkosten. Direkten Einfluss darauf hat jeder im Privaten, etwa in der eigenen Wohnung. Man kann Standby-Betrieb vermeiden, Elektrogeräte clever nutzen oder energieeffiziente Leuchtmittel einsetzen. In Mehrfamilienhäusern wird neben dem privaten auch sogenannter Allgemeinstrom verbraucht. Er fliesst beispielsweise in die Treppenhausbeleuchtung, den Heizungsraum oder die Waschküche. In diesen Bereichen ist häufig nicht die energieeffizienteste technische Lösung im Einsatz – das bedeutet unnötig hohe Nebenkosten für alle Bewohner. NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 PUBLIREPORTAGE serung der Stromeffizienz werden in einem Bericht festgehalten. Vom Stromcheck profitieren auch die Bewohner des Hauses. An alle Haushalte einer teilnehmenden Liegenschaft wird eine EKZ Stromsparbox verteilt. Diese enthält neben einer modernen, stromsparenden LED-Lampe wertvolle Tipps, wie jeder Mieter ohne Komfortverlust seinen Stromverbrauch senken kann. Wenn der Hauseigentümer einen EKZ Stromcheck bestellt, erhält jeder Mieter von den EKZ eine solche Stromsparbox. Stromeffizienz im grossen Stil Um die «Stromeffizienz im Mehrfamilienhaus» zu steigern, haben die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) ein gleichnamiges Umwelt-Förderprogramm lanciert. Finanzielle Anreize motivieren die Eigentümer von Mehrfamilienhäusern, Stromfresser in ihren Liegenschaften aufzufinden und ineffiziente Beleuchtungsanlagen sowie Haushaltsgrossgeräte zu ersetzen. Der Einstieg in das Förderprogramm ist der EKZ Stromcheck, eine vergünstigte Energieberatung. Ineffizienz aufspüren Mit dem EKZ Stromcheck erhält der Hauseigentümer für 100 Franken pro Liegenschaft eine energetische Bewertung der an den Allgemeinstrom angeschlossenen Verbraucher. Ein EKZ Energieberater erfasst vor Ort den Istzustand der Anlagen und überprüft die Einstellwerte der Steuergeräte. Speziell die Beleuchtungseinrichtungen, zum Beispiel im Treppenhaus, werden genau unter die Lupe genommen. Die möglichen Massnahmen zur Verbes- EKZ Stromcheck als Zugang zu Förderaktionen Die Durchführung des EKZ Stromchecks berechtigt zur Teilnahme an verschiedenen Förderaktionen. Finanzielle Beiträge werden für den Ersatz alter, zur Liegenschaft gehörender Haushaltsgrossgeräte und für die energetische Modernisierung der allgemeinen Beleuchtungsanlagen gezahlt. Für die Haushaltsgrossgeräte gilt: Es werden ausschliesslich neue Geräte der höchsten Energieeffizienzklasse gefördert, welche bei Topten (www.topten.ch) aufgeführt sind. Wäschetrockner und Waschmaschinen fördern die EKZ pro Gerät mit bis zu 500 Franken. Bei effizientesten Kühl- und Gefriergeräten profitieren die Hauseigentümer von maximal 450 Franken Förderung pro Gerät. Im Bereich der Beleuchtungsanlagen werden der Leuchtenersatz sowie der Einbau einer Lichtsteuerung gefördert. Beim Leuchtenersatz werden Leuchten mit eingebautem elektronischen Vorschaltgerät mit maximal 75 Franken pro Leuchte unterstützt. Bei der Lichtsteuerung wird die Installation von Bewegungsmeldern mit 75 Franken pro Gerät und der Einbau einer Minuterie mit 200 Franken pro Anlage gefördert. Wie weiter? Förderberechtigt sind Eigentümer von Mehrfamilienhäusern mit mindestens drei Wohneinheiten, die von den EKZ mit Strom versorgt werden. Das Anmeldeformular für den EKZ Stromcheck und weitere Informationen können unter www.ekz.ch/umwelt-foerderprogramm abgerufen oder telefonisch unter der Nummer 058 359 11 13 angefragt werden. ■ Elektrizitätswerke des Kantons Zürich Energieberatung Dreikönigstrasse 18 Postfach 2254 8022 Zürich Telefon 058 359 11 13 www.ekz.ch/umwelt-foerderprogramm [email protected] NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 11 12 NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 WOHNÜBERBAUUNG SUNNYWATT MINERGIE-P-ECO Leben im Einklang mit der Sonne Carmen Eschrich SunnyWatt – so betitelte Architekt Kämpfen sein jüngstes Pilotprojekt der Solararchitektur. Sonne liefert kostenlose Energie, man muss sie nur in «Watt» umrechnen können und nutzbar machen. Die Minergie-P-ECO Wohnüberbauung in Watt, Nähe Zürich, macht genau dies: Die Häuser brauchen keine Energie von aussen – die Nullenergieüberbauung setzt neue Massstäbe … Es wird viel gebaut in Watt, so auch um die Nullenergiesiedlung SunnyWatt. Doch sie unterscheidet sich von den Nachbarn mit einem einfachen und logischen Konzept – sie «baut» auf Solararchitektur. Der sonnige, leicht geneigte Südhang scheint wie geschaffen für die «kluge» Siedlung. Sie setzt sich prinzipiell aus zwei parallelen Gebäudereihen zusammen. Die hintere und somit höher am Hang stehende Häuserreihe wurde 4-stöckig erstellt, die vordere nur 2-stöckig. Dazwischen liegt ein Innenhof, der dem Sonnenertrag der Wohnungen maximierend proportioniert ist – so erreichen auch die flach geneigten Sonnenstrahlen im Winter die «ungünstigste» Lage im Grundriss, das Erdgeschoss der hinteren Gebäudezeile. NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 13 WOHNÜBERBAUUNG SUNNYWATT Verschiedene Wohnformen für unterschiedlichste Nutzer Unterschiedliche Wohnformen sprechen eine breite Nutzerschaft an und versprechen gute Durchmischung. Entsprechend setzte man auf ein breites Angebot: Die obere Grundstücksgrenze markierend sitzt eine Landmarke mit vier übereinanderliegenden Geschosswohnungen. Daran schliessen, mit einem offenen, jedoch witterungsgeschützten Treppenraum, zweigeschossige Attika – und Maisonettwohnungen an. Die vordere Gebäudezeile setzt sich aus sieben Reihenhäusern zusammen. Die Grundstücksgrösse wurde wirtschaftlich ausgenützt, wobei bei der hohen Dichte noch viel Raum für Grün und Privatsphäre bleibt. Gemäss diesem Konzept hat jeder Bewohner – wie in einem Einfamilienhaus – seine eigene Eingangstüre, die er über Laubengänge oder den halböffentlichen Raum von aussen erreicht. Freiraum, Aussenraum und Natur Nachhaltigkeit endet nicht hinter den eigenen vier Wänden, SunnyWatt lässt den Innenraum in den Aussenraum fliessen und bietet so Anreiz, sich in der Natur aufzuhalten. So liegen die Kellerfenster nicht vor betonierten 14 Schächten, sondern blicken auf eine begrünte Böschung, die dunklen, speicherfähigen Bodenplatten gehen praktisch nahtlos in die Terrasse über. Der Bezug zum Aussenraum ist über clever positionierte Fensteröffnungen allgegenwärtig, so kann man beispielsweise beim Abspülen in die Küche die spielenden Kinder im Hof beobachten. Geschützt können die Kinder am Spielplatz toben, der Innenhof lädt aber auch Erwachsene zum Verweilen ein. Innerhalb der Siedlung gibt es keine Autos, diese werden bereits von der Strasse in die Tiefgarage geleitet. Nachhaltige Energiequellen Solare Architektur und entsprechende Grundrissaufteilung nutzen die Sonne passiv. Demnach sind die Aufenthaltsbereiche wie Wohnen nach Süden orientiert. Kernzone bilden die Sanitär- und Erschliessungsblöcke, Nebenräume oder auch die Küche mit Blick zum Innenhof bzw. die Anliegerstrasse befinden sich im Norden. Auch aktiv wird die Sonnenenergie genutzt; das eine Dach des Geschosswohnbaues liefert über Solarkollektoren Warmwasser und die mit Photovoltaik ausgerüsteten übrigen Dächer der Wohnhäuser und Reihenhäuser versorgen mit Strom. Zusammen erwirtschaften die aktiven Dachflächen NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 MINERGIE-P-ECO NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 15 WOHNÜBERBAUUNG SUNNYWATT genug Energie, um die Siedlung autark zu machen. Die Komfortlüftung sorgt mit einem Lüftungsgerät pro Wohnung für Frischluft und gewinnt Wärme aus der Abluft. Die Wärmepumpe mit den fünf Erdsondenbohrungen liefert Energie für die Fussbodenheizung. Alles in allem bezieht die Siedlung nicht mehr Energie, als im Jahresdurchschnitt verbraucht wird und darf sich daher als «Nullenergiesiedlung» bezeichnen. Ökologie in der Materialwahl Architekt kämpfen für architektur ag Badenerstrasse 571 8048 Zürich Tel. 044 344 46 20 www.kaempfen.com 16 Energietechnik naef energietechnik Jupiterstrasse 26 8032 Zürich Tel. 044 380 36 88 www.naef-energie.ch Fenster 1a hunkeler Bahnhofstrasse 20 6030 Ebikon Tel. 041 444 04 40 www.1a-hunkeler.ch Nicht nur das Minergie-P zertifizierte Energiekonzept ist zukunftsweisend, auch die Materialwahl gestaltet sich nachhaltig. Wände, Decken und Dächer sind durchgängig aus Holz konstruiert. Lediglich die Holzraster- Geschossdecken wurden aufgrund der hohen akustischen Anforderungen im Wohnungsbau mit Beton beschwert. Holz ist CO2 neutral und zudem atmungsaktiv, seine wichtige Rolle im Gesamtkonzept sollte nicht verborgen bleiben. So blieb die statisch wirksame Dreischichtplatte in Wänden und Decken sowie im Treppenturm sichtbar – nur auf Käuferwunsch wurden einzelne Wohnobjekte mit Glasfasertapete ausgestattet. Die vorfabrizierten Holzelemente wurden vor Ort mit unbehandelten, horizontalen Holzlatten verschalt. Warm gehalten werden die kompakten Baukörper durch 40 cm Wärmedämmung im begrünten Dach und 36 cm Steinwolle in den Wänden. Ökologie, Ökonomie und Nachhaltigkeit vereinen sich hier zu einem gelungenen Gesamtkonzept, aus dem zufriedene Bewohner herausgehen. ■ NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 MINERGIE-P-ECO Kenndaten: Standard: bilanzierte Nullenergiesiedlung Energiekennzahl: 12 kWh/m2a Geschossfläch GF: 5900 m2 Kubatur nach SIA 416: 17 500 m3 Beheiztes Volumen: Haus A total 771 m2 2188 m3 Haus B total 1530 m2 4483 m3 Haus C total 705 m2 2046 m3 Haus D 531m2 1541 m3 Total Hauptbauten 3537 m2 10 258 m3 NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 17 ERDGAS ZÜRICH AG, ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN Innovatives Gemeinschaftswerk als die bisherigen dezentralen Anlagen. Neben dem Kranken- und Altersheim werden auch die in der Nähe befindliche Schulanlage Untermosen inklusive dem benachbarten Hallenbad sowie die Gebäude des Kinderheims der Stiftung Bühl und ein Kindergarten an das 1,1 Kilometer lange Verbundnetz angeschlossen. In enger Zusammenarbeit bauen die Stadt Wädenswil und Erdgas Zürich als Energiedienstleister derzeit den Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt. Dank einer Holzschnitzelheizung mit integrierter Wärmerückgewinnung wird der neue Verbund den CO2-Ausstoss um 567 Tonnen pro Jahr senken können. Seit Mai 2010 gehört Wädenswil zum Kreis der Energiestädte. Diesen Titel hat die Stadt erhalten, da sie seit mehreren Jahren eine nachhaltige Energie-, Verkehrsund Umweltpolitik verfolgt. Einen Schwerpunkt bildet die Senkung des Energieverbrauchs und des CO2-Ausstosses der stadteigenen Liegenschaften. Ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung ist die anstehende Sanierung des Kranken- und Altersheims Frohmatt. Durch die Sanierung des Gebäudes nach Minergiestandard und durch die Schaffung eines Wärmeverbundnetzes in Zusammenarbeit mit Erdgas Zürich als Energiedienstleister können der Energieverbrauch und der CO2-Ausstoss der städtischen Liegenschaften auf einen Schlag stark gesenkt werden. Denn der Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt stellt die Energie effizienter und umweltfreundlicher zur Verfügung 18 Holzschnitzel als optimale Lösung Viel Gewicht legte die Stadt Wädenswil auf die Wahl des passenden Energieträgers. Gewünscht war einerseits eine Anlage, die möglichst wenig CO2 ausstösst, zum anderen müssen in den Altbauten aber Vorlauftemperaturen von bis zu 70 Grad erreicht werden. Die Evaluation zeigte, dass eine Heizanlage mit einem grossen Holzschnitzelofen den Anforderungen am besten gerecht wird. «Durch diese Anlage können wir auch minderwertige Holzabfälle aus den umliegenden Forstbetrieben verwenden, die heute nur wenig genutzt werden», sagt Rolf Baumbach, Leiter der Werke der Stadt Wädenswil. Die Zusammenarbeit mit einem Energiedienstleister lag für ihn auf der Hand. Denn mit einer geplanten Jahresenergiemenge von 3,75 Gigawattstunden und der Belieferung von fünf Abnehmern übersteigt die Anlage die betrieblichen Möglichkeiten der Stadt: «Uns fehlt noch die Erfahrung mit solch grossen Infrastrukturanlagen, deshalb haben wir uns entschlossen, einen Energiedienstleister beizuziehen», sagt Rolf Baumbach. Auf die entsprechende Ausschreibung hin reichten drei Anbieter ein Angebot ein. Das Rennen machte die Offerte von Erdgas Zürich. Den Ausschlag gaben unter anderem der Fixpreis, der über 15 Jahre Laufzeit ohne Teuerungsanpassung garantiert wird sowie die Qualität der Offerte. Enge Zusammenarbeit Endgültig grünes Licht für die Realisierung der Anlage gaben die Wädenswiler Stimmbürger im März 2010 mit einem klaren Ja zum Wärmeverbund und zur Sanierung des Kranken- und Altersheims Frohmatt. Die Planung und die derzeit laufende Realisierung der Anlage erfolgen in enger Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wädenswil und Erdgas Zürich: «Wir entwickeln und realisieren als Energiedienstleister keine Standardlösungen, sondern richten unser Angebot immer so aus, dass es den Bedürfnissen des Kunden entspricht», sagt Ingo Siefermann, Bereichsleiter Energiedienstleistungen bei Erdgas Zürich. Im Fall des Wädenswiler Wärmeverbundes baut beispielsweise die Stadt das Gebäude für die Heizzentrale inklusive VorratsNACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 PUBLIREPORTAGE bunker für die Schnitzel selber sowie die Schächte für die Fernwärmeleitungen. Erdgas Zürich wiederum erstellt die gesamten technischen Anlagen. Eng wird die Zusammenarbeit auch nach der Inbetriebnahme des kompletten Verbundes im Juli 2011 sein: Den Pikettdienst und die täglichen Kontrollen in der Technikzentrale übernehmen Mitarbeiter der Werke der Stadt Wädenswil im Auftrag von Erdgas Zürich. Dort, wo das entsprechende Knowhow vor Ort bereits vorhanden ist, macht eine solche Zusammenarbeit viel Sinn», sagt Ingo Siefermann. Erdgas Zürich wiederum sorgt für den reibungslosen Betrieb und Unterhalt der Anlagen während der 15-jährigen Vertragsdauer und kauft das Brennmaterial ein. Ein Arrangement, mit dem die Stadt Wädenswil gut fährt: «Der Wärmepreis wird gemäss unseren Berechnungen zwar zwei Rappen über dem liegen, was es uns mit einer eigenen Anlage kosten würde, dafür müssen wir keine betrieblichen Risiken übernehmen», rechnet Rolf Baumbach vor. 15 Prozent höhere Effizienz Kern des neuen Verbundnetzes ist die Energiezentrale, direkt neben dem Schulhaus Untermosen. Darin wird die neue Holzschnitzelheizung mit einer Leistung von 850 Kilowatt installiert. Sie trägt die Hauptlast und wird über das Jahr 80 Prozent der Wärme erzeugen. Zur Abdeckung von Spitzenlasten, als Rückfallebene und zur Versorgung in Schwachlastzeiten – beispielsweise wenn das Hallenbad im Sommer geschlossen ist – dienen die zwei bestehenden Gaskessel im Schulhaus mit einer Leistung von je 350 Kilowatt. Erdgas Zürich baut in Wädenswil aber nicht nur einen Wärmeverbund mit Holzschnitzelheizung auf Wunsch des Kunden, sondern geht auf eigenes Risiko noch einen Schritt weiter: Die Heizung wird zusätzlich mit einer Wärmerückgewinnungsanlage gekoppelt. Sie entzieht – analog einer Gasheizung – den Abgasen durch Kondensation die darin enthaltene Energie. Die dafür nötige Feuchte fällt bei einer Holzschnitzelheizung reichlich an, enthält das Brenngut doch 35 bis 50 Prozent Wasser. «Die Energieeffizienz der Anlage erhöht sich durch die Kondensation um 15 Prozent», erklärt Bernd Rupflin, Projektleiter bei Erdgas Zürich. Voraussetzung für die optimale Wärmerückgewinnung ist aber, dass die Rücklauftemperaturen des NetEnergiedienstleistungen von Erdgas Zürich Seit 2008 ist Erdgas Zürich als Energiedienstleister tätig. In dieser Funktion plant, baut und betreibt das Unternehmen im Auftrag Dritter Energieversorgungsanlagen für Gebäude in der ganzen Schweiz. Um die Bedürfnisse der Kunden möglichst optimal zu erfüllen, ist Erdgas Zürich eine enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit wichtig. Im Vordergrund steht die Suche nach möglichst ökonomischen Lösungen, die spezifisch auf die Wünsche und Anforderungen des jeweiligen Kunden zugeschnitten sind. Die Art der Zusammenarbeit, die Verteilung der Aufgaben in Planung, Bau und Betrieb sowie die Wahl des Energieträgers erfolgen dabei individuell und projektbezogen. NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 zes möglichst tief liegen. Dies erfordert ausgefeilte, hydraulische Schaltungen und eine Kontrolle der Wassermengen. Die Effizienzsteigerung durch die Wärmerückgewinnung wirkt sich mehrfach positiv aus: Die Anlage benötigt weniger Holzschnitzel, arbeitet wirtschaftlicher, verfügt über Leistungsreserven für den Anschluss weiterer Gebäude und entlastet die Umwelt zusätzlich. Und nicht zuletzt geht auch für den Energiedienstleister die Rechnung auf: «Ziel ist es, dass durch die Einsparungen auf der Energieseite die Mehrinvestitionen gedeckt sind», sagt Projektleiter Bernd Rupflin. Neben der Wärmerückgewinnung wird der Holzschnitzelheizung auf Wunsch des Kunden zusätzlich noch eine Entschwadungsanlage nachgeschaltet. Diese sorgt dafür, dass bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt die Abgase der Heizanlage kaum zu sehen sein werden – aus Rücksicht auf die Nachbarschaft. Inbetriebnahme Wenn im Juli 2011 der Wärmeverbund in Betrieb geht, erhält Wädenswil – dank des innovativen Zusammenarbeitsmodells mit Erdgas Zürich – die Energie für die angeschlossenen Gebäude nicht nur zu einem attraktiven Preis, sondern die Stadt entlastet auch die Umwelt: Durch den Einsatz der Holzschnitzelheizung sinkt der CO2-Ausstoss der angeschlossenen Liegenschaften um 80 Prozent – ein Resultat, das zu einer Energiestadt passt. Doch damit ist das Maximum an Effizienz des Verbundes noch nicht ausgeschöpft: Durch die bereits angedachte wärmetechnische Sanierung der Gebäude von Schule und Hallenbad, die aus den siebziger Jahren stammen, wird der Energiebedarf weiter sinken. Das ermöglicht es, künftig weitere Liegenschaften anzuschliessen und die Umweltbilanz nochmals zu verbessern. Erste Interessenten für einen Anschluss haben sich bereits gemeldet. ■ Erdgas Zürich AG, Energiedienstleistungen Aargauerstr. 182, Postfach 805, 8010 Zürich Tel. 043 317 24 29, Fax 043 317 20 25 [email protected], www.erdgaszuerich.ch 19 ERDGAS ZÜRICH AG, ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN INTERVIEW «Die Zukunft gehört Unternehmen, die Energie smart einsetzen und verteilen.» Kurt Lüscher (53) ist seit 2008 CEO von Erdgas Zürich. Zuvor arbeitete er in leitenden Positionen in der IT und im Telekommunikationsbereich, unter anderem bei UBS, Swisscom und Sunrise. Der Markt für Energiedienstleistungen hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Die immer komplexer werdenden Anlagen für Heizung, Kühlung und Luftbehandlung von Gebäuden sowie der Wunsch nach einer möglichst ökonomischen und ökologischen Produktion von Kälte und Wärme haben zu einer eigentlichen Spezialisierung geführt. Entsprechend hat die Nachfrage nach Energiedienstleistungen aus professioneller Hand stark zugenommen. Längst bieten nicht mehr nur reine Contracting-Unternehmen die Planung sowie den Bau, Betrieb und Unterhalt von Energieversorgungsanlagen für Liegenschaften an, sondern auch Unternehmen, die einst nur auf die Lieferung einer bestimmten Energie fokussiert waren. Die von den neuen Anbietern erstellten Anlagen werden ohne Bevorzugung des Energieträgers des einstigen Kerngeschäftes geplant und realisiert. Doch was bewegt die Energieversorger zum Einstieg in den Markt für Energiedienstleistungen? Was unterscheidet sie von anderen Mitbewerbern? Ein Energielieferant, der solche Energiedienstleistungen anbietet, ist Erdgas Zürich. Kurt Lüscher, CEO von Erdgas Zürich, nimmt gerne Stellung dazu. In Wädenswil startet Ihr Unternehmen im Frühling 2011 mit dem Betrieb eines Wärmverbundnetzes, dessen Grundlast durch eine Holzschnitzelheizung abgedeckt wird. Ist das für einen Gaslieferanten kein Widerspruch? Überhaupt nicht. Als innovativer und moderner Energiedienstleister bieten wir unseren Kunden diejenige Energieversorgung an, die für sie am wirtschaftlichsten und ökologischsten ist sowie ihren Wünschen entspricht. 20 Deshalb fiel in Wädenswil der Entscheid für die Verwendung von Holzschnitzeln. Zudem ist Erdgas ein Brennstoff, der sich bestens mit erneuerbaren Energien wie Sonne, Erdwärme, Biogas oder eben Holz kombinieren lässt. Dafür ist auch Wädenswil ein gutes Beispiel. Dort stehen für Spitzenzeiten und als Rückfallebene weiterhin Gaskessel zur Verfügung. Warum sucht Erdgas Zürich nach neuen Betätigungsfeldern? Der Energiemarkt wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Daraus ergeben sich neue Chancen, die wir gerne wahrnehmen. Dazu gehören insbesondere erneuerbare Energien und Energiedienstleistungen. Erdgas, als ideale Brückenenergie, wird zwar noch viele Jahre erfolgreich eingesetzt werden. Neue, praktische CO2-neutrale Konzepte werden sich aber vermehrt durchsetzen. Da wollen wir an der Spitze mit dabei sein. Was sind die Gründe für einen Einstieg in den Bereich Energiedienstleistungen? Die Zukunft im Energiemarkt wird Unternehmen gehören, die nicht einfach Energie liefern oder produzieren, sondern die Energie smart einsetzen, messen, steuern und verteilen. Unsere Vision geht dahin, dass mittel- bis langfristig dezentral – insbesondere auch durch Immobilien selbst – viel Energie produziert wird. Dies erfolgt aber nicht immer zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge und in der richtigen Form. Im Zentrum werden also immer öfter moderne, gesamtheitlich zu betrachtende Energiesysteme stehen. Das Anbieten und Erbringen von Energiedienstleistungen ist für uns deshalb ein erster logischer Schritt in diese Richtung. Weshalb eignen sich traditionelle Energielieferanten wie Erdgas besonders gut als Energiedienstleister? Wir planen, bauen und betreiben seit vielen Jahren eine komplexe Energieinfrastruktur und kennen den Umgang mit den entsprechenden Risiken. In allen Bereichen arbeiten motivierte und erfahrene Fachleute. Das sind die wichtigsten Ressourcen von Erdgas Zürich. Auch in den Geschäftsfeldern erneuerbare Energien und Erdgas sind wir innovativ und kundenorientiert unterwegs. ■ NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 GLAS TRÖSCH AG PUBLIREPORTAGE «SILVERSTAR E-LINIE» Novum in der Isolierglastechnik: Bei der SILVERTSTAR E-Linie sind U- und g-Werte nach Mass möglich. Seit über 20 Jahren sorgen Silberbeschichtungen, die kaum sichtbar sind, für eine ausgezeichnete Wärmedämmung im Isolierglas und erlauben damit eine transparente und lichtdurchflutete Bauweise. Modernste Isoliergläser von Glas Trösch im Einsatz Mit einer Verglasung möchte man jedoch neben Licht und Sicht, in der kalten Jahreszeit auch die Gratisenergie, die uns die Sonne in einem Übermass zur Verfügung stellt, in die Innenräume bringen. Massgebend für diese Zusatznutzung ist der Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) einer Verglasung. Je höher der g-Wert desto mehr Sonnenenergie gelangt in den Innenraum. Zwischen der Wirksamkeit einer Wärmedämmbeschichtung und dem g-Wert besteht ein Zusammenhang. Bis anhin blieb daher oft nur die Wahl zwischen einem optimalen U-Wert mit reduziertem g-Wert oder einem optimalen g-Wert mit höherem U-Wert. Wirtschaftlichkeit nach Mass. Voraussetzung für gute U-Werte sind entsprechende Wärmedämmbeschichtungen. Mit Gasfüllungen in den Zwischenräumen lässt sich der U-Wert noch weiter verfeinern. Durchgesetzt haben sich Füllungen mit dem Edelgas Argon. Mit Argonfüllungen wird eine namhafte Verbesserung des U-Wertes erreicht, ohne nennenswerte Mehrkosten. Demgegenüber sind Argon/Krypton-Mischungen oder reine Kryptonfüllungen, die insbesondere bei kleinen Scheibenzwischenräumen noch wirksamer sind, erheblich teurer. Wer eine besonders ökonomische Lösung wünscht, gibt daher argongefüllten Isolierglaslementen den Vorzug. Mit der SILVERSTAR E-Linie bringt Glas Trösch erstmals 3-fach-Isoliergläser auf den Markt, bei denen sich U- und g-Werte in einem grossen Bereich optimal den jeweiligen Anforderungen anpassen lassen. Die U-Werte reichen von 1.0 W/m2K bis 0.4 W/m2K und die g-Werte von 49% bis 69%. U-Wert und g-Wert der Verglasung lassen sich damit objektbezogen, massgeschneidert auf die Gebäudetechnik und bauphysikalischen Erfordernisse abstimmen. Ein Gewinn für jedes Fenster – SILVERSTAR E mit ACSplus Isoliergläser der SILVERSTAR E-Linie sind mit ACSplus, dem neuen wärmedämmenden Randverbundsystem von Glas Trösch ausgerüstet. Dies bedeutet eine zusätzliche Verbesserung des Fenster-U-Wertes um bis zu 0.3 W/m2K. Zudem wird die Kondensatanfälligkeit im Randbereich auf ein absolutes Minimum reduziert, ein Vorteil der insbesondere bei Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit entscheidend ist. ■ Hoher Durchlass von Tageslicht Funktionsweise SILVERSTAR E-Linie Solare Energiegewinne Wärmedämmbeschichtungen Wärmereflexion NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 Glas Trösch AG Industriestrasse 29 CH-4922 Bützberg Tel. +41 (0)62 958 52 52 Fax +41 (0)62 958 52 55 [email protected] www.glastroesch.ch 21 22 NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 «ESSLINGER DREIECK», NEUBAU GESCHÄFTSHAUS C MINERGIE-P-ECO Neue Dimension für die Energienutzung Stücheli Architekten Das noch weitgehend unbebaute Areal «Esslinger Dreieck» bietet zwischen Löwen-, Uster- und Forchstrasse Dank seiner zentralen Lage zum Bahnhof das notwendige Entwicklungspotential und befindet sich in einem stetigen Wandel. Der Gestaltungsplan aus dem Jahre 1991, welcher 2002 vom Architekturbüro agps überarbeitet wurde, sieht auf rund 24000 m2 ein Zentrum für das heute 1600 Einwohner zählende Dorf Esslingen mit Bürohäusern, Läden, Autoeinstellhallen, Dorfwiese und Wohnbauten vor. NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 Derzeit bestehen bereits Bauten wie die Endstation der Forchbahn, die Post, ein Dorfladen und zwei Geschäftshäuser für das Ingenieurbüro Basler & Hofmann, welche durch das Architekturbüro agps erstellt wurden. Als Bauherr für das gesamte Gebiet zeichnet die Rehalp-Verwaltungs AG, ein Unternehmen der Basler & Hofmann Gruppe. Für die Erstellung des dritten Geschäftshauses wurde die Verlegung des durch das Areal verlaufenden Vollikerbaches notwendig. Bei dieser Gelegenheit wurde der Bach renaturiert und hochwassersicher ausgestaltet. Die neu angelegte Bachpromenade bietet Raum zum Verweilen und Begegnen. Langfristig sieht der Gestaltungsplan den Bau von zwei weiteren Geschäftshäusern vergleichbarer Grösse vor. Nördlich der insgesamt fünf Geschäftshäuser werden Wohnungsbauten die Bebauung ergänzen. 23 «ESSLINGER DREIECK», NEUBAU GESCHÄFTSHAUS C Aufgabe und Zielsetzung vorgesehen sind. Insgesamt wird eine Geschossfläche von 2900 m2 erstellt. So werden ab Mitte 2010 in Esslingen 60 zusätzliche Arbeitsplätze angeboten. St'A wurden im April 2008 von der Rehalp-Verwaltungs AG mit dem Neubau des dritten Bürogebäudes, des Geschäftshauses C in Esslingen beauftragt. Beordert wurde eine Weiterführung des Projektes von agps, welche zu diesem Zeitpunkt bereits eine Baubewilligung bei der Gemeinde Egg eingereicht hatte. Die Planung stand durch den Architektenwechsel unter einem grossen Termin- und Kostendruck. Das neue Geschäftshaus setzt, wie auch schon die beiden bestehenden Bürogebäude, in Bezug auf Energienutzung neue Massstäbe. Als Planungsprinzip gilt «Lowtech statt Hightech» – möglichst einfache, aber intelligente Lösungen. Das bestehende Projekt von agps wurde dahingehend überarbeitet, dass die zahlreichen Anforderungen mit Hilfe der Gebäudetechnik in das Konzept integriert werden konnten. Das Zusammenspiel zwischen Gebäudetechnik, Energie, Ökologie, Ökonomie und Architektur wurde mittels einer Hülle, welche sich über das Gebäude faltet, architektonisch ausformuliert. Dadurch gelingt es, komplexe Problemstellungen im Zusammenspiel der verschiedenen Interessen und Anforderungen zu entflechten. Nutzung Technische Lösungen Das Geschäftshaus C wird mit einer flexiblen Raumaufteilung verschiedenen Nutzungsansprüchen gerecht und entspricht dem Wunsch nach Nachhaltigkeit. Im Erdgeschoss werden 500 m2 externe Vermietungsflächen für öffentliche Nutzung wie Ladenlokale, Praxen oder stilles Gewerbe bereitgestellt. Die beiden Obergeschosse werden als Bürofläche von der Basler & Hofmann AG genutzt, wohingegen im Dachgeschoss Büros zur Fremdvermietung 24 Konzept und Architektur Mittels gebäudeintegrierter Photovoltaik wird das Gebäude zum Kraftwerk. Die hochgedämmte innere Holzelementfassade, welche für das Erreichen des MINERGIE-PStandards entscheidend ist, wird nach Süden hin von einer Energiefassade überspannt. In ihr sind Photovoltaik-Elemente zur Stromerzeugung und Solarthermie-Kollektoren für die Erhitzung von Warmwasser integriert. Im Bereich der Fenster erlaubt die grossflächige Verglasung vollen NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 MINERGIE-P-ECO Ausblick. Diese Lösung wurde in intensiver Zusammenarbeit mit den Fachplanern von Basler & Hofmann entwickelt. Die Neigungswinkel der PV-Elemente in den Bereichen der Brüstungen wurden optimal auf die Ansprüche an Energieertrag und Verschattung ausgerichtet. Die südorientierten Dach- und Fassadenflächen werden sowohl mit über 200 m2 PV-Paneelen als auch mit ca. 95 m2 Solarthermie-Kollektoren bestückt. Die Energie der Solaranlage wird in erster Priorität zum Heizen des Gebäudes und in zweiter Priorität für das Vorwärmen des Brauchwarmwassers eingesetzt. Die Heizenergie wird in einem neuartigen Erdspeicher unter dem Gebäude zwischengespeichert. Dadurch wird ermöglicht, Sonnenenergie vom Sommer in den Winter zu verlagern. Dieser Erdspeicher besteht aus 33 ca. 35 m tiefen konzentrisch angeordneten Erdwärmesonden. Basler & Hofmann konnte sich für den gewonnen Solarstrom eine Einspeisevergütung sichern. Die Grundfeuchte des Gebäudes wird ausschliesslich durch die Feuchterückgewinnung in der Lüftung sichergestellt. Der intensive Einsatz von Lehmbauplatten mit Lehmputz im Grundausbau (Bürowände und Kernzonen) trägt zusätzlich zur Optimierung des Feuchtehaushalts bei. NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 25 «ESSLINGER DREIECK», NEUBAU GESCHÄFTSHAUS C MINERGIE-P-ECO Materialisierung Bauherrschaft Rehalp-Verwaltungs AG Bachweg 1 8133 Esslingen Tel. 044 387 15 16 www.rehalp-verwaltung.ch Nachhaltigkeit/Bauphysik Gebäudetechnik/PV/Bauingenieur Basler & Hofmann AG Ingenieure, Planer und Berater 8032 Zürich Tel. 044 387 11 22 www.baslerhofmann.ch Architektur Stücheli Architekten Binzstrasse 18 8045 Zürich Tel. 044 465 86 86 www.stuecheli.ch Bauleitung ECKERT ARCHITEKTEN GmbH Torgasse 6 8001 Zürich Tel. 043 268 02 18 26 Kriterien der Nachhaltigkeit und Ökologie, liegen auch der Wahl der Materialien im Innenausbau zu Grunde. Die ausgewählten Materialien sollen möglichst in ihrer natürlichen Farbigkeit und Haptik eingesetzt werden. In den Zirkulations- und Bürozonen wird ein braun maserierter Linoleumbelag verlegt. Die zentralen Kern- und die seitlichen Stirnwände sind als Sichtbetonoberfläche aus Recycling-Beton ausgeführt. Aus konzeptionellen Gründen wurden, mit Ausnahme der Betonfertigteile, alle Betonarbeiten aus Recycling-Beton angefertigt. Auf Grund der sehr günstigen feuchteregulierenden Eigenschaften von Lehm wurden sämtliche Bürotrennwände und die Wände der beiden Kerne damit verputzt. ■ NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 AIR-ON AG NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 PUBLIREPORTAGE 27 ERSATZNEUBAU MFH SPEERSTRASSE ZÜRICH Visionäres Energiekonzept Getreu dem Grundsatz der Nachhaltigkeit und der Schonung unserer natürlichen Ressourcen, wurde der Minergie-P Ersatzneubau mitten im Stadtgebiet von Zürich realisiert. Die Aufgabenstellung der Bauherrschaft war von Beginn an evident und die Vorgaben ambitioniert. Als Zielwert galten die Passivhaus Anforderungen, mindestens 80% weniger Heizenergieverbrauch gegenüber den heute geltenden gesetzlichen Grenzwerten für Neubauten. Um die adäquaten Ansprüche an die aussergewöhnlichen Eigentumswohnungen zu erfüllen, durften architektonisch keine Kompromisse eingegangen werden. Die Fenster auf der Nordseite des Gebäudes mussten gleichermassen wie auf der Südseite angeordnet werden. Grosse Fensterflächen und teilweise auch Balkone, welche an der Ost- und West Fassade örtlich eine Verschattung verursachen, stellten planerisch eine komplexe Aufgabe dar. Jede Eigentumswohnung sollte über eine dezentrale, eigenständige und autonome Energie- und Wärmeversorgung verfügen. Der Lösungsansatz war ein dezidiertes Energiekonzept und der Einsatz von Spitzentechnologie in allen Disziplinen. Bauphysikalischen Massnahmen Neben den hochwertigsten Baumaterialien für den Wärmedämm- und Luftdichtigkeitsperimeter wurde konsequent auf die Vermeidung von Wärmebrücken geachtet. Sämtliche an der Fassade befestigten Bauteile sind mit speziell konzipierten Einlageelementen wärmetechnisch vom Baukörper abgetrennt. Die Bauleitung war mit dem konsequenten Durchsetzen dieser Vorgaben gefordert. Planer und handwerkliche Betriebe verfügen generell über fragmentarisches Knowhow, um diese Massnahmen auf Anhieb richtig umzusetzen. 28 NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 MINERGIE-P Für die Gebäudebeschattung wurden vorgesetzte Fensterzargenelemente mit im Holsturz integrierten Lamellenstoren entwickelt und eingesetzt. Die repräsentativen XL Minergie-Modul-Kunststofffenster von EgoKiefer erreichen bei einem Ug-Wert von 0,5 W/m2K durch Dreifachverglasung mit doppelter Beschichtung einen g-Wert von 60 %. Bei den Türelementen wurde primär auf die Luftdichtigkeit geachtet. Die geprüfte Minergie-Holztüre mit Dreifachdichtung von RWD Schlatter erfüllt alle geforderten Eigenschaften. Dezentrales Energie- und Gebäudekonzept Jede Wohnung verfügt über eine eigene kompakte Wärmepumpenheizungs- und Lüftungsanlage vom Typ Aerosmart X2 der Firma Drexel und Weiss. Für die Wärmeversorgung wurden zwei Erdsonden in eine Tiefe von 160 m gebohrt. Die Aussenluft wird durch ein Erdregister unter der Bodenplatte im Winter vorgewärmt und im Sommer vorgekühlt. Die Wärmeabgabe erfolgt parallel zur Komfortlüftung auch über eine Niedrigtemperatur-Bodenheizung. Die Küchenabluft wird mittels Umlufthauben mit Aktivkohlefilter gereinigt. Thermische Solarenergie Zur Warmwasser Vorwärmung wurden spezielle Xinox Vakuum-Röhrenkollektore der Firma Conergy mit hervor- NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 ragendem Wirkungsgrad eingesetzt. Die Kollektorenfelder sind auf dem Flachdach und an der Fassade des Dachaufbaus angeordnet. Photovoltaik (PV) Anlage Die direkte Umwandlung von Licht in elektrische Energie aufgrund des physikalischen Photoeffekts faszinierte die Bauherrschaft von Anbeginn. Die Nutzung der Sonnenenergie zum Zwecke der Stromerzeugung wurde durch eine Solaranlage der Firma Muntwyler realisiert. Die Sola29 ERSATZNEUBAU MFH SPEERSTRASSE ZÜRICH MINERGIE-P re Netzeinspeisung erfolgt mit zehn SANYO-Solarmodulen auf dem Flachdach und erreicht eine Spitzenleistung von 2300 Wp. Die Anlage erspart jährlich ca. 1500 kg CO2 im EU-Strommix. Abwasser Wärmerückgewinnung Eine weitere energieeffiziente Lösung zur Raumheizung wurde durch die Nutzung der Abwasserwärme realisiert. Das warme Abwasser der Bade- und Duschwannen wird durch ein separat geführtes Ablaufsystem einem Edelstahltank zugeführt. Die Wärmerückgewinnung erfolgt passiv über die Tankoberfläche. Dadurch kann die gemeinsam genutzte Räumlichkeit im Gartengeschoss temperiert werden. Luftdichtigkeit der Gebäudehülle «Blower-door» Die Minergie-P Zertifizierungsstelle verlangt in Mehrfamilienhäusern, dass jede einzelne Wohnung den Luftdichtigkeitstest mit dem Grenzwert von 0,6 bestehen muss. Frühzeitig bei Projektbeginn wurden die Spezialisten der Firma Clicon AG beigezogen. Die Planung der Luftdichtigkeitsperimeter, im speziellen der Steigzonen und der unzähligen wohnungsübergreifenden Haustechnikinstallationen, musste minuziös durchgeführt werden. Um Leckagen vorzubeugen, wurden die ausführenden Monteure von der Bauleitung fortlaufend angewiesen und überwacht. Elektroanlage Die eingesetzten Elektrogeräte entsprechen vorwiegend der Energieeffizienzklasse A+ und A++. Energieeffizienz mit behaglich warmem Licht war die klare Forderung der Bauherrschaft betreffend Evaluation der Beleuchtungskörper. Mit der NIMBUS Aufbauleuchte und den breit strahlenden ATLAS Einbauspots wurde eine perfekte Lösung gefunden. Dieser Standard entspricht der neusten Generation der LED Technologie. Die Stromersparnis gegenüber normalen Glühlampen liegt bei 90 % und die längere Lebensdauer ist ein weiterer Vorteil. Fazit Das Mehrfamilienhaus dient als Beispiel einer zukunftsorientierten Bauweise. Von den theoretischen Ansätzen konnte das Energiekonzept erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden. Die Investitionen (BKP 2) gegenüber einer konventionellen Bauweise liegen gut 30 % höher und die Bauzeit verlängert sich um ca. 1/2 Jahr. Längerfristig bietet diese Bauweise jedoch einen optimalen Investitionsschutz und einen Beitrag an unsere Umwelt. Minergie-PZertifikat Nr. ZH-038-P ■ Bauherrschaft Esther und Markus Näpfer-Lendi Speerstrasse 37 8038 Zürich 30 Baumanagement und Bauleitung RENOKONZEPT Bauleitungs AG Schaffhauserstrasse 333 8050 Zürich Tel. 044 315 13 55 www.renokonzept.ch Architektur KONDISPO Konzeptionen und Dispositionen AG Schaffhauserstrasse 333 8050 Zürich-Oerlikon Tel. 044 315 13 50 Fax 044 315 13 54 [email protected] HLK-Ingenieur hässig sustech gmbh Ingenieurbüro Weiherallee 11a 8610 Uster Tel. 044 940 74 15 www.sustech.ch NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 Ihr kompetenter Partner für: • Luftdurchlässigkeitsmessungen • Thermografie-Aufnahmen Unsere Standorte: Lindau–Zürich 052 343 73 52 [email protected] • Gebäudediagnosen Rorschacherberg 071 855 34 47 [email protected] Mehr Informationen: www.clicon.ch Gossau–Zürich 043 928 06 38 [email protected] RENOKONZEPT BAULEITUNGS AG SCHAFFHAUSERSTRASSE 333 8050 ZÜRICH-OERLIKON BAULEITUNG + PLANUNG BAUMANAGEMENT + BAUBERATUNG Tel. 044 315 13 55 | FAX 044 315 13 59 [email protected] www.renokonzept.ch NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 31 ZENTRUM MITTIM WALLISELLEN Wallisellen setzt energetische und städtebauliche Akzente 5400 m2 Verkaufsfläche, 6000 m2 Bürofläche, 7000 m2 Wohnfläche – das sind die Eckwerte der neuen Überbauung Zentrum Mittim Wallisellen, die unmittelbar neben dem markanten neuen Bahnhofsgebäude Ende Mai 2010 eingeweiht wurde. Herzstück der Überbauung ist die auf zwei Ebenen angesiedelte, halböffentliche Halle, die im unteren Geschoss nahtlos an den Bahnhofplatz anschliesst und der Wallisellener Bevölkerung einen pulsierenden Begegnungsort bietet. oberst auf der Prioritätenliste der Projektentwicklerin. Aus diesem Grund haben diese bereits im Frühstadium der Entwicklung das Gespräch mit ewz gesucht. Basierend auf dem Leistungsauftrag der Stadt Zürich konzipiert und entwickelt ewz im Rahmen des EnergieContracting zusammen mit seinen Kundinnen und Kunden massgeschneiderte Lösungen für die Energieversorgung von Gebäuden. Dabei plant, finanziert und baut ewz die Energieversorgungsanlagen und stellt deren Betrieb sicher. Für diese Dienstleistung zahlen die Kundinnen und Kunden einen vertraglich festgelegten Preis. Die Verträge laufen in der Regel 15 bis 30 Jahre. Den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden nach Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit, einem effizientem Betrieb und kalkulierbaren Kosten wird ebenso Rechnung getragen wie ökologischen Aspekten. Wie fruchtbar die Zusammenarbeit im Falle der Zentrumsüberbauung Mittim Wallisellen war, zeigt sich unter anderem auch daran, dass die Projektentwicklerin während der Realisierung das eigene Energielabel «HAE-Energy» für ihre Überbauungen entwickelte; dieses soll künftig auch bei weiteren Überbauungen der Hänseler Immokonzept AG angewendet werden. Fruchtbare Partnerschaft Das Zentrum Mittim Wallisellen wurde von der Firma Hänseler Immokonzept AG erstellt. Energieeffizienz und nachhaltige Energieversorgung standen von Anfang an zu- Abwärme und Erdwärme als zentrale Pfeiler der Energieversorgung Die Zentrumsüberbauung Mittim Wallisellen wurde im Minergie-Standard erstellt und erfüllt damit die Anforde- Noch bis vor wenigen Jahren präsentierte sich das Areal beim Bahnhof Wallisellen als städtebaulich wenig überzeugendes Konglomerat aus Wohn- und Bürogebäuden, leerstehenden Hallen und Parkplätzen. Mit der Einweihung einer neuen Überbauung hat sich dieses Bild grundlegend verändert. Das neue Zentrum Mittim Wallisellen basiert auf einem klaren, durchdachten Konzept: verdichtetes Wohnen und Arbeiten in energetisch innovativen Bauten mit optimaler Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Die von ewz erstellte Energiezentrale, welche die Überbauung mit Wärme und Kälte versorgt, spielt dabei eine Schlüsselrolle. 32 NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 PUBLIREPORTAGE rungen an energiesparende Bauten. Sie wird durch eine Energiezentrale mit Wärme und Kälte versorgt. ewz war nicht nur für die Erstellung dieser Energiezentrale zuständig, sondern ist auch nach der Übernahme der Überbauung durch die Firma Allreal für deren Betrieb verantwortlich. Erneuerbare Energien spielen eine tragende Rolle: Zum Heizen und zur Aufbereitung des Brauchwarmwassers wird Erdwärme genutzt. Diese wird durch 34 Sonden gewonnen, die bis zu 250 Meter tief in die Erde führen. Die Erdsonden werden als Energiespeicher eingesetzt und sowohl für die Wärmeentnahme als auch für die Wärmerückgabe genutzt. Eine Wärmepumpe erzeugt die benötigte Wärme auf dem geforderten Temperaturniveau. Ebenso wird die Abwärme aus der Kälteanlage des eingemieteten Grossverteilers genutzt. Einzig die Spitzenlast wird durch einen Gasheizkessel abgedeckt. Insgesamt summiert sich der Wärmebedarf auf 1635 MWh pro Jahr. Auch der jährlich Kältebedarf von 445 MWh wird durch eine elegante Lösung gedeckt: In der Übergangszeit wird zum Kühlen der Räume die Kälte genutzt, welche beim Betrieb der Wärmepumpe anfällt. Die nicht weiter verwertbare Abwärme kann über die Erdsonden an das Erdreich abgegeben wird. Für Spitzenlasten stehen Kältemaschinen zur Verfügung. Erfreuliche Energiebilanz Die Bilanz dieses Energiekonzepts lässt sich sehen: Dank des Einsatzes erneuerbarer Energien können jährlich 1390 MWh fossile Brennstoffe eingespart werden, was einer CO2-Reduktion von 275 Tonnen pro Jahr entspricht. Das bedeutet: Der Wärme- und Kältebedarf der Zentrumsüberbauung Wallisellen kann zu 85 % mit erneuerbarer Energie gedeckt werden. ■ NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 ewz Energiedienstleistungen Tramstrasse 35 8050 Zürich Telefon 058 319 47 12 Telefax 058 319 43 93 [email protected] www.ewz.ch/energiedienstleistungen 33 EFH RINGWILERSTRASSE WETZIKON Naturgerecht für die Zukunft Michael Graf Im Weiler Ettenhausen, in der Kernzone am östlichen Dorfeingang, steht das neue Einfamilienhaus im Minergie-P Standard. Ein Ersatzbau für ein altes, baufälliges Wohnhaus, umgeben von Bauernhöfen mit Scheunen, Weiden und vom Ländenbach. Wie kann man ein Einfamilienhaus mit dem modernsten Minergie-P Standard mit Sonnenkollektoren in eine von Traditionen geprägte Umgebung eines ländlichen Weilers integrieren? Die gültigen Bauvorschriften, welche das Giebeldach und die Abmessungen für Dachaufbauten in der Kernzone genau festlegen, widersprechen ja eigentlich dem modernen neuen Bautypus. So darf die Gebäudehülle nur wenige Vor- und Rücksprünge aufweisen, das Volumen / Oberflächenverhältnis ist optimal zu wählen. Die Fassade selbst genügt mit 25 cm mineralisch verputzter Kompaktfassade (atmungs-aktiver Baumit Dämmung) und Fenstern mit 3-fach Isoliervergla34 NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 MINERGIE-P sungen den höchsten Anforderungen der Dämmtechnik. Sie wird somit zu einem Aussen- und Innenwelt trennenden Hightech-Bauteil. Die Nordfassade ohne Sonnenenergie-Nutzung ist zugleich auch die Strassenfassade und typologisch die Rückseite des Hauses. Sie enthält nur minimale Fensterausschnitte, die vom Grundriss her gedacht sind und so auch Wärmeverluste möglichst vermeidet. Natürlich entstandene Zwischenzonen, die man von alten Gebäuden her kennt wie Windfang, Loggia, grosse Vordachzonen von alten Scheunen und die Zwischenräume bei alten Kastenfenstern, lassen etwas vom Wohnleben NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 nach aussen hervortreten. Bei einem Minergie-P Haus drohen solch qualitativ wertvollen Bereiche verloren zu gehen, weil Energieverluste in der Fassade unbedingt vermieden werden müssen. Ein Dialog mit der Aussenwelt wird aber gerade über solche Zwischenzonen erreicht, sie integrieren ein Gebäude in seiner Umgebung. Es wird für dieses Projekt ein geeignetes architektonische Mittel gefunden, welches auch zur Dorfeingangsstrasse (Norden) hin trotz dem «Rücken» eine einladende Gestik ermöglicht und wertvolle Zwischenzonen wieder aufleben lassen: eine feine Holzlattenhülle, die grosszügig um das kompakte Haus gelegt wird. Diese zweite Fassade 35 EFH RINGWILERSTRASSE WETZIKON MINERGIE-P hat einen ganz anderen Ausdruck mit ihren grossen Öffnungen und «blinden» Reihenfenstern als die thermische Fassade und sie ermöglicht viele Zwischenzonen (Loggien) als unbeheizten Wohnbereich des Hauses. Es entsteht ein Verdeckspiel des Innenhauses mit seinen energetischen Anforderungen zum Aussenhaus, welches so ungezwungen seinem Standort in der Umgebung gerecht werden kann. Bewusste Material- und Formwahl dieser zwei Hüllen bilden gerade in der Differenz zueinander, in der nicht deckungsgleichen Begegnung, freie Zonen, die vom Wohnen belebt, nach aussen wahrnehmbar in Besitz genommen werden können. Die Nordfassade mit den «blinden» Reihenfenstern wurde teilweise nicht mit Holzlatten belegt, so dass nur die vertikale Grundlattung erscheint. Dieses Bild fördert den Gedanken an Spaliere, die das Einwachsen-Lassen des Hauses ermöglichen, ein Grundmotiv der Urhütte. Das Wohnhaus wird so mit der Natur wieder versöhnt. Ein Familienhaus für einen Geologen und eine Landschaftsarchitektin mit ihren drei Kindern. ■ Bauherrschaft Familie M. und Th. Schirmer-Abegg Ringwilerstrasse 60 8620 Wetzikon 36 Energiekennzahlen Energiebezugsfläche EBF: Heizwärmebedarf Qh: Heizwärmebedarf Raumheizung und Warmwasser: Solar: Stückholz: Jährlicher Stückholzbedarf: 11 600 kWh 4100 kWh 7500 kWh 2200 kg = 5 Ster Minergie-P: Primäranforderung an Gebäudehülle: Grenzwert: 27.3 kWh/m2 30.0 kWh/m2 EFH Ringwilerstrasse 60: Primäranforderung an Gebäudehülle: Grenzwert: 26.7 kWh/m2 19.6 kWh/m2 Architekt Michael Graf Architekt FH SIA STV Architektur + Baurealisation Waserstrasse 16 8032 Zürich Tel. 044 381 73 53 www.atelier-graf.ch HLK-Ingenieur Planforum GmbH Tösstalstrasse 12 8400 Winterthur Tel. 052 213 08 05 370 m2 63 MJ/m2 Fenster 1a hunkeler Bahnhofstrasse 20 6030 Ebikon Tel. 041 444 04 40 www.1a-hunkeler.ch NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 LIEBI LNC AG PUBLIREPORTAGE «ASPIRO TLH» Energie aus dem nahegelegenen Wald Bei den alternativen, erneuerbaren Energieträgern gilt Holz, neben dem Wasser und der Sonne, als der wichtigste. Holz steht nicht nur in grossen Mengen zur Verfügung, sondern ist auch innert kurzer Frist nutzbar.Der einheimische Wald bietet eine grosse, ungenutzte Energieholzmenge, die problemlos eine Verdoppelung des heute benötigten Volumens ermöglicht. Der Natur zuliebe Im Gegensatz zu den Öl- und Gas-Heizungen ist Holz an der Anreicherung der Atmosphäre mit CO2, dem sogenannten Treibhauseffekt, nicht beteiligt. Beim richtigen Verbrennen des Holzes wird nur das Kohlendioxid freigesetzt, das der Baum während seinem Wachstum der Atmosphäre entzogen hat. Deshalb spricht man beim Holz, im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen, von einem umweltneutralen CO2-Energieträger. Wer mit Holz heizt, leistet einen wichtigen Beitrag zur Entlastung unserer Atmosphäre. ASPIRO TLH mit Lambda-Sonde – der Massstab für die Heizung der Zukunft Geniale Funktionalität Der ASPIRO TLH ist ein Heizkessel, der die moderne Holzvergasungstechnologie in optimaler Weise ausnützt. Bei der Verbrennung des Holzes wird eine grösstmögliche thermische Leistung erreicht und gleichzeitig werden die Rauch- und Schadstoffemissionen verringert. Ein grosser Füllraum ermöglicht ein bequemes Beschicken des Heizkessels mit Halbmeterspälten. Nach dem Anfeuern erfolgt die Austrocknung und Vergasung des Holzes. Bei einer Temperatur von 1200°C werden in der hochhitzebeständigen, speziallegierten Stahlbrennkammer die Holzgase nachverbrannt. Diese moderne Technologie ermöglicht ein fast aschenfreies Verbrennen des Holzes. Elektronische Leistungsregulierung Die im Heizkessel erzeugte Wärme gelangt als heisses Wasser entweder direkt in das Heizsystem oder wird in einem Speicher NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 zwischengelagert. Dank der elektronischen Leistungsregulierung und Verbrennungsoptimierung kann die Anlage auch mit einem kleinen Speicher betrieben werden. Mit der Wahl eines grösseren Speichers kann aber der Komfort gesteigert werden. Mit einer Lambda-Sonde wird der Restsauerstoff der Verbrennungsabgase gemessen. Genau geregelte Luftklappen führen die notwendige Menge Primär- und Sekundärluft zu. So kann während des gesamten Abbrandes ein Optimum an Verbrennungsqualität mit äusserst geringen Emissionswerten erzielt werden und es ist kein Einstellen der Holzart erforderlich. Die Mikroprozessorsteuerung LNCcombimatic regelt mittels der Lambda-Sonde die Holzverbrennung, steuert und überwacht sämtliche Betriebsabläufe und bietet höchstentwickelte Technologie für die Holzvergasungstechnik. Die komplette Verteilergruppe mit den Abgängen auf den Energiespeicher, auf die Heizung und bei Bedarf auf den Wassererwärmer, ist fertig am Heizkessel montiert und elektrisch verdrahtet. ■ LIEBI LNC AG Burgholz 3753 Oey-Diemtigen Tel: 033 / 681 27 81 Fax: 033 / 681 27 85 E-Mail: [email protected] 37 SWISSPOR An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen Der neue, erweiterte Prüfstand bietet die Möglichkeit, beliebige Testszenarien zu definieren und neu auch mittels Laser-Scannern die Oberfläche abzutasten und auf feinste Veränderungen zu untersuchen. Damit werden wertvolle Erkenntnisse zum Langzeitverhalten unter wechselnder Temperaturbelastung gewonnen. Eine tolle Zusammenarbeit lässt sich immer an konkreten Resultaten und Erfolgen messen. Seit längerer Zeit arbeitet die swisspor AG intensiv mit der Hochschule Luzern zusammen. Mit Erfolg, denn die steten Optimierungen und Verbesserungen im Detail bringen immer wieder grosse Vorteile. Nochmals bessere Dämmwerte und eine nochmals vereinfachte Verarbeitung gibt es jetzt bei unseren neuen Fassadenplatten swissporLAMBDA Plus / Light. Sonne, Regen, Hitze und Kälte, aber auch unterschiedlich beschaffene, nicht ebene Untergründe gehören zum Alltag auf einer Baustelle. Bei den heutigen Dämmstärken gilt es, mehr denn je, die komplexen Zusammenhänge bei der Verarbeitung näher zu untersuchen und entsprechende Optimierungen an den Produkten vorzunehmen. Ziel ist 38 es, dass Verarbeiter bei jeder Witterung schnell und sicher arbeiten können. Neues Design für swissporLAMBDA Plus /Light Fassadenplatten bis 200 mm. Die bereits bekannten Entlastungsschlitze von swisspor haben nun eine neue Dimensionierung und geometrische Anordnung erhalten. Diese sind jetzt asymetrisch angeordnet. Eine Verbesserung die dem Verarbeiter auf der Baustelle mehr Sicherheit und kürzere Verlegezeiten bringt. Jede Platte kann verbaut werden, so wie sie in der Hand liegt. Eine spezielle Bezeichnung «Wandseite» ist nicht zu beachten. Diese neuen Platten verfügen über optimale Verarbeitungseigenschaften bei jeder Witterung, auch bei direkter Sonneneinstrahlung. NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 PUBLIREPORTAGE LAMBDA PLUS /LIGHT «Magische Schlitze» gegen den Kräfteaufbau bei Sonneneinstrahlung. Die von den swissporLAMBDA Plus / Light Fassadenplatten bereits bekannten, innovativen «Entlastungsschlitze» sind neu asymetrisch angeordnet. Das Handling beim Verarbeiten wird dadurch nochmals einfacher und sicherer. Mit nochmals verbesserten !D-Werten von nur 0.030 W/(m·K) für swissporLAMBDA Plus und 0.032 W/(m·K) für swissporLAMBDA Light. Fassadenaufbauten sollten immer bessere Dämmwerte erreichen, dabei aber so schlank wie möglich bleiben. Diese Forderung von Planern und Architekten ist verständlich. Mit dieser Vorgabe wurden die Hochleistungsdämmplatten aus der Familie swissporLAMBDA Plus / Light für möglichst schlanke verputzte Fassaden entwickelt. Die neuen Platten eignen sich damit bestens für alle hochwertigen und leistungsstarken Systemaufbauten. Der neue Prüfaufbau von der Hochschule Luzern bringt neue Erkenntnisse während der Produktentwicklung hervor. Mit dem neu entwickelten Prüfaufbau, einer Spezialanfertigung die in Zusammenarbeit mit der swisspor AG entwickelt wurde, können verschiedene thermische Zustände und Abläufe simuliert werden. Unterschiedliche Oberflächentemperaturen, schneller Temperaturanstieg, langsame Abkühlung – alles kein Problem, der Prüfstand lässt sich entsprechend programmieren. Kraftsensoren in zwei Ebenen und mehrere Lasersensoren registrieren kleinste Veränderungen. Verschiedene Temperaturfühler messen an unterschiedlichen Stellen die Temperaturverteilung im innern einer Dämmplatte. Alle Daten werden aufgezeichnet, protokolliert und können anschliessend ausgewertet werden. Der harte Alltag auf einer Baustelle wird auf diese Weise, auf relativ kleinem Raum, quasi in einem Zeitraffer simuliert. Dies erlaubt es, eine beliebige Anzahl an Experimenten und Prüfzyklen vollautomatisch durchzuführen. Ein komplettes Sortiment – für jede Anwendung. Von der einfachen swissporEPS Fassadenplatte bis zur Hochleistungsdämmplatte swissporLAMBDA Plus mit einer intelligenten Plattenrandlösung, swisspor bietet ein volles Sortiment für jede Anwendung. Dabei gibt es keine Kompromisse bei der Herstellung und beim Service. Welches Produkt auch immer zur Anwendung kommt, swisspor steht für Schweizer Qualität bester Güte. ■ Weitere und ausführliche Informationen und Auskünfte sind erhältlich unter www.swisspor.ch oder Telefon 056 678 98 98 NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 39 t i o n e n . . . I n n o v a t i o n e n . . . I n n o v a Wie Sie ihre Kunden schnell und perfekt beraten. Clevere Planungs-Software: Der Wärmepumpen-Navigator Der Wärmepumpen-Navigator bringt Sie schnell und mobil ans Ziel. Jeder Kunde ist anders. Aber für jeden Kunden finden Sie mit Stiebel Eltron die Lösung, die passt. Den Weg zu dieser Lösung ebnet ihnen der Wärmepumpen-Navigator schnell und einfach. Im Dialog mit dem Kunden entwickeln Sie individuelle Angebote, zeigen Varianten auf, erstellen Grobbudgets. Auf dem Laptop haben Sie den Navigator stets bei sich und beraten effizient vor Ort. Nachdem Sie im Meeting mit dem Kunden dank dem Navigator bereits viele Details besprochen haben, ist die nachfolgende individuelle Offerte mit geringem Aufwand erstellt. Ihr Kunde wird die speditive und präzise Beratung schätzen. durch den Prozess ermöglichen ein problemloses Arbeiten mit der Software. Alle relevanten Daten zur Systemempfehlung werden als Ergebnis grafisch dargestellt – zusätzlich ausgegeben werden Materialstückliste, Schaltpläne und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Dafür notwendige Daten können aus Vorschlagswerten vom System eigenständig generiert oder auf Wunsch vom Nutzer selbst den Gegebenheiten angepasst werden. Die Software steht den Fachpartnern der Stiebel Eltron (Schweiz) AG in den drei Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch zur Verfügung. So funktioniert Ihr Navigator Der Wärmepumpen-Navigator vereinfacht die Konfiguration und Planung einer kompletten Wärmepumpenanlage mit Stiebel-EltronSystemen. Aus über 30 000 Varianten wird eine Lösung für das individuelle Bauvorhaben geliefert – auf Wunsch inklusive eventueller Optionen. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die gradlinige Führung STIEBEL ELTRON AG Netzibodenstrasse 23c 4133 Pratteln www.stiebel-eltron.ch REDAKTIONELLE PARTNER Archipel – Planung und Innovation GmbH Hardturmstrasse 261 8005 Zürich www.archipel.ch Gerhard Catrina Architekturbüro AG Grundstrasse 16a 8712 Stäfa www.catrina.ch Bauatelier Metzler GmbH Lussistrasse 7a 8536 Hüttwilen www.bauatelier-metzler.ch AWEL Abteilung Energie Stampfenbachstrasse 12 Postfach 8090 Zürich www.energie.zh.ch Michael Graf Architekt FH SIA STV Waserstrasse 16 8032 Zürich www.atelier-graf.ch Renokonzept Bauleitungs AG Schaffhauserstrasse 333 8050 Zürich www.renokonzept.ch Baumann Roserens Architekten Limmatstrasse 285 8005 Zürich www.brarch.ch Kämpfen für Architektur AG Badenerstrasse 571 8048 Zürich www.kaempfen.com Stücheli Architekten Binzstrasse 18 8045 Zürich www.stuecheli.ch 40 Swissolar David Stickelberger Neugasse 6 8004 Zürich www.swissolar.ch NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 41 EFH ANDELFINGEN Langhaus tankt Sonne Das «Langhaus» – so bezeichnet der Architekt das Wohnhaus mit knapp 23 m Länge und nur 7 m Breite. Der lange, schmale Grundriss, kombiniert mit dem leicht geneigtem, schlichtem Giebeldach geben dem Haus eine elegante Form. Farben geben dem klaren Kubus spannende Akzente. Das Haus nimmt traditionelle Gebäudeformen auf, auch die Unterteilung in Wohnbereich und Ökonomiebereich mit Carport, Atelier und Laubengang ist aus Südfassade mit Ausblick Die Haupt- und Aussichtsseite orientiert sich nach Süden und liegt somit parallel zur Quartierstrasse. Die Fassade spielt mit verschiedenen Oberflächen und Formelementen. Grundfarbe- und struktur ist eine feine, speziell angefertigte graue Stülpschalung. Das Farbkonzept ist wohlbedacht; die Fensterlaibungen sind grün herausgearbeitet, im Carport, im Laubengang und am Eingangs- ländlich-traditionellen Bauten bekannt. Die Formensprache integriert sich gut, wobei sie sich nicht «anbiedernd», sondern eigenständig und in Form und Konstruktion zeitgemäss zeigt. 42 NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 MINERGIE-P NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 43 EFH ANDELFINGEN MINERGIE-P Minergie-P Kennzahlen Minergie-P bedingt ein eigenständiges, am niedrigen Energieverbrauch orientiertes Gebäudekonzept. Um die Zertifizierung zu erhalten, müssen u. a. folgende Anforderungen eingehalten werden: Energiebezugsfläche: 280 m2 Primäranforderungen an Gebäudehülle: Dieser Grenzwert gilt als Mittelwert über das ganze Gebäude. Haus Hallauer Griesser: Anforderung 33.4, erreicht 25.3 kWh/m2 Grenzwert Minergie-P: Der Energiebedarf für Heizung, Wassererwärmung, Komfortlüftung. Haus Hallauer Griesser: Anforderung 30.0, erreicht 27.0 kWh/m2 Luftdichtigkeit der Gebäudehülle: N50 Drucktest gemessen vor Ort. Anforderung 06, erreicht 0.4 bereich entschied man sich ebenfalls für olivgrün. Die Farbgestaltung markiert wichtige Bereiche wie den Eingang, das Vordach über diesem Bereich, ost- und westseitig durch eine markante Blende abgeschlossen, unterstützt diese Idee. An der Süd–West Ecke wählte man grosszügig raumhohe Fenster. Diesen vorgestellt mindert ein anthrazitfarbenes Rankegrüst (Stahl) den Einblick – bewachsen dient es als Sicht-, aber auch als Sonnenschutz. Raue Bretter gegen Osten und Westen Raumprogramm und Konstruktionsart UG: Technik, Waschen, Keller, Betonbodenplatte und Betonwände EG: Wohnen, Essen, Kochen, Sep. WC, Gästezimmer, Arbeitszimmer Holzelementbau U-Wert 0.1 OG: 3 Schlafzimmer, 2 Bäder Holzelementbau, Dach und Wände U-Wert 0.1 Bauherrschaft Maja Griesser und Walter Hallauer Altweg 14 8450 Andelfingen 44 An der Ostseite entschied man sich für eine grün gestrichene Holzschalung, die vertikal, in roh gesägten, unterschiedlich breiten und dicken Fichtenbrettern angebracht wurde. Die unebene Struktur erzeugt ein wunderschönes Licht- und Schattenspiel auf der Fassade. Das Grün ist speziell vom Architekten für dieses Haus abgemischt und von der Farbenmanufaktur KT Color hergestellt worden. Die Fassade, hinter der sich Carport, Veloraum und Laubengang verbergen, wurde ohne Fenster ausgeführt; lediglich der Zugang zum Veloraum ist bündig eingelassen. Die Westfassade gleicht von der Oberflächenstruktur der Ostfassade, besonderer Blickfang sind hier die eckübergreifenden Fenster im Obergeschoss die im Innenraum den Abschluss des Flurs kennzeichnen sowie den Essbereich im Erdgeschoss markieren. Nordfassade mit Laubengang An der Nordfassade dominiert der dem Atelier vorgelagerte Laubengang. Der Ausblick ins Zürcher Weinland richtig Schaffhausen lädt zum Vrweilen ein. Der «Ökonomieteil» trägt die selbe grüne Vertikalschalung wie die Ostfassade. ■ Architekt Bauatelier Metzler GmbH Lussistrasse 7a 8536 Hüttwilen Tel. 052 740 08 81 www.bauatelier-metzler.ch Haustechnik Neukom Installationen AG Bahnhofstrasse 5 8197 Rafz Tel. 044 879 14 14 www.neukom.com NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 Wir gratulieren der Bauherrschaft und dem Architekten zur innovativen Bauweise. Markus Zehnder und Team Schlanke Haustechnik spart Kosten. Das Minergie-P-ECO-Gebäude besticht durch seine schlanke Haustechnik. Ein hocheffizientes Kompaktgerät vom Typ aerosmart XLS der Firma Drexel und Weiss dient zum Lüften, Heizen und Warmwassererzeugen. Als Wärmequelle für die Kleinstwärmepumpe sorgt ein im Erdreich verlegter Solekreis (oder Erdsonde), welcher zusätzlich die Aussenluft vorwärmt und im Sommer angenehm kühlt. Die Wärmeabgabe erfolgt in den Zimmern über die Zuluft, im Wohn- und Badbereich zusätzlich über eine Fussbodenheizung. Diese Art von Kompaktgeräten mit zentraler Steuerung weisen gegenüber modularen Systemen (Wärmepumpe und Komfortlüftung getrennt) betriebliche und energetische Vorteile auf und werden vermehrt in Minergie- und Minergie-P-Gebäuden eingesetzt. Vertrieb Schweiz: Gasser Passivhaustechnik, Zürich / St.Gallen, www.gasser.ch NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 45 EFH WILDBERG Ehrlicher Holzkubus Grosszügig Wohnen ist Lebensqualität Herz des Gebäudes ist der überdurchschnittlich grosszügige Wohn-Ess-Kochbereich. Hier dominieren kräftige Farb- und Materialakzente den Innenraum: die Wände erscheinen in gebrochenem Weiss, die EG Decke zeigt die Holzbalken und OSB (Grobspanplatte), als Kontrast dazu wählte man schwarze Fensterrahmen, Leibungen und Türen. Eine Treppe aus Schwarzstahl führt durch einen hohen, magentagefärbten Raum. Wände und Decke leuchten in der kräftigen Farbe, man taucht förmlich in ein Farbmeer ein. Die übrigen Bauteile wurden roh belassenen, wie die formaldehydfreien OSB Platten, das Schwarzblech an Ofen und Treppe oder der eingefärbte Anhydritboden. Weniger ist mehr Im Aussenbereich entschied man sich für eine unaufdringliche Materialisierung und Farbgebung. Für die Fassade wählte man eine Schalung aus Fichtenbrettern, die natur und sägeroh, aber raffiniert strukturiert montiert wurde: Einzelne Bretter wurden weggelassen, darunter ist die Lattung diagonal angebracht. Diese wird an den offenen Fassadenstellen sichtbar und gibt dem kubischen Baukörper ein interessant strukturiertes Kleid. Mit 12 m Gebäudelänge auf 12 m Gebäudetiefe plus 1.0 m Laubengang und Vordach gegen Süden und Westen wurde ein kompaktes Volumen erstellt. Die quadratische Grundform unterstützt die energieeffiziente Bauweise. Die Bauherrschaft wünschte sich ein grosszügiges, schnörkelloses, funktionelles Gebäude mit wohlproportionierten, hohen Räumen – eine Bauaufgabe, die die Philosophie der Planer aus dem «Bauatelier» widerspiegelt und daher motiviert angegangen wurde. Als Ergebnis zeigt sich ein kubischer Holzbau, der auf einem Betonsockel thront. Die Hanglage generierte eine dreigeschossige Westfassade, nach Osten schmiegt sich das Bauwerk an den Hang. Im Vordergrund stand die Ehrlichkeit zum Material, konstruktive Bauteile wurden daher sichtbar und ohne zusätzliche Verkleidungen ausgeführt. 46 Sonne und Schatten für Süd- und Westfassade Wer die Sonne für Wärme- und Lichtquelle nutzen will, der möchte sie an heissen Tagen auch ausschliessen können. Zur Beschattung auf Süd- und Westseite dienen bei diesem Projekt einerseits das Vordach sowie der 1 m tiefe Balkon. Zusammen ergeben sie – seitlich durch eine Blende abgeschlossenen – einen geschützten Aussenraum. Er ist dem Wohnen, Essen und der Küche bzw. im OG dem Arbeits- und Schlafzimmer vorgelagert. Betont werden sollte, dass es sich um einen privaten Bereich handelt. Diesen Gedanken unterstützt auch die in diesem Bereich beMinergie-P Kennzahlen Haus Oberländer Minergie-P bedingt ein eigenständiges, am niedrigen Energieverbrauch orientiertes Gebäudekonzept. Um die Zertifizierung zu erhalten, müssen u. a. folgende Anforderungen eingehalten werden: Energiebezugsfläche: 253m2 Primäranforderungen an Gebäudehülle: Dieser Grenzwert gilt als Mittelwert über das ganze Gebäude. Haus Oberländer: Anforderung 31.4, erreicht 23.1kWh/m2 Grenzwert Minergie-P: Der Energiebedarf für Heizung, Wassererwärmung, Komfortlüftung. Haus Oberländer: Anforderung 30.0, erreicht 27.7 kWh/m2 Luftdichtigkeit der Gebäudehülle: N50 Drucktest gemessen vor Ort. Haus Oberländer: Anforderung 06, erreicht 0.2 NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 MINERGIE-P sonders fein gehobelte Fassadenschalung. Gegen Westen dient das Dach des Sockelgeschosses mit Keller und Garagenräumen ausserdem als Sitzplatz, hier geniesst man ungehinderten Fernblick. Bauherrschaft Sabine und Frank Oberländer Sunnhalderstrasse 19 8489 Wildberg NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 Kleine Fenster an Nord- und Ostfassade Auf der Nord- sowie der Ostseite ist das Sockelgeschoss praktisch uneinsehbar und äusserst privat gestaltet. Das Gebäude zeigt sich kubisch geschlossen, was die kleinen, in die Fassade geschnittenen Fenstern betonen. Die Fassadenschalung ist in einer groben, sägerohen Art ausgeführt, speziell zu erwähnen ist der Hauszugang: Vom Sockelbereich gelangt man über eine Aussentreppe, die zwischen Kellerwand und einer zusätzlichen Betonwand errichtet wurde, zum Eingangsbereich. Sanft fällt das Tageslicht auf die Stufen, das transparente Dach, ausgeführt in Holz- Fieberglaskonstruktion filtert dezent. ■ Architekt Bauatelier Metzler GmbH Lussistrasse 7a 8536 Hüttwilen Tel. 052 740 08 81 www.bauatelier-metzler.ch Haustechnik E. Fuchs AG Kieswerkstrasse 4 8355 Aadorf Tel. 052 368 03 03 www.efuchs-ag.ch 47 DAS NEUE BÜROGEBÄUDE DER AXPO AG IN BADEN Nachhaltig gebaut und dafür ausgezeichnet Die Axpo AG konnte ihr neues Bürogebäude an der Verenastrasse in Baden beziehen. Nebst einer aufwändigen Fassadengestaltung die neue Akzente setzt, zeichnet sich das Gebäude durch eine vorbildliche Energiebilanz aus. Im Vergleich zu einem konventionell erstellten Gebäude sind Energieeinsparungen von bis zu 50 Prozent möglich. Die Bauherrschaft – die Axpo AG (vormals NOK) Die Axpo AG engagiert sich als Energieversorgungsunternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, in der Stromproduktion, der Stromübertragung sowie im Handel und Vertrieb. Den Strom für ihre Kunden produziert die Axpo AG aus Kernenergie, Wasserkraft und erneuerbaren Energien. Die 1914 gegründete Axpo AG beschäftigt heute über 1600 Mitarbeitende und ist zu 100 Prozent im Besitz der Axpo Holding AG, die ihrerseits vollständig den Nordostschweizer Kantonen gehört. 48 Das Gebäude Das neue Bürogebäude der Axpo AG in Baden entspricht hohen Energiestandards und widerspiegelt damit die Nachhaltigkeitspolitik des Unternehmens. Der Neubau stellt das erste nachhaltig gebaute Bürohaus dieser Grösse im Kanton Aargau dar. Das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich liess unter drei Dutzend verschiedenen Bauten zehn auswählen, die den Anforderungen des nachhaltigen Bauens am besten gerecht werden. Der Neubau an der Verenastrasse gehört zu diesen Top Ten. Das neue Bürogebäude erfüllt die Anforderungen der Standards Minergie, Minergie Eco und SIA Effizienzpfad Energie, teilweise übertrifft es diese sogar klar. Dazu tragen nebst der hohen Wärmedämmung unter anderem die Wärmeerzeugung bzw. Kühlung mittels Grundwasserwärmepumpen und eine volumenstromgeregelte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung bei. Beispielsweise kommt das Gebäude mit einer Heizenergie von 48 MJ/m2 und Jahr aus, das Minergie-Label erlaubt bis zu 110 MJ. Insgesamt kann die Betriebsenergie des neuen Bürobaus im Vergleich zum Bedarf eines konventionellen Gebäudes halbiert werden. Erstes Bürogebäude im Kanton Aargau mit Minergie-EcoStandard Optimiert wurde das Gebäude nicht nur bei der Betriebsenergie, sondern auch bezüglich der Herstellungsenergie. Beim Bau wurden nur gut verfügbare Rohstoffe und ein hoher Anteil an Recyclingbaustoffen eingesetzt, so NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 PUBLIREPORTAGE 4B zum Beispiel ausschliesslich Recyclingbeton. Zudem stammen mindestens 20 Prozent der Heizenergie aus erneuerbaren Quellen und auch die gesundheitlichen Kriterien wie optimale Tageslichtnutzung, geringe Lärmemissionen und Schadstoffbelastung der Raumluft wurden umgesetzt. Damit ist es das erste Bürogebäude im Kanton Aargau mit Minergie-Eco-Standard. Dieser erfordert nebst Energieeffizienz auch eine gesunde und ökologische Bauweise. Die werkvertraglich vereinbarte Nachweisdokumentation über die «Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten» nach SIA493, umfasste allein im Bereich Fassadenbau über 110 Seiten. «Axpo ist sich der Bedeutung nachhaltigen Verhaltens bewusst und handelt danach», sagt Manfred Thumann, CEO Axpo AG. «Mit diesem Gebäude setzen wir höchste umwelttechnische Standards bezüglich eines Ressourcen schonenden Baus und Betriebs um. Wir werden uns auch weiterhin für die effiziente Nutzung von Energie einsetzen.» Das neue Bürogebäude besteht aus einem viergeschossigen Hauptteil und einem zweigeschossigen Verbindungsbau zum bestehenden Hauptgebäude. Von aussen besticht die vorgehängte Fassade aus Glas, durch das eine farbige Folie durchschimmert. Sie sorgt zusammen mit dem begrünten Dach und den Garteninseln für eine optimale Eingliederung in die Umgebung. Der Neubau bietet Raum für rund 150 Mitarbeitende sowie moderne Sitzungszimmer und ein grosszügiges Personalrestaurant. ■ 4B Fassaden AG an der Ron 7 CH-6281 Hochdorf Tel. +41 (41) 914 57 57 www.4-b.ch NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 49 FLUMROC Steinwolle für Schallschutz und Optik Direkt am Bahngleis in Dietikon steht eine neue Zentrumsüberbauung. Flumroc-Steinwollplatten schützen die exponierten Gebäude vor Lärm. Die gedämmte Fassade überzeugt auch optisch. Einundzwanzig, zweiundzwanzig – und schon liegt der in der Sonne schimmernde Gebäudekomplex weit zurück. Wer mit dem Intercity an der Überbauung Trio in Dietikon vorbeifährt, kann das unmittelbar an den Gleisen gelegene Bauwerk kaum genau betrachten. Es umfasst 112 Wohnungen, 1650 Quadratmeter Bürofläche, 4000 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie ein Parking mit 150 Kundenparkplätzen und gehört zu den interessantesten Bauprojekten der Region – viel zu schade, um achtlos daran vorbeizufahren. Herausforderung Schallschutz In Sachen Schallschutz war die exponierte Lage der Überbauung zwischen Bahnlinie und Kantonsstrasse eine Herausforderung für das Planungsteam. Auf der Bahnseite entschieden sich die Planer für eine vorgehängte Glasfassade in leichter, transparenter Optik. Trotz 160 Millimeter dicker Dämmung umhüllt sie die fünf Gebäude scheinbar schwerelos. Die verwendete FlumrocDämmplatte DECO eignet sich besonders für durchschei- Das Lichtspiel der Glasfassade wird durch spezielle Steinwollplatten von Flumroc ermöglicht. Bild: Karl Steiner AG 50 Die Überbauung Trio in Dietikon bietet Raum für Wohnungen, Läden und Büros. Bild: Karl Steiner AG NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 PUBLIREPORTAGE Vor dem Zuglärm schützen Flumroc-Dämmplatten. nende Fassaden (siehe Kasten). Neben dem Schallschutz und den optischen Vorzügen dient die Steinwolle auch dem vorbeugenden Brandschutz – sie ist nicht brennbar und weist einen Schmelzpunkt von über 1000 Grad Celsius auf. Schwierige Rahmenbedingungen Auch bei der Organisation der Bauarbeiten war die Lage der Gebäude für den Generalunternehmer Karl Steiner AG ein Thema. Für den Güterumschlag blieb den Berufsleuten nur eine schmale Piste zwischen den Gleisen und dem Baukörper. Eine Belieferung per Bahn war aus technischen Gründen nicht möglich. Und auf der Vorderseite der Überbauung war der Verlad nicht erlaubt, weil die Kantonsstrasse zu stark befahren ist. Minergie-zertifiziert Die fünf Trio-Gebäude präsentieren sich hell, frisch und grosszügig. Die Überbauung ist Minergie-zertifiziert und mit einer Wärmepumpe ausgerüstet. Diese bezieht Wärme aus der Limmat und versorgt sowohl Bodenheizung als auch Warmwasseraufbereitung. ■ Dekorative Dämmplatte Die Flumroc-Dämmplatte DECO wird nach der Montage grundiert und zweimal im gewünschten Farbton gestrichen. Sie eignet sich deshalb optimal für Aussenwände mit durchscheinenden, vorgehängten Fassaden. Der bewährte zweischichtige Aufbau und die Wellfaserstruktur auf der harten Aussenseite erleichtern die Arbeit auf der Baustelle. Die Innenseite der Steinwollplatte ist geschliffen. Die Flumroc-Dämmplatte DECO ist ideal für durchscheinende Fassaden. Die Flumroc AG in Kürze Die Flumroc AG ist die landesweit führende Herstellerin von Mineralwolleprodukten zur Wärmedämmung sowie für den Schall- und Brandschutz. Sie beschäftigt 290 Mitarbeitende (inkl. 24 Lernende) und gehört damit zu den grössten Arbeit– gebern im Sarganserland. Die Flumroc AG engagiert sich seit Jahren aktiv für energieeffiziente Lösungen und ganzheitliche Energiekonzepte. Sie weist immer wieder auf das grosse Energiesparpotenzial im Baubereich hin und fördert Energiestandards wie Minergie, Minergie-P und Passivhaus. NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 Flumroc AG Industriestrasse 8 8890 Flums Tel. 081 734 11 11 www.flumroc.ch 51 UMBAU BAUERNHAUS BERTSCHIKON Altes Haus im neuen Kleid Gerhard Catrina Der Bauherr eröffnete mir seinen Wunsch, das Elternhaus – ein 150-jähriges Bauernhaus in der Landwirtschaftszone – in ein Minergie-P Haus umzubauen und dabei auch den Wohnraum zu vergrössern. Dank unserer engen und sehr konstruktiven Zusammenarbeit konnte ich ein Konzept entwickeln, welches in allen Punkten den Wünschen der Bauherrschaft entsprach und auch bewilligungsfähig war. Selbstverständlich hat der Umbau des alten Bauernhauses in ein Minergie-P Haus einige harte Knacknüsse mit sich gebracht: Selbst noch während der Bauzeit mussten Änderungen am Konzept vorgenommen werden, weil die alte Bausubstanz den Anforderungen der modernen Technik nicht genügte. So wurde z. B. die im Dachgeschoss geplante Wärmepumpe inkl. Speicher in den ehemaligen Kuhstall verlegt, weil die Belastung für die bestehenden Balken zu gross gewesen wären. 52 NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 MINERGIE-P Die Lüftungsführung wurde laufend den vorgefundenen Gegebenheiten angepasst, damit diese sich optimal in den Baukörper einfügt. Der Blower-Door-Test (Test für die Luftdichtigkeit des Hauses, unabdingbar für das MinergieP-Zertifikat) stellte sehr hohe Anforderungen an alle Handwerker, was Sorgfalt und Präzision bei den Abdichtungen der alten Bauteile erforderte. Die Konstruktion des Stalldachs wurde völlig neu konzipiert, um einen stützenfreien Anbau zu realisieren. NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 Selbstredend gibt es Sonnenkollektoren, Wärmepumpe und kontrollierte Lüftung in allen Räumen, sowie einen Grauwassertank für WC-Spülung, und Gartenbewässerung. Architektur Das Haus präsentiert sich gegen aussen optisch fast unverändert, nur der vor ca. 100 Jahren gemachte Anbau wurde entfernt, und auf dem Dach befindet sich ein Son53 UMBAU BAUERNHAUS BERTSCHIKON nenkollektor. Gut sichtbar sind die im neuen Scheunenteil untergebrachten Wohnräume. Die grossen Fenster sind geschickt mit mobilen, lamellenartigen Holzwänden als Sonnenschutz versehen. Die Küche und der Essraum befinden sich neu auf dem Niveau des ehemaligen Stalls, 80 cm tiefer als der angrenzende Wohnraum im alten Teil. Beide Niveaus sind in der ganzen Breite offen sichtbar und mit einer raffinierten mobilen Treppe verbunden, die je nach Bedürfnissen verschoben werden kann. Die Familie Peter wohnt nun seit Juli 2010 im neuen alten Haus und wie sie mir versichert hat, fühlt sie sich dabei wohl und zufrieden. Wie viel raffinierte und ausgeklügelte Technik, verbunden mit subtiler Renovation von alter Bausubstanz und neuer Architektur sich darin verbirgt, wird von aussen wohl niemand erahnen können ■ Bauherrschaft Familie Peter Benklen 11 8614 Bertschikon 54 Architekt Gerhard Catrina Architekturbüro AG Grundstrasse 16a 8712 Stäfa Tel. 043 477 10 50 www.catrina.ch Kennzahlen Bauernhaus alt: Bauernhaus mit Erweiterung im ehemaligen Stall: Raumprogramm: UG: EG: Neuer Teil: EG: Alter Teil: OG: Neuer Teil: OG Alter Teil: Estrich kalt: Stall: 145 m2 inkl. Anbau 233 m2 Waschküche, Keller Eingang, WC/ Dusche, Küche, Wohnessraum Wohnzimmer, Gastzimmer, Treppenhaus 2 grosse Zimmer, à ca. 25 m2 2 Zimmer à ca 15 m2, Bad, Dusche/ WC Lüftungszentrale Technikzentrale HLK-Ingenieur hässig sustech gmbh Ingenieurbüro Weiherallee 11a 8610 Uster Tel. 044 940 74 15 www.sustech.ch NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 MINERGIE-P Ihr Berater und Fachplaner, wenn es um MINERGIE (-P) geht Über 20 Jahre Erfahrung – siehe Referenzen unter www.sustech.ch hässig sustech gmbh, 8610 Uster 044 940 74 15 NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 MINERGIE-P – Modernisierung 55 SWISSOLAR Solarstrom vom eigenen Dach Die Photovoltaikanlage von Ehepaar Matti wurde von der BE Netz AG in Ebikon LU realisiert: Die Solarmodule sind auf das Dach aufgebaut. Bilder: BE Netz AG Immer mehr Einfamilienhausbesitzer überlegen sich, eine Solarstromanlage zu installieren. Viele Argumente sprechen dafür, auch wenn die kostendeckende Einspeisevergütung angesichts der langen Wartelisten noch weit entfernt scheint. Kleine Anlagen, die in erster Linie Strom für den Eigenbedarf liefern, sind bereits heute attraktiv. «Wir sind stolz, selber Strom zu produzieren», erzählt Christian Matti. Im Moment rechne sich die Photovoltaikanlage auf ihrem Reiheneinfamilienhaus im bernerischen Mühlethurnen zwar nicht. Denn sie stehe wohl noch längere Zeit auf der Warteliste für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV). Doch Matti beobachtet die Situation gelassen: «Wir hätten die Anlage auch ohne KEV gebaut. Wir wollten unseren Beitrag zu einer sauberen Energieversorgung leisten.» Eine Überlegung von Claire und Christian Matti war, dass sie mit der PV-Anlage den Strom für ihre Wärmepumpe bereitstellen können. Einen Beitrag leisten Ähnlich sieht es auch Manfred Haag aus Pfäfers: Er hat seine PV-Anlage zwar zur KEV angemeldet. Doch er hätte auch sonst auf Solarstrom gesetzt. Als er sein Elternhaus energetisch sanierte, war klar, dass er das Warmwasser im Sommer nicht mehr mit der Ölheizung bereitstellen wollte – aus finanziellen und ökologischen Gründen. Da lag es für ihn auf der Hand, gleich Module zur Produktion von Solarstrom zu integrieren. «Ich hatte ein Budget für 56 die gesamte Sanierung, dabei waren die 25 000 Franken für die PV-Anlage nicht der grösste Teil», so Manfred Haag. «Jeder sollte im Rahmen seiner Möglichkeiten etwas tun, denn die fossilen Energien sind beschränkt und der Neubau eines Kernkraftwerks ist umstritten.» Dass die Energie immer teurer wird, ist ein weiteres Argument für den Bau einer Solarstromanlage. So auch für Michel Perrenoud aus Epalinges: «Die Solarenergie steht unbegrenzt zur Verfügung.» Sind die Investitionen getätigt, produziert die PV-Anlage für die nächsten 20 bis 30 Jahre Solarenergie zum gleichen Preis. Anders der Strom vom Netz: Allein für 2011 rechnet der Verband Schweizer Elektrizitätsunternehmen VSE mit einer durchschnittlichen Preiserhöhung um 4 Prozent. Beim Solarstrom zeigt die Entwicklung genau in die umgekehrte Richtung: In den letzten Jahren sanken die Preise für PV-Anlagen stetig und damit auch diejenigen für den Solarstrom. Die Kosten tief halten konnte Michel Perrenoud, weil er als diplomierter Elektroinstallateur einen Teil der Installationsarbeiten selbst durchführte. Er hat auch Zeit und Engagement in die Planung seiner Photovoltaikanlage gesteckt. «Für mich war das eine Art Hobby», so der aktive Pensionär. Unterschiedliche Montagemöglichkeiten Photovoltaikanlagen lassen sich auf praktisch jedem Hausdach installieren. Ideal ist eine Ausrichtung von Südost bis Südwest und eine Dachneigung von 30 bis 60 Grad. Der Einfluss der Schräge und der Abweichung von Süden NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 PUBLIREPORTAGE ist jedoch relativ moderat: Der Minderertrag eines direkt gegen Südwesten gerichteten Daches mit einer Neigung von 30° liegt bei etwa 5 Prozent. Solarmodule können entweder ins Dach integriert oder aufgebaut installiert werden. Auf Flachdächern werden die Module im idealen Winkel auf Ständern montiert. Manfred Haag wählte eine dachintegrierte Lösung, weil er das Dach bei der energetischen Sanierung sowieso erneuerte: Die Solarmodule wurden direkt auf den Dachunterbau verlegt und ersetzen die Dachziegel. Ehepaar Matti hingegen entschied sich für eine Lösung, bei der die Solarmodule auf das bestehende Dach montiert werden. «Unser Reiheneinfamilienhaus ist erst einige Jahre alt», so Matti. «Das Dach war also noch wie neu.» Auch auf Vordächern, Sonnenschutzvorrichtungen oder an Fassaden lässt sich Solarstrom produzieren. Welche Flächen sich eignen, welche Solarzelltechnologie und Montagelösung am besten geeignet ist, wissen die Planer und Solarinstallateure. Unter www.solarprofis.ch ist eine Liste ausgewiesener Fachleute zu finden. Anschluss ans Netz Solarstromanlagen werden in der Regel ans öffentliche Stromnetz angeschlossen. Der lokale Energieversorger ist zur Abnahme des Stroms verpflichtet. Bei Kleinanlagen kann man über das sogenannte Netmetering abrechnen: Im Zähler werden Stromproduktion und -bezug saldiert. Somit wird der Solarstrom in erster Linie vom Produzenten direkt genutzt. Für Kleinanlagen bis zu 3 Kilowatt liegt der Einspeisetarif gemäss der neuen Empfehlung des Bundesamtes für Energie (BFE) gleich hoch der Bezugstarif, solange die abgegebene Strommenge den Eigenbedarf im saisonalen Mittel nicht überschreitet. Bei grösseren Anlagen entspricht die Vergütung dem Grosshandelspreis für Strom, also rund 6 bis 8 Rappen. Es gibt jedoch auch Elektrizitätswerke, die bei Anlagen über 3 Kilowatt das Prinzip des Netmetering anwenden. Dank der neuen Vergütungsempfehlungen sind Kleinanlagen auch ohne KEV attraktiv. Ein Rechenbeispiel: Eine Solarstromanlage mit einer Leistung von 3 Kilowatt kostet zwischen 21 000 bis 26 000 Franken. Davon lassen sich in den meisten Kantonen rund 3000 Franken durch Steuerab- NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 Bei der energetischen Sanierung seines Hauses liess Manfred Haag Sonnenkollektoren und Photovoltaikmodule ins Dach zu integrieren. Realisiert wurde die Anlage durch die Heizplan AG in Gams.Bild: Manfred Haag züge einsparen. Bei einer Vollkostenrechnung kämen noch Unterhalts- und Kapitalkosten hinzu. Die Anlage erbringt bei optimaler Positionierung einen Ertrag von 3000 Kilowattstunden. Dies deckt ungefähr den Stromverbrauch einer 4-köpfigen Familie (ohne Elektroboiler). Bei Strompreisen von 20 Rappen pro Kilowattstunde spart die Familie also rund 600 Franken pro Jahr. Aufgerechnet auf die Lebensdauer einer Anlage von 25 Jahren entspricht dies 15 000 Franken. Abbau der KEV-Warteliste beschleunigt Michel Perrenouds Anlage gehört mit 4,4 Kilowatt Leistung nicht mehr zu den Kleinanlagen. Er speist den ganzen Strom ins öffentliche Netz ein. Dafür erhält er vom lokalen Netzbetreiber zurzeit 12 Rappen pro Kilowattstunde. In etwa drei Jahren wird ihm über die KEV 74 Rappen vergütet. Dass er als Solarstromproduzent vorübergehend drauflegt, ist für Perrenoud kein Problem: «Damit leiste ich einen Beitrag zum Schutz der Umwelt.» Die KEV-Warteliste ist bis Ende August 2010 auf 6600 Anlagen angewachsen. Doch laut Swissgrid zeichnet sich ab 2011 eine Entspannung der Situation an: Der Ständerat 57 SWISSOLAR PUBLIREPORTAGE Michel Perrenouds Anlage, realisiert von Solstis, soll jährlich 4000 bis 5000 Kilowattstunden Strom produzieren.Bild: Michel Perrenoud hat die maximale Fördersumme für Anlagen zur Produktion erneuerbarer Energien um 50 Prozent erhöht. Ab 2011 werden wieder Anlagen zur KEV zugelassen, in drei Jahren sollte die jetzige Warteliste abgebaut sein. Zudem bieten einige Kantone, wie Appenzell Ausserrhoden, Thurgau, Schaffhausen oder Baselstadt, oder auch einige Elektrizitätswerke und Kantone Überbrückungsbeiträge bis zur KEV an. Einen anderen Weg überlegt sich zurzeit Manfred Haag. Nämlich seinen Solarstrom über die Naturstrombörse Ostschweiz anzubieten. Hier könnte er über eine Internetplattform seinen Solarstrom direkt an lokale Abnehmer verkaufen. Positive Nebenwirkungen Mit kleinen PV-Anlagen, die in erster Linie Elektrizität für den Eigenbedarf liefern, lassen sich beträchtliche Unterschiedliche Solarzelltechnologien Solarzellen wandeln das Sonnenlicht in elektrische Energie um. Die Entwicklung brachte eine grosse Vielfalt an Solarzellen-Technologien hervor. Weitaus am häufigsten kommen kristalline Siliziumzellen zum Einsatz, die einen Wirkungsgrad von bis zu 20 Prozent erzielen. Silizium ist das zweithäufigste Material der Erdkruste, womit die Versorgung langfristig sichergestellt ist. Daneben gibt es eine Vielfalt von Dünnschicht-Solarzellen aus amorphem Silizium, Kupfer-Indium-Selenid und weiteren Materialien. Sie brauchen deutlich weniger Material als kristalline Zellen und können kostengünstiger produziert werden. Allerdings haben sie einen tieferen Wirkungsgrad. Erst im Forschungsstadium sind Zellen aus organischen Kunststoffen, zu denen auch die bekannten Grätzel-Zellen gehören. Stromkosten einsparen. Erhält ein Betreiber eine kostendeckende Einspeisevergütung, ist die Anlage klar rentabel. Doch im Vordergrund steht bei den meisten Bauherren das persönliche Engagement. «Es gibt ein gutes Gefühl, Solarstrom zu produzieren», so Manfred Haag. «Ein Erfolgserlebnis» nennt es Christian Matti. Zudem animiere die Solaranlage zu einem effizienteren Umgang mit elektrischer Energie. «Wenn unser Verbrauch die Produktion übersteigt, überlegen wir uns, welches Gerät wir ausschalten könnten», so Matti. Schliesslich gibt einem die Energie vom eigenen Dach ein Stück Unabhängigkeit – vor allem vor dem Hintergrund steigender Strompreise. Ein gutes Argument, auch ohne kostendeckende Einspeisevergütung. ■ KEV in Kürze Die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) garantiert den Betreibern von Photovoltaikanlagen, den produzierten Strom während 30 Jahren zu einem garantierten Preis an das örtliche Elektrizitätswerk zu verkaufen. Finanziert wird die KEV über eine Abgabe auf dem gesamten Strom von aktuell 0,45 Rappen pro Kilowattstunde. Dieser Betrag kann bis 0,9 Rappen erhöht werden. Die Einspeisevergütung wird entsprechend der Kostenentwicklung bei Photovoltaikanlagen abgesenkt, jährlich um mindestens 8 Prozent. Aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung bei PV-Komponenten wurde der Preis 2010 um zusätzlich 10 Prozent abgesenkt. Anlagen, die eine KEV-Zusage haben und bereits in Betrieb stehen, sind von den Absenkungen nicht betroffen. Die nationale Netzgesellschaft Swissgrid ist für das KEV-Anmeldeverfahren der Anlagen zuständig und wickelt die Erfassung der Anlagen ab. KOMPETENTE UNTERNEHMEN FÜR SOLAR- UND PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN www.hoval.ch www.schweizer-metallbau.ch www.soltop.ch www.3-s.ch www.waltermeier.com www.stiebel-eltron.ch www.conergy.ch www.benetz.ch 58 NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 SCHWEIZER QUALITÄT DER A-KLASSE PUBLIREPORTAGE Conergy Sunrise Eco – die energieeffiziente Solaranlage für das Einfamilienhaus tem entwickelt, das 90 % weniger Energie verbraucht als herkömmliche Anlagen. Extreme Sparsamkeit gepaart mit höchster Effizienz. Damit setzt Conergy einen weiteren Meilenstein. Energieeffiziente Pumpe und modernste Reglertechnik Herzstück dieser revolutionären Neuentwicklung sind eine extrem sparsame Pumpe mit ECM-Technologie und eine komplett neu entwickelte Reglertechnik, die im Zusammenspiel den Stromverbrauch um 90 % reduzieren. Die neue Drehzahlregelung VarioFlow® ermöglicht zudem eine stufenlose Regelung der Pumpendrehzahl von 0 bis 100 %. Dadurch kann die Sunrise Eco selbst bei schwacher Sonneneinstrahlung Energie gewinnen und erzielt erheblich längere Laufzeiten. Weniger Input – noch mehr Output. Conergy präsentiert ihre neueste Entwicklung, die erste energieeffiziente Kompakt-Solaranlage für das Einfamilienhaus. Mit der Energieeffizienzklasse A entspricht sie den heutigen Anforderungen an die Haustechnik. Durch das bewährte BackBox®System läuft die Sunrise® Eco sicher und wartungsfrei. Die Sonne ist heute schon eine wichtige Energiequelle für Warmwassergewinnung im Einfamilienhaus. Im Neu- oder Umbau entscheiden sich immer mehr Bauherren für diese umweltfreundliche Technik und profitieren von der «kostenlosen» Energie der Sonne. Mit modernen Systemen wird die Solartechnik einfach, sicher und effizient. 90 % Energieeinsparung Der Stromverbrauch der Solarpumpe der Sunrise Eco kostet im Jahr etwa soviel wie ein Café-Crème! Bei herkömmlichen Solaranlagen ist der Stromverbrauch seit langer Zeit ein Diskussionsthema. Jetzt hat Conergy ein SysNACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 Tausendfach bewährtes BackBox®-System Ein Problem von konventionellen Solaranlagen sind die Überhitzung und die damit verbundene Dampf- und Gasbildung im Solarkreislauf. Die Lösung dazu wurde von Conergy bereits vor über 10 Jahren vorgestellt: Das BackBox System. Durch eine intelligente Entleerung der Kollektoren bei Erreichen der gewünschten Boilertemperatur wird jede Überhitzung ausgeschlossen. Sämtliche Komponenten der Solaranlage werden so geschont. Seit der Einführung wurden viele tausend BackBox-Systeme installiert. Diese Technologie steht für Anlagen jeder Grösse zur Verfügung, von der Kompaktanlage für Warmwasser im Eigenheim bis zur Grossanlage im Mehrfamilienhaus oder in öffentlichen Gebäuden. Conergy Schweiz – Ihr professioneller Partner für Solartechnik Seit bald 25 Jahren ist die Schweizer Conergy GmbH in Flurlingen marktführend im Solarbereich. Als Entwickler und Hersteller von Solaranlagen für Warmwasser, Heizung und Strom bietet Conergy GmbH ein umfassendes Produktsortiment und Komplettlösungen aus einer Hand. ■ Conergy GmbH Winterthurerstrasse 8247 Flurlingen Tel. 052 647 46 70 www.conergy.ch 59 MFH SEGANTINISTRASSE HÖNGG Von Energieschleuder zum PlusHeizenergieHaus Carmen Eschrich Höchst motiviert erwarb die Bauherrschaft vor zirka 4 Jahren das 3stöckige Wohnhaus an Zürichs prominentestem Südhang, dem Höngger Berg. Eine ökologische und nachhaltige Optimierung des Gebäudes aus den 50iger Jahren war gefragt – das Ergebnis wurde nach Minergie-P zertifiziert und mit dem Schweizer Solarpreis 2010 ausgezeichnet. Das bestehende Gebäude wies eine äusserst gute Bausubstanz vor, die Wände aus massiven Zweischalen-Mauerwerk mit mineralischem Aussenputz waren tadellos. Das Tragwerk war also noch gut in Schuss, ein Ersatzneubau stand daher nicht zur Diskussion, auch der Grauenergie zuliebe. Dringenden Einsatz geboten jedoch die Erneuerung der Badezimmer und Küchen, da hier seit der Entstehung keine Arbeiten ausgeführt wurden. Weniger aus ästhetischen, jedoch aus energetischer Sicht umso wichtiger war der Ersatz der zentralen Ölheizung aus dem Jahr 1983. Sonne pur – aktiv und passiv Das schlüssige Gesamtkonzept des Architekturbüros Kämpfen basiert auf aktiver und passiver Nutzung der Son60 NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 MINERGIE-P nenenergie und überzeugte die Bauherrschaft – die Zusammenarbeit war besiegelt. Passiv wird die kostenlose Energiequelle Sonne über die Grundrissgestaltung genutzt: Ähnlich dem Bestand, jedoch offener gestaltet sind die Wohnräume hauptsächlich gegen Südosten oder Südwesten ausgerichtet – Treppe, Küchen und Bäder liegen auf der Nordwestseite. Die Attikawohnung wurde als kompaktes Volumen auf dem Dach platziert und hilft, die Investitionskosten zu amortisieren. Vorfabrikation en vouge Konsequent wurden die neu angefügten Bauteile zur Grundrisserweiterung und zur Fassadenoptimierung aus Holzelementen erstellt. Sie heben sich deutlich durch eine NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 unbehandelte Lärchenschalung vom grau verputztem Bestand ab. Neu ist der Einsatz vorfabrizierter Holzwände und -decken auf dem Schweizer Markt nicht mehr, bieten sie doch grosse Vorteile in passgenauer und äusserst präziser Ausführung. Beat Kämpfen reizte mit einem Team von erfahrenen Holzbauingenieuren und motivierten Unternehmern den Stand der Technik aus. In die Elemente, die üblicherweise aus dem ausgedämmten Holzraster bestehen, wurden auch die Lüftungskanäle und Elektroleitungen bereits im Werk eingebaut. Dafür war ein exaktes Aufmass des Bestands erforderlich um Öffnungen und Abmessungen für die Fabrikation berücksichtigen zu können. Die Fachhochschule Nordwestschweiz führte das erforderliche Laserscanning der bestehenden Fassaden durch. Mit die61 MFH SEGANTINISTRASSE HÖNGG MINERGIE-P sen Messresultaten konnten alle beteiligten Unternehmer die Elemente millimetergenau erstellen und einbauen. Nachhaltige Energiequellen Die Hülle wurde mit 20 cm aufgesetzer Dämmung optimiert, der Energieverbrauch konnte so erheblich gesenkt werden. Das Warmwasser wird zu 60 % über Sonnenkollektoren generiert, den Rest liefert eine Erdsonden-Wärmepumpe. Die Dachfläche des Attikageschosses ist komplett mit einer von unten nicht sichtbaren Photovoltaik-Anlage der Firma BE Netz AG belegt. Die bestehenden Radiatoren werden weiterhin verwendet und schaffen warme Räume. Die Sanierung hat Vorbildcharakter und resultiert in einem bilanzierten Plus-Heizenergie-Haus. ■ Bauherrschaft Peter Rieben Segantinistrasse 200 8049 Zürich Architekt kämpfen für architektur ag Badenerstrasse 571 8048 Zürich Tel. 044 344 46 20 www.kaempfen.com Energietechnik naef energietechnik Ingenieur- und Planungsbüro Jupiterstrasse 26 8032 Zürich Tel. 044 380 36 88 www.naef-energie.ch 62 NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 MFH BIRMENSDORFERSTRASSE ZÜRICH MINERGIE-P Viel Lärm um Minergie-P Carmen Eschrich Die stark frequentierte Hauptverkehrsachse im Herzen Zürichs mag vielleicht nicht der ideale Wohnort für Naturliebhaber sein. Wer jedoch von bester Infrastruktur und kürzesten Wegen in der City profitieren will, wird sich im Wohnhaus von 1938 gerne einmieten. Nach der energetischen Sanierung im Minergie-P Standard wurde der Betrieb äusserst wirtschaftlich und attraktiv, der Energiebedarf beläuft sich heute nur noch auf einen Bruchteil des Bestandes. Der Bestand zeigte sich als typsicher, 6-geschossiger Altbau einer Blockrandbebauung: Dach und Aussenwände waren ungedämmt, Küchen und Bäder veraltet, die Balkonplatten stellten Wärmebrücken dar und die Wärmeerzeugung über einen Öl-Heizkessel war wenig nachhaltig. Die motivierte Bauherrschaft wollte eine sinnvolle, energetische Sanierung umsetzen, das Büro Kämpfen brachte die notwendige Erfahrung für dieses Projekt mit. NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 63 MFH BIRMENSDORFERSTRASSE ZÜRICH Grössere Wohnungen für verbessertes Lebensgefühl Die Grundrisse wurden optimiert und offener gestaltet. Aus dem der Strasse – und somit dem Lärm – zugewandten Balkon wurde ein Erker, der den Wohnraum vergrössert. Hofseitig wurde an die bestehenden Betondecken angeknüpft und so der Innenraum um einen Meter erweitert. Den Abschluss dieses Anbaus bilden die neu und bestens gedämmten Aussenwände. Konstruiert wurden diese aus Holzelementen, die vor Ort verputzt und mit den vorgestellten Balkonen aus Lärchenholz eine geschmackvolle Gestaltung erzielen. In dieses Ensemble fügt sich auch der neue Aufzug ein, der den Komfort der Erschliessung erhöht. Die innenliegenden Bäder erhalten Tageslicht über Oberlichter und können so tagsüber ressourcenschonend ohne elektrisches Licht genutzt werden. Strassenseitig durfte aus baurechtlichen Gründen nur 15cm Wärmedämmung aufgebracht werden. Investitionspotential Attikawohnung Die wirkungsvollste Wertsteigerung im Rahmen der Sanierung stellt zweifellos der Ausbau des Dachgeschosses dar. Die bis zum Giebel offene Decke im grossen Wohnraum schafft unvergleichbare Offenheit und Transparenz. Die grosszügig geschnittene Wohnung nutzt die alten Wände und erhielt ein neues Dach aus Holzelementen, das mit 30 m2 Sonnenkollektoren und 35 m2 Photovoltaik64 paneelen bestückt wurde. Dem Material treu bleibend, ist die Dreischichtplatte als Deckenuntersicht des Holzelements sichtbar. Thermischer Komfort Eine neu installierte Fussbodenheizung sorgt im Vergleich zur Wärmeverteilung über die Radiatoren aus dem Bestand für konstante Temperaturen. Die Wärme dafür liefert ein Gaskessel, unterstützt von den Sonnenkollektoren und Photovoltaikpaneelen auf dem Dach. Eine Erdsondenbohrung für einen möglichen Betrieb über eine Wärmepumpe war an diesem Standort nicht zulässig. Frische Luft statt Strassenstaub Eine systematische Lufterneuerung ist für Minergie-P Projekte obligatorisch. An der lauten Hauptverkehrsachse bietet der Einbau einer Komfortlüftung viele Vorteile, der die Fensteröffnung unnötig macht: Würde man die Fenster öffnen, wäre man nebst verschmutzter Luft auch mit Lärmbelästigung konfrontiert. Heute bleibt der Staub der Strasse im Filter hängen, die Luft wird gereinigt dem Innenraum und somit dem Bewohner zugeführt. Die Verteilung erfolgt über die neu eingezogene, abgehängte Decke im Flur und schafft moderne Wohnverhältnisse in einer alten Hülle. ■ NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 MINERGIE-P Bauherrschaft Thomas Ledermann Birmensdorferstrasse 114 8003 Zürich Architekt kämpfen für architektur ag Badenerstrasse 571 8048 Zürich Tel. 044 344 46 20 www.kaempfen.com HLK-Ingenieur Planforum GmbH Ingenieurbüro Tösstalstrasse 12 8400 Winterthur Tel. 052 213 08 05 Fenster 1a hunkeler Bahnhofstrasse 20 6030 Ebikon Tel. 041 444 04 40 www.1a-hunkeler.ch NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 65 SWISSPOR Wie Phönix aus der Asche – das neue Werk Steinhausen ist ökologisch und ökonomisch ein Musterbetrieb. Nach einer Planungszeit von nur 9 Monaten und einer anschliessenden Bauzeit von 16 Monaten werden in Steinhausen wieder hochwertige Dämmplatten aus EPS produziert. Zwei Jahre nach dem Grossbrand steht der moderne Industriekomplex da, ganz so, als wäre nichts geschehen. Wie Phönix aus der Asche; grösser, schöner, moderner und leistungsfähiger. Aussen fix… Beim Neubau wurden selbstverständlich wo immer möglich Eigenprodukte der swisspor-Gruppe verwendet. Eigene Dämmstoffe, eigene Fenster, eigene Fassade – eine Gebäudehülle mit Vorzeigecharakter. Der swisspor Neubau mit seinem grossen Bauvolumen prägt das Ortsbild von Steinhausen. Ein Grund mehr, um auf die Ästhetik des Baus ganz besonders grossen Wert zu legen. Eine echte Herausforderung für die Architekten von Cadosch & Zimmermann. Edel und zweckmässig zugleich – mit Eternit. Zusammen mit der Bauherrschaft entschied man sich für eine Verkleidung mit gewellten Faserzementplatten der Eternit (Schweiz) AG. Diese wurden in einer zweifarbigen Reflexbeschichtung realisiert. Je nach Betrachtungswinkel erscheinen die Fassadenbänder tiefblau, grau, silberfarben bis hin zu metallischen Glanz; das Gebäude verändert so immer wieder seinen Ausdruck. Gedämmt auf höchstem Niveau. Ob in der Fassade oder auf dem Flachdach, die Bauherrschaft verwendete zur Dämmung und Abdichtung immer die besten Produkte und Systeme aus eigener Herstellung. Damit kam das auf dem Markt erfolgreiche System swissporLAMBDA Vento in der hinterlüfteten Fassade zum Einsatz, auf dem Flach66 dach folgerichtig das System swissporLAMBDA Roof. Alle Bauten, mit Ausnahme des Fertigwarenlagers Ost, wurden nach den Richtwerten des Minergie-Labels gedämmt. swisswindows – für Fenster, Türen und Tore. Auch in diesem Bereich wurde soweit möglich ein Produkt aus der swisspor-Gruppe verwendet, immer das Beste für den entsprechenden Zweck und Einsatz. So kamen unter Anderem grossflächige, pulverbeschichtete Fenster aus der Serie Imago Alko zur Anwendung. Die Fensterflächen sind auf einer Stahl-Pfosten-Riegel-Konstruktion mit Sonnenschutz montiert. Bei den Fenstern ohne Brandwiderstand handelt es sich um Kunststofffenster. Die Fenster mit Brandwiderstand sind als Fixverglasungen mit Metall- oder Massivholzrahmen ausgeführt. …und innen? Auch alles vom Feinsten! Nur beste Qualität? Ja natürlich, aber dieser Entscheid ist nicht in einem Luxus-Denken begründet. swisspor will und muss selber Qualität herstellen, um der Kundschaft auch immer die besten Produkte und Leistungen anbieten zu können. Das ist das Erfolgesrezept von swisspor seit jeher und dabei bleibt es auch. Das konsequente Handeln hat seinen guten Grund. Hohe Sicherheitsstandards in der Produktion. In enger Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Institut zur Förderung der Sicherheit, sowie mit allen im Projekt Beteiligten, wurde ein Konzept welches nach heutigem Stand die bestmögliche Sicherheit bietet ausgearbeitet. Mit den fünf zentralen Elementen; modernste Brandmeldeanlage, grossdimensionierte Sprinkler- und Entrauchungsanlage, sowie einem Löschwasserrückhalte-System und einer klaren Alarmorganisation wurde ein beispielhaftes Sicherheitskonzept installiert. NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 PUBLIREPORTAGE WERK STEINHAUSEN «Ein Mann der recht zu wirken denkt, muss auf das beste Werkzeug halten.» (Goethe, Faust) Innovative Technologien und optimale Arbeitsabläufe. Natürlich wurde die Chance wahrgenommen um alle betrieblichen Abläufe optimal zu gestalten. Der ganze Herstellungsprozess, angefangen bei der Anlieferung des Rohmateriales, der Aufbereitung, über die Herstellung und Konfektionierung der Produkte bis hin zum Fertigwarenlager, für alles wurde ausschliesslich die beste Technologie gewählt. Zusammen mit dem ausgeklügelten Layout alle Arbeitabläufe, präsentiert sich das Werk Steinhausen als äusserst moderner und effizienter Produktionsstandort. ...von Menschen, für Menschen Was für die betrieblichen, produktionsbezogenen Einrichtungen gilt, soll auch für die Mitarbeiter gelten. Alle Sozialräume wurden grosszügig und hochwertig konzipiert. Funktion, Form und Farben wurden gleichermassen gewichtet. Schliesslich geht es um das Wohlbefinden – das zum Glück immer noch der wichtigste Teil einer Firma ist – den Mitarbeitenden. Das zeitgemässe Anliegen nach bestmöglicher Energieeffizienz zum Wohle der Umwelt sind keine leeren Worte. «saving energy», das Credo der swisspor-Gruppe wurde im Neubau konsequent umgesetzt. So wird die Abwärme aus dem Produktionsprozess in einem ausgeklügelten System für die gezielte Beheizung der einzelnen Arbeitszonen verwendet. Bis hin zu Heizschlaufen im Boden, für mehr Sicherheit im Winter bei der LKW-Rampe und dem LKW-Waschplatz. Im Weiteren wurde mit den Gemeindebehörden von Steinhausen ein Projekt zur Abwärmenutzung für eine Neubausiedlung beschlossen. Der AbNACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 wärmeüberschuss soll dereinst in einem Wärmeverbundsystem die Warmwasseraufbereitung der neuen Siedlung effizienter und damit umweltschonender gestalten. Damit schliesst sich der Kreis aus wirtschaftlichen, umweltpolitischen und sozialen Bedürfnissen auf harmonische Weise. Die Mitarbeitenden der swisspor-Gruppe mit ihrem Patron Bernhard Alpstaeg sind zu recht stolz auf den neuen Vorzeigebetrieb. Die Produktion ist hochgefahren, alle Prozesse funktionieren, täglich verlassen mehrere Lastwagenzüge die Logistikhallen auf den Weg zu unseren Kunden, auf die Baustelle. Kurz gesagt: Es ist alles so, wie es sein muss. Architektur / Bauleitung: Cadosch & Zimmermann GmbH Architekten ETH /SIA, Grubenstrasse 38, 8045 Zürich Tel. 044 461 98 98, www.czarch.ch Holzbauingenieur: Ivo Diethelm GmbH, Ingenieurbüro für Holzbauten, Blatten 319, 8737 Gommiswald Prozessenergietechnik: Lier Energietechnik AG, 8304 Wallisellen Bauphysik: Ragonesi Strobel & Partner GmbH, 6003 Luzern Bauingenieur Hochbau: PlüssMeyerPartner AG, 6005 Luzern Bauingenieur Tiefbau: Peter Ott AG, 6312 Steinhausen Elektroingenieur: EPZ Elektroplaner AG, 6330 Cham HLS-Ingenieur: Suter Ing. Büro, 6302 Zug Planung Sprinkleranlage: Zentex Brandschutz AG, 5432 Neuenhof Sicherheitsberatung: Sicherheitsinstitut, 8001 Zürich Geometer: Gätzi Vescoli AG, 6340 Baar Geologe: Terraproject RL Luthiger, 6300 Zug 67 KLEINTIERKLINIK ZÜRICH Verschränkte Raumskulptur Die bereits in den 1960er Jahren erstellte Anlage der Veterinärmedizinischen Fakultät geht auf einen wegweisenden Entwurf des Architekten Werner Stücheli zurück und zeichnet sich durch die klare Formensprache der Gebäudeteile und den subtilen Umgang mit differenzierten Aussenräumen aus. Der entlang mehrerer Erschliessungsachsen aufgebaute Campus schafft durch die klare funktionale Zuordnung der Bauten der Lehre und der verschiedenen Kliniken sowie der Stallungstrakte eine vielfältige Struktur aus durchgrünten Hofräumen, welche im Wesentlichen den Charakter der gesamten Fakultät bestimmt. 68 NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 MINERGIE Mit dem Neubau soll diese stimmige Konzeption des ursprünglichen städtebaulichen Entwurfes wieder aufgenommen und im Hinblick auf die geforderte weitere Verdichtung des Areals in ein neues, nachhaltiges Bebauungskonzept überführt werden. Indem der neue, T-förmige Baukörper die klare süd- westliche Begrenzung des Campus gegenüber dem Irchelpark markiert und gleichzeitig die charakteristische Hofstruktur in neuer Form NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 weiterführt, zeichnet sich die Kleintierklinik klar als öffentliche Institution innerhalb des Tierspitals aus. Architektonisch bilden die beiden senkrecht zueinander stehenden Gebäudetrakte eine komplex verschränkte Raumskulptur, deren Wahrnehmung sich in der ansteigenden Topografie immer wieder ändert, was ganz unterschiedliche Kompositionen von mehrheitlich längsgerichteten Volumen ergibt. Bedingt durch die 69 KLEINTIERKLINIK ZÜRICH MINERGIE Hanglage spielt die bewegte Dachaufsicht eine besonders wichtige Rolle und ist als eigentliche fünfte Fassadenansicht konzipiert. Die in der Regel mit einfachen, stehenden Fensterformaten rhythmisierte Fassade ist mit einem ockerfarbenen, in der Sonne leicht glitzernden Kratzputz versehen. Sie wird durch diese erdige Materialität zusätzlich mit dem Ort verbunden. An einigen architektonisch ausgezeichneten Stellen wird die kompakte Aussenhülle von grossen, gespannten Fensterflächen durchbrochen und vermittelt damit räumlich zur inneren Struktur des mäandrierenden Erschliessungsraums der Klinik. Die Erschliessungszone ist geprägt durch unterschiedliche räumliche Ausformulierungen von der weiten Eingangshalle über die schmaleren Korridorbereiche bis hin zu den geschossübergreifenden Treppenhallen und wird durch den gezielten Einsatz von Tageslichtbezügen zu einem wichtigen Orientierungssystem in der weitläufigen Anlage. Grosszügige Raumzonen wie der Pausenraum im Obergeschoss oder der Medienraum beim Haupteingang bilden Orte im Haus, wo die innere Struktur sich zum Aussenraum hin erweitert und die spürbare Dichte und Kompression der Korridore angenehm ausgleichen kann. Auch die gewählten Farben und Oberflächen im Haus sind in einer orientierungsstiftenden Funktion eingesetzt: In den Korridoren kontrastieren die honiggelben Bodenbeläge und die hell lasierten Betonwände mit den umbrafarbenen Streckmetalldecken und Türblättern und zeichnen damit den Korridorraum mit seinen räumlichen Erweiterungen als klar öffentlichen Bereich aus. Die Farbstimmung in den Behandlungs- und Untersuchungsräumen mit ihren medizinischen Einrichtungen und Apparaten unterscheidet sich ganz bewusst von der Tonalität der Korridore. Hier wird die weisse Welt der Medizin mit einem blauen Bodenbelag und umbrafarbenen Einbauten ergänzt. Der Stallungsbereich schliesslich, mit den metallenen Käfigen und Behandlungstischen in Chromstahl, wird in einem einheitlichen, eleganten Warmgrau gehalten. Zielsetzung für den Neubau der Kleintierklinik im Tierspital war die Schaffung eines vielfältig lesbaren Gebäudes, das neben der funktionalen Erfüllung der medizinischen und technischen Abläufe den Anspruch auf anregende Räume für den Austausch zwischen den Benutzergruppen einlösen und den Baukörper in selbstverständlicher Weise in den bestehenden Campus integrieren und verorten kann. ■ Bauherrschaft Baudirektion Kanton Zürich Hochbauamt Baubereich 2 Stampfenbachstrasse 110 8090 Zürich www.hochbauamt.zh.ch 70 Architekten BAUMANN ROSERENS ARCHITEKTEN ETH SIA Limmatstrasse 285 8005 Zürich Tel. 044 277 70 20 www.brarch.ch HLK-Ingenieure Luginbühl & Partner AG Minervastrasse 149 8032 Zürich Tel. 043 499 12 00 Bauingenieur dsp Ingenieure & Planer AG Stationsstrasse 20 8606 Greifensee Tel. 044 905 88 88 www.dsp.ch NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 71 MINERGIE IM KANTON ZÜRICH 5000 Gebäude zertifiziert Annähernd 6 Mio. m2 Fläche in Minergie-Qualität im Kanton Zürich - das übersteigt selbst optimistische Einschätzungen. Allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2010 sind über eine Mio. m2 beheizte Nutzfläche zertifiziert worden. Der beispiellose Erfolg innerhalb von nur 12 Jahren ist das Resultat eines intelligenten Konzeptes, das ökonomische und ökologische Vorteile mit einer Komfortsteigerung kombiniert. Nicht zu unterschätzen sind die willkommenen volkswirtschaftlichen Auswirkungen: Die Energieeinsparungen in den Gebäuden mindern die Nachfrage nach fossilen Energien; die dafür notwendigen baulich-technischen Massnahmen stützen dagegen den schweizerischen Arbeitsmarkt. Hansruedi Kunz Der seit Jahren dokumentierte Trend bei den Minergiebauten setzt sich in akzentuierter Form fort. Ende September 2010 waren insgesamt 4938 Gebäude mit 5,8 Mio. m2 beheizter Nutzfläche mit dem Minergie-Label ausgezeich72 Der Kanton Zürich baut vorbildlich: Die Kantonsschule Rychenberg in Winterthur. net. Damit sind zur Quantifizierung des Minergie-Erfolges neue Massstäbe nötig. Für die erste Million Quadratmeter brauchte es fünf Jahre, heute reicht ein Jahr für diese Fläche. Die Zahlen sind umso erstaunlicher, als dass mit der Übernahme von Mustervorschriften der Kantone 2008 die gesetzlichen Anforderungen in der Folge auch im Kanton Zürich deutlich verschärft wurden. Im Vergleich zu den gültigen Wärmedämmvorschriften garantiert der MinergieStandard indessen einen deutlichen Mehrwert. Dieser ist vor allem in einer langfristigen Werterhaltung und in einem verbesserten Schutz vor Lärm begründet. Nicht zu vergessen ist dabei auch die höhere Energieeffizienz durch die Wärmerückgewinnung aufgrund der Komfortlüftung. Mittlerweile, so ist anzunehmen, sind die Vorteile dieses Baustandards vielen Planenden und Hausbesitzern bekannt. NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 Komfort als Kriterium Tatsächlich ist der höhere Komfort von Minergie-Häusern ein überzeugendes Argument, wenn auch bei weitem nicht das einzige. Eine gut gedämmte und dichte Bauhülle garantiert ein ausgeglichenes Raumklima. Und das heisst: In Minergie-Wohnungen gibt es keine unbehaglichen Ecken und Nischen. Zudem sorgt die Komfortlüftung für einen stetigen Luftersatz – ohne Zugserscheinungen. Und ohne Lärmbelastung, ist anzufügen, weil die Lufterneuerung auch an lärmexponierten Lagen nicht über die Fenster erfolgen muss. Auf der Liste der Vorteile von Minergie figurieren seit Jahren die vergleichsweise geringen Energiekosten weit oben. Viele Fachleute prognostizieren mittelfristig steigende Energiepreise. Mit dem tiefen Energiebedarf eines Minergie-Hauses koppelt sich die Besitzerschaft wenigstens teilweise von dieser unheilvollen Entwicklung ab. Weiter im Steigen begriffen ist auch der Marktanteil von Minergie: Etwa ein Viertel der beheizten Nutzfläche in Neubauten entsprechen heute Minergie. Die grösste Zuwachsrate weisen Mehrfamilienhäuser aus. Deutlich niedriger sind die Anteile im Modernisierungsmarkt. Von den in der Statistik per Ende September 2010 ausgewiesenen 5,8 Mio. m2 entfallen 88 % auf Neubauten, lediglich 12 % oder 667'000 m2 wurden aufgrund einer Modernisierung von Altbauten zu Minergie-Flächen. Allerdings zeigt die Statistik deutlich, dass der Anteil der Modernisierungen an den gesamten Minergie-Flächen markant steigt, wenn auch noch vorderhand auf insgesamt tiefen Niveau. Das lässt den Schluss zu, dass Minergie als Baustandard auch bei Erneuerungen langsam, aber sicher an Boden gewinnt. Gut angelegtes Geld Einige Schweizer Banken offerieren für Bauvorhaben nach Minergie Hypothekardarlehen zu Vorzugszinsen, beispielsweise die Zürcher Kantonalbank (ZKB). Mit einem sogenannten Umweltdarlehen der ZKB profitiert eine Hausbesitzerschaft von einer Zinsvergünstigung von bis zu 0,8 %. Zusätzlich trägt die Bank die Zertifizierungskosten. Bei einem Einfamilienhaus mit einem begünstigten Hypothekaranteil von 200 000 Fr. ergeben sich Kostenvorteile von bis zu 8000 Fr. Bis zu 5000 Franken als Renovationsbonus erhalten private Hausbesitzer von der ZKB, die ihr Eigenheim nach ökologischen Kriterien renovieren. Der Nutzen derartiger Aktionen ist zweifach. Einerseits werden dadurch umweltfreundliche Bauweisen direkt gefördert, andererseits hat die Empfehlung der Finanzexperten zur Anwendung des Baustandards bei Investoren erhebliches Gewicht. Die positive Einschätzung basiert auf einer ZKB-Untersuchung, wonach Minergie-Bauten schon nach 15 Jahren 10 % mehr Wert sind als übliche Objekte. Neben dem höheren Komfort ist es die verbesserte Wertsicherung, die für Minergie spricht. Fazit: Minergie stimmt auch auf der Kostenseite! Minergie als Planungshilfe Kosten sparen lässt sich mit Minergie oftmals schon beim Bau oder bei der Sanierung. Denn durch die frühzeitige Erhebung von Nutzerbedürfnissen in der Planungsphase ergeben sich präzise Bedarfswerte für Luftvolumen, Kälte NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 und Wärme. Gerade bei grossen Bürobauten führt die Abstimmung mit dem Minergie-Standard zu einer Verschlankung der Haustechnik. Dadurch spart der Investor und der spätere Nutzer dreimal: bei der Investition, bei der Wartung der installierten Anlagen sowie bei deren späteren Instandsetzung. An die Umwelt denken Ganz offensichtlich ist für viele Hausbesitzer der Schutz unserer Umwelt – und damit ein energiesparender Baustandard –ein Thema. Ein Minergie-Haus stösst deutlich weniger CO2 aus als ein übliches Objekt. Sehr viel niedriger sind auch die Emissionsraten von Luftschadstoffen. Gerade der Aspekt der Umweltbelastung ist von besonderer Brisanz. Denn in der Regel haben Bauten eine Lebensdauer von vielen Jahrzehnten. CO2- und Schadstoff-Frachten fallen also während 30 bis 80 Jahren an. Leider lässt sich ein Haus später kaum – oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand – nachrüsten. Deshalb ist es auch aus energiepolitischer Sicht von grosser Bedeutung, dass die heute realisierten Baumassnahmen zukunftsfähig sind. Beliebte Förderung Unter den klassischen Instrumenten zur Beeinflussung der energetischen Bauqualität – Anreize, Förderung, Information und Beratung sowie Vorschriften – ist die finanzielle Förderung sehr beliebt. Im Vordergrund stehen Beiträge des Kantons an Sanierungen nach Minergie sowie an Ersatzneubauten im Minergie-P-Standard. Hausbesitzer können aber auch für Teilerneuerungen mit Finanzbeiträgen des Kantons rechnen. Die Beitragsregelung erfolgt zusammen mit dem nationalen Gebäudeprogramm der Kantone und des Bundes. Im Förderprogramm sind ausserdem thermische und photovoltaische Solaranlagen sowie Ersatzinstallationen von Elektroheizungen enthalten. Weitere Infos: www.dasgebaeudeprogramm.ch, auf der Intro-Seite «Kanton Zürich» wählen; www.energie.zh.ch/Subvention Gebäudeprogamm: mehr als 2000 Gesuche Die Aktivitäten im Gebäudeprogram der Kantone und des Bundes übertrifft die Erwartungen bei weitem. Dies gilt auch für den Kanton Zürich: Vom 1. Januar bis Ende September 2010, also innerhalb von neun Monaten, konnten rund 2200 Gesuche bewilligt werden. 20 Mio. Franken wurden für Objekte im Kanton Zürich verpflichtet, was einem durchschnittlichen Beitrag von 9000 Franken entspricht. Etwa 45 % der Gesuche beziehen sich auf den Ersatz von Fenstern. Beiträge werden indessen nur an 3-fach-Verglasungen, mit oder ohne Minergie-Label, ausgerichtet. Weitere 1,2 Mio. Franken hat der Kanton Zürich in den ersten neun Monaten dieses Jahres zusätzlich an Projekte von Minergie-Sanierungen zugesagt. Diese Gelder werden in Ergänzung zu den Beiträgen des Gebäudeprogamms ausgerichtet. Ersatzneubauten in Minergie-P Untersuchungen, unter anderem der Fachhochschule Nordwestschweiz, belegen, dass Ersatzneubauten statt Ge73 MINERGIE IM KANTON ZÜRICH Minergie-P im Grossformat: Das grösste Minergie-P-Gebäude der Schweiz steht in Opfikon. Das Bürogebäude hat eine beheizte Nutzfläche von mehr als 20 000 m2. (ZH-036-P) bäudesanierungen in vielen Fällen die bessere Lösung sind. Durch eine Neukonzeption lassen sich Orientierung und Erschliessung eines Gebäude sowie deren Grundrisse gemäss der heutigen Nachfrage des Marktes und aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse planen und realisieren. Zudem schneiden viele gute Neubauten in einer ökologischen Gesamtbewertung besser ab als Sanierungen der Vorgängerbauten. Voraussetzung ist allerdings, dass die Ersatzsubstanz erheblich effizienter ist als der sanierte Altbau. Deshalb fördert der Kanton Zürich Ersatzneubauten, sofern diese im Minergie-P-Standard realisiert werden. Die Strategie dieser Förderprogramme ist offenkundig: Für Sanierungen: Minergie; für Neubauten: Minergie-P. Beide Standards lassen sich mit Eco-Label ergänzen. Damit kombiniert ein Hausbesitzer die klassischen Minergie-Themen Werterhaltung, Komfort und Energie mit den Eco-Kriterien Bauökologie und Gesundheit. Minergie-A Plus- und Nullenergiehäuser tauchen in letzter Zeit häufiger in den Medien auf. Dabei geht es um Gebäude, die über das ganze Jahr gerechnet – gleich viel oder gar mehr erneuerbare Energie gewinnen als sie für ihren Betreib brauchen. Notwendig sind dafür allerdings Speicher, um den Unterschied von Angebot und Bedarf an Energie zwischen Sommer und Winter auszugleichen. Bei Bauten mit Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen übernimmt das öffentliche Elektrizitätsnetz in der Regel die Funktion des Speichers, indem im Sommerhalbjahr elektrischer Strom eingespeist und während der Heizperiode bezogen wird. Energiepolitisch sind diese Konzepte insofern relevant, als dass die Speicherkapazitäten durch die Elektrizitätsversorgungsunternehmen geschaffen werden müssen, beispielsweise mit Pumpspeicherwerken an alpinen Standorten. Das vom Verein Minergie geplante Label Minergie-A eignet sich 74 Entwicklung der Anzahl Bauten und deren Energiebezugsfläche (in 1000 m2) im Minergie-Standard, 1999 bis 2010. (Die Flächen sind in 1000 m2 angegeben.) Bauten und Flächen nach Minergie: Entwicklung 1998 bis 2009 Jahr bis 1998 1999 Anzahl Bauten Energiebezugsfläche pro Jahr insgesamt pro Jahr insgesamt 150 150 76'000 m2 76'000 m2 187 15'000 m2 91'000 m2 263'000 m2 37 2000 115 302 172'000 m2 2001 159 461 259'000 m2 522'000 m2 874'000 m2 2002 274 735 352'000 m2 2003 207 942 249'000 m2 1'123'000 m2 1'406'000 m2 2004 247 1189 283'000 m2 2005 354 1543 343'000 m2 1'749'000 m2 2006 411 1954 445'000 m2 2'194'000 m2 2'674'000 m2 2007 508 2462 480'000 m2 2008 749 3211 1'035'000 m2 3'709'000 m2 4'766'000 m2 5'788'000 m2 2009 991 4202 1'057'000 m2 2010 * 736 4938 1'022'000 m2 * Bis Ende September 2010 zur Zertifizierung von Plus- und Nullenergiehäuser, die mit minimalen Speicherlasten betrieben werden können. Fazit: Energieeffizienz auf Kosten externer Infrastrukturen ist nach Einschätzung von Minergie kein Beitrag zu einer nachhaltigen Energieversorgung. Vorbildlich ist ein Minergie-A-Haus auch bezüglich Strombedarf für Beleuchtung und Geräte sowie Grauer Energie für die Herstellung. Damit ermöglicht der neue Minergie-Standard eine am Lebenszyklus des Gebäudes orientierte Bewertung. Mit dem geplanten Standard rundet der Verein Minergie sein Sortiment ab: Minergie-A steht für neue Ideen in der Bautechnik. NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 Die 171 Gemeinden des Kantons Zürich, koloriert nach der spezifischen Minergie-Fläche in m2 je Einwohner. Stand: Oktober 2010 Architektur und Energieeffizienz kombiniert: Das Zentrum für Gehör und Sprache in Zürich wird über eine ErdsondenWärmepumpe beheizt. (ZH-1310) Information und Beratung Beliebt sind die Infoveranstaltungen, die in vielen zürcherischen Gemeinden stattfinden und bislang eine grosse Zuhörerschaft interessieren konnten. Als Ergänzung zu einer ersten Information für Hausbesitzer eignet sich das betont modular konzipierte Beratungsangebot. In Zusammenarbeit mit den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich, der Zürcher Kantonalbank und dem Hauseigentümerverband Kanton Zürich bietet die Baudirektion drei Beratungsmodule an: Heizungsersatz, Gebäudecheck sowie Gebäudemodernisierung. Dabei geht es um das Aufzeigen von Möglichkeiten für energetisch vorbildliche Baumassnahmen. Typisch dafür sind Systeme zur Nutzung erneuerbarer Energien für die Erzeugung von Heizwärme und für die Wassererwärmung bei einem Ersatz der Heizung, also Sonnenkollektoren, Wärmepumpen und Holzheizungen. Bei einer äusseren Renovation geht es um die verbesserte Dämmung von Aussenbauteilen respektive Wärmeschutzfenster. Weitere Infos: www.energetisch-modernisieren.ch Bauten des Kantons haben Vorbildcharakter Der Kanton Zürich empfiehlt privaten Hauseigentümern Minergie – und hält sich als Bauherrschaft selbst an diese Empfehlung. Dies zeigt die Statistik: 34 kantonseigene Bauten mit einer Fläche von über 245 000 m2 entsprechen den Minergie-Anforderungen. Darunter hat es Bauten für Mittel- und Hochschulen, für Verwaltung und Unterhaltsdienste. Trotz des offenkundigen Kostendruckes bei Bauten der öffentlichen Hand lässt sich Minergie umsetzen, was einmal mehr beweist, dass sich Kosten- und Energieeffizienz keineswegs ausschliessen. ■ Hansruedi Kunz ist Leiter der Abteilung Energie im Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), Baudirektion Kanton Zürich. [email protected] NACHHALTIG BAUEN | 3 | 2010 75