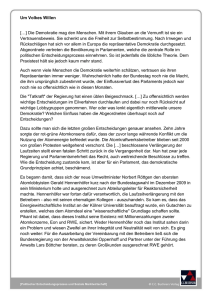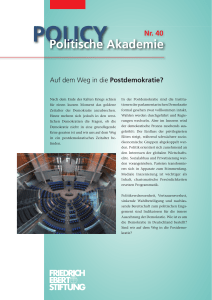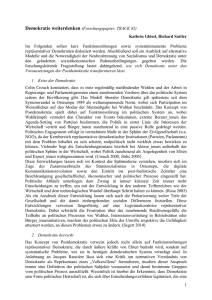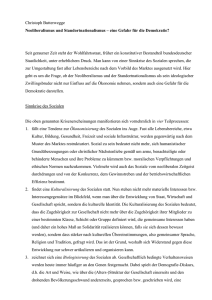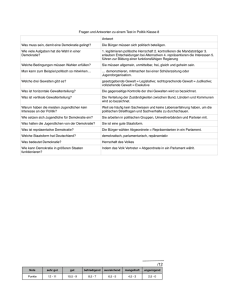Es ist alles schlimmer geworden - Alexander von Humboldt Institut
Werbung
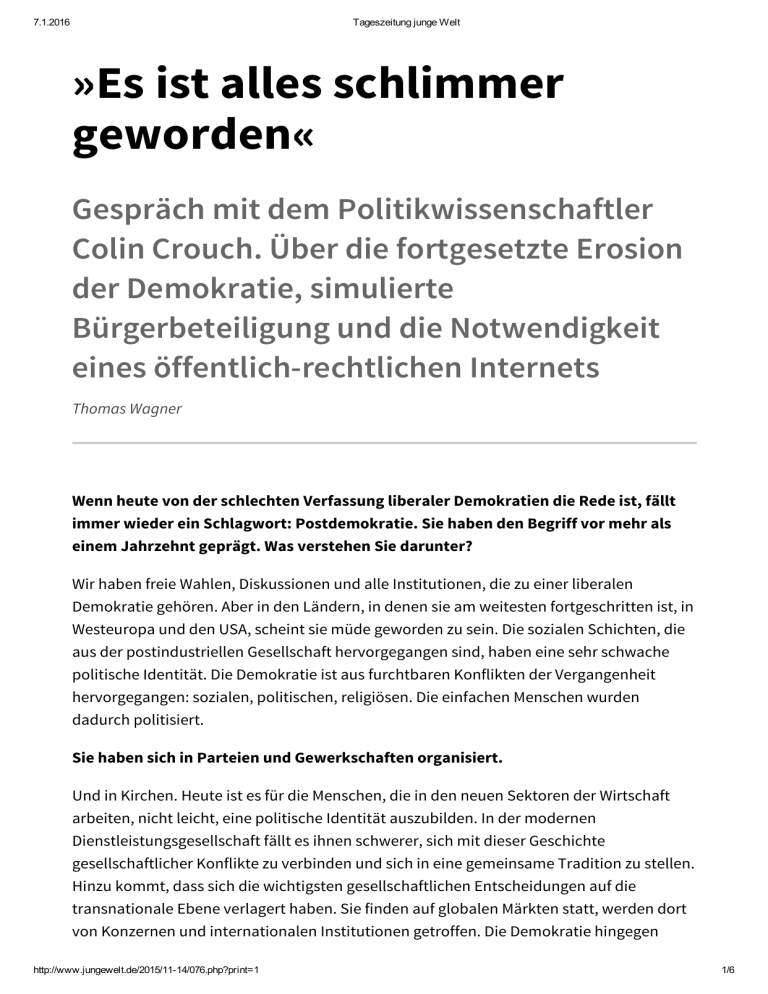
7.1.2016 Tageszeitung junge Welt »Es ist alles schlimmer geworden« Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Colin Crouch. Über die fortgesetzte Erosion der Demokratie, simulierte Bürgerbeteiligung und die Notwendigkeit eines öffentlich-rechtlichen Internets Thomas Wagner Wenn heute von der schlechten Verfassung liberaler Demokratien die Rede ist, fällt immer wieder ein Schlagwort: Postdemokratie. Sie haben den Begriff vor mehr als einem Jahrzehnt geprägt. Was verstehen Sie darunter? Wir haben freie Wahlen, Diskussionen und alle Institutionen, die zu einer liberalen Demokratie gehören. Aber in den Ländern, in denen sie am weitesten fortgeschritten ist, in Westeuropa und den USA, scheint sie müde geworden zu sein. Die sozialen Schichten, die aus der postindustriellen Gesellschaft hervorgegangen sind, haben eine sehr schwache politische Identität. Die Demokratie ist aus furchtbaren Konflikten der Vergangenheit hervorgegangen: sozialen, politischen, religiösen. Die einfachen Menschen wurden dadurch politisiert. Sie haben sich in Parteien und Gewerkschaften organisiert. Und in Kirchen. Heute ist es für die Menschen, die in den neuen Sektoren der Wirtschaft arbeiten, nicht leicht, eine politische Identität auszubilden. In der modernen Dienstleistungsgesellschaft fällt es ihnen schwerer, sich mit dieser Geschichte gesellschaftlicher Konflikte zu verbinden und sich in eine gemeinsame Tradition zu stellen. Hinzu kommt, dass sich die wichtigsten gesellschaftlichen Entscheidungen auf die transnationale Ebene verlagert haben. Sie finden auf globalen Märkten statt, werden dort von Konzernen und internationalen Institutionen getroffen. Die Demokratie hingegen http://www.jungewelt.de/2015/11­14/076.php?print=1 1/6 7.1.2016 Tageszeitung junge Welt bleibt an die nationale Ebene gebunden. Außerdem ist die ökonomische Entwicklung mit wachsender Ungleichheit verknüpft. Was hat das für Folgen? Eine kleine Gruppe von Superreichen kann sich politischen Einfluss kaufen. Unter diesen Bedingungen ist es sehr schwer, gegen die Ideologie des Neoliberalismus zu kämpfen. Denn auf der einen Seite stehen diese wenigen ökonomisch Mächtigen und auf der anderen die vielen Menschen, die an politischem Einfluss verloren haben. Zum Ausdruck kommt dieses politische Ungleichgewicht im Freihandelsabkommen TTIP zwischen der Europäischen Union und den USA. Die Verhandlungen finden jenseits der Demokratie statt. Insbesondere die geplanten internationalen Schiedsgerichte zum Schutz von Investoren sind mit der Demokratie nicht zu vereinbaren. In Deutschland ist Ihr Buch 2008 veröffentlicht worden. Auf Italienisch war es bereits einige Jahre zuvor erschienen, oder? Es erschien 2003 auf Italienisch und 2004 auf Englisch. Ich habe zehn Jahre lang in Italien gearbeitet. Italienisch ist dadurch meine zweite Sprache geworden. 2008 publizierte ich mein Buch auch auf Deutsch, ein bisschen spät. Deutsch habe ich nach Französisch in den 1950er Jahren in der Schule gelernt und bei meinen zahlreichen Besuchen in Deutschland immer wieder auffrischen können. Ich habe viele Kontakte dorthin. Ich habe auch Russisch in der Schule gelernt, es aber später nicht gesprochen. »Postdemokratie« erschien schließlich auch noch auf Chinesisch, Russisch, Koreanisch, Japanisch, Bulgarisch, Spanisch, Hebräisch und Slowenisch. Welche Rolle hat die Sozialdemokratie bei der Schwächung der Demokratie gespielt? War der unter Premier Anthony Blair, 1997 bis 2007, in Großbritannien und Bundeskanzler Gerhard Schröder, 1998 bis 2005, in Deutschland eingeleitete Kurswechsel, die Orientierung auf die sogenannte neue Mitte, eine Folge oder ein Motor der postdemokratischen Entwicklung? Beides. Diese Politik war der Versuch, sozialdemokratische Politik im Kontext der Postdemokratie zu betreiben. Dabei haben sie sich meiner Ansicht nach zu sehr an die neoliberale Ideologie angepasst. Sie waren der Auffassung, sich nicht gegen die Macht der internationalen Konzerne durchsetzen zu können. Sie haben versucht, eine soziale Politik im Schatten dieser ökonomischen Macht zu verwirklichen. Das blieb aber unzureichend, weil es am grundsätzlichen Problem des wachsenden Ungleichgewichts zwischen der zunehmenden Macht der Konzerne und den anderen Teilen der Gesellschaft nichts geändert hat. Hätte es die Möglichkeit gegeben, einen anderen politischen Kurs einzuschlagen? http://www.jungewelt.de/2015/11­14/076.php?print=1 2/6 7.1.2016 Tageszeitung junge Welt Es wäre sehr schwer gewesen. Denn die nationalstaatlich verfasste Demokratie ist nicht ausreichend in der Lage, die international agierende Wirtschaft zu erreichen. Eine soziale Bewegung, die dagegen etwas ausrichten will, muss sich international organisieren. Das sehe ich aber nicht. Die einzige politische Identität, die derzeit immer kräftiger wird, ist die nationale Identität. Ein Teil der Labour Party versammelt sich unter dem Begriff »Blue Labour«. Diese Leute hoffen, auf dem Weg einer nationalstaatlich orientierten Politik eine Strategie für die Stärkung des Gemeinwohls zu finden. Sie haben insofern recht, als die Nation eine öffentliche Instanz ist, an der sich soziale und populäre Politik ausrichten können. Ich verstehe die Absicht dieses »nationalen« Sozialismus und finde das Anliegen sympathisch. Ich befürchte jedoch, dass eine solche Politik sich noch weiter von den wichtigen ökonomischen Schalthebeln entfernen könnte, als es die heute vorherrschende schon ist. Notwendig wäre eine europäische politische Identität. Aber man muss davon ausgehen, dass diese auch in Zukunft nur schwach entwickelt sein wird. Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die Rolle, die Jeremy Corbyn spielt? Der Politiker hat den zurückgetretenen Ed Miliband, für viele überraschend, als Vorsitzenden der Labour Party abgelöst und gilt als links. Kann er eine fortschrittlichere Politik durchsetzen? Auf der einen Seite haben wir es endlich mit einem Politiker zu tun, der über die wirklichen Probleme der Menschen spricht: die wachsende Konzentration des Reichtums und der politischen Macht bei einigen wenigen. Andererseits verstehen er und seine Gruppe bislang noch nicht, einen größeren Teil der britischen Gesellschaft zu erreichen. Sie befürchten, dass Corbyn und seine Leute ihre an sich guten Ideen nicht populär genug machen können? Es handelt sich um eine kleine Gruppe, die ihr ganzes politisches Leben lang in der Opposition war und sich nie die Frage stellen musste, wie sie ein größeres Publikum erreichen kann. Aber vielleicht werden sie das noch lernen. Sie müssen zum Beispiel jetzt lernen, Prioritäten zu setzen. Etwa, ob es wichtiger ist, sich mit der Königin zu treffen oder eine Sozialpolitik zu entwickeln, für die sie das Verständnis der Mehrheit in der Bevölkerung erreichen. Sie müssen die Frage klären, was wichtiger ist: die Sozialpolitik oder die Verteidigungspolitik. Wenn Sie auf die Zeit seit dem Erscheinen Ihres Buchs »Postdemokratie« zurückblicken, was hat sich verändert? Es ist alles schlimmer geworden. Zum Beispiel wurden die Kosten der Finanzkrise nicht von den Banken, sondern von den ganz normalen Menschen getragen. Auch in der Griechenland-Krise geht es nicht um Hilfe für die einfachen Menschen, sondern um die Rettung der Banken. Nach wie vor ist die Politik in neoliberaler Ideologie befangen und an http://www.jungewelt.de/2015/11­14/076.php?print=1 3/6 7.1.2016 Tageszeitung junge Welt den Interessen der Konzerne ausgerichtet. Wer könnte daran etwas ändern? Im Rahmen neoliberaler Hegemonie gibt es immer wieder Beispiele, wie sich auf niedrigem Level soziale oder sozialdemokratische Politik realisieren lässt. Das sind aber nur Ausnahmen. Das Problem ist, wie wir einen Richtungswechsel in der großen Politik erreichen können. Der Markt braucht mehr Regulierung. Die Mehrheit der Menschen denkt nicht neoliberal. Die große Demonstration gegen TTIP am 10. Oktober in Berlin hat das gezeigt. Obwohl es bei dem geplanten Freihandelsabkommen um zum Teil sehr technische Fragen geht, haben viele Menschen das Problem verstanden und sind auf die Straße gegangen. Hoffentlich wird der von ihnen erzeugte Druck Einfluss auf die Politik der sozialdemokratischen Parteien haben. Nur wenn sich diese Parteien sicher sind, dass sie dafür einen großen Teil der Öffentlichkeit hinter sich haben, werden sie den Weg einer sozialeren Politik einschlagen. Sie wollen gewählt werden. Ja. Andererseits ziehen Politiker aller großen Parteien, einschließlich der Sozialdemokraten, in Deutschland derzeit an einem Strang, wenn es darum geht, aufkeimenden sozialen Bewegungen durch die Einbindung ihrer Akteure in Bürgerbeteiligungsverfahren den Wind aus den Segeln zu nehmen. Im deutschsprachigen Raum hat sich für die Instrumentalisierung von scheinbar basisdemokratischer Partizipation durch Investoren sowie privater und öffentlicher Projektträger zur Durchsetzung von Verwertungsstrategien der Begriff der »Mitmachfalle« durchgesetzt. Es geht darum, Proteste einzudämmen, bevor sie ein öffentlich wahrnehmbares Stadium erreichen und in den Augen der Herrschenden aus dem Ruder laufen wie im Falle der Bewegung gegen das Bahnprojekt »Stuttgart 21«. Ich sehe das als eine Erscheinungsform der von Ihnen kritisierten Postdemokratie. Würden Sie diese Beobachtung teilen? Ich war Teil der Bewegung der 68er. Für uns war das Thema der Mitbestimmung an den Universitäten sehr wichtig. Heute, im Rahmen der neoliberalen Ideologie, stellt sich das so dar, dass die Studenten als Kunden betrachtet werden und man auf dieser Grundlage mit ihnen diskutiert. In Deutschland dürfen sie die Arbeit ihrer Professoren bewerten, nach dem Motto: gute Vorlesung, schlechte Vorlesung. Das hat mit der von den 68ern angestrebten Partizipation nicht viel zu tun, oder? Das ist Ausdruck der um sich greifenden Kundenorientierung. Zugleich wird es immer http://www.jungewelt.de/2015/11­14/076.php?print=1 4/6 7.1.2016 Tageszeitung junge Welt schwieriger zu protestieren, weil der öffentliche Raum zunehmend überwacht wird. Bundeskanzlerin Angela Merkel versucht die zunehmende Parteienverdrossenheit der Bürger dadurch zu kompensieren, dass sie wie eine mittelalterliche Königin über das Land zieht und in verschiedenen Städten mit ausgewählten Bürgern einen Dialog über Deutschlands Zukunft inszeniert. Das erinnert an sehr alte Formen der Fürstenberatung. Das ist gut. (lacht) Parteien, Gewerkschaften und andere Organisationen der abhängig Beschäftigten und sogenannten kleinen Leute werden dabei umgangen. Das ist eine neue Form des Bonapartismus. Ja, genau. In Großbritannien gibt während des Wahlkampfs Veranstaltungen der großen Parteien, in deren Verlauf sich die führenden Repräsentanten als besonders volksnah inszenieren. Auf dem Fernsehbildschirm wirkt das beeindruckend. Anwesend sind aber bloß Parteileute, die ein Publikum nur spielen. Es gibt keine echten Fragen, alles ist gut vorbereitet, um die entsprechende Wirkung zu erzeugen. In Ihrem aktuellen Buch »Die bezifferte Welt« beschreiben Sie die negativen Folgen des Neoliberalismus auf die Wissensgesellschaft. Sie sagen, er drohe die wichtigste Quelle des kritischen Wissens, die Universitäten, versiegen zu lassen. Wie geschieht das? Beispielsweise erlaubt die Pharmaindustrie, die viel Geld in die universitäre Forschung steckt, nur die Veröffentlichung von Artikeln, die in ihren Augen für die Verbreitung ihrer eigenen Produkte günstig sind. Die Universitäten sind in immer größerem Maße vom Geld der großen Konzerne abhängig. In Deutschland finanziert der US-Konzern Google das Berliner Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Die Berliner Hochschulen kooperieren, und die Berliner Sozialdemokratie applaudiert auch noch dazu. Das ist ein weiteres Beispiel für den schlechten Einfluss, den Konzerne im Zeichen des Neoliberalismus auf das Bildungswesen ausüben. Heute sind die weltweit am meisten genutzten Kommunikationsdienstleistungen in der Hand von privaten Monopolunternehmen wie Google, Facebook, Youtube und Co. Sie plädieren in Ihrem neuen Buch für eine Stärkung öffentlich-rechtlicher Institutionen. Müsste nicht zumindest die Basisversorgung mit solchen stark nachgefragten Kommunikationsdienstleistungen von der privaten in die öffentliche Hand überführt werden, um die enorme Macht dieser Konzerne einzudämmen? http://www.jungewelt.de/2015/11­14/076.php?print=1 5/6 7.1.2016 Tageszeitung junge Welt Das ist ein sehr guter Vorschlag. Es gibt allerdings Einwände gegen öffentlich-rechtliche Medien, die begründet sind. Öffentlich-rechtliche Rundfunksender stehen beispielsweise häufig unter dem Druck, dem Willen staatlicher Instanzen zu entsprechen. Deshalb ist es wichtig, dass der Staat bei der Einrichtung von Institutionen, die von seiner Finanzierung abhängig sind, darauf achtet, dass diese gegen staatliche Eingriffe geschützt sind. Eine gewisse Unabhängigkeit ist notwendig, damit Universitäten oder Medien relevantes Wissen produzieren können. Wenn nun private Konzerne diese Medien kontrollieren, um Gewinn mit ihnen zu machen, ist das eine Gefahr für die Demokratie. Ein öffentlichrechtliches Internet wäre daher sehr wichtig. Eine Kampagne für ein öffentlich-rechtliches Internet böte für linke Kräfte die Möglichkeit, argumentativ in die Offensive zu kommen. Man könnte könnte beispielsweise den Slogan verwenden: »Demokratie heißt: Keine Werbegeschäfte mit meinen Daten.« Genau. Das ist ein wichtiges Feld der politischen Auseinandersetzung. Das Gespräch führte Thomas Wagner Colin Crouch, geboren 1944, ist britischer Politikwissenschaftler. Er lehrte bis zu seiner Emeritierung an der Warwick Business School. Sein 2008 in deutscher Sprache erschienenes Buch »Postdemokratie« wird schon heute zu den Klassikern sozialwissenschaftlicher Zeitdiagnosen gezählt. 2011 erschien »Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus«. Aktuelle Veröffentlichung: Colin Crouch: Die bezifferte Welt. Wie die Logik der Finanzmärkte das Wissen bedroht. Suhrkamp Verlag: Berlin 2015, 250 Seiten, 21,95 Euro http://www.jungewelt.de/2015/11-14/076.php http://www.jungewelt.de/2015/11­14/076.php?print=1 6/6