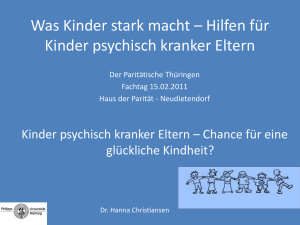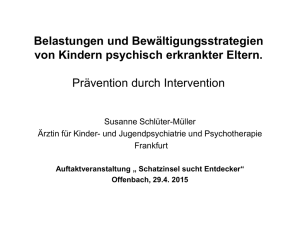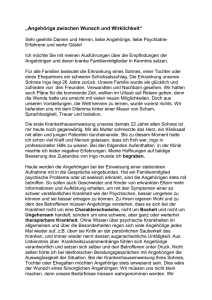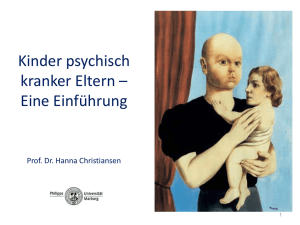Präventive Interventionen für Familien mit psychischen Erkrankungen
Werbung

Präventive Interventionen für Familien mit psychischen Erkrankungen Dr. Hanna Christiansen 1 Warum sind Interventionen für Familien mit psychisch kranken Eltern wichtig? Als ich nach Hause gekommen bin, hat zuerst keiner aufgemacht. Ich habe geklingelt und geklingelt, aber es hat sich nichts gerührt, und dann bin ich ums Haus rumgegangen und hab gegen die Terrassentür getrommelt. Es ist aber immer noch nichts passiert. Da bin ich langsam böse geworden, weil man das von Mama schon erwarten kann, finde ich. Dass sie wenigstens zu Hause ist und einem die Tür aufmacht, wenn man aus der Schule kommt. Wenigstens das könnte man erwarten, wo sie schon sonst nichts tut und man sich schämen muss in der letzten Zeit. Ich habe mich auf die Fußmatte gesetzt und überlegt, ob ich einfach zu Lule gehen soll. Damit Mama Angst kriegt und einen Schrecken, wenn sie nach Hause kommt und ich bin nicht da. Ja, und dann hab ich es eben erfahren. Frau König hat plötzlich vor mir gestanden, ich weiß nicht, warum sie so lange gebraucht hat. Dabei hat sie doch bestimmt schon auf mich gewartet. „Charlotte, mein Kind“, hat sie gesagt. Ja, und dann hab ich es eben erfahren. Und so ist es gewesen, wie ich es erzähle, Ehrenwort. 2 Warum sind Interventionen für Familien mit psychisch kranken Eltern wichtig? Mama hat nicht mehr leben wollen. Sie sagen, Mama hat nicht mehr leben wollen. Es hat aber nicht geklappt, und jetzt liegt sie im Krankenhaus in einem Zimmer, das heißt Intensivstation, und da hängen viele Schläuche, durch die kriegt Mama Medizin. Direkt in die Adern. Weil sie ja nicht schlucken kann. Weil sie ja bewusstlos ist. Papa ist bei ihr, und heute Abend soll mich Frau König ins Bett bringen. Ich würde viel lieber bei Lule sein, aber ich mag nicht fragen. ……………….… In meiner Klasse sagen sie, Mama wäre sowieso krank geworden. Und ich werde es später auch mal. So was erbt man, sagen sie in meiner Klasse. Das macht mir Angst, aber dann denke ich, dass ich gerade erst neun bin, und da habe ich wenigstens noch viele Jahre Zeit, bis es passiert wie bei Mama. 3 Warum sind Interventionen für Familien mit psychisch kranken Eltern wichtig? Prävalenz psychisch kranker Eltern liegt über verschiedene Studien hinweg zwischen 9 – 61 %. Legt man die Zahl der Familien und Raten psychisch Erkrankter zusammen, so kann von 3.8 Millionen betroffener Kinder und Jugendlicher ausgegangen werden. ABER: wirklich verlässliche Daten, die Aufschluss über die tatsächliche Zahl betroffener Kinder geben sowie genauere Angaben zu den Diagnosen und familiären Umständen machen fehlen bislang. (Mattejat & Remschmidt, 2008 ; Lenz, 2007; Statistisches Bundesamt, 2006; Wittchen, 2000) 4 Prävalenzstudie • Auswertung von Basisdokumentationsdaten dreier großer Fachkliniken. • Die Vogelsbergklinik ist eine Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik. • Die Schön‐Klinik in Bad Arolsen ist eine Klinik für Psychosomatik mit einem Akut‐ und Rehabereich. • Die Elbe‐Klinik Stade ist eine Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. • Alle Kliniken leisten sowohl regionale als auch überregionale Versorgung. • Datenerhebung: 2008‐2012 Prävalenzstudie: Vogelsbergklinik Januar 2008 – Juni 2012 • N = 7298 Patienten • n = 2126 (29.1 % ) keine Kinder Alter 42.59 (10.74) Frauen 77.2 % • n = 5148 (70.5 %) Kinder 32.5 % = 1 Kind; 46 % = 2 Kinder; 21.4 % ≥ 3 Kinder 97.2 % der Kinder leben bei den Eltern Alter 49.05 (8.23) Frauen 75.7 % Prävalenzstudie: Vogelsbergklinik Schulabschluss & Erwerbstätigkeit Anteil der Patienten Noch in der Schule 0.2 % (n = 12) Sonderschulabschluss 0.5 % (n = 36) Hauptschule 23.9 % (n = 1745) Mittlere Reife 41.6 % (n = 3036) Fachhochschulabschluss/Abitur 27.5 % (n = 2007) Kein Schulabschluss 2.4 % (n = 173) Anderer Abschluss 3.1 % (n = 229) Vollzeit beschäftigt 51.7 % (n = 3775) Teilzeit beschäftigt 23.3 % (n = 1698) Nicht erwerbstätig 8.6 % (n = 629) Arbeitslos 15.7 % (n = 1143) Prävalenzstudie: Vogelsbergklinik Störung Patienten ohne Kinder Patienten mit Kindern Depressive Episode 26.9 % (n = 483) 73.1 % (n = 1311) Rezidivierende depressive Störung 28.5 % (n = 587) 71.5 % (n = 1476) Angststörung 31.3 % (n = 137) 68.7 % (n = 301) Angst und depressive Störung gemischt 26.2 % (n = 60) 73.8 % (n = 169) Anpassungsstörung 27.5 % (n = 374) 72.5 % (n = 987) Somatoforme Störung 27.1 % (n = 76) 72.9 % (n = 204) Posttraumatische Belastungsstörung 37.3 % (n = 85) 62.7 % (n = 143) Essstörung 73.8 % (n = 76) 26.2 % (n = 27) Persönlichkeitsstörungen 50.8 % (n = 60) 49.2 % (n = 58) Gesamt 29.3 % (n = 1938) 70.7 % (n = 4676) Prävalenzstudie: Vogelsbergklinik Anteil Patienten mit Kindern pro Quartal und Jahr Jahr Quartal I Quartal II Quartal III Quartal IV 2008 72.8 % (n = 308) 68.9 % (n = 284) 72,1 % (n = 320) 69.7 % (n = 267) 2009 69.3 % (n = 285) 72.4 % (n = 312) 69.8 % (n = 278) 69.1 % (n = 284) 2010 73.2 % (n = 290) 72.4 % (n = 310) 70.4 % (n = 304) 65.8 % (n = 265) 2011 73.6 % (n = 295) 72.4 % (n = 310) 70.4 % (n = 304) 65.8 % (n = 265) 2012 71.8 % (n = 316) 79.8 % (n = 91) Prävalenzstudie: Schön Klinik Februar 2008 – August 2012 • N = 8145 Patienten • n = 3166 (38.9 % ) keine Kinder Alter 39.94 (13.04) Frauen 55.9 % • n = 4979 (61.1 %) Kinder 31.1 % = 1 Kind; 50.2 % = 2 Kinder; 18.7 % ≥ 3 Kinder Alter 52.08 (9.68) Frauen 45.9 % Prävalenzstudie: Schön Klinik Schulabschluss & Erwerbstätigkeit Anteil der Patienten Noch in der Schule 0.6 % (n = 51) Sonderschulabschluss 0.3 % (n = 26) Hauptschule ohne Abschluss 1.4 % (n = 113) Hauptschule 22.2 % (n = 1808) Mittlere Reife 29.5 % (n = 2399) Fachhochschulabschluss 9.5 % (n = 774) Gymnasium ohne Abitur 1 % (n = 81) Abitur 31.3 % (n = 2551) Vollzeit beschäftigt 53.8 % (n = 4378) Teilzeit beschäftigt 9.9 % (n = 806) Gelegentlich Teilzeit beschäftigt 2.7 % (n = 217) Keine Beschäftigung 33.6 % (n = 2744) Prävalenzstudie: Schön Klinik Störung Patienten ohne Kinder Patienten mit Kindern Depressive Episode 37.8 % (n = 1288) 62.2 % (n = 2117) Rezidivierende depressive Störung 40.7 % (n = 810) 59.3 % (n = 1179) Angststörung 50.7 % (n = 191) 49.3 % (n = 186) Angst und depressive Störung gemischt 37.5 % (n = 6) 62.5 % (n = 10) Anpassungsstörung 27.3 % (n = 94) 72.7 % (n = 250) Somatoforme Störung 35.7 % (n = 86) 64.3 % (n = 155) Posttraumatische Belastungsstörung 42.6 % (n = 40) 57.4 % (n = 54) Essstörung 83.1 % (n = 138) 16.9 % (n = 28) Gesamt 40 % (n = 2653) 60 % (n = 6632) Prävalenzstudie: Schön Klinik Anteil Patienten mit Kindern pro Quartal und Jahr Jahr Quartal I 2008 Quartal II Quartal III Quartal IV 55.8 % (n = 72) 68.8 % (n = 273) 61.8 % (n = 220) 2009 62.6 % (n = 285) 66.3 % (n = 328) 64.2 % (n = 360) 60.8 % (n = 322) 2010 65.7 % (n = 347) 64.6 % (n = 319) 64.4 % (n = 368) 65 % (n = 347) 2011 68.2 % (n = 347) 57.7 % (n = 261) 56 % (n = 261) 55.9 % (n = 270) 2012 50.3 % (n = 255) 47.7 % (n = 236) 33.3 % (n = 36) Prävalenzstudie: Elbe Kliniken April 2011 – Juni 2011 • N = 461 Patienten • n = 172 (37.3 % ) keine Kinder Alter 46.27 (13.38) Frauen 63.4 % • n = 289 (62.7 %) Kinder 32.2 % = 1 Kind; 38.8 % = 2 Kinder; 28.6 % ≥ 3 Kinder 50.2 % der Kinder leben bei den Eltern Alter 51.13 (12.14) Frauen 69.6 % Prävalenzstudie: Elbe Kliniken Schulabschluss & Ausbildung Anteil der Patienten Kein Schulabschluss 4.1 % (n = 19) Hauptschule 33.6 % (n = 155) Realschule 37.7 % (n = 174) Abitur 11.9 % (n = 55) Fachhochschulreife 11.1 % (n = 51) Keine Angaben 1.5 % (n = 7) Abgeschlossene Ausbildung 72.2 % (n = 333) Abgeschlossenes Studium 11.1 % (n = 51) Keine Angaben 16.7 % (n = 77) Prävalenzstudie: Elbe Kliniken Störung Patienten ohne Kinder Patienten mit Kindern Depressive Episode 38.5 % (n = 52) 61.5 % (n = 83) Rezidivierende depressive Störung 30.4 % (n = 41) 69.6 % (n = 94) Angststörung 42.1 % (n = 8) 57.9 % (n = 11) Angst und depressive Störung gemischt 23.8 % (n = 5) 76.2 % (n = 16) Anpassungsstörung 0 % (n = 0) 100 % (n = 1) Somatoforme Störung 0 % (n = 0) 100 % (n = 2) Posttraumatische Belastungsstörung 50 % (n = 1) 50 % (n = 1) Essstörung 0 % (n = 0) 100 % (n = 1) Gesamt 3.9 % (n = 107) 66.1 % (n = 209) Prävalenzstudie: Elbe Kliniken Charakteristika der Kinder • Alter 1. Kind 22.62 (12.25) • Alter 2. Kind 22.29 (11.60) • Alter 3. Kind 19.14 (10.56) • Alter 4. Kind 14.33 (11.92) • 15.4 % der Kinder haben nach den Angaben der Eltern eigene psychische Störungen: Depression Angststörungen ADHS Störungen des Sozialverhaltens/Oppositionelle Störungen Sauberkeit Psychose Bipolare StörungenSomatoforme Störungen BindungsstörungenLese‐Rechtschreib‐Schwäche Zusammenfassung • In allen 3 Kliniken haben zwischen 60 – 70 % der Patienten Kinder, die Mehrzahl 1‐2 Kinder, 20‐30 % aber auch 3 Kinder und mehr; 50‐ 97 % der Kinder leben bei den Eltern. • Die Mehrzahl der Patienten sind Frauen mit einem mittleren Alter von ca. 50 Jahren mit niedrigen bis mittleren Bildungsabschlüssen und nur ca. 50 % sind voll erwerbstätig. • Angststörungen und Depression sind die häufigsten Störungen und auch dort zeigt sich der Anteil von 60 ‐ 70 % mit Kindern; nur bei den Essstörungen hat die große Mehrzahl der Patienten (80 %) keine Kinder. • Über die Quartale zeigen sich Schwankungen in der Rate der Kinder zwischen 66 – 80 %, wobei sich die größten Schwankungen im aktuellen Jahr zeigen: 33 – 69 %. Zusammenfassung • Punktprävalenzen können so die tatsächliche Zahl betroffener Kinder deutlich unterschätzen. • In der Regel sind in der Basisdokumentation über die Anzahl der Kinder hinaus keine Informationen vorhanden. • In den Elbe‐Kliniken haben wir explizit nach weiteren Informationen gefragt. • Danach sind die Kinder zwischen 14‐22 Jahre alt und nach den Angaben der Eltern sind 15.4 % von psychischen Störungen betroffen, die Mehrzahl von Depression und Angststörungen, wobei sich insbesondere letztere durch ein frühes Ersterkrankungsalter und eine hohe Persistenz auszeichnen (Kessler et al., 2012; Kim‐Cohen, 2003). Fazit • Damit schließt sich der Kreislauf: Die große Mehrzahl der Patienten, die intensive therapeutische Behandlung in Anspruch nimmt – und das ist nur eine kleine Minderheit – hat Kinder; • diese zeigen bereits selber wieder behandlungsbedürftige Auffälligkeiten und es besteht ein hohes Chronifizierungsrisiko; • dies steht einer mangelnden integrativen Versorgung gegenüber sowie einem mangelnden Wissen über die tatsächliche Situation der Kinder (genaue Angaben über Alter, Geschlecht, psychische Beeinträchtigungen und Ressourcen). Warum sind Interventionen für Familien mit psychisch kranken Eltern wichtig? Nach metaanalytischen Ergebnissen entwickeln 61 % der Kinder psychisch kranker Eltern selbst eine psychische Störung im Laufe ihres Lebens. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist damit das Risiko, psychisch zu erkranken für diese Kinder vierfach erhöht. Dies zeigt sich bereits im Kindes‐ und Jugendalter: 48.3 % der Patienten in kinder‐ und jugendpsychiatrischer Behandlung haben ein Elternteil mit einer schweren psychischen Störung. (Mattejat & Remschmidt, 2008 ; Lenz, 2007; Statistisches Bundesamt, 2006; Wittchen, 2000) 21 Genaue Analyse von ambulanten kindertherapeutischen Fällen: Ausbildungstherapien 2007‐2008 Staatliche Prüfung Kinder‐ und Jugendlichenpsychotherapie Schwerpunkt Verhaltenstherapie; Sept. 2008 • 42 Fälle; ambulante Therapien; meist leichter bis mittlerer Schweregrad. Hohes Engagement, gute Supervision; erfolgreicher Therapieverlauf. Sehr gut dokumentiert. [Also: Keine „desolaten“ Fälle, eher positive Auswahl.] • 12 Fällen (= 29%) lag bei den Eltern eine Achse‐V‐dokumentierte psychische Störung vor (1 Organisches Psychosyndrom; 2 „major“ Depressionen; 1 Alkoholkrankheit), mit stationären psychiatrischen Aufenthalten. • In 6 (14%) Fällen hatten die leiblichen Eltern, zu denen kein Kontakt mehr bestand, schwere psychische Störungen (Drogenabusus, Borderline‐Störung) • In 21 (50%) Fällen lagen bei den Eltern leichtere psychische Störungen oder Auffälligkeiten vor. • In drei (7%) Fällen hatten die Eltern keine psychischen Auffälligkeiten oder Störungen. • In keiner Therapie stand die Arbeit mit den Eltern oder der Familie im Vordergrund (Meist Relation 4:1). 22 Was macht es Kindern schwer? • Sprachlosigkeit der Erwachsenen (Tabusierung) • Fehlende Möglichkeiten, die eigenen Erfahrungen zu verarbeiten, d.h. zu verstehen, einzuordnen, auf Realität zu prüfen. • Fehlende vertrauensvolle Einbettung in ein soziales Netz (Eltern, Großeltern, Verwandtschaft, Nachbarschaft, Freunde); • Sozialer Rückzug, soziale Isolation. 23 Berichte der Kinder von psychisch kranken Eltern: Die Sprachlosigkeit im Erleben der Kinder • Desorientierung und Angst: Sie können die Erkrankung nicht einordnen und nicht verstehen. • Tabuisierung: Sie haben das (begründete) Gefühl, dass sie mit niemandem darüber sprechen dürfen. • Schuldgefühle: Sie glauben, dass sie schuld sind. „Mama ist krank/durcheinander/traurig“ weil ich böse war. • Isolierung: Sie wissen nicht, mit wem sie darüber sprechen können. Sie fühlen sich alleine gelassen, sie ziehen sich zurück. 24 Woher kommt die Sprachlosigkeit der Erwachsenen? Was macht es den Eltern und ihren Partnern so schwer? • Gesellschaftliche Stigmatisierung, Vorurteile, Benachteiligung (Versicherung) • Befürchtungen/Ängste im Zusammenhang mit der Erkrankung (realistisch und unrealistisch) • Verleugnung, Verdrängung, Tabuisierung der Erkrankung. Im schlimmsten Fall: Vermeidung von Diagnostik und Behandlung. • Angst offen zu kommunizieren; Rückzug vor anderen Menschen; Fehlen von Unterstützung durch andere. • Probleme, selbst Unterstützung zu aktivieren. Defensive Position („Kopf in den Sand“/„Auf einem Pulverfass sitzen“). Verlust der Kontrolle/Selbstwirksamkeit. 25 Die Gefahr der Kumulierung von Risiken (Epidemiologische Forschung) Niedriger SES Arbeitslosigkeit Große Familie mit geringem Wohnraum • Sexuelle und/oder aggressive Misshandlung • Eheliche Disharmonie, Scheidung, Trennung der Eltern • • • Vernachlässigung Häufig wechselnde frühe Beziehungen • Alleinerziehender Elternteil • Verlust der Mutter • Längere Trennung von den Eltern in den ersten 7 Lebensjahren • • alle psychosozialen Risikofaktoren kommen gehäuft vor in Familien mit einem psychisch kranken Elternteil Elterliche psychische Erkrankung = zentrales Kernmerkmal 26 Bella‐Studie: Die vier Risikofaktoren mit den stärksten Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Kinder / Jugendlichen Faktor Häufigkeit Auswirkung Odds Ratio Psychiatrische Symptome bei den Eltern 10,1% 4,0 Bedeutsame subjektive elterliche Stressbelastung (z.B. Haushalt, Erziehung, Arbeitstress, finanzielle Belastungen) 9,9% 4,7 Geringe psychologische Lebensqualität (psychisches Wohlbefinden) der Eltern 10,0% 4,2 Bedeutsame Konflikte in der Familie 5,9% 4,9 Bella (Wille et al., 2008) 27 Prozentsatz der Kinder mit psychischen Problemen Kumulationseffekte: Psychische Störungen und psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen in Abhängigkeit von der Anzahl der Risikofaktoren (Bella, 2008) Psych. Auffäll. Psych. Stör. Anzahl der Risikofaktoren 28 Die Folgen für die Kinder sind umso schwerwiegender: ‐ je stärker sie in die Symptomatik des kranken Elternteils einbezogen sind; ‐ je jünger sie sind, wenn die elterliche Erkrankung auftritt; ‐ wenn gravierende, ungelöste elterliche Konflikte bestehen; ‐ wenn die Familie isoliert ist; ‐ wenn Kinder parentifiziert werden; ‐ wenn die Erkrankung zum Auseinanderbrechen der Familie führt. (Kühnel & Bilke 2004; Lenz 2006; 2007; 2008) 29 Wie müssen wir uns den Zusammenhang zwischen elterlicher Erkrankung und psychischen Störungen beim Kind vorstellen? Psychische Erkrankung bei einem Elternteil Verunsicherung; emot. u. Verhaltensprobleme beim Kind 30 Zusammenhang zwischen elterlicher Erkrankung und psychischen Störungen beim Kind Psychische Erkrankung bei einem Elternteil Erhöhte Stressbelastung Sprachlosigk. Fehlende Orientierungs - möglichk. Reduz. elt. Verunsicherung; emot. u. Verhaltensprobleme beim Kind Kompetenz; Eltern- KindInteraktionsprobleme Zusätzliche Risikofaktoren 31 Die Kauai‐Studie • Emmy Werner, geb. 1929. • Ansatzpunkt: Kauai‐Studie (Beginn 1955). Alle 698 auf der hawaiianischen Insel Kauai geborene Kinder wurden 32 Jahre lang „verfolgt“. Dabei wurden ganz unterschiedliche Risiken erfasst (z.B. perinatale Komplikationen; risikoreiche Umweltbedingungen wie z.B. Armut oder psychische Erkrankung eines Elternteils). • 1/3 der 200 Kinder, die unter risikoreichen Bedingungen aufwuchsen, wuchsen trotz aller Widrigkeiten zu selbständigen und erfolgreichen jungen Erwachsenen heran. • Resiliente Kinder: Es ist diesen Kindern gelungen, eine Widerstandskraft gegenüber risikoreichen Lebensbedingungen zu entwickeln. Resiliente Kinder sind im Vergleich zu nicht‐ resilienten Kindern • eher in der Lage aus negativen Affekten und Stimmungslagen herauszufinden, • sie sprechen eher über ihre Gefühle, • sie sind vertrauensvoller und weniger aggressiv, • sie sind einfühlsamer, • sie reagieren positiv auf Aufmerksamkeit, sie sind „leichter zu lenken“, orientieren sich an Erwachsenen, • sie sind interessiert an Menschen, Sachen und Ideen und lernen gerne, • und sie können Impulse besser kontrollieren, sind zu Belohnungsaufschub in der Lage. Bella‐Studie: Die erfassten Schutzfaktoren • Personale Ressourcen: Selbstwirksamkeit, Selbstkonzept, Optimismus • Familiäre Ressourcen: Familienklima; elterliche Unterstützung. • Soziale Ressourcen: Soziale Unterstützung durch Andere; Kontakt zu Gleichaltrigen. 34 Positiver Kumulationseffekt auch bei den Schutzfaktoren/Ressourcen Prozentsatz der Kinder mit psychischen Problemen (Bella, 2008) Psych. Auffäll. Psych. Stör. Anzahl der Ressourcen 35 Interaktionseffekte zwischen Risikofaktoren und Schutzfaktoren/Ressourcen (Bella-Studie, 2008) - ? + - ? + - ? + - ? + - ? + - keine/geringe Ressourcen ? mäßige Ressourcen + viele/gute Ressourcen 36 Was ist entscheidend für Kinder von psychisch kranken Eltern? • Die Fähigkeit und Möglichkeit über belastende/problematische und über freudige Dinge sprechen zu können. Die Anerkennung der Wirklichkeit in der Familie und im sozialen Netz. Die Validierung der eigenen Erfahrung. • Die Chance sich selbst als stark und fähig zu erfahren, etwas zu können sich für etwas interessieren, engagieren und begeistern zu können; sich selbst intensiv und positiv zu erleben. • Das Gefühl erwünscht zu sein, von anderen gemocht, akzeptiert, anerkannt, geliebt zu werden. Das Gefühl, sich auf andere stützen zu können. 37 Was hat Kindern psychisch kranker Eltern geholfen? Positive Wirkfaktoren • Die Fähigkeit und Möglichkeit über belastende/problematische und über freudige Dinge sprechen zu können. Die Validierung der eigenen Erfahrung (Therapie, Freundschaften). • Die Chance, sich selbst als stark, fähig und belastbar zu erfahren, sich für etwas zu interessieren (Schule, Interessen). • Kontinuierlicher Kontakt/Bindung zu engen Vertrauenspersonen über viele Jahre. Die Fähigkeit, solche Menschen zu suchen und zu finden. 38 Warum ist ein Interventionsprogramm für Familien mit psychisch kranken Eltern wichtig? Häufig wird bei der Behandlung psychisch kranker Erwachsener nicht nach den Kindern gefragt, so dass diese oftmals unversorgt und mit ihren Ängsten und Sorgen allein bleiben. Familienangebote gehören leider immer noch nicht zum Standard der Behandlung – auch nicht in Deutschland. ABER: „Kinder von psychisch kranken Eltern haben dann gute Entwicklungschancen, wenn Eltern, Angehörige und Fachleute lernen, in sinnvoller und angemessener Weise mit der Erkrankung umzugehen, und wenn sich die Patienten und ihre Kinder auf tragfähige Beziehungen stützen können.“ (Mattejat 2008) 39 Präventionsprogramme International wurde eine Vielzahl präventiver Interventionen für Familien mit psychisch kranken Eltern entwickelt, wobei die Mehrzahl indizierte Pärventionsprogramme sind (Übersicht in: Christiansen et al., 2011; Fraser et al., 2006; Garber et al., 2009; Gladstone & Beardslee, 2009; Röhrle & Christiansen, 2009; Röhrle, Behner & Christiansen, 2012). Formal lassen sich kind‐ oder elternzentrierte sowie bifokal angelegte Programme unterscheiden. 40 Präventionsprogramme Gemeinsame Komponenten dieser präventiven Maßnahmen sind: – Screenings zur Einschätzung der Risiko‐ und Versorgungssituation – Psychoedukation (Eltern, Kinder, Familie) – Innerfamiliäre Entlastungen, z. B. durch Stressbewältigungstraings, Förderung der familiären Kommunikation – Unterstützung beim Umgang mit Gefühlen, v. a. Abbau von Ängsten und Schuldgefühlen, Aufbau positiven Selbstwertes – Intensivierung familienexterner Kontakte zur familiären Dezentrierung und Förderung kindlicher Autonomie – Strukturelle Maßnahmen (Röhrle & Christiansen, 2009) 41 Kritik der bestehenden Präventionsprogramme Die Mehrzahl der bestehenden Programme basiert nicht auf evidenzbasierten Forschungskriterien, d. h. Interventions‐ und Präventionsstrategien beruhen vielfach auf Erfahrungen im Kontext von Projektberichten, nicht auf kontrollierten Studien mit FU (Christiansen et al., 2011). Interventionen mit guten Effekten waren evidenzbasiert, strukturiert, manualisiert und wurden von trainierten Projektleitern durchgeführt, wobei die Umsetzungsqualität erfasst wurde (Gladstone & Beardslee, 2009; Christiansen et al., 2011). ‐ In einer eigenen Studie konnten wir 4990 Studien zu dem Thema identifizieren, von denen aber nur 31 für eine Meta‐Analyse herangezogen werden konnten (Christiansen et al., submitted). 42 Kritik der bestehenden Interventionsprogramme Ergebnisse unserer Meta‐Analyse (Christiansen et al., submitted) ‐ Interventionen für Kinder/Jugendliche (6‐18 Jahre) führen zu kleinen, homogenen Effekten (Abnahme Psychopathologie, g = .346), die im FU erhalten bleiben (g = .338). ‐ Mütter‐Säugling‐Programme führen zu ähnlichen, aber heterogenen Effekten (g = .337), wobei sich der SÖS als ein signifikanter Mediator erweist (g = .371). ‐ Spezifische Interventionen für Kinder psychisch kranker Eltern sind unspezifischen und TAU überlegen (g = .542), wobei die Moderatoren Studienqualität (g = .265) und Gruppenformat (g = .227) bedeutsam sind. ‐ Mehrzahl der Studien zu Depression und Suchterkrankungen, kaum Angaben zu mediierenden (z. B. Programmakzeptanz) und moderierenden Faktoren (z. B. SES, aktuelle elterliche Erkrankung).43 Zusammenfassung • Von den stationär psychiatrisch behandelten Patienten hat die Mehrzahl Kinder und unser Wissen über diese Kinder, deren Belastungen und Hilfebedarf ist sehr gering. • Dabei sind Kinder psychisch kranker Eltern einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt und die transgenerationale Transmission psychischer Störungen ist eine der Hauptursachen psychischer Störungen (Hosman et al., 2009). • Schutzfaktoren können Risiken abmildern, aber nur dann erfolgreich, wenn die Anzahl der Risiken 2‐3 nicht übersteigt (Wille et al., 2008). • Die vorliegenden Präventionsprogramme sind alle indizierte Programme und nur wenige sind evidenzbasiert. • Diese zeigen kleine, stabile Effekte, wobei bislang bedeutsame Moderatoren und Mediatoren nicht systematisch erfasst und analysiert werden. Strukturelle Faktoren psychischer Gesundheit „Warum nicht den Fluss hinaufgehen und den suchen, der die Leute hineinstößt? Das ist mit Prävention gemeint.“ (Rappaport, 1977, S. 62) 45 Strukturelle Faktoren psychischer Gesundheit Obschon die Risiken und Widersprüchlichkeiten im Leben nach wie vor sozial produziert werden, ist die Verantwortung, mit diesen umzugehen und sie zu bewältigen, auf das Indiviudum übertragen worden. (Zygmunt Baumann, 2007) Je höher der SÖS, desto besser ist die physische & psychische Gesundheit. Unterschiede in der Gesundheit sind ein Resultat sozialer Unterschiede. 46 Strukturelle Faktoren psychischer Gesundheit 47 Strukturelle Faktoren psychischer Gesundheit 48 Strukturelle Faktoren psychischer Gesundheit Pickett KE, James OW, Wilkinson RG. Income inequality and the prevalence of mental illness: a preliminary international analysis. Journal of Epidemiology and Community Health 2006;60(7):646-7. 49 Strukturelle Faktoren psychischer Gesundheit 50 Strukturelle Faktoren psychischer Gesundheit 51 Strukturelle Faktoren psychischer Gesundheit Die Reduktion gesundheitlicher Ungleichheit hat 6 Ziele: 1. Beste Startchancen für alle Kinder; 2. Volle Ausschöpfung von Fähigkeiten und Kapazitäten aller Kinder und Erwachsener; 3. Faire und gute Arbeitsbedingungen für alle; 4. Sicherstellung gesunder Lebensstandards für alle; 5. Schaffung und Ausbau gesunder und nachhaltiger Städte und Gemeinden; 6. Ausbau der Gesundheitsprävention und Betonung ihrer gesellschaftlichen Bedeutung. 52 Strukturelle Faktoren psychischer Gesundheit 53 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! [email protected]‐marburg.de 54 55 Projekt SONNE Gruppenprogramm mit jeweils 3‐5 teilnehmenden Familien I. Diagnostik für Eltern & Kinder: 1 – 2 Termine II. Gruppensitzungen Eltern: 2 Termine (je 90 Min.) III. Gruppensitzungen Kinder: 5 Termine (je 90 Min.) IV. Individuelle Familiensitzung 1 Termin (90 Min.) 56 Projekt SONNE Annahmen: Wissen über die Erkrankung entlastet! „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ Innerhalb der Familien bestehen Redeverbote, nicht geäußerte Sorgen/Ängste bei Kindern & Eltern! Alle Familien haben Ressourcen! 57 Kindersitzungen Sitzung 1 Kennenlernen & Gruppenregeln – Bildung einer Gruppenidentität Sitzung 2 & 3 kindgerechte Informationsvermittlung über psychische Störung & Austausch von Erfahrungen Sitzung 4 Gefühlswahrnehmung & – ausdruck; Gefühlsbewältigungsstrategien Sitzung 5 Vorbereitung Familiensitzung & Krisenplan; Abschied (Party) Psychoedukation Störungsspezifisch Emotionen Störungsunspezifisch Soziale Unterstützung Störungsunspezifisch 58 Informationsvermittlung Kinder Die Informationsvermittlung fand mit Hilfe einer kindgerechten, fiktiven Geschichte (Sarah,9 Jahre) oder für Ältere mit einer Jugendzeitschrift und Leserbriefen statt. 59 Gefühlswahrnehmung & ‐ausdruck Zentral, dass man nicht immer wissen muss, warum man traurig, fröhlich, wütend oder ängstlich ist, dass man auch durcheinander sein kann und es v.a. darauf ankommt, anderen seine Gefühle mitzuteilen. 60 Krisenplan 61 Inhalte Elternsitzungen Krankheitsspezifische Erfahrungen & Psychoedukation – eigene krankheitsspezifische Erfahrungen und Sicht des gesunden Partners auf die Erkrankung des Partners – elterliche Wahrnehmung des psychosozialen Funktionsniveaus des Kindes • Stärken und Schwächen der Kinder • Risiko‐ und Resilienzfaktoren (Schutzfaktoren) – Vorbereitung der Familiensitzung 62 Familiensitzung Ziel der Sitzung ist der gegenseitige Austausch von Eindrücken und Gefühlen innerhalb der Familie. Die Familie soll miteinander ins Gespräch kommen und dadurch zur Perspektivenübernahme befähigt werden. 63 Familiensitzung Mögliche Fragen an jedes Familienmitglied: Was kann der andere besonders gut? Was soll sich im Alltag verändern? Wie nimmst du die Erkrankung wahr? Außerdem wird in der Familiensitzung ein Krisenplan ausgearbeitet. 64 Pilotstudie In Kooperation mit der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Rheinischen Kliniken Essen und der Hephata‐Klinik Schwalmstadt nahmen insgesamt 18 Familien teil. 30 gesunde Familien nahmen als Kontrollstichprobe teil. 65 Pilotstudie 24 Familien der KG aber nur 2 Familien der EG verfügten über ein Einkommen von > 40.000 Euro. Eltern aus 10 Familien der KG und keine Familie aus der EG hatten ein abgeschlossenes Hochschulstudium. 29 Familien der KG und 1 Familie der EG waren Teil‐ oder Vollzeit beschäftigt. Die Kinder waren im Mittel 10 Jahre alt und hatten einen durchschnittlichen IQ. Im Vergleich zur KG hatten die Kinder der EG signifikant erhöhte Werte in der CBCL/im SDQ und im DIKJ. 66 Pilotstudie Alle Kinder zeigten nach der Intervention einen signifikanten Zuwachs an Wissen über die elterliche Erkrankung. Es zeigte sich keine Veränderung in der Symptomatik (CBCL/SDQ/DIKJ). Aber es gab einen positiven Zusammenhang zwischen dem Wissenszuwachs und Verhaltensauffälligkeiten, d.h. je größer der Wissenszuwachs, desto geringer die Verhaltensauffälligkeiten. Der Zuwachs an Wissen hing in gleicherweise mit der Einschätzung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität der Kinder durch die Eltern zusammen. Die Zufriedenheit mit der Programmteilnahme war bei allen Eltern und Kindern sehr hoch. 67 Pilotstudie Durchführungsprobleme ADHS‐Symptomatik der Kinder häufig komorbide LRS‐Symptomatik der Kinder große Altersspanne in der Kindergruppe Entfernung zur Klinik Schweinegrippe 68 Pilotstudie Vorläufiges Fazit Multiple Belastungen von Eltern & Kindern – Eignung ambulantes Gruppenprogramm? Eltern wollten nicht, dass ADHS als Krankheit bezeichnet wird. Wissen der Kinder zu ADHS beschränkte sich darauf, dass sie Medikamente nahmen; in Gruppe erstmals Aufklärung über Störungsbild. Sowohl Eltern als auch Kinder äußerten sich sehr positiv über die Programmteilnahme und gaben an, dass sie trotz anfänglicher Bedenken gern gekommen seien und Spaß an der Teilnahme gehabt hätten. 100 % Rücklauf Postbefragung 69 Fazit • Die große Mehrzahl der Patienten, die intensive therapeutische Behandlung in Anspruch nimmt – und das ist nur eine kleine Minderheit – hat Kinder; • diese zeigen bereits selber wieder behandlungsbedürftige Auffälligkeiten und es besteht ein hohes Chronifizierungsrisiko; • dies steht einer mangelnden integrativen Versorgung gegenüber sowie einem mangelnden Wissen über die tatsächliche Situation der Kinder (genaue Angaben über Alter, Geschlecht, psychische Beeinträchtigungen und Ressourcen). Fazit • Präventive Maßnahmen für Familien, die in die Behandlung der Eltern integriert werden, bieten eine Möglichkeit, gezielt an einem der größten Risikofaktoren psychischer Störungen anzusetzen • und haben sich zudem in verschiedenen Studien als wirksam erwiesen (Christiansen et al., 2010). • Dafür brauchen wir aber noch genaueres Wissen über die betroffenen Kinder kranker Eltern. • Ein erster Schritt wäre, dies systematisch in den Einrichtungen der Erwachsenenversorgung zu erfassen, um dann den Risikofaktoren mit gezielten Präventionsmaßnahmen begegnen zu können. Fazit Wir brauchen ein gesundheitspolitisches Umdenken und strukturelle Präventionen, die wahrscheinlich sehr viel mehr und langfristig erreichen können. Bis das erreicht ist, brauchen wir sehr gute Interventionen für Kinder psychisch kranker Eltern. Wir brauchen gute Studien – nicht nur zu affektiven und Suchterkrankungen – , die die Wirksamkeit von Intervention belegen, um gesundheitspolitisch eine Regelversorgung für diese Familien fordern zu können. Wir brauchen Kooperationen mit Kliniken, Beratungsstellen, Ambulanzen, Praxen, Jugendämtern, Initiativen und Projekten, die mit diesen Familien arbeiten, um die Wirkung von Interventionen im klinischen Alltag erproben und verbessern zu können. 72