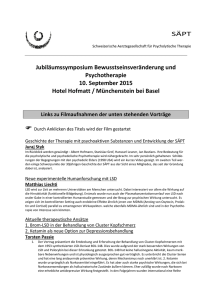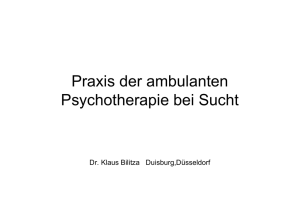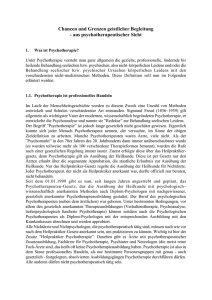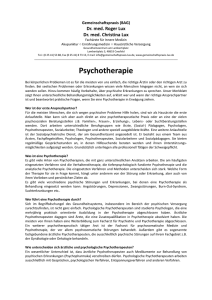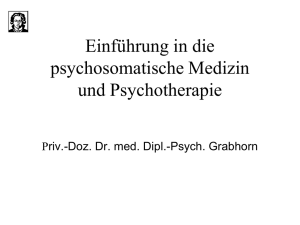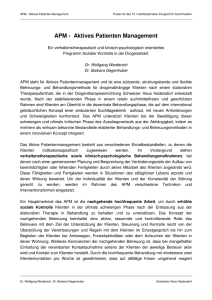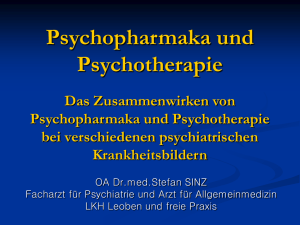Barrieren bei der Inanspruchnahme von Psychotherapie
Werbung

Stefan Spitzbart Barrieren bei der Inanspruchnahme von Psychotherapie Ergebnisse einer empirischen Studie bei TherapienutzerInnen in Oberösterreich Stefan Spitzbart Barrieren bei der Inanspruchnahme von Psychotherapie Linz 2004 Schriftenreihe “Gesundheitswissenschaften” Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Josef Weidenholzer Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik Johannes Kepler Universität Linz In Zusammenarbeit mit der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse Band 28: „Barrieren bei der Inanspruchnahme von Psychotherapie“ Wissenschaftlicher Beirat: Dr. Martin Gleitsmann, Mag. DDr. Oskar Meggeneder, Dr. Michaela Moritz, Univ.-Prof. Dr. R.H. Noack, Ph.D., Dr. Hans Popper, Dr. Josef Probst, Univ.-Prof. Dr. Reinbert Schauer, Univ.-Prof. Dr. Josef Weidenholzer, Redaktionelle Betreuung: Wirtschaftskammer Österreich Direktor-Stellv. OÖ Gebietskrankenkasse Österr. Bundesinstitut für Gesundheitswesen Institut f. Sozialmedizin, Universität Graz Direktor OÖ Gebietskrankenkasse Mitglied der Geschäftsührung, Hauptverband d. österr. Sozialversicherungsträger Institut f. BWL der gemeinschaftlichen Unternehmen, Universität Linz Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik, Universität Linz Mag. Werner Bencic OÖ Gebietskrankenkasse Medieninhaber: Oberösterreichische Gebietskrankenkasse Copyright 2004 beim Autor Umschlag: Reinhard Koppensteiner ISBN 3-900581-44-4 Printed in Austria 2 3 Inhaltsverzeichnis 1 2 Vorwort 7 Einleitung 9 1.1 Problemstellung 10 1.2 Zentrale Ziele und Forschungsfragen 11 1.3 Forschungsdesign / Methodik 12 Theoretische Konzeption 2.1 Psychotherapie im Gesundheitssystem 13 2.2 Gesundheits- und Krankheitsverhalten 14 2.2.1 2.2.2 Begriffsdefinitionen Erklärungsansätze für Gesundheits- und Krankheitsverhalten 2.2.2.1 Psychologische Ansätze 2.2.2.1.1 Theorie der Handlungsveranlassung 2.2.2.1.2 Modell gesundheitlicher Überzeugung 2.2.2.1.3 Das sozialkognitive Prozessmodell 2.2.2.2 Soziologische Theorien 2.2.2.2.1 Theorie des Hilfesuchens 2.2.2.2.2 Soziale Ungleichheit und gesundheitliche Ungleichheit 2.2.2.2.3 Strukturmodell gesundheitsrelevanter Lebensstile 2.2.2.3 Coping – Verarbeitungsprozesse bei Krankheit 2.2.2.3.1 Modelle der Krankheitsbewältigung 2.2.2.3.2 Soziale Netzwerke im Copingprozess 2.3 Psychische Störungen im Versorgungssystem 2.3.1 2.3.2 2.3.3 15 16 16 17 18 19 21 23 26 28 29 30 32 33 Die Rolle der Ärzte im Zuweisungsprozess Medikation und psychische Störungen Compliance in der Arzt - Patienten Beziehung 34 37 38 2.3.3.1 Determinanten der Compliance 2.3.3.2 Patientenmerkmale 2.3.3.3 Behandlungsvariablen und Krankheitsvariablen 39 40 42 2.4 Stigmatisierung 2.4.1 2.4.2 Goffmans Stigmabegriff Stigmatisierung psychisch Kranker 2.5 Ausgangssituation und Forschungsdesign der Untersuchung 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 3 13 Modell der Untersuchung Konzeption der Barrieren Forschungshypothesen der Untersuchung Durchführung der Erhebung und Beschreibung der Stichprobe Empirische Befunde 3.1 Die Ausgangslage der Psychotherapieklienten 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 Geschlecht Alter Schulbildung Derzeitiger Lebensstatus und berufliche Position Haushaltseinkommen Familienstand 42 43 43 44 45 49 50 52 56 56 56 57 58 60 61 62 5 3.1.7 3.1.8 Wohnbezirk Bisherige Inanspruchnahmen 3.2 Symptome und Hilfesuchen 3.2.1 3.2.2 Symptome und Auffälligkeiten Informationsquellen über Psychotherapie und Therapiefinanzierung 3.2.2.1 Informationen über Psychotherapie 3.2.2.2 Informationen zur Therapiefinanzierung 3.2.3 Die Bedeutung der Gesundheitsprofessionen beim Hilfesuchen 63 64 64 65 68 68 71 73 3.2.3.1 Die Bedeutung der praktischen Ärzte im Zuweisungsprozess 75 3.2.3.1.1 Einschätzung der fachlichen Kompetenz 3.2.3.1.2 Therapieinformation und –motivation durch den praktischen Arzt 78 80 3.2.3.2 Zuweisung zur Psychotherapie 3.2.4 Psychotherapieklienten und Psychopharmaka 3.3 Barrieren und Hilfen vor der Inanspruchnahme 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Die Therapeutensuche Erwartungshaltungen an die Behandlung Die Kosten einer Behandlung 3.3.3.1 Die finanziellen Kosten einer Inanspruchnahme 3.3.3.2 Die zeitlichen Kosten einer Inanspruchnahme 3.3.3.3 Die sozialen Kosten einer Inanspruchnahme 3.3.4 Das Angebot 3.3.4.1 Erreichbarkeit der Therapie 3.3.4.2 Wartezeiten 3.4 Inanspruchnahme der Therapie und Therapiebewertung 3.4.1 3.4.2 3.4.3 Organisationsform der aufgesuchten Praxis Anzahl der absolvierten Therapieeinheiten Bewertung der Zufriedenheit mit der Therapie 3.4.3.1 3.4.3.2 3.4.3.3 3.4.3.4 3.4.3.5 Wiederaufsuchen einer Therapie Empfehlung an Freunde Zufriedenheit mit dem Therapeuten Erfolg der Therapie Gesamtzufriedenheit 3.5 Die Wirkung von Barrieren 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 3.5.7 Der Leidensweg unter soziodemografischen Gesichtspunkten Unterschiede in der zeitlichen Vereinbarkeit Soziale Kosten und sozialer Status Geografische Erreichbarkeit und Wohnbezirk Wartezeit und Kostenhindernis Ausmaß der Barrieren Unterschiede im Ausmaß der Barrieren 81 84 86 86 88 91 91 94 96 98 99 100 102 102 103 104 104 105 106 107 107 108 109 111 112 113 114 116 117 3.6 Unterschiede zwischen freien Praxen und institutionellen Praxen118 3.6.1 3.6.2 4 6 Unterschiede im Klientel Unterschiede in den Barrieren und der Zufriedenheit 118 121 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 123 Literaturverzeichnis 128 Internetrecherche 131 Anhang 132 Vorwort Psychische Erkrankungen zählen nach einer international vergleichenden Studie weltweit zu jenen Erkrankungen, welche am meisten Kosten verursachen. Insbesondere in den sogenannten „westlichen“ Gesellschaften sind offenbar die Menschen immer weniger in der Lage, die vielfältigen sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Herausforderungen „gesund“ zu bewältigen. Rund ein Viertel der Bevölkerung leidet mindestens einmal im Leben an einer psychischen Erkrankung, welche behandlungsbedürftig ist. Bei einer entsprechenden Behandlung spielen neben medikamentösen biologischen Therapieverfahren psycho- und soziotherapeutische Maßnahmen eine immer größere Rolle. Insbesondere über die Nutzung der „leichter“ zugänglichen Therapieverfahren im Umkreis der Psychotherapie ist allerdings wenig bekannt. Dies gilt im besonderen Maße für Österreich. Es wird zwar davon gesprochen, dass rund 0,7 Prozent der österreichischen Bevölkerung psychotherapeutische Hilfen in Anspruch nehmen, der tatsächliche Bedarf in Österreich wird aber auf zwei bis fünf Prozent der Bevölkerung geschätzt. Dies, obwohl in Österreich Psychotherapie als eigenständige Heilverfahren im Gesundheitsbereich zur Behandlung von psychischen, psychosozialen und psychosomatisch bedingten Verhaltensstörungen seit 1991 gesetzlich geregelt ist und seit 1992 psychotherapeutische Heilverfahren im Pflichtenkatalog der sozialen Krankenversicherungen enthalten sind. Über diese Diskrepanz zwischen Bedarf und tatsächlicher Nutzung ist allerdings kaum etwas bekannt. Mit diesem Phänomen hat sich auf Anregung der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse Stefan Spitzbart in der vorliegenden Arbeit ausführlich befasst. Er geht in seiner empirischen Untersuchung der Frage nach, welchen Barrieren und Hindernissen wirtschaftlicher, sozialer, emotionaler und struktureller Art Menschen, die eine psychotherapeutische Behandlung beginnen wollen, ausgesetzt sind und überwinden müssen. Verlässliche Kenntnisse über diese Barrieren sind eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass entsprechende Maßnahmen zu deren Überwindung ergriffen werden können. Die gewonnenen Ergebnisse sind im besonderen Masse interessant. Mittels einer anonymisierten postalischen Befragung hat Spitzbart bei Kunden der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse herausgefunden, wie wichtig das engere soziale Umfeld bei der Inanspruchnahme einer Psychotherapie ist. Auf ein Ergebnis sei in diesem Zusammenhang besonders hingewiesen: Die Studie zeigt unter anderem deutlich auf, dass die gesellschaftliche Stigmatisierung nach wie vor sehr hoch ist und eine wesentliche Barriere beim Zugang zu psychotherapeutischen Heilverfahren darstellt. Spitzbart hat auch ganz klare praktische Empfehlun- 7 gen zur Verbesserung der Situation heraus gearbeitet. Insgesamt machen die Ergebnisse deutlich, dass es bei weitem nicht genügt, Therapieangebote zu installieren, sondern dass es wesentlich auch auf die Bekanntheit und die „emotionale“ Zugänglichkeit ankommt, damit diese Angebote auch angenommen werden. In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, dass es im Rahmen der Fragestellung und der vorhandenen organisatorischen und finanziellen Ressourcen weder beabsichtigt noch möglich war, auch die Barrieren bei jenen Menschen zu erkunden, welche trotz eines objektiv hohen Behandlungsbedarfs keine psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Dies schmälert aber den wissenschaftlichen und praktischen Wert der Diplomarbeit in keiner Weise. Die vorliegende gesundheitssoziologische Diplomarbeit ist somit als ein wichtiger Beitrag zum in Österreich eher vernachlässigten Bereich der psychosozialen Versorgungsforschung zu betrachten. Alfred Grausgruber Institut für Soziologie, Johannes Kepler Universität Linz 8 1 Einleitung In westlichen Gesellschaften wächst der Anteil der Bevölkerung mit sozialen Belastungen und psychischen Leiden. Kulturelle, soziale, wirtschaftliche und ökologische Lebensbedingungen sind scheinbar für viele Menschen nicht „gesund“ zu bewältigen.1 Epidemiologischen Studien zufolge leidet rund ein Viertel der Bevölkerung mindestens einmal in seinem Leben an einer definierten psychischen Krankheit. Je nach Weite der theoretischen Konzeption von psychischer Erkrankung in den verschiedenen Studien beträgt der Anteil bis zu 50 Prozent der Bevölkerung. Aber nur ein kleiner Teil derer, die an einer psychischen Störung leiden, erhalten tatsächlich professionelle Hilfe und nehmen eine adäquate Therapie in Anspruch. Die psychotherapeutische Versorgung in Österreich ist seit 1991 durch eine Reihe gesetzlicher Maßnahmen geregelt, die den sukzessiven Aufbau eines bedarfsadäquaten Versorgungsangebotes bilden. Mit der 1992 in Kraft getretenen ASVG-Novelle wurde die psychotherapeutische Behandlung in den Pflichtkatalog der sozialen Krankenversicherungen aufgenommen.2 Psychotherapie kann zur Erreichung einer umfassenden Gesundheit auf psychischer Ebene beitragen. Als Bestandteil der gesundheitlichen Versorgung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung gewinnt die psychotherapeutische Behandlung immer mehr an Bedeutung. Eine wachsende Nachfrage und eine quantitative Erweiterung des Angebotes durch die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse spiegeln diese Entwicklung wider. Damit aber den Bedürfnissen der Versicherten, in diesem Fall den Klienten von Psychotherapie, entsprochen werden kann, benötigt man Informationen von dieser Bevölkerungsgruppe. Der Zugang ist ein sensibler Bereich, bei dem die Hilfesuchenden Hemmschwellen und soziale Barrieren zu überwinden haben, und wo es wichtig wäre, zusätzliche Frustrationserlebnisse zu vermeiden. Aus diesem Grund wurden Klienten, die Psychotherapie als Sachleistung oder eine finanzielle Bezuschussung durch die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse in Anspruch genommen haben, nach ihren Erfahrungen befragt. Um den Menschen, die psychotherapeutische Hilfe brauchen und suchen, den Zugang zu einer Therapie zu ermöglichen, die ihren Bedürfnissen und Erwartungen entgegenkommt, sollte dafür gesorgt sein, dass die Hilfesuchenden nicht bereits auf dem Weg dorthin ihre Motivation verlieren. 1 2 Hurrelmann S.7 ASVG-BGBI. Nr. 676/1991 9 Diese Erhebung soll als ein Diskussionsbeitrag zur Erleichterung und Beschleunigung des Zugangs zur Psychotherapie, zur Aufdeckung von Bedürfnissen und Erwartungen potentieller Klienten und zum Abbau von sozialen Barrieren und Hemmschwellen in Bezug auf die Zugangsbedingungen aus Sicht der Klienten betrachtet werden. 1.1 Problemstellung Die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse bietet ihren Versicherten unterschiedlichste Sach- und Geldleistungen zur Wiedererlangung von Gesundheit und zur Krankheitsprävention an. Seit ca. 10 Jahren beinhaltet dieser Leistungskatalog auch die finanzielle Bezuschussung oder die vollständige Leistungsübernahme für die Inanspruchnahme von Psychotherapie. Da es bis zum heutigen Tag vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger noch keinen Gesamtvertrag für diese Leistung gibt, basiert die Leistungserbringung in den einzelnen Bundesländern auf unterschiedlichen Modellen. Die Sachleistungsversorgung durch die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse erfolgt in eigenen Instituten der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse, durch Fachärzte und Allgemeinmediziner mit psychotherapeutischer Zusatzausbildung, sowie durch den Verein für prophylaktische Gesundheitsarbeit (PGA) und der Oberösterreichischen Gesellschaft für Psychotherapie (OÖGP). Neben einer Inanspruchnahme von Psychotherapie als Sachleistung besteht bei einer krankheitswertigen psychischen Störung auch die Möglichkeit für Betroffene, therapeutische Unterstützung bei Wahlpsychotherapeuten zu suchen. In diesem Fall wird diese psychotherapeutische Leistungserbringung in pauschalierter Weise – unabhängig von den tatsächlichen Kosten der Therapieeinheit - durch die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse bezuschusst. Kategorisiert man Leistungsempfänger ganz allgemein zum einen nach dem Bedarf, und zum anderen nach dem Nutzungsverhalten einer konkreten Leistung, ergibt sich folgendes Bild: Bedarfsgerecht versorgt sind all jene einzustufen, bei denen der Bedarf nach Versorgung besteht, und die eine angebotene Leistung nutzen. Besteht kein Bedarf, und erfolgt keine Inanspruchnahme von Leistungen, kann von einer adäquaten Nichtversorgung gesprochen werden. Zum Phänomen der Über- oder Unterversorgung kommt es in jenen Fällen, in denen der Bedarf und die Nutzung im Widerspruch zueinander stehen. Ziele einer optimierten gesundheitlichen Versorgung beinhalten unter anderem den Abbau von unterversorgten Versicherten und eine Minimierung der Überversorgung. 10 Ausgehend von dieser grundsätzlichen Überlegung soll in meiner Arbeit der/die „NutzerIn“ von Psychotherapie genauer charakterisiert, und der Weg bis zur Inanspruchnahme einer derartigen Therapie untersucht werden. Persönliche Erfahrungen und wahrgenommene Hemmnisse von ehemaligen Therapienutzern von der Wahrnehmung einer psychischen Beeinträchtigung bis zur tatsächlichen Inanspruchnahme einer Psychotherapie sollen Aufschluss darüber geben, wie sich die Versorgungsrealität aus Sicht der Versicherten darstellt, und welche Faktoren Einfluss auf die Inanspruchnahme von Psychotherapie nehmen. Schlussfolgerungen auf die Gruppe der Unterversorgten, also jenen Personen, die auf dem Weg des Hilfesuchens im Stadium des Leugnens, der Bagatellisierung, der Minimalisierung der Erkrankung, der Selbstmedikation oder im Laiensystem verhaftet bleiben, sind aus methodischen Gründen nicht zulässig. Auch wenn Psychotherapie vermehrt positiv bewertet wird und die Informiertheit in der Bevölkerung zugenommen hat, erfährt der Therapienutzer noch immer gewisse Barrieren bei der Inanspruchnahme von Psychotherapie. Die Zustimmung des Patienten von der Therapieempfehlung bis zur tatsächlichen Nutzung unterliegt einer Reihe von personellen und sozialen Faktoren, die einer Nutzung förderlich sein können, oder im Sinne vom Hemmnisfaktoren wirken. 1.2 Zentrale Ziele und Forschungsfragen Der Zugang zur Psychotherapie scheint zwar durch finanzielle Leistungen der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse erleichtert. Empirische Daten erwecken aber nach wie vor den Eindruck, dass Psychotherapienutzer überwiegend aus der Mittelschicht stammen. Ziel der empirischen Untersuchung ist es festzustellen ob, und wie sehr die Versorgungsleistung durch die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse beim Zugang und der Nutzung im Sinne einer egalisierenden Maßnahme wirkt, und welche personalen und sozialen Faktoren eine Rolle bei der Inanspruchnahme einer Psychotherapie spielen. Zu berücksichtigen sind hierbei unter anderem sozioökonomische und soziokulturelle Rahmenbedingungen, das Angebot und der individuelle Zugang im Bereich der Psychotherapie, Einstellungen zur Psychotherapie sowie das Krankheitsverhalten und wahrgenommene Hemmnisse. Die zentralen Forschungsfragen, die im Zuge meiner Arbeit näher beleuchtet werden sollen, lauten: • Welche Barrieren existieren, und erschweren somit den Zugang im Bereich der Psychotherapie? • Wie groß ist das Ausmaß der Barrieren die vor einer Inanspruchnahme wirken? 11 • Gibt es Statusunterschiede in Bezug auf die wahrgenommenen Barrieren? • Existieren Unterschiede in der Zufriedenheit mit der Therapie in Abhängigkeit vom Ausmaß der wahrgenommenen Barrieren? • Existieren Unterschiede im Ausmaß der Barrieren und der Zufriedenheit in Abhängigkeit von der Organisationsform der psychotherapeutischen Praxen? • Was kann getan werden, um die vorhandenen Barrieren abzubauen? 1.3 Forschungsdesign / Methodik Bei dieser Untersuchung liegt der Schwerpunkt auf quantitativen Methoden, mit einem überwiegend deskriptiven Charakter, und teilweise erklärenden Elementen. Gegenstand der Untersuchung sind in Oberösterreich lebende und bei der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse versicherte Personen, die Versicherungsleistungen für die Inanspruchnahme von Psychotherapie erhalten haben. Untersucht wird ein Querschnitt einer repräsentativen Stichprobe, die mittels postalischer Befragung interviewt werden. 12 2 Theoretische Konzeption 2.1 Psychotherapie im Gesundheitssystem In Österreich nehmen etwa 0,7 Prozent der Bevölkerung eine Psychotherapie in Anspruch, wobei dieser Anteil in den einzelnen Bundesländern stark variiert. In Oberösterreich liegt der Anteil an der Gesamtbevölkerung bei 0,45 Prozent, wobei rund die Hälfte davon Psychotherapie in einer Institution in Anspruch nimmt. Der auf zwischen 2,1 und 5 Prozent der Bevölkerung geschätzte quantitative Bedarf wird somit keinesfalls abgedeckt. Dieses rechnerische Defizit wird umso größer, wenn man berücksichtigt, dass ein Teil der derzeit Behandelten keine krankheitswertige Störung aufweist. Zur Erreichung der geschätzten Untergrenze müsste die Zahl der Behandelten zumindest um das Dreifache steigen.3 Psychotherapie in der Gesundheitsversorgung lässt sich von anderen Behandlungsmethoden vor allem dadurch unterscheiden, dass sie sich psychologischer Mittel bedient, um ihre Behandlungsziele zu erreichen. Weniger der Anwendungsbereich, sondern viel mehr das Vorgehen definiert Psychotherapie. Hauptanwendungsgebiete dieser Therapieform sind ohne Zweifel die psychischen und psychosomatischen Störungen. Immer mehr werden psychologische Behandlungsmethoden aber auch bei rein organischen Störungen begleitend zu medizinischen Maßnahmen angewandt. Psychotherapie wird neben einer Krankheitsbehandlung auch immer häufiger im Normalbereich, sprich bei Menschen die sich nicht im eigentlichen Sinne krank oder in der Alltagsausübung gestört fühlen, sondern Psychotherapie im Sinne einer Persönlichkeitsbildung betreiben, angewandt. Letztendlich sind trotz unterschiedlicher Anwendungsbereiche Anwender und angewandte Methoden weitgehend identisch, ob nun in der Anwendung im Normalbereich oder im Krankheitsbereich.4 In Österreich ist die Ausübung von Psychotherapie seit 1991 gesetzlich geregelt, und gilt als ein eigenständiges Heilverfahren im Gesundheitsbereich zur Behandlung von psychischen, psychosozialen oder auch psychosomatisch bedingten Verhaltensstörungen und Leidenszuständen. Sie besteht neben anderen Heilverfahren, wie beispielsweise der medizinischen oder der klinisch-psychologischen Behandlung.5 3 vgl. Schaffenberger et al. S.162 vgl. Grawe S.10f 5 vgl. ASVG -BGMI. Nr. 361/1990 4 13 Klerman und Weissmann klassifizieren drei Hauptklassen von Therapienutzern: 1. Personen mit einer diagnostizierten psychischen Erkrankung mit einer beträchtlich langen Dauer 2. Personen, die Probleme bei der Bewältigung von stresserfüllten Lebensereignissen haben 3. Personen, die dahingehend Psychotherapie betreiben, um ihre Möglichkeiten für mehr Erfolg und ein zufriedenes Leben zu verbessern. Nur bei den ersten beiden Gruppen kann eine psychiatrische Diagnose erstellt, und somit von einer krankheitswertigen psychischen Störung gesprochen werden. 6 Der Gesetzgeber und die Krankenkassen versuchen Psychotherapie im Krankenbereich von der Anwendung im Normalbereich, im Sinne einer psychologischen Beratung, zu trennen. Eine Leistungserbringung im Sinne einer Sachleistung oder Bezuschussung zur Psychotherapie wird von der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse nur für krankheitswertige Störungen gewährt. Als Leitlinien für die Klassifikation der Störungen als krankheitswertig dienen der ICD-9 und ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation. Ob eine entsprechende krankheitswertige Störung vorliegt und diagnostiziert, und in weiterer Folge auch psychotherapeutisch behandelt wird, hängt letztendlich davon ab, inwieweit die Betroffenen das bereitgestellte Angebot nutzen oder nutzen können, und wie der individuelle Umgang mit einer vorliegenden psychischen Störung aussieht. Denn das alleinige Vorliegen einer definierten Krankheit bedeutet noch lange nicht, dass die Betroffenen professionelle Hilfe aufsuchen. 2.2 Gesundheits- und Krankheitsverhalten Die Definition von Gesundheit und Krankheit variiert zwischen den Kulturen, Subkulturen und sozialen Gruppen. Auch innerhalb eines Haushaltes - beispielsweise zwischen den Generationen - kann das, was Gesundheit und Krankheit ausmacht, sehr unterschiedlich definiert werden. Abgesehen von den kulturellen Unterschieden gibt es große Unterschiede zwischen den Vorstellungen von Laien und den Konzepten der Medizin. 7 Grundsätzlich sind Gesundheit und Krankheit Phänomene, die in mindestens drei verschiedenen Bezugssystemen definiert werden: • Das Bezugssystem der betroffenen Person, welche sich gesund oder krank fühlt. 6 7 Klerman und Weissmann in Howard et al. S.697 vgl. Scambler S.35 14 • Das Bezugssystem der Professionen, das Gesundheit und Krankheit als Erfüllung oder Abweichung von objektivierbaren Normen physiologischer Regulation, organischer und auch psychischer Funktionen definiert. • Das Bezugssystem Gesellschaft, das Gesundheit und Krankheit unter dem Aspekt der Leistungsminderung und der Notwendigkeit Hilfe zu gewähren betrachten.8 Als primärrelevant und initial für die Inanspruchnahme einer Behandlung oder Therapie scheint das Verhalten der betroffenen Personen und deren Umgang mit Gesundheit und Krankheit zu sein. Ein psychotherapeutisches Angebot zu nutzen, ist letztendlich sowohl die Entscheidung eines Individuums, im Rahmen gesellschaftlicher Normen und unter Berücksichtigung individueller Ressourcen und Möglichkeiten für eine bestimmte Behandlungsform, als auch Ausdruck eines spezifischen Umgangs mit der vorliegenden psychischen Störung. Siegrist sieht Krankheit zu allererst als ein Phänomen der Befindlichkeit und des Verhältnisses des Menschen zu seinem Körper und seiner Psyche, und zum selbstinitiierten Handeln. Das Verständnis von Gesundheit und Krankheit ist aber auch durch gesellschaftliche Normen beeinflusst und Bestandteil der gesellschaftlichen Konstruktion von Wirklichkeit. Deshalb muss die Analyse des Hilfesuchens im Krankheitsfall, insbesondere der Reaktion auf wahrgenommene Beeinträchtigungen und Symptome, von diesen subjektiven und gesellschaftlichen Definitionsprozessen ihren Ausgang nehmen.9 2.2.1 Begriffsdefinitionen Verhalten kann zur Erhaltung von Gesundheit, zur Entwicklung von Krankheiten und deren Bewältigung und Heilung beitragen. Diese Erkenntnis führte zu vielseitigsten Versuchen auf das Verhalten von Menschen einzuwirken, um Krankheit zu verhindern, oder die Bewältigung von Beschwerden und Befindlichkeitsstörungen zu fördern. Mit dem Begriff Gesundheitsverhalten bezeichnet man Verhaltensweisen, die vor dem Hintergrund medizinischer Erkenntnisse als für deren Gesundheit förderlich, riskant oder schädlich (überwiegend im Sinne der potentiellen Verursachung von Krankheit) bewertet werden können. 10 8 vgl. Schwartz et al. S.8ff Siegrist 1995 S.199 10 vgl. Troschke S.371 9 15 Der Begriff des Krankheitsverhaltens bezieht sich auf Verhaltensweisen in der Auseinandersetzung mit eigenen Beschwerden und Befindlichkeitsstörungen, die als Krankheit interpretiert werden. Davon abzugrenzen ist das Krankenrollenverhalten als Verhalten eines Erkrankten unter dem Einfluss von Selbst- und Fremdwahrnehmung in seiner Rolle als Kranker.11 Die Begriffe Gesundheits- und Krankheitsverhalten charakterisieren zwar unterschiedliche situative Elemente und Sachverhalte, zeigen aber je nach der Weite des theoretischen Konstruktes gewisse Zusammenhänge. Theorien zum Gesundheitsverhalten beziehen sich im engeren Sinne überwiegend auf die Ursachen von Krankheit und intendieren meist Präventionsmaßnahmen zur Förderung von Gesundheit. Theorien des Gesundheitsverhaltens im weiteren Sinne erlauben aber auch Schlüsse auf den subjektiven Bewertungs- und Erklärungsprozess im Krankheitsfall, und liefern einen wichtigen Beitrag zur Verbessung des Systems der gesundheitlichen Versorgung. 2.2.2 Erklärungsansätze für Gesundheits- und Krankheitsverhalten Unterschiedliche Forschungen psychosozialer Fachrichtungen haben sich mit der Frage des Umgangs und der Bewältigung von Krankheit beschäftigt, und unterschiedliche theoretische Gebäude zu diesem Thema errichtet. Wurzeln liegen im psychoanalytischen Denken, in der Stressforschung, in kognitiv behavioralen Richtungen und in soziologischen Herangehensweisen. Entsprechend vieldimensional sind die Bestrebungen, die Determinanten des Krankheitsverhaltens und der Krankheitsbewältigung zu bestimmen. Die Frage ob der Umgang mit der Krankheit durch die Belastungssituation oder durch Persönlichkeitsmerkmale determiniert wird, ist Ausdruck dieser Bemühungen. In der Literatur wird nach der jeweiligen theoretischen Ausgangslage eine Vielzahl von Faktoren diskutiert, die das Krankheitsverhalten beeinflussen. Neben Krankheit und Persönlichkeitsmerkmalen können auch Determinanten im Bereich institutioneller und kultureller Faktoren von Bedeutung sein. So nehmen beispielsweise auch geografische, finanzielle und soziale Verfügbarkeit und Erreichbarkeit von Behandlungsressourcen einen gewissen Einfluss auf die Inanspruchnahme einer Behandlung. 2.2.2.1 Psychologische Ansätze 11 ebenda S.371 16 Psychologische Erklärungsansätze versuchen Verhalten in Abhängigkeit von Einstellungen und Kenntnissen zu verstehen. Die Gesundheitspsychologin Taylor fasst die aus ihrer Sicht wichtigsten Bestimmungsgrößen für Gesundheitsverhalten wie folgt zusammen: Menschen verhalten sich gesundheitsbewusst, wenn: • eine Gesundheitsbedrohung schwerwiegend erscheint • die subjektive Verletzbarkeit oder Auftretenswahrscheinlichkeit für eine Krankheit hoch ist • jemand glaubt eine protektive Handlung zur Verfügung zu haben • diese Handlung als eine wirksame Maßnahme zur Abwehr der Gefahr eingeschätzt wird12 2.2.2.1.1 Theorie der Handlungsveranlassung Die von Ajzen und Fishbein entwickelte Theorie der Handlungsüberzeugung steht in der sozialpsychologischen Tradition der Klärung der Beziehung zwischen Einstellung und Verhalten. Es geht in dieser Theorie primär darum, welche psychologischen Faktoren in welcher Kombination menschliches Handeln hervorrufen und vorhersagen lassen. Obwohl sie als allgemeine Theorie des Handelns verfasst wurde, fand sie vor allem Anwendung auf gesundheitsrelevante Fragestellungen.13 Die Theorie umfasst die vier Elemente Verhalten, Intention, Einstellung und subjektive Norm. Unter Intention werden verbal vermittelte Verhaltensabsichten verstanden, die darin bestehen können, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen oder zu unterlassen. Verhalten wird als direkte Folge einer Verhaltensabsicht betrachtet. Die Intention wird als einzig direkter Bestimmungsfaktor des Verhaltens angesehen, weshalb sich das Modell auf die Erklärung der Verhaltensintention beschränkt. Die beiden Variablen Einstellung und subjektive Norm wirken dabei auf die Intention. Die Einstellungsvariable beinhaltet, ob die Durchführung des jeweiligen Verhaltens positiv oder negativ bewertet wird. Die subjektive Norm bezieht sich auf Kognitionen der Person darüber, wie wichtig Bezugspersonen oder –gruppen über die Ausführung des Verhaltens denken, und es bewerten. Es geht hier um die Perzeption des sozialen Gruppen- oder Umgebungsdrucks.14 Demografische Variablen, Einstellung gegenüber Objekten und Persönlichkeitsmerkmale werden in diesem Modell lediglich als externe Variab12 Taylor zitiert in Schwarzer S.11 vgl. Hornung S.34 14 vgl. Hornung S.34f 13 17 len betrachtet, deren Stellenwert als eher gering veranschlagt wird. Sie sind nur in sofern von Bedeutung, als sie persönliche und normative Überzeugungen direkt beeinflussen können, die dann indirekt auf das Handeln einwirken.15 Bezogen auf die Fragestellung würde die Theorie verkürzt folgendes postulieren: Eine Person, die psychisch erkrankt ist, wird dann Psychotherapie in Erwägung ziehen, wenn eine positive Einstellung zur Inanspruchnahme einer Psychotherapie vorliegt, sprich die Einstellung zum Verhalten eine positive Bewertung der Sofortfolgen für die Gesundheit erfährt, und die für die Person wichtigen Bezugsgruppen wie beispielsweise Freunde, Partner/in oder Familienmitglieder ebenfalls diese Behandlungsmethode positiv bewerten oder empfehlen. 2.2.2.1.2 Modell gesundheitlicher Überzeugung Die medizinischen Professionen gehen oft davon aus, dass die Wiederherstellung von Gesundheit das oberste Ziel eines jeden Kranken sei. Dass aber die individuelle Wichtigkeit von Gesundheit variiert in Bezug auf die wahrgenommenen Nutzen und Kosten, wird beispielsweise durch die Health Belief Theorie relativiert. Das Modell impliziert, dass menschliches Handeln rational bestimmt ist. Es versucht sowohl Vorhersagen über Vorsorgeverhalten als auch über das Aufsuchen einer professionellen Beratung oder Behandlung zu treffen. Eingebettet in einen demografischen und soziopsychologischen Rahmen wird das Individuum von vier Faktoren in seinem Krankheitsverhalten beeinflusst. Ein Faktor betrifft die subjektive Vulnerabilität oder Verletzbarkeit. Menschen die sich selbst gegenüber einer Krankheit als verwundbar halten, sind eher geneigt, professionelle Hilfe aufzusuchen, und sich an deren Empfehlungen zu halten. Der erlebte Schweregrad von Symptomen wird als ein weiterer Faktor für das Gesundheitsverhalten angesehen. Häufig wird aber die objektive Gefährlichkeit von Krankheiten unterschätzt. Symptome werden nicht ernst genommen, sodass kein Gefühl der Bedrohung entsteht, welches zu einem gesundheitsförderlichen Verhalten motivieren könnte. Schweregrad und subjektive Verletzlichkeit ergeben gemeinsam den Grad der wahrgenommenen Bedrohung durch eine Krankheit. Zusätzlich zur wahrgenommenen Bedrohung muss das vorhanden sein einer wirksamen Gegenmaßnahme erwartet werden, welche es gestattet, die Krankheit erfolgreich zu behandeln. Dieser Faktor löst eine Kosten-Nutzen-Abwägung aus. Die Behandlung mag teuer, nicht bekannt, wenig erfolgversprechend oder schwer zugänglich sein, 15 vgl. Schwarzer S.9 18 was dem erwarteten Nutzen gegenüber gestellt wird. Neben diesen Faktoren sind im Modell der gesundheitlichen Überzeugung noch externe Reize vorgesehen, die als Handlungsanstöße wirken.16 Derartige Handlungsanstöße könnten die Empfehlung einer bestimmten Behandlung oder die Beurteilung der Symptome und das Erkennen einer Erkrankung durch andere sein. Empirische Prüfungen des Modells haben gezeigt, dass es offenbar konsistente, wenn auch schwache Zusammenhänge zwischen den Modellkomponenten und dem Gesundheits- und Krankheitsverhalten gibt. Diese empirischen Schwächen dürften durch eine mangelnde theoretische Stringenz sowie Operationalisierungsprobleme zu erklären sein. Das Konzept ist nicht präzise genug definiert, und man weiß nicht ganz genau, wie man die Variablen überhaupt messen soll.17 2.2.2.1.3 Das sozialkognitive Prozessmodell Dieses Modell stellte eine Synthese aus den oben angeführten Modellen nach Schwarzer dar, und versucht strukturelle Mängel vorangegangener Modelle zu überwinden. Das Modell unterscheidet zwischen einem motivationalen Prozess, in dem es zur Intentionsbildung kommt, und dem volitionalen Prozess, bei dem es zur Realisierung des gesundheits- oder krankheitsbezogenen Handelns kommt. Gesundheitsbezogene Intentionsbildung Für den Prozess der Intentionsbildung spielen im Wesentlichen die Konstrukte aus den vorher beschriebenen Modellen eine Rolle. Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass die wahrgenommene Verwundbarkeit, der wahrgenommene Schweregrad und die erwartete Handlungswirksamkeit eine wichtige Bedeutung besitzen, jedoch in bisherigen Modellen undifferenziert verwendet wurden. Verwundbarkeit und Schweregrad werden als subjektive Stresseinschätzungen aufgefasst, aus denen ein gewisses Maß an Bedrohung resultiert. Der wahrgenommene Schweregrad einer Krankheit ist nichts anderes als eine Ergebniseinschätzung in der die Gefahrenelemente erkannt und interpretiert werden. Je schwerwiegender die Folgen einer Erkrankung sind, desto mehr Stress wird empfunden. Der erlebte Grad der Bedrohung hängt nicht nur vom Schweregrad, sondern auch vom Grad der subjektiven Verwundbarkeit ab. Dieser stress16 17 vgl. Schwarzer S.42f ebenda S. 42 19 relevante Variablenkomplex ist neben anderen kognitiven Faktoren wie Ergebniserwartung, Kompetenzerwartung und sozialen Erwartungen wesentlich für die Intentionsbildung in der Theorie des Gesundheitsverhaltens.18 Kompetenzerwartung drückt in Anlehnung an Bandura eine optimistische Annahme bezüglich der Kontrollierbarkeit und Steuerbarkeit personalen Handels aus. Unter Kompetenzerwartung versteht man demnach die Überzeugung einer Person mit dem eigenen Verhaltensrepertoire in einer bestimmten Situation erfolgreich zu sein. 19 Bei der Ergebniserwartung geht es um die Bestimmung einer Wahrscheinlichkeit, durch Handeln oder systematische Anstrengung ein gewünschtes Ergebnis hervorzurufen. Erwartet eine Person, durch Einsatz der ihr zur Verfügung stehenden Mittel mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit etwas zu bewirken, dann hegt sie eine positive Ergebniserwartung.20 Die genannten Merkmalsbereiche stehen in Beziehung zueinander und werden als ursächliche Determinanten für die Intentionsbildung, die der Realisierung einer Handlung vorausgehen, angesehen. Der volitionale Prozess Dieser Prozess verläuft auf drei verschiedenen Ebenen: einer kognitiven, einer handlungsbezogenen und einer situativen. Der Begriff Volition meint hier nicht einfach Willenskraft, sondern ist ein Sammelbegriff für alle handlungsbezogenen Kognitionen direkt vor, während und nach einer Handlung. Bevor die Handlung durchgeführt wird, wird die Handlung geplant, wobei in dieser Planungsphase noch einmal die Kompetenzerwartung zur Geltung kommt. Sind Intention, Kompetenzerwartung und Handlungsplanung durchlaufen, wird die Handlung initiiert. In diesem aktionalen Prozess kommt es immer wieder zu Bewertungen und Rückkoppelungen. Da Handlungen nicht nur von Kognitionen mitbestimmt werden, werden im Modell auch objektive und subjektive Situationselemente aufgenommen. Situative Elemente sind beispielsweise die Kosten einer Handlung, soziale Barrieren und Ressourcen.21 Dieses von Schwarzer entwickelte sozialkognitive Modell verbindet verschiedene Modelle des Gesundheitsverhaltens und betont den Prozess18 vgl. Schwarzer S.65ff. vgl. Hornung S.31 20 vgl. Schwarzer S.12f 21 vgl. Allmer S.72ff. 19 20 charakter von Gesundheitsverhalten. Die empirische Erklärungskraft dieses Modells muss aber noch weiter geprüft werden.22 2.2.2.2 Soziologische Theorien Soziologische Erklärungsansätze befassen sich mit sozialem Handeln von Individuen als Reaktion auf andere Menschen und gesellschaftlich vermittelten Phänomenen. In medizinsoziologischen Betrachtungsweisen ist der Begriff des Krankheitsverhaltens verbunden mit der Erkennung von Krankheit und dem angemessen behandeln oder behandeln lassen dieser Krankheit. In den 1960er Jahren wurde das Krankheitsverhalten von David Mechanic in den USA zu einem wissenschaftlichen Konzept zusammengefasst. Nach Mechanic üben folgende Variablen Einfluss auf das Krankheitsverhalten aus: 1. Sichtbarkeit, Erkennbarkeit oder Auffälligkeit der Anzeichen und Symptome 2. Das Ausmaß in dem die Symptome als ernsthaft empfunden werden; wobei das Ausmaß der Ernsthaftigkeit die Einschätzungen von gegenwärtiger und zukünftiger Wahrscheinlichkeit der Gefahr meint 3. Das Ausmaß in dem die Symptome die Familie, Arbeit und andere soziale Aktivitäten stören 4. Die Häufigkeit des Auftretens der Anzeichen und Symptome, deren Fortbestand sowie deren Wiederkehr 5. Die Toleranzschwelle derjenigen, die den Anzeichen und Symptomen ausgesetzt sind und diese bewerten 6. Verfügbare Information, Wissen und kulturelle Annahmen sowie das Verstehen der Bewertung 7. Grundbedürfnisse, die zur Verleugnung führen 8. Bedürfnisse die mit den Anforderungen der Krankheit konkurrieren 9. Die Konkurrenz der möglichen Interpretationen die den Symptomen zugeschrieben werden kann, wenn sie einmal wahrgenommen worden sind 10. Die Verfügbarkeit und Erreichbarkeit von Behandlungsressourcen, sowie psychische und monetäre Kosten für ein Aktivwerden. (Wobei nicht nur die Entfernung, der Zeitaufwand, die finanziellen Kosten und die Anstrengungen, sondern auch die sozialen Kosten einer Stigmatisierung, die soziale Entfernung und das Gefühl einer Erniedrigung bilanziert werden.)23 22 23 vgl. Siegrist 1998b S.119 Mechanic zitiert in Scambler S.40 21 Seit dieser Konzeption durch Mechanic wurden zahlreiche Aspekte des Krankheitsverhaltens erfasst. Sanders versucht mögliche multivariante Zusammenhänge und Wechselbeziehungen zwischen Krankheit und dem Konsultationsverhalten zu erklären. Er meint, dass die Ausprägung der Symptome und das verfügbare Wissen über Krankheit Einfluss nehmen auf eine mögliche Behandlung. Die Wahrscheinlichkeit für das Erkennen und Behandeln lassen einer Krankheit steigt mit der Ausprägungsform der Symptome. Je auffallender sich ein Symptom zeigt, wie beispielsweise starke Kopfschmerzen, desto eher wird es von den Betroffenen als Krankheit interpretiert und somit einer raschen Behandlung unterzogen. 24 Die Symptomqualität spielt aber auch hinsichtlich der gesellschaftlichen Akzeptanz des Symptoms eine gewisse Rolle. In einer deutschen Untersuchung zeigte sich, dass psychogen erkrankte Personen, die gegenüber einer Psychotherapie aufgeschlossen waren, im Gegensatz zu denjenigen Personen, die eine psychotherapeutische Behandlung ablehnten, hochsignifikant häufiger über Kopfschmerzen klagten. Dieses aufgrund gegenseitiger Rollenerwartung von Arzt und Patient akzeptierte Symptom könnte also gewissermaßen eine latent vorhandene positive Psychotherapieakzeptanz signalisieren, und dabei als Kränkungsschutz fungieren.25 Die Symptome bei psychischen Störungen werden oft von den Betroffenen nicht wahrgenommen und als krankheitswertig eingestuft. Im Falle einer psychischen Störung zeigt sich, dass es durchschnittlich etwa sechs bis sieben Jahre dauert bis ein Patient mit einer psychischen Störung bei einem dafür ausgebildeten Fachmann Hilfe sucht. Nur 5% der Befragten in einer deutschen Studie wandten sich innerhalb von drei Jahren von sich aus an einen Psychiater, Neurologen oder Psychologen.26 In einer amerikanischen Umfrage zeigte sich, dass zwei Drittel derer die als hoch depressiv einzustufen waren, verneinten, dass sie sich deprimiert fühlten.27 Einer von vielen Gründen für ein derart störungsinadäquates Inanspruchnahmeverhalten ist die fehlende Informiertheit der Patienten über psychische Erkrankungen und deren Symptome.28 Howard meint, dass der Weg von Vorhandensein bis zur Inanspruchnahme einer psychiatrischen oder psychologischen Therapie als ein Pro24 vgl. Scambler S.40ff vgl. Franz S.452 26 vgl. Grawe S.12 27 vgl. Howard et al. S.698 28 vgl. Franz S.450 25 22 zess verstanden werden kann, der sich auf zwei überschneidende personenzentrierte Prozesse bezieht. Zum einen ist es die Erkenntnis der betroffenen Person, dass eine Erkrankung vorliegt und die Entscheidung darüber wie diese Erkrankung behandelt werden kann. Zum anderen sind es interpersonelle Prozesse und externe Verhaltensweisen, mit Hilfe derer Behandlungsbarrieren überwunden und Wege in den professionellen Sektor ausgehandelt werden. Der Prozess des Hilfesuchens besitzt viele Schritte, vom Erkennen des Problems, über die Entscheidung, dass externe Hilfe notwendig ist bis hin zur Kontaktaufnahme mit professionellen Helfern. Zu erkennen, dass eine psychische Störung vorliegt, geschieht weder auf einfache Art und Weise noch automatisch, und stellt somit eine enorme Zugangsbarriere für eine Behandlung dar.29 2.2.2.2.1 Theorie des Hilfesuchens Siegrist verwendet im Zusammenhang mit Krankheitsverhalten den Begriff des Hilfesuchens. Dieser Begriff vermeidet aus seiner Sicht die begriffliche Einengung auf Wahrnehmung und Reaktionen auf Krankheitsanzeichen, und betont die tatsächlichen Handlungsentscheidungen im Prozess der Krankheitsbewältigung. Eine allgemeingültige soziologische Theorie des Hilfesuchens gibt es bis heute nicht. Siegrist hat ein Modell für den unorganisierten Teil des Hilfesuchens im Vorfeld professioneller Versorgung geschaffen, welches diesen Prozess in vier Entscheidungsstufen gliedert. In diesem Modell wird zwischen Selbsthilfe und Fremdhilfe unterschieden. 29 vgl. Howard et al. S.698 23 Symptomwahrnehmung Verleugnung, Minimalisierung, Bagatellisierung und ähnliches oder Selbstmedikation (selbstinitiiert) Mitteilung an andere (Konsensbildung, sozialer Druck) (selbstinitiiert) Zuweisung zu Laiensystem Zuweisung zu einem professionellen Zuweisungssystem 30 Am Beginn des Prozesses des Hilfesuchens steht die Bewertung und Beurteilung der Symptomqualität. Die Symptomwahrnehmung und –interpretation, sowie die Einleitung des Prozesses des Hilfesuchens beruht dabei auf den von Mechanic beschriebenen Variablen. Unter den weiter oben genannten, das Hilfesuchen bestimmenden Bedingungen werden jedoch Handlungsentscheidungen nur dann getroffen, wenn psychische Prozesse der Angstabwehr, speziell der Verleugnung, der Minimalisierung und Bagatellisierung von Beschwerden nicht aktiviert werden.31 Gründe für die Verleugnung einer psychischen Störung könnten beispielsweise auf einer somatisierten Sichtweise von Krankheit beruhen. Die Symptome psychischer Erkrankungen werden oft erst wahrgenommen, wenn sie sich körperlich manifestieren. Eine somatisch manifestierte psychische Erkrankung wird oft auch von Seiten des Arztes nicht erkannt, weshalb psychische Probleme oft nur somatisch behandelt werden. Beide – Arzt und Patient – akzeptieren eine physische Diagnose und dementsprechende Behandlung.32 30 vgl. Siegrist 1995 S.204 vgl. Siegrist 1995 S.204 32 vgl. Ollert S.94 31 24 Das Ausmaß der Symptomaufmerksamkeit variiert nach einer Reihe von soziologischen und psychologischen Gegebenheiten. In amerikanischen und deutschen Studien konnte gezeigt werden, dass das Zusammentreffen von ungünstigen, in der schichtspezifischen Sozialisation erworbenen Handlungsorientierungen mit fehlender Symptomaufmerksamkeit bei Angehörigen sozialer Unterschichten signifikant häufiger anzutreffen war als bei Mittelschichtangehörigen.33 Der Schritt des Betroffenen zur Mitteilung einer Krankheitserfahrung an signifikant andere ist von Bedeutung, weil unter Umständen eine private Erfahrung zu einem sozialen Tatbestand wird, und sozialer Druck ausgeübt werden kann. Dadurch kann die Suche nach Hilfe beschleunigt oder ausgedehnt werden. Bei manchen Anzeichen psychischer Störungen ist es nicht der Betroffene selbst, der zuerst die Symptome wahrnimmt, sondern andere, welche eine primäre Abweichung definieren. Dies ist überall dort der Fall, wo kognitive Desorientierung und Beeinträchtigung von Selbstbeurteilung und Selbstwahrnehmung zu dem Störungsbild dazugehören. Vor allem Familie und enge Vertraute spielen bei diesem fremdinitiierten Hilfesuchen eine wichtige Rolle.34 Hinsichtlich der Mitteilung von Krankheitserfahrungen unterscheiden sich Frauen und Männer deutlich in ihrer Bereitschaft über Beschwerden Auskunft zu geben. Frauen reden mit anderen eher über körperliche und psychosomatische Symptome - sowohl mit Mitgliedern des informellen Netzwerkes als auch mit Ärzten und Ärztinnen. Die geringere Bereitschaft über Beschwerden zu sprechen und ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, wird mit der Unvereinbarkeit von Krankenrolle und männlichem Selbstbild erklärt. Diese Geschlechterdifferenz wird auch bei Studien zur psychosozialen Hilfe deutlich. 35 Selbst- oder fremdinitiiertes Hilfesuchen kann außerhalb der Familie im Laiensystem verhaftet bleiben, und dort zum Problemlösen führen. Gewährte Unterstützung im Erkrankungsfall breitet sich häufig entlang sozialer Netzwerke aus, und je nach Beschaffenheit dieser Netzwerke werden professionelle Anbieter als mehr oder weniger naheliegende Adressaten betrachtet. Dieses System von Empfehlungen ist von Normen und Vorstellungen einer gesellschaftlichen Gruppierung bestimmt. Ein Laiensystem kann mehr oder weniger mit dem professionellen Hilfesystem verzahnt sein. 36 Bei einer Umfrage in Oberösterreich zeigte sich, dass Hilfeinstanzen bei Problemen mit psychisch Kranken für Angehörige primär Ärzte und Psy33 vgl. Siegrist 1998b S.117 vgl. Siegrist 1995 S.205 35 Kolip S.511 36 Siegrist 1995 S.205f 34 25 chiater sind. Wenngleich sich die Angebotspalette von extramuralen Diensten in den letzten Jahren beträchtlich erweitert hat, zeigt die tägliche Praxis, dass Ärzte noch immer eine große Vertrauensstellung haben. Vor allem im ländlichen Bereich sind sie nach wie vor die erste Instanz bei psychischen Krisen. Wenngleich der Psychiater ebenfalls ein hohes Vertrauen genießt, so ist seine Position insofern etwas problematisch, da sein Berufsfeld in der Bevölkerung eher diffus wahrgenommen wird, und etwa die Hälfte der Befragten bei einer empirischen Untersuchung nicht in der Lage waren den Beruf des Psychiaters korrekt einzuordnen.37 2.2.2.2.2 Soziale Ungleichheit und gesundheitliche Ungleichheit Mielck hat seine Erkenntnisse zum Zusammenhang von sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit in einem Modell zusammengefasst. Soziale Ungleichheit die nach den Dimensionen Bildung, Macht, Geld, und Prestige festgestellt wird, wirkt sich vor allem auf Unterschiede in den gesundheitlichen Belastungen, den Fähigkeiten zur Bewältigung dieser Belastungen und der Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der gesundheitlichen Versorgung aus, und führt zu unterschiedlichen Ausprägungen im Gesundheits- und Krankheitsverhalten.38 Soziale Ungleichheit Unterschiede in den gesundheitlichen Belastungen Unterschiede in den persönlichen Bewältigungsressourcen Unterschiede im Gesundheits- und Krankheitsverhalten Gesundheitliche Ungleichheit 37 38 Schöny, Rittmannsberger S.169 vgl. Mielck S.173 ff. 26 Unterschiede in der gesundheitlichen Versorgung 39 Zahlreiche empirische Befunde stützen die Annahmen des Modells der gesundheitlichen Ungleichheit gerade auch im Hinblick auf die Inanspruchnahme psychotherapeutischer Behandlung und der unterschiedlichen Betroffenheit von psychischen Störungen. Auffällig ist die höhere Betroffenheit von sozial, kulturell und wirtschaftlich benachteiligten Bevölkerungsgruppen von psychischen und psychosomatischen Krankheiten und depressiven Syndromen. Offenbar spielt die soziale Diskriminierung hierbei eine Rolle, die von Menschen mit geringer sozialer Integration und unterentwickelter Kompetenz nur unter hohem psychischen Aufwand verarbeitet werden kann.40 Untersuchungen in den Vereinigten Staaten zeigten, dass Personen mit hohem Bildungsgrad am wenigsten von psychischen Störungen betroffen sind, dass diese aber gleichzeitig am ehesten professionelle Hilfe im psychiatrischen und psychologischen Bereich in Anspruch nehmen.41 Ollert sieht folgende Filter und Barrieren bei der Inanspruchnahme von Psychotherapie für untere soziale Schichten: • Selektion durch Allgemeinmediziner, die keine Psychotherapie empfehlen, sondern vor allem bei unteren sozialen Schichten eine medikamentöse Behandlung vorschlagen • die geografische Entfernung zum Therapieort und die damit verbundenen Fahrtkosten • Versorgung von Kindern während der Therapieeinheiten und die damit einhergehenden Schwierigkeiten, vor allem für alleinerziehende Mütter • die Unvereinbarkeit von Arbeitszeiten und den Therapiezeiten • Wartezeiten, vor allem bei psychischen Störungen die mit körperlichen Symptomen einhergehen • hohe Dropout- Raten im Vergleich zu sozial höheren Schichten • geringer Informationsstand über Psychotherapie und deren Nutzen • geringe Identifikation der Unterschichtklienten mit Psychotherapeuten die der Mittelschicht zugehörig sind • Kosten für eine Psychotherapie • kulturelle Werte, die ein Problemlösen im Verwandten- oder Freundeskreis verbleiben lassen • Stigmatisierung in Bezug auf psychische Probleme 42 Psychotherapieklienten in Österreich sind insgesamt gebildeter, bekleiden höhere berufliche Positionen und verfügen über ein höheres Einkommen als die Bevölkerung im Allgemeinen. Das Psychotherapieange39 ebenda S.173 Hurrelmann S.31 41 Howard et al. S.697 42 vgl. Ollert S.92ff 40 27 bot ist somit mit sozialen Barrieren behaftet und nicht allen Bevölkerungsgruppen gleich zugänglich, wenngleich es Unterschiede zwischen den Klienten in freien Praxen und der institutionellen Versorgung gibt. Institutionelle Psychotherapie weist im Gegensatz zur Psychotherapie in freien Praxen geringere Zugangsbarrieren für sozial Schwache auf.43 Auch fehlende Informationen über eine psychotherapeutische Behandlung beschränken vor allem in der Unterschicht den Zugang zur Behandlung. Eine Reihe von empirischen Untersuchungen und Forschungsberichten zeigten übereinstimmend, dass Klienten aus Unterschicht, vor allem Arbeiter, in den seltensten Fällen Informationen über Psychotherapie hatten. 44 „Wenn untere soziale Schichten psychisch erkranken und dann zu einem Psychotherapeuten, Psychologen, Arzt oder Sozialarbeiter gehen, kommen sie meistens wegen einer Wendung zum Schlechten. Die Krankheiten sind in der Regel chronifiziert, und die äußeren Lebensumstände sind eingeschränkt. Neben den psychischen Belastungen sind diese Personen in einer Vielzahl anderer Lebensbereiche an der vollen Entfaltung ihrer Persönlichkeit und in ihrer Lebensqualität gehindert oder eingeengt.“45 2.2.2.2.3 Strukturmodell gesundheitsrelevanter Lebensstile Das Konzept der Lebensstile geht im Wesentlichen auf Max Webers Ausführungen zum sozialen Handeln zurück. Soziales Handeln als ein wert-, ziel-, sinn- und zweckorientiertes Verhalten bezieht den sozialen Kontext für das Tun oder Nichttun einer Handlung mit ein. Der soziale Kontext gewinnt somit eine zentrale Bedeutung. In der Auseinandersetzung mit der sozialen und dinglichen Umwelt entwickelt das Individuum Handlungsmuster, die einerseits durch die soziale Position des Handelnden geprägt sind, und andererseits diese prägen. Solche Handlungsmuster, die auch typische Einstellungs- Orientierungsund Wertkonstellationen umfassen, können mit dem Begriff der Lebensführung beschrieben werden. Spezifische, mehr oder weniger konsistente und überdauernde Formen der Lebensführung stellen in erster Linie eine Anpassungsreaktion an sozialstrukturell ungleich verteilte Lebenschancen dar. Zugleich können sie als kollektive Gestaltungsleistung verstanden werden. Typische Formen der Lebensführung bilden zusammen mit 43 vgl. Schaffenberger et al. S.137ff. vgl. Ackermann S.166 45 ebenda S. 63 44 28 den ihnen korrespondierenden Lebenschancen die Kategorie Lebensstil. Aus dieser Perspektive zeigen sich Handlungsmuster als Bestandteil der Lebensführung, wobei diese Wechselwirkung zwischen Lebensführung und Lebenschancen ihren Ausdruck unter anderem in distinkten Lebensstilen findet.46 Gesundheitliches Handeln ist somit ein Teil der gesundheitsrelevanten Lebensführung des Individuums, welche ihrerseits wiederum als Teil von kollektiv geprägten gesundheitsrelevanten Lebensstilen verstanden werden kann.47 Solche aus der soziologischen Handlungstheorie abgeleiteten Grundsätze erlauben die Entwicklung mehrdimensionaler Konzepte des gesundheitlichen Lebensstils. Das Strukturmodell gesundheitsrelevanter Lebensstile versucht Gesundheitsverhalten auf kollektiver Ebene unter Einbeziehung soziologischer, psychologischer und biologischer Faktoren zu erfassen. 48 Das Konzept gesundheitsrelevanter Lebensstile basiert auf der Annahme wechselseitiger Abhängigkeiten, innerhalb und zwischen den drei Dimensionen gesundheitsrelevantes Verhalten, gesundheitsbezogene Orientierungen und soziale Ressourcen. Es beschreibt gesundheitsrelevantes Verhalten als Teil eines komplexen adaptiven Systems. Der soziologische Lebensstilansatz bietet eine theoretische Grundlage zur Analyse des Gesundheitsverhaltens als soziales Handeln im Bemühen Gesundheit und Krankheitsprozesse auf einer kollektiven Ebene zu verstehen.49 2.2.2.3 Coping – Verarbeitungsprozesse bei Krankheit In den siebziger Jahren wurde eine Reihe von empirischen Arbeiten durchgeführt, die erstmals die zentrale Bedeutung von sozialen Faktoren wie Copingressourcen bei der Entstehung und Bewältigung von Krankheit demonstriert haben. Historisch lassen sich für die Entwicklung der Forschung zur Krankheitsverarbeitung zwei zentrale Vorläufer erkennen. Die psychoanalytische Abwehrlehre denen die Werke von Anna Freud zugrunde liegen, und die Stress-Forschung, deren paradigmatischer Wechsel von der Seite der Stressoren hin zu Bewertungs- und Verarbeitungsprozessen und somit zur Coping-Forschung führte. Die Coping- Forschung betont stärker die 46 vgl. Abel S. 57f vgl. Siegrist 1995 S.158 48 vgl. Abel S.58 49 ebenda S.58 47 29 prozesshaften Veränderungen im Verarbeitungsgeschehen, die Wechselwirkung von situativen Anforderungen und Persönlichkeitsfaktoren.50 Der Begriff Coping stammt aus der angelsächsischen Forschung und bedeutet „mit einer Sache (erfolgreich) fertig zu werden bzw. etwas zu bewältigen“. In der Coping-Forschung gibt es zahlreiche theoretische Ansätze zur Klassifikation von Coping und Verarbeitung. 2.2.2.3.1 Modelle der Krankheitsbewältigung Bezogen auf die Coping-Theorie definiert Heim Krankheitsverarbeitung in Anlehnung an Lazarus und Folkman als „... das Bemühen, bereits bestehende oder erwartete Belastungen durch die Krankheit innerpsychisch (emotional/kognitiv) oder durch zielgerichtetes Handeln aufzufangen, auszugleichen, zu meistern oder zu verarbeiten.“ 51 Harrer betont, dass die Krankheitsverarbeitung Einfluss auf die Informationssuche und Inanspruchnahme medizinischer Hilfe sowie für die Aufrechterhaltung und Entwicklung von gesundheitsschädigendem Verhalten hat. Direkten Einfluss auf den Krankheitsverlauf haben Stress, Depression und Hilflosigkeit, die auf hormonelle und immunologische Größen Einfluss haben. Er sieht Möglichkeiten zur Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung in einer Unterstützung durch den Arzt, den Psychotherapeuten und Psychiater und in der Selbsthilfe.52 Siegrist beschreibt Coping folgendermaßen: • ein Fehlen vorgegebener Routinelösungen • eine individuelle, problemspezifische Bewertung des Belastungscharakters und der vorhandenen Handlungsressourcen • wiederkehrende, langwierige Aktivität die ein Scheitern nicht ausschließt • eine Neuschöpfung von Handlungsressourcen aufgrund der Belastungen Coping dient somit nicht nur allein der Problemlösung, sondern auch der Regulation von Gefühlen, analog zum Begriff „Trauerarbeit“ von Siegmund Freud. Problemlösen und Gefühlsarbeit erfordert somit den Einsatz mehrerer Mittel: • der Suche nach Information • der Teilhabe an sozialem Handeln 50 vgl. Muthny S.338 Heim S.367 52 Harrer zitiert in Ogris S.25 51 30 • der Aktivierung intrapsychischer Prozesse (kognitive Distanzierung, Neubewertung, Verleugnung, Verdrängung, Ablenkung, Entspannung)53 Heim et al. haben 28 verschiedene empirisch ermittelte Sets von Krankheitsverarbeitungsstrategien in den Berner Bewältigungsformen erfasst, und diese in einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe näher untersucht. Diese Bewältigungsstrategien sind in drei empirisch festgelegte Dimensionen, eine handlungs-, eine kognitions- und eine emotionsbezogene Dimension, unterteilt. Unter handlungsbezogenen Strategien finden sich Bewältigungsformen wie Kompensation, konstruktive Aktivität, Relativieren, sozialer Rückzug, und ähnliches. Kognitionsbezogene Strategien können beispielsweise Ablenken, Problemanalyse, Haltung bewahren und Akzeptieren sein. Selbstbedauern, Optimismus, Resignation, und Schuldzuweisung sind Ausdruck der emotionsbezogenen Bewältigungsformen.54 Eine empirische Auswertung des Datenmaterials einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung ergab drei inhaltlich verschiedene Gruppen von Bewältigungsstrategien: • bedrohungsminderndes Coping • zuwendungsorientiertes Coping • bedrohungsfokussiertes Coping55 Zu der Gruppe des bedrohungsmindernden Coping gehören solche Bewältigungsformen, die über eine Ich-Leistung negative Krankheitsaspekte beeinflussen, die durch die Belastung einer Krankheit entstehen. Diese Gruppe tendiert stark dazu die Krankheit zu akzeptieren, und vertraut auf die eigenen Fähigkeiten im Umgang mit der Krankheit. Dies bedeutet, dass eine Erkrankung integrierend behandelt wird, und eine internale Kontrollüberzeugung besteht. Bei zuwendungsorientiertem Coping handelt es sich um Bewältigungsformen, die im Sinne einer angestrebten Stärkung des labilisierten Selbst durch die Suche nach Zufuhr jeglicher Art charakterisiert sind. Diese Bewältigungsformen tendieren in Richtung Schuld zuweisen und Wut ausleben. Zu bedrohungsfokussiertem Coping zählen jene Bewältigungsformen die sich durch Schuld zuweisen und Wut ausleben auf der einen Seite, und Resignation gegenüber der Erkrankung auf der anderen Seite auszeich- 53 Siegrist 1995 S.218 vgl. Hessl et al. S.312ff 55 ebenda S.315f 54 31 nen. Die Überzeugung der Kontrollierbarkeit der Erkrankung ist deutlich geringer als bei den anderen Verarbeitungsstrategien.56 Vergleicht man die Einschätzung von Ärzten und Patienten zum Auftreten von Krankheitsverarbeitungsmodi und deren Nützlichkeit, so wird ein überraschend diskrepantes Ergebnis deutlich. Während Patienten selbst in erster Linie Vertrauenssetzung in die Ärzte, Compliance-Strategien, Kampfgeist und Selbstermutigung als häufig beschrittene Wege angeben, steht in der Wahrnehmung der Ärzte Nicht-Wahrhaben-Wollen, Dissimilation, Grübeln und übermäßige Gefühlskontrolle im Vordergrund. Vergleicht man die Nützlichkeitseinschätzungen von Krankheitsverarbeitungsstrategien von Ärzten und Patienten ergibt sich ein ähnliches Bild. Ärzte haben eine starke Vorannahme von der Nützlichkeit beziehungsweise Schädlichkeit bestimmter Formen der Krankheitsverarbeitung. Sie verbinden vor allem depressive Verarbeitung mit schlechtem Verarbeitungserfolg. Dieses Ergebnis weist vor allem darauf hin, dass ein Konzept wie Trauerarbeit und psychosomatische Auffassungen zur Adäquanz von Verarbeitungsprozessen noch kaum Eingang in die praktische medizinische Versorgung gefunden haben dürften.57 2.2.2.3.2 Soziale Netzwerke im Copingprozess Die soziale Komponente im Copingprozesses betont, dass bei der Entstehung wie auch bei der Bewältigung von Krankheit soziale Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Im Prozess der Krankheitsbewältigung kommt den sozialen Ressourcen, sprich der Hilfe und Unterstützung die aus den sozialen Netzwerken des Individuums stammen, eine gewichtige Bedeutung zu.58 Soziale Netzwerke können den Prozess der Bewältigung in unterstützender Weise forcieren oder dem Prozess hinderlich sein. Diese Netzwerke wirken nach ihrer Qualität im Bezug auf die Krankheitsentstehung und den Krankheitsverlauf als soziale Unterstützung oder als eine soziale Belastung. Informelle Systeme, wie Familie, Freunde oder Nachbarn, können eine Barriere für die Inanspruchnahme einer Behandlung sein oder das Suchen nach professioneller Hilfe beschleunigen. 59 56 vgl. Hessl et al. S. 315f Muthny S. 334 58 vgl. Waltz S.45 59 vgl. Howard et al. S.702 57 32 Wie in der Ursachenforschung dürfte das Netzwerk auch im Bewältigungsprozess zwei grundlegende Funktionen haben. Einmal benötigt der Mensch ein adäquates soziales Netzwerk, um psychisch gesund und glücklich zu sein. Zweitens sind soziale Ressourcen im Sinne des Bewältigungsmodells notwendig, um mit den Problemen der Krankheit und des Alltags fertig zu werden. Der Informationsbedarf nimmt dabei eine Sonderstellung ein. 60 In Bezug auf psychische Störungen können soziale Netzwerke zur Entstehung einer psychischen Erkrankung beitragen. Sie können aber auch bei der Bewältigung und bei der Inanspruchnahme einer psychotherapeutischen Behandlung wesentlichen Einfluss nehmen. Unterstützende Netzwerke sind der psychischen Gesundheit förderlich und können psychische Probleme in einem gewissen Maße auffangen oder einer Inanspruchnahme von Psychotherapie im Wege stehen. Sie könnten aber auch eine Unterstützung bei der Informationssuche darstellen. 61 In einer deutschen Studie bezüglich der Psychotherapieakzeptanz zeigt sich, dass diejenigen, die gegenüber einer Psychotherapie aufgeschlossen waren, eher weniger soziale Kontakte und Unterstützung aufwiesen, als diejenigen, die eine Psychotherapie ablehnten. Die Ablehner waren insgesamt zufriedener im Hinblick auf ihre sozialen Kontakte und besser integriert. 62 Soziale Isolation beschleunigt demnach die Inanspruchnahme professioneller Hilfe. Dieses zuletzt genannte Ergebnis verdeutlicht die vielfältigen verborgenen Funktionen sozialen Handelns und unterstreicht, dass der Inanspruchnahme professioneller Hilfe auch Motive zugrunde liegen, die über das Krankheitsverhalten im engeren Sinne hinausweisen. Die Inanspruchnahme eines Psychotherapeuten könnte neben der Behandlung der psychischen Störung auch auf ein soziales Kontaktbedürfnis und dem Bedürfnis nach Austausch zurückzuführen sein. 2.3 Psychische Störungen im Versorgungssystem Die Erforschung der Bedingungen unter denen psychisch Kranke versorgt und behandelt werden zeigen, dass bei der Behandlung psychisch Kranker in vielen Ländern Defizite im Vergleich zu somatisch Kranken bestehen. Der Weg in eine fachgerechte Behandlung ist, wie die theoreti 60 vgl. Waltz S.106 Howard et al. S.699 62 vgl. Franz S.452 61 33 schen Ausführungen zum Krankheitsverhalten gezeigt haben, durch ein komplexes Zusammenwirken verschiedener Faktoren bestimmt. Goldenberg und Huxley haben ein Modell vorgeschlagen, dass innerhalb des Versorgungssystems fünf Ebenen unterscheidet, innerhalb derer Filter wirken, die eine adäquate Versorgung von Menschen mit psychischer Störung verhindern können. Diese Ebenen sind: • Gemeinde innerhalb derer keine Versorgung stattfindet • der Allgemeinarzt, der psychische Störungen nicht erkennt • der Allgemeinarzt, der psychische Störungen erkennt • entsprechende Fachärzte bzw. spezialisierte ambulante Versorgung • fachspezifische stationäre Versorgung Diese Versorgungsebenen werden durch vier Filter von einander getrennt: • das Krankheitsverhalten des Betroffenen • die Fähigkeit zur Fallerkennung beim Allgemeinmediziner • die Überweisung in fachspezifische ambulante Versorgung • der Zugang zur stationären Versorgung Huxley und Goldberg betonen die entscheidende Bedeutung der Wirkqualität dieser Filter für die Einleitung einer fachgerechten Behandlung. Selbst wenn ausreichende Behandlungsmöglichkeiten bestehen, so wird ihre Inanspruchnahme durch verschiedene Filter erschwert. 63 Im Falle der Inanspruchnahme von Psychotherapie sind die ersten drei genannten Filterfunktionen von Bedeutung. Das Krankheitsverhalten der betroffenen Person, die Fähigkeit der medizinischen Professionen eine psychische Störung zu erkennen und die Überweisung in eine entsprechende Versorgungseinrichtung, nehmen Einfluss auf eine adäquate Versorgung, wobei Krankheitsverhalten auch im Sinne eines Zustimmens des Betroffenen zu einer empfohlenen Therapie verstanden werden kann. 2.3.1 Die Rolle der Ärzte im Zuweisungsprozess Ärzte für Allgemeinmedizin sind innerhalb der Medizin die häufigste Anlaufstelle für Personen mit psychischer Störung. Die Gründe dafür sind vielfältig. Praktische Ärzte, besonders in ländlichen Regionen, sind einfacher erreichbar als Fachärzte. Außerdem sind psychische Störungen sehr oft mit körperlichen Problemen verbunden, die dem Patienten das Aufsuchen eines praktischen Arztes nahe legen. Ein weiterer Grund für 63 Huxley und Goldberg zitiert in Arlot S.470f 34 die Konsultation von praktischen Ärzten könnte das Motiv der Vermeidung einer Stigmatisierung sein, indem der Kontakt mit der offiziellen Psychiatrie umgangen wird, um Benachteiligungen bei bekannt werden einer psychischen Störung zu vermeiden. Epidemiologischen Studien zu folge leidet jeder dritte Patient, der einen Allgemeinmediziner aufsucht unter einer behandlungsbedürftigen psychischen Krankheit, wobei Angststörungen und Depressionen überwiegen.64 Die Art der Zuweisung deutet oft auch auf die Art der Motivierung hin. Psychotherapeuten und Mediziner sind sich einig, dass die beste Voraussetzung eine eigene Aktivität ist, die sich zum Beispiel darin zeigt, dass die Klienten von sich aus zur Psychotherapie gehen. Eine deutsche Untersuchung zeigte, dass Klienten aus unteren sozialen Schichten immer von anderen geschickt wurden oder überwiesene Klienten waren. Arbeitereltern kommen sehr häufig wegen Erziehungsproblemen mit ihren Kindern, sehr selten kommen sie, um etwas für sich selbst zu bekommen. 65 Unterschichtfamilien verfügen nur selten über die notwendigen Informationen, um sich einen Berater, Psychotherapeuten oder auch nur eine staatliche oder städtische Beratungsstelle zu suchen, die für ihre Probleme zuständig sein könnten. Die Initiative muss also von den Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialbereich ausgehen.66 Die Bedeutung der Ärzte ist auch im Bezug auf die Leistungserbringung bzw. Bezuschussung zur Psychotherapie durch die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse relevant. Um Leistungsansprüche gegenüber der Krankenkasse geltend machen zu können, bedarf es nämlich der Bestätigung durch einen Arzt, dass eine Psychotherapie angebracht ist, wobei die fachärztliche Richtung hierbei keine Rolle spielt. In Untersuchungen wurde festgestellt, dass das Vorliegen einer psychischen Störung von Allgemeinmedizinern nur in rund der Hälfte aller Fälle korrekt diagnostiziert wird. Darüber hinaus erfolgt im allgemeinärztlichen Bereich auch bei eindeutigem Bestehen psychogener Beschwerden nur in Ausnahmefällen die Überweisung in fachpsychotherapeutische Behandlung.67 Die Wahrscheinlichkeit eine psychische Erkrankung als Hauptdiagnose bei einem Allgemeinmediziner gestellt zu bekommen, ist vergleichsweise gering. Als Nebendiagnose oder als irgendein Anliegen steigt die Wahr64 vgl. Katschnig et al. S.21 vgl. Ackermann S.148 66 ebenda S.148 67 vgl. Franz S.449f. 65 35 scheinlichkeit um das dreifache, dass eine psychische Störung erkannt oder diagnostiziert wird. Diese hohe Fehlerquote in der Diagnose wird dadurch erklärt, dass Allgemeinmediziner dazu neigen, bei spontaner, versorgungsnaher Dokumentation Krankheitsphänomene eher dem somatischen Bereich zuzuordnen. Die Dominanz der praktischen Ärzte in der Versorgung von Patienten mit psychischen Problemen wird dadurch verschärft, dass sich vor allem ältere Menschen mit psychischen Problemen an den Hausarzt wenden, während Patienten jüngeren und mittleren Lebensalters eher Neurologen oder Psychiater aufsuchen.68 Die Konfrontation der Ärzteschaft, sowohl praktischer Ärzte als auch Fachärzte aller medizinischen Richtungen, steht einem Mangel an entsprechender Ausbildung gegenüber. Im Wissen um diese Lücken wurden in den letzten Jahren Versuche unternommen Ausbildungsmängel im Studium zu beheben, sowie postpromotionelle Lehrgänge anzubieten im Hinblick auf eine Verbesserung der Kompetenzen im psychosozialen, psychosomatischen und psychotherapeutischen Bereich. Problematisch in Bezug auf die Weiterbildung in Richtung psychotherapeutischer Medizin scheint allerdings zu sein, dass diese Fortbildung mehrheitlich von Fachärzten der Psychiatrie absolviert wird. Nur 40% der Absolventen kommen aus einer nicht-psychiatrischen Fachrichtung. 69 Trotz mangelnder Diagnostik von psychischen Störungen durch Allgemeinmediziner erhielt in Österreich rund ein Fünftel aller Psychotherapieklienten von dieser Berufsgruppe die Empfehlung zur Inanspruchnahme einer Psychotherapie. Neben dem Feststellen einer psychisch bedingten Beeinträchtigung durch niedergelassene Ärzte spielt diese Berufsgruppe auch eine bedeutende Rolle bei der erforderlichen Information über und Motivation zur Therapie.70 Die Bedeutung einer positiven Einstellung des behandelnden Hausarztes gegenüber Psychotherapie für eine positive Psychotherapieakzeptanz des Patienten wurde in mehreren Untersuchungen bestätigt. 71 Auch eine Untersuchung von depressiven Patienten, die nach einer stationären psychiatrischen Behandlung zu ihrem Inanspruchnahmeverhalten von ambulanter Psychotherapie befragt wurden, legt nahe, dass eine tatsächliche Inanspruchnahme nicht nur von Patientenmerkmalen und der Indikationsentscheidung, sondern auch von einer entsprechenden Motivierung durch die Behandler mitbestimmt wird. 72 68 Herrmann S.332f vgl. Katschnig et al. S.22 70 vgl. Schaffenberger et al. S.162 71 Franz S.453 72 Backenstraß et al. S.238 69 36 Die Konsultation eines Psychotherapeuten wird aber eher noch selten empfohlen. Diese Empfehlung hängt neben dem Vorhandensein eines geografisch und kostengünstigen Angebotes von mehreren Voraussetzungen ab, und zwar • von den psychosozialen Kompetenzen und der Einstellung des Arztes zur Psychotherapie • von den zeitlichen Ressourcen zur Information und Motivation der Patienten im Rahmen der ärztlichen Tätigkeit und • letztlich sicher von einer entwickelten Kooperation zwischen den beiden Berufsgruppen.73 2.3.2 Medikation und psychische Störungen Psychopharmakotherapie und Psychotherapie sind zwei Therapieformen, die im psychosozialen und psychiatrischen Bereich verbreitet eingesetzt werden. Die beiden Bereiche können keinesfalls gegeneinander aufgerechnet werden, da einerseits die Indikationen ihres Einsatzes zum Teil sehr unterschiedlich sind, andererseits oft auch ihr kombinierter Einsatz sinnvoll sein kann. Eine Untersuchung zum Status der Psychotherapie des Vereins für Prophylaktische Gesundheitsarbeit zeigt, dass rund zwei Drittel der Klienten die eine Psychotherapie in Anspruch genommen haben, vor der Inanspruchnahme mit Psychopharmaka behandelt wurden.74 In Österreich zeigt der Verbrauch von Psychopharmaka seit Jahren einen klaren Trend der Zunahme, wobei die jährlichen Zuwachsraten selbst steigen. Bei der Verschreibung der einzelnen Substanzgruppen finden sich hinter dem generellen Trend der zunehmenden Steigerungsraten aber auch deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Psychopharmakagruppen. Die größte Gruppe mit der höchsten Zuwachsrate ist dabei die Gruppe der Antidepressiva. Die Zunahme in dieser Gruppe scheint dabei auf die Verschreibung durch Allgemeinmediziner zurückzuführen zu sein.75 Demgegenüber steht die Tatsache, dass im Bereich der niedergelassenen Fachärzte für Psychiatrie in Oberösterreich ein erheblicher Nachholbedarf im Hinblick auf die zur Verfügung stehende Versorgungsdichte besteht. Extrem hohe Patientenzahlen pro Facharzt und daraus resultie73 vgl. Schaffenberger et al. S.162 vgl. Janout S.57 75 vgl. Katschnig et al. S.92ff 74 37 render Zeitdruck führt dazu, dass die niedergelassenen Psychiater sich nur auf die medizinischen Kernaufgaben konzentrieren - und zwar: • die diagnostische Zuordnung und organische Durchuntersuchung • das Erarbeiten eines Behandlungsplans und • die Durchführung einer medikamentösen Behandlung 76 Die Zunahme an Psychopharmakotherapie zeigt sich auch im internationalen Vergleich. In den Vereinigten Staaten hat sich die Anzahl derer die Psychopharmaka verschrieben bekommen haben, innerhalb von 10 Jahren verdoppelt. Der Anteil derer, die sich im Vergleichszeitraum einer psychotherapeutischen Behandlung unterzogen haben, ist dabei nur geringfügig von 3,2% auf 3,6% angestiegen.77 Unterschiedliche Krankheitskonzepte und Behandlungsstrategien, wie der Stellenwert der medikamentösen und/oder einer psychotherapeutischen Behandlung auf Seiten der Behandler als auch Behandelten, sowie zeitliche Ressourcen der Ärzteschaft können - neben der verschiedenen Indikation für eine jeweilige Therapie – Einfluss auf eine therapeutische Entscheidung nehmen. 78 Es ist nicht das verfolgte Ziel dieser Arbeit den Stellenwert dieser beiden Therapiemethoden im Vergleich näher zu beleuchten. Es zeigt sich jedoch ein gewisser Einfluss den die Verschreibung von Psychopharmaka auf die Inanspruchnahme einer psychotherapeutischen Behandlung ausüben kann, wenngleich hierbei nicht vom günstigsten Fall gesprochen werden kann. 2.3.3 Compliance in der Arzt - Patienten Beziehung Auch wenn Ärzte eine psychische Störung erkennen, eine krankheitswertige Diagnose stellen und einer Psychotherapie positiv gegenüberstehen, finden sie oft nicht genug Möglichkeiten zur Information und Motivation der Patienten. Eine Empfehlung zur Inanspruchnahme einer psychotherapeutischen Behandlung durch den Arzt und die tatsächliche motivierte Inanspruchnahme durch den Patienten unterliegt noch einer Reihe von Filtern. Unter Compliance versteht man üblicherweise das Ausmaß des Patientenverhaltens, in den Bereichen der Einnahme von Medikamenten, Be- 76 vgl. Haberfellner S.171 vgl. Olfson et al. S.1916 78 vgl. Haberfellner S.175 77 38 folgung von Diäten und Veränderungen des lich/therapeutische Empfehlungen umzusetzen. Lebensstils ärzt- Im deutschsprachigen Raum wurde der Begriffe der Compliance, der übersetzt etwa soviel wie Therapiebefolgung heißt, oft kritisiert und durch den Begriff der Therapiemotivation (Adherence) ersetzt. Therapiebefolgung verweist gewöhnlich auf das Ausmaß, in dem die Patienten den Instruktionen, Vorschriften und Anweisungen der Therapeuten folgsam nachkommen. Die Kritik lautete, dass der Begriff der Therapiebefolgung den Patienten in einer sehr passiven Rolle sieht, nämlich der gehorsamen Umsetzung der Anweisungen des behandelnden Therapeuten und negative oder vorurteilsbezogene Bewertungen gegenüber dem Patienten beinhaltet. Therapiemotivation betone im Gegensatz dazu ein aktives vom Patienten bewusst eingegangenes Engagement, um ein therapeutisches Resultat zu erzielen.79 Der Bergriff der Compliance wird heute noch überwiegend verwendet, und wurde im Zuge der Kritik in Richtung einer Interaktion zwischen Arzt/Therapeut und Patienten modifiziert. Compliance ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Sie umfasst einen breiten Verhaltensbereich, von der Aufnahme einer Therapie bis hin zu einer kontinuierlichen Aufrechterhaltung.80 In Bezug auf die ärztliche Empfehlung zur Inanspruchnahme psychotherapeutischer Hilfe erwies sich bei einer Untersuchung, dass rund ein Drittel der zugewiesenen Personen das Angebot einer Psychotherapie ablehnten.81 2.3.3.1 Determinanten der Compliance Die Untersuchung zum Ausmaß der Compliance setzt am Zielverhalten an. Die Empfehlung zur Inanspruchnahme von Psychotherapie wird entweder angenommen oder nicht. Compliance stellt jedoch einen komplexen Prozess dar, ausgehend von der Diagnose und der ärztlichen Empfehlung, bis zum Verhalten des Patienten. Als wesentliche Einflussfaktoren auf diesen Prozess wurden folgende Merkmale untersucht: • Patientenmerkmale und seine gesundheitsbezogenen Kognitionen • Behandlungs- /Krankheitsmerkmale • Merkmale der Interaktion 79 vgl. Meichenbaum S.15 vgl. Petermann und Warschburger S.371f 81 vgl. Meichenbaum S.22 80 39 Der Einfluss dieser Faktoren kann aber bei jedem Patienten unterschiedlich stark ausgeprägt sein. 82 2.3.3.2 Patientenmerkmale Gerade die frühere Sichtweise der Compliance als Therapiefolgsamkeit oder –treue hat zur Suche nach Gründen der Non-Compliance beim Patienten geführt. Forschungsergebnisse deuten immer wieder in die Richtung, dass fehlende Compliance in allen sozialen Schichten und Bildungsgruppen zu beobachten ist. Als einflussreich im Prozess der Compliance werden die gesundheitsbezogenen Kognitionen und Wahrnehmungen der Patienten eingestuft.83 Meichenbaum meint, dass Patientenmerkmale nur bedingt zu Vorhersage der Compliance geeignet sind. Sie liefern nur in Kombination mit Behandlungs- und Umweltmerkmalen aussichtreiche Vorhersagebedingungen. Patientenmerkmale die auf die Compliance Einfluss nehmen können sind: • Typ und Schwere der psychiatrischen Störung • unzureichende Wahrnehmungsfähigkeit • fehlende Krankheitseinsicht • soziokulturelle Krankheitstheorien • subjektive Krankheitstheorien • soziale Situation des Patienten • Erwartung und Einstellung gegenüber der Behandlung • starke Stressoren wie Armut und Arbeitslosigkeit • Mangel an Ressourcen wie Transportmittel, Geld oder Zeit 84 Trotz der Schwierigkeit die Compliance aufgrund von Patientenmerkmalen ausreichend vorherzusagen, können die Zufriedenheit und subjektive Krankheitstheorien als Anhaltspunkt dienen. Wobei die Zufriedenheit im Verlauf der Therapie eine große Bedeutung zugeschrieben wird, während subjektive Konzepte bereits im Vorfeld einer Behandlung oder Therapie als auch im Gesundheits- und Krankheitsverhalten eine wichtige Rolle spielen.85 82 vgl. Petermann und Warschburger S.375 ebenda S.375 84 vgl. Meichenbaum S.36 85 ebenda S.36 83 40 Auch die Ziele, die ein Patient anstrebt, gelten als ein wichtiger motivierender Faktor für die Mitarbeit in einer Behandlung. Faller legt in einer empirischen Untersuchung nahe, dass die Therapieziele von Psychotherapieklienten in einem generellen Zusammenhang stehen, ob sich eine Person für oder gegen eine Psychotherapie entscheidet.86 Der Einfluss von Laienätiologien, die Einstellung der Nicht-Fachleute zu Gesundheit und Krankheit und deren verschiedenste Ausprägungen, können neben einer Reihe von anderen sozialen Faktoren Einfluss auf das Verhalten von Menschen im Krankheitsfall nehmen. Einen wichtigen Baustein zu einer umfassenden Theorie von Gesundheits- und Krankheitsverhalten bilden deshalb Laienannahmen über Gesundheit und Krankheit. Subjektive Krankheitskonzepte sind Systeme krankheitsbezogener Vorstellungen, Überzeugungen und Bewertungen, die sich der Patient bezüglich der Entstehung und der Behandlungsmöglichkeiten seiner Problematik macht. Jüngere Studien zeigen, dass die theoretischen Konstrukte von Laien das Krankheitsverhalten und infolge die Compliance ganz entscheidend mitbestimmen. Insbesondere Kausalattributierungen und Kontrollüberzeugungen werden für den Prozess der Bewältigung als bedeutsam angesehen.87 Patienten haben Konzepte über ihre Krankheit und den potentiellen Effekt der vorgeschlagenen therapeutischen Maßnahme. Manchmal basieren diese Patientenkonzepte auf falschen Vorstellungen, unzureichenden Informationen und negativen Verzerrungen. Zusätzlich können noch Angst, Schuldgefühle, Fatalismus, Scham und Willensschwäche zur fehlenden Therapiemotivation beitragen. 88 Bezogen auf eine psychotherapeutische Behandlung könnte fehlendes Wissen oder falsche Vorstellung über psychische Erkrankungen und Psychotherapie als eine Behandlungsmethode der adäquaten Inanspruchnahme einer derartigen Therapie im Wege stehen. Scham und die Angst vor der Stigmatisierung könnten demnach nicht nur dazu führen, das Symptome verleugnet oder bagatellisiert werden, sondern auch dazu, dass eine psychotherapeutische Behandlung von den Betroffenen aus diesen Gründen nicht in Anspruch genommen wird. 86 vgl. Faller S.299 Hessel et al. S.312 88 vgl. Meichenbaum S.36 87 41 2.3.3.3 Behandlungsvariablen und Krankheitsvariablen Behandlungsmerkmale können neben den erwähnten Patientenmerkmalen und in Kombination mit diesen auch eine Rolle bei der Therapiebefolgung spielen. Was würde ein motivierter Patient nützen, wenn eine Behandlungsmethode nur schwer erreichbar oder finanziell nicht erschwinglich sein würde. Kasl führt aus, dass Behandlungsmerkmale wie Komplexität, Dauer, Nebenwirkungen und ähnliches oft eher etwas über die Qualität der Therapiemotivation aussagen als die Patientenmerkmale.89 Behandlungsmerkmale die auf die Compliance Einfluss nehmen können sind: • • • • • lange Wartezeiten Art der Behandlungsempfehlung lange Dauer der Behandlung Kosten Unzugänglichkeit (Ort der Therapie, schlechte Zugangswege)90 Wartezeiten könnten insofern für untere soziale Schichten problematisch sein, da diese erst dann professionelle Hilfe suchen, wenn die Beschwerden stark angewachsen sind, und die Notwendigkeit sofortiger Hilfe naheliegend ist. Untersuchungen haben aber gezeigt, dass auch bei Wartezeiten eine gute und erfolgreiche Beratung und Therapie stattfinden kann. Die Länge der Wartezeit hatte bei einer deutschen Studie keinen Einfluss auf den Erfolg der Beratung.91 Letztendlich können auch die Symptome der Erkrankung, wie beispielsweise Verwirrung, Wahrnehmungs- oder Verhaltensstörungen negative Auswirkungen auf die Therapiemotivation haben. 2.4 Stigmatisierung Der Begriff „Stigma“ wurde von den Griechen geschaffen als Verweis auf körperliche Zeichen, die dazu bestimmt waren, etwas Ungewöhnliches oder Schlechtes über den moralischen Zustand des Zeichenträgers auszusagen. In christlichen Zeiten wurde der Begriff auf körperliche Zeichen göttlicher Gnade bezogen. Heutzutage wird der Terminus weitgehend in 89 Kasl zitiert in Meichenbaum S.43 vgl. Meichenbaum S.35 91 vgl. Ackermann S.74 90 42 einer Annäherung an seinen ursprünglichen wörtlichen Sinn gebraucht. Wobei sich diese Annäherung eher auf die Unehre als auf deren körperliche Erscheinungsweise bezieht. Eine sehr bedeutende Rolle zum Thema Stigmatisierung kommt E. Goffman zu, der sich in seinem Buch „Stigma“ mit dieser Thematik aus soziologischer Sicht auseinandersetzt. 2.4.1 Goffmans Stigmabegriff 92 Der Terminus „Stigma“ wird laut Goffman in bezug auf eine Eigenschaft verwendet, die zutiefst diskreditierend ist. Er spricht von drei verschiedenen Stigmatypen: den physischen Deformationen, den individuellen Charakterfehlern wie beispielsweise Geistesverwirrung oder Gefängnishaft, und phylogenetischen Stigmata, wozu Rasse, Nation oder Religion zählen. Nicht zuletzt sind in dieser Hinsicht auch Personen betroffen, die nicht nach den Normen leben, die für die jeweilige Umwelt als üblich oder empfehlenswert gelten wie beispielsweise Leute, die nicht verheiratet sind oder keine Kinder haben, arbeitslos sind oder ähnliches. Die Art in der Normale auf Stigmatisierte reagieren, macht aus ihnen das, was sie für sie sind. Die Vielzahl von Diskriminierungen welche durch die sogenannten Normalen ausgeübt werden, verringern die Lebenschancen der Stigmatisierten und diskreditieren diese. Der Charakter, den die Normalen den Stigmatisierten zuschreiben, erzeugt eine virtuelle soziale Identität dieser Personen. Ihre tatsächlich bewiesenen Eigenschaften werden von Goffman als ihre aktuale soziale Identität bezeichnet. Er unterscheidet auch zwischen diskreditierten Personen, über deren Stigma die Umwelt bereits Bescheid weiß, und den diskreditierbaren Personen, über die noch keine diskreditierenden Informationen an die Umwelt gedrungen sind. 2.4.2 Stigmatisierung psychisch Kranker Einstellungen und Verhalten der Bevölkerung gegenüber psychisch Kranken sind durch Vorurteile und unzureichendes Wissen belastet. Psychisch Kranke müssen sich nicht nur mit den Symptomen und Folgen ihrer Erkrankung auseinandersetzen, hinzu kommt die Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Stigma und der Diskriminierung aufgrund der Erkrankung. 92 vgl. Goffman S.9ff 43 Das Stigma der psychischen Erkrankung ist ein soziokulturell tief verwurzeltes Phänomen. Alles was im Umfeld von psychischem Kranksein anzutreffen ist – Patientinnen und Patienten, Angehörige, Behandler, Institutionen und Behandlungsmethoden - ist davon betroffen. Die mit der Stigmatisierung vergesellschaftete Diskriminierung führt in Rückkoppelungsprozessen mit der Erkrankung bei psychisch Kranken zu einem Teufelskreislauf, und zu einer von der ursprünglichen Erkrankung losgelösten „zweiten Erkrankung“ wodurch die Lebensqualität und der Krankheitsverlauf negativ beeinflusst werden kann. 93 Häufige negative Einstellungen gegenüber psychisch Kranken sind: • Sie seinen unberechenbar und gefährlich. • Psychische Erkrankungen sind unheilbar. • Alles was diese Menschen sagen sei nicht ernst zu nehmen. • Sie seinen faul und arbeitsunwillig.94 Untersuchungen haben gezeigt, dass der Informationstand in der Bevölkerung über psychische Störungen und psychisch Kranke sehr gering ist, und es großer Anstrengungen bedarf, diesbezügliche Informationen in der Bevölkerung zu verankern. Um eine Stigmatisierung durch ein falsches Bild zu vermeiden und die Zugänglichkeit zu einer Behandlung zu erleichtern, bedarf es einer Verbesserung dieses öffentlichen Bildes.95 Eine amerikanische Studie zeigte, dass das Stigma in Bezug auf psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung immer noch eine große Barriere für das Suchen von professioneller Hilfe darstellt. Es zeigte sich, dass Personen, obwohl sie erkannten, dass sie von einer derartigen Hilfe profitiert hätten, keine professionelle Hilfe suchten. Die Angst was andere über sie denken würden, war dabei eine oft genannte Barriere. 96 2.5 Ausgangssituation und Forschungsdesign der Untersuchung Mit der 50. ASVG-Novellierung im Jahre 1992 wurde Psychotherapie in den Pflichtkatalog der sozialen Krankenversicherungen aufgenommen. Obwohl seit diesem Zeitpunkt das Angebot im Bereich der kostenlosen Psychotherapie stetig ausgebaut wurde, gibt es keine empirisch fundierte und veröffentlichte Untersuchung, inwieweit das Angebot der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse den psychotherapiebedürftigen Personen auch tatsächlich zugänglich ist. Lange Zeit war die Inanspruchnahme von Psychotherapie durch die hohen Kosten der Behandlung, das erfor93 vgl. De Col et al. S.203 vgl. Schöny, Schleier S.234 95 vgl. Schöny, Rittmannsberger S.165 96 vgl. Howard et al. S.699 94 44 derliche Wissen über das Angebot und nicht zuletzt die häufig geforderte verbale Ausdrucksfähigkeit eher oberen sozialen Schichten vorbehalten. Durch die zunehmende Bedeutung der psychotherapeutischen Versorgung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung stellt sich die Frage, ob dieses Angebot die Zugänglichkeit erhöht. Auf Grundlage der angeführten theoretischen Konzepte zum Gesundheits- und Krankheitsverhalten, sowie Experteninterviews mit Psychotherapeuten - die eine Therapie im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung anbieten - wurde zunächst ein Modell aufgestellt, auf Basis dessen eine empirische Primärerhebung durchgeführt wurde. Ziel der quantitativen Erhebung in Oberösterreich war die Ermittlung personaler und sozialer Faktoren einer Inanspruchnahme, die Rolle der Ärzte im Prozess des Hilfesuchens, sowie die Bewertung der durchgeführten Psychotherapie. 2.5.1 Modell der Untersuchung Das Modell gliedert sich im Wesentlichen in vier Abschnitte. Ausgangspunkt bilden soziodemografische Daten der betroffenen Personen und deren bisherige Inanspruchnahmen. Der zweite Abschnitt des Modells beinhaltet, neben der subjektiven Wahrnehmung der Einschränkung durch die psychische Störung und etwaiger körperlicher Symptome, die Rolle des professionellen Systems – im Speziellen der praktischen Ärzte - sowie den Einfluss des Laiensystems auf Entscheidungen im Prozess des Hilfesuchens. Erfolgt eine ärztliche Zuweisung zur Psychotherapie, so kann die betroffene Person in Abschnitt drei noch eine Reihe von Barrieren oder begünstigenden Faktoren erfahren, die einer tatsächlichen Inanspruchnahme im Wege stehen oder förderlich sind. Wesentlich hierbei sind Erwartungen der betroffenen Person an eine Psychotherapie, die sozialen, zeitlichen und finanziellen Kosten, sowie das zur Verfügung stehende Angebot. Der letzte Abschnitt des Modells setzt sich mit der tatsächlichen Inanspruchnahme und der Bewertung der Therapie durch die Klienten auseinander. 45 Soziodemografische Ausgangslage und bisherige Inanspruchnahmen Symptome und Hilfesuchen Bewertung und Einschätzung des professionellen Systems Symptome Bedeutung des Laiensystems Zuweisung Zuweisung Barrieren und Hilfen vor der Inanspruchnahme Erwartung an Psychotherapie Angebot Kosten der Therapie Inanspruchnahme und Bewertung der Therapie Das Modell impliziert, dass der Weg des Hilfesuchens im Bezugsrahmen der gesetzlichen Krankenversicherung großteils durch die medizinischen Professionen mitbestimmt wird. Dieser Annahme liegt zugrunde, dass die Sachleistungserbringung oder Bezuschussung durch die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse einer ärztlichen Zuweisung bedarf, und in einem gewissen Maße der Regulation durch die Ärzteschaft unterliegt. Dieser bewusst eingebaute Regulationsmechanismus begründet sich großteils darauf, dass Ärzte psychische Störungen – im Gegensatz zum Laien - erkennen müssten, und eine adäquate Therapie weiterempfehlen sollten. Das Modell schließt ein selbstinitiiertes und direktes Aufsuchen eines/r Psychotherapeuten/in nicht aus, verweist aber auf die Notwendigkeit einer ärztlichen Zuweisung für die Sachleistungserbringung oder Bezuschussung durch die Gebietskrankenkasse. 46 Die Fragen und Variablen des Fragebogens lassen sich den einzelnen Abschnitten des Modells wie folgt zuordnen. Die Angaben in der Klammer entsprechen dabei der Fragenummerierung im Fragebogen.97 Ausgangslage der Klienten • Geschlecht (a) • Alter (b) • Familienstand (c) • höchste abgeschlossene Bildung (d) • Lebensstatus (erwerbstätig, arbeitslos, etc.) (e) • berufliche Position (f) • Antrag auf Berufsunfähigkeitspension (g) • Einkommen (h) • Wohnbezirk (i) • bisherige Inanspruchnahmen (3) Symptome und Hilfesuchen ¾ Bewertung und Einschätzung des professionellen Systems: • Arztvertrauen (22) • Information über Therapie und Therapiefinanzierung (1,2) • Hilfeinstanz im professionellen System (6) • Unterstützung durch den praktischen Arzt (22) • Medikation (20) • Unterstützung bei der Therapeutensuche (24) ¾ Symptome: • körperliche Symptome (21) • Ausmaß der Behinderung im Alltag (19) ¾ Bedeutung des Laiensystems: • Information über Therapie und Therapiefinanzierung (1,2) • Unterstützung bei der Therapeutensuche (24) • Empfehlung zur Inanspruchnahme (5) • Therapieerfahrung des sozialen Umfeldes (25) Zuweisung • Zuweiser zur Psychotherapie (7) 97 siehe Anhang 47 Barrieren und Hilfen vor der Inanspruchnahme ¾ Erwartung an Psychotherapie: • Leidensdruck, Erwartungen an und Vorstellung über eine Psychotherapie (18) ¾ Angebot: • Erreichbarkeit (11,12) • Wartezeiten (9,10) • Finden eines Psychotherapeuten (23) ¾ Kosten der Therapie: • zeitliche Kosten (14, 15, 16, 17) • finanzielle Kosten (4,13) • soziale Kosten (26) Inanspruchnahme und Bewertung der Therapie • • • • • • 48 Organisationsform (8) Anzahl der Therapieeinheiten (28) Wiederaufsuchen (27) Weiterempfehlung (29) Zufriedenheit mit dem Therapeuten (30) Erfolg der Psychotherapie (31) 2.5.2 Konzeption der Barrieren Die Inanspruchnahme einer psychotherapeutischen Behandlung ist neben selbst- und fremdinitiierten Entscheidungen im Prozess des Hilfesuchens, deren Ziel die Mitteilung, Abklärung und gegebenenfalls Behandlung von Leidenserfahrungen darstellt, auch von einer wirksamen, bedarfsgerechten und finanziell tragbaren Abstimmung von Angebot und Nachfrage abhängig. Dies gilt ganz besonders in einem System gesundheitlicher Versorgung, welches weitgehend den Versicherten die Initiative zur Inanspruchnahme überlässt. Hindernisse auf der Anbieterseite wie auch auf der Nachfrageseite erschweren den Zugang zu einer Behandlung und wirken demnach als Barrieren. Wenngleich die wahren Barrieren für eine fehlende Inanspruchnahme bei faktischen Bedarf aus methodischen Gründen in dieser Untersuchung nicht festgestellt werden konnten, so geben die Erfahrungen der befragten KlientInnen – sprich TherapienutzerInnen – Aufschluss darüber welcher Anstrengungen es bedurfte und welche Barrieren es zu überwinden gab, bis eine Psychotherapie in Anspruch genommen werden konnte, und liefern somit wesentliche Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Versorgung. Barrieren die einer Nutzung im Wege stehen können beziehen sich in dieser Untersuchung neben fremdinitiierten Hilfesuchverhalten auch auf die Verfügbarkeit, die Erreichbarkeit sowie die Kosten einer Behandlung. Die Einflussnahme von Dritten beim Prozess des Hilfesuchen kann insofern eine Barriere für die Inanspruchnahme einer Therapie darstellen, wenn die Symptome durch das soziale Umfeld verharmlost oder bagatellisiert werden, oder von medizinischen Fachleuten lange Zeit falsch oder ungenügend behandelt werden. Der Leidensweg der direkt Betroffenen kann durch das Unverständnis der sozialen Umwelt, oder durch eine lange medizinische Behandlung der Symptome teilweise unnötig verlängert werden, und wird somit zur einer Barriere für eine adäquate Therapie. Die Wartezeiten von der Anmeldung zur Therapie bis zur ersten Therapiesitzung sowie das subjektiv empfundene Problem der Wartezeit stellen einen Indikator für die Verfügbarkeit einer Behandlung dar. Eine lange Wartezeit, sowie eine Bewertung der Wartezeit durch die Betroffenen als problematisch, liefern Hinweise auf Barrieren auf der Angebotseite. Die objektive Entfernung zwischen Wohnort und dem Ort der Therapie, sowie das individuell unterschiedliche erlebte Problem diese Entfernung zu überwinden, geben Auskunft darüber wie es mit dem Angebot im Hinblick auf die geografische Erreichbarkeit bestellt ist. Nicht zu vernachlässigen in Bezug auf mögliche Barrieren sind die Kosten einer Behandlung, die den Klienten entstehen können. Der Begriff der Kosten ist hierbei allerdings weiter gefasst als im allgemein gebräuchlichen Sinne. Unter den Kosten einer Behandlung sind neben den finanziellen Kosten auch die zeitlichen und sozialen Kosten zusammengefasst. Das finanzielle Kos- 49 tenhindernis bleibt hierbei ein hypothetisches, da bei der Inanspruchnahme einer Therapie, sofern die Klienten nicht eine freie Praxis aufsuchen, im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung keinerlei finanzielle Kosten entstehen. Die zeitlichen Kosten einer Therapie beziehen sich auf die zeitliche Vereinbarkeit der Therapie mit der Erwerbstätigkeit, der Kinderbetreuung und sonstigen Verpflichtungen, sowie der Bereitschaft des Therapeuten auf die Terminwünsche der Klienten einzugehen. Die zeitlichen Kosten können zur Barriere werden, wenn eine Behandlung aus zeitlichen Gründen nur schwer, oder gar nicht möglich ist. Im Bereich der Behandlung von psychischen Erkrankungen oder Beschwerden besitzen die sozialen Kosten einen besonderen Stellenwert, und können unter Umständen zu einem großen Hindernis für eine adäquate Inanspruchnahme einer Behandlung werden. Unter den sozialen Kosten werden hierbei die Ängste vor einer sozialen Stigmatisierung und deren Folgen verstanden. Der Kostenfaktor der dabei den Ausschlag gibt, sind nicht primär die tatsächlich erwarteten Folgen, sondern vielmehr die Angst gesellschaftliche diskreditierbar zu werden durch den Umstand, dass eine psychotherapeutische Behandlung in Anspruch genommen wurde. Die angeführten Barrieren sowohl auf der Angebotsseite als auch auf der Nachfrageseite können jede für sich, oder aber auch in ihrem Zusammenspiel die Inanspruchnahme eine Psychotherapie erheblich erschweren und einer gezielten gesundheitlichen Versorgung im Wege stehen. 2.5.3 Forschungshypothesen der Untersuchung Hypothese 1: Im Idealfall sollten psychotherapiebedürftige Personen in erreichbarer Nähe freie Kapazitäten an psychotherapeutischer Behandlung bei entsprechend qualifizierten Psychotherapeuten vorfinden und eine Psychotherapie ohne soziale Barrieren in Anspruch nehmen können. Ein bedarfgerechtes Angebot sollte im Sinne einer gerechten Versorgung für alle Versicherten in gleicher Weise zugänglich sein. Die Anzahl und das Ausmaß von Barrieren die einer Inanspruchnahme im Wege stehen oder diese behindern, sollten möglichst gering sein oder abgebaut werden. Das Ziel einer optimierten Versorgung ist ein barrierefreier Zugang zu den angebotenen Leistungen unabhängig vom sozialen Status. Wenngleich die Erreichung dieses Ziels nicht immer gelingt, so sollten zumindest die vorhandenen Barrieren im Sinne einer gerechten Versorgung, unabhängig von der sozialen Position der Versicherten, wahrgenommen werden. Mit den Begriffen „soziale Position“ und „bessere bzw. schlechtere Lage“ werden zwei wesentliche Merkmale soziologischer Analyse von Un- 50 gleichheit herausgestellt: erstens das Merkmal der Kategorisierung oder Typisierung von Personen durch deren Zuordnung zu bestimmten sozialen Orten, zweitens das Merkmal der gesellschaftlichen Bewertung ungleicher Lebenslagen, das heißt der vertikalen Differenzierung einer Gesellschaft. Mit dem Terminus „sozialer Status“ verbindet die Soziologie diese beiden grundlegenden Konstruktionsprinzipien der Gesellschaft, die Tatsache nämlich, dass Personen einen bestimmten, gesellschaftlich definierten Ort besetzen oder einnehmen und über diese Besetzung an den zentralen gesellschaftlichen Verteilungsprozess teilnehmen. Aufgrund ihrer zentralen Stellung im gesellschaftlichen Leben beeinflussen soziale Ungleichheiten wesentlich die Chancen und Risiken der Lebensgestaltung des einzelnen. Auch Gesundheit und Krankheit sind Phänomene, die auf vielfältige Weise durch soziale Ungleichheit bestimmt werden98 Als Statusmerkmale gelten hierbei: • Geschlecht • Alter • Bildung • Einkommen • Lebensstatus • berufliche Position • Wohnbezirk • Antragstellung auf Berufsunfähigkeitspension Die Hypothese, die sich daraus ableiten lässt, lautet: Die Barrieren, die Klienten bei der Inanspruchnahme einer Psychotherapie im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung behindern, wirken unabhängig vom sozialen Status der Versicherten. Hypothese 2: Das Angebot der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse lässt den Psychotherapieklienten, in Anlehnung an das Wahlarztmodell, die Wahl sich zwischen einer kostenlosen und einer bezuschussten Therapieform zu entscheiden. Wenngleich der soziale und wirtschaftliche Status von Klienten als ein wichtiger Faktor im Rahmen der Entscheidung für eine bestimmte Form der Leistungserbringung angesehen werden kann, sollten dennoch keine sozialen Ungleichheiten in Bezug auf die wahrgenommenen Barrieren und die Zufriedenheit mit dem Angebot vorhanden sein. Daraus resultiert folgende Hypothese: Klienten, die eine bezuschusste Therapie in einer freien Praxis in Anspruch genommen haben, unterscheiden sich in Bezug auf die wahrge98 Siegrist 1995 S. 56f 51 nommenen Barrieren und die Zufriedenheit mit dem Angebot nicht von Klienten, die eine kostenlose und institutionelle Form der Psychotherapie aufgesucht haben. 2.5.4 Durchführung der Erhebung und Beschreibung der Stichprobe Für die quantitative Erhebung wurde jene Personengruppe ausgewählt, bei der innerhalb des ersten Halbjahres 2003 eine psychotherapeutische Behandlung als Sachleistung abgerechnet wurde. In der Stichprobe wurden somit jene Personen erfasst, die eine Psychotherapie bei einem Institut der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse, über die Vereine PGA und OÖLP oder bei einem Vertragsarzt in Anspruch genommen haben. Im Bereich der vertragsärztlichen Inanspruchnahme wurden allerdings nur jene Psychotherapieklienten erfasst, die ein Mindestsausmaß von fünf Therapieeinheiten aufwiesen. Diese Untergrenze wurde deshalb festgesetzt, da sich bei einer ersten Stichprobendurchsicht herausstellte, dass bei etwa 50% dieser Psychotherapienutzer die Versicherungsleistung in einer einzigen Therapieeinheit bestand. Da nicht davon auszugehen ist, dass es sich hierbei um eine psychotherapeutische Maßnahme handelte, sondern vielmehr um ein beratendes Gespräch, wurde diese Gruppe von der Erhebung ausgeschlossen. Ingesamt umfasste die Stichprobe eine Anzahl von 1953 Personen. Nach Abzug der Personen mit unvollständigen Adressen (230), und der aufgrund von Adressänderungen nicht zustellbaren Fragebögen (309) erhielten 1414 Personen tatsächlich einen Fragenbogen. Der sechsseitige Fragebogen99 wurde (zur Wahrung des Datenschutzes) von der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse im März 2004 versendet, und die Befragten wurden gebeten den ausgefüllten Fragebogen bis zum 12. April 2004 zurück zu senden. Bis einschließlich 12. Mai 2004 gingen insgesamt 546 Fragebögen ein, was einer Rücklaufquote von rund 39% entspricht. In Anbetracht der Thematik der Untersuchung, die sich mit einem besonders sensiblen und teilweise stigmabehafteten Thema befasst, stellte dies eine sehr hohe zufriedenstellende Quote dar. Eine abschließende wesentliche Information bezieht sich auf die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse dieser empirischen Untersuchung. Zur Prüfung der Repräsentativität wurden jene Klienten, die den Fragebogen beantwortet haben, mit den Klienten aus der Stichprobe verglichen. Vergleichsmerkmale hierbei waren: Geschlecht, Alter und Wohnbezirk. Die statistische Überprüfung der Anteilswerte nach erwarteter und beobachteter Verteilung ergab bei allen drei Vergleichsmerkmalen, dass Verzer- 99 siehe Anhang 52 rungen bei den Ergebnisse aufgrund des Rücklaufs nicht auszuschließen sind. Grafik 1: Vergleich Geschlechterverteilung in der Stichprobe mit dem Rücklauf (p<0,01, dass vorgegebene Verteilung nicht der beobachteten Verteilung entspricht) Vergleichsmerkmal Geschlecht 100,0% 80,0% 79,4% 68,2% 60,0% Stichprobe 40,0% Rücklauf 31,8% 20,6% 20,0% 0,0% w eiblich männlich In Bezug auf die Geschlechterverteilung sind Frauen im Rücklauf um 11,2% mehr vertreten als in der Stichprobe. Diese Überrepräsentation der weiblichen Klienten im Rücklauf lässt darauf schließen, das Frauen einer Psychotherapie gegenüber aufgeschlossener sind, und eher darüber Auskunft geben als Männer. Für Männer ist Psychotherapie nach wie vor ein heikles Thema, über das „Mann“ nicht spricht. Beim Vergleichsmerkmal Alter fällt auf, dass vor allem Klienten die älter als 41 Jahre sind, proportional besonders stark überrepräsentiert sind. Speziell die Gruppe der über 60jährigen ist im Rücklauf im Verhältnis zur Stichprobe am stärksten vertreten. Der geringe Rücklauf bei den bis 20jährigen Klienten relativiert sich insofern, da etwa ein Drittel dieser Alterskategorie in der Stichprobe unter 13 Jahre alt war, und der Fragebogen verständlicherweise nicht von den Klienten selbst und auch kaum von deren Eltern ausgefüllt wurde. Trotz dieser Tatsache scheint die Gruppe der bis 20jährigen im Hinblick auf Psychotherapie nicht besonders auskunftsfreudig zu sein, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass speziell jüngere Personen das Thema und die Auseinandersetzung mit Psychotherapie eher als problematisch empfinden. 53 Grafik 2: Vergleich der Altersverteilung in der Stichprobe mit dem Rücklauf (p<0,01, dass vorgegebene Verteilung nicht der beobachteten Verteilung entspricht) Vergleichsmerkmal Alter 35,0% 31,1% 31,5% 30,0% 24,1% 25,0% 20,0% 15,0% 14,6% 10,0% 16,8% 20,5% 18,0% Stichprobe 12,0% 13,4% 6,1% Rücklauf 5,0% 5,0% 6,9% 0,0% bis 20 21bis 30 31 bis 40 41 bis 50 51 bis 60 über 60 Grafik 3: Vergleich der Verteilung der Wohnbezirke in der Stichprobe mit dem Rücklauf (p<0,01,dass vorgegebene Verteilung nicht der beobachteten Verteilung entspricht) Vergleichsmerkmal Bezirk 25,0% 20,0% 15,0% Stichprobe 10,0% Rücklauf 5,0% Linz Linz-Land Urfahr-Umg. Gmunden Vöcklabruck Wels Wels-Land Braunau Steyr Ried Grieskrichen Kirchdorf Steyr-Land Schärding Perg Freistadt Eferding Rohrbach 0,0% Wie aus der Verteilung in Grafik 3 klar ersichtlich ist, zeigt der Rücklauf ein starkes Übergewicht der Klienten aus Linz. Weiters sind Klienten aus den Bezirken Wels, Urfahr-Umgebung, Steyr und Linz-Land in der Unter- 54 suchung überrepräsentiert. Die Bereitschaft in den übrigen Bezirken über die Inanspruchnahme einer Therapie Auskunft zu geben, fiel dementsprechend gering aus. Diese vorgefundene Verzerrung im Rücklauf liefert einen Hinweis darauf, dass Klienten aus urbanen Bezirken zum einen mit einer größeren Selbstverständlichkeit Psychotherapie in Anspruch nehmen. Zum anderen könnte dies ein Hinweis sein, dass die soziale Kontrolle und die Folgen einer Stigmatisierung im städtischen Bereich wesentlich geringer sind als auf dem Land. Auch Schaffenberger et al. verweisen darauf, dass es in ländlichen Regionen eine stärkere soziale Kontrolle als im städtischen Raum gibt, und die Folgen einer gesellschaftlichen Stigmatisierung im ländlichen Bereich eine höhere Hemmschwelle zur Inanspruchnahme von Psychotherapie darstellen.100 100 vgl. Schaffenberger et al. S.101 55 3 Empirische Befunde Die Auswertung der Ergebnisse aus der standardisierten Befragung erfolgte computerunterstützt unter Anwendung des Statistikprogramms ALMO 6_4. Als Analysemethoden wurden neben eindimensionalen auch zweidimensionale Analyseverfahren herangezogen. 3.1 Die Ausgangslage der Psychotherapieklienten Die Ausganglage der Psychotherapieklienten beinhaltet im Wesentlichen sozioökonomische Daten und bisherige Erfahrungen mit Psychotherapie. Bei den sozioökonomischen Daten wurden Geschlecht, Alter, Familienstand, Schulabschluss, die derzeitige Tätigkeit, sowie die berufliche Position und das monatliche Haushaltsnettoeinkommen erhoben. Zudem wurde die Frage nach einer etwaigen Antragstellung auf Berufsunfähigkeitpension gestellt. 3.1.1 Geschlecht Der Fragebogen wurde zu 78,6% von Frauen und 20,3% von Männern beantwortet. 1,1% machten keinerlei Angaben zum Geschlecht. Im Vergleich zur Stichprobe sind Frauen im Rücklauf überrepräsentiert. In der Stichprobe liegt der Frauenanteil bei 68,2% und der Anteil der Männer bei 31,8%. Die Überrepräsentation der Frauen beim Psychotherapieklientel mit zirka zwei Drittel scheint durchgängig, und unterscheidet sich auch nicht zwischen freien Praxen und institutionellen Organisationsformen, sowie in den Bundesländern. Das Übergewicht von Frauen bei der Inanspruchnahme von Psychotherapie wurde in zahlreichen Studien bestätigt. 101 Geschlechtsspezifisches Gesundheits-, Hilfesuch- und Inanspruchnahmeverhalten zeigt sich bei nahezu allen Institutionen der medizinischen und psychosozialen Versorgung. Wenngleich die Ursachen dafür nicht vollständig geklärt sind, scheint die Überrepräsentation von Frauen, neben der höheren Bereitschaft zu klagen und einer gelernten Hilflosigkeit, auch auf eine höhere Krankheitsbelastung von Frauen zurückzuführen zu sein. Außerdem sind Frauen eher auf professionelle Gesundheitsversor- 101 vgl. Schaffenberger et al. S.130 56 gung angewiesen, da sie selbst von ihren Familien wenig soziale Unterstützung erhalten.102 Grafik 4: Verteilung nach dem Geschlecht der PsychotherapieklientInnen (n=546) Geschlecht männlich 20,3% w eiblich 78,6% k. A. 0% 1,1% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 3.1.2 Alter Aus der Altersverteilung ist ersichtlich, dass etwa ein Drittel der Befragten – genau 31,6% - zwischen 31 und 40 Jahren alt ist. Die zweitgrößte Gruppe bilden die 41 bis 50jährigen mit 24,1%. Mehr als die Hälfte der Befragten (55,7%) ist somit zwischen 31 und 50 Jahren alt. Die Alterklasse zwischen 21 und 30 ist mit 18,0% vertreten, und die 51 bis 60jährigen mit 13,4%. Die beiden Gruppen mit dem geringsten Anteil bilden die über 60jährigen mit 6,8% und die unter 20jährigen mit 6,1%. 102 vgl. Siegrist 1998a S.106 57 Grafik 5: Altersverteilung (n=539, Mittelwert= 38,8 Jahre) Alter über 60 6,8% 51 bis 60 13,4% 41 bis 50 24,1% 31,6% 31 bis 40 21 bis 30 18,0% 6,1% bis 20 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Psychotherapieklienten sind in der Regel im mittleren Lebensalter zwischen 31 und 50. Diese Verteilung spiegelt sich auch in der Stichprobe wider. Die unterrepräsentierten Gruppen der über 60jährigen und bis 20jährigen – speziell im Kindesalter - lässt auf eine Unterversorgung dieser Gruppen schließen. Ein Grund für die geringe Inanspruchnahme von Psychotherapie durch Kinder und Jugendliche im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung liegt zum einen sicher darin, dass es kaum ein spezifisches Angebot für diese Gruppe gibt. Zum anderen wird der Bedarf durch andere Institutionen abgedeckt. Inwieweit andere Organisationen diesen Bedarf decken, kann jedoch im Rahmen dieser Erhebung nicht geklärt werden. 3.1.3 Schulbildung Bezüglich der höchsten abgeschlossenen Schulbildung stellte sich folgendes Bild dar: 22,6% haben eine Lehre abgeschlossen, weitere 25,2% absolvierten eine berufsbildende Schule. 7,5% schlossen ihre Ausbildung mit der Hauptschule und 6,8% mit der Pflichtschule ab. Somit weisen insgesamt 62,1% der befragten Psychotherapieklienten eine Ausbildung ohne Matura auf. Auf die Gruppe der Klienten mit Matura als höchste abgeschlossene Bildung entfielen 21,1%. Der Anteil der Fachhochschul- und Universitätsabsolventen bei den befragten Klienten betrug 16,8%. 58 Grafik 6: Verteilung der höchsten abgeschlossenen Schulbildung (n=531) Schulbildung 16,80% Universität/FH Matura 21,10% 22,60% Lehre 25,20% berufbild. Schule 7,50% Hauptschule Pflichtschule 0,00% 6,80% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% Tabelle 1: Vergleich Schulabschluss der Psychotherapieklienten mit der oberösterreichischen Bevölkerung ( älter als 15 Jahre) Psychotherapieklienten OÖ Wohnbevölkerung (älter als 15 Jahre)103 Pflichtschule 14,3% 35,5% Lehre 22,6% 37,8% berufsbildende Schule 25,2% 8,7% Matura 21,1% 12,1% Universität bzw. FH 16,8% 5,8% Aus der Gegenüberstellung der Bildungsniveaus der Psychotherapieklienten mit jenen der gesamten oberösterreichischen Bevölkerung ist ersichtlich, dass bei den befragten Psychotherapieklienten Pflichtschulabsolventen und Personen mit einer abgeschlossenen Lehre unterrepräsentiert sind. Ab einem mittleren Bildungsniveau (berufsbildende Schule) bis hin zu einem akademischen Abschluss ändert sich das Verhältnis insofern, dass in diesen Kategorien Psychotherapieklienten überrepräsentiert sind im Vergleich zur Oberösterreichischen Wohnbevölkerung. 103 www.ooe.gv.at - Mikrozensus 2002 59 Diese Unausgewogenheit der Klienten in Bezug auf das Bildungsniveau zeigt sich auch in anderen Studien zur Psychotherapie. Allerdings fällt bei dieser Erhebung auf, dass besonders Personen mit einem Pflichtschulabschluss deutlich geringer vertreten sind als beispielsweise in der ÖBIG-Studie104. Diese Verzerrung im Bereich der Pflichtschulabsolventen könnte zum Teil auch durch den Rücklauf bedingt sein. 3.1.4 Derzeitiger Lebensstatus und berufliche Position Bei der Verteilung der Berufsgruppen der befragten Psychotherapieklienten konnte folgendes erhoben werden: Mehr als die Hälfte der Befragten (58,5%) gab an derzeit erwerbstätig zu sein. 17,7% hatten zum Zeitpunkt der Erhebung bereits die Pension angetreten, wobei 4,3% der Pensionisten als Grund für die Pensionierung eine Berufsunfähigkeit anführten. Neben den bereits pensionierten Personen gaben weitere 14,1% der Befragten an, einen Antrag auf Berufsunfähigkeit gestellt zu haben. 7,8% befanden sich noch in einer Ausbildung, 6,0% waren arbeitslos und 4,6% waren zum Erhebungszeitpunkt in Karenz. 5,4% der Befragten gaben an im Haushalt tätig zu sein. Grafik 7: Verteilung des Lebensstatus (n=537) Lebensstatus Haushalt in Ausbildung 5,4% 7,8% Karenz 4,6% berufsunfähig 4,3% 13,4% Pension arbeitslos 6,0% erw erbstätig 0,0% 58,5% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Um ein differenziertes Bild der Erwerbstätigkeit zu erhalten, wurde auch nach der beruflichen Position im momentanen Arbeitsverhältnis oder vor der Pensionierung, Arbeitslosigkeit oder Karenzierung gefragt. 54,5% und somit die Mehrheit der Psychotherapieklienten – sind oder waren als nichtleitende Angestellte tätig. Bei den leitenden Angestellten betrug der 104 vgl. Schaffenberger et al. S.134f 60 Anteil 16,4% und bei den Facharbeitern 7,7%. Un- und angelernte Arbeiter stellen mit 14,2% die drittgrößte Gruppe dar. 2,9% gaben an selbstständig oder freiberuflich zu arbeiten, und 2,1% waren laut eigenen Angaben Beamte. Die übrigen 2,3% der Befragten betreiben eine Landwirtschaft, befinden sich in einem Lehrverhältnis oder sind Teil einer Beschäftigungsmaßnahme. Grafik 8: Verteilung - berufliche Position (n= 470) berufliche Position Sonstiges 2,3% Beamter 2,1% selbstständig/freiberuflich 2,9% leitender Ang. Facharbeiter 16,4% 7,7% Angestellter 54,4% un-/angelernter Arbeiter 0,0% 14,2% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 3.1.5 Haushaltseinkommen Der Einkommensgruppe unter 350,-- € ordneten sich 5,8% der Befragten zu. Anzumerken ist hierbei, dass bei einem Teil dieser Gruppe wahrscheinlich aufgrund eines begrifflichen Missverständnisses nicht das tatsächliche Haushaltseinkommen angegeben wurde, sondern nur ein Anteil. Weiters ist anzumerken, dass sich in der Einkommensklasse bis 350,-- € 52,0% der Befragten noch in Ausbildung befinden, und das elterliche Einkommen scheinbar nicht berücksichtigt wurde, wodurch sich diese Kategorie erklären lässt. Jeweils etwa 16,0% innerhalb der Kategorie bis 350,-- € gaben an im Haushalt tätig oder arbeitslos zu ein. 17,4% gaben an, monatlich über einen Betrag zwischen 350,-- € und 700,-- € zu verfügen. Bei 19,8% lag das Einkommen zwischen 701,-- € und 1050,-€. Die größte Gruppe bildet mit 21,4% die Einkommensklasse zwischen 1051,-- € und 1400,-- €. 11% führen ein Einkommen zwischen 1401,-- € und 1750,-- € an, und 9,8% zwischen 1751,-- € und 2100,-- €. Die Gruppe mit dem höchsten Einkommen – über 2100,-- € - weist einen Anteil von 14,8% auf. 61 Grafik 9: Verteilung des monatlichen Haushaltsnettoeinkommens (n=500) Haushaltseinkommen 25,0% 21,4% 19,8% 20,0% 17,4% 14,8% 15,0% 11,0% 9,8% 10,0% 5,8% 5,0% 0,0% bis 350€ 351 - 700€ 701 - 1050€ 1051 1400€ 1401 1750€ 1751 2100€ über 2100€ 3.1.6 Familienstand Mehr als die Hälfte, nämlich 54% der Psychotherapieklienten, ist verheiratet oder lebt in einer Partnerschaft. 31,2% der befragten Personen sind ledig und weitere 12,0% sind geschieden. Verwitwete Personen sind mit 2,8% die kleinste Gruppe innerhalb der Klienten. Grafik 10: Verteilung nach dem Familienstand (n= 539) Familienstand verwitwet 2,8% geschieden 12,0% verheiratet/Patnerschaft 54,0% 31,2% ledig 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Stellt man den Psychotherapieklienten denen der oberösterreichischen Wohnbevölkerung gegenüber zeigt sich eine deutliche Überrepräsentation von geschiedenen Klienten. Geschiedene Klienten sind mit 12,0% im Vergleich zu 4,5%105 in der Bevölkerung fast dreimal so stark vertreten. 105 www.ooe.gv.at - Mikrozensus 2002 62 Verwitwete Klienten sind mit einem Anteil von 6,6% in der oberösterreichischen Bevölkerung106 eher unterrepräsentiert. 3.1.7 Wohnbezirk Hinsichtlich der regionalen Verteilung konnte festgestellt werde, dass der Großraum Linz (Linz, Urfahr-Umgebung und Linz-Land) mit insgesamt 44,6% am stärksten vertreten war. Wobei der Anteil der Befragten aus Linz mit 22,2% in etwa gleich groß ist wie die Anteile aus Linz-Land mit 11,5% und Urfahr-Umgebung mit 10,9% zusammen. Klienten aus Wels waren mit 5,9% und aus der Stadt Steyr mit 4,8% an der Befragung beteiligt. Grafik 11: Verteilung nach politischem Wohnbezirk (n= 478) Wohnbezirk Linz Linz-Land Urfahr-Umg. Gmunden Vöcklabruck Wels Wels-Land Braunau Steyr Ried Grieskrichen Kirchdorf Steyr-Land Schärding Perg Freistadt Eferding Rohrbach 0,0% 22,2% 11,5% 10,9% 7,1% 7,1% 5,9% 5,0% 4,8% 4,8% 3,8% 3,6% 2,9% 2,7% 2,1% 2,1% 1,9% 0,8% 0,8% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% In den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck leben jeweils 7,1% der Klienten, im Bezirk Wels-Land 5%, und im Bezirk Braunau 4,8%. In den Bezirken Ried mit 3,8% und in Grieskirchen mit 3,6% waren in etwa gleich viele der Befragten wohnhaft. 2,9% gaben Kirchdorf und 2,7% Steyr-Land als Wohnbezirk an. Klienten aus den Bezirken Schärding und Perg sind mit einem Anteil von jeweils 2,1% vertreten. Am wenigsten be106 www.ooe.gv.at - Mikrozensus 2002 63 teiligten sich Personen aus den Bezirken Freistadt mit 1,9%, Rohrbach und Eferding mit jeweils 0,8%. 3.1.8 Bisherige Inanspruchnahmen Das untersuchte Klientel unterscheidet sich neben soziodemografischen Merkmalen auch hinsichtlich der bisherigen Inanspruchnahmen einer Psychotherapie. Auf die Frage wie oft bereits eine Psychotherapie durchgeführt wurde, die in sich als abgeschlossen bezeichnet werden kann, zeigt sich, dass die Mehrheit der Befragten, genau 59,2%, keinerlei Erfahrung im Umgang mit Psychotherapie hatte. Für diese Gruppe war die durchgeführte Therapie somit die erste. 40,8% gaben an bereits eine oder mehrere Psychotherapien in Anspruch genommen zu haben. Von den Therapieerfahrenen waren 11,4% zum Zweiten mal in Therapie und 29,4% schon mehrmals. Die Obergrenze bei der Inanspruchnahme lag bei 10 Therapien, wobei dies einen Einzelfall darstellte. Grafik 12: Anzahl der bisherigen Inanspruchnahmen (n=525, Mittelwert = 0,91) bisherige Inanspruchnahmen öfter als einmal einmal 29,4% 11,4% 59,2% keine 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 3.2 Symptome und Hilfesuchen Mit dem Auftreten von psychischen wie körperlichen Symptomen einer Krankheit beginnt für den Erkrankten ein Prozess - sofern die Symptome nicht bagatellisiert, verleugnet oder selbstbehandelt werden - des Suchens nach Hilfe und Unterstützung. Der Prozess beginnt meist im privaten Umfeld des Betroffenen und kann sich auf das Umfeld von ge- 64 sundheitlichen Professionisten ausweiten.107 Die Bedeutung von körperlichen Symptomen, des Hilfesuchens im privaten Umfeld und im professionellen System der Gesundheitsberufe ist Gegenstand des folgenden Kapitels. 3.2.1 Symptome und Auffälligkeiten Auf die Frage, ob sich die seelischen Beschwerden auch in einer körperlichen Form manifestierten, antworteten 88,4% mit ja. 11,6% hatten im Verlauf der psychischen Beschwerden keinerlei körperliche Symptome. Wenngleich dies eine sehr allgemeine subjektive Einschätzung des wahrgenommenen Gesundheitszustandes darstellt, gibt sie dennoch Aufschluss drüber, dass die Befragten den eigenen Gesundheitszustand als relativ schlecht beurteilen. Grafik 13: körperliche Symptome aufgrund der psychischen Beschwerden (n=535) körperliche Beschwerden 11,6% ja nein 88,4% Ein differenzierteres Bild über den Gesundheitszustand liefert die Betrachtung der verschiedenen funktionalen Störungen und deren Anzahl. Das mit Abstand am häufigsten angeführte Symptom waren Schlafstörungen mit 68,0%. Unruhe und Zittern sowie Müdigkeit nannten ebenfalls mehr als die Hälfte der Befragten. Weitere sehr häufig genannte Störungsbilder waren Konzentrationsstörungen, Magen-Darm-Störungen, Kopfschmerzen, Wirbelsäulenprobleme und Atembeklemmung, sowie Schwindelgefühle und Herzbeschwerden. Symptome wie Essstörungen, Hauterkrankungen oder allgemeine Schmerzen wurden zu einem gerin107 vgl. S.21f 65 gen Anteil von den Befragten angeführt. Sehr vereinzelt wurden unter der Kategorie Sonstiges Kreislaufprobleme, Asthma, Durchblutungsstörungen, Entzündungen und Beeinträchtigungen im Bereich der akustischen Wahrnehmung angegeben. Tabelle 2: wahrgenommene funktionale Störungen in Verbindung mit den psychischen Beschwerden (n=473, Mehrfachangaben, nach Häufigkeit gereiht) funktionale Störungen absolut Prozent funktionale Störungen absolut Prozent Schlafstörungen 324 68,5 Atembeklemmung 138 29,1 Unruhe, Zittern 274 57,9 Schwindelgefühle 132 27,9 Müdigkeit 256 54,1 Herzbeschwerden 111 23,5 Konzentrationsstörungen 233 49,3 Essstörungen 10 2,1 Magen-Darm-Störungen 192 40,6 Hauterkrankungen 7 1,5 Kopfschmerzen 145 30,7 Schmerzen allgemein 5 1,1 Schweißausbrüche 145 30,7 Sonstiges 24 5,1 Wirbelsäulenprobleme 139 29,4 Im Bereich der Symptome zeigt sich im Vergleich zur ÖBIG-Studie, dass die Anteile bei der vorliegenden Erhebung bei den einzelnen funktionalen Störungen um ein wesentliches höher liegen.108 Ein Teil dieser Verzerrung ist hierbei allerdings durch die Art der Erhebung verursacht. In der ÖBIG-Studie beruhen die Werte auf der Diagnose und der Einschätzung durch die Ärzteschaft. Die subjektive Einschätzung des Gesundheitszustandes durch die Betroffenen scheint erwartungsgemäß schlechter auszufallen. Ungeachtet der methodischen Verzerrung deutet dieses hohe Ausmaß an funktionalen Störungen auf einen relativ großen Leidensdruck bei den Befragten hin. Auch die Anzahl von funktionalen Störungen bei den Befragten verstärkt den Eindruck, dass die befragten Klienten vor der Inanspruchnahme einer Therapie einem relativ hohen Leidensdruck ausgesetzt waren. 70,2% zeigten drei oder mehr Symptome. 13,4% hatte keinerlei körperliche Symptome und 6% nannten eine funktionale Störung. 108 vgl. Schaffenberger et al. S.17 66 Grafik 14: Anzahl funktionaler Störungen (n=535) Anzahl funktionaler Störungen 8 und mehr 8,8% 31,7% 5 bis 7 3 bis 4 29,7% 2 10,4% 1 6,0% 13,4% keine 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Neben körperlichen und funktionalen Störungen stellt die wahrgenommene Einschränkung in der alltäglichen Lebensführung einen weiteren Indikator für das Ausmaß der Betroffenheit durch die psychische Störung dar. Auch hier zeigt sich ein hohes Maß an Leidensdruck bei den Befragten. 86,2% der Klienten fühlten sich sehr oder eher schon in ihrem alltäglichen Leben durch die psychischen Beschwerden eingeschränkt. Für 13,8% scheint die Erkrankung zu kaum einer bis keiner Einschränkung in der Lebensführung geführt zu haben. Grafik 15: wahrgenommenes Ausmaß der Einschränkung im Alltag durch die psychische Störung (n= 537) Behinderung im Alltag gar nicht eher nicht 2,6% 11,2% 39,1% eher schon 47,1% sehr 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 67 3.2.2 Informationsquellen über Psychotherapie und Therapiefinanzierung Die Informationssuche findet im Wesentlichen in drei Bereichen statt. Zum einen erfahren die Betroffenen in ihrem sozialen Umfeld Rat und Unterstützung, zum anderen wird Hilfe bei medizinischen Fachleuten gesucht. Die mehr oder weniger gezielte Suche in diversen Medien, und die persönliche Auseinandersetzung mit entsprechenden Informationen stellt einen weiteren Bereich dar. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die verschiedenen Medien sehr selektiv und in Abhängigkeit von den personalen Ressourcen genutzt werden. Die Qualität solcher Informationen liegt im Wesentlichen darin, dass dem Betroffenen alternative Entscheidungsmöglichkeiten für sein Verhalten eröffnet werden. Auf die zeitliche Komponente im Prozess des Hilfesuchens wurde in dieser Erhebung aus methodischen Überlegungen und Gründen der Verständlichkeit des Fragebogens verzichtet. 3.2.2.1 Informationen über Psychotherapie Tabelle 3 zeigt, dass vor allem das System der medizinischen Professionen und enge soziale Beziehungen, wie Freunde oder Verwandte, die größte Bedeutung bei der Informationssuche besitzen. Die mit 30,7% am häufigsten angeführte Informationsquelle war der praktische Arzt. Neurologen oder Psychiater wurden mit 21% am dritthäufigsten genannt. Auch Schaffenberger et al. verweisen auf die zentrale Rolle der primären Gesundheitsversorgung bei der Feststellung einer psychisch bedingten Beeinträchtigung und der dafür erforderlichen Information und Motivation zur Therapie. Sie stellen fest, dass Psychotherapieklienten etwa zu einem Fünftel von der Ärzteschaft geschickt werden. 109 Die höheren Anteile in der vorliegenden Studie erklären sich zum einen durch die Fragestellung, die sich nur auf Informationsquellen, und nicht auf eine eventuelle Fremdmotivation bezogen hat. Zum anderen durch das spezielle Klientel, das für die kostenlose Inanspruchnahme einer Therapie notwendiger Weise einen Arzt konsultieren muss. Freunde wurden in diesem Zusammenhang mit 28,3% am zweithäufigsten genannt. Dies kann als ein Hinweis darauf gewertet werden, dass enge soziale Beziehungen einen nicht unwesentlichen Einfluss bei der Informations- und Hilfesuche einnahmen, und das Umfeld der Befragten 109 vgl. Schaffenberger et al. S.61f 68 einer psychotherapeutischen Versorgung gegenüber eher aufgeschlossen ist. Die Aufgeschlossenheit des sozialen Umfeldes zeigt sich auch darin, dass etwa zwei Drittel der Befragten angaben, Personen aus ihrem Bekanntenkreis zu kennen, die bereits eine Psychotherapie in Anspruch genommen haben. Eine Ausnahme stellen jedoch die Partner der Befragten dar, die nur von 8,5% angeführt wurden, im Gegensatz zu Bekannten, die von 11,0% genannt wurden. Diese Bedeutung des sozialen Umfeldes zeigt sich auch in der Empfehlung und der Motivation zur Therapie. 50,8% der Befragten gaben an, dass ihnen eine Psychotherapie von Personen aus ihrem sozialen Umfeld empfohlen wurde. Die überragende Stellung von Mitgliedern der Primärgruppe im Prozess des Hilfesuchens bei psychischen Problemen zeigte sich auch bei einer Untersuchung zur Einstellung zu psychisch Kranken und zur psychosozialen Versorgung in Oberösterreich. Rund 40% der Befragten würden sich im Falle persönlicher psychischer Probleme Hilfe und Rat beim Ehepartner, Eltern oder guten Freunden holen. Andererseits wird Freunden die psychische Beschwerden haben, eher zu einem Arztbesuch – egal ob Hausarzt oder Facharzt für Psychiatrie – geraten, während die Befragten selber nur in Ausnahmefällen eine derartige Vorgehensweise praktizieren oder ins Auge fassen.110 Auf den ersten Blick erscheint dieses Ergebnis jedoch im Bezug auf die Therapieempfehlung im Vergleich zur ÖBIG-Studie widersprüchlich. Der relativ hohe Anteil an Empfehlungen durch das nähere soziale Umfeld entspricht eher dem Klientel in freien Praxen als den Klienten einer institutionellen Organisationsform. Klienten die eine Psychotherapie in einer Institution in Anspruch nehmen, wurde demnach eher von Berufsgruppen des Gesundheits- und Sozialbereichs nahe gelegt eine Therapie zu beginnen, als von Freunden, Angehörigen oder Kollegen.111 Aufschluss über die scheinbaren Widersprüchlichkeiten liefert Grafik 40, die zeigt dass die Mehrheit der befragten Klienten eine Therapie in einer freien Praxis in Anspruch genommen haben, entgegen der Annahme dass in der Stichprobe nur Klienten enthalten sind, die das Angebot einer institutionellen Therapie genutzt haben. Weiters fällt auf, dass Krankenhäuser mit 17,7% nicht wesentlich häufiger genannt wurden als Bücher mit 16,5%. 11,8% gaben an entsprechende Broschüren gelesen zu haben und 11,4% haben sich in Zeitschriften informiert. Weniger bedeutend sind andere Massenmedien wie Fernsehen mit 7,5% oder Zeitungen mit 7,4%. Die Informationsquelle Internet ist mit 3,1%, das am wenigsten genutzte Medium. 110 111 vgl. Grausgruber et al. S.194f vgl. Schaffenberger et al. S.113 69 Tabelle 3: Informationsquellen über Psychotherapie als adäquate Therapieform (n=544, Mehrfachangaben, nach Häufigkeiten gereiht) Informationsquelle absolut Prozent Informationsquelle absolut 41 Prozent praktischer Arzt 167 30,7 Zeitung 7,5 Freunde 154 28,3 Psychotherapeut 39 7,2 Psychiater/Neurologe 114 21,0 Beratungsstellen 33 6,1 Krankenhaus 96 17,7 „das weiß man“ 29 5,3 Bücher 90 16,5 Sozialarbeiter 27 5,0 Angehörige /Verwandte 76 14,0 OÖ Gebietskrankenkasse 27 5,0 Broschüren 64 11,8 Ausbildung 21 3,9 Zeitschriften 62 11,4 Internet 17 3,1 Bekannte 60 11,0 Arbeitskollegen 16 2,8 Partner 46 8,5 div. Gesundheitsexperten 14 2,6 sonstige Fachärzte 45 8,3 diverse Ämter 9 1,7 Fernsehen 40 7,4 sonstiges 8 1,5 Im Bereich der Gesundheitsversorgung wurden noch sonstige Fachärzte mit 8,3%, Psychotherapeuten mit 7,2%, die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse mit 5,0% und diverse Gesundheitsexperten wie Psychologen, Schularzt, Homöopathen oder Heilpraktiker mit 2,6% angegeben. Das Aufsuchen von Beratungsstellen, speziellen Informationsstellen wie PGA oder OÖLP, die unter der Kategorie Sonstiges zusammengefasst sind, und die Rolle von Sozialarbeitern scheinen eher von geringer Bedeutung zu sein. Auch eher oberflächliche Bekanntschaften aus der Arbeitswelt, der Ausbildung oder aus dem öffentlichen Raum spielen kaum eine Rolle. Die durchschnittliche Anzahl von verschiedenen Informationsquellen liegt bei etwa zwei angeführten Quellen. 43,8% der Befragten führten zwei bis drei Informationsquellen an, und sind somit als eher durchschnittlich informiert zu bezeichnen. Bei einem Anteil von 37,0% kann von einer eher einseitigen Informiertheit gesprochen werden. Die restlichen 19,3% nannten vier oder mehr Bereiche, und sind somit quantitativ besser informiert. 70 Grafik 16: Anzahl der Informationsquellen über Psychotherapie als adäquate Therapieform (n= 544, Mittelwert = 2,38) Informationsquelle über Psychotherapie 7 bis 10 2,9% 4 bis 6 16,4% 2 bis 3 43,8% 1 0,0% 37,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 3.2.2.2 Informationen zur Therapiefinanzierung Die Information, dass Psychotherapie bei bestimmten Beschwerden hilfreich sein kann, mag für den Betroffenen zwar ein wertvoller Hinweis sein, vernachlässigt aber die finanziellen Kosten einer Therapie. Gerade die relativ hohen Kosten einer Psychotherapie behinderten lange Zeit die Zugänglichkeit im Bereich dieser Therapieform. Deshalb wurden die Klienten auch gezielt danach befragt, von wem sie Informationen über die Therapiefinanzierung durch die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse erhalten haben. In Tabelle 4 zeigt sich deutlich, dass im Wesentlichen das System der Gesundheitsprofessionen über die Leistungen der Krankenkasse in Bezug auf Psychotherapie aufklärt. Im Bereich der Gesundheitsberufe leistet die Berufsgruppe der Psychotherapeuten, die von 47,5% der Befragten angegeben wurde, den größten Teil der Informationsarbeit. Wenngleich dieses Ergebnis auf den ersten Blick nicht wirklich überrascht, so ist es doch in gewisser Weise eher bedenklich, dass der Hilfesuchende erst beim Therapeuten über die Möglichkeit einer kostenlosen oder durch die Gebietskrankenkasse bezuschusste Therapie erfährt. Für 26,0% der Klienten war der Psychotherapeut die einzige Informationsquelle. Im Bereich der medizinischen Versorgung erhielten 23,2% der Klienten bei einem Psychiater oder Neurologen, 21,0% bei einem praktischen Arzt, 3,4% bei einem anderen Facharzt und 7,8% in einem Krankenhaus Auskunft über eine kostenlose Psychotherapie. Vergleicht man diese 71 Werte mit denen in Tabelle 3 fällt auf, dass Neurologen und Psychiater ihre Patienten eher über eine Leistungserbringung durch die Krankenkasse aufklären als praktische Ärzte und andere Fachärzte. Dies könnte zum Teil darin liegen, dass Neurologen und Psychiater oft eine psychotherapeutische Zusatzausbildung aufweisen, und auch eine Therapie anbieten. Die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse nannte mit 14% ein relativ großer Teil der Befragten als Informationsquelle. Inwieweit die Klienten diese Information aktiv und gezielt eingeholt haben, bleibt allerdings unklar. Das soziale Umfeld der Klienten scheint zwar über die Möglichkeit einer Psychotherapie informiert zu sein, weiß aber kaum über eine kostenlose oder bezuschusste Therapie durch die Krankenkasse bescheid oder weist kaum darauf hin. 9,7% nannten Freunde, 6,3% Angehörige oder Verwandte, 3,7% Bekannte und 1,5% den Partner als Informationsquelle. Medien spielen in dieser Beziehung eine untergeordnete Rolle. Die Massenmedien Zeitung und Fernsehen bringen es gemeinsam auf einen Anteil von 5,2% und Broschüren auf 4,5%. Zeitschriften und Internet sind mit jeweils rund 2% kaum von Bedeutung. Tabelle 4: Informationsquellen über eine kostenlose oder bezuschusste Psychotherapie (n= 534,Mehrfachangaben, nach Häufigkeiten gereiht) Informationsquelle absolut Prozent Informationsquelle Prozent Sozialarbeiter absolut 24 Psychotherapeut 255 47,5 Psychiater/ Neurologe 124 23,2 Bekannte 20 3,7 praktischer Arzt 112 21,0 sonstige Fachärzte 18 3,4 OÖ Gebietskrankenkasse 75 14,0 Arbeit/ Ausbildung 13 2,4 Freunde 52 9,7 Zeitschriften 11 2,1 Krankenhaus 42 7,8 Internet 10 1,8 Angehörige/ Verwandte 34 6,3 Partner 8 1,5 Beratungsstelle 30 5,5 diverse Ämter 7 1,3 Zeitung und Fernsehen 28 5,2 Sonstiges (OÖLP, PGA...) 5 0,9 Broschüre 24 4,5 4,5 Sozialarbeiter, Beratungsstellen sowie diverse Ämter sind zwar eher von geringer Bedeutung, wissen aber um die Bedürfnisse ihrer Klienten, und informieren auch in entsprechenden Maße über eine kostenlose Therapie. Die Vereine OÖLP und PGA –zusammengefasst unter der Kategorie Sonstiges – führten nur 0,9% an. 72 Von der Möglichkeit einer kostenlosen oder durch die Gebietskrankenkasse bezuschusste Psychotherapie hat die Mehrheit der Klienten, 57,5%, an einer Stelle erfahren. 26,4% nannten zwei Informationsquellen, und 16,1% führten drei und mehr Quellen an. Der Maximalwert lag bei insgesamt acht Informationsquellen. Grafik 17: Anzahl der Informationsquellen über eine kostenlose oder bezuschusste Psychotherapie (n= 534, Mittelwert = 1,68) Anzahl Informationsquellen zur Therapiefinanzierung 16,1% 3 und mehr 2 26,4% 57,5% 1 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 3.2.3 Die Bedeutung der Gesundheitsprofessionen beim Hilfesuchen Fast 40% der Klienten gaben an, dass sie wegen ihrer Beschwerden auf dem direkten Weg einen Psychotherapeuten aufsuchten. 34,2% zogen zu allererst einen praktischen Arzt zu Rate, und 18,3% konsultierten einen Neurologen oder Psychiater aufgrund der psychischen Beschwerden. 73 Grafik 18: Erste Hilfsinstanz im professionellen Sektor (n=520) 1.Hilfsinstanz andere med. Berufe anderer Facharzt Psychiater/Neurologe prakt. Arzt Psychotherapeut 0,0% 2,3% 5,6% 18,3% 34,2% 39,6% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% Andere Fachärzte wurden von 5,3% der Befragten als erste Hilfsinstanz für ihre Beschwerden genannt. 2,3% besprachen ihre psychischen Probleme das erste Mal mit Schul- oder Betriebsärzten, Physiotherapeuten oder Heilpraktikern. Nur eine kleine Gruppe von 7,9% scheint demnach in Bezug auf die psychischen Beschwerden relativ ungerichtet nach fachlicher Unterstützung gesucht zu haben. Ein relativ hoher Anteil der Befragten, 39,6%, wählte den direkten Weg zum Psychotherapeuten. Da sich die Befragten im Hinblick auf ihre Psychotherapieerfahrung unterschieden, lag der Schluss nahe, dass es sich hierbei hauptsächlich um Klienten handelte, die bereits eine oder mehrere Therapien in Anspruch genommen haben. Dass ein derartiger, statistisch signifikanter Zusammenhang besteht, konnte jedoch nicht bestätigt werden. Die höchste abgeschlossene Bildung der Befragten scheint eher einen Hinweis darauf zu geben, welche Klienten den unmittelbaren Weg zum Therapeuten wählen, wenngleich die Stärke des Zusammenhangs als eher gering einzustufen ist. Die Hypothese lautete, dass Personen mit zunehmenden Bildungsgrad gezielter und direkt eine Psychotherapie in Anspruch nehmen. Die Annahme konnte dahingehend bestätigt werden, dass besser Gebildete, sprich Personen mit Matura oder einem Hochschulabschluss einen Psychotherapeuten direkter aufsuchen als diejenigen, die ein geringes Bildungsniveau aufweisen. 74 Grafik 19: Erste Hilfeinstanz in Abhängigkeit vom Bildungsgrad (p<0,05, Phi=0,10) 1. Hilfeinstanz und Bildungsgrad mit Matura 55,7% 44,3% prakt. Arzt Psychotherapeut ohne Matura 0,0% 65,9% 25,0% 34,1% 50,0% 75,0% 100,0% 3.2.3.1 Die Bedeutung der praktischen Ärzte im Zuweisungsprozess Wie Grafik 18 zeigt, besitzen praktische Ärzte auch bei psychischen Problemen als erste Anlaufstelle im Bereich der Gesundheitsberufe für Betroffene eine wichtige Funktion. Ähnlich hohe Werte an Erstkonsultation bei praktischen Ärzten finden sich auch in anderen Untersuchungen. So führt etwa Katschnig im Österreichischen Psychiatriebericht an, dass ungefähr jeder Dritte der einen Allgemeinmediziner aufsucht, unter einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung leidet. Als Gründe für die bedeutende Stellung der praktischen Ärzte werden unter anderen eine besser Erreichbarkeit und Zugänglichkeit speziell in ländlichen Gebieten angeführt. Auch körperliche Symptome die mit einer psychischen Erkrankung einhergehen können, legen oft den Besuch eines Arztes nahe. 112 Die Annahme, dass speziell in ländlichen Regionen dem praktischen Arzt in der Erstversorgung bei psychischen Problemen eine größere Bedeutung zukommt als im städtischen Bereich konnte in dieser Untersuchung nicht bestätigt werden. Klienten aus dem städtischen Bereich unterschieden sich diesbezüglich nicht signifikant von den Klienten aus eher ländlichen Bezirken. Der praktische Arzt besitzt demnach sowohl im städtischen wie auch im ländlichen Bereich in der Primärversorgung bei psychischen Problemen eine wichtige Funktion. Die Hypothese, dass körperliche Symptome den Betroffenen nahe legen einen praktischen Arzt zu konsultieren, konnte hingegen bestätigt wer112 Katschnig et al. S.21 75 den. Zwischen dem Auftreten von körperlichen oder funktionalen Störungen und dem Aufsuchen eines praktischen Arztes besteht ein statistisch signifikanter Zusammenhang, wenn gleich dieser Zusammenhang als eher schwach einzustufen ist. In Grafik 21 zeigt sich dieser Zusammenhang noch deutlicher. Je mehr körperliche Symptome die Befragen zeigten, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass ein praktischer Arzt aufgesucht wurde. Weiters nimmt auch die Bedeutung der Psychiater und Neurologen als erste Hilfeinstanz ab einem genannten körperlichen Symptom zu. Die Entscheidung ob ein praktischer Arzt oder ein Psychiater oder Neurologe zu Rate gezogen wird, ist wahrscheinlich von der Symptomatik abhängig. Grafik 20: Erste Hilfeinstanz in Abhängigkeit vom Vorhandensein von körperlichen Symptomen (p< 0,05,Phi 0,10) 1. Hilfeinstanz und körperliche Symptome keine körperlichen Symptome 79,0% 21,0% prakt. Arzt andere Profession körperliche Symptome 0,0% 76 65,0% 35,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% Grafik 21: Erste Hilfeinstanz in Abhängigkeit von der Anzahl der körperlichen Symptome (p< 0,01, C(cor)= 0,27) 1. Hilfeinstanz und Anzahl der körperlichen Symptome mehr als 4 3 bis 4 keine 0,0% 7,0% 33,3% 20,0% prakt. Arzt Psychotherapeut 14,0% 15,2% 45,5% 14,3% 17,1% 48,6% 40,0% 60,0% 7,2% 12,7% 39,9% 45,6% 9,1% 30,3% 20,0% 30,3% 15,8% 31,7% 2 1 24,0% 38,5% 80,0% 100,0% Psychiater/Neurologe Sonstiges Um die Rolle der praktischen Ärzte näher zu beleuchten wurden all jene Klienten, die wegen ihrer Beschwerden einen praktischen Arzt aufgesuchten haben, gebeten die Aussagen in Tabelle 5 zu bewerten. Anzumerken ist hierbei, dass auch Klienten, die einen Allgemeinmediziner nicht als erste Hilfeinstanz aufsuchten, die Aussagen beantwortet haben. Relevante Dimensionen dieses Teils der Befragung waren, abgesehen von Arztvertrauen, die Einschätzung der fachlichen Kompetenz der praktischen Ärzte sowie die erlebte Unterstützung der Klienten zur Inanspruchnahme einer Psychotherapie. Die Trennschärfe der einzelnen Items wurde faktorenanalytisch überprüft, und bestätigte die theoretische Annahme.113 113 siehe Anhang 77 Tabelle 5: Wahrgenommene Unterstützung und Einschätzung der Kompetenz des praktischen Arztes ja nein Mein/e prakt. Arzt/Ärztin hält Psychotherapie für eine geeignete Methode seelische Beschwerden zu heilen oder zu lindern. 91,1 Mein/e prakt. Arzt/Ärztin hat sich bemüht mich zu einer psychotherapeutischen Behandlung zu bewegen. % n 8,9 100 367 51,1 48,9 100 352 Er/ sie meinte, dass nur eine medizinische Behandlung (Medikamente) bei meinen Beschwerden helfen kann. 11,1 89,9 100 353 Ich habe eine gründliche Information über eine psychotherapeutische Behandlung von meinem/r Arzt/Ärztin erhalten. 31,1 68,9 100 354 Ich wurde wegen meiner Beschwerden sehr lange von meinem/r prakt. Arzt/Ärztin behandelt, bevor er/sie mich schließlich zur Psychotherapie überwiesen hat. 19,2 80,8 100 354 Er/ sie hat mich zu einem/r andere/n Facharzt/-ärztin überwiesen, um mögliche körperliche Ursachen ausschließen zu können. 51,6 48,4 100 365 Wann immer ich gesundheitliche Beschwerden habe, suche ich meine/n prakt. Arzt/Ärztin auf. Er/sie ist kompetent und nimmt sich Zeit für mich. 83,3 16,7 100 366 3.2.3.1.1 Einschätzung der fachlichen Kompetenz Auffallend bei einer ersten Durchsicht von Tabelle 5 ist der Befund zum generellen Arztvertrauen der Klienten in Bezug auf die praktischen Ärzte. 83,3% der Befragten meinten, dass sie bei gesundheitlichen Problemen den Hausarzt aufsuchen, sich dort fachlich gut aufgehoben fühlen, sowie ein offenes Ohr finden. Die relativ große Vertrauensstellung und Zufriedenheit mit den Allgemeinmedizinern könnte somit ein weiteres Indiz dafür sein, das Aufschluss über die bedeutende Rolle der praktischen Ärzte gibt. Die befragten Psychotherapieklienten unterscheiden sich in Bezug auf ihre Zufriedenheit mit dem praktischen Arzt nicht wesentlich von anderen Versicherten. Der relativ hohe Wert an Zufriedenheit mit dem praktischen Arzt in dieser Untersuchung fällt nur geringfügig positiver aus, als bei einer umfassenden Kundenbefragung durch die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse im Jahre 2001. Bei dieser Kundenbefragung gaben 78 79% der befragten Patienten an, dass sie beim letzten Besuch bei einem Allgemeinmediziner das Gefühl hatten, dass sich der Arzt genügend Zeit genommen hat, und bestätigten somit den praktischen Ärzten gegenüber eine hohe Zufriedenheit.114 Ein weiterer wichtiger Befund in diesem Zusammenhang scheint die Überweisung zu anderen Fachärzten zu sein. 51,6% der Befragten wurden demnach nicht direkt zum Psychotherapeuten, sondern zu einem Facharzt überwiesen, um eventuelle körperliche Ursachen ausschließen zu können. Ausgehend von dieser sehr globalen Einstellung zum praktischen Arzt sollten die Befragten eine differenziertere Einschätzung des Hausarztes in Bezug auf die fachliche Kompetenz im Umgang mit psychischen Problemen vornehmen. Hierbei zeigt sich ein verfeinertes Bild, das aber in groben Zügen dieser globalen Einschätzung entspricht. Die Beurteilung passiert auf einer Indexbildung. Berücksichtigt wurden dabei die ärztliche Einstellung zu Medikamenten, eine etwaige Überweisung zum Facharzt, sowie die Behandlungsdauer durch den praktischen Arzt. Eine rasche Überweisung zu einem Facharzt, eine kurze Behandlungsdauer bis zur Überweisung zum Psychotherapeuten sowie eine gemäßigte Einstellung zur Psychopharmakotherapie führen zu einer positiven Bewertung des praktischen Arztes. Demzufolge sind 88% der konsultierten Hausärzte in Bezug auf den fachlich kompetenten Umgang mit psychischen Problemen aus Sicht der Klienten als sehr gut oder gut zu beurteilen. 10% sind dieser subjektiven Einschätzung nach nur genügend und lediglich 1,5% als ungenügend zu qualifizieren. 114 Samhaber S.54 79 Grafik 22: Index der subjektiven Einschätzung der fachlichen Kompetenz des praktischen Arztes (n=334) Beurteilung der fachlichen Kompetenz ungenügend genügend 1,5% 10,5% 53,0% gut 35,0% sehr gut 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 3.2.3.1.2 Therapieinformation und –motivation durch den praktischen Arzt Die positive Beurteilung von 91,1% der Befragten zur Einschätzung der Aufgeschlossenheit der Ärzteschaft gegenüber der psychotherapeutischen Methode als Behandlungsverfahren scheint relativ hoch zu sein, wenngleich dieses Ergebnis mit Vorsicht zu interpretieren ist. Zum einen erklärt sich dieses Ergebnis dadurch, da nur Personen befragt wurden, die tatsächlich eine Therapie in Anspruch genommen haben, und nicht bereits auf dem Weg dorthin Hindernisse erfahren haben oder entmutigt wurden. Zum anderen könnte es sich hierbei auch um einen überdurchschnittlich aufgeschlossenen Teil der Ärzteschaft handeln, wenngleich es hierzu keine Vergleichswerte gibt. Aussagekräftiger in Bezug auf die wahrgenommene Unterstützung scheint jedoch die wahrgenommene Bemühung die Patienten zu einer Therapie zu bewegen, sowie die Informationstätigkeit der praktischen Ärzte. Das Ausmaß des erlebten Unterstützungsgrades setzt sich aus der erlebten Aufgeschlossenheit gegenüber einer Psychotherapie, der Bemühung den Patienten zu einer Therapie zu bewegen und einer Information über eine psychotherapeutische Behandlung durch den praktischen Arzt zusammen. Ein Arzt, der einer Therapie gegenüber aufgeschlossen ist, den Patienten zu einer Therapie motiviert und diesen über eine derartige Behandlung aufklärt, wird in Bezug auf den erlebten Unterstützungsgrad als sehr gut eingestuft. Wenngleich nicht unterstellt werden kann, dass jeder Patient einer derartigen Unterstützung bedarf oder eine solche wünscht, so stellt dieser Index 80 dennoch einen brauchbaren Hinweis auf die Tätigkeit der Allgemeinmediziner dar. Das Ausmaß des Unterstützungsgrades relativiert in gewisser Weise die Bedeutung der Allgemeinmediziner im Prozess des Hilfesuchens. Wenngleich bei 56% der Befragten die Angaben auf einen hohen oder eher hohen Unterstützungsgrad durch die praktischen Ärzte hinweisen, erscheint der Anteil an niedriger oder keiner Unterstützung durch die Ärzteschaft mit 44% im Vergleich zur Beurteilung der fachlichen Kompetenz eher hoch. Grafik 23: Index: Bewertung der Information und Motivation durch den praktischen Arzt (n=336) Unterstützungsgrad durch den praktischen Arzt 9,5% keine Unterstützung 34,5% niedrig 28,3% eher hoch hoch 0,0% 27,7% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Pointiert könnte man zusammenfassen, dass praktische Ärzte zwar ihre Patienten zur Psychotherapie schicken, es aber nicht als ihre Aufgabe sehen oder es ihre Möglichkeiten übersteigt, ihre Klientel über eine derartige Therapie zu informieren oder zu einer Therapie zu motivieren. 3.2.3.2 Zuweisung zur Psychotherapie Die Zuweisung zur Psychotherapie ist deswegen von Bedeutung, da diese für die Leistungsverrechnung mit der Krankenkasse eine Notwendigkeit darstellt. Für die Inanspruchnahme einer bezuschussten Therapie – sprich für eine Therapie bei einem Wahlpsychotherapeuten - genügt allerdings eine ärztliche Bestätigung ab der zweiten Therapiesitzung. Die beiden Begriffe der Zuweisung und der ärztlichen Bestätigung entsprechen den versicherungsrechtlichen Fachbezeichnungen im Prozess des Hilfesuchens im professionellen System. Begriffliche Unterschiede zwischen Fachleuten und Laien scheinen demnach im Fragebogen bei eini- 81 gen Klienten zu Missverständnissen geführt zu haben. So sind die Kategorien „selbst“ und „Beratungsstelle“ als Ausdruck der Fremd- oder Selbstmotivation der Klienten zu verstehen, und nicht im versicherungsrechtlichen Sinne. Grafik 24: Ärztliche Zuweisung zur Psychotherapie (n= 512) Zuweisung zur Psychotherapie Sonstiges Beratungsstelle 2,4% 4,9% Facharzt 5,7% Krankenhaus 6,1% selbst 8,8% 19,7% Psychiater/Neurologe 52,5% prakt. Arzt 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Im Bereich der Zuweisung zeigt sich, dass auch hier der praktische Arzt mit einem Anteil von 52,2% mit Abstand die bedeutendste Stellung einnimmt. Psychiater oder Neurologen sind mit 19,7% die am zweithäufigsten genannte Berufsgruppe. Krankenhäuser, Fachärzte sowie unter der Kategorie Sonstiges angeführte Schul-, Betriebs- oder Chefärzte spielen eine eher untergeordnete Rolle. Die 8,8% der „Selbstzuweisungen“ könnten als Hinweis auf eine hohe Therapiemotivation dieser Klienten gedeutet werden, während 4,9% der Klienten scheinbar die Informationsund Motivationstätigkeit diverser Beratungsstellen hervorheben. Die Anteile der verschiedenen Berufsgruppen relativieren sich insofern, da die Zuweisung zur Therapie stark durch die erste Hilfeinstanz mitbestimmt wird. Der Zusammenhang zwischen erster Hilfeinstanz und dem Zuweiser zur Therapie ist statistisch hoch signifikant, und die Stärke des Zusammenhangs relativ groß. Für die Praxis der Zuweisung bedeutet dies folgendes. Allgemeinmediziner besitzen bei der Zuweisung zur Therapie in zweierlei Hinsicht eine große Bedeutung. Zum einen zeigt sich, dass praktische Ärzte die mit den psychischen Beschwerden von Patienten konfrontiert werden, diese Patienten auch am ehesten einer Therapie zuweisen. Zum anderen ist diese Berufsgruppe die mit großem Abstand wichtigste Anlaufstelle für Psychotherapieklienten, die zuerst einen 82 Psychotherapeuten aufsuchen, und erst danach eine ärztliche Zuweisung einholen. Die Zuweisungswahrscheinlichkeit bei Psychiatern und Neurologen, sowie anderen Fachärzten, die als erste Hilfeinstanz aufgesucht wurden, ist tendenziell etwas geringer als bei praktischen Ärzten. Wenngleich andere Fachärzte als Psychiater und Neurologen eher selten von den befragten Klienten als erstes aufgesucht werden, so relativiert dieses Ergebnis dennoch die Bedeutung von Fachärzten dahingehend, da sie in einem sehr hohen Maße zuweisen. Die Zuweisungspraxis zur Therapie durch das medizinische Personal in einem Krankenhaus ist in allen vier Bereichen relativ gleich, und liefert einen Hinweis auf einen längeren, von körperlichen Symptomen bestimmten Leidensweg. Das vorgefundene Ergebnis verweist zum einen auf die zentrale Bedeutung des praktischen Arztes als Steuerungselement im Gesundheitssystem, und liefert zum anderen einen weiteren Hinweis auf den Stellenwert des praktischen Arztes in der Versorgung von Personen mit psychischen Problemen. Grafik 25: Zuweiser zur Psychotherapie in Abhängigkeit von der ersten Hilfsinstanz (p<0,001, C(cor)=0,75) 1. Hilfeinstanz und Zuweiser 8,0% 68,0% 20,0% 4,0% 1.Hilfeinstanz anderer Facharzt 9,9% 4,3% 9,2% 76,6% Psychotherapeut 24,4% 1,2% 4,7% 69,8% Psychiater/Neurologe 80,4% 11,0% 2,5% 6,1% prakt. Arzt 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% Zuweiser prakt. Arzt Psychiater/Neurologe anderer Facharzt Krankenhaus 83 3.2.4 Psychotherapieklienten und Psychopharmaka Psychopharmakotherapie und Psychotherapie können nicht gegen einander aufgerechnet werden, da die Indikationen ihres Einsatzes sehr unterschiedlich sind. Der kombinierte Einsatz der beiden Therapieformen kann aber auch sinnvoll sein. Bei der Mehrheit der Befragten wurde seitens der Mediziner die Einnahme von Medikamenten zur Linderung der Beschwerden als sinnvoll erachtet. 41,3% bekamen kein Medikament verordnet. Im Vergleich zur PGA-Studie ist in der vorliegenden Untersuchung der Anteil der Personen die ein Medikament verordnet bekommen haben um rund 10% niedriger. 115 Olfson et al. konstatieren in einer landesweiten US amerikanischen Studie einen Anteil von 61,5% der Psychotherapieklienten die Psychopharmaka einnehmen.116 Grafik 26: Verordnung von Psychopharmaka (n= 538) Medikamentenverordnung 41,3% 58,7% nein ja Abweichend von der Verordnung durch einen Arzt nehmen allerdings nur 81% der Befragten auch tatsächlich die Medikamente regelmäßig ein. 16,1% nahmen die Medikamente nur teilweise zu sich und 2,9% verzichteten völlig auf die Einnahme. 115 116 vgl. Janout S.54 vgl. Olfson et al. S.1917 84 Grafik 27: tatsächliche Einnahme der verordneten Medikamente (n= 316) Einnahme der verordneten Medikamente nein 2,9% teilw eise 16,1% ja 0,0% 81,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Auf die Frage ob die Klienten das Gefühl hatten, dass das eingenommene Medikament auch hilfreich war, antworteten nur 38,8% mit ja. Der Mehrheit der Klienten brachte die medikamentöse Behandlung nur teilweise oder gar keine Linderung der Beschwerden. Dieses Ergebnis ist insofern interessant da Olfson et al. feststellte, dass sowohl auf Patientenseite als auch auf Seite der Behandler eine medikamentöse Behandlung, die wenig zu einer Besserung der Symptome beträgt oder gar als unzufriedenstellend eingestuft wird, zur Initiierung einer Psychotherapie führen kann.117 Die relative hohe Unzufriedenheit mit der Wirkung der Medikamente könnte demnach einen Einfluss auf die Entscheidung der Inanspruchnahme einer Psychotherapie ausgeübt haben. Grafik 28: Linderung der Beschwerden durch die verschriebenen Medikamente (n=307) Medikament geholfen 15,2% nein teilweise 46,0% ja 0,0% 117 38,8% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% vgl. Olfson et al. S.1917 85 3.3 Barrieren und Hilfen vor der Inanspruchnahme Die Empfehlung zur Inanspruchnahme einer Therapie durch die Primärgruppe und/oder durch professionelle Helfer im Bereich der Gesundheitsberufe erklärt nur zum Teil warum jemand eine bestimmte Therapie beginnt oder unterlässt. Das Wissen über und die Empfehlung zur Therapie scheint zwar Initial für einen Therapiebeginn zu sein, vernachlässigt aber Barrieren und Hindernisse, die einer Therapie im Wege stehen oder die Ausführung erschweren. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Faktoren, wie beispielsweise die Aufgeschlossenheit gegenüber einer Therapie oder die Unterstützung bei eventuellen Hindernissen, die einer Inanspruchnahme förderlich sein können. Gegenstand des nächsten Kapitels ist die Auseinandersetzung mit den Erwartungen an die Therapie, den wahrgenommenen Hindernissen sowie erlebten Hilfen im Vorfeld der Inanspruchnahme. 3.3.1 Die Therapeutensuche Für etwa 30% der Befragten war es sehr oder eher schwierig einen passenden Therapeuten zu finden. Der Mehrheit der Befragten bereitete die Suche allerdings kaum bis keine Probleme, da sie großteils bei der Suche nach einem Psychotherapeuten von der Primärgruppe, den medizinischen Professionen oder von diversen Beratungsstellen unterstützt wurden. Von den rund 31% die hierbei keine Unterstützung erfahren haben, hätten sich 76% eine Unterstützung gewünscht. Für die restlichen 24% war eine Unterstützung durch andere nicht notwendig, da sich die Therapeutensuche problemlos darstellte. Grafik 29: Schwierigkeit einen passenden Psychotherapeuten zu finden (n= 535) Schwiergkeit einen Therapeuten zu finden gar nicht 35,9% 34,2% eher nicht 20,4% eher schon 9,5% sehr 0,0% 86 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Tabelle 6 zeigt durch wen die Klienten bei der Suche nach einem Psychotherapeuten unterstützt wurden. Die Ärzteschaft, im Speziellen die praktischen Ärzte und Psychiater und Neurologen, leisten auch bei der Therapeutensuche einen Großteil der Unterstützung. Auch die Gruppe der Freunde, Bekannten, Angehörigen und Verwandten erfüllt diesbezüglich einen nicht unwichtigen Teil der Informationsarbeit. Tabelle 6: Unterstützung bei der Therapeutensuche Unterstützung durch absolut Prozent Unterstützung durch absolut Prozent praktischer Arzt 108 28,8 Sozialarbeiter 26 6,9 Freunde 73 19,5 OÖ Gebietskrankenkasse 25 6,7 Psychiater/Neurologe 72 19,2 sonstige Fachärzte 24 6,4 Angehörige/Verwandte 54 14,4 Beratungsstelle 24 6,4 Bekannte 53 14,2 Diverse Gesundheitsberufe 19 5,1 Krankenhaus 31 8,3 sonstiges 14 3,7 Partner 29 7,7 Die Bedeutung der anderen Berufsgruppen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich ist eher von geringer Bedeutung in Bezug auf die Nennungen, wenngleich deren Rolle für einen Teil der befragten Klienten nicht zu unterschätzen ist. Auffallend bei den Kategorien Sozialarbeiter und Beratungsstellen ist die durchgängige Beratungs- und Informationstätigkeit, die scheinbar den Bedürfnissen ihrer Klienten gerecht werden. In Bezug auf das quantitative Ausmaß der Unterstützung zeigt sich, dass mit 66,6% zwei Drittel der Befragten einen Unterstützer bei der Therapeutensuche anführten. 30,8% gaben zwei oder drei Unterstützungen an, und die restlichen 2,7% nannten mehr als drei Quellen. Grafik 30: Anzahl der Unterstützungen bei der Suche nach einem Psychotherapeuten (n=374, Mittelwert= 1,5) Anzahl der Unterstützungen bei der Therapeutensuche mehr als 3 2,7% 2 bis 3 30,8% 1 0,0% 66,6% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 87 3.3.2 Erwartungshaltungen an die Behandlung Patienten haben bestimmte Erwartungen und Einstellungen gegenüber verschiedenen Behandlungsansätzen. Diese Erwartungen und Einstellungen können der Inanspruchnahme einer Therapie förderlich sein oder aber einem Therapiebeginn im Wege stehen. Wie in Kapitel 3.2 beschrieben, gibt es diesbezüglich eine Reihe von Faktoren die auf die Erwartungshaltung und die Einstellung zur Therapie Einfluss nehmen. Auch im Falle einer Psychotherapie gibt es eine Reihe von Vorannahmen und Vorerfahrungen seitens der Klienten die auf das Inanspruchnahmeverhalten förderlich oder eher hemmend einwirken können. Die hierzu formulierten Aussagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern beinhalten nur einen bestimmten Teil relevanter Bereiche. Die Auswahl der Bereiche erfolgte unter Einbeziehung der letzten wissenschaftlichen Erkenntnisse, und unter dem Gesichtspunkt möglicher Verbesserungen im Bereich des Zugangs zur Psychotherapie. Die in Tabelle 7 formulierten Aussagen beinhalten drei Dimensionen. Die Trennschärfe dieser drei Dimensionen wurde in einer Faktorenanalyse überprüft, und bestätigte die theoretische Annahme.118 Die erste Dimension bezieht sich auf den erlebten Leidensdruck der sich in körperlichen Symptomen manifestierte. Maßgeblich hierbei sind die erwartete und durch den Arzt erfahrene Behandlung der körperlichen Symptome. Die zweite Dimension misst die Aufgeschlossenheit des Klienten gegenüber einer psychotherapeutischen Behandlung. Die Bedeutung von Medikamenten, die Art der Zuweisung sowie die Erwartungshaltung in Bezug auf die Wirkungsweise einer Therapie sind Teil dieser Dimension. Die dritte Dimension setzt sich mit den Negativerwartungen der Klienten auseinander. Die Einschätzung der zeitlichen Dauer und der Bedrohung durch den Therapeuten sind Bestandteil dieser Dimension. 118 vgl. Anhang 88 Tabelle 7: Erwartungen und Vorstellungen in Bezug auf eine Psychotherapie trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu % n 36,8 27,4 16,7 19,1 100 525 13,2 17,6 20,2 49,0 100 529 Ein wirksames Medikament wäre mir lieber gewesen als eine psychotherapeutische Behandlung. 4,6 6,3 17,8 71,3 100 527 Ich wurde von meinem/r Arzt/Ärztin zur Psychotherapie geschickt und hatte keinerlei Erwartungen und Vorstellungen. 7,8 12,6 17,9 61,7 100 525 61,7 31,2 4,3 2,8 100 532 8,3 18,5 29,6 43,6 100 530 6,4 9,6 24,2 59,8 100 539 Ich hatte die Erwartung, dass Psychotherapie mir helfen könnte bei der Bewältigung meiner körperlichen Beschwerden. Ich hatte schon unzählige Ärzte/innen wegen meiner Beschwerden aufgesucht und keine/r konnte mir helfen. Psychotherapie war meine letzte Hoffnung. Ich glaubte, dass Psychotherapie mir helfen könnte besser mit mir selbst und der Umwelt klar zu kommen. Eine psychotherapeutische Behandlung erschien mir anfangs zu aufwendig und anstrengend. Ich habe befürchtet, dem/r Psychotherapeuten/in weitgehend ausgeliefert zu sein. Der Leidensdruck im Bereich der körperlichen Symptome scheint für die Mehrheit der Befragten eine große Rolle bei der Inanspruchnahme einer Therapie gespielt zu haben. 64,2% der Befragten hatte die Erwartung, ihre körperlichen Symptome mit Hilfe einer Psychotherapie in den Griff zu bekommen. Unter einem relativ hohen Leidensdruck standen dabei speziell jene Personen, die durch Hoffnungslosigkeit und das Scheitern der Symptombehandlung durch die Medizin ihre letzte Hoffnung in einer Psychotherapie sahen. 30,8% hatte einen langen Leidensweg hinter sich, ehe sie eine Therapie in Anspruch genommen haben. Dies kann als ein Hinweis darauf gewertet werden, dass ein Teil der Ärzte die Möglichkeit einer psychotherapeutischen Behandlung oft viel zu lange außer Acht lässt, oder es versäumt den Patienten dahingehend frühzeitig aufzuklären und zu motivieren. Die Aufgeschlossenheit der Klienten in Bezug auf eine Psychotherapie scheint sehr groß zu sein. 92,9% sahen in einer Psychotherapie die Möglichkeit einen Weg zu finden, mit sich selbst und der Umwelt besser klar 89 zu kommen. Dieser hohe Anteil an reflektiertem Problembewusstsein scheint auf ein relativ aufgeschlossenes Klientel hinzuweisen. Wenngleich diese große Aufgeschlossenheit nicht wirklich verwundert, da sich die Befragten bereits einer derartigen Therapie unterzogen haben. Obwohl das Ergebnis dadurch verzerrt sein könnte, lassen sich dennoch einige Hinweise auf die Therapieaufgeschlossenheit finden. Aufschluss geben hierbei die Aussagen zur medikamentösen Behandlung und die Rolle des Arztes im Zuweisungsprozess. Nur 10,9% der Befragten wäre eine medikamentöse Behandlung lieber gewesen, als die Inanspruchnahme einer Therapie. Dieser Teil der Befragten war demnach einer Therapie gegenüber nicht sonderlich aufgeschlossen, und bedurfte wahrscheinlich einer speziellen Motivation durch andere. Noch deutlich zeigt sich die Verschlossenheit eines Teils der Befragten gegenüber einer psychotherapeutischen Behandlung im Hinblick auf die Rolle der Ärzteschaft bei der Zuweisung. 20,4% der Befragten gaben an mehr oder weniger vom Arzt geschickt worden zu sein, und keinerlei Erwartungen an und Vorstellungen über eine Psychotherapie gehabt zu haben. Zum einen deutet dieser Befund auf die Motivationslage der Klienten hin, zum anderen weist er aber auch auf ein Problem im Bereich der ärztlichen Versorgung hin. Auf die Problematik der Motivation zur Inanspruchnahmen einer Therapie weisen auch Schaffenberger et al. hin. Ein Gros der Ärzteschaft ist zwar gegenüber einer Psychotherapie positiv eingestellt. Die Schwierigkeiten liegen laut Angaben der Ärzte in erster Linie darin, die Patienten zu motivieren. Mehr als die Hälfte der Ärzte verweist diesbezüglich auf die eingeschränkten oder nicht vorhandenen Möglichkeiten zur Information der Patienten im Rahmen ihrer Tätigkeit.119 Weiters stellten sie fest, dass ein Großteil der nicht motivierten Klienten unter den von niedergelassenen Ärzten überwiesenen Personen zu finden sind. Auf eigene Initiative gekommene Personen sind in der Regel auch motiviert und haben zudem zu einem höheren Anteil einen Psychotherapiebedarf als überwiesene Personen. Etwa 18% bei denen eine Psychotherapie indiziert war, und die von einem Arzt zugewiesen wurden, erwiesen sich als nicht motiviert. 120 Die Wahrnehmung der Patienten im Bereich der Motivation zur und Information über eine Therapie scheint mit den Aussagen der befragten Klienten überein zu stimmen. Auch Grafik 23 liefert diesbezüglich ein deutliches Bild. 119 120 vgl. Schaffenberger et al. S.25 vgl. Schaffenberger et al. S.33 90 Die dritte Komponente neben persönlichem Leidensdruck und der Aufgeschlossenheit gegenüber der Therapie setzt sich mit den subjektiv wahrgenommenen Hindernissen der Klienten auseinander. Dass eine Psychotherapie nur unter großem persönlichen Einsatz, der mit einem hohen zeitlichen Aufwand und einer gewissen Anstrengung verbunden ist, absolviert werden kann, befürchteten 26,8% der Befragten vor dem Therapieantritt. 16% der Befragten schätzten die Situation einer Therapiesitzung als unangenehm ein, da sie meinten dem Therapeuten weitgehendst ausgeliefert zu sein. Diese geäußerte Befürchtung des Ausgeliefertseins besteht im Wesentlichen in der Annahme des Klienten, dass ein Therapeut aufgrund seines Wissens die Strukturen einer Persönlichkeit erkennt, und er somit als überlegen eingestuft wird. 3.3.3 Die Kosten einer Behandlung Unter den Kosten einer Therapie werden primär die finanziellen Aufwendungen, die vom Patienten oder Klienten zu tragen sind, verstanden. Diese rein pekuniäre Sicht der Kosten vernachlässigt aber die zeitlichen Aufwendungen die mit einer Behandlung verbunden sind - speziell bei eher zeitintensiveren Therapieformen. Neben finanziellen und zeitlichen Einsätzen des Behandelten ergibt sich eine dritte Komponente, die besonders bei gesellschaftlich weniger akzeptierten Therapieformen auf dem sozialen Konto des Therapienutzers zu Buche schlägt. Die Bedeutung dieser drei Kostenfaktoren für das Psychotherapieklientel soll im nächsten Abschnitt näher beleuchtet werden. 3.3.3.1 Die finanziellen Kosten einer Inanspruchnahme Die finanziellen Kosten für die Inanspruchnahme einer Psychotherapie hätten sich bei den Befragten auf null belaufen müssen, da nur Klienten befragt wurden, die eine Psychotherapie als Sachleistung – sprich eine kostenlos Therapie - erhalten haben. Das Ergebnis der Befragung weist allerdings auf eine andere Verteilung hin. Eine mögliche Erklärung für das vorgefundene Ergebnis könnte ein Therapeutenwechsel oder eine erneute Therapie bei einem Psychotherapeuten in einer freien Praxis sein. Da die Klienten ausdrücklich über die letzte Inanspruchnahme einer Psychotherapie befragt wurden, und die Stichprobe aus dem gesamten Verrechnungszeitraum des ersten Halbjahres 2003 ergab, scheint dies eine mögliche Erklärung zu sein. Begriffliche Missverständnisse sind hierbei eher auszuschließen, da die Angaben zur Finanzierungsform und die angeführte Organisationsform des Psychotherapeuten zum Großteil logisch richtig und nachvollziehbar sind. Vorausgesetzt die getätigte Annahme zum Therapeutenwechsel stimmt, könnte man sich die Frage stellen, wa- 91 rum ein Großteil der Befragten zu einer Therapie in eine freie Praxis wechselte und auf eine erneute kostenlose Inanspruchnahme verzichtete. Grafik 31: Art der Therapiefinanzierung durch die OÖ Gebietskrankenkasse (n=534) Therapiefinazierung 23,8% kostenlos bezuschusst 76,2% 76,2% und somit mehr als drei Viertel der Befragten gaben an, eine durch die Gebietskrankenkasse finanziell bezuschusste Psychotherapie in Anspruch genommen zu haben. Etwa ein Viertel der Befragten erhielt eine psychotherapeutische Behandlung als Sachleistung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung. Im Hinblick auf ein eventuelles Kostenhindernis wurden die Klienten danach befragt, ob sie eine Psychotherapie auch dann in Anspruch genommen hätten, wenn sie keine kostenlose oder finanziell bezuschusste Therapie durch die Gebietskrankenkasse erhalten hätten. Für 58% der Klienten hätte eine eigene Übernahme der Therapiekosten keinen Hindernisgrund dargestellt. Für die restlichen 42% wären die finanziellen Aufwendungen ein mehr oder weniger schwerwiegendes Hindernis gewesen eine Psychotherapie erst gar nicht in Anspruch zu nehmen. 24,2% der Klienten gaben diesbezüglich die Kategorie „vielleicht“ an, und 17,2% hätten aufgrund der hohen Kosten gar keine Therapie begonnen. 92 Grafik 32: Kostenhindernis bei Selbstfinanzierung der Therapie (n=524) Kostenhindernis 17,2% nein vielleicht 58,0% 24,8% ja Wenig überraschend scheint die Tatsache, dass vor allem jene Klienten die eine kostenlose Therapie in Anspruch genommen haben, auf die Leistungserbringung durch die Gebietskrankenkasse angewiesen waren oder sich eine Finanzierung der Therapie aus der eigenen Tasche nicht leisten wollten. Die statistische Überprüfung eines Zusammenhangs zwischen einem eventuellen Kostenhindernis und der Art der Therapiefinanzierung dokumentiert dies mit einer großen Sicherheit. Grafik 33: Zusammenhang zwischen Therapiefinanzierung und Kostenhindernis (p<0,001, Phi`= 0,34) Therapiefinanzierung und Kostenhindernis 50,6% Kostenhindernis eventuell Kostenhindernis kein Kostenhindernis 49,4% 32,8% 67,2% 12,7% 87,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0 % kostenlos bezuschusst 93 Für den Großteil der Klienten die eine kostenlose Therapie in Anspruch genommen haben, ist somit die Leistungserbringung durch die Gebietskrankenkasse ein Beitrag zur Beseitigung der finanziellen Barriere bei der Inanspruchnahme einer Therapie. 3.3.3.2 Die zeitlichen Kosten einer Inanspruchnahme Die zeitlichen Ressourcen eines pensionierten und alleinstehenden Mannes sind wahrscheinlich um ein erhebliches größer, als die einer alleinerziehenden und berufstätigen Mutter. Wenngleich es sich hierbei um ein Extrembeispiel handelt, wird deutlich, dass die freie verfügbare Zeit, und somit auch der Freiraum eine Therapie in Anspruch zu nehmen, bei den einzelnen Klienten sehr unterschiedlich erfahren wird. Der zeitliche Aufwand der mit einer Psychotherapie verbunden ist, kann demnach mit anderen Verpflichtungen mehr oder weniger schwer vereinbar sein. Deshalb wurden die Klienten danach befragt, inwieweit die Therapie mit ihren persönlichen Verpflichtungen in Einklang zu bringen war. Die Vereinbarkeit bezog sich dabei auf die Bereiche der Erwerbstätigkeit, der Betreuung von Kindern und sonstigen, nicht näher bestimmten Verpflichtungen. Die Vereinbarkeit der Therapiesitzungen mit der Erwerbstätigkeit stellte nur für einen geringen Teil der Befragten ein Problem dar. 5,2% gaben an, dass es schwierig für sie war Therapie und Arbeit unter einen Hut zu bringen, während 71,4% der Klienten damit kaum bis keine Probleme hatten. Für die restlichen 23,3% stellte sich die Frage der Vereinbarkeit nicht, da sie keiner Erwerbstätigkeit nachgingen. Tabelle 8: Verteilung der zeitlichen Vereinbarkeit mit Beruf, Kinderbetreuung und sonstigen Verpflichtungen (*da nicht erwerbstätig oder keine Kinder zu betreuen) zeitlich Vereinbarkeit der Therapie mit: Erwerbstätigkeit Kinderbetreuung sonstige Verpflichtungen problemlos eher problemlos eher schwer nur schwer Frage irrelevant* 43,9 27,5 5,1 0,2 23,3 100 506 22,6 17,0 3,5 0,9 56,0 100 442 60,5 33,5 5,8 0,2 - 100 532 % n In Bezug auf die Kinderbetreuung zeigte sich ein ähnliches Bild. Vorauszuschicken ist hierbei, dass 56% der Befragten keine oder keine zu betreuenden Kinder hatten. Für rund 40% stellte jedoch die Betreuung der Kinder kein Hindernis für die Inanspruchnahme einer Therapie dar. 94 Ein geringer Teil von 4,4% hatte diesbezüglich allerdings große bis größere Probleme. Die globale Einschätzung zur Vereinbarkeit von Therapie mit sonstigen Verpflichtungen spiegelt im Wesentlichen die Einschätzung zu den Bereichen Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung wider. 6% hatten Schwierigkeiten die Sitzungen beim Therapeuten mit ihren sonstigen Vereinbarungen zu regeln, während dies für 94% der Befragten zu keinen wesentlichen Problemen führte. Da die einzelnen Bereiche und deren Vereinbarkeit mit der Therapie nur Ausschnitte darstellen und kein Gesamtbild liefern, wurde auch überprüft wie die Therapie mit dem gesamten Zeitbudget, sprich der Summe von Verpflichtungen durch Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung und sonstigen Verpflichtungen, zu vereinbaren war. Für rund 5% der Befragten stellte demnach die Inanspruchnahme der Therapie ein extrem großes zeitliches Problem dar. Die zeitlichen Ressourcen waren bei dieser Gruppe durch die Mehrfachbelastung der Kinderbetreuung in Kombination mit der Erwerbstätigkeit äußerst knapp bemessen. Dass dennoch eine Therapie durchgeführt wurde, könnte ein Hinweis auf eine besonders hohe Therapiemotivation sein. Hervorzuheben ist in Bezug auf die zeitliche Komponente aber auch, dass ein Großteil der Psychotherapeuten sich nach den zeitlichen Möglichkeiten ihrer Klienten richtete, und somit eine Therapie ermöglichte. 87,3% der Befragten gaben an, dass die Therapeuten bei der zeitlichen Planung der Therapiesitzungen auf die individuellen Bedürfnisse Rücksicht nahmen. Anzumerken bleibt noch, dass der Anteil von 5% zwar nicht wirklich groß erscheint, sich aber dadurch relativiert, da nur Personen befragt wurden, die auch eine psychotherapeutische Behandlung durchgeführt und nicht bereits auf dem Weg dorthin an diversen Hürden und Barrieren gescheitert sind. 95 Grafik 34: Berücksichtigung von Terminwünschen durch den Therapeuten (n=536) Berücksichtung von Terminwünschen 11,2% 1,5% ja teilweis nein 87,3% 3.3.3.3 Die sozialen Kosten einer Inanspruchnahme Gerade in Bezug auf psychische Beschwerden und Erkrankungen gibt es eine Reihe von Vorurteilen gegenüber den Betroffenen wie auch den Behandelnden und Behandlungsmethoden. Die Thematik der Stigmatisierung von Personen mit psychischen Beschwerden wurde bereits im theoretischen Teil kurz angeschnitten. Wenngleich sich die Problematik der Stigmatisierung im Umfeld von Psychotherapie nicht in dem Ausmaß darstellt wie im Umfeld einer psychiatrischen Behandlung, kann sie dennoch als eine Barriere für die Inanspruchnahme einer Therapie erfahren werden. Unter den sozialen Kosten werden hierbei im Wesentlichen die Stigmatisierung und die persönlichen Folgen für den Stigmatisierten verstanden. Inwieweit die Klienten Ängste vor einer eventuellen Stigmatisierung haben, und welche Bedeutung dieser Thematik im Bereich der Psychotherapie zukommt, zeigt sich in Tabelle 9. Die Verständnislosigkeit der Umwelt gegenüber den Beschwerden und der Symptomatik haben 41,3% der befragten Klienten erfahren. Ein relativ großer Anteil der Befragten wurde demnach, in seinen psychischen Beschwerden von seinen Mitmenschen nicht ernst genommen oder verstanden. Dieses nicht ernst genommen werden zeigt sich auch dahingehend, dass eine Psychotherapie zwar etwas ist, das man unter Umständen in Anspruch nimmt, über das man aber nicht spricht. So hielten es 41,7% der Klienten für besser, wenn niemand aus dem Bekanntenkreis erfährt, dass man zum Psychotherapeuten geht. Wenngleich der Inhalt einer psychotherapeutischen Auseinandersetzung etwas sehr persönliches ist, über das man nicht mit jedermann spricht, so erscheint doch die Tatsa- 96 che, dass man eine Therapie nutzt für den aufgeschlossenen Klienten kein Problem darzustellen. Tabelle 9: Stigmatisierung und Psychotherapie Meine Umwelt verhielt sich gegenüber meinen Beschwerden eher verständnislos. Wenn ich eine Psychotherapie in Anspruch nehme, sollte dies möglichst niemand aus meinem Bekanntenkreis erfahren. Ich habe Angst davor, dass mich andere für verrückt halten, wenn sie wissen, dass ich Psychotherapie in Anspruch genommen habe. An meinem Arbeitsplatz sollte keiner wissen, dass ich eine Psychotherapie gemacht habe, da es sein könnte, dass ich dann meine Arbeit verliere. trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu % n 14,1 27,2 33,8 24,9 100 526 14,9 26,7 31,0 27,4 100 532 9,2 17,9 29,1 43,8 100 532 15,3 13,9 26,6 44,2 100 477 Ein Grund warum man nicht über die Inanspruchnahme einer Psychotherapie spricht, ist nach wie vor die Angst davor, dass man von seinen Mitmenschen für verrückt gehalten werden könnte. 27,1% der Psychotherapienutzer äußerten derartige Befürchtungen. Für 29,2% der Befragten stellte es zudem eine existenzielle Bedrohung dar, wenn publik würde, dass man einen Psychotherapeuten aufgesucht hat, da sie befürchten den Arbeitsplatz zu verlieren. Die Bedenken der Klienten im Hinblick auf die sozialen Folgen, die psychische Beschwerden und in Folge eine psychotherapeutische Behandlung mit sich bringen können, sind nach wie vor ein Problem, dem sich ein nicht unwesentlicher Teil der Personen im Umfeld einer Psychotherapie ausgesetzt sieht. Wenngleich nicht zu vernachlässigen ist, dass ein großer Teil der Befragten diesbezüglich kaum bis keine Bedenken äußerte und somit einen weiteren Hinweis dafür liefert, dass das private wie berufliche Umfeld bei einem Teil der befragten Personen einer Psychotherapie gegenüber eher aufgeschlossen ist. Fasst man die vier Bereiche „Unverständnis“, „Verschwiegenheit“, „für verrückt gehalten werden“ und „Angst vor einem Arbeitsplatzverlust“ zusammen, ergibt sich das Ausmaß der wahrgenommenen Bedrohung der Klienten eventuell durch die soziale Umwelt stigmatisiert zu werden. Für 97 die Mehrheit der Befragten war demnach die Überwindung ihrer diesbezüglichen Ängste eine große Hürde. 60,7% empfanden eine große oder eher große Bedrohung durch mögliche soziale Folgen. Bei 17,5% ist die Angst vor einer Stigmatisierung als eher mittelmäßig einzustufen, während 21,9% diesbezüglich kaum Bedenken äußerten. Grafik 35: Index: Ausmaß der Ängste in Bezug auf eine gesellschaftliche Stigmatisierung (n=470) Ängste vor einer Stigmatisierung 8,9% garnicht 13,0% kaum mitelmäßig 17,5% 27,7% eher groß 33,0% groß 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die sozialen Kosten die Personen im Umfeld einer Psychotherapie zu tragen haben, nach wie vor ein großes Problem darstellen. 3.3.4 Das Angebot Ein schwer erreichbares oder wenig zugängliches Angebot kann zur Selektion im Bereich der Versorgung führen. Qualitätsmerkmale im Bereich der Versorgung sind im Wesentliche die Erreichbarkeit, die Zugänglichkeit und die Bedarfsgerechtheit eines Angebotes. In Bezug auf die Qualität des Angebotes wurden in dieser Untersuchung die Klienten im Hinblick auf die Zugänglichkeit im Bereich der Wartezeiten sowie die geografische Erreichbarkeit des Angebotes befragt. 98 3.3.4.1 Erreichbarkeit der Therapie In Bezug auf die geografische Erreichbarkeit war die zu überwindende Distanz für 78,1% der Klienten objektiv betrachtet im Bereich des zumutbaren. Die Entfernung zwischen Therapieort und Wohnort der Klienten lag bei den meisten Befragten unter 25 Kilometer. 18,2% mussten zwischen 25 und 50 Kilometer zum Therapieort zurücklegen, und nur ein sehr geringer Anteil musste mehr als 50 Kilometer Anreise in Kauf nehmen. Grafik 36: Entfernung des Wohnortes vom Therapieort (n= 538) Enfernung zum Therapieort mehr als 100km 0,6% 50 - 100km 25 - 50km 3,2% 18,2% unter 25km 0,0% 78,1% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Inwieweit die relativ großen Distanzen von mehr als 100 Kilometer zu erklären sind, bleibt allerdings unklar, angesichts des relativ gut gestreuten, wenn auch regional unterschiedlichen Angebotes in Oberösterreich.121 Anmerkend sei noch darauf verwiesen, dass sich in der Untersuchung vor allem Klienten aus dem Zentralraum Linz – Wels – Steyr beteiligt haben, wodurch sich die Verteilung der Entfernungen etwas verzerrt haben könnte. Entsprechend der Verteilung zu den objektiven Distanzen zum Therapieort stellt auch die Erreichbarkeit aus Sicht der Klienten für 92,6% kein wesentliches Problem dar. Eine Distanz von bis zu 50 Kilometer zwischen Wohnort und Therapieort ist demnach zumutbar und keine große Einschränkung in Bezug auf die Erreichbarkeit. 121 vgl. Therapeutenliste der OÖGKK 99 Grafik 37: Problem der geografischen Erreichbarkeit des Therapeuten (n= 537) Problem der Erreichbarkeit 67,6% überhaupt nicht 25,0% eher nicht 6,0% eher seher sehr 1,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 3.3.4.2 Wartezeiten Die Wartezeiten bei der Inanspruchnahme einer Psychotherapie lagen bei 64,1% der Befragten bei zwei Wochen oder weniger. 21,0% mussten eine Wartezeit von drei bis zu vier Wochen in Kauf nehmen, und 8,6% zwischen fünf bis acht Wochen. Bei 6,3% der Klienten wurde eine Wartezeit von mehr als acht Wochen angegeben. Im Durchschnitt mussten die Befragten 3,3 Wochen warten, ehe sie eine Therapie beginnen konnten. Im Vergleich zur PGA-Studie scheinen die hier angeführten Wartzeiten deutlich kürzer zu sein. In der Erhebung des PGA wird eine durchschnittliche Wartezeit von 12 Wochen angeführt. Die Differenz der Mittelwerte würde demnach 8,7 Wochen betragen. 122 Die relativ kurzen Wartezeiten erklären sich Großteils durch den hohen Anteil an Klienten die freie Praxen aufsuchten123, in denen die Wartezeiten erfahrungsgemäß kürzer sind. Die vorgefundene Verteilung ist somit in keiner Weise repräsentativ. 122 123 Janout S.3 vgl. Grafik 40 100 Grafik 38: Wartezeit von der Anmeldung zur Therapie bis zur ersten Therapiesitzung (n= 523, Mittelwert =3,3 Wochen) Wartezeit mehr als 8 Wochen 6,3% 5 bis 8 Wochen 8,6% 3 bis 4 Wochen 21,0% 0 bis 2 Wochen 64,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Klienten beurteilen die Dringlichkeit einer Therapie und somit das Problem der Wartezeiten sehr unterschiedlich. Unter Umständen können auch 2 Wochen Wartezeit für den Klienten ein großes Problem darstellen. Die Betroffenheit durch die psychischen Beschwerden und die Dringlichkeit einer Therapie muss im Einzelfall und in Rücksprache mit dem Psychotherapeuten abgeklärt werden. Grafik 39: Problem der Wartezeit für den Klienten in Abhängigkeit von der Wartezeit (p<0,001, Phi`= 0,60) Problem Wartzeit 60,0% 36% 40,0% 33% 31% 30,0% 20,0% 10,0% 21% 15% 52% 48% 47% 50,0% 42% 27% 20% 14% 5% 2% 6% 0,0% 0 bis 2 Wochen sehr 3 bis 4 Wochen eher schon 5 bis 8 Wochen eher nicht mehr als 8 Wochen überhaupt nicht 101 Wenngleich aus diesem Grund pauschalierte Urteile eher schwer zu treffen sind, so zeigt sich dennoch, dass mit zunehmender Wartezeit der problembehaftete Charakter steigt. Der kritische Punkt in Bezug auf die Wartezeit liegt demnach zwischen der zweiten und dritten Woche, wo der Problemcharakter für die Mehrheit der Befragten überwiegt. Noch deutlicher wird die Problematik zwischen fünf und acht Wochen, wo fast 50% der Befragten die Wartezeit als ein sehr großes Problem beschreiben. 3.4 Inanspruchnahme der Therapie und Therapiebewertung Das befragte Klientel unterscheidet sich auch in Bezug auf die Organisationsform des aufgesuchten Psychotherapeuten. Sucht ein Klient einen Psychotherapeuten auf, der in einer freien Praxis tätig ist, so erhält er von der Gebietskrankenkasse nur einen Teil seiner Ausgaben zurückerstattet. Die Rückerstattung richtet sich dabei allerdings nicht nach den tatsächlichen Kosten der Therapie, sondern erfolgt in pauschalierter Form. Pro Therapieeinheit werden 21,80 € von der Krankenkasse an den Versicherten refundiert. Eine Inanspruchnahmen bei den Vereinen PGA und OÖLP, bei den Instituten der OÖGKK sowie bei Ärzten mit einer psychotherapeutischen Zusatzausbildung erfolgt für den Klienten kostenlos, da diese Leistungen nach dem Prinzip der Sachleistungserbringung direkt mit der Gebietskrankenkasse abgerechnet werden. 3.4.1 Organisationsform der aufgesuchten Praxis 63,1% der Befragten haben demnach einen Teil der Therapie selbst bezahlt, da diese einen Therapeuten in einer freien Praxis aufgesucht haben. Alle übrigen Klienten nahmen eine psychotherapeutische Behandlung kostenlos in Anspruch. Hierbei wurden die Institute der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse mit einem Anteil von 19,4% am häufigsten genannt. 5,3% absolvierten eine Therapie bei einem Psychotherapeuten des Vereins OÖLP, 4,8% suchten diesbezüglich einen Neurologen oder Psychiater auf, und 1,9% der Befragten nützten das Angebot des Vereins PGA. 102 Grafik 40: Organisationsform des aufgesuchten Psychotherapeuten (n= 526) Organisationsform des Psychotherapeuten 4,0% Sonstiges prakt. Arzt 1,5% PGA 1,9% Psychiater/Neurologe 4,8% OÖLP 5,3% OÖGKK 19,4% 63,1% freie Praxis 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 1,5% gaben an eine Therapie bei einem praktischen Arzt gemacht zu haben und 4,0% nannten sonstige Einrichtungen die zwar eine kostenlose Therapie anbieten, allerdings nicht im Katalog der Sachleistungserbringer der Gebietskrankenkasse enthalten sind. Die Befragten führten in der Kategorie „Sonstiges“ die Angebote von pro mente, der Studentenberatung oder dem Verein Exit an. Wenngleich diese Verteilung nicht den wahren Anteilen in der Grundgesamtheit entspricht, so stellt sich dennoch die Frage weshalb ein Gros der befragten Klienten von einer kostenlosen zu einer bezuschussten Form der Therapie gewechselt hat. Diese Frage stellte sich deshalb, da in der Stichprobe lediglich jene Klienten erfasst waren, die im ersten Halbjahr 2003 eine kostenlose Therapie in Anspruch genommen haben, bei der Frage nach der Organisationsform ihrer letzten in Anspruch genommen Therapie aber die Kategorie „freie Praxis“ angaben. 3.4.2 Anzahl der absolvierten Therapieeinheiten Die Angaben zur Anzahl der absolvierten Therapieeinheiten sind auch hier im Vergleich zur Stichprobe um ein Deutliches höher als erwartet. Deshalb liegt der Schluss nahe, dass die Befragten diese Frage nicht auf die letzte Inanspruchnahme einer Therapie bezogen haben, sondern diese Werte vielmehr die Summe aller in Anspruch genommenen Therapien darstellen. 27,3% der Befragten gaben an zwischen 11 und 30 Therapieeinheiten absolviert zu haben. Mit einem Anteil von 26,9% in etwa gleich viele Befragte nannten ein Therapieausmaß von bis zu 10 Einheiten. 103 Rund ein Viertel der Klienten gab eine Therapiedauer von mehr als 60 Einheiten, und 21,4% führten diesbezüglich 31 bis 60 Einheiten an. Grafik 41: Anzahl der in Anspruch genommenen Therapieeinheiten (n=532) Anzahl der Therapieeinheiten 24,4% mehr als 60 Einheiten 21,4% 31 bis 60 Einheiten 27,3% 11 bis 30 Einheiten 26,9% bis 10 Einheiten 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Das quantitativ relative hohe Ausmaß an Therapie könnte zum einen auf einen großen Bedarf des befragten Klientels hinweisen, zum anderen aber durch einen oder mehrere Therapeutenwechsel bedingt sein. Ein Teil der Klienten führt im Fragebogen an, dass sie auf der Suche nach einem passenden Therapeuten eine Vielzahl von Therapien begonnen haben, diese aber wieder abgebrochen haben, da das therapeutische Beziehungsgefüge für sie nicht stimmig war. 3.4.3 Bewertung der Zufriedenheit mit der Therapie Die Zufriedenheit mit der Psychotherapie wurde anhand von vier Indikatoren gemessen. Diese Indikatoren beziehen sich auf eine eventuelle Wiederinanspruchnahme einer Therapie, die Weiterempfehlung an Freunde, die Zufriedenheit mit dem Psychotherapeuten sowie die Beurteilung des Erfolges einer derartigen Maßnahme. 3.4.3.1 Wiederaufsuchen einer Therapie Die überragende Mehrheit von 93,9% der befragten Personen würde erneut eine Psychotherapie aufsuchen, wenn sie wieder einmal therapeutische Hilfe benötigen würden. Für 6,1% der Klienten käme die Erwägung einer erneuten Inanspruchnahme nicht in Frage. 104 Grafik 42: Wiederaufsuchen einer Therapie bei Bedarf (n=538) Wiederaufsuchen einer Therapie 6,1% ja nein 93,9% Dieser hohe Anteil in Bezug auf ein Wiederaufsuchen einer Psychotherapie kann als ein erster Hinweis auf die große Zufriedenheit der Klienten gewertet werden. Vergleicht man diese hohe Bereitschaft der Klienten zur erneuten Inanspruchnahme einer Therapie mit den Erwartungen und den Einstellungen vor dem Therapiebeginn124 so liefert dies einen Hinweis darauf, dass sich die Motivationslage bei einem Teil der Befragten im Laufe der Therapie deutlich geändert hat. Fehlende Therapiemotivation seitens der Klienten wird demnach im Laufe der Therapie kompensiert oder ändert sich. 3.4.3.2 Empfehlung an Freunde Die Frage ob man eine Psychotherapie als Behandlungsmethode im Freundeskreis weiterempfehlen würde, wurde von 96,3% der Klienten bejaht. Die Bereitschaft Freunden eine Therapie zu empfehlen, ist somit etwas größer, als die eigene Neigung erneut eine Therapie in Anspruch zu nehmen. Unterschiede zwischen dem beabsichtigten eigenen Verhalten und der Verhaltensempfehlung an andere zeigen sich auch in anderen Untersuchungen zum Krankheitsverhalten, wenngleich die hier vorgefundenen Unterschiede vergleichsweise gering sind. 124 vgl. Tabelle 7 105 Grafik 43: Weiterempfehlung einer Therapie an Freunde (n= 536) Weiterempfehlung an Freunde 3,7% ja nein 96,3% 3.4.3.3 Zufriedenheit mit dem Therapeuten Ihre große Anerkennung sprechen die befragten Personen auch in Bezug auf die Zufriedenheit mit den Psychotherapeuten aus. Die Arbeit der Therapeuten trägt ihren Teil dazu bei, dass die Klienten mit der psychotherapeutischen Behandlung en gros zufrieden sind. 92,9% der Befragten äußerten ihre Zufriedenheit mit dem aufgesuchten Therapeuten. Nur 7,1% der Befragten waren eher nicht bis gar nicht zufrieden mit ihrem Therapeuten. Grafik 44: Zufriedenheit der Klienten mit dem Psychotherapeuten (n= 353) Zufriedenheit mit dem Therapeuten gar nicht zufrieden 1,7% eher nicht zufrieden 5,4% 25,4% eher zufrieden sehr zufrienden 0,0% 106 67,5% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 3.4.3.4 Erfolg der Therapie Auch die Einschätzung des Erfolges der Therapie spiegelt im Wesentlichen die Zufriedenheit der befragten Klienten wider, wenngleich die Beurteilung diesbezüglich etwas differenzierter gemessen wurde, und die Einschätzung auch dementsprechend kritischer ausfällt. Dennoch bewerten 92% der Befragten die Wirkung der Therapie als voll bis mittelmäßig erfolgreich. Grafik 45: subjektive Beurteilung des Erfolges der Psychotherapie (n= 534) Erfolg der Psychotherapie kaum bis nicht erfolgreich eher weniger erfolgreich 3,2% 4,9% mittelmäßg erfolgreich 19,9% großteils erfolgreich 47,8% voll erfolgreich 0,0% 24,3% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Etwa ein Viertel der Befragten beurteilten die Therapie in vollem Umfang als erfolgreich und 47,8% äußerten diesbezüglich einen Therapieerfolg zu größten Teilen. Etwa ein Fünftel sieht zwar auch einen Erfolg in der Therapie, bewertet diesen allerdings als mittelmäßig. 8,1% der befragten Personen sahen demnach eher weniger bis kaum einen Erfolg. 3.4.3.5 Gesamtzufriedenheit Der Index der Gesamtzufriedenheit ergibt sich aus der Bewertung der vier Zufriedenheitsindikatoren, und liefert somit ein Kriterium zur Gesamtbeurteilung. Der Index beruht auf einer Dichotomisierung der einzelnen Variablen in Positiv- und Negativwerte und einer anschließenden Summenbildung. Eine Zuordnung zur linken Hälfte der Skala führt somit zu einem positiven Wert, während die rechte Hälfte der Skala zum Negativwert wird. Bei der fünfstufigen Einschätzung des Erfolges der Therapie wurde der mittlere Wert der Skala dem positiven Wertebereich zugeordnet. 88,6% können demnach als sehr zufriedene Klienten bezeichnet werden. 4,7% weisen eine als gut zu bewertende Gesamtzufriedenheit 107 auf und 2,6% eine eher mittelmäßige Zufriedenheit. Bei 4,3% der Befragten herrschte mehr oder weniger große Unzufriedenheit in Bezug auf die in Anspruch genommene Therapie. Grafik 46: Index der Gesamtzufriedenheit mit der Therapie (n=530) Gesamtzufriedenheit mit der Therapie gar nicht 1,7% eher nicht 2,6% mittelmäßig 2,6% eher 4,7% sehr 0,0% 88,3% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 3.5 Die Wirkung von Barrieren Die bisherigen Ergebnisse der Untersuchung zeigten, dass die Inanspruchnahme von Psychotherapie nach wie vor mit bestimmten sozialen aber auch institutionellen Barrieren behaftet ist. Im Sinne einer gerechten Versorgung sollten diese vorhandenen Barrieren jedoch unabhängig vom sozialen Status und der geografischen Lage der Versicherten erfahren werden. Aus diesem Grund wurde zum einen überprüft, ob es Zusammenhänge zwischen dem sozialen Status der Versicherten und den einzelnen Hemmnisfaktoren gibt. Zum anderen wurde das befragte Klientel dahingehend untersucht, ob das Ausmaß der Barrieren, sprich die Summen aller Barrieren die einer Inanspruchnahme im Wege stehen können, in Beziehung mit der sozialen Position der Klienten steht. Ein Fehlen von derartigen signifikanten Zusammenhängen würde demnach bedeuten, dass das Angebot der Gebietskrankenkasse zur Psychotherapie im Sinne einer gerechten Versorgung wirksam ist. 108 Die in der Analyse berücksichtigten Barrieren setzen sich aus fünf Problembereichen zusammen. 1. Leidensweg der Klienten: - der Beginn einer Therapie aufgrund von Hoffungslosigkeit, da die Symptome lange erfolglos medizinisch behandelt wurden - eine lange erfolglose Behandlung durch den praktischen Arzt - das erlebte Unverständnis der sozialen Umwelt gegenüber den Beschwerden. 2. Zeitliche Vereinbarkeit der Therapie: - Vereinbarkeit mit der Erwerbstätigkeit - Vereinbarkeit mit der Kinderbetreuung - Vereinbarkeit mit sonstigen Verpflichtungen - die Bereitschaft der Therapeuten auf die Terminwünsche ihrer Klienten einzugehen 3. Soziale Kosten einer gesellschaftlichen Stigmatisierung: - die Angst für verrückt gehalten zu werden - die Angst den Arbeitsplatz zu verlieren - die Geheimhaltung einer beanspruchten Therapie vor dem sozialen Umfeld 4. Geografische Erreichbarkeit: - objektive geografische Entfernung zum Therapieort - subjektives Problem der geografischen Erreichbarkeit 5. Institutionelle Barrieren: - Dauer der Wartezeit - empfundene Problematik der Wartezeit - das Problem eines Kostenhindernisses bei fehlender Finanzierung durch die Gebietskrankenkasse (Wenngleich das Kostenhindernis in diesem Falle ein rein hypothetisches bleibt, so gibt es dennoch Aufschluss darüber, ob dieses Angebot die finanzielle Hürde der Inanspruchnahme einer Psychotherapie bei bestimmten Gruppen beseitigt.) 3.5.1 Der Leidensweg unter soziodemografischen Gesichtspunkten Eine lange Verweildauer im Bereich der medizinischen Professionen, die von Erfolglosigkeit der Symptombehandlung gekennzeichnet ist, steht im Wesentlichen in einem Zusammenhang mit dem Alter und dem Bildungsgrad der Klienten. Der deutlichste Zusammenhang in Bezug auf den Bildungsgrad zeigt sich bei Klienten mit Hauptschulabschluss und Klienten 109 mit Hochschulabschluss. Während Klienten mit Hauptschulabschluss eher lange medizinisch behandelt werden, werden Akademiker eher schneller zur Therapie überwiesen. Außerdem zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man eher zu spät als rechtzeitig zur Psychotherapie überwiesen wird, mit zunehmenden Alter der Klienten steigt. Je älter die Klienten waren, desto mehr trat die medizinische Behandlung in den Vordergrund, während psychische Beschwerden scheinbar eher vernachlässigt oder lange Zeit ausgeschlossen wurden. Grafik 47: Dauer der medizinischen Behandlung in Abhängigkeit vom Alter der Klienten ( p< 0,05, Phi´=0,15) Alter und Dauer der med. Behandlung 53,3% 46,7% über 60 51 bis 60 42,7% 57,4% 71,5% 28,5% 41 bis 50 31 bis 40 31,2% 68,8% 21 bis 30 23,2% 76,8% bis 20 21,9% 78,1% 0% 20% 40% lange med. Behandlung 60% 80% 100% kurze oder keine med. Behandlung In weiterer Folge sind es vor allem Pensionisten und Klienten die einen Antrag auf Berufsunfähigkeitspension gestellt haben oder arbeitslos sind, deren Weg zur Psychotherapie von Hoffnungslosigkeit und dem Versagen der Medizin gekennzeichnet ist. Auch bei un- oder angelernten Arbeitern stellt eine lange erfolglose medizinische Therapie einen erheblichen Leidensweg dar. Die gesundheitliche Ungleichheit, die sich in einer ungleich langen medizinischen Behandlungsdauer zeigt, und die in einem Zusammenhang mit dem Bildungsstatus und dem Lebensstatus der Klienten steht, spiegelt sich auch in schlüssiger Weise in Bezug auf das Einkommen der Klienten wider. Im Bereich der primärärztlichen Versorgung präsentiert sich im Wesentlichen das gleiche Bild. Weiters zeigte sich, dass die lange Verweildauer im medizinischen System in bedeutendem Maße durch die praktischen Ärzte beeinflusst und gesteuert wird. 110 Nicht nur im Bereich der Medizin sondern auch im sozialen Umfeld wächst das Unverständnis gegenüber den Beschwerden mit zunehmenden Alter der Klienten. Die körperliche Komponente im Gesundheitsverständnis scheint mit zunehmenden Alter die Oberhand zu gewinnen, während psychische Aspekte von Gesundheit bei älteren Klienten eher vernachlässigt werden. Grafik 48: Verständnislosigkeit der Umwelt in Abhängigkeit vom Alter der Klienten (p<0,05, punktbiserales r = -0,11) Alter und Verständnislosigkeit der Umwelt über 60 47,1% 52,9% 51 bis 60 55,7% 44,3% 41 bis 50 31 bis 40 0% 61,3% 38,7% 21 bis 30 bis 20 53,2% 46,8% 64,9% 35,1% 31,2% 10% 20% 68,8% 30% 40% 50% verständnislos 60% 70% 80% 90% 100% verständnisvoll Angesichts einer immer älter werdenden Bevölkerung scheint es aber zusehends wichtiger zu werden die Sichtweisen in Bezug auf ältere Menschen in Kontext zur Gesundheit zu fördern, die einem ganzheitlichen Konzept von Gesundheit entsprechen. 3.5.2 Unterschiede in der zeitlichen Vereinbarkeit Inwieweit eine Therapie mit dem zeitlichen Budget vereinbar ist, wird bei den befragten Klienten im Wesentlichen durch die berufliche Position, den Lebensstatus und den Bildungsstatus der Befragten bestimmt. Generell ist es für erwerbstätige Klienten am schwierigsten die Therapiesitzungen zeitlich zu vereinbaren. Klienten die bereits die Pension angetreten hatten, oder arbeitslos waren, hatten kaum Probleme in Bezug auf die zeitliche Vereinbarkeit. Mit zunehmenden Alter der Befragten wird auch das Problem der zeitlichen Vereinbarkeit ein Geringeres, was zum 111 Großteil auf den Lebensstatus zurückzuführen ist. Klienten die sich zum Therapiezeitpunkt in Karenz oder in Ausbildung befanden, hatten teilweise größere Schwierigkeiten die Therapiesitzungen zeitlich mit ihren Verpflichtungen zu vereinbaren. Im Hinblick auf die berufliche Position ist festzustellen, dass nichtleitende Angestellte in allen Bereichen größere Schwierigkeiten hatten, die Therapie mit ihren Verpflichtungen zeitlich in Einklang zu bringen, während un- und angelernte Arbeiter, sowie Personen, die einen Antrag auf Berufsunfähigkeitspension gestellt hatten, damit eher weniger Probleme hatten. Auffällige Unterschiede zeigten sich auch hinsichtlich des Bildungsstatus. Pflicht- und Hauptschulabsolventen sowie Personen mit einem Lehrabschluss äußerten in Bezug auf die zeitlichen Kosten weniger Probleme als Personen mit Matura oder Universitätsabschluss. Im Vergleich zwischen den Geschlechtern haben Frauen in Bezug auf die zeitliche Vereinbarkeit weniger Probleme als Männer, wenngleich sich ein signifikanter Zusammenhang nur bei den sonstigen Verpflichtungen zeigte. 3.5.3 Soziale Kosten und sozialer Status Das Geschlecht der Klienten steht in einem Zusammenhang mit den geäußerten Ängsten vor gesellschaftlicher Stigmatisierung bei der Inanspruchnahme einer Psychotherapie. Männer haben diesbezügliche viel größere Bedenken, dass sie von ihrem Umfeld für verrückt gehalten werden könnten, wenn sie einen Psychotherapeuten aufsuchen, während Frauen mit einer psychotherapeutischen Behandlung offener umgehen, und entsprechend weniger Ängste äußern. Grafik 49: Angst für verrückt gehalten zu werden in Abhängigkeit vom Geschlecht (p<0,01, Phi= 0,12) Angst für verrückt gehalten zu werden in Abhängigkeit vom Geschlecht Männer 37,6% Frauen 0% 62,4% 24,2% 75,8% 20% 40% 60% ja 112 nein 80% 100% In Bezug auf den Lebensstatus zeigt sich, dass die Gruppe der Erwerbstätigen es im engeren sozialen Umfeld eher bevorzugt über die in Anspruch genommene Psychotherapie zu schweigen. Auch mit zunehmenden Einkommen sinkt die Bereitschaft der Klienten über die eigene psychotherapeutische Behandlung im Bekanntenkreis zu sprechen. Personen die hingegen einen Antrag auf Berufsunfähigkeitspension gestellt haben, äußerten diesbezüglich geringere Bedenken. Wenngleich es im Hinblick auf den Bildungsstatus keine konsistenten Zusammenhänge gibt, deuten diese Befunde darauf hin, dass Personen die im Erwerbsleben stehen und ein eher hohes Einkommen aufweisen, aufgrund ihrer gesellschaftlichen Rolle eher Angst vor einer Diskreditierung durch das soziale Umfeld haben, als jene Personen, die durch ihren gesundheitlichen Status nicht mehr am Erwerbsleben teilnehmen können oder aus der Erwerbsrolle ausgeschieden sind. Auch die berufliche Position der befragten Klienten gibt teilweise Aufschluss darüber, wie mit dieser Thematik umgegangen wird. Signifikante Zusammenhänge zeigen sich hierbei vor allem bei un- und angelernten Arbeitern, die tendenziell die größten Bedenken äußern. Sie befürchten dass sie bei bekannt werden den Arbeitsplatz verlieren könnten. Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppen und dem Bildungsgrad der Klienten konnten nicht festgestellt werden. 3.5.4 Geografische Erreichbarkeit und Wohnbezirk Die geografische Entfernung vom Wohnort zum Therapieort ist speziell in Linz und in den Bezirken Linz Land, Urfahr-Umgebung und SteyrUmgebung für die Klienten am geringsten, und stellt dementsprechend auch kaum bis kein Problem in Bezug auf die Erreichbarkeit für die Klienten dar. Die befragten Klienten in den Bezirken Freistadt, Ried, Perg sowie Grieskirchen legten im Vergleich zu den Klienten aus anderen Bezirken deutlich größere Distanzen zurück. Speziell bei den Klienten aus Freistadt und Grieskirchen stellte die Entfernung auch das größte Problem dar. Einen Sonderfall stellt der Bezirk Braunau dar, da keine signifikant längeren Wege in Kauf genommen werden musste, die Klienten jedoch die Entfernung als eher problematisch einstuften. In den übrigen Bezirken gibt es keine größeren Unterschiede in Bezug auf die Entfernung und die Erreichbarkeit der Therapie. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass die regionale Verteilung des Angebotes mit Ausnahme von Freistadt und Grieskirchen den befragten Klienten entspricht, und somit auch kaum ein Hindernis darstellt. 113 Tabelle 10: Unterschiede zwischen den Wohnbezirken (Korrkoeff.: punktbiserales r *p<0,5, **p<0,1, ***p<0,01) L LL UU WE FR PE EF GR WL -0,0159 Wartezeit 0,1854*** -0,0083 0,0709 0,0494 -0,0218 0,1079* 0,0023 -0,0342 Entfernung -0,1953*** -0,1170* -0,0291 -0,0046 0,1382** 0,0958* -0,4590 0,1650*** -0,0042 Problem Entf. 0,1866*** -0,0378 -0,0049 0,0245 -0,0982* -0,0839 0,0588 -0,1170* -0,0192 -0,0389 -0,1044* 0,0570 0,0113 0,0420 0,0311 0,0621 0,0485 SR SE RI BR VB GM KI RO SD Wartezeit -0,0341 -0,0577 -0,0411 -0,0345 -0,0872 -0,0722 -0,0336 -0,0289 -0,0377 Entfernung -0,0328 -0,1640*** 0,0916* 0,0759 -0,0756 0,0498 0,0565 0,0425 0,0677 Problem Entf. 0,0649 -0,0881 -0,0234 -0,1082* 0,0784 0,0166 -0,0349 0,0240 -0,1060* Problem Wartezeit 0,0590 0,0004 -0,0178 -0,1054* 0,0137 0,0732 0,0397 0,0311 -0,0031 Problem Wartezeit -0,0470 3.5.5 Wartezeit und Kostenhindernis Im regionalen Vergleich zeigen sich in Bezug auf die Dauer der Wartezeiten bis auf zwei Ausnahmen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Bezirken. Die Barriere der Wartezeit wurde demnach von dem untersuchten Klientel in einem regional sehr ausgewogenen Verhältnis erfahren. Die großen Ausnahmen bei den Wartezeiten betreffen jedoch Klienten aus dem Raum Linz und dem Bezirk Perg. Hier mussten die Befragten mit den längsten Wartezeiten rechnen. Anzumerken bleibt aber, dass die Dauer der Wartezeit bei den befragten Klienten aus dem Raum Linz und dem Bezirk Perg nicht gerade dazu führt, dass die Wartezeiten als problembehaftet eingestuft werden. Einen Sonderfall stellt der Bezirk Braunau dar, in dem zwar keine signifikant längere Wartezeit in Kauf genommen werden musst, die Klienten aber die Wartezeit deutlich problematisch einschätzten. Hinweise auf das Problem der Wartezeiten liefern eher das Alter der Klienten und eine etwaige Antragstellung auf Berufsunfähigkeitpension. Signifikante Zusammenhänge bei der Dauer und dem empfundenen Problemcharakter der Wartezeit zeigen sich bei Klienten, die einen Antrag auf Berufsunfähigkeitspension gestellt haben. Diese spezielle Gruppe erfährt relativ längere Wartezeiten als andere Klienten, und nimmt die Dauer der Wartezeiten auch als dementsprechend problematisch wahr. 114 Grafik 50: Wartezeit in Abhängigkeit von einer Antragstellung auf Berufsunfähigkeitspension ( p< 0,01, punktbiserales r= - 0,16) Wartezeit und Antragstellung auf Berufsunfähigkeit 80,0% 66,7% 70,0% 60,0% 50,0% 47,1% 40,0% 26,5% 30,0% 19,9% 20,0% 10,0% 13,2% 8,0% 13,2% 5,4% 0,0% 0 bis 2 Wochen 3 bis 4 Wochen Antrag auf Berufsunfähigkeitspension 5 bis 8 Wochen mehr als 8 Wochen kein Antrag auf Berufsunfähigkeitspension Auch Facharbeiter und Pensionisten stuften das Problem der Wartezeiten signifikant problembehafteter ein. Mit zunehmendem Alter wird die Barriere der Wartezeit zusehends prekärer eingeschätzt. Da jedoch gerade ältere Klienten einen relativ langen Leidensweg hinter sich haben, beruht die empfundene Dringlichkeit einer Therapie zum Teil auch auf der Hoffungslosigkeit und der Verzweiflung aufgrund fehlgeschlagener medizinischer Behandlungen und nicht nur auf der Dauer der Wartezeit. Ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Höhe des Einkommens und der Länge der Wartzeit, sowie dem subjektiv empfundenen Problem der Wartezeit lässt sich im wesentlichen auf Unterschiede zwischen freien und institutionellen Praxen zurückführen. Die Höhe des Einkommens stellt einen wesentlichen Parameter bei der Entscheidung für eine bestimmte Art der Leistungserbringung dar. Das Angebot zur kostenlosen oder bezuschussten Therapie ermöglicht es gerade einkommensschwächeren Klienten eine Therapie in Anspruch zu nehmen. Der Zusammenhang zwischen Kostenhindernis und dem Einkommen der Klienten erwies sich als hoch signifikant und dementsprechend stark. Speziell Klienten die einer un- oder angelernten Tätigkeit nachgingen, oder aufgrund einer Berufsunfähigkeit pensioniert wurden oder einen Antrag auf Berufsunfähigkeitspension gestellt hatten, waren auf dieses Angebot angewiesen, und hätten ohne die Leistungen der Gebietskrankenkasse keine Therapie in Anspruch genommen. Für die übrigen Klienten hätte die Selbstfinanzierung der Therapie kaum bis keine Barriere für die Inanspruchnahme dargestellt. 115 3.5.6 Ausmaß der Barrieren Nachdem die unterschiedliche Wirkung der einzelnen Barrieren näher beleuchtet wurde, stellt sich die Frage nach der Anzahl oder dem Ausmaß dieser Hindernisse und eventuellen Unterschieden im Hinblick auf soziodemografische Merkmale der befragten Klienten. Um die erhobenen Daten sinnvoll vergleichen zu können, wurde ein Index zum Ausmaß der Barrieren gebildet. Dieser Index setzt sich aus den Variablen der fünf relevanten Barrierenbereiche, die unter Punkt 2.5.2 im theoretischen Teil dieser Arbeit näher erläutert wurden, zusammen. Sofern die Variablen nicht dichotom erfasst wurden, erfolgte vor der Summenbildung eine Dichotomisierung der Barrierevariablen in problembehaftete und problemlose Ausprägungen. In Bezug auf die Wartezeit wurde die Grenze zwischen problemloser und problembehafteter Ausprägung bei der 4. Woche gezogen, da ab dieser Dauer der Problemcharakter für die Klienten überwiegt.125 Die theoretische Annahme die dieser Indexbildung zur Grunde liegt, besteht darin, dass mit einer zunehmenden Anzahl an Barrieren die Schwierigkeit eine Psychotherapie in Anspruch zu nehmen wächst. Der Summenwert der Variablen der Barrierenbereiche Leidensweg, der geografischen Erreichbarkeit, der zeitlichen Vereinbarkeit, den Wartezeiten sowie den sozialen und finanziellen Kosten stellt einen brauchbaren Indikator für das Ausmaß der erlebten Schwierigkeiten vor der Inanspruchnahme dar. Anzumerken bleibt, dass diese Indexbildung auf der quantitativen Erfassung der Barrieren beruht und nicht die individuelle Gewichtung der einzelnen Faktoren berücksichtigt. 125 vgl. Grafik 39 116 Grafik 51: Index des Ausmaßes der Barrieren (n=238, Mittelwert = 3,4 Barrieren) Ausmaß der Barrieren sehr groß 10,5% 50,8% eher groß 31,1% eher gering keine 0,0% 7,6% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Die Verteilung zum Ausmaß der Barrieren zeigt, dass einer psychotherapeutischen Behandlung bei 7,6% der Befragten keinerlei Hindernisse im Weg standen. Bei dieser Gruppe der befragten Klienten kann man daher eher vom Idealfall als vom Regelfall sprechen. Für 31,1% war die Inanspruchnahme der Therapie mit einer oder zwei Barrieren verbunden, weshalb das Ausmaß als eher gering eingestuft werden kann. Einem verhältnismäßig eher großem Ausmaß an Barrieren, dass zwischen drei bis sechs erlebten hinderlichen Faktoren liegt, waren 50,8% der Befragten ausgesetzt. Letztendlich mussten 10,5% der Befragten sieben bis zehn verschiedene Hindernisse überwinden, ehe sie eine Psychotherapie aufsuchen konnten. Das Ausmaß der Barrieren kann demnach bei dieser Gruppe der Befragten als sehr groß eingestuft werden. 3.5.7 Unterschiede im Ausmaß der Barrieren Wie Grafik 51 zeigt, erlebten die Klienten ein sehr unterschiedliches Ausmaß an Hindernissen auf dem Weg zum Psychotherapeuten. Auch die Ausführungen zu den Zusammenhängen zwischen den einzelnen Barrieren und dem sozialen Status der befragten Klienten verweisen auf sozial ungleich verteilte Barrieren im Zugang zur Therapie. Dass diese sozialen Ungleichheiten auch in Bezug auf das Ausmaß der Barrieren bestehen, konnte anhand der Daten bestätigt werden. Der Lebensstatus sowie die berufliche Position der befragten Klienten erklären zum Teil die vorgefundenen Unterschiede. Personen die einen Antrag auf Berufsunfähigkeit gestellt hatten, mussten signifikant mehr Barrieren überwin- 117 den als andere Klienten. Im Hinblick auf die berufliche Position erlebten Klienten die einer un- oder angelernten Tätigkeit nachgehen die meisten Hürden. Zwischen männlichen Klienten und weiblichen Klienten bestehen diesbezüglich keine signifikanten Unterschiede. Die Forschungshypothese, dass die Barrieren die Klienten bei der Inanspruchnahme einer Psychotherapie im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung behindern, unabhängig vom sozialen Status der Versicherten wirken, ist aufgrund der vorgefundenen Ergebnisse nicht haltbar. In Bezug auf die Barrieren zeichnete sich ein klares Ungleichgewicht zu Lasten von sozial benachteiligten Klienten ab. 3.6 Unterschiede zwischen freien Praxen und institutionellen Praxen Im Hinblick auf die Zugänglichkeit des psychotherapeutischen Angebotes zeigte sich, dass es Unterschiede in Bezug auf den sozialen Status der Klienten gibt. Diese Unterschiede erklären aber nur zum Teil die vorgefundenen Ungleichheiten. Die von den Klienten aufgesuchte Organisationsform der psychotherapeutischen Praxis gibt ebenfalls Aufschluss über den Zugang zur psychotherapeutischen Behandlung. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen der Inanspruchnahme einer Psychotherapie in einer freien Praxis, bei der die Klienten einen Teil der Therapiekosten selbst zu tragen haben, und dem Angebot einer kostenlosen Therapie, die durch die verschiedenen Institutionen - die Vereine PGA oder OÖLP, das Institut der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse, praktische Ärzte mit einer psychotherapeutischen Zusatzausbildung sowie Psychiater oder Neurologen - erbracht wird. Diese Unterschiede in der Organisationsform beziehen sich im Wesentlichen auf Klientenmerkmale sowie auf die Barrieren im Bereich des Zugangs. 3.6.1 Unterschiede im Klientel Die Entscheidung der Klienten eine institutionelle psychotherapeutische Praxis aufzusuchen, wird zum einen durch das zur Verfügung stehende Einkommen beeinflusst und ist zum anderen auch vom Alter der Klienten abhängig. Je geringer das Einkommen der Klienten, desto eher wird eine institutionelle Praxis, die eine kostenlose Therapie anbietet, aufgesucht. Dementsprechend suchen Klienten mit höherem Einkommen eher eine freie Praxis auf und tragen einen Teil der Therapiekosten selbst. Die Ausnahme hierbei stellt die Kategorie bis 350,-- € dar. Trotz eines sehr geringen Einkommens wären für einen relativ hohen Anteil in dieser Kategorie eventuelle Kosten einer Therapie kein Hindernis gewesen. Dieser 118 scheinbare Widerspruch erklärt sich zum einen durch das Alter und zum anderen durch den Bildungsstatus der Klienten. Die Mehrheit der Befragten in dieser Einkommensgruppe befindet sich noch in Ausbildung und ist nicht älter als 30 Jahre. Die Bereitschaft die Kosten einer Psychotherapie auch bei einem geringen Einkommen zu tragen, ist demnach bei jungen und besser gebildeten Personen ungleich größer als in den anderen Einkommenskategorien und Altersklassen. Grafik 52: Kostenhindernis in Abhängigkeit vom Einkommen (p<0,05, Phi= 0,19) Kostenhindernis und Einkommen mehr als 2100 € 70,4% 29,6% 1751 bis 2100 € 1401 bis 1750 € 64,4% 35,6% 701 bis 1050 € 52,6% 47,4% 43,5% 56,5% 351 bis 700 € 0% 55,8% 44,2% 1051 bis 1400 € bis 350 € 62,5% 37,5% 31,0% 10% 20% 69,0% 30% 40% 50% ja nein 60% 70% 80% 90% 100% Außerdem gibt es deutliche Unterschiede in den Organisationsformen in Bezug auf die Altersstruktur des Klientels. Klienten in freien Praxen sind im Vergleich zu Klienten in institutionellen Formen deutlich jünger. Das höhere Alter und das geringere Einkommen der Klienten in institutionellen Praxen steht hierbei in einem gewissen Zusammenhang mit dem Lebensstatus und der Lebensform der Klienten. So suchen beispielweise Pensionisten viel häufiger eine kostenlose Therapie auf als erwerbstätige Klienten. Auch Klienten die einer un- oder angelernten Tätigkeit nachgehen oder einen Antrag auf Berufsunfähigkeitspension gestellt haben, suchen eher eine institutionelle Form der Therapie auf, als dass sie einen Therapeuten in einer freien Praxis konsultieren. Klienten denen aufgrund von Arbeitslosigkeit oder einer Scheidung ein eher geringeres Einkommen zur Verfügung steht, nehmen ebenfalls eher eine kostenlose als eine bezuschusste Psychotherapie in Anspruch. Zwischen dem Bildungs- 119 grad der befragten Klienten und der aufgesuchten Organisationsform der Praxis konnte jedoch kein signifikanter Zusammenhang festgestellt werden. Dementsprechend scheint die Entscheidung für eine bestimmte Form der psychotherapeutischen Praxis nicht vom Wissen der Klienten, sondern vielmehr von den finanziellen Ressourcen abhängig zu sein. Ingesamt werden aber sozial schwächere Personen eher in einer Institution behandelt als in freien Praxen. Weiters fällt bei den Unterschieden zwischen den Organisationsformen ein starkes Stadt-Land-Gefälle auf. Während Klienten aus Linz, LinzLand und Urfahr eher einen Psychotherapeuten in einer freien Praxis aufsuchten, war in den übrigen Bezirken eher die Tendenz zur Inanspruchnahme einer Therapie in einer institutionellen Praxis zu erkennen. Die Klienten in freien und institutionellen Praxen unterscheiden sich nicht nur im Hinblick auf den sozialen Status, sondern auch in ihrem Hilfesuchverhalten. So konnte ein Zusammenhang zwischen der Organisationsform und der zuerst aufgesuchten Hilfeinstanz nachgewiesen werden. Klienten, die eine freie Praxis aufsuchten, konsultierten demnach eher einen Psychotherapeuten auf direktem Weg, während Klienten die ein institutionelles Angebot nutzen, überwiegend zuerst bei einem Arzt, ungeachtet der fachlichen Ausrichtung, Hilfe und Unterstützung suchten. Auch im Hinblick auf eine gewisse Resignation und Hoffnungslosigkeit gegenüber den Symptomen äußerten sich eher Klienten, die eine Psychotherapie in einer Institution in Anspruch genommen haben, als solche die eine freie Praxis aufgesucht haben. Grafik 53: Erste Hilfeinstanz in Abhängigkeit von der aufgesuchten Organisationsform der psychotherapeutischen Praxis (p<0,001, Phi= 0,21) 1. Hilfeinstanz und Organisationsform der Praxis freie Praxis 50,5% 72,1% inst. Praxis 0,0% 49,5% 25,0% 50,0% Arzt 120 27,9% Psychotherapeut 75,0% 100,0% 3.6.2 Unterschiede in den Barrieren und der Zufriedenheit Die Kosten einer psychotherapeutischen Versorgung waren lange Zeit eine wirksame Barriere bei der Inanspruchnahme einer Therapie. Wie der Vergleich zwischen den Organisationsformen zeigt, hätte das Fehlen einer kostenlosen Therapiemöglichkeit bei einer Vielzahl von Klienten in institutionellen Praxen dazu geführt, dass eine Therapie erst gar nicht begonnen worden wäre. Für das Klientel in freien Praxen hätte eine eigenfinanzierte Therapie ein wesentlich geringeres Problem dargestellt. Wenngleich das Angebot einer kostenlosen Therapie einen wichtigen Bestandteil der psychotherapeutischen Versorgung von sozial schwächeren Personen darstellt, so konnte festgestellt werden, dass gerade das Klientel einer kostenlosen Therapie mehr Hürden bei der Inanspruchnahme einer Therapie überwinden musste. Freie Praxen unterscheiden sich von institutionellen Praxen deutlich in Bezug auf das Ausmaß der erlebten Barrieren. Die vorgefundenen Ergebnisse verweisen darauf, dass hier Ungleichheiten zu ungunsten der Klienten in institutionellen Praxen existieren. Worauf diese Ungleichheiten in der Versorgung zurückzuführen sind, lässt sich in der Betrachtung der einzelnen Barrieren genauer erfassen. Zum einen sind die Wartezeiten in freien Praxen geringer als bei einer kostenlosen Therapie. Auch zum problembehafteten Charakter der Wartzeit äußerten sich dementsprechend eher Klienten die eine kostenlose Therapie in Anspruch genommen haben. Grafik 54: Wartezeiten in Abhängigkeit von der Organisationsform ( p< 0,001, punktbiserales r= 0,47) Wartezeit und Organisationsform 73,8% 75,0% 50,0% 45,5% 20,0% 25,0% 21,2% 17,6% 17,0% 4,1% 0,9% 0,0% 0 bis 2 Wochen 3 bis 4 Wochen institutionelle Praxis 5 bis 8 Wochen mehr als 8 Wochen freie Praxis Die Wartezeit führt somit sowohl nach objektiven wie subjektiven Gesichtspunkten zu einer Benachteiligung in der Versorgung von Klienten in institutionellen Praxen. Zum anderen können Therapeuten in freien Praxen flexibler auf die zeitlichen Bedürfnisse der Klienten eingehen, im Ge- 121 gensatz zu Therapeuten in Institutionen. Weiters war der Weg vom Auftreten der Beschwerden bis zur Inanspruchnahme einer Psychotherapie bei Klienten in institutionellen Praxen von einer großen Hoffungslosigkeit durch eine lange und erfolglose medizinische Behandlung geprägt, während das Klientel in freien Praxen eher rascher und direkter einen Psychotherapeuten aufsuchte. Im Hinblick auf die geografische Erreichbarkeit konnten in Bezug auf die Organisationsform keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was einen weiteren Hinweis liefert, dass die regionale Verteilung des Angebotes als zufriedenstellend eingestuft werden kann. Hinweise auf signifikante Abweichungen der Gesamtzufriedenheit mit der absolvierten Therapie, die als ein subjektives Qualitätsmerkmal gewertet werden könnte, zeigten sich in Abhängigkeit von der gewählten Organisationsform nicht. Aus Sicht der Klienten trugen sowohl freie Praxen als auch institutionelle Praxen zur Zufriedenheit ihrer Kunden bei. Großen Einfluss auf die Zufriedenheit der Klienten übt allerdings das erlebte Ausmaß an Barrieren aus. Je mühevoller und schwieriger sich der Weg in eine psychotherapeutische Behandlung gestaltete, desto größer war die Gesamtzufriedenheit der Klienten. Tabelle 11: Unterschiede zwischen institutionellen und freien Praxen (Korrkoeff.: punktbiserales r *p<0,01) Organisationsform Gesamtzufriedenheit inst. Praxis freie Praxis Gesamtzufriedenheit Anzahl der Barrieren 0,0969 -0,0969 0,2724* -0,2724* -0,2618* Die vorgefundenen Ergebnisse legen nahe die zweite Forschungshypothese dahingegen zu modifizieren, dass Klienten die eine bezuschusste Therapie in einer freien Praxis in Anspruch genommen haben, sich zwar in Bezug auf die Zufriedenheit mit der Therapie nicht unterscheiden, jedoch weniger Barrieren erfahren als Klienten, die eine kostenlose und institutionelle Form der Psychotherapie aufgesucht haben. 122 4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen Ausgehend von der Entwicklung der zunehmenden Bedeutung von Psychotherapie, wurde die Forschungsfrage nach den personalen, sozialen und institutionellen Faktoren der Inanspruchnahme einer Psychotherapie gestellt, um somit einen Beitrag zur Feststellung der momentanen Versorgungslage im Rahmen der gesetzlichen Krankenkasse aus Sicht der Versicherten zu leisten. Als erster Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit wurden bisherige theoretische Ansätze zum Gesundheits- und Krankheitsverhalten aus unterschiedlichen Fachrichtungen erläutert und auf ihren empirischen Gehalt geprüft. Dabei wurden sowohl psychologische als auch soziologische Theorien berücksichtigt. Die medizinische Versorgung im Bereich psychischer Störungen und die Bedeutung der Ärzteschaft stellten einen weiteren Schwerpunkt des theoretischen Teils der Arbeit dar. Bisherige empirische Ergebnisse flossen hierbei ebenso ein, wie theoretische Arbeiten zur Therapiemotivation. Auch auf die Problematik der gesellschaftlichen Stigmatisierung von psychisch Erkrankten wurde kurz eingegangen. Aufbauend auf diese bisherigen theoretischen Arbeiten und empirischen Befunde wurde ein Modell entwickelt, das den Weg vom Vorhandensein einer psychischen Erkrankung bis zur Inanspruchnahme einer Psychotherapie nachzeichnet. Der Schwerpunkt des Modells liegt dabei zum einen auf dem Hilfesuchen im Umfeld von Laien, sowie im Bereich von professionellen Helfern, und zum anderen auf wahrgenommenen Hilfen und Barrieren die Betroffene auf dem Weg des Hilfesuchens erfahren. Die Operationalisierung des Modells erfolgte unter der Annahme, dass eine repräsentative Stichprobe von Versicherten befragt werden sollte, bei denen eine Versicherungsleistung im Bereich der Psychotherapie entweder als Sachleistung oder in Form einer finanzielle Bezuschussung erbracht wurde. Aus technischen Gründen konnten allerdings nur jene Psychotherapieklienten in der Stichprobe erfasst werden, bei denen eine kostenlose Therapie verrechnet wurde. Eine Überarbeitung des Fragebogen konnte aus zeitlichen Gründen nicht mehr vorgenommen werden. Dies hatte auf das Ergebnis insofern eine Auswirkung, da sich herausstellte, dass der Großteil der Befragte entgegen der Annahme keine kostenlose, sondern eine bezuschusste Therapie in Anspruch genommen hatte. Die naheliegendste Erklärung diesbezüglich scheint ein Therapeutenwechsel der Klienten zu sein, da begriffliche Missverständnisse im Großen und Ganzen eher auszuschließen sind. Falls tatsächlich ein Therapeutenwechsel stattfand – was anzunehmen ist - bleibt offen warum derartig viele Klienten von einer kostenlosen zu einer bezuschussten Form der Leistungserbringung wechselten. 123 Angesichts des noch immer stigmabehafteten Themas der Untersuchung und einer zunehmenden Sensibilisierung in der Bevölkerung beim Thema Datenschutz, speziell bei gesundheitsbezogenen Daten, zeigte sich bei einigen Versicherten großer Unmut in Bezug auf die verschickten Fragebögen. Eine zugegebener Maßen etwas missverständliche Formulierung im Begleitschreiben erweckte bei einem Teil der Versicherten den Eindruck, dass der Datenschutz im Rahmen dieser Erhebung verletzt wurde. Wenngleich diese Bedenken völlig unbegründet waren, und dieses Missverständnis von den zuständigen Stellen auch aufgeklärt wurde, möchte ich mich hier noch einmal persönlich bei den angeschriebenen Personen dafür entschuldigen, dass derartige Missdeutungen passieren konnten. Es lag nicht in der Absicht des Verfassers Zweifel an der datenschutzrechtlichen Korrektheit dieser Fragebogenuntersuchung zu erwecken. Ungeachtet der Schwierigkeiten beteiligten sich dennoch etwa 39% der angeschriebenen Personen an dieser Untersuchung. Diese unerwartet hohe Rücklaufquote spiegelt das Mitteilungsbedürfnis der Klienten wider, und ist ein Zeichen dafür, dass es auch positives Feedback von Seiten der Befragten gab. Im Kontext zu anderen empirischen Arbeiten zur psychotherapeutischen Versorgung, die Großteils auf einer Einschätzung von Experten aus dem professionellen Sektor beruhen, ergänzt diese Erhebung das Spektrum durch die Sichtweise der Klienten und deren Erfahrungen bei der Inanspruchnahme einer Therapie. Trotz dieser unterschiedlichen Sichtweisen entsprechen die Befunde dieser Erhebung im Hinblick auf personale und soziale Barrieren zu großen Teilen den Ergebnissen bisheriger Arbeiten, verweisen aber auch deutlich auf eine Verbesserung im Bereich des Angebotes. Gerade in Bezug auf die regionale Verteilung des Angebotes, die durch eine Unterversorgung von ländlichen Bereichen gekennzeichnet war126, deutet das Angebot der Gebietskrankenkasse im Bereich der kostenlosen Therapie auf eine regional sehr ausgeglichene Versorgungslage hin. Die zentralen Ergebnisse der Untersuchung betonen im Wesentlichen die Bedeutung des sozialen Umfeldes bei der Inanspruchnahme einer Psychotherapie, beleuchten die Rolle des praktischen Arztes im Zuweisungsprozess und verweisen auf bestehende gesundheitliche Ungleichheiten in der psychotherapeutischen Versorgung. Das soziale Umfeld wirkt bei der Inanspruchnahme einer Therapie auf sehr gegensätzliche Art und Weise. Zum einen informiert es über eine mögliche Therapie und unterstützt die Betroffenen bei der Suche nach professioneller Hilfe. Zum anderen kann es aber als ein erhebliches Hin126 vgl. Schaffenberger et al. S 159 124 dernis bei der Inanspruchnahme erfahren werden. Die Unterschiede in der Wirkung des sozialen Umfeldes erklären sich zum Teil durch die Qualität der Beziehungen. Als unterstützend wurden vor allem enge soziale Beziehungen, wie Freunde und Angehörige, wahrgenommen. Losere soziale Kontakte, wie beispielsweise im einem Arbeitsverhältnis besitzen eher eine gegenteilige Wirkung. Es zeigte sich, dass die Kosten einer gesellschaftlichen Stigmatisierung nach wie vor sehr hoch sind und eine große Barriere bei der Inanspruchnahme einer Therapie darstellen. Männer und Personen in eher niedrigeren beruflichen Positionen erfahren hierbei die größten Hindernisse. Sowohl die Ergebnisse der Untersuchung, wie auch die Tatsache, dass sich Männer in einem eher geringen Maße an der Befragung beteiligten, deuten sehr deutlich darauf hin, dass diesbezüglich noch große Vorurteile bestehen. Die große Bedeutung der praktischen Ärzte im gesundheitlichen Versorgungssystem spiegelt sich auch bei der Zuweisung zur psychotherapeutische Versorgung wider. So bedeutend die Funktion der Allgemeinmediziner als zentrale Schnittstelle im Gesundheitssystem auch ist, zeigen sich dennoch gerade hier Defizite in der Versorgung von Patienten mit psychischen Beschwerden. Es mangelt nicht an der Aufgeschlossenheit der Ärzteschaft gegenüber einer Psychotherapie, sondern vielmehr an der Information über und in einem noch größeren Maße an der Motivation zur Therapie. Gerade die lange und erfolglose medizinische Behandlung bei älteren Menschen und Personen mit geringem Bildungsgrad in der primärärztlichen Versorgung, macht deutlich, dass dadurch eher jene Patientengruppe im medizinischen Umfeld verhaftet bleiben, die von Seiten der Mediziner als eher schwer motivierbar eingestuft wird. Die Ergebnisse zur Therapiezufriedenheit verweisen aber darauf, dass diese Annahmen seitens der Mediziner großteils unbegründet sind. Eine frühzeitige, gezielte und ausführliche Beratung und Aufklärung könnte im Bereich der medizinischen Versorgung zu einer deutlichen Verkürzung der Behandlung führen. Wenngleich das Angebot einer kostenlosen Psychotherapie ein wichtiger und notwendiger Bestandteil der Versorgung von sozial schwächeren Personen ist, bestehen dennoch gerade in diesem Bereich des Angebotes gesundheitliche Ungleichheiten im Vergleich zu freien Praxen. Diese Ungleichheit zeigt sich am deutlichsten dadurch, dass das Klientel in institutionellen Praxen meist nicht nur einen längeren Leidensweg hinter sich hatte, sondern überdies auch noch längere Wartezeiten in Kauf nehmen musste. Die Empfehlungen zum weiteren Abbau von gesundheitlicher Ungleichheit im Bereich der psychotherapeutischen Versorgung, die sich aus den vorgefundenen Ergebnissen ableiten lassen, lauten wie folgt: Die Verrin- 125 gerung der Wartezeiten im Bereich einer kostenlosen Therapie wäre ein erster Schritt in Richtung einer gerechteren Versorgung. Wartezeiten unter zwei Wochen würden zu einer zufriedenstellenden und angeglichenen Versorgung im Bereich der institutionellen Therapie führen. Wenngleich eine derartige Versorgungsqualität nicht immer erreicht werden kann, so stellt eine maximale Wartezeit von vier Wochen, bei gleichzeitig flexibler Terminvereinbarung in dringenden Fällen, eine vertretbare Obergrenze dar. Gezielte Information über psychotherapeutische Verfahren und deren Anwendung speziell bei älteren Menschen, Männern und Personen mit geringerem Bildungsstatus wären ein weiterer wichtiger Beitrag zum Abbau von Barrieren. Schwerpunkt hierbei sollte eine adressatenspezifische Aufklärung und Informationstätigkeit sein. Die Information durch den praktischen Arzt scheint zwar sinnvoll und am zielgerichtetsten zu sein, läuft aber Gefahr die Ärzteschaft zu überfordern. Eine gezielte Information zur Psychotherapie alleine würde aber zu kurz greifen. Es bedarf großer gesellschaftlicher Bemühungen und Anstrengung zum Abbau von Vorurteilen in Bezug auf psychische Erkrankungen und die Behandlung derartiger Störungen. Auch im Umfeld einer psychotherapeutischen Behandlung gibt es nach wie vor große Ängste seitens der Behandelten dahingehend, dass man aufgrund einer derartigen Behandlung gesellschaftlich oder beruflich benachteiligt werden könnte. Dass diese Ängste vor einer gesellschaftlicher Stigmatisierung nach wie vor sehr groß sind, zeigte sich nicht nur in den Ergebnissen der Fragebogenauswertung, sondern auch in den teilweise sehr heftigen Reaktion der angeschriebenen Klienten auf die ausgesandten Fragebogen. Geht man weiters davon aus, dass Personen aus eben diesen Ängsten den Fragebogen nicht beantwortet haben, so bleibt festzuhalten, dass diese Vorurteile noch immer ein enormes Problem für Personen mit psychischen Leiden und eine große Barriere für die Inanspruchnahme einer entsprechenden Behandlung darstellen. Aufgrund der Überrepräsentation von Frauen und Klienten aus eher städtischen Gebieten, sowie durch Abweichungen in der Altersverteilung im Rücklauf verglichen mit der Stichprobe sind gewisse Verzerrungen in den vorgefundenen Ergebnissen nicht auszuschließen. Anmerkend sei noch darauf verwiesen, dass die Ergebnisse der Untersuchung aufgrund des Untersuchungsdesigns nicht den Schluss auf jene Personengruppe zulassen, bei denen zwar eine psychische und behandlungswürdige Störung vorliegt, die jedoch auf dem Weg des Hilfesuchens scheitern, oder im Laiensystem verhaftet bleiben. Die Befunde beziehen sich nur auf jene Personen, die im Rahmen der gesetzlichen Pflichtversicherung eine Psychotherapie auch tatsächlich in Anspruch genommen, und eventuelle 126 Barrieren auf dem Weg dorthin erfolgreich überwunden haben. Offen bleiben demnach die wahren Hinderungsgründe, die einer derartigen Therapie im Wege stehen, sowie der Stellenwert des Angebotes der Gebietskrankenkasse im Rahmen des Gesamtspektrums an psychotherapeutischer Versorgung. 127 Literaturverzeichnis Abel T. (1997): Paradigmatische Anforderungen und ihre Umsetzung am Beispiel gesundheitsrelevanter Lebensstile. S. 56 – 61 in Weitkunat, R., Haisch, J., Kessler M. (Hrsg.). Public Health und Gesundheitspsychologie. Göttingen: Verlag Hans Huber Ackermann J. (1984): Psychoanalyse, Psychotherapie und Beratung mit Arbeiterfamilien und einkommensschwachen Schichten. Ein qualitativ-empirischer Untersuchungsansatz. München: Profil – Verlag Allmer H. (1990): Gesundheitsverhalten als intentionales und volitives Geschehen. S.105 – 119 in: Schwarzer R. (Hrsg). Gesundheitspsychologie. Göttingen: Hogrefe Arlot V.(1998): Psychiatrische Erkrankungen. S. 467 – 476 in Schwartz F. W.(Hrsg.). Das Public Health Buch. München: Urban und Schwarzenberg Backenstraß M., Kronmüller K. T., Mundt C., Fiedler P. (1997): Inanspruchnahme ambulanter Psychotherapie von Patienten mit endogener Depression nach stationärpsychiatrischer Behandlung. S. 234 – 239 in: Psychotherapie, Psychosomatik und medizinische Psychologie 47: Stuttgart: Thieme Verlag De Col C., Kemmler G., Gurka P., Sulzenbacher H., Meise U. (2002): Das Stigma psychischer Erkrankung – eine Innenperspektive. S 203 - 212 in: Zapotoczky K., Grausgruber A., Mechtler R. (Hrsg.). Gesundheit im Brennpunkt. Der Patient zwischen Vernetzung und Isolation. Band 8/1, Linz: Universitätsverlag Rudolf Trauner Faller H. (2000): Therapieziele und Indikationen: Eine Untersuchung der Fragebogenangaben von Patienten bei der psychotherapeutischen Erstuntersuchung. S 292 – 300 in: Psychotherapie, Psychosomatik und medizinische Psychologie 50: Stuttgart: Thieme Verlag Franz M. (1997): Einflussfaktoren des Inanspruchnahmeverhaltens psychogen erkrankter Patienten. S 449 – 455 in: Weitkunat, R., Haisch, J., Kessler M. (Hrsg.). Public Health und Gesundheitspsychologie. Göttingen: Verlag Hans Huber Goffman E. (2003): Stigma. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Sonderausgabe Grausgruber A., Hofmann G., Schöny W., Zapotoczky (1989): Einstellung zu psychisch Kranken und zur psychosozialen Versorgung. Stuttgart: Thieme Verlag Grawe K., Donati R., Bernauer F. (1994): Psychotherapie im Wandel. Von der Konfession zur Profession. 2. Auflage, Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie Haberfellner M. (2000): Die Kooperation in der psychosozialen Versorgung aus Sicht des niedergelassenen Facharztes. S 170 – 186 in: Zapotoczky K., Grausgruber A., Mechtler R. (Hrsg.). Gesundheit im Brennpunkt. Eigeninitiative und gesellschaftliche Verantwortung. Band 7/1, Linz: Universitätsverlag Rudolf Trauner Heim E., Willi J. (1986): Psychosoziale Medizin – Gesundheit und Krankheit aus biopsycho-sozialer Sicht. Band 2 Klinik und Praxis. Berlin: Springer 128 Hessel A., Heim E., Geyer M., Brähler E. (2000) : Krankheitsbewältigung in einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe. Situative, soziodemographische und soziale Einflussfaktoren. S 311 – 321 in: Psychotherapie, Psychosomatik und medizinische Psychologie 50: Stuttgart: Thieme Verlag Herrmann M. (1997): Chronische Krankheit als Thema der Öffentlichen Gesundheit. S 322 – 337 in: Weitkunat, R., Haisch, J., Kessler M. (Hrsg.). Public Health und Gesundheitspsychologie. Göttingen: Verlag Hans Huber Hornung Rainer(1997): Determinanten des Gesundheitsverhaltens. S. 29 – 40 in: Weitkunat, R., Haisch, J., Kessler M. (Hrsg.). Public Health und Gesundheitspsychologie. Göttingen: Verlag Hans Huber Howard K. I., Cornille T. A., Lyons J. S., Vessey J. T. Lueger R. J., Saunders S. M. (1996): Patterns of mental health service utilization. S. 696 – 703 in: Archives of general psychiatry Vol.: 53 (8), United States Hurrelmann K. (2000): Gesundheitssoziologie. Eine Einführung in sozialwissenschaftliche Theorien von Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung. München: Juventa Verlag Janout U., Seiler M. (2002) : Psychotherapie - Status Studie 2002. Studie zur Evaluierung des Psychotherapiestatus beim PGA. Katschnig H. e.a. (Hrsg.) (2001): Österreichischer Psychiatriebericht 2001. Im Auftrag des Staatssekretariats für Gesundheit im Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen. Wien Kolip P. (1998): Frauen und Männer. S. 507 – 524 in Schwartz F. W.(Hrsg.). Das Public Health Buch. München: Urban und Schwarzenberg Kodex: Sozialversicherung. Stand 1. 9. 2002 mit der 60. Novelle zum ASVG. Wien: Linde Verlag Meichenbaum D., Turk D. C. (1994): Therapiemotivation des Patienten. Göttingen: Verlag Hans Huber Mielck A. (2000): Soziale Ungleichheit und Gesundheit: empirische Ergebnisse, Erklärungsansätze, Interventionsmöglichkeiten Bern: Verlag Hans Huber Muthny F. A. (1997): Verarbeitungsprozesse bei körperlicher Krankheit. S. 338 – 347 in: Weitkunat, R., Haisch, J., Kessler M. (Hrsg.). Public Health und Gesundheitspsychologie. Göttingen: Verlag Hans Huber Ogris Christs (1999): Individuelle Herangehensweisen und Erfahrungsberichte von Klienten auf der Suche nach einem Psychotherapeuten. Wien Olfson M., Marcus S. C., Druss B., Pincus H. A. (2002): National Trends in the Use of Outpatient Psychotherapy S. 1914 – 1920 in: The American Journal of Psychiatry Vol.: 159, United States Ollert I. (1995): Class Barriers to psychotherapy and counselling. S. 91 – 95 in: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing Vol. 2 (2) Blackwell Sience Ltd.: England 129 Petermann F., Warschburger P. (1997): Compliance. S. 371 –383 in: Weitkunat, R., Haisch, J., Kessler M. (Hrsg.). Public Health und Gesundheitspsychologie. Göttingen: Verlag Hans Huber Samhaber I. (2003): Motivation zum Wahlarztbesuch unter besonderer Berücksichtigung von Gender-Aspekten – eine empirische Studie. Linz: Rudolf Trauner Verlag Scambler G. (1997): Sociology as applied to medicine. London: W. B. Saunders Company Ltd. Schaffenberger E., Glatz W., Frank W., Rosian I. (1997): Ambulante psychotherapeutische Versorgung in Österreich. Wien: Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales Schwartz F., Siegrist J., Troschke J. (1998): Wer ist gesund? Wer ist krank? Wie gesund bzw. krank sind Bevölkerungen? S. 8 – 31 in: Schwartz F. W. (Hrsg.). Das Public Health Buch. München: Urban und Schwarzenberg Schwarzer, R. (1992): Psychologie des Gesundheitsverhaltens. Reihe Gesundheitspsychologie. Band 1, Berlin: Hogrefe Schöny W., Rittmannsberger (1996): Einstellung zur psychiatrischen Behandlung S.65 - 180 in: Möller H.-J., Kapfhammer H. P. (Hrsg.). Interaktion von Medikamentöser und psychosozialer Therapie in der Psychiatrie. Linz: Edition Pro Mente Schöny W., Schleier F. (2002): Ein österreichisches Programm zur Bekämpfung des Stigmas und der Diskriminierung gegenüber Menschen die an Schizophrenie leiden. S. 233 – 239 in: Zapotoczky K., Grausgruber A., Mechtler R. (Hrsg.). Gesundheit im Brennpunkt. Der Patient zwischen Vernetzung und Isolation. Band 8/1, Linz: Universitätsverlag Rudolf Trauner Siegrist J. (1995): Medizinsoziologie. 5. Auflage, München: Urban und Schwarzenberg Siegrist J., Möller-Leimkühler A. M. (1998a): Gesellschaftliche Einflüsse auf Gesundheit und Krankheit. S.94 – 109 in: Schwartz F. W.(Hrsg.). Das Public Health Buch. München: Urban und Schwarzenberg Siegrist J. (1998b): Machen wir uns selbst krank? S.110 – 123 in: Schwartz F. W.(Hrsg.). Das Public Health Buch. München: Urban und Schwarzenberg Troschke J. Frh. V. (2000): Gesundheits- und Krankheitsverhalten S 371 – 394 in Hurrelmann, K., Laaser U. (Hrsg.). Gesundheitssoziologie. 4.Auflage, München: Juventa Waltz E. M. (1981): Soziale Faktoren bei der Entstehung und Bewältigung von Krankheit – Ein Überblick über die empirische Literatur. S 40 – 119 in: Bandura B. (Hrsg.). Soziale Unterstützung und chronische Krankheit. Zum Stand der sozialepidemiologischen Forschung. Frankfurt am Main: Suhrkamp 130 Internetrecherche www.ooe.gv.at/statistik www.ooegkk.at www.medline.at www.who.com www.dimdi.de 131 Anhang Faktorenanalyse: Erwartungen an eine Psychotherapie Anzahl der Faktoren 2 erklärte Varianz 53,76% Cronbach´s Alpha 0,285 Matrix der Korrelationen zwischen den schiefwinkligen Achsen Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 1 1 0,0793 0,3453 Faktor 2 - 1 0,043 Faktor 3 - - 1 Matrix der auf die schiefwinkligen Achsen rechtwinklig projizierten Faktorladungen Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 zu aufwendig 0,8301 0,0944 0,3399 dem Therapeuten ausgeliefert sein 0,8424 0,0388 0,2386 Bewältigung körperlicher Beschwerden -0,0075 0,822 -0,1118 letzte Hoffung 0,1380 0,8155 0,1854 Medikament lieber 0,3921 0,2690 0,6149 von prakt. Arzt geschickt 0,3894 -0,1764 0,6793 besser mit sich und der Umwelt klar kommen 0,0045 0,0240 -0,7836 132 Faktorenanalyse: Rolle der/des prakt. Arztes/Ärztin bei der Zuweisung Anzahl der Faktoren 2 erklärte Varianz 53,76% Cronbach´s Alpha 0,285 Matrix der Korrelationen zwischen den schiefwinkligen Achsen Faktor 1 Faktor 2 Faktor 1 1 -0,1262 Faktor 2 - 1 Matrix der auf die schiefwinkligen Achsen rechtwinklig projizierten Faktorladungen Faktor 1 Faktor 2 Psychotherapie als geeignete Methode 0,6774 -0,4847 zur Psychotherapie bewegt 0,7837 -0,0045 gründliche Information 0,7183 0,1828 nur Medikament hilfreich -0,4485 0,6419 lange medizinische Behandlung 0,0328 0,7068 zum Facharzt überwiesen 0,2562 0,4737 133 Spitzbart Stefan Johannes Kepler Universität Institut für Soziologie Abteilung für Politik- und Entwicklungsforschung Altenbergstraße 69 4040 Linz Linz, März 2004 Sehr geehrte Psychotherapienutzerin, sehr geehrter Psychotherapienutzer, jeder Mensch kann einmal in seinem Leben an den Punkt kommen, an dem man Unterstützung in seelischer Not und die Hilfe anderer braucht. Belastende Situationen, Überforderung durch Arbeit und Familie, der Tod eines nahen Angehörigen oder andere belastende Ereignisse können zu seelischem Leid führen. Psychotherapie ist ein Heilverfahren, das seelisches Leid heilen oder lindern, in Lebenskrisen helfen und die seelische Gesundheit fördern kann. Sie haben ein Angebot zur Psychotherapie genutzt und haben Ihre Erfahrungen mit dieser Behandlungsmethode gemacht. Als Student der Universität Linz verfasse ich meine Diplomarbeit zum Thema „Inanspruchnahme von Psychotherapie“. Ich möchte feststellen wo die Schwierigkeiten für die Nutzer/innen von Psychotherapie liegen eine Therapie zu beginnen. Welche Hindernisse gibt es aus ihrer Sicht Psychotherapie in Anspruch zu nehmen? Wie sieht der Weg von der seelischen Belastung bis zum Psychotherapeuten aus? Für die Klärung dieser Frage benötige ich Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie sich daher etwas Zeit und beantworten Sie den beiliegenden Fragebogen. Den Versand des vorliegenden anonymen Fragebogens in Kuverts der Universität Linz hat dankeswerter Weise die OÖ Gebietskrankenkasse übernommen. Wenn Sie den ausgefüllten Fragebogen mittels beiliegendem Briefumschlag an das Institut für Soziologie, z. H. Herrn Dr. Alfred Grausgruber senden, ist ein Rückschluss auf die ausfüllende Person ausgeschlossen. Das Ausfüllen des Fragebogens und die Mitteilung Ihrer Erfahrungen helfen, Schwierigkeiten bei der Nutzung von Psychotherapie zu beseitigen und den Zugang zu erleichtern. Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen Bitte beantworten Sie den Fragebogen am besten gleich und senden Sie ihn im beiliegenden Rückkuvert – für Sie kostenfrei – bis spätestens 11. April 2004 zurück. DANKE! 134 Fragebogen HINWEISE zum Ausfüllen des vorliegenden Fragebogens: Kreuzen Sie bitte die jeweils zutreffende Antwort an. Beantworten Sie bei den Fragen 18., 22. und 26. jede angeführte Aussage. Bei den Frage 1., 2., 21.und 24. sind mehrere Antworten möglich. Beachten Sie weiters, dass Sie Frage 22. unter Umständen nicht beantworten müssen. Bei den Antwortvorgaben mit Platzhalter können Antworten ergänzt werden, falls aus Ihrer Sicht Antwortmöglichkeiten fehlen. 1. Wo haben Sie erfahren, dass Psychotherapie bei Ihren Beschwerden hilfreich sein könnte? (Mehrfachnennung möglich) □ prakt. Arzt/Ärztin □ Krankenhaus □ Bücher □ Psychiater/in/ Neurologe/in □ Freunde □ Broschüren □ OÖ Gebietskrankenkasse □ Internet □ Fernsehen □ sonstiger Facharzt/-ärztin □ Bekannte □ Partner/in □ Sozialarbeiter/in □ Psychotherapeut □ Verwandte □ andere Beratungsstelle □ Zeitungen □ Zeitschriften □ Landesverband für Psychotherapie (OÖLP) □ Verein für prophylaktische Gesundheitsarbeit (PGA) □ Sonstiges, und zwar ________________ 2. Wo haben Sie erfahren, dass Sie Psychotherapie kostenlos in Anspruch nehmen können bzw. von der OÖ Gebietskrankenkasse eine Bezuschussung erhalten? (Mehrfachnennung möglich) □ prakt. Arzt/Ärztin □ Krankenhaus □ Bücher □ Psychiater/in/ Neurologe/in □ Freunde □ Broschüren □ OÖ Gebietskrankenkasse □ Internet □ Fernsehen □ sonstiger Facharzt/-ärztin □ Bekannte □ Partner/in □ Sozialarbeiter/in □ Psychotherapeut □ Verwandte □ andere Beratungsstelle □ Zeitungen □ Zeitschriften □ Landesverband für Psychotherapie (OÖLP) □ Verein für prophylaktische Gesundheitsarbeit (PGA) □ Sonstiges, und zwar ________________ 3. Haben Sie wegen psychischer Beschwerden schon öfters Psychotherapie in Anspruch genommen? (Gemeint ist hier nicht die Anzahl der Therapieeinheiten, sondern die Anzahl abgeschlossener Therapien) □ ja □ nein wenn ja: Wie oft haben Sie bereits eine Psychotherapie in Anspruch genommen? □ einmal □ zweimal □ dreimal □ ______mal (Falls Sie schon öfters Psychotherapie in Anspruch genommen haben, beziehen sich alle weiteren Fragen auf die von Ihnen zuletzt durchgeführte Psychotherapie!) 135 4. Hätten Sie eine Psychotherapie auch dann in Anspruch genommen, wenn die Inanspruchnahme nicht kostenlos gewesen wäre bzw. Sie keine Bezuschussung von der OÖ Gebietskrankenkasse erhalten hätten? □ ja □ vielleicht □ nein 5. Wurde Ihnen von Personen aus Ihrem Umfeld empfohlen wegen Ihrer Beschwerden Psychotherapie in Anspruch zu nehmen? □ ja □ nein 6. Nachdem Sie sich entschieden haben, wegen Ihrer Beschwerden professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wen haben Sie aufgrund Ihrer Beschwerden als Erstes aufgesucht? □ prakt. Arzt/Ärztin □ Psychiater/in/ Neurologe/in □ Psychotherapeut/in □ anderer Facharzt/-ärztin □ Sonstiges, und zwar ____________ 7. Durch wen erfolgte die Zuweisung zur Psychotherapie? □ prakt. Arzt/Ärztin □ Psychiater/in/ Neurologe/in □ anderer Facharzt/-ärztin □ Krankenhaus □ Sonstige _____________ 8. □ □ □ □ □ □ □ Bei wem haben Sie Psychotherapie in Anspruch genommen? Psychotherapeut/in des Vereins für prophylaktische Gesundheitsarbeit (PGA) Psychotherapeut/in der Oberösterreichischen Gesellschaft für Psychotherapie Psychotherapeut/in der OÖ Gebietskrankenkasse Psychotherapeut/in in freier Praxis Neurologe/in oder Psychiater/in prakt. Arzt/Ärztin mit psychotherapeutischer Zusatzausbildung Sonstiges ___________________ 9. Wie viele Wochen betrug die Wartezeit von der Anmeldung bei Ihrem/r Psychotherapeuten/in bis zur ersten Sitzung? _______ Wochen 10. War die Dauer der Wartezeit für Sie ein Problem? □ ja, sehr □ eher schon □ eher nicht □ überhaupt nicht 11. Welche Entfernung lag zwischen Ihrem Wohnort und dem Therapieort? □ unter 25 km □ 25 – 50 km □ 50 – 100 km □ mehr als 100 km 12. War die Entfernung zum Therapieort im Bezug auf die Erreichbarkeit für Sie ein Problem? □ ja, sehr □ eher schon □ eher nicht □ überhaupt nicht 13. War die Inanspruchnahme der Psychotherapie für Sie kostenlos oder durch die OÖ Gebietskrankenkasse bezuschusst? □ kostenlos □ durch die OÖGKK bezuschusst 136 14. Falls Sie erwerbstätig sind: Wie waren die Therapiesitzungen zeitlich mit Ihrer Arbeit vereinbar? □ problemlos □ eher problemlos □ eher schwer □ nur schwer □ bin nicht erwerbstätig 15. Falls Sie Kinder zu betreuen haben: Wie waren die Therapiesitzungen zeitlich mit der Betreuung Ihres/er Kindes/er vereinbar? □ problemlos □ eher problemlos □ eher schwer □ nur schwer □ habe keine Kinder zu betreuen 16. Wie waren die Therapiesitzungen zeitlich mit Ihren anderen Verpflichtungen vereinbar? □ problemlos □ eher problemlos □ eher schwer □ nur schwer 17. Hat der/ die Psychotherapeut/in Rücksicht auf Ihre Terminwünsche und Ihre zeitlichen Möglichkeiten genommen? □ ja □ teilweise □ nein 18. Welche Erwartungen und Vorstellungen hatten Sie an eine psychotherapeutische Behandlung, bevor Sie damit begonnen haben? Bewerten Sie dazu die folgenden Aussagen nach den Kategorien: trifft voll zu, trifft eher zu, trifft eher nicht zu oder trifft gar nicht zu. Ich hatte die Erwartung, dass Psychotherapie mir helfen könnte bei der Bewältigung meiner körperlichen Beschwerden. Ich hatte schon unzählige Ärzte/innen wegen meiner Beschwerden aufgesucht und keine/r konnte mir helfen. Psychotherapie war meine letzte Hoffnung. Ein wirksames Medikament wäre mir lieber gewesen als eine psychotherapeutische Behandlung. Ich wurde von meinem/r Arzt/Ärztin zur Psychotherapie geschickt und hatte keinerlei Erwartungen und Vorstellungen. Ich glaubte, dass Psychotherapie mir helfen könnte besser mit mir selbst und der Umwelt klar zu kommen. Eine psychotherapeutische Behandlung erschien mir anfangs zu aufwendig und anstrengend. Ich habe befürchtet, dem/r Psychotherapeuten/in weitgehend ausgeliefert zu sein. trifft voll zu trifft eher zu trifft trifft eher gar nicht zu nicht zu □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 19. Haben Ihre Beschwerden Sie im Alltag stark behindert? □ sehr □ eher schon □ eher nicht □ gar nicht 137 20. Haben Sie Medikamente (Psychopharmaka) zur Linderung Ihrer seelischen Beschwerden vom einem/r Arzt/Ärztin verschrieben bekommen? □ ja □ nein wenn ja: Haben Sie diese verschriebenen Medikamente auch eingenommen? □ ja □ teilweise □ nein wenn ja: Hatten Sie das Gefühl, dass diese Medikamente Ihnen geholfen haben? □ ja □ teilweise □ nein 21. Äußerten sich Ihre seelischen Beschwerden auch in körperlicher Form wie z.B.: Kopfschmerzen, Herzbeschwerden, Magenprobleme, etc.? □ ja □ nein wenn ja: Welche körperlichen Symptome hatten Sie? (Mehrfachnennung möglich) □ Atembeklemmung □ Schlafstörungen □ Schweißausbrüche □ Müdigkeit □ Herzbeschwerden □ Magen- Darmstörungen □ Kopfschmerzen □ Unruhe, Zittern □ Konzentrationsstörungen □ Schwindelgefühle □ Wirbelsäulenprobleme □ Sonstige ____________ 22. Praktische Ärzte/innen nehmen in der gesundheitlichen Versorgung eine wichtige Rolle ein. Deshalb wäre es wichtig zu wissen, wie Sie Ihre/n prakt. Arzt/Ärztin hinsichtlich Ihrer seelischen Beschwerden als Unterstützung erlebt haben bzw. ihn/sie als fachlich kompetent einschätzen würden. Beantworten Sie dazu folgende Aussagen mit ja oder nein. (Falls Sie keinen prakt. Arzt/Ärztin wegen Ihrer Beschwerden aufgesucht haben gehen Sie direkt weiter zu Frage 23.) ja nein Mein/e prakt. Arzt/Ärztin hält Psychotherapie für eine geeignete Me□ □ thode seelische Beschwerden zu heilen oder zu lindern. Mein/e prakt. Arzt/Ärztin hat sich bemüht mich zu einer psychothera□ □ peutischen Behandlung zu bewegen. Er/ sie meinte, dass nur eine medizinische Behandlung (Medikamente) □ □ bei meinen Beschwerden helfen kann. Ich habe eine gründliche Information über eine psychotherapeutische □ □ Behandlung von meinem/r Arzt/Ärztin erhalten. Ich wurde wegen meiner Beschwerden sehr lange von meinem/r prakt. Arzt/Ärztin behandelt, bevor er/sie mich schließlich zur Psychotherapie □ □ überwiesen hat. Er/ sie hat mich zu einem/r andere/n Facharzt/-ärztin überwiesen, um □ □ mögliche körperliche Ursachen ausschließen zu können. Wann immer ich gesundheitliche Beschwerden habe, suche ich meine/n prakt. Arzt/Ärztin auf. Er/sie ist kompetent und nimmt sich Zeit für □ □ mich. 138 23. War es für Sie schwierig eine/n passende/n Psychotherapeuten/in zu finden? □ ja sehr □ eher schon □ eher nicht □ gar nicht 24. Wurden Sie bei der Suche nach einem/r Psychotherapeuten/in unterstützt? □ ja □ nein wenn ja: Durch wen wurden Sie unterstützt? (Mehrfachnennung möglich) □ □ □ □ □ prakt. Arzt/Ärztin Psychiater/in/ Neurologe/in sonstiger Facharzt/-ärztin OÖ Gebietskrankenkasse Bekannte □ □ □ □ □ andere Beratungsstelle □ Krankenhaus Partner/in □ Verwandte Sozialarbeiter/in □ Freunde OÖLP □ PGA Sonstiges, und zwar ________________ wenn nein: Hätten Sie sich eine Unterstützung gewünscht? □ ja □ vielleicht □ nein 25. Gibt/Gab es in Ihrem Umfeld Personen, die auch eine Psychotherapie in Anspruch genommen haben? □ ja □ nein □ weiß nicht 26. Hier ist eine Liste von Aussagen. Sagen Sie mir bitte, ob die Aussagen für Sie voll oder eher zutreffen, oder ob sie eher nicht oder gar nicht zutreffen. trifft trifft trifft trifft voll eher eher gar zu zu nicht zu nicht zu Meine Umwelt verhielt sich gegenüber meinen □ □ □ □ Beschwerden eher verständnislos. Wenn ich eine Psychotherapie in Anspruch nehme, sollte dies möglichst niemand aus □ □ □ □ meinem Bekanntenkreis erfahren. Ich habe Angst davor, dass mich andere für verrückt halten, wenn sie wissen, dass ich □ □ □ □ Psychotherapie in Anspruch genommen habe. An meinem Arbeitsplatz sollte keiner wissen, dass ich eine Psychotherapie gemacht habe, □ □ □ □ da es sein könnte, dass ich dann meine Arbeit verliere. 27. Würden Sie einen/eine Psychotherapeuten/in wieder aufsuchen, wenn Sie wieder einmal Hilfe brauchen? □ ja □ eher ja □ eher nein □ nein 28. Wie viele Einheiten Psychotherapie haben Sie in Anspruch genommen? □ bis 10 Einheiten □ 11 – 30 Einheiten □ 31 – 60 Einheiten □ mehr als 60 Einheiten 139 29. Würden Sie bei Bedarf Ihrem Freundeskreis Psychotherapie als eine Behandlungsmethode weiterempfehlen? □ ja □ eher ja □ eher nein □ nein 30. Wie zufrieden waren Sie mit Ihrem/er Psychotherapeut/in? □ sehr zufrieden □ eher nicht zufrieden □ eher zufrieden □ gar nicht zufrieden 31. Alles in allem: Wie beurteilen Sie den Erfolg der Psychotherapie? □ voll erfolgreich □ eher weniger erfolgreich □ großteils erfolgreich □ kaum bis nicht erfolgreich □ mittelmäßig erfolgreich 32. Zum Schluss noch ein paar Fragen zu Ihrer Person a) b) c) Ihr Geschlecht: □ weiblich Ihr Alter: □ unter 20Jahre □ 21 – 30 Jahre □ männlich □ 31 – 40 □ 41 – 50 Jahre Jahre Ihr Familienstand: □ ledig □ Partnerschaft/verheiratet □ 51 – 60 Jahre □ über 60 Jahre □ geschieden □ verwit- wet d) Ihre höchste abgeschlossene Bildung: □ Pflichtschule □ Hauptschule □ berufsbildende Schule □ Lehre □ Matura an AHS oder BHS □ Universität/Fachhochschule e) Sie sind derzeit : □ erwerbstätig □ in Karenz □ arbeitslos □ in Ausbildung (Schüler/Student/Lehrling) □ in Pension □ im Haushalt tätig □ in befristeter Berufsunfähigkeitspension f) In welcher Position sind Sie derzeit tätig bzw. waren Sie tätig bevor Sie arbeitslos, in Karenz bzw. in Pension waren? □ ungelernte/r/ angelernte/r Arbeiter/in □ nichtleitende/r Angestellte/r □ Facharbeiter/in/ Meister/in □ leitende/r Angestellte/r □ Sonstiges _____________ g) 140 Haben Sie einen Antrag auf Berufsunfähigkeitspension gestellt? □ ja □ nein h) Wie hoch ist Ihr monatliches Haushaltsnettoeinkommen? □ unter 350 € □ 351 – 700 € □ 701 – 1050 € □ 1051 – 1400 € □ 1401 – 1750 € □ 1751 – 2100 € □ mehr als 2100 € i) In welchem politischen Bezirk sind Sie wohnhaft? _______________________ Falls Sie noch Anregungen, Wünsche oder Anliegen zum Thema Psychotherapie haben, die im Fragebogen nicht angesprochen wurden, finden Sie hier noch Platz dafür. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ____________________________ Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 141