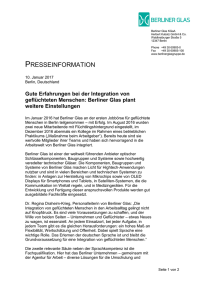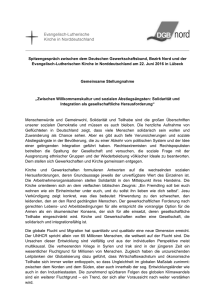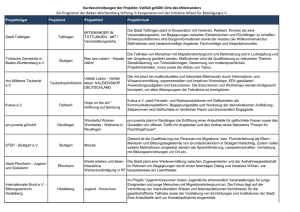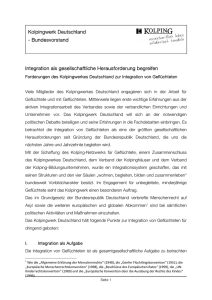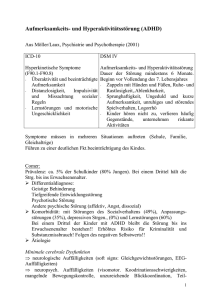“Den Helfern helfen: Manualisierung und Evaluationskon
Werbung

“Den Helfern helfen: Manualisierung und Evaluationskonzept einer Psychoedukation in der Flüchtlingshilfe” Verfasserinnen Anne Breidenstein Anleitung Dr. Dr. Ricarda Nater-Mewes [email protected] Prof. Dr. Urs Nater Friedrichsplatz 13 Klinische Biopsychologie 35037 Marburg Fachbereich Psychologie Philipps-Universität Marburg Anna Enrica Strelow [email protected] Bahnhofstraße 12 35037 Marburg Inhaltsverzeichnis 1. Zusammenfassung (Anna Enrica Strelow)................................................................. 1 2. Einleitung und Leseempfehlung (Anne Breidenstein) .............................................. 1 3. 2.1. Einleitung (Anne Breidenstein) ................................................................................ 1 2.2. Leseempfehlung (Anne Breidenstein) ..................................................................... 2 Theorie – oder Manualisierung des Vortrags (Anna Enrica Strelow) .................... 4 3.1. Definition und Nutzenanalyse einer Psychoedukation in der Flüchtlingshilfe (Anna Enrica Strelow) .................................................................................................................. 4 3.2. Psychische Störungen bei Geflüchteten (Anna Enrica Strelow) .............................. 6 3.2.1. Depression (Anna Enrica Strelow) ................................................................. 14 3.2.2. Die Posttraumatische Belastungsstörung (Anna Enrica Strelow) ................... 22 3.2.3. Suizidalität (Anna Enrica Strelow) .................................................................. 30 3.3. Welche kulturellen Unterschiede gibt es? (Anna Enrica Strelow) .......................... 34 3.3.1. Störungskonzept (Anna Enrica Strelow)......................................................... 37 3.3.2. Kollektivistische Gesellschaften im Vergleich zu individualistischen Gesellschaften (Anna Enrica Strelow) .......................................................................... 39 3.3.3. Besonderheit somatischer Symptome (Anna Enrica Strelow) ........................ 42 3.3.4. Glaube und traditionelle Volksmedizin als Heilmittel (Anna Enrica Strelow) ... 45 3.3.5. Einfluss auf Inanspruchnahmeverhalten und Bewältigungsgewohnheiten (Anna Enrica Strelow) ............................................................................................................ 47 3.4. Was ist Psychotherapie? (Anne Breidenstein) ...................................................... 52 3.4.1. Übersicht über die Therapie-Verfahren (Anne Breidenstein) .......................... 55 3.4.2. Traumatherapie Verfahren (Anne Breidenstein) ............................................. 60 3.4.3. Empirische Fundierung (Anne Breidenstein) .................................................. 67 3.5. Was können ehrenamtliche Helfer tun? (Anna Enrica Strelow) ............................. 68 3.5.1. Konkretes Verhalten im Umgang (Anna Enrica Strelow) ................................ 69 3.5.1.1. Soziale Unterstützung (Anne Breidenstein) ................................................ 77 3.5.1.2. Selbstwirksamkeit stärken (Anne Breidenstein) ......................................... 80 3.5.2. Behandlungskette (Anne Breidenstein) .......................................................... 84 3.5.3. Barrieren abbauen und Motivation steigern (Anne Breidenstein) ................... 90 3.6. 4. Rechtslage (Anne Breidenstein)............................................................................ 90 3.6.1. Asylrecht (Anne Breidenstein)........................................................................ 91 3.6.2. Regelungen für psychotherapeutische Behandlung (Anne Breidenstein) ....... 92 3.6.3. Regelung für Abschiebungsverhinderung (Anne Breidenstein) ...................... 95 Literaturverzeichnis ................................................................................................... 97 Tabellenverzeichnis Tabelle 1. Aufschlüsselung kulturspezifischer Syndrome .................................................... 45 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1. Traumatische Ereignisse, denen Geflüchtete häufig ausgesetzt sind ............. 31 Abbildung 2. Darstellung der EMDR.................................................................................... 60 Abbildung 3. Ergebnisse der Studie von Berkman zum „social tie index.............................. 75 1. Zusammenfassung (Anna Enrica Strelow) Geflüchtete1 sind einer Vielzahl an Belastungen ausgesetzt. Auf der Flucht und auch im Heimatland können sie vielzähligen traumatischen Ereignissen, wie Folter oder der Konfrontation mit dem Tod, ausgesetzt sein. Das führt dazu, dass Geflüchtete im Vergleich zu der deutschen Bevölkerung viel häufiger an Depressionen oder Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) leiden. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer leisten einen wichtigen Beitrag zur Integrationsarbeit und sind meist die ersten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Geflüchtete. Doch ist das Wissen über psychische Störungen oft nicht ausreichend vorhanden. Zum Beispiel über den kulturspezifischen Symptomausdruck, den Weg, den ein Geflüchteter bestreiten muss, um eine Psychotherapie genehmigt zu bekommen, den adäquaten Umgang mit psychisch Erkrankten und die aktuelle Rechtslage liegen meist nicht genügend Informationen vor. Aus diesem Grund haben Kowarsch und Reinacher (2016) unter Anleitung von Dr. Dr. Ricarda Nater-Mewes, Fachbereich Psychologie der Philipps-Universität Marburg, einen psychoedukativen Vortrag für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer entwickelt, der über diese Themen informieren soll. In der vorliegenden Arbeit werden die wissenschaftlichen Hintergründe zu diesem Vortrag dargestellt sowie eine Handlungsanleitung zum Halten eines solchen Vortrags geliefert. So kann die vorliegende Arbeit sowohl als Manual für einen psychoedukativen Vortrag als auch als Nachschlagewerk für Interessierte gelten. 2. Einleitung und Leseempfehlung (Anne Breidenstein) 2.1. Einleitung (Anne Breidenstein) Deutschland ist schon lange ein Ankunftsland vieler Geflüchteter, die ihr Land auf der Flucht vor Bürgerkrieg und Verfolgung verlassen mussten. Seit dem Jahr 2015 steigen die Zahlen der Schutzsuchenden und die mediale Aufmerksamkeit für das Thema stark an (BAMF, Aktuelle Zahlen zu Asyl 07/2016). In der deutschen Bevölkerung gibt es unterschiedliche Reaktionen auf diese Entwicklung. Durch sie entstehen Angst und Wut, aber auch Mitgefühl und Hilfsbereitschaft. Zu Beginn 1 In dieser Arbeit verwenden wir den Begriff des Geflüchteten synonym mit dem Begriff des Flüchtlings, wie er von der Genfer Flüchtlingskonvention definiert ist (UNHCR, 2016). Aus verschiedenen Gründen ziehen wir den Begriff des Geflüchteten dem des Flüchtlings vor. 1/156 dieser Entwicklung wurde in den Medien der Begriff der Willkommenskultur geprägt, um ein erstaunliches Maß an ehrenamtlichem Engagement zu beschreiben. Bundeskanzlerin Angela Merkel bedankte sich am 31. Dezember 2015 in ihrer Neujahrsansprache bei den vielen Helfern „für die überwältigende und tatsächlich bewegende Welle spontaner Hilfsbereitschaft, die wir in diesem Jahr erlebt haben, als so viele Menschen oft lebensgefährliche Wege auf sich genommen haben, um bei uns Zuflucht zu suchen.“ (Bundesregierung, 2016) Die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helferinnen und Helfer übernehmen dabei ganz verschiedene Aufgaben: vom Sprachunterricht über die Kinderbetreuung und Hilfe bei Behördengängen bis hin zur Wohnungssuche. Dabei treten sie unweigerlich auch in einen engen persönlichen Kontakt mit Geflüchteten. Wie die Bundeskanzlerin in ihrer Neujahrsansprache betont hat, haben die Geflüchteten oft ein hohes Risiko für Leib und Seele auf sich genommen und viel zurücklassen müssen, um in Deutschland Asyl zu beantragen. Daher ist es nachvollziehbar, dass die Prävalenzraten für psychische Störungen bei ihnen deutlich höher sind als in der Durchschnittsbevölkerung (vgl. hierzu Abschnitt 3.2 Psychische Störungen bei Geflüchteten). Die häufigsten Störungen sind die Posttraumatische Belastungsstörung und die Depression. Das macht die Arbeit der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nicht immer einfach. Um denjenigen, die sich dafür entschieden haben, die Geflüchteten bei ihrer Ankunft in Deutschland zu unterstützen, selbst Hilfe zukommen zu lassen, entstand die vorliegende Arbeit im Rahmen eines Projekts der Intercultural Health Research Group (Leitung Dr. Dr. Ricarda Nater-Mewes) am Fachbereich Psychologie der Philipps-Universität Marburg. 2.2. Leseempfehlung (Anne Breidenstein) Die folgende Manualisierung des Vortrages ist für diejenigen besonders relevant, die den Vortrag selbst halten möchten. Sie richtet sich an ein Fachpublikum mit psychologischem Wissen. Der Aufbau entspricht nicht unmittelbar dem Aufbau des Vortrages, sondern folgt einer intuitiven Herangehensweise an das Thema mit sukzessivem Wissensaufbau. Zunächst widmen wir uns dabei 1. dem Thema Psychoedukation an sich, 2. den häufigsten psychischen Störungen bei Geflüchteten, 3. den kulturellen Unterschieden im Allgemeinen und in Bezug auf die Störungswahrnehmung, 4. dem Thema Psychotherapie, 5. der Frage, was ehrenamtliche Helferinnen und Helfer selbst tun können und 6. den rechtlichen Grundlagen des Asyls und der Gesundheitsversorgung. Inhaltlich sind damit alle Bereiche des Vortrags abgedeckt. 2/156 Im Anschluss an die einzelnen Kapitel finden sich die entsprechenden Vortragsfolien, denen wir Formulierungsvorschläge für die mündliche Präsentation beigefügt haben (dabei haben wir uns an den digitalen Notizen in der Präsentation von Kowarsch und Reinacher [2016] orientiert). Diese sollen verdeutlichen, was besonders wichtig ist, können aber natürlich auch in ihrer Umsetzung verändert oder ergänzt werden. Dabei haben wir uns auf die Folien beschränkt, die eine Erläuterung benötigen. Der gesamte Vortrag wurde nach der Auswertung der Evaluation überarbeitet und eine aktualisierte Version kann bei Fr. Dr. Dr. Nater-Mewes auf Anfrage erhalten werden. 3/156 3. Theorie – oder Manualisierung des Vortrags (Anna Enrica Strelow) Wie kann ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ein Erste-Hilfe-Paket für psychische Störungen mitgegeben werden? Das Ziel der der vorliegenden Arbeit ist es, den ausgearbeiteten Vortrag von Kowarsch und Reinacher (2016) mit einem Manual zu untermauern. Das Manual klärt in detaillierterer Form über die gleichen Themen wie der Vortrag auf. Somit dient es als Vorbereitung für die Vortraghaltenden und als Nachschlagewerk. 3.1. Definition und Nutzenanalyse einer Psychoedukation in der Flüchtlingshilfe (Anna Enrica Strelow) Psychoedukation wird bei Imm-Bazlen und Schmieg (2017) als ein Mittel definiert, mit dem der Mensch gelehrt werden kann, sich selbst zu verstehen. Aus diesem Wissen soll ein adäquater, sicherer Umgang mit der (eigenen) psychischen Störung resultieren. In einer Definition des psychologischen Nachschlagewerks von Dorsch (Vogel, 2014) wird zudem betont, dass Psychoedukation bei Patientinnen und Patienten und bei Angehörigen als Intervention oder als Teil dieser gilt, die dazu dient, Motivation zu erhöhen, Empowerment2 und Selbstmanagement zu erreichen, sowie auch Störungsakzeptanz und -verständnis zu erhöhen. In einer Psychoedukation über die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) kann bspw. die Erkenntnis vermittelt werden, dass die seelische und körperliche Reaktion in Form von Flashbacks eine normale Reaktion des Menschen auf eine unnormale, überfordernde Situation ist (Imm-Bazlen & Schmieg, 2017). In einer Psychoedukation über Depression kann dem Zuhörenden bspw. eine Übersicht über die Symptome und die Behandlungsmöglichkeiten vermittelt werden, um der/dem Erkrankten aufzuzeigen, dass es Wege aus der Depressionsspirale gibt (Schaub, Roth, Goldmann, 2013). Vor allem Menschen, die unter einer psychischen Störung leiden, brauchen eben dieses Wissen, um einen sicheren Umgang mit ihrer Störung entwickeln zu können. Das Umfeld der Erkrankten benötigt jedoch auch Hinweise, wie sie auf psychische Störungen und auf Veränderung der Störungssymptome reagieren können und sollen. 2 Empowerment (=Ermächtigung) wird als die Befähigung einer Person verstanden, ihre Lebenswelt selbst zu gestalten (Stark, 2014). 4/156 In einer Meta-Analyse von Schmid, Spießl, Vulkovich, & Cording, (2003), in die 145 Arbeiten miteinbezogen wurden, wurden die Belastungen der Angehörigen psychisch Erkrankter erfasst. Es zeigte sich, dass Angehörige psychisch Erkrankter unter einer Vielzahl an Belastungen leiden. Neben einem erhöhten Betreuungsaufwand und einer erhöhten finanziellen Beanspruchung berichteten die Angehörigen von Diskriminierungserfahrungen. Zudem hatten 46% der Angehörigen keine oder nur unzureichende Informationen über die Störung. Nur knapp die Hälfte der Befragten gab an, institutionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, obwohl 75% über Belastungen klagten. Als Grund dafür wurde das als unübersichtlich und lückenhaft empfundene Versorgungssystem genannt. 50% der Angehörigen hatten nicht das Gefühl, bei Kliniken um Rat fragen zu können. Zudem berichteten die Angehörigen von emotionaler Belastung, wie Schuldgefühlen oder dem Gefühl der Hilflosigkeit. Des Weiteren berichteten die Befragten von großen Schwierigkeiten im Umgang mit der erkrankten Person. Rund 75% der Befragten gaben an, dass sie sich ausführliche Informationen über Therapien, Medikamente, Nebenwirkungen und den Behandlungsverlauf wünschen – 65% der Befragten berichteten, dass sie sich eine offene und verständliche Aufklärung über die Störung wünschen würden. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer stehen im engen Kontakt mit Geflüchteten und sind meist Ansprechpartner/innen, Hilfs-Diagnostiker/innen, Familienersatz und Arztbegleitung in Einem. Die Arbeit Ehrenamtlicher wird von Karakayali und Kleist (2015) als all jene Tätigkeiten definiert, die unentgeltlich für die Geflüchteten ausgeführt werden. Die Intensität dieser Arbeit wird als Mittelwert zwischen spontan ausgeführten Hilfeverhalten gegenüber Fremden und dem Ausmaß an Hilfe, das man Freund/innen/en oder Familienmitgliedern zukommen lässt, beschrieben. Somit ist die Beziehung zwischen Geflüchteten und Ehrenamtlichen nicht mit der Beziehung zwischen Angehörigen gleichzusetzen, jedoch sind die Ehrenamtlichen oft die ersten Ansprechpartner/innen der Geflüchteten. Um zu hohe Belastung und belastenden Umgang der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vorzubeugen, ist es sinnvoll, sie über etwaig auftretende psychische Störungen bei Geflüchteten zu informieren. Neben den Informationen, die eine psychoedukative Veranstaltung vermitteln kann, soll auch das Hilfeverhalten und das eigene Kompetenzerleben der Ehrenamtlichen erhöht werden. Nach Latanè und Darley (1970), die beschreiben, wie ein Hilfeprozess abläuft, und erörtern, wann es zu Hilfeverhalten kommt, ist Wissen der entscheidende Faktor an dem die potentiellen Helferinnen und Helfer festmachen, ob eine Situation vorliegt in der sie helfen sollten. Des Weiteren ist der letzte Schritt vor dem Hilfeverhalten das Abwägen der eigenen Fähigkeiten; nur wenn diese vorhanden sind, kommt es zu einem Hilfeverhalten. Eine Psychoedukation, die das Wissen erhöht und Hilfsmöglichkeiten aufzeigt, kann somit dazu 5/156 beitragen, dass in Notsituationen ein erhöhtes Maß an Hilfeverhalten gezeigt wird. Zudem zeigt sich auch in einer Meta-Analyse von Fischer und Kollegen (2011), dass der BystanderEffekt3 durch Wissen über angemessene Handlungsoptionen, reduziert werden kann. Kowarsch und Reinacher (2016) entwickelten einen ca. einstündigen Vortrag, der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern über die häufigsten psychischen Störungen von Geflüchteten informieren soll. Darin soll unter anderem erörtert werden, wie sich diese psychischen Störungen äußern und wie sie erkannt werden können und wie die Ehrenamtlichen sich unterstützend verhalten können. Dieses Manual soll zur Vorbereitung für die Vortragenden zur Verfügung gestellt werden. Es kann zudem auch als Nachschlagewerk für Interessierte gelten. 3.2. Psychische Störungen bei Geflüchteten (Anna Enrica Strelow) 43% der deutschen Bevölkerung leiden in ihrem Leben an mindestens einer psychischen Störung. Davon leiden 17,1% irgendwann in ihrem Leben an einer Depression. Eine Depression ist eine Störung, die sich vor allem durch eine deprimierte Stimmung, Interessenverlust und den Verlust der Freude an Dingen, die früher Spaß bereiteten sowie durch gesteigerte Ermüdbarkeit oder verminderten Antrieb auszeichnet (Dilling, Mombour, Schmidt, & Schulte-Markwort, E., 2011). Sie ist die zweithäufigste4 psychische Störung der Betroffenen in Deutschland. Das bedeutet, dass zu einem gegeben Zeitpunkt in Deutschland etwa 3,1 Millionen Menschen zwischen 18 und 65 Jahren an einer Depression erkrankt sind. Weltweit sind es Schätzungen zufolge ca. 120 Millionen Menschen, die an einer Depression erkrankt sind (Jacobi et al, 2004). Weitergehende Informationen zu den Symptomen einer Depression werden im Abschnitt 3.2.1 dargelegt. 1,5 bis 2% der Deutschen leiden im Laufe ihres Leben unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) (Flattern et al., 2011). Diese kann bei Menschen auftreten, die einer traumatischen Situation ausgesetzt waren. Eine traumatische Situation wird als eine Situation verstanden, die die Betroffenen selbst als katastrophal und lebensbedrohlich einschätzen. Symptome können dann bspw. sein, dass die betroffene Person unter sehr lebhaften Erinnerungen an die traumatische Situation leidet (Flashbacks), sie Situationen, Gerüche 3 Der Bystander-Effekt ist nach Fischer, Asal und Krueger (2013) jenes Phänomen, welches beschreibt, dass das Hilfeverhalten gegenüber einer Person in Not geringer wird, je mehr Personen anwesend sind. 4 Am häufigsten leiden die Betroffenen in Deutschland unter einer affektiven Störung (also einer Depression, einer Dysthymie, einer Bipolaren Störung oder einer hypomanischen Episode). Die dritthäufigsten psychischen Störungen der Betroffenen in Deutschland sind somatoforme Störungen (Jacobi et al., 2004). 6/156 und Gedanken an die traumatisches Situation vermeidet, sie verschiedene Dinge vergessen hat, die mit der traumatischen Situation zu tun haben und u.a. Schlafstörungen hat (Dilling et al., 2011). Weitergehende Informationen zu den Symptomen einer PTBS lassen sich im Abschnitt 3.2.2 finden. Besonders häufig sind Menschen von psychischen Störungen betroffen, die nicht verheiratet sind, einen geringen Sozialstatus haben und in einer schlechten körperlichen Verfassung sind (Jacobi et al., 2004). Nur 40% derjenigen, die in den letzten 12 Monaten an einer psychischen Störung litten, haben sich um eine Behandlung dieser bemüht und das, obwohl Depression weltweit als eine der 20 größten körperlichen Belastungen beschrieben wird (Üstün et al., 2004). Dieser Missstand zeigt eindrücklich auf, dass viele Betroffene sich selbst, trotz großer Belastung, nicht in eine Psychotherapie begeben. Aus diesem Grund sollte das Bewusstsein dafür, dass psychische Störungen behandlungsbedürftig und behandelbar sind, erweitert werden. Menschen aus der ganzen Welt kommen nach Deutschland. 2015 sind 476.649 Asylanträge gestellt worden. 2016 wurden zwischen Januar und Juli 396.947 Asylanträge gestellt. Die Antragsteller/innen kommen dabei primär aus Syrien/der Arabischen Republik (44%), aus Afghanistan (15,6%) und aus dem Irak (14,5%). Damit kommen fast drei Viertel aller Asylanträge des Jahres 2016 aus Ländern, in denen Krieg herrscht und in denen zahlreiche Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung stehen (BAMF, 2016). Geflüchtete sind in ihrem Heimatland, während der Flucht, bei der Ankunft im Migrationsland sowie während des Migrationsprozesses vielen Erschütterungen und potentiell traumatischen Situationen ausgesetzt. Dazu können unter anderem Folter, Haft, die erzwungene Trennung von Familienmitgliedern, die Bedrohung des eigenen Lebens, der traumatische Verlust von Angehörigen und ein erlebter Mangel an Nahrungsmittel und Schutz gehören (Schellong, Epple, Weidner, 2016; Heeren et al., 2012). Doch auch im Migrationsland selbst können Risikofaktoren und belastende Ereignisse zur Entwicklung einer psychischen Störung beitragen oder sie sogar auslösen. So belegt eine Studie von Gerlach und Pietrowsky (2012), dass unsichere Aufenthaltsbedingungen bei traumatisierten Geflüchteten mit einer höheren Symptomausprägung einhergingen. Mewes, Asbrock und Laskawi (2015) konnten in einer Studie zeigen, dass es einen starken direkten Effekt von wahrgenommener Diskriminierung türkischer Migrant/innen/en in Deutschland auf depressive und körperliche (somatoforme) Symptomen gab. Zudem zeigte sich ein indirekter Effekt von Bevormundung (passiver Diskriminierung) auf schlechtere psychische Gesundheit. Dieser wurde durch wahrgenommenen Stress mediiert. Der Effekt zeigte sich jedoch nur für die Teilnehm/erinnen/er, die sich wenig damit identifizierten, türkisch zu sein. Morawa und Erim (2013) zeigten auf, dass häufigere subjektive Diskriminierungserlebnisse im Migrationsland mit einem höheren De7/156 pressivitätslevel assoziiert waren. Das bedeutet, dass negative Erfahrungen im Migrationsland bei der Ausprägung einer psychischen Störung eine entscheidende Rolle spielen können. Heeren et al. (2012) zeigten, dass Asylsuchende im Schnitt sechs traumatischen Lebensereignissen ausgesetzt waren bevor sie in dem Ankunftsland ankamen. Steel, Zilove, Phan und Bauman (2002) konnten in einer 10-jährigen Studie zeigen, dass Geflüchtete, die mehr als drei traumatischen Ereignissen ausgesetzt waren im Vergleich zu Geflüchteten, die keinem traumatischen Ereignis ausgesetzt waren, nach zehn Jahren noch immer ein erhöhtes Risiko zeigten, an einer psychischen Störung zu erkranken. So ist es nicht verwunderlich, dass sich ich einer Meta-Analyse von Lindert et al. (2009) zeigte, dass Geflüchtete im Vergleich zu Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten fast doppelt so häufig von Depression, Angststörungen und PTBS betroffen sind. Während ein höheres Bruttosozialprodukt sich auf die psychischen Störungen der Arbeitsmigrantinnen und -migranten positiv auswirkte, hatte es bei den Geflüchteten keinerlei Auswirkung auf die psychische Gesundheit. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass es bei Geflüchteten andere Gründe für die Störung gibt als bei Arbeitsmigrantinnen und -migranten (Lindert et al., 2009). Vor dem beschriebenen Hintergrund wird bereits deutlich, dass Geflüchtete eine besonders vulnerable Gruppe darstellen, bei denen frühe Interventionen und das frühe Erkennen von Symptomen psychischer Störungen von entscheidender Bedeutung sind. Diese besondere Situation wird auch in der Definition eines Flüchtlings (durch die Genfer Flüchtlingskonvention) sichtbar, die sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren ständigen Wohnsitz hat, und die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung hat und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht vor Verfolgung nicht dorthin zurückkehren kann. (UNHCR, 2016) Im Gegensatz dazu wird eine Migrantin oder ein Migrant als ein Mensch verstanden, der ihr/sein Land verlasse, um ihre/seine Lebensbedingungen zu verbessern, jedoch jederzeit in sein Heimatland zurückkehren kann (UNHCR, 2016). Flucht und die damit einhergehende Angst und Unsicherheit haben einen Einfluss auf die Entwicklung psychischer Störungen. So zeigten auch Kizilhan und Beremejo (2009) auf, dass der Grad der Freiwilligkeit der Migration eine wichtige Rolle spielt. Je höher diese war, desto höher wurde die Kontrolle über das eigene Leben eingeschätzt. Eine geringe Freiwilligkeit der Migration ging mit einem erhöhten Stresserleben einher. 8/156 Heeren und Kollegen (2012) fanden in einer Querschnitssanalyse heraus, dass 31,4% der Asylsuchenden in der Schweiz direkt nach ihrer Ankunft die Kriterien einer Depression erfüllten. An einer Posttraumatischen Belastungsstörung litten 23,3%. Die Befragten kamen aus Asien, Afrika und dem Balkan. Die Mehrheit der Befragten gab an, dass Krieg und politische Verfolgung der Grund für die Flucht gewesen seien. In einer noch unveröffentlichten Studie von Nater-Mewes (2016) zeigte sich, dass 60% von 141 untersuchten Asylsuchenden innerhalb eines Jahres nach Ankunft im Migrationsland eine PTBS und 61% eine Depression entwickelten. Depression und Posttraumatische Belastungsstörungen sind die größten psychischen Belastungen unter Geflüchteten. Dies zeigt sich auch in einer 161 Artikel umfassenden MetaAnalyse von Steel, Chey, Silove, Marnane, Bryant und van Ommeren (2009). Diese liefert Auskunft über 81.866 Menschen aus 40 verschiedenen Ländern und zeigte, dass die höchsten Prävalenzzahlen für psychische Störungen bei Geflüchteten bei depressiven und posttraumatischen Störungen zu finden waren. Es zeigte sich eine Prävalenz von 30,8% für Depression und von 30,6% für Posttraumatische Belastungsstörungen. Geflüchtete leiden somit wesentlich häufiger an psychischen Störungen als die deutsche Population. Trotz der Belastung, die mit diesen psychischen Störungen einhergeht und den sehr hohen Prävalenzzahlen, werden nur ca. 4% der erkrankten Geflüchteten in Deutschland behandelt (BPtK, 2015). Demir, Reich & Mewes (2015) haben das Konzept einer Psychoedukationsgruppe für Geflüchtete entwickelt, damit diesen niedrigschwellig in kurzer Zeit geholfen werden kann. Neben den Informationen für die Geflüchteten selbst ist es jedoch auch wichtig, dass die engsten Kontaktpersonen der Geflüchteten Informationen über psychische Störungen sowie über Hilfs- und Umgangsmöglichkeiten erhalten. Ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer von Geflüchteten haben engen Kontakt zu Geflüchteten und können großen Einfluss darauf nehmen, wie mit einer psychischen Störung bei Geflüchteten umgegangen wird. Sie können durch eine Erweiterung ihres Wissens über Störungsbilder und Möglichkeiten der Hilfe, sowie durch eine Erweiterung ihres Handlungsspektrums dazu beitragen, dass Störungen schneller erkannt werden und somit der von Koch (2005) postulierten Tatsache entgegenwirken, dass Zugewanderte sich erst in Behandlung begeben, sobald sich die Störung manifestiert und chronifiziert hat. Im nächsten Abschnitt soll näher darauf eingegangen werden, wie sich die oben genannten psychischen Störungen zeigen, wie sie klassifiziert und erklärt werden können. Zuerst wird 9/156 auf die depressive Störung, dann auf die Posttraumatische Belastungsstörung und dann auf Suizidalität eingegangen. 10/156 Zusammenfassung und Vortragshinweise zu den Folien: Übersichtsfolie zu den häufigsten psychischen Störungen unter Geflüchteten Das ist die dritte Folie des Vortrags. Sie dient als einleitende Folie. Dazu könnte bspw. gesagt werden: „Die häufigsten psychischen Störungen bei Geflüchteten sind Depression und die Posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS oder auch auf Englisch (Verweis auf die Folie) Post Traumatic Stress Disorder. Diese stellen wir Ihnen nun näher vor.“ 11/156 Prävalenz von Depression bei Deutschen und Geflüchteten Obig ist die fünfte Folie des Vortrags abgebildet. Auf ihr soll deutlich werden, dass Geflüchtete im Vergleich zu der deutschen Population häufiger an Depressionen leiden. Dazu könnte bspw. gesagt werden: „Im Laufe Ihres Lebens leiden ca. 17,1% der Deutschen an Depression. Insgesamt leiden damit zu einem gegebenen Zeitpunkt ca. 3,1 Millionen Menschen zwischen 18 und 65 Jahren in Deutschland unter einer Depression. Weltweit wird die Zahl auf ungefähr 120 Millionen Erkrankte geschätzt. Heeren und Kollegen haben eine Studie mit 86 Asylsuchenden direkt nach der Ankunft im Migrationsland durchgeführt. Das bedeutete, dass sie zwischen drei und 15 Monaten in der Schweiz gelebt hatten. Dabei erfüllten 31% der Geflüchteten die Kriterien einer Depression. Die Teilnehmer/innen waren größtenteils aus Asien, Afrika und dem Balkan. Die Mehrheit der Befragten gab an, dass Krieg und politische Verfolgung der Grund für die Flucht war.“ 12/156 Prävalenz von PTBS bei Deutschen und Geflüchteten Das ist die zehnte Folie des Vortrags. Auf dieser soll deutlich gemacht werden, dass Geflüchtete wesentlich häufiger an einer Posttraumatischen Belastungsstörung leiden als Deutsche. Die Zahlen variieren jedoch stark. Dazu könnte Folgendes gesagt werden: „Im Laufe ihres Lebens leiden ca. 1,5 bis 2% der Deutschen an einer PTBS. Geflüchtete leiden wesentlich häufiger daran. Die Zahlen variieren stark und liegen zwischen 23% und 60%. Das liegt daran, dass bei jeder Studie eine unterschiedliche Anzahl an Menschen aus unterschiedlichen Ländern kommen und daran, dass die Untersuchungszeiträume verschieden sind.“ 13/156 3.2.1. Depression (Anna Enrica Strelow) „Unipolare Depressionen” sind „affektive Störungen, für die das Vorliegen von depressiven Symptomen bei Abwesenheit von (hypo-)manischen Symptomen charakteristisch ist” (Berking & Rief, 2012. S.29). Das bedeutet, dass bei Vorliegen einer depressiven Symptomatik diese von anderen Störungsbildern, wie bspw. einer bipolaren affektiven Störung oder einer Manie abzugrenzen ist. Bei depressiven Episoden wird nach ICD-10 (Dilling et al., 2011) zwischen Kern- und Nebensymptomen unterschieden. Das ICD-10 ist ein Klassifikationssystem, in dem alle psychischen, physischen und psychosomatischen Erkrankungen beschrieben sind. Neben der Auflistung der Erkrankungen finden sich dort auch die Symptome, unter denen die Betroffenen leiden. Es gibt drei Kernsymptome und sieben zusätzliche Symptome, unter denen eine depressive Person leiden kann. Als erstes Kernsymptom einer depressiven Episode zählt nach ICD-10 (Dilling et al., 2011) eine depressive Stimmung, die unabhängig von den äußeren Umständen in einem für die betroffene Person ungewöhnlichem Maße auftritt und allgemein präsent ist. Im AMDP-System (Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie [AMDP], 2016, S.89 & 90), in dem psychologische Begriffe einheitlich erklärt und definiert werden, wird „deprimiert” als ein weites Spektrum von Gefühlen definiert, das von einem Traurigkeitsempfinden bis zu einem Gefühl der „unbeschreiblichen inneren Qual” reichen kann. So kann die Ausprägung von Person zu Person völlig verschieden sein. Eine betroffene Person könnte beispielsweise von genereller Deprimiertheit berichten, ohne dass ihr das von außen anzusehen wäre, sie könnte jedoch auch von heftigem Weinen gebeutelt erscheinen oder sich vor Schmerz erstarrt zeigen. Als zweites Kernsymptom zählt Interessenverlust und Verlust der Freude an Dingen, die der betroffenen Person früher Freude bereitet haben. Zudem kann ein verminderter Antrieb und/oder eine gesteigerte Ermüdbarkeit als drittes Kernkriterium mit einer depressiven Episode einhergehen (Dilling et al., 2011). Im AMDP-System (AMDP, 2016, S.103 & 104) wird weiterhin zwischen Antriebsarmut, welche als ein Mangel an Energie, Initiative und Interesse beschrieben wird, der sich dadurch auszeichnet, dass die betroffene Person weder eigene Initiative zeigt, noch sich von außen zu Aktivitäten anregen lässt und Antriebshemmung unterschieden. Antriebshemmung zeichnet sich dadurch aus, dass die Person zwar Pläne äußert, sich jedoch als gehemmt erlebt und somit keine Aktion stattfinden kann. Es werden im ICD-10 (Dilling et al., 2011) sieben Nebenkriterien benannt, die von Berking und Rief (2012) durch zusätzliche Merkmale ergänzt werden. Das erste Nebenkriterium ist 14/156 der Verlust des Selbstvertrauens oder des Selbstwertgefühls. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, wie bspw. Lernen, Lesen oder das Bewältigen einer kurzen Wanderstrecke ist eingeschränkt, des Weiteren kann der Wert der eigenen Person als sehr gering empfunden werden. Selbstvorwürfe, die von außen als unbegründet eingestuft werden oder Schuldgefühle, die als unangemessen angesehen werden, sind das zweite Kriterium. Die betroffene Person könnte sich bspw. selbst die Schuld für ihre Störung geben und sich Vorwürfe machen, dass sie die Menschen in ihrem Umfeld stark belastet. Gedanken an den Tod oder an Suizid, die regelmäßig vorkommen oder auch suizidales Verhalten sind das dritte Symptom der Nebenkriterien. Dazu können bspw. wiederkehrende Gedanken an den eigenen Tod, die konkrete Planung des eigenen Tods, sowie auch suizidale Handlungen gehören. Im Kapitel 3.2.3 wird das Thema Suizidalität noch weitergehend beschrieben. Ein geringeres Denk- und Konzentrationsvermögen, sowie eine eingeschränkte Fähigkeit, Entschlüsse zu fassen, sind das vierte Symptom einer depressiven Episode. Dazu kann das Gefühl der Person gehören, sich nicht mehr auf alltägliche Dinge, wie Lesen, Fernsehgucken oder ein Treffen mit Freundinnen oder Freunden konzentrieren zu können. Des Weiteren kann es dazu kommen, dass es den betroffenen Personen sehr schwer fällt, Entscheidungen, auch der alltäglichen Art (‚Was ziehe ich heute an?‘, ‚Welches Shampoo sollte ich benutzen?‘), zu treffen. Das AMDP-System (AMDP, 2016) fasst unter Denkstörungen verschiedene Arten zusammen. So kann es bspw. zu einer Gehemmtheit, also einer subjektiv empfundenen Blockierung im Denken oder zu einer Verlangsamung des Denkens kommen. In AMDP-System (AMDP, 2016) wird als Beispiel für eine gestörte Konzentrationsfähigkeit genannt, dass es den Personen schwer falle, leichte Rechenaufgaben im 100er-Bereich zu lösen. Das fünfte Nebenkriterium ist sehr divers beschrieben. Einerseits kann es bei depressiven Personen zu einer Hemmung der Psychomotorik kommen. Das bedeutet, dass die körperliche Bewegung sehr stark herabgesetzt ist – die betroffene Person könnte dann bspw. viel im Bett liegen und sich kaum bewegen. Andererseits nennt das Kriterium auch eine psychomotorische Agitiertheit. Das AMDP-System (AMDP, 2016, S.105 & 106) beschreibt mit „motorisch unruhig” Patientinnen und Patienten, die sich ständig bewegen, ohne dass diese Bewegung ein Ziel hätte – bspw. ungerichtetes Umherlaufen, Wippen mit den Füßen oder auch Kratzbewegungen und Händeringen. Das sechste Kriterium sind Schlafstörungen jeder Art. Das AMDP-System (AMDP, 2016, S.135-139) listet hier unter anderem Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen oder auch Früherwachen auf. Diese führen entweder dazu, dass die Person weniger schläft als sie 15/156 eigentlich bräuchte und tagsüber deswegen müde ist. Andererseits gehört auch stark vermehrtes Schlafen zu diesem Kriterium. Das letzte Kriterium kann in der Ausprägung dualistisch sein. Einerseits kann es zu einem Appetitverlust kommen, der sich bspw. dadurch auszeichnet, dass keine Lieblingsspeise mehr genannt werden kann oder sich zum Essen gezwungen werden muss (AMDP, 2016, S.139 & 140). Andererseits kann es zu einem gesteigerten Appetit kommen, der sich in einer gesteigerten Esslust, dem verstärkten Genuss von bestimmten Nahrungsmitteln (z.B. Snacks, wie Chips oder Süßigkeiten) oder auch „Fressattacken” äußern (AMDP, 2016, S.140). Berking und Rief (2012, S.31) berichten zusätzliche zu den Kern- und Nebenkriterien noch weitere Symptome. Diese und die Symptome des ICD-10 teilen sie in vier Kategorien ein. Diese Kategorien verdeutlichen, dass sich depressive Symptome auf verschiedenen Ebenen des körperlichen und seelischen Empfindens auswirken können. Die erste Kategorie heißt Affektive Symptome, also Symptome, die die Gefühlslage betreffen. Zu denen können Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Verzweiflung, Interessen- und Freudlosigkeit, Ängstlichkeit, das Gefühl innerer Leere, Reizbarkeit, Feindseligkeit, Einsamkeit, Gefühl der Entfremdung und Distanz zur Umwelt gehören. Die zweite Kategorie wird Kognitive Symptome genannt, bezieht sich also auf die durch die Störung veränderten Gedanken. Diese bezieht negative Gedanken und Einstellungen gegenüber der eigenen Person und der Zukunft, Pessimismus, Hoffnungslosigkeit, ständiges Grübeln, permanente Selbstkritik, Selbstunsicherheit, Denk-, Konzentrations-, Gedächtnisund Entscheidungsprobleme, Einfallsarmut, Gedanken an den Tod und Wahnvorstellungen mit ein. Die dritte der Kategorien bilden die Motivational-behaviorale Symptome, also solche, die sich auf das Verhalten der betroffenen Personen beziehen. Zu ihr gehören Antriebslosigkeit, Verringerung des Aktivitätsniveaus, sozialer Rückzug, verlangsamte Sprache und Motorik bis hin zum katatonen Stupor, aber auch Agitiertheit, Suizidhandlungen, Vermeidungsverhalten und Probleme bei der Bewältigung alltäglicher Anforderungen. Die vierte dieser Kategorien bezieht sich auf somatisch-viszerale Veränderungen durch die Störung. Also Veränderungen, die sich in der Körperlichkeit der betroffenen Person ausprägen. Sie beinhaltet Schlafstörungen, Energieverlust, leichte Ermüdbarkeit, Appetit- und Gewichtsveränderungen, Libidoverlust, gesteigertes oder erniedrigtes psychophysiologisches Erregungsniveau, innere Unruhe, Weinen, leises, monotones und langsames Sprechen, kraftlose und spannungsleere Körperhaltung, tageszeitliche Schwankungen im Befinden, vegetativ-somatische Beschwerden und erhöhte Schmerzempfindlichkeit. Bei dieser großen Anzahl von Symptomen zeigt sich, dass Störungsausprägungen so divers wie die Menschen selbst sein können. Klassifikationssysteme helfen Ordnung in diese Viel16/156 zahl zu bringen, damit Hilfe sich an den speziellen Problemen des Menschen orientieren kann. Bei Seiedin (2005. S. 128) kommt Herr K. zu Wort, ein Geflüchteter aus dem Iran, der 33 Jahre alt ist und seine Geschichte erzählt: „Seit ca. einem Jahr lebe ich als Flüchtling und Asylbewerber in Deutschland. Im Iran habe ich Theologie studiert. Während des Studentenaufstands wurde ich verhaftet. Ich habe ein halbes Jahr in Einzelhaft verbracht und wurde gefoltert. Mein Freund starb nach wenigen Tagen an den Folgen der Folter. Ich wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt. Während des Gefängnisaufenthalts habe ich zwei Selbstmordversuche unternommen. Die Flucht hat mehrere Monate gedauert und war sehr schwierig und belastend. Mein Asylantrag wurde hier abgelehnt. Die Zeit hier ist seelisch belastend. Zeitweise habe ich drei Monate alleine in einem Hotel gelebt, ohne nähere Kontakte. Später habe ich eine Wohnung zugeteilt bekommen und musste gemeinnützige Arbeiten wie Straßenreinigung verrichten. Diese ‚Zwangsarbeit‘ war für mich sehr kränkend und entwertend. Ich habe mich sehr geschämt, wenn ich von Bekannten und Landsleuten beim Straßenkehren gesehen wurde. Der zuständige Sachbearbeiter im Sozialamt ist sehr streng und ablehnend. Alle Versuche, eine andere Arbeit in nicht öffentlichen Stellen zu bekommen, sind gescheitert. Diese Konfliktsituation und die Fremdbestimmung reaktivierten in mir die im Heimatland gemachte Erfahrung der Unterdrückung und Folter. Zeitweise habe ich wohl sehr massive aggressive Phantasien gehabt, die mir dann Angst machten. Als Reaktion bin ich in eine Resignation und Hoffnungslosigkeit verfallen. [...] Ich bin einsam und fremd und habe keine Hoffnung. Meine Zukunft ist ungewiss und unsicher. Ich habe das Gefühl, diesen Umständen entfliehen zu müssen. Ähnlich wie ich von zu Hause geflohen bin.“ Es zeigt sich, dass Herr K. nicht nur unter den Erlebnissen auf der Flucht leidet, sondern, dass ihm auch die einschränkenden Regeln und die negativen Bedingungen im Ankunftsland zu schaffen machen. Dazu kommt, dass die Umstände dazu führen, dass sein Hoffnungslosigkeits- und sein Einsamkeitsempfinden sich weiter verstärken. Diese Fallbeispiel zeigt eindrücklich, weshalb Geflüchtete häufiger an psychischen Störungen leiden und, dass die Bedingungen im Ankunftsland einen großen Einfluss auf die psychische Gesundheit der Geflüchteten haben. Bei der Klassifikation einer depressiven Episode ist sicherzustellen, dass sie, unabhängig vom Schweregrad, länger als zwei Wochen dauert, keine klinisch bedeutsamen (hypo)manischen Symptome auftraten oder -treten und die andauernde Episode nicht durch einen Missbrauch psychotroper Substanzen oder auf eine organische Störung zurückzuführen ist. 17/156 Depressive Episoden werden nach dem ICD-10-Katalog (Dilling et al., 2011, S.110-113) in leicht, mittelgradig oder schwer eingeteilt. Der Schweregrad der Depression wird anhand der Anzahl der Symptome, die die betroffene Person zeigt, unterschieden. Bei zwei vorliegenden Kernsymptomen und insgesamt vier bis fünf vorliegenden Kriterien (unabhängig davon, ob es Kern- oder Nebensymtome sind), wird von einer „leichten depressiven Episode” gesprochen. Bei dem Vorhandensein von zwei Kernkriterien und insgesamt sechs bis sieben der Kriterien wird von einer „mittelgradigen depressiven Episode” gesprochen. Bei der Erfüllung aller drei Kernkriterien und zusätzlich mindestens fünf der Nebenkriterien, sodass insgesamt mindestens acht Kriterien erfüllt sind, wird von einer „schweren depressiven Episode” gesprochen (ebd., S.110-113). Zu der leichten und mittelgradigen depressiven Episode kann zusätzlich angegeben werden, ob ein Somatisches Syndrom vorliegt. Das Somatische Syndrom ersetzt nach Berking und Rief (2012, S.32) die Bezeichnung der „endogenen” oder „reaktiven” Depression. Darunter fallen nach ICD-10 (Dilling et al., 2011) acht Symptome, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie bei einer Vielzahl der „schweren depressiven Episoden” vorliegen. Daher wird das Syndrom in der Regel nicht für schwere depressive Episoden kodiert. Vier dieser acht Symptome sollten vorhanden sein, um das Somatische Syndrom zu kodieren. Zu den Symptomen des Somatischen Syndroms gehören ein deutlicher Interessenverlust, eine mangelnde emotionale Schwingungsfähigkeit, Früherwachen, ein Morgentief, sowie ein deutlicher Appetit-, Gewichts- und Libidoverlust und der objektive Befund ausgeprägter psychomotorischer Hemmung oder Agitiertheit (ICD-10, Dilling et al., 2011). Berking und Rief (2012) geben an, dass das Vorhandensein des somatischen Syndroms zusätzlich zu der depressiven Episode mit einem höheren Suizidrisiko einhergehen kann. Von daher ist das Klassifizieren von diesem eine (lebens)wichtige Information. Dysthymie kann als eine lange, meist monatelang andauernde, nicht derart stark ausgeprägte Depression verstanden werden. Bei dieser Störung werden die Kriterien für eine depressive Episode nicht erfüllt, die betroffene Person berichtet aber dennoch bspw. von Müdigkeit, schlechter Stimmung und einem Gefühl der Unzulänglichkeit (ICD-10, Dilling et al., 2011). Nach einer ersten depressiven Episode, liegt das Wiedererkrankungsrisiko bei 50%, bei zwei oder drei depressiven Episoden bei 70% und 90% (Berking & Rief, 2012). So zeigt sich eindrucksvoll, dass frühe, intervenierende Maßnahmen, die Rezidive verhindern können, dazu führen, dass Störungsverläufe weniger chronisch werden und betroffene Personen sich schneller wieder besser fühlen. 18/156 Im DSM-5 (APA et al., 2015), das ein weiteres Klassifikationssystem neben dem ICD-10 ist, sich jedoch nur auf psychische Störungen bezieht, werden neben einer negativen Affektivität auch belastende Ereignisse in der Kindheit sowie stressassoziierte Lebensereignisse als Risikofaktoren für eine Depression genannt. Eine Migration und die darauf folgende Akkulturation, die als Bewältigung der Spannung zwischen der Kultur des Heimatlandes und des Migrationslandes verstanden wird, enthalten viele mögliche Stressoren. Dazu können bspw. Trennung, Verlust der Bezugspersonen, Identitäts- und Rollenschwierigkeiten, Orientierungslosigkeit bezüglich der Zukunft, unfreiwillige Unterbringung, sprachliche und kulturelle Verständigungsschwierigkeiten, Generationskonflikte, finanzielle Probleme und Diskriminierungserfahrung gehören (Kizilhan, 2013). 19/156 Zusammenfassung und Vortragshinweise zu den Folien: Kernsymptome und Auswirkungsebenen einer Depressiven Störung Das ist die vierte Folie des Vortrags. Sie stellt die Kernsymptome der Depression dar und legt die Ebenen dar, auf denen sich Symptome der Depression äußern können. Dazu könnte unter anderem gesagt werden: „Merkmale, wie eine traurige oder auch depressive Verstimmung, kennt jeder. Man kann unter anderem traurig werden, wenn man einen traurigen Film guckt. Manchmal ist einem auch nicht zum Lachen zu Mute oder man hat mal keine Lust aufzustehen. Bis dahin ist das völlig unauffällig, wenn jedoch solche Symptome länger als zwei Wochen andauern, übersteigen sie die normale Intensität. Wenn man zum Beispiel morgens fast zwei Stunden zum Aufstehen braucht oder man keine Energie mehr zum Duschen oder Rasieren hat oder ohne ersichtlichen Grund anfängt zu weinen, kann es sein dass man an einer depressiven Störung leidet. Das kann sich dann auf vier Ebenen auswirken. Erstens auf der Ebene der Gedanken. Bspw. hat man nur noch negative Gedanken, man ist von Hoffnungslosigkeit, Konzentrations- und Denkstörungen geplagt und fragt sich dauernd, warum es einem so schlecht geht. 20/156 Zweitens auf der Ebene Gefühle. Man kann Gefühle von Traurig- und Freudlosigkeit haben, sich leicht gereizt fühlen, das Interesse an Dingen verlieren, die einem eigentlich Freude bereitet haben und sich leer fühlen. Drittens auf der Ebene des Verhaltens. Dadurch, dass man sich antriebslos fühlt, zieht man sich von sozialen Aktivitäten zurück, vermeidet vielleicht sogar gewisse Aktivitäten, wie bspw. ein Treffen mit den Freunden, und fühlt sich schon bei alltäglichen Aufgaben überfordert. Es kann auch zu Suizidgedanken oder Suizidhandlungen kommen. Viertens können sich Symptome auf der körperlichen Ebene zeigen. Es kann unter anderem zu Schlafstörungen kommen, zu Appetitveränderungen, zu Weinen und somatischen Beschwerden, wie z.B. Bauchweh oder Drücken im Magen. Depressive Störungen gehen bei den Betroffenen häufig mit einem hohen Leidensdruck einher, da es ihnen gar nicht oder nur sehr schwer gelingt, ihr eigenes Leben zu meistern. Die Störung beeinflusst, wie kaum eine andere Störung, das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl der betroffenen Person.“ 21/156 3.2.2. Die Posttraumatische Belastungsstörung (Anna Enrica Strelow) Eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) wird als „eine mögliche Folgereaktion auf ein traumatisches Ereignis” verstanden (Berking und Rief, 2012, S.105). „Das traumatische Ereignis wurde hierbei von einer Person selbst erlebt oder an fremden Personen beobachtet”(ebd.). Das DSM-5 (APA, 2015) definiert einen traumatischen Stressor oder auch ein traumatisches Ereignis als eines, dass mit dem Tod oder einer ernsthaften Todesgefahr, einer schweren Verletzung oder sexueller Gewalt assoziiert ist. Dabei kann die eigene Person, ein Familienmitglied, eine nahe Freundin oder ein Freund betroffen sein. Es kann das Gefühl bei der/dem Betroffenen entstehen, sich hilflos zu fühlen und sich nicht wehren zu können. Zu traumatischen Stressoren können zum Beispiel Kriegserfahrungen, körperliche Übergriffe, Entführung, Terroranschläge, Katastrophen oder auch schwere Verkehrsunfälle gehören. Um die Störung eindrücklich darzustellen, dient die Erkrankungsgeschichte Ayoubs (entnommen und frei nacherzählt aus Weltgesundheitsorganisation et al., 2012, S. 223-225). Ayoub, ein 32-jähriger Kraftfahrer, der früher in Kuwait arbeitete, wurde in einem Zustand akuter Panik in eine psychiatrische Ambulanz gebracht. Während der Untersuchung veränderte sich die Stimmung Ayoubs immer wieder. Er schwankte zwischen ängstlichem Hyperventilieren und Aggressionsausbrüchen, während derer er feindselig wurde und gegen die Wand schlug. Es kam auch vor, dass er sich ausdruckslos darüber beklagte, dass er einerseits nichts fühlen könne und andererseits beschrieb, lebhafte Erinnerungen an seine Zeit in Kuwait nicht loszuwerden. Während dieser Zeit habe er die Invasion der Iraker erlebt, infolge derer er gefangen genommen und gefoltert wurde. Zudem habe er einen schweren Schock erlitten als seine Schwester vor seinen Augen vergewaltigt wurde. Seitdem leide er an Albträumen und sich aufdrängenden Erinnerungen an seine Folter und die Vergewaltigung seiner Schwester. Zudem habe er Angstzustände, die mit Schreien und aggressivem Verhalten einhergingen. Auch wenn er unter aufdrängenden, sehr lebhaften Erinnerungen litt, fiel es ihm doch schwer sich an einzelne Abschnitte der Zeit zu erinnern. Er vermied es, über seine Zeit in Kuwait zu sprechen. Der akute Panikzustand wurde dadurch ausgelöst, dass er eine Dokumentation über den zweiten Weltkrieg im Fernsehen gesehen habe. Ayoub erfüllt eindeutig die Kriterien einer PTBS (im ICD-10 F 43.1). Nach ICD-10 (Dilling et al., 2011, S. 127-129) gibt es vier Kriterien, welche als relevant gelten, wenn sie innerhalb von sechs Monaten nach einem kritischen Ereignis auftreten. Kriterium eins beinhaltet, dass die/der Betroffene einem Ereignis ausgesetzt war, dass als außergewöhnlich oder katastrophal eingestuft wird und bei „nahezu jedem tiefgreifende Verzweiflung” auslösen würde (ebd, S. 127). Das zweite ist erfüllt, wenn die betroffene Person 22/156 unter anhaltenden, lebendigen Erinnerungen, die auch als Wiedererleben der Belastung durch Nachhallerinnerung beschrieben werden, leidet. Diese werden auch Intrusionen genannt. Im DSM-5 wird zudem eine besondere Form der lebendigen Erinnerungen als Symptom beschrieben: Dissoziative Reaktionen, wie z.B. Flashbacks, bei denen die/der Betroffene handelt oder fühlt, als ob sich die traumatischen Ereignisse wieder ereignen würden. Dabei kann es bei den Betroffenen zu einem völligen Wahrnehmungsverlust der Umgebung kommen. Das dritte Kriterium beschreibt ein Vermeidungsverhalten den Umständen gegenüber, die mit den traumatischen Ereignissen im Zusammenhang stehen oder die/den Betroffenen daran erinnern könnten. Dazu können bspw. auch Gerüche, Gedanken und Geräusche gehören, die die betroffene Person an die Situation erinnern. Das vierte Kriterium kann zwei Ausprägungen haben, die getrennt oder gemeinsam vorliegen können. Es kann zu einer (Teil-)Amnesie kommen, also einer mangelhaften Erinnerung an Ereignisse, die mit dem traumatischen Stressor verknüpft sind, so dass die/der Betroffene sich teilweise oder vollständig nicht an wichtige Aspekte der belastenden Situation erinnern kann. Das kann auch dazu führen, dass es bei einer Befragung von Geflüchteten nach dem Fluchthergang zu widersprüchlichen Aussagen kommen kann. Das liegt dann nicht an der willentlichen Verzerrung des Geflüchteten, sondern an einem Schutzmechanismus des Gehirns. Es kann zudem dazu kommen, dass der/die Belastete Symptome einer erhöhten psychischen Sensitivität oder Erregung zeigt. Dazu gehören fünf typische Anzeichen, von denen zwei erfüllt sein müssen, damit dieses Kriterium als gegeben gelten kann. Es gehören Ein- und Durchschlafstörungen, Reizbarkeit und Wutausbrüche, sowie Konzentrationsstörungen, Hypervigilanz und erhöhte Schreckhaftigkeit dazu. Hypervilianz wird bei Reischies (2007) als ein Zustand beschrieben, der sich dadurch auszeichnet, dass die/der Betroffene überwach ist und ungerichtet auf alles in der Umgebung achtet. Im DSM-5 (APA et al., 2015) werden zudem weitere Kriterien ergänzt. Dazu gehört eine negative Veränderung von Kognitionen und der Stimmung im Zusammenhang mit den traumatischen Ereignissen. Das kann unter anderem bedeuten, dass die/der Betroffene anhaltend von negativen Annahmen überzeugt ist (bspw. ‚Die ganze Welt ist gefährlich!‘) oder in einer emotionalen Taubheit münden (Berking & Rief, 2012). Zudem kann eine PTBS mit Dissoziativen Symptomen klassifiziert werden, die dann zusätzlich zu den Symptomen der PTBS auftreten können. Dazu könnte dann entweder Depersonalisation, das als Gefühl des Losgelöstseins von dem eigenen Körper oder den eigenen Gedanken definiert wird, gehören oder eine Derealisation, die als anhaltende oder wiederkehrende Erfahrung der Unwirklichkeit der Umgebung verstanden wird (APA et al., 2015). 23/156 Symptome, die später als sechs Monate nach den kritischen Ereignissen auftreten, können auch Hinweise auf eine PTBS sein. Bei Vorliegen der relevanten Symptome, die später als sechs Monate auftreten, wird von einer PTBS mit verzögertem Beginn gesprochen (Dilling et al., 2011). Differentialdiagnostisch ist es wichtig, die PTBS von der akuten Belastungsreaktion und der Anpassungsstörung abzugrenzen. Die akute Belastungsreaktion (im ICD-10 F 43.0) kann als eher unmittelbare, nicht allzu lang anhaltende Reaktion auf eine außergewöhnliche Belastung verstanden werden. Sie kann einer PTBS vorausgehen. Die Anpassungsstörung hingegen geht von einem Ereignis aus, dass von nicht katastrophaler Art ist (wie bspw. ein leichter Autounfall, bei dem nur Sachschäden entstehen), jedoch Symptome nach sich zieht, die von affektiven Störungen bekannt sind. So kann bspw. eine Anpassungsstörung mit kurzer depressiver Reaktion diagnostiziert werden. In dem Lexikon der Psychologie von Paulzen und Casper (2014) wird betont, dass ein traumatisches Ereignis, welches meist mit dem Tod oder schweren Verletzungen assoziiert ist, bei vielen Menschen tiefe Verzweiflung auslösen würde. Das stellt den engen Zusammenhang zwischen dem Erleben katastrophenartiger Ereignisse und der PTBS dar. Eben dieser Zusammenhang lässt sich in der Querschnitssanalyse von Heeren und Kollegen (2012) zeigen, die in ihrer Studie zwei Gruppen mit jeweils 43 befragten Asylsuchenden untersuchten, die zu unterschiedlichen Zeiten in der Schweiz ankamen. Je höher die Anzahl der erlebten traumatischen Ereignisse war, desto höher war die Wahrscheinlichkeit an einer PTBS zu erkranken und desto höher war die allgemeine psychische Morbidität. Auch in der MetaAnalyse von Steel und Kollegen (2009), konnte nachgewiesen werden, dass berichtete Folter und das Erleben traumatischer Erlebnisse als stärkste Einflussfaktoren der Störung gelten können. Dennoch führt nicht jedes traumatische Erlebnis zwangsläufig zu einer PTBS. Die Art des Traumas und den damit assoziierten Umwelt- und internalen Faktoren hat einen Einfluss darauf, wie häufig sich eine PTBS ausbildet. So führen häufig Ereignisse, die von Menschen verursacht wurden, wie bspw. sexuelle Übergriffe oder interpersonelle Gewalt zu der Ausprägung der Störung (Flatten et al., 2011). Weitere Risikofaktoren können unter anderem sehr frühe Konfrontation mit dem Trauma, ein niedriger sozio-ökonomischer Status, kulturelle Besonderheiten, wie bspw. fatalistische und selbstbeschuldigende Bewältigungsstrategien oder ein erhöhtes Auftreten von Situationen, die an das traumatische Ereignis erinnern, sein (APA et al., 2015). 24/156 Die PTBS ist eine Störung, die häufig chronifiziert und meist Komorbiditäten ausbildet. Dazu gehören affektive Störungen, Angststörungen, somatoforme Störungen und Substanzmissbrauch. Bei ca. einem Drittel der Fälle lag vorher schon eine psychische Störung vor, die die Vulnerabilität an einer weiteren zu erkranken erhöht hat. Bei den restlichen Fällen war es jedoch so, dass eine weitere psychische Störung in Folge der PTBS auftrat. Es kann bspw. zu einer Substanzabhängigkeit kommen, um die Symptome der PTBS zu überdecken (APA et al., 2015; Berking & Rief, 2012) Die PTBS ist eine schwere Störung. Durch das hohe Risiko an einer weiteren psychischen Belastung zu erkranken und der Gefahr der Chronifizierung ist es sehr wichtig, dass Symptome früh erkannt werden. 25/156 Zusammenfassung und Vortragshinweise zu den Folien: Definition einer PTBS und eines traumatischen Ereignisses Das ist die siebte Folie des Vortrags. Sie definiert die Posttraumatische Belastungsstörung und stellt die Kriterien heraus, die bei einem traumatischen Ereignis gegeben sind. Dazu könnte bspw. Folgendes vorgetragen werden: „Unter einem traumatischen Ereignis wird ein Vorfall mit existentieller Bedrohung verstanden, bei welchem die Betroffenen starke Angst empfinden. Dabei kann dieses Ereignis selbst erlebt werden oder an anderen Personen, wie einer engen Freundin, einem engen Freund oder einem Familienmitglied beobachtet werden. Ein solches Erlebnis kann zum Beispiel Kriegserfahrungen, körperliche Übergriffe, Entführung, Terroranschläge, Katastrophen oder auch schwere Verkehrsunfälle beinhalten. Zu dem traumatischen Erlebnis kommt meist noch das Gefühl der Hilflosigkeit, das die Betroffenen als belastend empfinden. Das traumatische Ereignis kann zu einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) führen, aber nicht jedes traumatische Ereignis führt zu der Ausprägung einer PTBS. Ereignisse, die durch Menschen verursacht sind, werden als schlimmer empfunden und führen häufiger zu der Ausprägung einer PTBS.“ 26/156 Definition und Kernsymptome einer PTBS Das ist die neunte Folie des Vortrags. Sie definiert die PTBS und beschreibt deren Symptome. Dazu könnte Folgendes referiert werden: „Ein traumatisches Erlebnis ist eine unnormale Situation. Viele Menschen würden darauf mit Symptomen reagieren, die gleich vorgestellt werden. Wenn diese Symptome jedoch mindestens über einen Zeitraum von vier Wochen bestehen bleiben, kann von einer PTBS gesprochen werden. Die Symptome können direkt oder bis zu sechs Monaten nach dem Erlebnis auftreten. Es gibt jedoch auch Störungsverläufe, bei denen sich die Symptome noch später zeigen. Unter Intrusionen kann auch ein Wiedererleben der Symptome verstanden werden. Das bedeutet, dass die Betroffenen unter anderem unter Bildern und Flashbacks, also ein blitzartiges Wiedererleben des Traumas oder lebhaften Albträumen leiden. Sie fühlen sich dann in die traumatische Situation zurückversetzt. Diese Erinnerungen können durch ein auf das traumatische Ereignis hinweisenden Reiz ausgelöst werden. Bspw. leiden Geflüchtete während der Flucht und auch während traumatischer Ereignisse an Hunger. Wenn die oder der Geflüchtete an Hunger leidet, kann das eine Intrusion an das Ereignis auslösen. Die Befragung auf dem Amt nach den Fluchtursachen oder nach bspw. einer Gefangenschaft im Heimatland kann auch dazu führen, dass Intrusionen ausgelöst werden. 27/156 Dissoziationen, die auch als ein Weglaufen im Inneren verstanden werden, äußern sich darüber, dass nur noch wenig oder keine Interaktion mit der Außenwelt möglich ist. Die Person wirkt dann wie ‚ausgeschaltet‘ und kann bspw. keinen Blickkontakt mehr halten. Zudem vermeiden die Betroffenen häufig Personen, Orte oder Situationen, die sie an das Trauma erinnern könnten. Das kennen Sie vielleicht von Ihren Eltern oder Ihren Großeltern, die nicht über ihre Kriegserfahrungen sprechen möchten. Ein weiteres Anzeichen einer PTBS kann sein, dass Menschen eine Veränderung in ihrem emotionalen Erleben empfinden. So kann es einerseits dazu kommen, dass die Stimmung sehr negativ eingetrübt ist oder sie emotional abgestumpft sind. Personen empfinden sich dann als taub und beschreiben, dass sie weder Fröhlichkeit noch Traurigkeit fühlen können. Ein weiterer Aspekt der Störung sind mangelhafte Erinnerungen und große Erinnerungslücken in Verbindung mit dem Trauma. Es kann in Folge dessen passieren, dass ein Geflüchteter keine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, weil seine Aussagen widersprüchlich und die Erzählungen in sich nicht schlüssig sind und er deswegen als ‚unglaubwürdig‘ eingestuft wurde. Zudem kann es zu einem Hyperarousal, also einer erhöhten allgemeinen Erregung kommen, die dann mit Ein- und Durchschlafstörungen, Reizbarkeit und Wutausbrüchen, sowie einer übertriebenen Schreckreaktion und Konzentrationsproblemen einhergehen kann.“ 28/156 Gründe für eine höhere psychische Belastung bei Geflüchteten Das ist die elfte Folie des Vortrags. Sie nennt einige Gründe, weshalb Geflüchtete vermehrt von psychischen Störungen betroffen sein können. Dazu könnte Folgendes gesagt werden: „Nachdem wir jetzt etwas über Depression und PTBS im Allgemeinen gehört haben, wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, warum Geflüchtete besonders häufig von psychischen Störungen betroffen sein können. Ungesicherter Aufenthaltsstatus, Angst vor Abschiebung, schlimme Ereignisse im Heimatland oder auf der Flucht, Trennung und Entwurzelung, Verlust von Familienmitgliedern oder Freunden, Identitätsprobleme und Rollenverluste, sprachliche und kulturelle Verständigungsprobleme, finanzielle Krisen und Diskriminierung sind Stressoren, denen Geflüchtete häufig ausgesetzt sind. Das kann dazu beitragen, dass es häufiger zu psychischen Störungen bei Geflüchteten kommt.“ 29/156 3.2.3. Suizidalität (Anna Enrica Strelow) 40% aller befragten Asylsuchenden berichteten in einer Studie von Neuner, Kurreck, Ruf, Odenwald, Elbert und Schaurer (2010) von Suizidplänen oder hatten sogar schon den Versuch unternommen, sich selbst zu töten. Unter Suizidalität wird der Wunsch verstanden, sein Leben zu beenden (Plener, 2015). Diese Intention lässt sich in verschiedene, zeitlich aufeinander folgende Phasen einteilen. So stehen am Anfang meist die Suizidgedanken und -wünsche, danach kommt es zur konkreten Planung, sowie der Vorbereitung des Suizids, bevor es, schlimmstenfalls zur Durchführung des Suizidversuchs kommt. Die Intention, sein eigenes Leben zu beenden grenzt suizidale Handlungen von selbstverletzenden, nicht suizidalen Handlungen ab (Plener, 2015). In einer Meta-Analyse von Cavanagh, Carson, Sharpe und Lawrie (2013) zeigte sich, dass bei 91% der Menschen, die sich selbst töteten, eine psychische Störung vorlag. Des Weiteren zeigte sich, dass affektive Störungen, sowie eine Ko-Morbidität zwischen affektiven Störungen und einem Abhängigkeitsproblem den größten negativen Einfluss auf Suizidversuche hatten. Geflüchtete haben höhere Prävalenzraten psychischer Störungen (Heeren et al., 2012; Steel et al., 2009) als die restliche deutsche Bevölkerung (Jacobi et al., 2004). Sie stellen somit eine Hochrisikogruppe für suizidale Handlungen dar. In einer großen Meta-Analyse der World Health Organisation (Stein et al., 2010) wurde der Zusammenhang zwischen erlebten traumatischen Lebensereignissen und Suizidalität erfasst. Es zeigte sich, dass ein Fünftel derer, die einen Suizidversuch hinter sich hatten, eine geliebte Person verloren hatten und ein Sechstel dieser Gruppe interpersonelle Gewalt erlebt hatte. Des Weiteren zeigte sich, dass fast alle der abgefragten, traumatischen Erlebnisse mit suizidalen Gedanken oder einem Suizidversuch verknüpft waren, bspw. war das Erleben eines Kriegs (OR5=1.3), das Erleben sexueller Gewalt (OR=2.6) oder das Erleben interpersoneller Gewalt (OR=1.9) mit einem Suizidversuch signifikant verknüpft. Zudem werden bei Plener (2015) affektive Symptomatik, soziale Isolation, Stressoren, wie bspw. finanzielle Probleme, körperliche Misshandlung sowie Pessimismus und das Gefühl überflüssig zu sein, als Risikiofaktoren für Suizidalität genannt. In der Abbildung 1 zeigt sich, 5 Das Odds Ratio (OR) gibt an, inwiefern das Risiko eines Suizidversuch in der Gruppe der Befragten, die einem der traumatischen Ereignis ausgesetzt war, höher ist, im Vergleich zu der Gruppe, die einem solchen Ereignis nicht ausgesetzt war. Ein OR = 1 bedeutet, dass es keinen Unterschied zwischen den Gruppen gibt. Ein OR > 1 bedeutet, dass es einen Unterschied zwischen den Gruppen gibt (Wirtz, 2014). 30/156 dass diese Erlebnisse häufig von Geflüchteten in Deutschland berichtet werden (BPtK, 2015). Traumatische Ereignisse, denen Geflüchtete häufig ausgesetzt sind: Abbildung 1. Quelle: BPtK, 2015, S.4. In dem Werk von Plener (2015) wird betont, dass es bei suizidalem Verhalten wichtig ist, dass die/der Betroffene sich in psychotherapeutische Behandlung begibt. Des Weiteren werden Handlungsvorschläge gemacht, wie mit suizidalen Personen umgegangen werden soll. So sind Herunterspielen des Problems (bzw. des Suizidversuchs), eine belehrende oder ermahnende Grundhaltung, Verallgemeinerungen oder (gut gemeinte) Ratschläge, der Versuch einer vorschnellen Tröstung und beurteilendes Kommentieren gefährliche Fehler im Umgang mit suizidalen Menschen, die vermieden werden sollten. Das Deutsche Bündnis gegen Depression e.V. gibt auf seiner Internetseite an, wie Angehörige mit Suizidalität umgehen und auf welche Zeichen sie achten sollten. Angehörigen wird vor allem geraten, das Thema Suizidalität bei den Betroffenen anzusprechen. Durch das Ansprechen wird der Suizid nicht provoziert. Meist ist es eine Erleichterung für die Betroffenen, darüber sprechen zu können. Zudem wird empfohlen, für die/den Betroffene/n zu sorgen. Das kann bspw. eine Begleitung zu einem ärztlichen Notdienst oder emphatisches Zuwenden sein, das zeigt, dass man ganz für die betroffene Person da ist. Der wichtigste Hinweis ist, dass Angehörige die/den Betroffene/n darin unterstützen sollen, sich professionelle Hilfe zu suchen. Nur ein/e Therapeut/in oder ein/e Psychiater/in können dem Menschen die Hilfe zukommen lassen, die er benötigt. Manchmal ist auch ein stationärer Aufenthalt notwendig, wie sich in der S3-Leitlinie Unipolare Depression (DGPPN et al., 2015) nachlesen 31/156 lässt. Bspw. wenn die/der Betroffene akut suizidgefährdet ist oder es einer medizinischen Nachversorgung bedarf, wird ein Aufenthalt in einer Klinik dringend empfohlen. Nur 23% der Befragten einer Meta-Analyse von Bruffaerts (2011) gaben an, dass sie nach irgendeiner Art des suizidalen Verhaltens psychologische Hilfe erhalten hätten. Die größten Hindernisse waren dabei, dass kein größerer Handlungsbedarf von der betroffenen Person selber gesehen wurde, nicht genügend Informationen über das Angebot verfügbar waren und gedacht wurde, dass sich der Zustand von alleine verändern würde. Im DSM-5 (APA et al., 2015) wird zudem betont, dass der größte Risikofaktor für suizidales Verhalten vergangene Suizidversuche und die Androhung eines ebendiesen sind. Diese Analyse zeigt eindrücklich, dass zu wenig suizidale Menschen Hilfe erhalten. Da Geflüchtete häufiger suizidal sind, ist die Prävention der Suizidalität in der Hilfe für Geflüchtete besonders wichtig. Aufmerksames Zuhören und das Anbieten von Hilfe bei der Suche nach professioneller Hilfe könnten diesen Zustand deutlich verbessern und Suizide verhindern. 32/156 Umgang mit Suizidalität Das ist die 33. Folie des Vortrags. Auf der Folie geht es darum, wie suizidalen Menschen geholfen werden kann. Dazu kann Folgendes gesagt werde: „Suizidalität wird als der Wunsch verstanden, sein Leben zu beenden. In einer Studie von Cavanagh, Carson, Sharpe und Lawrie aus dem Jahr 2013 zeigte sich, dass 91% der Menschen, die sich selbst töteten, eine psychische Störung vorlag. Geflüchtete sind anfälliger für psychische Störungen und sind somit eine besonders gefährdete Gruppe. Falls sich der Verdacht erhärtet, dass ein/e Geflüchtete/r suizidal ist, ist es besonders wichtig, mit der/dem Betroffenen empathisch über diesen Verdacht zu sprechen. Durch das Ansprechen wird der Suizid nicht provoziert, eher fühlt sich die belastete Person erleichtert, dass sie mit jemandem reden kann. Zudem kann man der betroffenen Person dabei helfen, professionelle Hilfe zu suchen und sie zu Terminen begleiten. Es sollte vermieden, das Problem herunterzuspielen, eine belehrende oder ermahnenden Grundhaltung zu haben oder die Gedanken der betroffenen Person so zu kommentieren, dass sie sich beurteilt fühlt. Das kann bspw. auch durch gut gemeinte Ratschläge oder den Versuch der vorschnellen Tröstung passieren. Dann könnte sich die belastete Person nicht ernst genommen fühlen oder hätte das Gefühl, dass sie sich schämen müsste.“ 33/156 3.3. Welche kulturellen Unterschiede gibt es? (Anna Enrica Strelow) Der Begriff Geflüchtete wird häufig als Beschreibung für eine homogene Masse an Menschen verstanden. Doch dies ist nicht der Fall. Menschen flüchten aus unterschiedlichen Gründen aus unterschiedlichen Ländern. In den Ländern gibt es verschiedene Kulturen und Religionen, die sich auf das Störungsverhalten der dort lebenden Menschen auswirkt. Ein Großteil der Geflüchteten kommt aus Ländern, die islamisch oder orthodox geprägt sind. Es gibt Besonderheiten, die beachtet werden müssen, da es sonst sehr leicht zu schwerwiegenden Missverständnissen kommen kann. So können sich durch sprachliche Differenzen, den religiösen Glauben, ein anderes Rollenverständnis, ein anderes Verständnis von Körper und Störung oder durch traditionelle Heilvorstellungen ein anderer Blick auf Medizin, Ärztinnen und Ärzte und auf Psychotherapie ergeben (Assion, 2005). So kann bspw. schon ein Händedruck, der in Deutschland bei der Begrüßung üblich ist, zu Verwirrung führen. Für muslimisch-orthodox gläubige Frauen kann dieser Händedruck ein Verletzen der persönlichen Integrität bedeuten (Assion, 2005). Für eine in Deutschland aufgewachsene Person kann der abgewiesene Händedruck jedoch als eine Beleidigung der eigenen Person verstanden werden. Dabei ist das Vermeiden des Körperkontakts meist ein Ausdruck von religiöser Integrität oder auch von Scham dem eigenen Körper gegenüber (ebd.). Auch Sprachschwierigkeiten tragen häufig dazu bei, dass Migrierten nicht adäquat geholfen werden kann. So wird bspw. die türkische Phrase „başımı yedin”, die wortwörtlich übersetzt bedeutet „Ich habe den Kopf gegessen!” unter anderem dazu verwendet, um zu beschreiben, dass man „durchgedreht” ist oder den „Verstand verloren hat” (Assion, 2005, S.137). Eine in Deutschland lebende Deutsch-Türkin erklärte hierzu, dass es zudem dazu verwendet werden könne, um zu sagen, dass „man sich viele Gedanken mache”, man „traurig sei” oder „jemand einem Probleme bereite” (C.A. Toker, Persönliche Kommunikation, 4 August 2016). Assion berichtet, dass eine Dolmetscherin ihm von einer Gegebenheit erzählte, bei der ein Therapeut den fälschlich übersetzten Satz („Ich habe den Kopf gegessen!”) als einen Hinweis auf eine Psychose verstand und nachfragte, wessen Kopf gegessen worden sei (2005, S.137). Aus diesem Beispiel ergibt sich, dass es in manchen arabischen Ländern gewöhnlich ist, psychische Beschwerden über körperliche Empfindungen zu kommunizieren und Fachwissen über kulturelle Besonderheiten auch bei Anwesenheit einer/s 34/156 Dolmetscher/s/in von besonderer Wichtigkeit ist. Diese Verkörperlichung psychischer Symptome resultiert aus einem ganzheitlicheren Störungsbild, welches impliziert, dass Störungen eher als den ganzen Körper betreffend wahrgenommen werden als an einer spezifischen Stelle (Assion, 2005). Beispielsweise kann eine übermäßige körperliche Anstrengung im Türkischen durch das Beschreiben einer „vergrößerten Milz” (Dalağı şişmek) ausgedrückt werden (C.A. Toker, Persönliches Gespräch, 4 August 2016). Assion (2005, S.138) erläutert, dass diese Verkörperlichung der Symptome von behandelnden Medizinern häufig als „Ganzkörperschmerz” verstanden und somit nicht ernst genommen werden. Die folgenden Abschnitte sollen einen Einblick in den Begriff des Störungskonzeptes geben und erläutern inwiefern Kultur einen Einfluss auf dieses hat. Da das veränderte Störungskonzept maßgeblich mit dem Inanspruchnahmeverhalten und der Bewältigung von Störungen der Geflüchteten zu tun hat, soll auch auf diese Punkte gesondert eingegangen werden. Diese Informationen haben das Ziel, die Interkulturelle Kompetenz zu erhöhen, die von Koch und Assion (2011, S.303) folgendermaßen definiert wird: Interkulturelle Kompetenz ist das Resultat eines Entwicklungs- und Lernprozesses, der eine empathische, von gegenseitiger Wertschätzung getragene Kommunikation und Kooperation auch unter erschwerenden Bedingungen wie Dolmetscherbeteiligung und (anfänglicher) kultureller Fremdheit ermöglicht. Von den Autoren wird gesondert betont, dass empfundene „Fremdheit” meist nur anfänglich besteht und nicht überbewertet werden sollte. So sei es wichtig den „kulturellen Schleier” abzunehmen, weil erst dann zu den allgemein bekannten, menschlichen Problemen vorgedrungen werden könne. 35/156 Zusammenfassung und Vortragshinweise zu den Folien: Weltkarte mit Kulturkreisen Das ist die 13. Folie des Vortrags. Sie soll verdeutlichen, dass es viele Kulturen und Religionen auf der Welt gibt. Zudem lässt sich hier zeigen, dass viele Geflüchtete nicht aus dem westlichen Kulturkreis kommen und nicht als homogene Masse verstanden werden können. Dazu könnte bspw. referiert werden: „Es gibt viele verschiedene Kulturkreise auf der Welt. Hier sehen Sie eine sehr grobe Darstellung dieser. Diese halten sich nicht an Ländergrenzen und können auch in nächster Umgebung unterschiedlich ausgelegt werden. Die meisten der Geflüchteten kommen aus dem islamischen oder dem afrikanischen Kulturkreis. Sie sehen, dass Flüchtlinge somit keine homogene Masse sind, sondern individuelle kulturelle Erfahrungen mit im Gepäck haben.“ 36/156 3.3.1. Störungskonzept (Anna Enrica Strelow) Das subjektive Störungskonzept wird im Lexikon der Psychologie (Salewski, 2014, S.945) als das „kognitive, individuelle Erklärungsmodell für die Entstehung und den Verlauf einer Erkrankung” verstanden. Das bedeutet, dass verschiedene Annahmen über Symptome, Ursachen, Konsequenzen, den Verlauf einer Störung und deren Auswirkung auf die Gefühlslage der betroffenen Personen gebildet werden. Dadurch erscheint die Störung verstehbarer und es trägt somit zu einem Gefühl der Kontrollierbarkeit der Störung bei. Aus dem Störungskonzept können sich Bewältigungsstrategien entwickeln, die adaptiv und maladaptiv sein können. Wenn das Störungskonzept der Patientin/ des Patienten weit von dem der behandelnden Klinikerin oder des behandelnden Klinikers abweicht, kann das ein Grund für mangelnde Therapiemotivation sein (Salewski, 2014). Das Verständnis von Störung kann von verschiedenen kulturellen Einflüssen geprägt sein. Verschiedene Menschenbilder können bspw. einen Einfluss darauf haben, ob eine Person sich eher als passiv oder aktiv versteht (Steinkopff, 2014) und somit versucht, aktiv ihre Störung zu bewältigen oder eher passiv auf eine Heilung wartet. Kizilhan (2013, S.46) beschreibt bspw., dass Patientinnen und Patienten aus familienorientierten Gesellschaften bei Schmerz häufig in eine „passive Schonhaltung” verfallen, da sie der Annahme seien, dass „der Körper bei Schmerzen ruhen müsse”. In einem Bericht aus der psychotherapeutischen Arbeit mit Geflüchteten warnt Steinkopff (2014) vor verallgemeinernden Aussagen über „das Störungskonzept von Geflüchteten”. Dieses sei sehr heterogen und hänge unter anderem davon ab, ob die betroffene Person auf dem Land oder in der Stadt aufgewachsen sei, welcher Religion gefolgt wird, welcher sozialen Schicht sie angehört und welcher Nationalität sie zugehörig ist. Dennoch werden Beispiele, der für uns nicht gängigen Störungskonzepte vorgestellt. So haben manche Patientinnen und Patienten Steinkopffs geäußert, dass sie Störungen in kalte und warme Störungen einteilen würden. Je nachdem müssten unterschiedliche Heilmittel und auch Nahrungsmittel zu sich genommen werden, damit eine Linderung eintritt. Zudem wurde häufig die Überzeugung vertreten, dass religiöse Rituale bei körperlichen und psychischen Symptomen wirksam seien. In diesen Beispielen zeigt sich, dass Kultur und auch Religion sich darauf auswirken, wie Krankheit und Störung verstanden werden. In den folgenden Kapiteln sollen verschiedene Einflüsse detaillierter vorgestellt werden, die auf das Störungskonzept wirken können. 37/156 Zusammenfassung und Vortragshinweise zu den Folien: Warnende Worte vor Kategorisierung und Verallgemeinerung Das ist die 16. Folie des Vortrags. Sie soll nach dem erworbenen Wissen über das kulturspezifische Störungskonzept davor warnen, die Informationen zu verallgemeinern oder zu kategorisieren. Dazu könnte Folgendes referiert werden: „Das Wissen um andere Kulturen kann uns in vielen Fällen helfen, Geflüchtete zu verstehen, um ihnen so besser helfen zu können. Jedoch kann von der Herkunft eines Menschen nicht darauf rückgeschlossen werden, welches Verständnis von Störung sie/er hat oder wie sie/er tickt. Dafür muss jeder Mensch erst kennengelernt werden. Von daher sollte das Wissen über die Herkunftsgesellschaft der Geflüchteten nicht verallgemeinert werden, sondern soll als Interpretationshilfe für gezeigtes Verhalten dienen. So kann die kulturelle Färbung von Problemen erkannt und verstanden werden, damit dann zu den allgemein bekannten menschlichen Problemen vorgedrungen werden kann. Gesellschaften sind nie homogen, auch Deutsche sind nicht alle gleich. Beispielsweise gibt es in Syrien große Unterschiede zwischen der städtischen Bevölkerung, wie z.B. in Damaskus, die sehr modern ist und der ländlichen Region, die von Tradition geprägt ist.“ 38/156 3.3.2. Kollektivistische Gesellschaften im Vergleich zu individualistischen Gesellschaften (Anna Enrica Strelow) Ein migrierender Mensch hat grundsätzlich die Aufgabe, die Kultur seines Heimatlandes mit der des Migrationslandes in seiner Person zu vereinen, also eine transkulturelle Identität zu bilden. Bei Migrierten aus familienorientierten oder eher kollektivistischen Gesellschaften zeigt sich, dass sie sich sehr lange an der Identität des Heimatlandes festhalten. Diese ist im Gegensatz zu der eher individualistisch-westlich geprägten Identität, die in Deutschland vorherrscht, von einem recht großen Kollektiv wie bspw. der Familie oder der Dorfgemeinschaft geprägt (Kizilhan, 2013). Syrische Geflüchtete machen zurzeit den größten Teil der Asylsuchenden aus. Syrien liegt im Nahen Osten und lässt sich eher dem kollektivistischen Gesellschaftsmodell zuordnen. Bei dem Modell der sozialen Identität und Deindividuation (Reicher et al., 1995) wird zwischen der persönlichen Identität, die sich durch individuelle Eigenschaften definiert, und der sozialen Identität unterschieden. Diese wird als ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe und deren Merkmalen verstanden. Je nachdem welche Identität vorherrscht, ändert diese das Verhalten in Situationen. Es scheint so, dass bei familienorientierten oder auch kollektivistischen Gesellschaften die soziale Identität stärker ausgeprägt ist und dadurch bei Handlungen die Gedanken an das Kollektiv meist vorherrschen. Daher lernen Kinder häufig in ‚Wir‘-Begriffen zu denken und es findet eine starke Orientierung an Werten, Normen und Religion der sozialen Gruppe statt. Eine große Angst der Mitglieder ist es, der Grund für eine Beschämung des Kollektivs zu sein und somit für einen Gesichtsverlust der Gruppe verantwortlich zu sein. Das hat die Folge, dass das Privatleben zu einem großen Teil von kollektiven Interessen und der Gruppe mitbestimmt wird (Kizilhan, 2013). Deutschland ist von einem individuellen Gesellschaftskonzept geprägt. Das bedeutet, dass die Identität im Individuum und nicht in einem sozialen Netzwerk begründet wird, eher in ‚Ich‘-Begriffen gesprochen wird und die freie Meinungsäußerung ein höheres Ziel darstellt als die Bewahrung der Harmonie (ebd.). Ein großer Unterschied zeigt sich auch in den Empfindungen, die nach einem Fehltritt beschrieben werden. Während Menschen in Deutschland sich nach Fehlern tendenziell eher schuldig fühlen und von einem Verlust der Selbstachtung sprechen, wird in kollektivistischen Gesellschaften häufig ein Schamgefühl berichtet, das mit einem Gesichtsverlust der eigenen Person und der Gruppe einhergeht (Kizilhan, 2013). Das enge Netz an sozialen Kontakten in kollektivistischen Gesellschaften bietet im Gegenzug zu sozialen Verpflichtungen Schutz, Loyalität sowie emotionale und materielle Unterstützung. Eben dies kann ein wirksamer protektiver Faktor bei hohen Belastungen, wie bspw. einer Migration sein. Somit ist das starke Orientieren an traditionellen Werten des 39/156 Heimatlandes eine mögliche Bewältigungsstrategie, um mit dem Prozess der Migration umgehen zu können (Kizilhan, 2013). Dieses kollektivistische Denken kann sich auf die Ausbildung des Störungskonzeptes auswirken. Da jedes Individuum verantwortlich für den Erhalt des Kollektivs ist, können psychische Störungen als Schwäche gesehen werden, für die sich geschämt werden muss, da sie eine Labilität in der Gruppe aufzeigen. Denn diese Gruppe ist eigentlich dafür zuständig, dass psychische Konflikte aufgefangen und gelöst werden (ebd.). Aus diesem Grund werden häufig psychische Probleme über körperliche Beschwerden geäußert. Für diese muss das Individuum sich nicht schämen, da das Kollektiv auf diese keinen Einfluss hat (Kizilhan, 2013). Des Weiteren soll die Familie durch das Äußern psychischer Probleme nicht belastet oder sogar entehrt werden. Kizilian (2013, S.29) erörtert, dass „kollektiv-dysfunktionale Kognitionen”, wie starke Angst vor einem Ehrverlust, dazu führen können, dass bspw. das Erleben sexueller Gewalt tabuisiert wird. Zudem kann die Spannung zwischen dem subjektiven Streben nach dem Selbst und der kollektiven Orientierung die Entwicklung von Anpassungsstörungen, Entwicklungsproblemen oder Integrationsschwierigkeiten fördern. Eine Folgewirkung der Kollektivorientierung auf das Störungsverständnis zeigt sich nach Kizilhan (2013) häufig in der Kommunikation über Störungen. Sie ist primär von einem harmoniegenerierenden Beziehungsaufbau geprägt. Über die Störung wird häufig nebenbei, bildhaft und über Umwege gesprochen und auch Gestik und Mimik sind sehr ausdrucksstark und können häufig als indirekte Aussagen an den Gegenüber verstanden werden. Körperliche Beschwerden stehen meist im Fokus der Störungskommunikation, welche häufig mit der Folgewirkung auf das Kollektiv in Verbindung gesetzt werden. Kizilihan (2013, S.47) erörtert, dass die „imaginäre Familie in der Einzeltherapie” durch die/den Patient/in/en anwesend ist, da die Auswirkungen der körperlichen Schmerzen mit der Familie in Verbindung gebracht werden („Mein Rückenschmerz führt dazu, dass ich nicht arbeiten kann und nicht in der Lage bin, meine Familie zu versorgen […]”). Erst bei gewonnenem Vertrauen kann über psychische Konflikte gesprochen werden. Es kann dazu kommen, dass die betroffene Person äußere Bedingungen oder einen Fehler in der Gruppe für ihre/seine Probleme verantwortlich macht, auf diese sie/er dann nur beschränkt einwirken kann. So zeigte sich zum Beispiel in einer Studie von Reich, Bockel und Mewes (2015), dass die Therapiemotivation für Psychotherapie bei türkischen Migrant/innen/en aufgrund eines stärkeren Glaubens an übernatürliche Kräfte und aufgrund der Empfindung, dass die Kontrolle der Störung außerhalb ihres Handlungsspektrums liege, im Vergleich zu deutschen Patientinnen und Patienten ohne Migrationshintergrund geringer war 40/156 Zusammenfassung und Vortragshinweise zu den Folien: Weltkarte mit Gegenüberstellung von individualistischem Kulturkreis (bspw. Deutschland) und kollektivistischem Kulturkreis (bspw. Syrien) Das ist die 14. Folie des Vortrags. Anhand ihrer soll erläutert werden, dass Deutschland eher von einem individualistischen Gesellschaftskonzept geprägt ist, während bspw. in Syrien ein eher kollektivistisches Gesellschaftskonzept vorherrscht. Dazu könnte bspw. referiert werden: „Deutschland zählt zu dem westlichen Kulturkreis. Hier ist ein individuelles Gesellschaftskonzept vorherrschend. Das bedeutet, dass viel Wert auf bspw. Meinungsfreiheit, die Entwicklung des Individuums und eigene Entscheidungen gelegt wird. Zudem wird sich dort von einem vergleichsweise kleinen Familienkreis umgeben. Syrien gehört zum Nahen Osten und zählt zu einem Kulturkreis, der eher kollektivistisch geprägt ist. Menschen identifizieren sich dort meist über soziale Gruppen, wie bspw. der Familie, die ihnen Schutz liefern und denen sie aber zu Loyalität verpflichtet sind. Das kann bedeuten, dass eigene Bedürfnisse eher zurückgestellt werden und sich dazu verpflichtet gefühlt wird, die Meinungen der Gruppe zu teilen.“ 41/156 3.3.3. Besonderheit somatischer Symptome (Anna Enrica Strelow) In einer qualitativen Untersuchung sprachen Perron und Hudelson (2006, S.4) mit Asylsuchenden und Geflüchteten, die andauernde körperliche Symptome (bspw. Kopfschmerzen, andere Schmerzen, etc.) hatten, welche aber nicht eindeutig einer körperlichen Krankheit zugeordnet werden konnten. 19 der 26 Befragten erörterten, dass die Symptome zu einem Zeitpunkt hoher Belastung einsetzten oder schlimmer wurden. So wurde bspw. von einem Patienten beschrieben: „Es war der Krieg... Wir ertrugen so viel. Ich hatte in meinem Leben vorher noch nie solche Schmerzen. Und da waren Mitglieder meiner Familie, die getötet wurden. Das ist so eine tiefliegende Nervosität… Ja, ich habe Bauchschmerzen und mein Körper zittert und ich bin erschöpft.“ (Perron und Hudelson, 2006, S.4) oder von einem anderen Patienten: „Aber die Epilepsie kommt öfter, wenn ich an die Vergangenheit denke” (Perron und Hudelson, 2006, S.4). Dies ist natürlich kein Beleg dafür, dass diese Ereignisse kausal die körperlichen Symptome ausgelöst haben, aber es zeigt eindrücklich, wie sehr die Patientinnen und Patienten an den Erinnerungen und den körperlichen Symptomen litten. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass die Befragten bei der Frage nach der Entstehung der Störung selbst eine Verbindung zwischen psychischer Belastung und physischen Symptomen herstellten, obwohl die meisten (23 der 26 Befragten) davon ausgingen, dass ihre Symptome körperlich bedingt waren und darauf bestanden medikamentöse Behandlung zu erhalten. Des Weiteren beschrieben die Patientinnen und Patienten Post-Migrations-Belastungen, wie finanzielle Sorgen, Zukunftsängste und Sorgen um die Kinder, wenn sie nach der Persistenz ihrer Symptome gefragt werden: „Die Angst ist immer präsent. Vor allem, wenn du zu Hause bist, nichts zu tun hast, wenn du viele Sorgen hast… Zum Beispiel darüber, wie du die Kinder ernähren willst, wie du ihnen eine Schulbildung ermöglichen kannst… und es ist klar, dass dir dann alles weh tut.“ (Perron und Hudelson, 2006, S.4) In einer Studie von Westermeyer und Kollegen (1989) wurde zudem ein Zusammenhang zwischen somatoformen Symptomen bei Geflüchteten und psychischen Störungen gefunden. Auch das ist mehr ein Hinweis darauf und nicht ein Beleg dafür, dass es in der Population der Geflüchteten dazu kommen kann, dass psychische Probleme eher über körperliche Symptome kommuniziert werden. Das kann unter anderem daran liegen, dass in kollektivistischen Gesellschaften psychische Störungen als Schwäche aufgefasst werden, die 42/156 eine Belastung für die ganze Gruppe darstellen. So ist es für die Mitglieder der Gruppe einfacher, über körperliche Beschwerden zu sprechen als über psychische (Kizilhan, 2013). Jedoch sollten diese Erkenntnisse nicht in der Art verstanden werden, dass körperliche Symptome nicht ernstgenommen werden sollten. Sie sollten vielmehr als Informationsquelle betrachtet werden, die viel über den Menschen und seine Geschichte, Kultur und Probleme verraten kann. Eine medizinische Abklärung körperlicher Symptome ist daher in jedem Fall unerlässlich. Kizilhan (2013, S.35-39) konnte einige dieser Symptome bezüglich ihrer Hinweiswirkung aufschlüsseln. Eine „brennende Leber” wird im Nahen- und Mittleren Osten häufig mit Traurigkeit, Sorgen und großem Leid konnotiert. Diese äußert sich bei den Patientinnen und Patienten dann als Leber- oder Oberbauchschmerzen. Im ICD-10-System könnte dieses Syndrom am ehesten als somatoforme Störung verstanden werden. Ähnlich dem Symptom der „Rückenschmerzen” mit dem häufig familiäre Konflikte, Sorgen, eine Rollenproblematik oder schwere Arbeit verknüpft sind. Diese Schmerzen können sogar so stark sein, dass die betroffene Person nicht mehr dazu in der Lage ist, schwere Dinge zu heben oder sich zu bewegen. Auch die „Wander- oder Windschmerzen” können am ehesten, wie eine somatoforme Störung verstanden werden. Im Nahen und Mittleren Osten werden sie wie ein wandernder Schmerz verstanden, der jeden Tag an einer anderen Stelle ist. Dieser geht mit Müdigkeit und Schwäche einher und ist mit wenig Akzeptanz in einer sozial relevanten Bezugsgruppe, Sorgen, Kummer und einem schweren Leben verknüpft. Des Weiteren können „Beklemmungsgefühle” geäußert werden, die sich über Kopf- und Halsschmerzen und ein Engegefühl äußern können. Diese sind häufig mit Sorgen, Ängsten, Schuldgefühlen und Unsicherheit verknüpft (ebd., S. 35-39). Es kann auch von einem „Problem mit den Nerven” berichtet werden, welches häufig mit Traurigkeit, Erschöpfung, Lustlosigkeit und Antriebslosigkeit einhergehend beschrieben wird. Es ist häufig assoziiert mit Stress, fehlenden Bewältigungsmöglichkeiten und einer geringen sozialen Unterstützung. Es kann ein Hinweis auf das Entwickeln einer depressiven Episode, einer somatoformen Störung oder eines Erschöpfungssyndroms sein (ebd., S. 35-39). Es kann auch von einem „Alpdruck” oder einem „schwarzen Druck” berichtete werden, bei dem die Betroffenen das Gefühl haben, dass eine dunkle Gestalt sich auf ihnen niederlässt und sie fast erdrückt. Die/Der Betroffene kann dann weder sprechen noch sich bewegen. Dieser Zustand kann als sehr belastend empfunden werden und ist am ehesten mit einer dissoziativen Störung in Verbindung zu bringen (ebd., S. 35-39). An diesem Symptom zeigt sich die enge Verbindung zwischen körperlichen Symptomen und religiöser Verankerung. Im Koran liest sich in der Sure sechs, Vers 125 (Rassoul & Khan, 2013, S.103): 43/156 Wen Allah aber rechtleiten will, dem weitet Er die Brust für den Islam; und wen Er in die Irre gehen lassen will, dem macht Er die Brust eng und bedrückt, wie wenn er in den Himmel emporsteigen würde. So verhängt Allah die Strafe über jene, die nicht glauben. Die Enge der Brust wird hier als direkte Bestrafung für Menschen, die sich auf Abwegen befinden, beschrieben. „Ohnmachtsanfälle”, „Haareausreißen”, „Schreianfälle”, „Kurzatmigkeit” oder eine „Störung der Impulskontrolle” und „Gefühle von Schwäche” können ein Hinweis auf Angst, Erinnerungen an traumatische Erlebnisse, Schamgefühle oder auf starke Überforderung im Alltag sein (Kizilhan, 2013, S. 35-39). Eine „fallende Nabelschnur” kann als Ausdruck starken Stressempfindens oder als Verlust der eigenen Körpermitte verstanden werden (ebd., S. 35-39). Neben der Gefahr, dass diese Symptome missverstanden werden, ist es wichtig zu beachten, dass jede Kultur eigene Erklärungsansätze dieser Syndrome hat. Daraus resultieren eigene Therapievorstellungen, die von denen der westlichen Welt sehr verschieden sein können. In der folgenden Tabelle findet sich eine tabellarische Darstellung der Syndrome sowie deren Auswirkung auf den Körper und die damit assoziierten Probleme. Aufschlüsselung kulturspezifischer Syndrome Benanntes Syndrom Körperliche Ausprägung Assoziierte Probleme Brennende Leber Leberschmerzen, Oberbauchschmerzen Traurigkeit, Sorgen, großes Leid Rückenschmerzen Schmerzen im Rücken, starke Bewegungseinschränkung familiäre Konflikte, Sorgen, Rollenproblematik, schwere Arbeit Wander- oder Windschmerzen wandernder Schmerz, der jeden wenig Akzeptanz in einer sozial Tag an einer anderen Stelle ist, relevanten Bezugsgruppe, SorMüdigkeit, Schwäche gen, Kummer, schweres Leben Beklemmungsgefühle Kopf- und Halsschmerzen, Gefühl der Enge Problem mit den Nerven Unruhe, Zittern, Schweißanfälle, Stress, fehlende BewältigungsAgitiertheit, Traurigkeit, Ermöglichkeiten, geringe soziale schöpfung, Lustlosigkeit, AnUnterstützung triebslosigkeit Alpdruck, schwarzer Druck dunkle Gestalt, die einen erdrückt, Gefühl von schwerer Last Sorgen, Ängste, Schuldgefühle, Unsicherheit Ängste, Unsicherheit, Panik, Kummer, Schuld- und Schamgefühle 44/156 Fallende Nabelschnur Bauch- und Magenschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Schwäche, Müdigkeit starker empfundener Stress, Verlust der eigenen Körpermitte Haareausreißen, Schreianfälle, Kurzatmigkeit, Impulskontrollstörung Ängste, starke Überforderung bei alltäglichen Anforderungen Angst, Schamgefühl, Hinweis auf traumatisches Erlebnis Ohnmachtsanfälle Gefühle von Schwäche, Unsicherheit Angst, Erinnerung an traumatisches Ereignis, Scham, Überforderung im Alltag, Unsicherheit, geringe Akzeptanz Tabelle 1. Quelle: Kizilhan, 2013, S. 35-39 Die Akzeptanz und das Wissen um die kulturell bedingten Abweichungen der Symptombeschreibung sind in der Kommunikation mit Geflüchteten über Störungen sehr wichtig. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Symptome richtig verstanden und gedeutet werden können. Körperliche Symptome können ein Hinweis auf psychische Symptome sein. Es ist wichtig genau hinzuhören und sich erklären zu lassen, was bspw. mit einer „fallenden Nabelschnur” (s. Tab. 1) gemeint ist. In jedem Fall sollte bei solchen Beschwerden eine Ärztin oder ein Arzt aufgesucht werden. Neben der körperlichen Untersuchung wäre eine psychische Diagnostik angebracht, um zu überprüfen, ob die Aussagen der betroffenen Person klinische Relevanz haben und der Geflüchtete behandlungsbedürftig ist. 3.3.4. Glaube und traditionelle Volksmedizin als Heilmittel (Anna Enrica Strelow) Der islamische Glaube ist mit 1,6 Milliarden Anhängern die zweitgrößte Weltreligion6. Er wird in verschiedenen Ländern und Kontinenten praktiziert; Bspw. in Somalia, Syrien, Afghanistan, Indien oder China (Pew Research Center, 2015). Da jedes Land und auch jeder Mensch Religion anders versteht oder auslebt, ist es schwer, vereinheitlichende Aussagen zu treffen. Jedoch gibt es einige Besonderheiten im Störungsverständnis, die sich häufig wiederfinden lassen. Diese werden im Folgenden vorgestellt. 6 Die meisten Anhänger hat mit 2,2 Milliarden Personen das Christentum. Die drittgrößte Gruppe sind die Konfessionslosen (Pew Research Center, 2015). 45/156 Einen wichtigen Einfluss auf das Verständnis von Krankheit haben die Beschlüsse der Akademie für islamisches Recht. Deren Mitglieder treffen sich in regelmäßigen Abständen und diskutieren über aktuelle medizinische Themen. Im Anschluss an diese Diskussionen werden Handlungsempfehlungen herausgegeben, die im Einklang mit der Scharia (dem islamischen Recht) stehen und z.B. regeln wie sich Ärztin und Arzt sowie Patientin und Patient in bestimmten Situationen verhalten sollen (Heine & Assion, 2005). Neben den Rechtsgelehrten des Islams, die die moderne Medizin zu großen Teilen anerkennen, gibt es eine Reihe von volksheilkundlichen Heilern, die sich an verschiedenen Störungskonzepten orientieren. So wird bspw. religiösen Heilern die Fähigkeit zugesprochen, mit Hilfe von Dschinnen eine Vielzahl an Erkrankungen und Störungen, wie bspw. Epilepsie oder Depression, heilen zu können, indem sie die Betroffenen von ‘schwarzer Magie’ oder ‘dem bösen Blick’ befreien. Von diesen werden in den Balkanländern und im Nahen und Mittleren Osten dann häufig Amulette oder Heiltränke verschrieben, die bei der Heilung von Störungen helfen sollen (Heine & Assion, 2005). Dschinne werden im Koran als „Blutsverwandte” Allahs angesehen, die aus Rauch und Feuer entstanden sind und diesem unterstellt sind („Und sie unterstellten ihm eine Blutsverwandtschaft mit dem Dschinn”, Sure 37, 158 [Rassoul & Khan, 2013, S. 335 - 336]; Heine & Assion, 2005) und bei denen Schutz gesucht werden kann („Und freilich pflegten einige Leute unter den gewöhnlichen Menschen bei einigen Leuten unter den Dschinn Schutz zu suchen”, Sure 6, Vers 72 [Rassoul & Khan, 2013, S. 98]). Demgegenüber stehen die Djanns, die böse Dämonen sind. Dschinne können von Menschen nicht wahrgenommen werden, aber können körperliche Gestalt annehmen, wie bspw. die eines Adlers oder einer Katze (Heine & Assion, 2005). Über die Anerkennung der Dschinne wird gestritten: Von der einen Seite wird die Existenz der Dschinne als gesichert angesehen, bei orthodox-islamischen Gelehrten wird der Glaube an diese als Scharlatanerie abgetan. Dschinne können somit als Bestandteil des islamischen Glaubens verstanden werden. Das Sehen von Geistern muss also kein Hinweis auf eine psychotische Störung sein (Kizilhan, 2013). Eine weitere Vielzahl an traditionellen Heiler/innen, wie die Hebammen, Gelbsuchtheiler/innen, Pflanzenheiler/innen, Derwische und Knochenheiler/innen, sind für spezifische Probleme verantwortlich. Sie versuchen Linderung durch religiöse, pflanzliche und teilweise auch durch zweifelhafte Mittel zu erzielen. Die damit verbundenen Störungskonzepte sind vor allem in ländlichen Regionen verbreitet und rücken bei längeren Erkrankungen in den Fokus (Heine & Assion, 2005). 46/156 Zentral ist es, mit den geäußerten Vorstellungen der Migrierten über Störung wert- und nicht abschätzend umzugehen. Mit ihnen kann ähnlich, wie mit den somatischen Symptomen umgegangen werden. Sie können ein Hinweis auf psychische Störungen oder körperliche Erkrankungen sein, dem nachgegangen werden sollte, wenn die betroffene Person darunter leidet. Jedoch sollten Äußerungen in dem spezifischen kulturellen Kontext und nicht im westlichen Kontext interpretiert werden. Kizilhan (2013, S.32 - 34) beschreibt, wie wichtig es für den Erfolg einer Therapie ist, das kulturspezifisische Störungskonzept der betroffenen Person zu akzeptieren. Er berichtet von Hamid, einem 46 Jahre alten Migranten, der zu ihm in die Therapie kam, da er der Überzeugung war, seit langem von schwarzer Magie verfolgt zu werden. Aus diesem Grund zog er weit von seinem Heimatort weg, verlor alle sozialen Kontakte und betete sehr intensiv, um der schwarzen Magie zu entkommen. Zudem wolle er niemandem „die Wahrheit verschweigen”, weswegen er anderen Menschen ausschließlich von seinem Wissen über Magie berichtete. Die Therapie zeigte bei ihm erste Verbesserungen als er an einen Therapeuten geriet, der seinen Glauben nicht in Frage stellte und ihm half, mit seinem Wissen um die Magie besser umzugehen. 3.3.5. Einfluss auf Inanspruchnahmeverhalten und Bewältigungsgewohnheiten (Anna Enrica Strelow) Die Bundespsychotherapeutenkammer schätzt, dass 2014 ca. 4% der Geflüchteten in psychotherapeutischer Behandlung waren. Die Prävalenzraten für psychische Störungen ergeben jedoch, dass viel mehr Geflüchtete psychotherapeutische Hilfe gebraucht hätten. Die Kammer macht vor allem die Regelung des Asylbewerbergesetzes dafür verantwortlich, welches es erschwere, Geflüchteten eine dolmetschergestützte Psychotherapie zu ermöglichen. Neben den politischen Gegebenheiten in Deutschland gibt es weitere Einflussfaktoren, die es den Geflüchteten schwer machen, eine Psychotherapie aufzusuchen. In einer qualitativen Studie von Asgary und Segar (2011) wurden Geflüchtete in der USA aus verschiedenen Ländern in Interviews dazu befragt, was für sie Barrieren sind, die sie daran hindern, Gesundheitsleistungen in Anspruch zu nehmen. Die Autoren unterschieden zwischen Barrieren, die der/dem Asylsuchenden immanent sind und strukturellen Gegebenheiten. Zu der ersten Kategorie zählt das Wissen über und die Einstellung zu psychischen 47/156 Störungen. Vielen der Befragten war es nicht bewusst, dass ihre psychischen Symptome Spätfolgen traumatischer Erlebnisse sein können. Zudem wird eine Störung der Psyche häufig als stigmatisierend erlebt. Die Befragten berichteten, dass sie sich schämten über Symptome dieser Art zu sprechen. Des Weiteren kann mit einer depressiven Störung eine Passivität einhergehen, die sie daran hindert, Gesundheitsleistungen in Anspruch zu nehmen. Als ein weiterer Faktor wurde Misstrauen und erlebte Diskriminierung angegeben. Die Geflüchteten berichteten, dass sie das Gefühl hatten, dass sie nicht dieselbe Versorgung erhalten würden wie nicht Geflüchtete. Zudem wurde teilweise ein Misstrauen gegenüber der westlichen Medizin beschrieben. Als größtes internales Hindernis wurde die Angst vor Abschiebung, Haft oder dem Verlust des Aufenthaltsstatus beschrieben. Die Geflüchteten stellten häufig einen direkten Zusammenhang zwischen der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistung und einer Bestrafung durch das System her. Zudem berichteten alle der Geflüchteten, dass die Gemeinschaft für sie ein sehr viel wichtigerer und unterstützender Faktor sei als das Gesundheitswesen. Als erste strukturelle Barriere wurde das häufig als unübersichtlich empfundene System angeführt. Es wurde große Unsicherheit im Umgang mit Ärzt/innen/en und Kliniken beschrieben. Des Weiteren wurde die monetäre Erschwinglichkeit als eine weitere Barriere genannt. Es gäbe Angebote für Geflüchtete, die kostenlos seien, aber keiner wisse darüber Bescheid. Als eine sehr große Hürde wurden sprachliche Schwierigkeiten erwähnt. Die Geflüchteten selbst schilderten die Suche und Auswahl der Dolmetscher als sehr schwierig und sehr intime Details wollten sie nicht von ihren Familienangehörigen übersetzen lassen. Zudem fühlten sich viele der Geflüchteten von den Ärzt/innen/en nicht verstanden und ernstgenommen und auch von der Interviewer/innen-Seite, die aus Ärzt/innen/en und Psycholog/innen/en bestand, wurde beschrieben, dass sie häufig nicht genug über Geflüchtete und deren Leidensweg wissen, so dass es ihnen teilweise sehr schwer falle, adäquat auf die Geflüchteten zu reagieren. Sie gaben zudem an, dass die Kapazitäten sehr begrenzt seien. Die Autoren resümieren, dass eine Mischung aus psychischer Belastung und der neuen, ungewissen Situation, die durch den Asylprozess entstanden ist, zu der beobachteten Passivität geführt habe. Die Studie lässt keine allgemeingültigen Aussagen zu, zudem ist sie in den USA durchgeführt worden, sodass nicht alle Barrieren äquivalent auf Deutschland übertragbar sind. Das generelle Bedürfnis nach mehr Informationen und die empfundene Überforderung, die zudem mit einer Stigmatisierung durch psychische Störungen einhergeht, sind jedoch Barrieren, die sich auf Deutschland übertragen lassen. Neben geringen Informationen der Geflüchteten über Psychotherapie und die Beantragung dieser können auch kulturelle und religiöse Werte einen Einfluss auf die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen haben. So kann der Glaube an die Vorhersehung und die Vor48/156 herbestimmung den Patientinnen und Patienten in eine passive Störungsrolle und zu einem fatalistischen Selbstbild führen. Vers 133 der 6. Sure (Rassoul & Khan, 2013, S.104) spiegelt dieses Verständnis wider: Und dein Herr ist Der, Der auf keinen angewiesen ist, und dem die Barmherzigkeit zu eigen ist. Wenn Er will, wird Er euch hinwegnehmen und an eurer Stelle folgen lassen, was Ihm beliebt, wie Er euch aus der Nachkommenschaft anderer entstehen ließ. Ein/e Betroffene/r könnte seine psychische Störung als von Gott gegeben ansehen, die er aushalten müsse. Jedoch könnte auf der Basis des Korans auch anders argumentiert werden. So heißt es in Sure 13, Vers elf (Rassoul & Khan, 2013, S. 181): „[...] Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, ehe sie [die Leute] nicht selbst das ändern, was in ihren Herzen ist […]”. Daraus ließe sich ableiten, dass die/der Glaubende aufgerufen wird sich selbst zu helfen, damit ihm dann auch von höherer Stelle geholfen werden kann. Die Islamgläubigkeit kann in einer solchen Auslegung eine wichtige Ressource darstellen. So beschreibt Kizilhan (2013), dass Stellen des Korans Hoffnung schenken können und auch bei der Angstbewältigung eine wichtige Rolle spielen können. Neben dem Koran kann auch die oben benannte kollektive Orientierung des Individuums eine Möglichkeit sein, mit dem Stress der Migration umzugehen (Kizilhan, 2013). Geflüchtete sind vielen Hindernissen ausgesetzt, wenn sie nach Deutschland kommen. Die sprachlichen und strukturellen Hürden führen häufig dazu, dass ein Informationsdefizit entsteht und daraus falsche Schlüsse gezogen werden. Ehrenamtliche können bei einer Vielzahl der Barrieren den Geflüchteten eine Hand reichen und über diese Barrieren hinweghelfen. Dazu müssen Sie jedoch wissen, bei welchen Symptomen und Störungsbildern, wie geholfen werden muss und kann. 49/156 Zusammenfassung und Vortragshinweise zu den Folien: Kulturspezifische Einflüsse auf das Störungskonzept Das ist die 15. Folie des Vortrags. Auf ihr soll erläutert werden, welche kulturell geprägten Einflüsse das Störungskonzept von Geflüchteten prägen können. Dazu könnte bspw. gesagt werden: „Im Nahen und Mittleren Osten sowie in den Balkanländern spielt die Existenz von Dschinnen, Geistern und damit verbundenen rituellen Handlungen eine wichtige Rolle bei der Erklärung und der Bekämpfung von Störungen. In der traditionell islamischen Bevölkerung wird davon ausgegangen, dass Dschinne tatsächlich existieren. Sie werden im Koran als Blutsverwandte Allahs angesehen, die aus Feuer und Rauch bestehen und in Gut und Böse eingeteilt werden. Wenn Menschen aus diesem Kulturkreis davon berichten, Geister zu sehen, sollte das nicht als psychotisch eingeschätzt werden, sondern erstmal weiter nachgefragt werden. In familienorientierten Gesellschaften, wie bspw. in Syrien, steht die Harmonie und die Sicherheit der Familie im Vordergrund. Die eigene Meinung und die Beschwerden des Einzelmitglieds sind dabei eher sekundär. Daher ist die Hauptaufgabe des Familienmitglieds, der Familie keine Schande zu bereiten. So werden psychische Beschwerden häufig als nicht wichtig genug empfunden, um sie zu äußern oder sie zu behandeln. Die Familie ist aber auch eine Ressource, die in dem Prozess der Migration viel Halt und Sicherheit geben kann. Durch die enge Verknüpfung mit der Familie ist es wichtig, das Individuum auch im Kontext seiner Familie zu betrachten. Häufig werden die Einflüsse der Störung nicht bei einem selbst 50/156 gesucht, sondern bei anderen, außerhalb des eigenen Einflussbereichs liegenden Faktoren (‚Mein Chef ist so unfair zu mir.‘), was zu einem passiven Störungsverhalten führen kann. In familienorientierten Gesellschaften ist es häufig nicht erlaubt, psychische Probleme zu kommunizieren, da diese der Familie Schande machen könnten. Deshalb werden Probleme häufig körperlich kommuniziert. Subjektives Leid kann somit ein Symbol für eine psychische Störung sein: Müdigkeit kann bedeuten, dass die Stimmung als gedrückt empfunden wird und eine ‚brennende Leber‘ bedeutet im Mittleren Osten nicht, dass tatsächlich ein Leberproblem besteht, sondern Kummer und Traurigkeit werden über diese Aussage ausgedrückt. Es ist also wichtig, wachsam zu sein und Symptome, wie Bauchschmerzen, Müdigkeit und Schwächegefüh,l zu hinterfragen. In islamisch-familienorientierten Gesellschaften steht im Gegensatz zu westlich-orientierten Gesellschaften eher ein Scham- statt einem Schuldgefühl im Vordergrund. So schämen sich von einer Depression Betroffene eher, da sie Angst haben, ihrer sozialen Bezugsgruppe Schande zu machen. Daher werden eher körperliche Symptome kommuniziert, die weniger Scham bereiten.“ 51/156 3.4. Was ist Psychotherapie? (Anne Breidenstein) In diesem Abschnitt soll - in Form eines groben Überblicks - das Prinzip der Psychotherapie erklärt werden. Strotzka (1978, S.4) definiert Psychotherapie als einen Prozess zur Beeinflussung von Verhaltensstörungen und Leidenszuständen, die (…) für behandlungsbedürftig gehalten werden, mit psychologischen Mitteln (durch Kommunikation), meist verbal aber auch averbal, in Richtung auf ein definiertes, nach Möglichkeit gemeinsam erarbeitetes Ziel. Dieses Zitat bringt den Kern der Psychotherapie auf den Punkt, nämlich die Beeinflussung bzw. Linderung von Verhaltensstörungen oder Leidenszuständen. Ähnlich sieht es auch der Gesetzgeber. Laut Psychotherapeutengesetz (erlassen 1998) ist Psychotherapie „jede mittels wissenschaftlich anerkannter psychotherapeutischer Verfahren vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Störungen mit Störungswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist.” Zudem wird festgestellt, wer psychotherapeutisch tätig sein wolle, bedürfe „der Approbation als Psychologischer Psychotherapeut oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut.” Der Titel des Psychotherapeuten oder der Psychotherapeutin wird durch das Gesetz geschützt, denn diese Berufsbezeichnung „darf von anderen Personen als Ärzten, Psychologischen Psychotherapeuten oder Kinderund Jugendlichenpsychotherapeuten nicht geführt werden”. Allerdings ist der Begriff Psychotherapie selbst nicht geschützt und kann somit von jedem bei der Bewerbung eigener Dienstleistungen verwendet werden. So bieten zum Beispiel oft Heilpraktiker Psychotherapie an, dürfen sich selbst aber nicht Psychotherapeuten nennen. Dieser Umstand ist nicht nur für Laien verwirrend und erfordert eine große Sorgfalt bei der Auswahl des Behandlers oder der Behandlerin, da sich hinter dem Begriff Psychotherapie also keinesfalls immer eine qualitätssichernde Approbation verbirgt. Unter denjenigen, die den Titel Psychotherapeut/in tragen dürfen, wird – in Bezug auf die jeweilige Behandlungsklientel – im Psychotherapeutengesetz (1998) weiter differenziert. „Die Berechtigung zur Ausübung des Berufs des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten erstreckt sich auf Patientinnen und Patienten, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.” Diejenigen mit einer allgemeinen psychotherapeutischen Ausbildung dürfen hingegen prinzipiell Patientinnen und Patienten allen Alters behandeln, spezialisieren sich aber oft auf Erwachsene. Klaus Grawe, einer der bekanntesten Psychotherapieforscher, hat sich in seiner Untersuchung „Empirisch validierte Wirkfaktoren statt Therapiemethoden” von 2005 den schulenübergreifenden Wirkfaktoren der Psychotherapie gewidmet. Darin postuliert er fünf zentrale 52/156 Wirkfaktoren (d.h. allgemeine, in allen Therapien vorkommende Faktoren, deren Umsetzung den Therapieerfolg ausmachen): die Ressourcenaktivierung (Welche nützlichen Ressourcen bringt der/die Patient/in mit?), die therapeutische Beziehung (das Vertrauensverhältnis zwischen Patient/in und Therapeut/in), die Problemaktualisierung (das unmittelbare Erfahren der Probleme durch Übungen oder durch intensives Erzählen), die Problembewältigung (durch therapeutische Unterstützung kann der/die Patient/in Erfolgserlebnisse bei der Problembewältigung haben) und die motivationale Klärung (der/die Patient/in versteht die aufrechterhaltenden Faktoren der eigenen Störung). 53/156 Zusammenfassung und Vortragshinweise zu den Folien: Definition des Begriffs der Psychotherapie und dem des Psychotherapeuten Das ist Folie 21. des Vortrages. Sie soll Antwort auf die Frage danach geben, was Psychotherapie sei, und die Geschütztheit des Begriffs Psychotherapeut/in hervorheben. Dazu könnte man zum Beispiel sagen: „Strotzka definierte Psychotherapie als einen ‘Prozess zur Beeinflussung von Verhaltensstörungen und Leidenszuständen, die (…) für behandlungsbedürftig gehalten werden, mit psychologischen Mitteln (durch Kommunikation), meist verbal aber auch averbal, in Richtung auf ein definiertes, nach Möglichkeit gemeinsam erarbeitetes Ziel (…).’. Kurz gesagt: Psychotherapie möchte psychisches Leid heilen. Dafür braucht es eine spezielle und lange Ausbildung, die der Psychotherapeutin, bzw. des Psychotherapeuten. Glücklicherweise ist der Begriff ‘Psychotherapeut/in’ vom Gesetzgeber geschützt, sodass man sichergehen kann, dass Menschen, die das auf ihrer Visitenkarte oder auf dem Praxisschild stehen haben, eine bestimmte Ausbildung genossen haben und damit auch eine bestimmte Qualität in der Behandlung sichergestellt ist. In Deutschland gibt es ca. 16000 psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, in Marburg sind über 100 bei der Kassenärztlichen Vereinigung eingetragen.“ 54/156 3.4.1. Übersicht über die Therapie-Verfahren (Anne Breidenstein) In Deutschland werden von den gesetzlichen Krankenkassen drei verschiedene Psychotherapie-Verfahren bezahlt: Verhaltenstherapie (VT), tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (TFP) und Psychoanalyse (PA). Für die Behandlung von Posttraumatischen Belastungsstörungen wird seit Januar 2015 auch die Therapieform Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) von den gesetzlichen Kassen übernommen. Bevor ein Antrag auf Psychotherapie an die Krankenversicherung gestellt wird, können probatorische Sitzungen zur Diagnostik und Therapieplanung abgehalten werden, in Verhaltenstherapie und tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie fünf, in Psychoanalyse acht. Diese werden immer von der Krankenversicherung bezahlt. Anschließend kann ein Antrag auf Kurz- oder Langzeittherapie bei den Krankenkassen gestellt werden. Die Verhaltenstherapie wird durch Berking (2012, S.24) folgendermaßen definiert: Sie stützt sich zur Erklärung und Behandlung psychischer Störungen v. a. auf lerntheoretische Prinzipien (klassische und operante Konditionierung, Modelllernen). Zu den prototypischen Interventionsmethoden gehören Expositionsverfahren und Kontingenzmanagementsysteme. In der Praxis wird von den meisten Therapeuten heutzutage allerdings eine Weiterentwicklung der VT, die sogenannte Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) angewendet, die nach der kognitiven Wende in den 1960er Jahren entstand. Nicht mehr ausschließlich äußerlich beobachtbare Ereignisse (bzw. Verhaltensweisen), sondern auch innere Vorgänge einer Person, wie Gedanken, Wahrnehmungen und Einstellungen, fanden Eingang in Erklärungsmodelle und Behandlungskonzepte. Typischerweise werden in der KVT behaviorale und kognitive Methoden kombiniert (z. B. behaviorale Aktivierung und Disputation depressogener Grundannahmen in der Therapie unipolarer depressiver Störungen). (Berking 2012, S. 24) Dabei gibt es auch spezialisiertere Unterformen der KVT, wie zum Beispiel eine Form der spezialisierten Behandlung chronischer Depressionen (Für mehr Informationen dazu siehe Berking (2012), Psychologische Hochschule Berlin (2015) und McCullough (2000)). Die Kurzzeittherapie in der VT umfasst 25 Stunden für Erwachsene, eine Langzeittherapie kann 45 Stunden umfassen, bei Antrag auf Verlängerung 60. In Einzelfällen können mit guter Begründung nochmals Verlängerungen beantragt werden: In der VT bis zu 80 Stunden 55/156 (Psychotherapie-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesauschusses über die Durchführung der Psychotherapie: § 23a und § 23b, 2016). Die Psychoanalyse geht auf die Lehren Sigmund Freuds zurück, hat sich aber seitdem immer weiterentwickelt. Laut Berking ist sie (2012, S. 79) ein Verfahren, das auf eine Veränderung der Persönlichkeitsstruktur abzielt. Basis für diese grundlegende Veränderung des Patienten oder der Patientin (‚Analysanden‘) ist der Aufbau einer intensiven emotionalen Beziehung mit dem Analytiker. Unbewusste Konflikte sowie konfliktbehaftete frühere Beziehungserfahrungen und -muster des Analysanden sollen aktiviert und in der Beziehung zum Analytiker (durch Übertragung) wiedererlebt und positiv gelöst werden (‚emotional korrigierende Erfahrung‘; Alexander & French 1946). In der Psychoanalyse werden deutlich höhere Stundenkontingente genehmigt: für eine Langzeittherapie in der Regel 160, bei begründetem Antrag auf Verlängerung bis zu 240. Auch hier können in Einzelfällen mit einer guten Begründung bis zu 300 Stunden beantragt werden (Psychotherapie-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesauschusses über die Durchführung der Psychotherapie: § 23a und § 23b, 2016). In der Tiefenpsychologisch Fundierten Psychotherapie dagegen wird den aktuellen Lebensbelastungen sowie den aktuellen sozialen und interpersonellen Beziehungen eine wichtige Rolle zugeschrieben, wodurch aktuelle psychosoziale Konflikte neben den inneren Konflikten stärker im Fokus der Behandlung stehen. Diese Form der Therapie gilt als weniger intensiv und aufwändig als die Psychoanalyse oder die analytische Psychotherapie und stellt die am häufigsten eingesetzte Form der dynamischen Psychotherapie dar (Rudolf et al., 2002). (Berking, 2012, S. 80) Die Stundenkontingente in der TFP sind denen der VT ähnlich; hier können 50 Stunden und in besonderen Fällen bis zu 80 Stunden genehmigt werden und in Einzelfällen mit guter Begründung bis zu 100 Stunden (Psychotherapie-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesauschusses über die Durchführung der Psychotherapie: § 23a und § 23b, 2016). In einer in der Psychotherapieforschung bis dahin einmaligen Metaanalyse, die Studien zu verschiedenen Therapieschulen einbezieht (Grawe, 1994), wurden Psychoanalyse, Gesprächstherapie nach Carl Rogers und Verhaltenstherapie einander gegenüber gestellt. Zwischen der Psychoanalyse und der Gesprächstherapie ließen sich keine signifikanten Wirkungsunterschiede feststellen. Beiden Therapieschulen war die Verhaltenstherapie aller56/156 dings hoch signifikant überlegen (der Psychoanalyse mit p<.0001 und der Gesprächstherapie mit p<.007). Für speziellere Wirknachweise siehe Abschnitt 3.4.3. 57/156 Zusammenfassung und Vortragshinweise zu den Folien: Prinzip der Kognitiven Verhaltenstherapie Dies ist die 22. Folie des Vortrags. Sie soll das grundlegende Prinzip der Verhaltenstherapie verdeutlichen. Dazu könnte beispielsweise gesagt werden: „Wie genau eine Therapie abläuft kommt auf die Therapierichtung und natürlich auf die Störung an. Wir möchten Ihnen kurz exemplarisch die Kognitive Verhaltenstherapie vorstellen, da diese an der Marburger Universität hauptsächlich gelehrt und praktiziert wird. Wie der Name schon sagt, setzt die Therapie sowohl bei den Kognitionen, also Gedanken, und dem Verhalten an, um Veränderungen zu erzielen. (Verweis auf Dreiecksbild) Lassen Sie mich das am Beispiel Selbstbewusstsein erklären: Viele Menschen möchten sich gerne selbstbewusst fühlen, wissen aber nicht genau wie sie das am besten erreichen können. Vereinfacht gesagt könnten sie entweder ihr Verhalten ändern und sich mal ‘etwas trauen’, oder sie könnten ihre Gedanken verändern, zum Beispiel anstatt ‘Ich bin zu schüchtern’ zu denken ‘Ich kann das und werde das schaffen!’. Da sich alle drei Bereiche, wie in der Grafik zu sehen ist, beeinflussen, wird sich dadurch auf lange Sicht auch das Gefühl ändern.‘ Wenn Zeit dafür ist, kann auch noch ein konkretes Beispiel angebracht werden: ‚Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Ihnen würde beim Spülen ein Glas kaputt gehen. Was denken Sie 58/156 dann? (Auch gerne Publikumsantworten abwarten.) Genau, und wie fühlen sie sich dann? Es kommt ganz darauf an was wir denken, das Gefühl folgt ihm dann! Man könnte natürlich denken: ‘Oh nein, wie ärgerlich, immer passiert das mir!’ und sich ärgern. Man könnte aber auch denken: ‘Scherben bringen Glück!’ oder ‘Na gut, dann muss ich das immerhin nicht mehr spülen!’ und lachen.“ 59/156 3.4.2. Traumatherapie Verfahren (Anne Breidenstein) Die auf wissenschaftlicher Evidenz und Expertenmeinungen basierenden S3-Leitlinien für Posttraumatische Belastungsstörungen der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF, 2011) 7legen die wichtigsten Eckpunkte einer Traumatherapie fest. Als erste Maßnahmen werden veranschlagt (S. 6): - Herstellen einer sicheren Umgebung, wenn immer möglich (Schutz vor weiterer Traumaeinwirkung) - Organisation des psycho-sozialen Helfersystems - Frühes Hinzuziehen eines mit PTBS [Posttraumatische Belastungsstörung]-Behandlung erfahrenen Psychotherapeuten - Psychoedukation und Informationsvermittlung bzgl. traumatypischer Symptome und Verläufe Unter anderem bestimmen die Leitlinien, dass - die oftmals gestörte Affektregulation berücksichtigt und in die Therapieplanung mit aufgenommen werden sollte, - Psychopharmaka begleitend, aber nicht als einzige Therapie verwendet werden können, - Therapieformen wie Ergotherapie, Kunsttherapie, Musiktherapie, Körper- und Bewegungstherapie, Physiotherapie auch begleitend angeboten werden können, - die Konfrontation mit dem traumatischen Erlebnis im sicheren Rahmen der Therapie ein wichtiger Teil der Behandlung sein muss, - dazu speziell traumaadaptierte Methoden verwendet werden sollte. Allerdings weisen die Leitlinien auch explizit darauf hin, wann eine solche konfrontative Therapie nicht angebracht ist. Zu den Kontraindikatoren für traumabearbeitende Verfahren zählen (AWMF, 2011, S. 9): „mangelnde Affekttoleranz, akuter Substanzkonsum, instabile psychosoziale und körperliche Situation, komorbide dissoziative Störung, unkontrolliert autoaggressives Verhalten” (relative Kontraindikation) sowie „akute Psychose, schwerwiegende Störungen der Verhaltenskontrolle (in den letzten 4 Monaten: lebensgefährlicher Suizidversuch, schwerwiegende Selbstverletzung, Hochrisikoverhalten, schwerwiegende Probleme mit Fremdagressivität) und akute Suizidalität” (absolute Kontraindikation). Auch ein 7 Auf der Website der AWMF findet sich folgender Hinweis zu diesen Leitlinien: „Seit > 5 Jahren nicht aktualisiert, Leitlinie wird zur Zeit überprüft; zur Überarbeitung neu angemeldet unter AWMF-Reg.Nr.: 155-001; redaktionelle Bearbeitung 02/2012“. Daher kann davon ausgegangen werden, dass in naher Zukunft neue Leitlininen erscheinen werden, dieses oben angeführte Zitat allerdings seine allgemeine Gültigkeit nich verliert. 60/156 noch vorhandener Kontakt zum/zur Täter/in mit bestehendem Risiko einer ReTraumatisierung sei eine absolute Kontraindikation. Die AWMF weist darauf hin, dass diese Leitlinien für die Posttraumatische Belastungsstörung zurzeit überarbeitet und aktualisiert werden. Es ist damit zu rechnen, dass Ende 2016 eine neue Version erscheint. Im Folgenden sollen ein paar der oben erwähnten, traumaadaptierten Methoden vorgestellt werden: Die Narrative Expositionstherapie (NET) ist ein konfrontatives Verfahren. Einen Eindruck von der Therapie bekommt man unter anderem durch das Manual „Narrative Exposure Therapy” von Maggie Schauer und Kollegen. Wie der Name schon andeutet, ist es das Prinzip dieser Therapie, die eigene Lebensgeschichte nachzuerzählen. Ein Symptom der PTBS ist das Wiedererleben der traumatischen Ereignisse in Form von Flashbacks. Viele Traumatisierte berichten davon, dass es sich für sie nicht anfühlt als sei das traumatische Erlebnis vorbei. Dem Artikel über die Lifeline-Methode von Schauer (2014) ist ein eindrückliches Zitat des Auschwitz-Überlebenden Primo Levi vorangestellt: „[Der] Horror hat nie aufgehört mich zu besuchen, in manchmal kürzeren, manchmal längeren Zeitabständen. Ich spüre eine drohende Gefahr … langsam und brutal zerfällt alles um mich … Ich bin allein in einem grauen und trüben Nichts und jetzt weiß ich, was es ist und dass ich es immer schon gewusst habe. Ich bin (immer noch) im Lager und nichts außerhalb des Lagers ist wahr. Der ganze Rest, meine Familie, die blühende Natur um mich, mein zu Hause, all das war nur eine kurze Pause, eine Sinnestäuschung, ein Traum.“ Ein Ziel der Narrativen Expositionstherapie ist es, die Vergangenheit und Abgeschlossenheit des traumatischen Erlebnisses zu verdeutlichen und bewusst zu machen. Daher wird jeder Lebensabschnitt einzeln vom Patienten oder von der Patientin erzählt und von der Therapeutin oder dem Therapeuten protokolliert. Nachdem die Erzählung eines Abschnittes abgeschlossen ist, wird auf die so genannte Lebenslinie (meistens eine ausgerollte Schnur auf dem Boden) ein Stein oder eine Blume als Symbol für diesen Abschnitt gelegt. Die Blumen stehen für schöne Abschnitte, die Steine für schlimme Abschnitte im eigenen Leben. So werden die Abschnitte, mit ihrem Anfang und vor allem auch ihrem Ende, der Patientin oder dem Patienten vor Augen geführt. Neben diesem chronologischen Einordnen der Lebensgeschichte ist der zweite zentrale Teil der NET die narrative Exposition und damit auch Habituation gegenüber den traumatisierenden Erlebnissen. Wenn in der Narration der Punkt dieses Erlebnisses erreicht ist, ändert sich die Erzählweise. Der/die Patient/in soll langsam, in slow- 61/156 motion erzählen und von allen Sinneseindrücken berichten. Wichtig ist dabei, darauf zu achten, dass kein Flashback und keine Dissoziation entsteht, sondern dass der/die Patient/in im Hier und Jetzt ist und bleibt, während er über die Vergangenheit berichtet. Die Dauer, in der dieses Erlebnis erzählt wird, muss lang genug sein, damit das Erlebnis selbst dabei an emotionalem Gewicht verlieren kann. Die Habituation, also das Absinken der emotionalen Reaktion auf einen Stimulus durch eine Exposition gegenüber diesem, ermöglicht es Patientinnen und Patienten, nach und nach weniger Angst bei der Erinnerung an ihre Erlebnisse zu empfinden. Eine weitere gängige Methode in der Traumatherapie ist die Eye-Movement Desensitization and Reprocessing-Methode (EMDR). Diese wurde von Francine Shapiro in den 1980er Jahren entwickelt und basiert auf der Entspannung durch bilaterale Stimulation, oftmals in Form von Augenbewegungen. Dies ist ein Phänomen, welches viele vom Zugfahren kennen: Blickt man in einem fahrenden Zug aus der Fenster und folgt der Landschaft mit dem Augen, so bewegen sich die Augen immer von der einen auf die andere Seite, schnell und oft hintereinander. Diese Augenbewegungen werden auch Sakkaden genannt. In der Therapie wird diese Augenbewegung bei den Patientinnen und Patienten dadurch ausgelöst, dass ihre Augen den nach rechts und links pendelnden Fingern der Therapeuten folgen sollen. Patient/in und Therapeut/in sitzen sich dabei leicht versetzt gegenüber (siehe Abb. 2). Diese Entspannungstechnik wird in der EMDR-Therapie kombiniert mit einem Nacherzählen und Nacherleben durch die Patientin oder den Patienten einer konkreten traumatisierenden Situation, um eine Habituation an diese zu erleichtern. Karsten Böhm beschreibt in seinem 2016 erschienenen Buch „EMDR in der Psychotherapie der PTBS” das konkrete Vorgehen in der EMDR. Darstellung der EMDR: Abbildung 2. Quelle: Böhm, A. (2016). EMDR in der Psychotherapie der PTBS. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, S.119. 62/156 Die Augenbewegungen werden in der Regel durch Handbewegungen der Therapeutin oder des Therapeuten angeleitet, denen die/der Patient/in mit den Augen folgen sollte. Die Hand der Therapeutin oder des Therapeuten zeigt währenddessen häufig mit zwei Fingern nach oben (z.B. Zeige- und Mittelfinger), während die anderen eingeklappt sind. Es ist wichtig, dass die Bewegung der Hand in einer geraden Linie erfolgt und nicht, wie bei einem tatsächlichen Pendel oder bei Scheibenwischern, schräg ist. Die Abbildung 2. aus dem oben genannten Buch von Herrn Böhm verdeutlicht das Prinzip nochmal. Die bilaterale Stimulation kann laut Böhm auch anders erfolgen. Er beschreibt drei geeignete Methoden: Augenbewegungen (welches die Methode der Wahl ist), taktile Reize („Tappen”) oder akustische Reize. Böhm weist in seinem Buch auch darauf hin, dass für komplex Traumatisierte nochmals besondere Vorsichtsmaßnahmen gelten und ein graduierteres Vorgehen empfohlen wird. Wichtig ist, dass man beim Rückerinnern an das Trauma in der EMDR ein „Window of Tolerance” einhält, das bedeutet, dass die EMDR wirkungslos ist, wenn das Arousal durch die Erinnerung zu schwach ist, aber auch, dass bei zu starkem Arousal ein kontraproduktives Flashback stattfinden kann. Daher gelten hier im Besonderen die oben beschriebenen generellen Voraussetzungen für eine Traumatherapie. In ihrem Buch „Grundlagen und Praxis: Handbuch zur Behandlung traumatisierter Menschen” beschreibt Francine Shapiro die acht Phasen der EMDR-Therapie, wobei Phase drei bis sieben die direkt zusammenhängenden Phasen einer EMDR-Sitzung beschreiben: 1. Anamnese und Behandlungsplanung (Grundsätzliche Anamnese und Traumaanamnese, Prüfung der Therapievoraussetzungen) 2. Vorbereitung und Stabilisierung (Planung der EMDR-Behandlung, Festlegung, welche Traumata in welcher Reihenfolge behandelt werden sollen, weitere Stabilisierung) 3. Bewertung des Traumas (Beginn der EMDR-Sitzung mit der Auswahl einer traumarelevanten Situation und der genauen Beleuchtung aller Aspekte (z.B. Kognitionen, Körperempfindungen) dieser Situation; Festlegung einer besseren, positiven Kognition) 4. Desensibilisierung und Reprozessieren (Durchgehen der aktivierten traumatischen Situation unter bilateraler Stimulation bis die Belastung auf null gesunken ist; bei einer komplexen Traumatisierung ist das allerdings nicht immer möglich) 5. Verankerung der positiven Kognition (Die zuvor festgelegte positive Kognition wird nun in die Erinnerung eingewoben) 6. Körpertest (Sind noch Reste sensorischer Belastung im Körper spürbar, die bearbeitet werden müssen?) 63/156 7. Abschluss (Nachbesprechung und Hinweise auf mögliche Nachwirkungen zum Beispiel in Träumen) 8. Nachevaluation (Erneutes Erinnern an die Situation in der nächsten Therapiestunde: Wie ist die Belastung jetzt?) Therapeuten können sich speziell in EMDR ausbilden und zertifizieren lassen. Auf der Website des Fachverbands für Anwender der psychotherapeutischen Methode Eye Movement Desensitization and Reprocessing (http://www.emdria.de) finden sich Informationen zur Therapie, zur Ausbildung und eine Suchmaske für Therapeuten vor Ort. Für Marburg sind dort aktuell zehn Therapeuten und Therapeutinnen eingetragen. Wie bereits oben beschrieben, wird EMDR seit Januar 2015 laut einer Pressemitteilung der Bundespsychotherapeuten Kammer (2015) zur Behandlung von Posttraumatischen Belastungsstörungen von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Pharmakologische Therapie kann indiziert sein, um eine psychotherapeutische Therapie vorzubereiten, zu begleiten und zum Beispiel eine nötige Stabilität des Affekts zu erreichen. Auch kann pharmakologische Therapie indiziert sein, wenn die psychotherapeutische Therapie wirkungslos bleibt. Generell ist jedoch eine alleinige pharmakologische Therapie der PTBS nicht das Mittel der Wahl. Im Kapitel zur „Pharmakotherapie der posttraumatischen Belastungsstörung“ von K. Leopold aus dem Buch „Posttraumatische Belastungsstörung“ von Maercker (2013), wird erklärt, dass in Deutschland nur ein Wirkstoff offiziell zur Behandlung der PTBS zugelassen ist: Paroxetin aus der Gruppe der SSRI (Serotonin-Wiederaufnahmehemmer). Es gebe zwar noch weitere Hinweise auf die mögliche Wirksamkeit von anderen Medikamenten aus der Gruppe der SSRI, aber die Studienlage sei diesbezüglich noch nicht ausreichend. Um einen Eindruck von der Praxis der psychotherapeutischen Behandlung von Geflüchteten zu erhalten, haben wir ein schriftliches Interview mit einer Therapeutin geführt (persönliche Kommunikation, 13 September 2016). Sie arbeitet in der psychotherapeutischen Nothilfe für Geflüchtete, organisiert von der Asylbegleitung Mittelhessen (für weitere Informationen siehe 3.5.2. Behandlungskette): Auszüge aus dem Interview sind hier zu lesen: 1. Wodurch oder durch wen kommen die Geflüchteten zu Ihnen? Wie werden sie auf Sie aufmerksam? 64/156 Therapeutin: „Die Anmeldungen von Asylbewerbern für eine psychologische Diagnostik, Krisenintervention oder Befundung erfolgt in der Regel über einen beteiligten Sozialarbeiter, Mitarbeiter von Flüchtlingsunterkünften oder ärztlichen Kollegen. Oft kommen die Anfragen von Freunden, Bekannten oder Familienangehörigen von denjenigen Flüchtlingen, die bereits erste (gute) Erfahrungen mit Therapie machen konnten.” 2. Was beschreiben die Geflüchteten als größte Hindernisse, um in eine Therapie zu kommen? Therapeutin: „In den Herkunftsländern existiert eine andere Vorstellung von psychischen Erkrankungen oder von möglichen Behandlungsweisen davon. Trotzdem bilden meiner Erfahrung nach nicht Stigmatisierung oder Vorurteile das größte Hindernis, sondern vielmehr das fehlende Wissen um unser Gesundheitssystem in Verbindung mit Sprachproblemen. Das Problem – wie komme ich an einen Therapeuten – existiert allerdings nicht nur unter den Flüchtlingen, sondern stellt ja tatsächlich für viele Menschen ein Hindernis dar.” 3. Inwiefern haben Sie das Gefühl, dass Ehrenamtliche den Geflüchteten helfen können, in eine Psychotherapie zu kommen? Therapeutin: „Ich würde es weniger als Gefühl als sicheres Wissen bezeichnen, dass, die sogenannten ‚Ehrenamtlichen ‘ dabei helfen können! Wichtig wäre es, die Möglichkeit für eine psychotherapeutische Unterstützung aufzuzeigen und wenn möglich Ängste und Vorurteile durch Aufklärung abzubauen. Also zum Beispiel zu erwähnen, dass für alles, was gesagt wird Schweigepflicht - auch gegenüber Ämtern und Behörden – gilt. Wichtig wäre vielleicht auch, eine Idee zu vermitteln was Psychotherapie kann: ähnlich wie bei einem ‚Heiler‘ versucht der Therapeut ein Verständnis für die Person und seine Probleme durch Gespräche zu erwerben, damit gemeinsam auf die Suche nach möglicher Unterstützung gegangen werden kann.” 4. Was sollten ehrenamtliche Helfer auf jeden Fall über psychische Krankheiten wissen? Wie sollten sie sich verhalten, bzw. welches Verhalten sollten sie vermeiden? Therapeutin: „Sicher ist das eine große Unsicherheit im Kontakt mit möglichen traumatisierten oder depressiven Menschen. Mit einer aufmerksamen, verständnisvollen Haltung und dem aktiv gezeigten Wunsch zu helfen kann ich mir allerdings rein gar 65/156 nichts vorstellen, was diese Leute falsch machen sollten! Eine möglichst langfristige Bindung oder Unterstützung anzubieten ist das was zählt.” 5. Wie empfinden Sie die Sprachbarriere? Arbeiten Sie mit einem Dolmetscher? Ist die zwangsläufige Entschleunigung durch den Übersetzungsprozess hilfreich oder hinderlich? Therapeutin: „Die Arbeit mit einem Dolmetscher oder einer Dolmetscherin hat mir zur Vermittlung zwischen den Kulturen sehr geholfen! Zunächst ungewohnt hat der Therapieprozess von der Entschleunigung insofern profitiert, als dass meine Worte sorgfältiger und damit präziser gewählt wurden.” 6. Haben Sie spezielle Erfahrungen als weibliche Therapeutin gemacht? Ist das manchmal ein Hindernis? Therapeutin: „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir weibliche Patientinnen Dinge erzählt haben, die sie einem Mann nicht anvertraut hätten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich für das andere Geschlecht genauso verhält.” 7. Funktionieren die westlich geprägten Therapiemethoden genauso gut mit Geflüchteten aus anderen Kulturen? Werden von den geflüchteten Patienten die Kulturunterschiede, die sich in der Therapie auftun (können), thematisiert? Therapeutin: „Es existieren Ansätze, die speziell für einen ‚kulturunabhängigen‘ Einsatz konzipiert wurden. Meines Wissens liegen zu dieser Frage (noch) keine Studien vor. Kulturunterschiede machen einen wesentlichen Anteil der Fragen aus. Die Menschen wollen wissen, wie man sich bei einem Behördengang verhalten sollte oder was man beim Small Talk an der Bushaltestelle besprechen kann. Oder wo es die besten Tomaten zu kaufen gibt.” 8. Was sind die häufigsten Symptome bei Geflüchteten? Therapeutin: „Meiner (begrenzten) Erfahrung nach somatische Symptome wie Kopfund Gliederschmerzen, depressive Symptome, Suchtprobleme und traumaassoziierte Symptome. Aktuelle Studien sind da sicher aussagekräftiger!” 9. Inwiefern unterscheidet sich der Symptomausdruck bei Geflüchteten von dem ihrer sonstigen Patienten? 66/156 Therapeutin: „Bisher habe ich keinen Unterschied entdecken können.” 10. Welche Rückmeldungen bekommen Sie von den Patienten? Therapeutin: „Im Wesentlichen: Danke, dass Sie für mich da sind.” 3.4.3. Empirische Fundierung (Anne Breidenstein) Die Kognitive Verhaltenstherapie zeigte eine gute generelle Wirksamkeit bei PTBS mit großen Effektstärken (d=1,49) im Vergleich zu Wartekontrollgruppen in der Meta-Analyse von Butler und Kollegen (2006). Aber auch die Erfolge der traumaspezialisierten TherapieMethoden wurden bereits durch Forschungsergebnisse untermauert: In einer Studie von Neuner und Kollegen (2004) wurde die Narrative Expositionstherapie mit zwei anderen Ansätzen (unterstützende Beratung und Psychoedukation) im Rahmen der Behandlung von Geflüchteten in Uganda mit PTBS verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass ein Jahr nach der Behandlung nur 29% der mit NET Behandelten noch Symptome zeigten, wobei die Patientinnen und Patienten in den anderen beiden Gruppen noch zu rund 80% Symptome zeigten. Auch der Review Artikel von Crumlish und Kollegen (2010) sprach sowohl der NET als auch der Kognitiven Verhaltenstherapie Wirksamkeit zu. Schauer und Kollegen zeigten 2006 sogar, dass durch NET die Hirnaktivität der Patientinnen und Patienten sich im 6-Monats-Follow-Up stärker an die Normstichprobe annäherte als durch die Standardbehandlung von traumatisierten Asylsuchenden in Deutschland. EMDR wird in der Forschung kontrovers diskutiert. Unumstritten ist, dass EMDR eine symptomlindernde Wirkung hat, die der der kognitiven Therapie mit Trauma-Fokus ebenbürtig ist (siehe Seidler & Wagner, 2006) und sogar noch eigene Vorteile mitbringt. Über den genauen Wirkmechanismus ist man sich aber noch nicht einig. Forscher der University of Surrey (Jeffries & Davis 2013) vermuten, dass zweierlei Dinge durch die Augenbewegungen ausgelöst werden: Zum einen werde durch die bilaterale Stimulation der Zugang zum Episodischen Gedächtnis verbessert und zum anderen wirke die Stimulation auch auf das Arbeitsgedächtnis ein, was das Konzentrieren auf die traumatische Situation leichter erträglich macht und zu einer besseren Erinnerung verhilft. Es gibt auch bereits Forschung und konkrete Vorschläge zum Vorgehen bei der Behandlung komplexer Traumatisierungen mit EMDR (siehe dazu Korn 2009). 67/156 2015 wurde eine Studie von den türkischen Forschern Acarturk, Konuk und Kollegen in einem Geflüchtetencamp in der Türkei durchgeführt: Die dortigen Geflüchteten aus Syrien, mit Symptomen der PTBS und der Depression, wurden zufällig in eine Behandlungs- (N=15) und eine Warte-Kontrollgruppe (N0=14) eingeteilt, Die Behandlungsgruppe wurde mit EMDR behandelt und ihre Symptome wurden direkt nach der Behandlung und noch einmal vier Wochen später erhoben. Die PTBS-Symptomatik reduzierte sich signifikant (d=1.78 im Vergleich zur Warte-Kontrollgruppe) und auch die depressiven Symptome reduzierten sich (d=1.14). Natürlich ist dies nur eine Pilotstudie, die noch weitere nachfolgende Studien in einem größeren Rahmen benötigt, aber sie lässt vermuten, dass dies eine vielversprechende Möglichkeit der Therapie ist. Erste Hinweise auf die Wirksamkeit von Antidepressiva, genauer gesagt SSRIs, bei PTBS haben schon Ebbinghaus und Kollegen im Jahr 1996 veröffentlicht. In der weiteren Forschung wurden umfassende Erklärungsmodelle für die PTBS entwickelt, die unter anderem auch die neuronalen Verbindungen und die Neurochemie einbeziehen (siehe Bonne 2004). Ein Review-Artikel von Stein und Kollegen (2006) zeigte, dass deutlich mehr Patientinnen und Patienten auf eine Medikations-Behandlung reagieren (51,9%) als auf eine PlaceboBehandlung (38,5%) und sich in der Medikationsgruppe die Symptome signifikant verbesserten. Auch wurde erneut die Überlegenheit von SSRIs gegenüber MAO-Hemmern, trizyklischen Antidepressiva und Placebo bei der Behandlung von PTBS, gerade auch in Bezug auf die langfristige Wirkung, verdeutlicht. 3.5. Was können ehrenamtliche Helfer tun? (Anna Enrica Strelow) In dem folgenden Kapitel wird beschrieben, wie Ehrenamtliche sich im Umgang mit Geflüchteten, die an einer Depression oder PTBS leiden, verhalten sollten und welches Verhalten eher vermieden werden sollte. Zudem wird im Folgenden darauf eingegangen, wie soziale Unterstützung und die Stärkung der Selbstwirksamkeit sich positiv auf die Erkrankten auswirken können. Im Folgenden wird weiterhin dargelegt, wie Ehrenamtliche den Geflüchteten helfen können, eine Psychotherapie zu beantragen. Zudem wird die rechtliche Grundlage der Psychotherapie für Geflüchtete erläutert. Es wird darauf eingegangen, wie die Motivation für eine Psychotherapie gesteigert werden kann und wie Barrieren abgebaut werden können. 68/156 3.5.1. Konkretes Verhalten im Umgang (Anna Enrica Strelow) Die Bundespsychotherapeutenkammer beschreibt in einem Ratgeber für Helf/erinnen/er von Geflüchteten (2016) was Geflüchtete brauchen, die unter Symptomen leiden, die durch ein traumatisches Ereignis ausgelöst wurden. Dazu kann bspw. gehören, dass die betroffene Person unter sehr lebhaften Erinnerungen an die traumatische Situation leidet, sie Situationen, Gerüche und Gedanken an die traumatisches Situation vermeidet, sie verschiedene Dinge vergessen hat, die mit der traumatischen Situation zu tun haben und sie bspw. Schlafstörungen hat (Dilling et al., 2011). Zudem wird beschrieben, wie der Umgang mit den Geflüchteten gestaltet werden sollte. Traumatisierte Geflüchtete haben ein großes Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz, so sollte ihnen mit Offenheit und besonderem Respekt begegnet werden. Es kann hilfreich sein, zu betonen, dass die betroffene Person sich nun weit weg von dem Ort des traumatischen Geschehens befindet und hier in Sicherheit ist (BPtK, 2016). Jedoch sollte der Person mit freundlicher Distanz begegnet werden. Auf freiwillige Erzählungen sollte mit Verständnis reagiert werden, aber detaillierte Nachfragen sollten vermieden werden, da das Erzählen von traumatischen Erlebnissen ohne professionelle Betreuung zu einer Verstärkung der Symptome führen kann und Nachfragen als zu intim für die/den Betroffenen empfunden werden kann. Vermieden werden sollten in dem Zusammenhang auch Versprechungen zu machen, die nicht eingehalten werden können sowie das Stellen einer vorschnellen Diagnose (ebd., 2016). Diagnosen sollte nur eine Ärztin oder ein Arzt, ein/e Psychiater/in oder ein/e Psychotherapeut/in stellen. Wenn die/der Betroffene häufig Flashbacks oder Nachhallerinnerungen hat, besonders gereizt oder aggressiv ist, sich zurückzieht oder sehr schreckhaft ist, sollte ihm geraten werden, sich professionelle Hilfe zu suchen. Es gibt bspw. Beratungs- und Behandlungszentren für traumatisierte Geflüchtete, die sich besonders gut mit dem Lebensweg der Geflüchteten auskennen. Wenn dies von der/dem Geflüchteten jedoch abgelehnt wird, sollte das akzeptiert werden (BPtK., 2016). Auch ohne professionelle Hilfe kann schon viel zu einem besseren Befinden der traumatisierten Person beigetragen werden. Traumatisierte Menschen brauchen Struktur und einen geregelten Tagesablauf. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Geflüchteten regelmäßig Nahrung zu sich nehmen und genügend schlafen. In Notfällen sollte jedoch ein psychiatrisches Krankenhaus oder eine Notärztin oder ein Notarzt kontaktiert werden (ebd., 2016). In der Patientenleitlinie (Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung, Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, 2011) für Depres- 69/156 sionen wird beschrieben, wie Angehörige von depressiv Erkrankten sich bestenfalls verhalten sollten, um den Umgang der Erkrankten mit der Störung zu erleichtern und nicht zu einer Verschlechterung der Symptome beizutragen. Der/Dem Erkrankten sollte in besonderem Ausmaß mit Empathie, Respekt und Verständnis begegnet werden. Dabei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass das Erzählte nicht dramatisiert wird. Langes Sprechen über unlösbare Probleme kann bei der betroffenen Person das Gefühl der Unzulänglichkeit verstärken und verschlimmern (ebd., 2016). Zudem sollte Unterstützung bei der Suche nach professioneller Hilfe angeboten werden. Depression ist eine Störung. Die Betroffenen brauchen die Hilfe einer/eines Fachkundigen und unter Umständen sogar Medikamente, damit es ihnen besser gehen kann. Zudem wird auch hier empfohlen, eine Hilfestellung bei der Tagesstruktur und dem Aufbau von Aktivitäten zu leisten. Zum Beispiel könnte man die/den Erkrankten fragen, was ihr/ihm früher Spaß bereitete und ihr/ihm Beschäftigungen anbieten. Dabei ist es hilfreich, häufigere und dafür kürzere Termine zu machen, um so sicher zu stellen, dass die Person nicht zu lange alleine ist. In jedem Fall sollte vermieden werden, die Störung zu erklären oder herunterzuspielen (ebd., 2016). Auf der Internetseite der Stiftung Deutsche Depressionshilfe wird zudem darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, geduldig zu sein und, dass die/der Betroffene keine schwerwiegenden Entscheidungen treffen sollte (Stiftung Deutsche Depressionshilfe, 2016). Beide Quellen betonen jedoch auch, dass Helfende auf sich selbst achten müssen. Sie sollten sich selbst nicht überfordern und nicht aus einem Loyalitätsempfinden heraus positive Aktivitäten einschränken. Sie sollten sich zeitliche Grenzen setzen und sich Unterstützung suchen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie das Gehörte bzw. die Arbeit zu sehr belastet. Nur wenn die/der Helfende selbst genug Kraft hat, kann sie/er andere unterstützen. 70/156 Vortragshinweise zu den Folien: Engagement in der Geflüchteten-Hilfe in Deutschland Das ist die 27. Folie des Vortrags. Auf ihr soll die Arbeit der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer gewürdigt werden. Zudem soll darauf hingewiesen werden, dass Geflüchtete einen Anspruch auf Psychotherapie haben. Dazu könnte Folgendes gesagt werden: „Sehr viel der aktiven Integrations- und Unterstützungsarbeit wird von ehrenamtlichen Schultern getragen – von Ihnen! Ohne Ihr Engagement hätte der Staat die vielen Geflüchteten kaum oder wesentlich schlechter betreuen können. Ihr Einsatz hat dazu beigetragen, den Geflüchteten in Deutschland einen besseren Start zu ermöglichen. Momentan haben Geflüchtete kaum Zugang zu Psychotherapie, weil sie häufig nicht wissen, dass sie einen Anspruch darauf haben, nicht auf die Idee kommen eine Therapeutin oder einen Therapeuten aufzusuchen oder nicht wissen, wie sie eine Therapie beginnen sollen. Deswegen wollen wir im folgenden Teil des Abends darauf eingehen, was Sie persönlich tun können, um möglicherweise psychisch erkrankten Geflüchteten zu helfen.“ 71/156 Wandel der Wilkommenskultur Das ist die 28. Folie des Vortrags. Sie soll aktuellere Pressemitteilungen zeigen und anhand derer den Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung verdeutlichen. Dazu könnte Folgendes gesagt werden: „Mittlerweile ist die sogenannte ‚Flüchtlingskrise', der politische Umgang mit ihr und die Auswirkungen all dessen ein streitbares Thema im ganzen Land geworden und auch aktuelle Pressemitteilungen spiegeln dies wieder. Nichtsdestotrotz gibt es noch immer ehrenamtliches Engagement in der ganzen Bundesrepublik, wie z.B. anlässlich der Silvesterfeier in Nürnberg.“ 72/156 Praktische Hilfestellung für Menschen mit Depression Das ist die 31. Folie des Vortrags. Auf ihr wird beschrieben, wie das konkrete Verhalten von Ehrenamtlichen im Umgang mit Geflüchteten, von denen vermutet wird, dass sie von einer Depression betroffen sind, umgegangen werden soll. „Wenn Sie vermuten, dass ein Geflüchteter unter einer Depression leiden könnte, benötigt dieser professionelle Hilfe. Die Weitervermittlung an eine/n Therapeut/in/en behandeln wir später im Vortrag. Sie persönlich können helfen, indem Sie empathisch und respektvoll sind, versuchen den Kontakt zu halten, auch wenn die erkrankte Person sich zurückziehen möchte. Geben Sie, wenn möglich, Hilfestellungen bei der Etablierung bzw. Beibehaltung einer Tagesstruktur, indem Sie konkrete Beschäftigung anbieten, z.B. Spazieren gehen. Soweit wie möglich sollten lieber häufigere, kurze Termine ausgemacht werden als seltene lange Termine; das hilft bei der Aufrechterhaltung der Tagesstruktur und bei schlechter Konzentrationsfähigkeit. Zudem sollte nachgefragt werden, was der Person früher Spaß gemacht hat, evtl. ist das Gleiche oder Ähnliches auch hier möglich. Insgesamt geht es erstmal darum, aktiver zu werden und die Tagesstruktur aufrecht zu erhalten, egal ob die Aktivität so viel Spaß macht, wie sie es ohne die Depression tun würde. Wichtig ist, dass Sie die Störung ernst nehmen und sie nicht einfach als Faulheit oder Lustlosigkeit abtun. Wenn es in einem Gespräch um ein Problem geht, das sich momentan nicht 73/156 lösen lässt, sprechen Sie möglichst nicht weiter darüber, da dies zu verstärktem Grübeln bei der Person führen kann. Versuchen Sie stattdessen etwas Aktives zu machen, den Betroffenen abzulenken. Je nachdem wie schwer die Depression ist, kann es hilfreich sein, die erkrankte Person nicht zu lange Zeiträume alleine zu lassen, da sie dann verstärkt grübeln wird und die Stimmung sich noch weiter verschlechtern könnte. Zudem sollten Sie den Betroffenen nicht zu viele Dinge abnehmen, sondern lieber nur kleine Hilfestellungen leisten, damit es den Betroffenen leichter fällt, Aufgaben selbst zu erledigen. Depressionen sollten fachgemäß behandelt werden! Ihr Verhalten kann aber eine Unterstützung zusätzlich zu einer Therapie sein!“ Praktische Hilfestellung für Menschen mit PTBS Das ist die 32. Folie des Vortrags. Zu ihr könnte bspw. Folgendes gesagt werden: „Wenn sie vermuten, dass ein Geflüchteter unter einer PTBS leidet, dann sind Sicherheit und Kontrollgefühl sehr wichtig. Die betroffene Person muss das Gefühl haben, selbst entscheiden zu können was mit ihr passiert. Vermeiden Sie bspw. zu engen, ungefragten und überraschenden Körperkontakt (Hand auf Schulter legen, ungefragt umarmen etc.), da dies eine Erinnerung an ein Trauma darstellen kann. Da traumatisierte Menschen oftmals im ‚ Inneren‘ sehr durcheinander sind, ist äußere Struktur für sie häufig sehr wichtig (Beispiel: Putzen gegen Flashbacks/Dissoziationen hilft Symptome auszuhalten). 74/156 Sie können helfen, indem Sie offen und respektvoll mit betroffenen Personen umgehen und auch hier eine/n Psychotherapeut/in/en kontaktieren. Seien Sie im Kontakt mit Geflüchteten gefasst auf Traumatisierungen und bleiben Sie zunächst, vor allem was Körperkontakt betrifft, freundlich distanziert. Falls Sie um Rat gefragt werden, was die Betroffenen selbst konkret tun können, damit es ihnen etwas besser geht, können Sie darauf hinweisen, dass es sehr hilfreich ist, wenn sie nachts ausreichend schlafen und regelmäßig essen und trinken. Wenn der Körper durch Schlafmangel oder Hunger und Durst gestresst ist, kann die Traumareaktion verstärkt auftreten. Vermeiden sollten Sie jede Art von Grenzverletzungen, wie z.B. Betreten des Zimmers ohne Klopfen, Bevormundung und vor allem detailliertes Ausfragen über Herkunft und Fluchtgeschichte, da dies die Betroffenen an ihr Trauma erinnern und Symptome hervorrufen kann. Jegliche Art von Aufregung bzw. negativem Stress sollte so weit wie möglich vermieden werden. Versuchen Sie ruhig und gelassen mit den Betroffenen umzugehen. Eine Psychotherapie bringt bei einer PTBS in der Regel sehr gute Erfolge.“ 75/156 Ehrenamtliche Helfer sollten auf ihr eigenes Wohlbefinden achten Das ist die 37. Folie des Vortrags. Dazu könnte man Folgendes sagen: „Wir können uns vorstellen, dass die Arbeit mit Geflüchteten sehr belastend sein kann. Sie hören vielleicht traurige Geschichten über Fluchtgründe oder Erlebnisse auf der Flucht. Vielleicht sehen Sie auch, dass Geflüchtete mit der neuen Situation, wie bspw. in Gemeinschaftsunterkünften, nicht gut zurechtkommen und darunter leiden. Wir würden Ihnen gerne ein paar Tipps mit an die Hand geben, die Ihnen dabei helfen können, mit belastenden Themen besser umzugehen: Seien Sie sich Ihrer Schwächen bewusst. Wenn Sie bspw. selbst Mutter oder Vater sind, kann Sie eine traurige Geschichte über ein Kind sehr belasten. Ihre Stärke kann jedoch sein, dass Sie die Sorgen einer Mutter oder eines Vaters gut verstehen können. Vernachlässigen Sie Ihre Freizeit und Ihre Hobbys nicht. Bestimmen Sie Grenzen und halten Sie diese auch ein. Strukturieren Sie sich Ihren Tag, behalten Sie die Kontrolle über Ihren Tagesablauf und lassen Sie sich nicht von außen kontrollieren. Tauschen Sie sich mit anderen Helfern aus. Auch ein Gespräch mit Freunden kann wohltuend sein. Achten Sie auf Warnsignale Ihres Körpers. Dazu kann gehören, dass Sie zu spät kommen, sich gestresst, schlapp oder lustlos fühlen, ständig unter Strom stehen oder Schlafprobleme haben. Dann sollten sie mehr auf sich achten! Nur, wenn es Ihnen gut geht, können Sie anderen helfen.“ 76/156 3.5.1.1. Soziale Unterstützung (Anne Breidenstein) Laireiter definiert soziale Unterstützung in seinem Artikel im „Handbuch Persönlicher Beziehungen” (Lenz, Nestmann 2009, S. 75) wie folgt: Soziale Unterstützung besteht aus sozialen Beziehungen und Interaktionen, die grundlegende Bedürfnisse von Menschen nach Zuneigung, Identität, Sicherheit, Information und Rückhalt befriedigen, aus denen sie Kraft und Stärke für ihre Lebensbewältigung schöpfen, sie damit ihr Befinden stabilisieren und ihre psychische und somatische Gesundheit aufrecht erhalten. Der Faktor der sozialen Unterstützung ist nicht zu unterschätzen, denn er kann einen sehr wichtigen Beitrag zur Resilienz-Steigerung eines jeden beitragen. Der Begriff Resilienz leitet sich von dem lateinischen Wort für abprallen / sich zusammenziehen, resiliere, ab und meint die Fähigkeit von Individuen, trotz widriger Umstände bei psychischer und körperlicher Gesundheit zu bleiben. In der Resilienzforschung wird z.B. untersucht, wieso manche Menschen nach potenziell traumatisierenden Erlebnissen eine PTBS entwickeln und andere nicht. Eine der ersten Studien zur Resilienz ist die „Alameda County Studie” (Beckman 1979), in der über Jahre hinweg eine Stichprobe der Bevölkerung dieser Gegend untersucht und begleitet wurde. Es wurden umfassende Daten zu ihrer Lebensweise, zu den Krankheiten und Störungen, die sie hatten und bekommen haben und zu den Mortalitätsraten gesammelt. Es wurde untersucht, wie genau sich soziale Unterstützung auf die Mortalität auswirkt und dabei statistisch für einen Einfluss von Alter, dem Gesundheitszustand, dem Todesjahr, dem sozio-ökonomischen Status, dem Gesundheitsverhalten (also z.B. Rauchen und Alkoholkonsum), dem Gewicht, der körperlichen Aktivität sowie dem Inanspruchnahmeverhalten von Gesundheitseinrichtungen kontrolliert. Es wurde ein „social tie index” berechnet, in den die quantitative Anzahl der sozialen Kontakte an der Arbeit, in der Kirche, in Vereinen, mit Freunden und Verwandten einfloss. Die Probanden der Studie wurden in vier Gruppen eingeteilt, anhand der Höhe ihres „social tie indexes”, beginnend bei „I: least connections” (diejenigen mit der wenigsten Unterstützung) bis zu „IV: most connections” (diejenigen mit der meisten Unterstützung). Dann wurde sich der Zusammenhang zwischen der Höhe der sozialen Unterstützung und dem Lebensalter, welches die (bereits verstorbenen) Probanden erreicht hatten, berechnet. 77/156 Ergebnisse der Studie von Berkman zum „social tie index”: Abbildung 3. Quelle: Berkman, L.F., Syme, S.L. (1978). Social networks, host resistance, and mortality: a nineyear follow-up study of Alameda County residents. American Journal of Epidemiology, Vol 109(2), S. 186-204. In der Abbildung 3 aus der Studie von Berkman (1978) werden die Ergebnisse grafisch dargestellt. Auf der x-Achse sind die Altersgruppen der Probanden abgetragen. Die Probanden in den Altersgruppen (30-49; 50-59 und 60-69) werden noch mal aufgeteilt in die vier „social tie index”-Gruppen, symbolisiert durch die verschieden schraffierten Balken. Die Höhe der Balken ist durch die Mortalitätsrate in dieser Gruppe bestimmt. Diese Grafik ist einmal für männliche Probanden (links) und weibliche Probanden (rechts) aufgeführt. So kann man beispielsweise mit der Grafik die Aussage treffen, dass 30,8% der 50 bis 59 jährigen Männer mit dem niedrigsten „social tie index” zwischen 1965 und 1974 (dem Zeitraum der Studie bis dahin) verstarben. Generell lassen sich verschiedene Trends mittels dieser Abbildung feststellen. Der für uns wichtigste ist der, dass die Balkenhöhe mit sinkendem „social tie index” in fast jeder Gruppe ansteigt, was bedeutet, dass die durchschnittliche Mortalitätsrate in den Gruppen mit wenigen sozialen Kontakten höher ist. Diese Studie war einer der ersten und gleichzeitig auch deutlichsten Hinweise auf die große Bedeutung von sozialer Unterstützung. Die dadurch inspirierte Resilienzforschung befasste sich auch weiterhin mit der Frage, welche Faktoren Menschen körperliche und seelische Gesundheit verschaffen. 2012 wurde z.B. von Begel und Lyssenko ein umfassender Artikel 78/156 über die zur Reslilienz beitragenden Faktoren veröffentlicht, in dem auch soziale Unterstützung als entscheidender Faktor benannt wird. Bengel und Lyssenko (2012, S.91) erläutern detailliert verschiedene mögliche Wirkmechanismen, betonen aber zwei besonders: Auf der kognitiven Ebene scheint [...] die wahrgenommene Unterstützung – also die stabile Erwartung, im Zweifelsfall die gewünschte und erhoffte Form der Unterstützung zu bekommen – einen protektiven Effekt zu haben. Auf der Handlungsebene scheinen hingegen vor allem nichtwertende Interaktionen, die dem individuellen Bedürfnis entsprechen, entlastend zu sein. Für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer lässt sich daraus schließen, dass sie besonders mit stabiler Verlässlichkeit und mit nicht-wertenden zwischenmenschlichen Interaktionen, also Gesprächen, in denen sie auf die Bedürfnisse des Geflüchteten eingehen, eine gute soziale Unterstützung dieser leisten können. Soziale Unterstützung wird üblicherweise in drei verschiedene Formen unterteilt, emotionale/psychologische Unterstützung (z.B. Trost spenden, zuhören und Verständnis zeigen), praktische/instrumentelle Unterstützung (z.B. ein Fahrrad reparieren oder eine Sachspende machen) und informationelle Unterstützung (z.B. einen psychoedukativen Vortrag mit nützlichen Informationen und Verhaltensempfehlungen halten). Ehrenamtliche können durch ihr Verhalten alle drei Formen sozialer Unterstützung für Geflüchtete bereitstellen. Sei es durch Einfühlungsvermögen bei Gesprächen über Probleme, durch ein einfaches Gespräch oder auch durch Spielen mit Kindern, durch Informationen und durch Aufklärung über Sachverhalte. Eine Untersuchung von Heeren und Kollegen (2012) zeigte, dass eine Gruppe Geflüchteter, die vor 15,5 Monaten in der Schweiz angekommen war, nicht signifikant mehr soziale Kontakte hatte als eine andere Gruppe von Geflüchteten, die erst vor kurzem angekommen war. Dies ist ein Hinweis darauf, dass es Geflüchteten nicht leicht fällt, viele soziale Kontakte zu knüpfen. Hier können Ehrenamtliche helfen. Zum Beispiel können sie Geflüchtete an verschiedene Gruppen, die Aktivitäten planen sowie an Tandem-Programme zum gemeinsamen Kochen vermitteln oder ihnen in Form der eigenen Kommunikationskompetenz sozialen Kontakt bereitstellen. Umgekehrt scheint auch Diskriminierung, also das Gegenteil von sozialer Unterstützung, einen Einfluss auf die psychische Gesundheit zu habe. Pascoe und Smart Richman (2009) berichten in ihrem Review-Artikel über wahrgenommene Diskriminierung, dass 90% der von ihnen zusammengefassten Studien eine Verschlechterung der mentalen Gesundheit bei 79/156 höherer wahrgenommener Diskriminierung gefunden haben, 69% sogar eine signifikante Verschlechterung. 3.5.1.2. Selbstwirksamkeit stärken (Anne Breidenstein) Die Selbstwirksamkeitserwartung wird ebenfalls von Bengel und Lyssenko (2012) in ihrer Liste resilienzfördernder Faktoren aufgelistet. Eine hohe Selbstwirksamkeit zu haben bedeutet, davon überzeugt zu sein, dass man die Probleme, die sich einem stellen selbstständig lösen kann. Anders gesagt, dass man die Fähigkeiten und das Wissen dazu hat, sich selber zu helfen und seine Ziele zu erreichen, also das genaue Gegenteil von Hilflosigkeit. In ihrem Review-Artikel zur Selbstwirksamkeit bei PTBS berichten Benight und Bandura (2004) von der zentralen Rolle der Selbstwirksamkeit bei der Genesung von einer PTBS. Sie sprechen ihr auch eine protektive Funktion bei der Verhinderung einer PTBS zu, nachdem ein potenziell traumatisierendes Ereignis geschehen ist. Benight und Bandura postulieren drei verschiedene Wirkmechanismen zum Einfluss der Selbstwirksamkeit auf die Verarbeitung des traumatischen Ereignisses: 1. Eine Situation wird dann als überfordernd und überwältigend empfunden, wenn die Ansprüche, die diese Situation stellt, über die eigenen Fähigkeiten hinausgehen. Da Menschen mit hoher Selbstwirksamkeit aber davon überzeugt sind, dass sie hohe Fähigkeiten haben um Probleme zu lösen und zu bewältigen, kommen sie seltener in Situationen in denen sie sich ausgeliefert und hilflos fühlen (Benight und Bandura nennen das „attentional and construal processes”). 2. Selbstwirksamkeit hilft auch beim Umgehen (Coping) mit überwältigenden und bedrohlichen Situationen. Menschen mit hoher Selbstwirksamkeit, schaffen es auch in diesen Situationen eher, produktive Coping-Mechanismen anzuwenden und aktiv gegen die Bedrohung anzuarbeiten, sie also aktiv zu bewältigen (Benight und Bandura nennen das „transformative actions”). 3. Menschen mit hoher Selbstwirksamkeit fühlen sich in bedrohlichen Situationen ihren negativen Gedanken weniger ausgeliefert. Sie schaffen es, die Kontrolle über ihre Gedanken zurück zu gewinnen oder sich zumindest von ihnen nicht zu sehr beunruhigen zu lassen (Benight und Bandura nennen das „thought control efficacy”). Bengel und Lyssenko betonen weiter, dass die Selbstwirksamkeit für die Resilienzforschung besonders interessant ist, weil sie keine feststehende Größe ist, sondern durch Lernerfahrungen verändert werden kann. Dabei beziehen sie sich wiederum auf die Forschung Band- 80/156 uras (2001), der postuliert, dass die Selbstwirksamkeitserwartung eines Menschen durch eigene Lernerfahrung verändert werden kann. Erfährt ein Geflüchteter zum Beispiel, dass sich durch seine Handlungen und Bemühungen tatsächlich etwas verändert, dass er Einfluss hat, so kann die Selbstwirksamkeit damit gestärkt werden. Daher empfiehlt es sich, den Geflüchteten so viel Entscheidungsfreiheit und Handlungsoptionen wie möglich zu geben, sei das bei der freien Kleidungswahl in der Kleiderkammer oder dadurch, dass man ihnen die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel erklärt und so neue Möglichkeiten der Fortbewegung eröffnet. Denkbar wären auch Hinweise auf verschiedene Projekte, in denen sie sich einbringen und aktiv etwas verändern könnten, wie z.B. auf den Raum Marburg bezogen die Fahrrad-Werkstatt, welche die Asylbegleitung Mittelhessen gemeinsam mit der Radikate Marburg für Geflüchtete betreibt (siehe: http://asylbegleitung- mittelhessen.de/Die_Asylbegleiter/Sonstige_Tatigkeiten/ sonstige_tatigkeiten.html) oder die Initiative „Über den Tellerrand schauen” aus Marburg (zu finden bei Facebook), in der Geflüchtete und Beheimatete gemeinsam kochen und essen. Auch die deutsche Sprache spielt eine entscheidende Rolle, denn nur mit ihr ist die Kommunikation mit einem großen Teil der Umwelt möglich. Ein wichtiger Schritt zur Selbstständigkeit ist also ein grundlegendes Beherrschen dieser Sprache. Auch dort können ehrenamtliche Helferinnen und Helfer Geflüchteten Unterstützung anbieten. Ein weiterer wichtiger unterstützender Mechanismus ist das Modelllernen. Bandura betont, dass auch durch „symbolische Erfahrungen”, die entstehen, wenn Menschen beobachten, wie andere in ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen und Situationen meistern, die Selbstwirksamkeitserwartung der Beobachter gestärkt werden kann. Für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer bedeutet das für ihre Arbeit: Mit gutem Beispiel voran gehen, nicht aufgeben, wenn es mal schwierig wird und solange aktiv nach einer Lösung suchen, bis das Problem gelöst werden kann. 81/156 Zusammenfassung und Vortragshinweise zu den Folien: Allgemeine praktische Hilfestellungen Das ist die 30. Folie des Vortrags. Sie soll verdeutlichen, was ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in ihrem Umgang mit Geflüchteten tun können um psychischen Störungen vorzubeugen oder psychisches Leiden zu lindern. Zu der Folie könnte man zum Beispiel folgendes sagen: „Sowohl soziale Unterstützung als auch die Selbstwirksamkeit sind wichtige Schutzfaktoren vor psychischen Störungen für jeden Menschen. Soziale Unterstützung besteht nach Laireiter „aus sozialen Beziehungen und Interaktionen, die grundlegende Bedürfnisse von Menschen nach Zuneigung, Identität, Sicherheit, Information und Rückhalt befriedigen, aus denen sie Kraft und Stärke für ihre Lebensbewältigung schöpfen, sie damit ihr Befinden stabilisieren und ihre psychische und somatische Gesundheit aufrecht erhalten‘ (Das kann auch paraphrasiert oder abgelesen werden) Soziale Unterstützung können Sie (und andere) Geflüchteten auf verschiedenste Weisen geben, sei es durch Einfühlungsvermögen bei Gesprächen über Probleme, durch ein einfaches Gespräch oder auch durch Spielen mit Kindern, oder durch Lieferung von Informationen und Aufklärung über Sachverhalte.“ „Eine hohe Selbstwirksamkeit hat den gleichen schützenden und puffernden Effekt. Was bedeutet Selbstwirksamkeit genau? Selbstwirksamkeit bedeutet die Erwartung zu haben, dass man die Probleme, die sich einem stellen, selbst lösen kann, dass die eigenen Handlungen Auswirkungen haben. Es ist quasi das genaue Gegenteil von Hilflosigkeit. Wie kann man Menschen also dabei helfen sich selbst zu helfen? Man kann ihnen so viele Werkzeuge 82/156 mitgeben wie sie brauchen, zum Beispiel das Verständnis des öffentlichen Nahverkehrs oder, auch ganz wichtig, die deutsche Sprache. Auch ist es wichtig, Geflüchteten so viel Entscheidungsfreiheit wie möglich zu lassen, zum Beispiel beim Aussuchen in der Kleiderkammer.“ 83/156 3.5.2. Behandlungskette (Anne Breidenstein) Möchte man für Menschen mit anerkanntem Asyl und damit bestehender Krankenversicherung eine Psychotherapie organisieren, so muss man denselben Weg gehen, wie jede/r andere gesetzlich Versicherte in Deutschland auch. Man muss einen Termin bei einem (oder auch mehreren) Psychotherapeuten ausmachen, dann können zunächst fünf probatorische Sitzungen stattfinden und anschließend muss ein Therapieantrag auf Lang- oder Kurzzeittherapie von der Therapeutin oder dem Therapeuten an die Krankenkassen gestellt werden. Hinweise zu der Suche nach den geeigneten Therapeuten finden sich am Ende dieses Abschnitts. Möchte man für Asylsuchende ohne Krankenversicherung eine Psychotherapie organisieren, muss man zunächst ein paar bürokratische Hürden nehmen. Diese sind von Landkreis zu Landkreis verschieden, im Folgenden wird das Vorgehen beispielhaft für den Landkreis Marburg-Biedenkopf vorgestellt: 1. Krankenschein beim Sozialamt abholen 2. Besuch beim Hausarzt bzw. bei der Hausärztin, dort Überweisung zum/zur Psychotherapeut/in 3. Fünf probatorische Sitzungen können (nach Genehmigung) sofort absolviert werden 4. Therapieantrag beim Sozialamt für mehr Sitzungen 5. Genehmigung abwarten; eventuell Untersuchung des Geflüchteten durch einen Amtsarzt/eine Amtsärztin Zu der Abholung des Krankenscheins erhielten wir von einer Mitarbeiterin des Fachdiensts Ausländer und Migration, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Stabsstelle Auslän- der/Migration/Flüchtlinge die Auskunft, dass „jede Person [...] einen Krankenschein pro Quartal [erhält]. Die dort beschriebenen Leistungen werden von uns übernommen ohne vorherige Prüfung der Kostenübernahme und richten sich inhaltlich nach § 4 Asylbewerberleistungsgesetz. Darüber hinaus gehende Behandlungen erfordern eine vorherige Prüfung der Kostenübernahme. Für den Besuch weiterer Ärzt/e/innen im gleichen Quartal benötigt man eine Überweisung der/des Ärztin/Arztes, bei dem man den Original-Krankenschein abgegeben hat,”; also in der Regel der Hausärztin oder dem Hausarzt, der einen dann an die Spezialisten verweisen kann. (Für eine detailliertere Übersicht über § 4 Asylbewerberleistungsgesetz siehe Abschnitt 3.6.2. Regelungen für psychotherapeutische Behandlung.) Die Mitarbeiterin wies außerdem darauf hin, dass auch die fünf probatorischen Sitzungen zunächst „von uns vorab genehmigt werden [müssen]. Dies geschieht mit Hilfe einer gutachterlichen Stellungnahme durch das Gesundheitsamt.” 84/156 Anders als bei den gesetzlich Versicherten, muss der Therapieantrag von der Psychotherapeutin oder dem Psychotherapeuten nach den probatorischen Sitzungen an das Sozialamt und nicht an die Krankenkasse gestellt werden, da Asylsuchende in der Regel noch nicht versichert sind. Gegebenenfalls kann es danach auch zu einer postalischen Vorladung zum/zur Amtsarzt/Amtsärztin kommen, zwecks einer Begutachtung des Asylsuchenden durch diesen. Allerdings muss man zu diesem Ablauf sagen, dass er sich jederzeit verändern kann. Da die Nachfrage im letzten Jahr immens angestiegen ist und auch der Gesetzgeber bereits Änderungen angekündigt hat, ist damit zu rechnen, dass sich demnächst noch Veränderungen ergeben. Bei akuter Suizidalität sind auch Psychiatrien Anlaufstellen; eine stationäre Aufnahme in einer geschützten Station ist unter solchen Umständen möglich. Zum Beispiel sind die beiden Kliniken in Marburg, an die man sich in einem solchen Fall wenden könnte, die Vitos Klinik in Cappel und die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Gießen-Marburg am Ortenberg. Auf der Website http://arztsuchehessen.de/arztsuche/arztsuche.php der Kassenärztlichen Vereinigung kann man gezielt Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten mit verhaltenstherapeutischem oder anderem Schwerpunkt in Marburg suchen. Auch über die Website http://www.psychotherapie-marburg.de ist eine Suche möglich, diese Website ist aber noch im Aufbau und enthält keine vollständige Übersicht über die Therapeuten. Allerdings kann man dort viele nützliche Informationen nachlesen, wie z.B. wann eine Psychotherapie angebracht ist, welche Verfahren es gibt und was zur Beantragung einer Psychotherapie nötig ist. Auch gibt es dort unter dem Punkt „Psychotherapie für Flüchtlinge” eine selbst organisierte Nothilfe, die sich mit dem Ziel zusammengefunden [hat], psychisch schwer beeinträchtigten Flüchtlingen Zugang zu Leistungen im Bereich Krisenintervention, Psychotherapie, Befundung und Begutachtung zu ermöglichen. Unter der Mailadresse psychonothilfe@asylbegleitung- mittelhessen.de kann ein kurzer Aufnahmebogen angefordert und ausgefüllt werden. Nach der Rücksendung versuchen wir, das Anliegen schnellstmöglich zu prüfen und Patient/inn/en, Dolmetscher/innen und Therapeut/innen zusammenzubringen, sofern dies möglich und sinnvoll ist. Die Asylbegleitung Mittelhessen, die bezüglich der Nothilfe mit den Therapeuten zusammenarbeitet und darüber hinaus viele Hilfen für Geflüchtete organisiert, ist ein gemeinnütziger Verein, der auch bei besonderen Fragen oder Problemen kontaktiert werden kann. Viele Psychotherapeuten suchen selbstständig Dolmetscher, ansonsten kann im Raum Marburg 85/156 z.B. das „DolMa” Angebot des Landkreises Marburg-Biedenkopf angenommen werden. Über die DolMa werden Dolmetscher vermittelt, mehr Informationen und Kontakt Daten auf der Website des Landkreises: http://www.marburg-biedenkopf.de/auslaender-migration/buerofuer-integration /unsere-angebote-und-projekte/dolmetscherdienst-dolma/ 86/156 Zusammenfassung und Vortragshinweise zu den Folien: Beispielablauf für die Beantragung einer ambulanten Psychotherapie für Asylsuchende Das ist Folie 34 aus dem Vortrag. Sie beschreibt den Ablauf einer Beantragung eines Psychotherapieplatzes für Asylsuchende im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Dazu lässt sich zum Beispiel Folgendes sagen: „Dieser Ablauf gilt für Asylsuchende, bereits Asyl-habende sind regulär krankenversichert und können wie jeder andere gesetzlich Versicherte einen Psychotherapieplatz bekommen. Generell ist es aber so, dass es bei Psychotherapieplätzen lange Wartezeiten von mehreren Monaten gibt, daher ist es sinnvoll, sich zeitig um einen Platz zu kümmern. Hier sehen sie den aktuellen Ablauf für den Landkreis Marburg-Biedenkopf, leider ist das von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich und kann sich auch bald wieder ändern. Momentan ist es aber so, dass zuerst ein Krankenschein beim Sozialamt abgeholt werden muss, dann folgt der Gang zur Hausärztin oder zum Hausarzt, wo der Krankenschein abgegeben wird. Dieser schreibt dann die Überweisung zum Psychotherapeuten. Wie sie Psychotherapeuten finden, erläutern wir Ihnen später noch genauer. Dort können nach Genehmigung zunächst fünf probatorische Sitzungen absolviert werden. Anschließend stellt der/die Therapeut/in einen Antrag auf Kurz- oder Langzeittherapie beim Sozialamt. Die Genehmigung dafür muss abgewartet werden und eventuell muss sich der Hilfesuchende bei der/beim Amtsärztin/Amtsarzt vorstellen zwecks einer Begutachtung. In akuten Fällen und bei Suizidalität ist auch immer eine Aufnahme in die geschützte Station der Psychiatrie möglich! Wenden Sie sich dafür an die Vitos Klinik in Cappel oder die Psychiatrie des Universitätsklinikums Gießen-Marburg.“ 87/156 Hilfreiche Anlaufstellen in Marburg Das ist Folie 35 des Vortrags. Auf ihr finden sich nützliche Anlaufstellen. Hierzu könnte man zum Beispiel sagen: „Das sind nützliche Anlaufstellen, die genauen Kontaktdaten finden Sie auf ihrem Handout. Die Asylbegleitung Mittelhessen bietet in Kooperation mit einigen Therapeuten einen Notdienst an, der in akuten Fällen kontaktiert werden kann, zusätzlich zur Psychiatrie. Die Emailadresse finden Sie auf ihrem Handout. Auf der Website der PsyMa finden Sie Informationen darüber wann eine Psychotherapie angeraten ist, welche Verfahren es gibt und was Sie zur Beantragung der Psychotherapie benötigen. Es gibt auch eine Liste von Therapeuten, die aber noch nicht ganz vollständig ist, weil sie gerade im Aufbau ist. DolMa ist ein Service des Landkreises, der Dolmetscher im Bereich der Gesundheitsversorgung vermittelt, mache Therapeuten kontaktieren aber auch selbst Dolmetscher. Bei weiteren Fragen kann man sich auch an die Ausländerbehörde in Marburg wenden.“ 88/156 Suche nach einem Psychotherapeuten Das ist Folie 36 des Vortrages, sie zeigt die Suchmaske der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen. Dazu könnte man folgendes sagen: „Auf dieser Website finden Sie eine vollständige Liste der Therapeuten in Marburg, Sie können in Ihrer Suche auch genau einstellen, welche Art von Therapie sie suchen und welche Sprache die oder der Therapeut/in sprechen soll oder welches Geschlecht er oder sie haben soll.“ 89/156 3.5.3. Barrieren abbauen und Motivation steigern (Anne Breidenstein) Sich mit einer psychischen Störung in eine psychotherapeutische Behandlung zu begeben ist keine leichte Entscheidung, auch für schon lange in Deutschland lebende Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Laut Jacobi und Kollegen (2014) liegt die 12-Monats-Prävalenz für psychische Störungen in Deutschland (in der Altersgruppe 18-79 Jahren) bei 27,7%. Von diesem 27,7% haben, je nach Schweregrad und Anzahl der Diagnosen, nur 10-40% professionelle Behandlung aufgesucht. Diese Zahlen machen deutlich, dass in der Allgemeinbevölkerung die Schwelle, zu Psychotherapeuten zu gehen, hoch liegt. Wenn dazu die Erkrankten in ein neues, fremdes Land geflüchtet sind, die Sprache nicht sprechen und das Konzept der Psychotherapie (und ihre Bezahlung durch die Krankenkassen oder den Staat) nicht kennen, ist es gut vorstellbar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich professionelle Hilfe suchen (können), sehr gering ist. Daher können ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sie darin unterstützen, zum Beispiel zunächst einmal durch Informationen über die Möglichkeit der Psychotherapie und über die konkreten Umstände einer solchen. Was passiert zum Beispiel in einer Psychotherapie? Wer führt diese durch? Wer bezahlt sie? Was muss ich tun um einen Platz zu bekommen? Wie kann die Sprachbarriere überwunden werden? Und gehen da nicht nur Verrückte hin? Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer können auch helfen, Stigmatisierungen abzubauen. Wie oben beschrieben, liegt die 12-Monats-Prävalenz für Psychische Störungen in Deutschland bei rund 30%. Das bedeutet, dass etwa ein Drittel der Bevölkerung (zwischen 18 und 79 Jahren) in der Situation ist, dass sie ein Problem haben das sich mit psychotherapeutischer Hilfe lösen lässt. Die Depression ist dabei die zweithäufigste Störung, also sind die Erkrankten damit keineswegs allein. Auch ein Hinweis auf die Spezialisierung vieler Therapeuten (siehe dazu auch im Abschnitt Traumatherapieverfahren) und die belegten Wirksamkeiten verschiedener spezieller PTBS oder Depressions-fokussierter Therapien lohnt sind. Oftmals ist die Hoffnung auf Besserung der Symptomatik ein guter Motivator. Letztendlich gilt auch hier, was oben im Abschnitt zur Selbstwirksamkeit beschrieben wurde: Eigenständigkeit stärken und die Möglichkeiten, sich selbst zu helfen zu erweitern, funktioniert besser als die Erkrankten zu einer Psychotherapie zu drängen. 3.6. Rechtslage (Anne Breidenstein) 90/156 3.6.1. Asylrecht (Anne Breidenstein) Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) kann es drei verschiedene Schutzformen auf Gesetzesbasis geben: 1. Anerkennung als Asylberechtigter (Art. 16a Abs. 1 GG) 2. Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach der Genfer Flüchtlingskonvention (§ 3 Abs. 1 AsylG) 3. Zuerkennung von subsidiärem Schutz (§ 4 Abs. 1 AsylG) Die erste Schutzform ist die Asylberechtigung nach Artikel 16a des Grundgesetzes. Dieser besagt, dass „politisch Verfolgte” Asylrecht genießen. Allerdings ist laut BAMF (nachzulesen auf der Website bamf.de unter: „Asyl und Flüchtlingsschutz”, „Ablauf des Asylverfahrens”, „Schutzformen”, „Asylberechtigung”) „bei einer Einreise über einen sicheren Drittstaat […] eine Anerkennung der Asylberechtigung ausgeschlossen.” Dies ist in Absatz 2 des Grundrechtes verankert. Außerdem bezieht sich die politische Verfolgung nur auf eine von dem Staat ausgehende Verfolgung oder eine Verfolgungen von Organisationen, die quasi an die Stelle des Staates getreten sind. Diese Spezifizierung erscheint vor dem Hintergrund der Formulierung des Grundgesetzes nach dem Zweiten Weltkrieg logisch. Allerdings schließt dieser Artikel so Asylberechtigung wegen eines reinen Bürgerkrieges im Heimatland (oder auch Armut oder Naturkatastrophen) aus. Die rechtlichen Folgen der Asylberechtigung sind laut BAMF (nachzulesen auf der selben Website unter „Rechtliche Grundlagen und Folgen”): „Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre, unbefristete Niederlassungserlaubnis nach drei Jahren, unbeschränkter Arbeitsmarktzugang - Erwerbstätigkeit gestattet”. Der Flüchtlingsschutz wird durch das BAMF definiert (nachzulesen auf der Website bamf.de unter: „Asyl und Flüchtlingsschutz”, „Ablauf des Asylverfahrens”, „Schutzformen”, „Flüchtlingsschutz”) als Schutz eines Menschens „wenn sein Leben oder seine Freiheit in seinem Herkunftsland wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist.”. Eine weitere Voraussetzung ist der Aufenthalt außerhalb des Herkunftslandes. Sollte jemand eine schwere Straftat begangen haben oder als Gefahr für das Land eingestuft werden, kann ihr oder ihm dieses Recht verwehrt werden. Die rechtlichen Folgen des Flüchtlingsschutzes sind laut BAMF die selben wie die der Asylberechtigung. Sollten weder Asylberechtigung noch der Flüchtlingsstatus zuerkannt werden, kann noch der subsidiärer Schutz anerkannt werden. Laut § 4 Abs. 1 AsylG wird der subsidiäre Schutz des Geflüchteten bei folgenden Fällen der Flucht vor „ernsthaftem Schaden” anerkannt: „1. die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, 2. Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung oder 3. eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen 91/156 eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts.“ Hierin sind also auch Fliehende vor Bürgerkriegen mit eingeschlossen. Laut BAMF sind die rechtlichen Konsequenzen daraus ähnlich, wenn auch weniger großzügig als die des Asylrechts und des Flüchtlingsschutzes: Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr, bei Verlängerung: jeweils zwei weitere Jahre. Niederlassungserlaubnis nach fünf Jahren (die Asylverfahrensdauer wird eingerechnet) möglich, wenn weitere Voraussetzungen, wie etwa die Sicherung des Lebensunterhalts sowie ausreichende Deutschkenntnisse, erfüllt sind. Unbeschränkter Arbeitsmarktzugang - Erwerbstätigkeit gestattet” (nachzulesen auf der Website bamf.de unter: „Asyl und Flüchtlingsschutz”, „Ablauf des Asylverfahrens”, „Schutzformen”, „Subsidärer Schutz”). Über die durchschnittliche Dauer des Asylverfahrens selbst gibt es unterschiedlichste Angaben, was unter anderem daran liegt, dass die offizielle Dauer des Asylverfahrens erst mit dem sogenannten Termin zur Aktenlage beginnt. Erst mit diesem Termin beginnt der Entscheidungsprozess über den Asylantrag. Laut der Landesrundfunkanstalt Bayrischer Rundfunk (BR) können bis zu acht Monate zwischen Antragsstellung und Verfahrensbeginn verstreichen (Kraft, 2015). „Gründe hierfür sind neben den extrem hohen Zugangszahlen Engpässe bei einigen Dolmetschern. Das Bundesamt arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, diesen Zustand zu beheben. Wenn alle bereits eingeleiteten Maßnahmen greifen, kann dies in absehbarer Zeit gelingen." kommentiert der Pressesprecher des BAMF gegenüber dem BR. 3.6.2. Regelungen für psychotherapeutische Behandlung (Anne Breidenstein) In Folge der oben beschriebenen Schwierigkeiten behalten viele Geflüchtete über einen längeren Zeitraum den Status der Asylsuchenden. Für diese Asylsuchenden gelten spezielle Bedingungen: „Im ersten Jahr ihres Aufenthaltes dürfen Asylsuchende nicht arbeiten, in der folgenden Zeit nur sehr eingeschränkt. Sie müssen in Unterkünften wohnen, die ihnen zugewiesen wurden und dürfen ihren Aufenthaltsort nicht ohne spezielle Erlaubnis verlassen.” (Witte, 2008). Asylsuchende müssen sich registrieren und bekommen einen Ankunftsnachweis ausgehändigt. Dieser weist laut BAMF als erstes offizielles Dokument die Berechtigung zum Aufenthalt in Deutschland nach. Und, ebenso wichtig: Er berechtigt dazu, staatliche Leistungen zu beziehen, wie etwa Unterbringung, medizinische Versorgung und Verpflegung.” (nachzulesen auf der Website bamf.de unter: „Asyl und Flüchtlingsschutz”, „Ablauf des Asylverfahrens”, „Ankunft und Registrierung”). 92/156 Die Gesetzesgrundlage für diese medizinischen Leistungen ist das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG, siehe auch Anhang). Dort steht in Paragraph vier, Satz eins: Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sind die erforderliche ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Störungen oder Störungsfolgen erforderlichen Leistungen zu gewähren. und in Paragraph sechs, Satz eins und zwei: (1) Sonstige Leistungen können insbesondere gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerläßlich, (...) sind. (2) Personen, (..), die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben, wird die erforderliche medizinische oder sonstige Hilfe gewährt. Mit diesem Gesetz ist also die medizinische Grundversorgung der Asylsuchenden sicher gestellt, ein Anspruch auf Psychotherapie und die nötigen Dolmetscher oder FahrtkostenErstattung (diese würden unter „sonstige Hilfe” fallen) leitet sich aus dem Gesetzestext aber nur indirekt ab. Psychotherapie wird oftmals (und häufig fälschlicherweise) nicht als Therapie einer akuten, sondern einer chronischen Störung gewertet, mit Ausnahme der Suizidalität. Diese schlechte Versorgungslage kann dann zur tatsächlichen Chronifizierung und deutlichen Verschlechterung von psychischen Störungen führen und wird von vielen FachVerbänden beklagt. Vor diesem Hintergrund ist es für die Beantragung einer Psychotherapie sehr wichtig, im Antrag deutlich zu machen warum die Behandlung keinen Aufschub erlaubt. Zum konkreten Vorgehen siehe Abschnitt 3.5.2. Behandlungskette. Bevor eine medizinische oder psychotherapeutische Beratung oder Behandlung möglich ist, muss diese also immer zuerst beim Sozialamt beantragt werden. Lösungsansätze für diesen hohen bürokratischen Aufwand, der eine Zeitverzögerung in der Behandlung bedeutet, finden sich z.B. in dem Modell der Gesundheitskarte für Asylbewerber, wie es in Hamburg und Bremen existiert (nachzulesen im Bericht „Erst zum Amt oder gleich zum Arzt?” von T. Anthony für den NDR). Sobald der Asylantrag anerkannt ist und jemand seinen Status von Asylbewerber/in zu Asylhabendem/-habender gewechselt hat, ist er/sie verpflichtet, sich bei einer gesetzlichen Krankenkasse zu versichern. Zurzeit ist das in der Regel die AOK. Ab diesem Zeitpunkt läuft 93/156 die medizinische Versorgung genau wie bei allen anderen gesetzlich Versicherten in Deutschland. 94/156 Zusammenfassung und Vortragshinweise zu den Folien: Asylbewerberleistungsgesetz Das ist Folie 20 des Vortrags. (Folie 19 und 20 zeigen aber Teile des gleichen Inhalts ohne die Hervorhebungen) Hier könnte man Folgendes sagen: „Für Asylbewerber (und geduldete oder Menschen, deren Abschiebung ausgesetzt wurde; siehe Regelung für Abschiebungsverhinderung) gilt dieses Gesetz. Es regelt, welche Leistungen der Staat für die Asylsuchenden bewilligt und bezahlt. In Paragraph vier ist zu lesen, dass akute Erkrankungen behandelt werden, leider gehören in der Auslegung dieses Gesetzes psychische Störungen eher selten dazu. Eine Ausnahme ist die akute Suizidalität. Der Anspruch auf Behandlung der meisten psychischen Störungen leitet sich indirekt aus Paragraph sechs, Abschnitt zwei ab. (Paragraph sechs vorlesen) Auch ein Anspruch auf Fahrt- und Dolmetscherkosten für eine ambulante Psychotherapie ergibt sich indirekt aus diesem Paragraphen (= sonstige Hilfe).“ 3.6.3. Regelung für Abschiebungsverhinderung (Anne Breidenstein) Ein Abschiebungsverbot kann nach Verwehrung der drei oben genannten Schutzbestimmungen noch erteilt werden, wenn die Abschiebung des Ausländers in sein Herkunftsland 95/156 unzumutbar ist. Laut § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG darf ein Ausländer weder abgeschoben werden, wenn ihm im Heimatland mit hoher Wahrscheinlichkeit Menschenrechtsverletzungen drohen oder eine schwere Störung ihn an der Ausreise hindert: „Eine erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen liegt nur vor bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden.”(§ 60 Abs. 7). Dieser Punkt schloss in der Praxis auch lange psychisch Erkrankte ein. Die Regelungen bezüglich der Abschiebung Kranker wurden aber mit dem Asylpaket II maßgeblich gelockert. Konkret heißt es im Gesetzesentwurf für das Asylpaket II dazu Die Änderungen des Aufenthaltsgesetzes dienen zum einen dem Abbau von Abschiebungshindernissen aus vermeintlich gesundheitlichen Gründen. Die Praxis zeigt, dass die Geltendmachung von medizinischen Abschiebungshindernissen die Behörden in quantitativer und qualitativer Hinsicht vor große Herausforderungen stellen. Daher geht der Gesetzgeber unter anderem davon aus, dass grundsätzlich nur lebensbedrohliche und schwerwiegende Erkrankungen, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden, die Abschiebung des Ausländers hindern können. (Deutscher Bundestag - Drucksache 18/7538 vom 16.02.2016, S. 11) Nach § 60a AufenthG wird die betreffende Person dadurch „geduldet”: Einem Ausländer kann eine Duldung erteilt werden, wenn dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. Auch diese geduldeten Ausländer fallen in den Leistungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes, nachzulesen in § 1 Absatz 1, 4. Variante. 96/156 4. Literaturverzeichnis Acarturk, C., Konuk, E., Cetinkaya, M., Senay, I., Sijbrandij, M., Cuijpers, P., & Aker, T. (2015). EMDR for Syrian refugees with posttraumatic stress disorder symptoms: results of a pilot randomized controlled trial. European Journal Of Psychotraumatology, 6. doi:http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v%v.27414 Anthony, T. für den NDR (2005, 24 September). „Erst zum Amt oder gleich zum Arzt?” Vergügbar unter: https://www.tagesschau.de/inland/gesundheitskarte-fluechtlinge101.html [03.08.2016] American Psychatric Association, Falkai, P., Wittchen, H.-U., Döpfner, M., Gaebel, W., Maier, W., Rief, W., Saß. H., Zaudig, M. (Hrsg.). (2015). Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen (DSM-5). Göttingen: Hogrefe. Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften. (2011) S3 – Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung ICD 10: F 43.1 Verfügbar unter: http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/051010k_S3_Posttraumatische_Belastun gsstoerung_2012-abgelaufen.pdf [08.01.2017] Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie. (2016). Das AMDPSystem: Manual zur Dokumentation psychiatrischer Befunde. (9., überarbeitete und erweiterte Auflage) Verlag für Psychologie, Hogrefe. Asgary, R., & Segar, N. (2011). Barriers to health care access among refugee asylum seekers. Journal of Health Care for the Poor and Underserved, 22(2), 506-522. Assion, H. J. (2005). Migration und seelische Gesundheit. Berlin, Heidelberg: SpringerVerlag. Bandura, A. (2001): Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, Vol 52, S. 1–26. Bengel, J. & Lyssenko, L. (2012). Resilienz und psychologische Schutzfaktoren im Erwachsenenalter. Stand der Forschung zu psychologischen Schutzfaktoren von Gesund- 97/156 heit im Erwachsenenalter. Schriftenreihe zu Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung, Band 43. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Benight, C.C., Bandrua, A. (2004). Social cognitive theory of posttraumatic recovery: the role of perceived self-efficacy. Behaviour Research and Therapy, Vol 42(10). S. 1129– 1148. Berking, M., Rief, W. (2012). Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band I und Band II. Heidelberg: Springer. Berkman, L.F., Syme, S.L. (1978). Social networks, host resistance, and mortality: a nineyear follow-up study of Alameda County residents. American Journal of Epidemiology, Vol 109(2). S. 186-204. Böhm, A. (2016). EMDR in der Psychotherapie der PTBS. Berlin, Heidelberg: SpringerVerlag. Bonne, O., Grillon, C., Vythilingam, M., Neumeister, A., Charney, D. S. (2004) Adaptive and maladaptive psychobiological responses to severe psychological stress: implications for the discovery of novel pharmacotherapy. Neuroscience & Biobehavioral Reviews Vol 28(1). S. 65-94. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2016). Aktuelle Zahlen zu Asyl. Ausgabe Juli 2016. Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2016): Entscheidung des Bundesamtes. Verfügbar unter: http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylverfahren/Entscheidung/entsch eidung-node.html [01.08.2016] Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung, Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (2011). PatientenLeitlinie zur Nationalen VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression. Verfügbar unter : http://www.patienten-information.de/mdb/downloads/nvl/depression/depression-1auflvers1.0-pll.pdf. [24.08.2016]. 98/156 Bundesministerium der Justiz und für Verbrauchterschutz (1998). Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Psychotherapeutengesetz - PsychThG) Verfügbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/psychthg/BJNR131110998.html [26.07.2016] Bundespsychotherapeutenkammer (2016). Ratgeber für Flüchtlingshelfer. Wie kann ich tramatisiserten Flüchtlingen helfen? Verfügbar unter: http://www.bptk.de/uploads/media/20160513_BPtK_RatgeberFluechtlingshelfer_2016_deutsch.pdf [23.08.2016] BundespsychotherapeutenKammer (2015). Psychische Erkrankungen bei Flüchtlingen. Verfügbar unter: http://www.bptk.de/uploads/media/20150916_BPtKStandpunkt_psychische_Erkrankungen_bei_Fluechtlingen.pdf [23.04.2016]. Bundesregierung. (2016). Neujahrsansprache 2016 von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel am 31. Dezember 2015 über Hörfunk und Fernsehen. Abgerufen von http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Bulletin/2016/01/01-1-bk-neujahr.html am 29.08.2016. Butler, A.C., Chapman, J.E., Forman, E.M., Beck, A.T. (2006). The empirical status of cognitive-behavioral therapy: a review of meta-analyses. Clinical Psychology Review Vol. 26(1). S. 17-31. doi: 10.1016/j.cpr.2005.07.003 Bruffaerts, R., Demyttenaere, K., Hwang, I., Chiu, W.-T., Sampson, N., Kessler, R.C., Alonso, J., Borges, G., de Girolamo, G., de Graaf, R., Florescu, S., Gureje, O., Hu, C., Karam, E. G., Kawakami, N., Kostyuchenko, S., Kovess-Masfety, V., Lee, S., Levinson, D., Matschinger, H., Posada-Villa, J., Sagar, R., Scott, K. M., Stein, D. J., Tomov, T., Viana, M.C., Nock, M.K. (2011). Treatment of suicidal people around the world. The British Journal of Psychiatry. DOI: 10.1192/bjp.bp.110.084129. Crumlish, N., O'Rourke, K. (2010). A Systematic Review of Treatments for Post-Traumatic Stress Disorder Among Refugees and Asylum-Seeker. The Journal of Nervous and Mental Disease Vol. 198(4). S. 237-251. DOI: 10.1097/NMD.0b013e3181d61258 99/156 Deutscher Bundestag (2016). Gesetzesentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD – Entwurf eines Gesetzes zur Einführung beschleunigter Asylverfahren. Drucksache 18/7538. S. 11 Deutsches Bündnis gegen Depression e.V. Suizidalität. Verfügbar unter: http://www.buendnis-depression.de/depression/suizidalitaet.php. [17.09.2016]. DGPPN, BÄK, KBV, AWMF AkdÄ, BPtK, BApK, DAGSHG, DEGAM, DGPM, DGPs, DGRW (2015). S3-Leitlinie/Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression - Langfassung. Verfügbar unter: https://www.dgppn.de/fileadmin/user_upload/_medien/download/pdf/kurzversionleitlinien/S3-NVLdepression-lang_2015.pdf [17.09.2016]. Demir, S.Ö. (2015). Beratung nach Flucht und Migration: Ein Handbuch zur psychologischen Erstbetreuung von Geflüchteten. In R. Mewes & H. Reich (Hrsg.), Beratung nach Flucht und Migration: Ein Handbuch zur psychologischen Erstbetreuung von Geflüchteten. Potsdam: Welttrends. Ebbinghaus, R., Bauer, M., Priebe, S. (1996). Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung. Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie Vol 64(11). S. 433-443 DOI: 10.1055/s-2007-996589 Flatten, G., Gast, U., Hofmann, A., Knaevelsrud, C., Lampe, A., Liebermann, P., Maercker, A., Reddemann, L. & Wöller, W. (2011). S3 - Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung. Trauma & Gewalt, 3, 202-210. Fischer, P., Krueger, J. I., Greitemeyer, T., Vogrincic, C., Kastenmüller, A., Frey, D., Heene, M., Wicher, M. & Kainbacher, M. (2011). The bystander effect: A meta-analytic review on bystander intervention in dangerous and non-dangerous emergencies. Psychological Bulletin, 137, 517–537. 100/156 Gemeinsamer Bundesausschuss (2016) Psychotherapie-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesauschusses über die Durchführung der Psychotherapie. § 23a und § 23b. S.1719. Verfügbar unter: https://www.g-ba.de/downloads/62-492-1099/PT-RL_2015-1015_iK-2016-01-06.pdf [31.08.2016] Gollwitzer, M. & Jäger, R. S.(2014). Evaluation -- kompakt. (2. Aufl.) Weinheim: Beltz. Grawe, K. (2005). Empirisch validierte Wirkfaktoren statt Therapiemethoden. In: Report Psychologie 7/8 2005. S. 311. Grawe, K., Donati, R. & Bernauer, F. (1994). Psychotherapie im Wandel. Von der Konfession zur Profession. Göttingen: Hogrefe. Heeren, M., Mueller, M., Ehlert, U., Schnyder, U., Copiery, N. & Maier, T. (2012). Mental health of asylum seekers: a cross-sectional study of psychiatric disorders. BMC Psychiatry,12 (114). S. 1-8. Heine, P. & Assion, H.J. (2005). Traditionelle Medizin in islamischen Kulturen. In J. Assion (Hrsg.), Migration und seelische Gesundheit (S. 29-42). Heidelberg: Springer. Imm-Bazlen, U., Schmieg, A.-K. (2017). Begleitung von Flüchtlingen mit traumatischen Erfahrungen. Heidelberg: Springer. DOI 10.1007/978-3-662-49561-2_1. Jacobi, F., Höfler, M., Strehle, J., Mack, S., Gerschler, A., Scholl, L., Busch, M.A., Maske, U., Hapke, U., Gaebel, W., Maier, W., Wagner, M., Zielasek, J., Wittchen, H.-U. (2014) Psychische Störungen in der Allgemeinbevölkerung, Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland und ihr Zusatzmodul Psychische Gesundheit (DEGS1MH). Der Nervenarzt Vol 85(1), S. 77-87. Jacobi, F., Wittchen, H.-U., Hölting, C., Höfler, M., Müller, N., Pfister, H. & Lieb, R. (2004). Prevalence, comorbidity and correlates of mental disorders in the general population: Results from the German Health Interview and Examination Survey (GHS). Psychological Medicine,34, 597-611. Jeffries, F. W. & Davis, P. (2013) What is the role of eye movements in eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) for post-traumatic stress disorder 101/156 (PTSD)? A review. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, Vol 41(3). S. 290300. http://dx.doi.org/10.1017/S1352465812000793. Karakayali, S., & Kleist, J. O. (2015). EFA-Studie.Sturkturen und Motive der ehrenamtlichen Flüchltingsarbeit (EFA) in Deutschland. 1. Forschungsbericht. Ergebnisse einer explorativen Umfrage vom November/Dezember 2014. Abrufbar unter http://www.fluechtlingshilfe-htk.de/uploads/infos/49.pdf [29.08.2016] Kizilhan, J. I. (2013). Kultursensible Psychotherapie: Hintergründe, Haltungen und Methodenansätze. Berlin: VWB-Verlag. Kizilhan, J.I. & Beremejo, I. (2009). Migration, Kultur, Gesundheit. In Bengel, J. & Jerusalem, M. (Hrsg.). Handbuch der Gesundheitspsychologie und Medizinischen Psychologie (S. 509-518). Göttingen: Hogrefe. Koch (2005). Institutionelle Versorgung von psychisch kranken Migranten. In Assion, H.J. (Hrsg.), Migration und seelische Gesundheit. Heidelberg: Springer, S. 167-186. Korn, D.L. (2009) EMDR and the treatment of complex PTSD: A review. Journal of EMDR Practice and Research, Vol 3(4). S. 264-278. http://dx.doi.org/10.1891/19333196.3.4.264 Kowarsch, L. & Reinacher H. (2016). Entwicklung und Evaluation einer Informationsveranstaltung für in der Flüchtlingshilfe tätige Personen - Wie können Flüchtlinge mit psychischen Krankheiten unterstützt werden? (Masterarbeit). Auffindbar in der Bibliothek des Psychologischen Instituts der Philipps-Universität Marburg. Kraft, S. (2015, 12. Oktober). „BAMF „verkürzt" Asylverfahren”. Bayrischer Rundfunk. Verfügbar unter: http://www.br.de/nachrichten/fluechtlinge-verfahren-bamf-100.html [02.08.2016] Koch, E., & Assion, H. J. (2011). Transkulturelle Psychiatrie: Alltag in Kliniken und Praxen. Psychiatrie und Psychotherapie up2date, 5(05), 301-312. Lenz, K., Nestmann, F. (2009). Handbuch Persönliche Beziehungen. Weinheim, München, Juventa. S. 15-63. 102/156 Latané, B. & Darley, J. M. (1970). The unresponsive bystander: Why doesn’t he help? New York: Appleton. Laux, D. & Dietmaier, O. (2012). Praktische Psychopharmakotherapie. München : Elsevier, Urban & Fischer Maercker, A. (2013). Posttraumatische Belastungsstörungen. (4. Aufl.) Heidelberg: Springer. Mewes, R., Asbrock, F., Laskawi, J. (2015). Perceived discrimination and impaired mental health in Turkish immigrants and their descendents in Germany. Comprehensive Psychiatry, 62, S. 42-50, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.comppsych.2015.06.009. Morawa, E., Erim, Y. (2013). Zusammenhang von wahrgenommener Diskriminierung mit Depressivität und gesundheitsbezogener Lebensqualität bei türkisch- und polnischstämmigen Migranten. Psychiatrische Praxis, 41(04), S. 200-207, DOI: 10.1055/s0033-1343221. Mühlig, S. (2014). Compliance. In M. A. Wirtz (Hrsg.), Dorsch – Lexikon der Psychologie (17. Aufl., S. 348). Bern: Verlag Hans Huber. Nater-Mewes, R. (2016). Psychologische Gesundheit und Möglichkeit der Erstbetreuung bei Asylsuchenden. Unveröffentlichte Studie, Philipps-Universität Marburg. Neuner, F., Kurreck, S., Ruf, M., Odenwald, M., Elbert, T., Schauer, M. (2010). Can AsylumSeekers with Posttraumatic Stress Disorder Be Successfully Treated? A Randomized Controlled Pilot Study. Cognitive behaviour, 39:2, S.81-91. Neuner, F., Schauer, M., Klaschik, C., Karunakara, U. Elbert, T. (2004) A Comparison of Narrative Exposure Therapy, Supportive Counseling, and Psychoeducation for Treating Posttraumatic Stress Disorder in an African Refugee Settlement. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 72(4). S. 579-587. http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.72.4.579 Pascoe, E. A., Smart Richman, L. (2009) Perceived discrimination and health: A metaanalytic review. Psychological Bulletin, Vol 135(4). S. 531-554. 103/156 Paulzen, M. & Caspar, F. (2014). Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). In M. A. Wirtz (Hrsg.), Dorsch – Lexikon der Psychologie (17. Aufl., S. 1283). Bern: Verlag Hans Huber. Perron, N. J., & Hudelson, P. (2006). Somatisation: illness perspectives of asylum seeker and refugee patients from the former country of Yugoslavia. BMC family practice, 7(10), 1-7. Pew Research Center. (2015). Muslims. Verfügbar unter: http://www.globalreligiousfutures.org/religions/muslims [ 20.08.2016]. Psychologische Hochschule Berlin (2015). „Interpersonelles integratives Modellprojekt für Flüchtlinge mit psychischen Störungen erhält Förderung vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales” Artikel auf der Homepage der PHB, Verfügbar unter: http://www.psychologische-hochschule.de/interpersonal-integrative-therapy-forrefugees-ein-kurzzeit-hilfsprogramm-an-der-phb-fuer-fluechtlinge/ [04.08.2016] Rassoul, A.-R. M. I. A. & Khan, M. W. (2013). Der Koran. New Delhi: Goodword Books. Reich, H., Bockel, L., Mewes, R. (2014). Motivation for Psychotherapy and Ilnness Beliefs in Turkish Immigrant Inpatients in Germany: Results of a Cultural Comparison Study. J Racial Ethnic Health Disparities, 2, 112-123. Reicher, S., Spears, R. & Postmes, T. (1995). A social identity model of deindividuation phenomena. In W. Stroebe & M. Hewstone (Eds.), European review of social psychology (Vol. 6, pp. 161–198). Chichester: Wiley. Reischies, F. M. (2007). Psychopathologie. Merkmale psychischer Krankheitsbilder und klinische Neurowissenschaft. Heidelberg: Springer. Salewski, C. (2014). Krankheitskonzepte, subjektive. In M. A. Wirtz (Hrsg.), Dorsch – Lexikon der Psychologie (17. Aufl., S. 945). Bern: Verlag Hans Huber. Schenkel, P. (2000). Ebenen und Prozesse der Evaluation.Qualitätsbeurteilung multimedialer Lern- und Informationssysteme. BW Bildung und Wissen, Nürnberg, 52-74. 104/156 Schaub, A., Roth, E. und Goldmann, U. (2013). Kognitiv-psychoedukative Therapie zu Bewältigung von Depression. Ein Therapiemanual (2. Auflage). Göttingen: Hogrefe. Schauer, M. & Ruf-Leuschner, et al. (2014): Lifeline in der Narrativen Expositionstherapie. Psychotherapeut 59(3), 226–238. doi:10.1007/s00278-014-1041-9 Schauer, M., Elbert, T., Gotthardt, S., Odenwald, M., & Neuner, F. (2006). Wiedererfahrung durch Psychotherapie modifiziert Geist und Gehirn. Verhaltenstherapie, 16(2), 96103. Schauer, M., Neuner, F., & Elbert, T. (2005). Narrative Exposure Therapy - a short term intervention for traumatic stress disorders after war, terror or torture. Cambridge, MA: Hogrefe & Huber. Schmid, R., Spießl, H., Vulkovich, A. und Cording, C. (2003). Belastungen von Angehörigen und ihre Erwartungen an psychatrische Institutionen. Literaturübersicht und eigene Ergebnisse. Fortschritte der Neurologie und Psychatrie, 71(3), S. 118-128. Seiedin, M. (2005). Kultur, Migration und seelische Gesundheit. Psych. Pflege Heute, 11(03), 125-130. Seidler, G. H. & Wagner, F. E.(2006). Comparing the efficacy of EMDR and trauma-focused cognitive-behavioral therapy in the treatment of PTSD: a meta-analytic study. Psychological Medicine Vol 36 (11). S. 1515-1522. doi:10.1017/S003329170600796. Shapiro, F. (2013a) „EMDR – Grundlagen und Praxis. Handbuch zur Behandlung traumatisierter Menschen.” Paderborn: Junfermann. Stark, W. (2014). Empowerment. In M. A. Wirtz (Hrsg.), Dorsch – Lexikon der Psychologie (17. Aufl., S. 477). Bern: Verlag Hans Huber. Steel, Z., Silove, D., Bauman, A. (2002). Long-term effect of psychological trauma on the mental health of Vietnamese refugees resettled in Australia: a population-based study. The Lancet, (9339), S.1056–1062. doi: 10.1016/S0140-6736(02)11142-1. Steel, Z., Chey, T., Silove, D., Marnane, C., Bryant, R. A., & Van Ommeren, M. (2009). Association of torture and other potentially traumatic events with mental health out- 105/156 comes among populations exposed to mass conflict and displacement: a systematic review and meta-analysis. Jama, 302(5), 537-549. Stefanowitsch, A. (2012). Flüchtlinge und Geflüchtete. Verfügbar unter: http://www.sprachlog.de/2012/12/01/fluechtlinge-und-gefluechtete/ [31.08.2016] Stein, D.J., Chiu, W.T., Hwang, I., Kessler, R.C., Sampson, N., Alonso, J., Borges, G., Bromet, E., Bruffaerts, R., de Girolamo, G., Florescu, S., Gureje, O., He, Y., KovessMasfety, V., Levinson, D., Matschinger, H., Mneimneh, Z., Nakamura, Y., Ormel, J., Posada-Villa, J., Sagar, R., Scott, K.M., Tomov, T., Viana, M.C., Williams, D.R., Nock, M.K. (2010). Cross-National Analysis of the Associations between Traumatic Events and Suicidal Behavior: Findings from the WHO World Mental Health Surveys. PLoS ONE 5(5): e10574. DOI:10.1371/journal.pone.0010574. Stein, D.J., Ipser, J.C., Seedat, S., Sager, C., Amos, T. (2006) Pharmacotherapy for post traumatic stress disorder (PTSD). Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 1. DOI: 10.1002/14651858.CD002795.pub2. Steinkopff, B. (1997). Psychosoziale Behandlung bei traumatisierten Flüchtlingen. Psychotherapie, 2, 35-44. Stiftung Deutsche Depressionshilfe (2016). Rat für Angehörige. Verfügbar unter http://www.deutsche-depressionshilfe.de/stiftung/rat-fuer-angehoerige.php. [24.08.2016]. Strotzka, H. (1978). Psychotherapie (2. Aufl.). München, Deuschland: Stronzka. UNHCR (2016). Fragen & Antworten: Flüchtling. Verfügbar unter : http://www.unhcr.de/questions-und-answers/fluechtling.html [21.09.2016]. Üstün, T.B., Ayuso-Mateos, J.L., Chatterji, S., Mathers, C., . Murray, C.J.L. (2004). Global burden of depressive disorders in the year 2000.The British Journal of Psychiatry May 2004, 184, 5, 386-392. Vogel, H. (2014). Psychoedukation. In M. A. Wirtz (Hrsg.), Dorsch – Lexikon der Psychologie (17. Aufl., S. 1331). Bern: Verlag Hans Huber. 106/156 Weidel, A. (2016). Italiens Flüchtlingspolitik ist verantwortungslos. Verfügbar unter: https://www.alternativefuer.de/weidel-italiens-fluechtlingspolitik-ist-verantwortungslos/ [31.08.2016] Weltgesundheitsorganisation, Dilling, H., Mombour, W., Schmidt, M.H., & Schulte-Markwort, E. (2011). Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10 Kapitel V (F): diagnostische Kriterien für Forschung und Praxis. (5., überarbeitete Auflage) H. Huber. Westermeyer, J., Bouafuely, M., Neider, J., & Callies, A. (1989). Somatization among refugees: an epidemiologie study. Psychosomatics, 30(1), 34-43. Witte, F. Dr. med., (2008, 30 Januar). „Ärztliche Versorgung von Flüchtlingen” Verfügbar unter: https://www.thieme.de/viamedici/arzt-im-beruf-aerztliches-handeln1561/a/versorgung-von-fluechtlingen-4419.htm [02.08.2016] Weltgesundheitsorganisation, Üstün, T.B., Bertelson, A., Dilling, H., van Drimmelen, J., Pull, C., Okhasa, A., Sartorius, N. (2012). WHO-Fallbuch zur ICD-10. (2.Aufl.). Schweiz, Bern: Verlag Hans Huber. 107/156