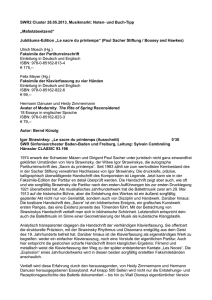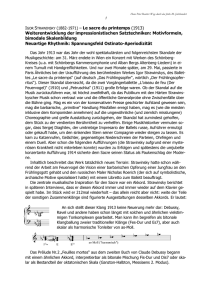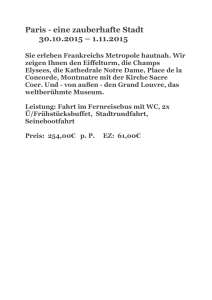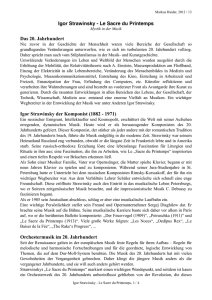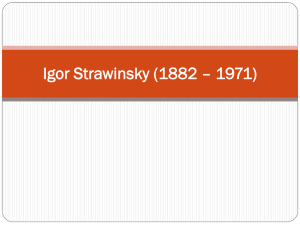6. kammer- konzert - Staatstheater Darmstadt
Werbung

6. k a m m e rkon z er t Strawinsky – Satie – Poulenc – Saint-Saëns – Jandl – Schwitters Silver-Garburg Klavierduo | Klischat – Schuster 6. Kammerkonzert Donnerstag, 17. März 2016, 20.00 Uhr Staatstheater Darmstadt, Kleines Haus Ernst Jandl (1925–2000) Talk Camille Saint-Saëns (1835–1921) „Kinder und Tiere verstehen meine Musik am besten.“ Igor Strawinsky aus „Karneval der Tiere“ Nr. 3 „Hémiones“. Animaux veloces (Maultiere. Schnelle Tiere) Presto furioso (1886) Ernst Jandl Karawane, La zeechn u bapp Francis Poulenc (1899–1963) Sonate pour piano aux quatre mains (1918) Prélude – Rustique – Final Ernst Jandl Andantino, Ohren im Konzert, Viel Vieh Erik Satie (1866–1925) La belle excentrique. „Fantaisie sérieuse“ (1920) Marche franco-lunaire – Valse du mystérieux baiser dans l’œil (Walzer des mysteriösen Kusses im Auge) – Cancan Grand-Mondain (High-Societey Can-Can) Kurt Schwitters (1887–1948) Ursonate (1923–32) Igor Strawinsky (1882–1971) Fünf leichte Stücke für Klavier zu vier Händen (1916–17) Andante – Espanola – Balalaika – Napolitana – Galop 3 Ernst Jandl Sieben kleine Geschichten, Chanson Camille Saint-Saëns (1835–1921) Introduction und Rondo capricciso a-Moll op. 28 (1863) Pause Igor Strawinsky (1882–1971) Le Sacre du printemps (1913). Version für Klavier zu vier Händen Premier tableau: L’adoration de la terre (Anbetung der Erde) Introduction Augures printaniers (Die Vorboten des Frühlings).– Danses des adolescentes (Tanz der Jünglinge) – Jeu du rapt (Das Spiel der Entführung) – Rondes printanières (Frühlingsreigen) – Jeu des cités rivales (Kampfspiel der feindlichen Stämme) – Cortège du Sage (Zug des Weisen) – L’ Adoration de la Terre (Anbetung der Erde) – Danse de la terre (Tanz der Erde) Second tableau: Le sacrifice (Das Opfer) Introduction – Cercles mystérieux des adolescentes (Mystischer Reigen der jungen Mädchen) – Glorification de l’élue (Verherrlichung der Erwählten) – Èvocation des ancêtres (Beschwörung der Ahnen) – Action rituelle des ancêtres (Ritualtanz der Geister der Ahnen) – Danse sacrale (Opfertanz) Sprecher Stefan Schuster und Christian Klischat The Silver-Garburg Piano Duo Klavier Sivan Silver und Gil Garburg Ton und Bildaufnahmen sind aus rechtlichen Gründen nicht gestattet. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone aus. Humor und Frankreich Man kann ganze Sinfonien und Opern allein auf dem Klavier darstellen: also wären Pianisten folgerichtig einsame Musiker, gäbe es da nicht die Möglichkeit, mit anderen Menschen Kammermusik oder zusammen vierhändig oder an zwei Klavieren zu spielen. Jeder, der Klavier gelernt hat, hat auch diese Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man „vierhändig“ oder an zwei Klavieren musiziert. Das hat mit dem, was man als Klavierduo bezeichnet, nur wenig zu tun. Hier haben die beiden gleichberechtigten Partien den gleichen virtuosen und musikalischen Anspruch. Das Zusammenspiel ist schwierig und heikel. Die wirklich gute Original-Literatur ist überschaubar, wenn man sie mit der Menge von exzellenten Werken für Solo-Klavier vergleicht. Ein Klavier-Duo ist eine Kategorie für sich. In der Vorbereitung des Programms für Darmstadt war das SilverGarburg-Duo mit der Frage „konfrontiert“ worden, eine Auswahl von Stücken zusammenzustellen, die zu dem Thema „Humor in der Musik“, dem Spielzeitmotto der Saison 2015/16, passen würde. Nach kurzem Nachdenken stand die Auswahl fest. Und nun, bei Durchsicht des fertigen Programms stellt sich die Frage: ist es ein Zufall, dass die Werke des ersten Teils sämtlich aus dem französischen Kulturkreis stammen? In seinem „Carneval der Tiere“ karikierte Saint-Saëns Zeitgenossen. Es sind beileibe keine Kinderstückchen, die Saint-Saëns in seiner „Grande fantaisie Zoologique“ da schrieb. Wen er mit seinen Werken satirisch aufs Korn nahm, ist dem heutigen Zuhörer nicht mehr geläufig. Aber dass man bei „Esel“, wie in der Nr. 3 des „Carneval“, nicht nur an Tiere denken muss, ist immer noch Allgemeingut. Hatte Camille Saint-Saëns auch im Alter Humor? Die Orchesterversion des „Carneval“ ließ er in der Schublade, sie erschien erst 1921, nach seinem Tod. 1835 geboren (und nur zwei Jahre jünger als Brahms), galt er später als unverbesserlich altmodischer Kauz. „Niemand kennt die Musik der ganzen Welt besser als Monsieur SaintSaëns“, lobte Claude Debussy seinen Komponistenkollegen, und nur wenige haben ein alle Gattungen abdeckendes Gesamtwerk hinterlassen wie er. Das Geigenrepertoire hat Saint-Saëns dabei besonders bedacht, 4 auch wegen seiner Freundschaft mit dem Virtuosen Pablo de Sarasate. Er zeigte Saint-Saëns, was auf dem Instrument technisch möglich ist – ihm widmete er auch sein drittes Violinkonzert und „Introduction et Rondo capriccioso“, opus 28. Das effektvolle Bravourstück besitzt viel spanisches Kolorit, was auch in der Version für Klavierduo zu hören ist. Poulencs Sonate entstand drei Jahre vor dem Tod von Saint-Saëns und ist auch ein Jugendwerk. Die Zeiten hatten sich gewandelt. Von Igor Strawinsky und Maurice Chevalier (dem Chansonnier) war er ebenso beeinflusst wie vom französischen Vaudeville. Poulenc gehörte nach dem Ersten Weltkrieg zu der Gruppe junger Komponisten um Erik Satie und den Schriftsteller Jean Cocteau, genannt „Les Six“, deren Mitglieder den Impressionismus zugunsten einer größeren Einfachheit und Klarheit ablehnten. Der Stil der „Six“ bestimmte Poulencs Musiksprache. Er übernahm Techniken der Dadaisten und ließ sich von populären Melodien beeinflussen. Charmant und doch irgendwie „gewöhnlich“ zu schreiben, erschien ihm wichtiger, als die ach so innerliche Gefühlswelt der Romantik. Er war ein herausragender Pianist, und die Klaviermusik dominierte Poulencs frühe Werke. Erst später wurde er ernster … Ist Humor also doch ein Privileg der Jugend? Nicht so bei Erik Satie. Satie ist der Urvater allen musikalischen Humors um 1900. Warf man ihm vor, seine Musik sei formlos, schrieb er ein „Stück in Form einer Birne“. Über den damals schon grassierenden Sport-Wahn macht er sich mit den Miniaturen „Sports et Divertissements“ lustig. Versenkte sich die Musikwelt in Bayreuth zu Wagner-Andachten, so schrieb er mit einer „Musique d’ Ameublement“ Werke, die man bewusst nur nebenbei hören, also wie Möbelstücke, die herumstehen, wahrnehmen sollte. Sein Einfluss bei den Kollegen wie Debussy war immens. Und richtig ernst nahm er seine Rolle als Künstler auch nicht. Seine „Memoires d’une Amnesique“ (die Memoiren eines Gedächtnislosen) sind auch heute noch eine herrliche Lektüre über den Unsinn der meisten Künstlerbiographien. „La belle Excentrique“ ist eigentlich eine Tanz-Suite für ein kleines 5 Orchester, eine Parodie auf Klischees der Tanz-Salons der zwanziger Jahre. Geschrieben zwischen Juli und Oktober 1920, besteht die Suite aus den Tänzen Marsch, Walzer und Can-Can. Das Stück war in Auftrag gegeben worden durch die Tänzerin und Choreographin Élisabeth Toulemont, die unter dem Bühnen-Namen Caryathis auftrat. Von diese Künstlerin sprach man in den Klatschspalten, auch, weil sie zu herrlich skandalösen Partys lud. Man war eben in Paris. Bei den Proben zur Uraufführung assistierte übrigens Poulenc … Hat(te) man in Frankreich doch mehr Humor? Die Wahrheit über Dada Mit dem Steckenpferd fing alles an. „Dada“, dieser naive Kindeslaut, in dem so vieles liegt und doch auch nichts. Das erste Wort einer Kunst, die keine sein wollte – sich als Anti-Kunst sah. Diese Einstellung machte der Dada-Trommler Richard Huelsenbeck deutlich: „Dada bedeutet nichts. Wir wollen die Welt mit nichts verändern.“ Aber ist es möglich, nichts zu sein? Kann es eine Kunst geben, die keine ist? Oder ist alles Kunst? 1916. Der Erste Weltkrieg tobt. Viele sind auf der Flucht in die neutrale Schweiz. Zürich ist der Anlaufpunkt vieler, auch der des bettelarmen Künstlerpaares Hugo Ball und Emmy Hennings. Im Mai des Vorjahres aus Deutschland gekommen, hielten sie sich mit Varieté-Auftritten über Wasser, bevor Ball am 5. Februar 1916 in der Spiegelgasse das „Cabaret Voltaire“ eröffnete. Weitere Mitglieder fanden sich durch Balls Pressenotiz aus der Neuen Zürcher Zeitung. In dieser hatte er sich an jene aus der „jungen Künstlerschaft Zürichs“ gewandt, die „sich ohne Rücksicht auf eine besondere Richtung mit Vorschlägen und Beiträgen“ bei ihm einfinden wollten. Der so gebildeten Gruppe gehörten Tristan Tzara, Richard Huelsenbeck, Hans Arp und Marcel Janco an. Und der erste Aufreger ließ nicht lange auf sich warten: Am 30. März 1916 brachten Huelsenbeck, Tzara und Janco ein „Poème simultan“ auf die Bühne. Diese mehrsprachige Wortkomposition in Deutsch, Englisch und Französisch war das erste Dada-Erdbeben. 6 Als eigentliche Urszene des Dadaismus zählt dennoch ein anderer Auftritt, nämlich Hugo Balls erster Vortrag. „gadji beri bimba glandridi laula lonni cadori …“ schallte es am 23. Juni 1916 aus dem Mund des „magischen Bischofs“ Hugo Ball, dessen kubistisches Kostüm aus Karton samt Schamanenhut Sinnbild der Bewegung wurde. Drei Wochen später verlas er dann das Eröffnungs-Manifest der 1. Dada-Soirée im Zunfthaus „Zur Waag“: „Wie wird man berühmt? Indem man Dada sagt. Mit edlem Gestus und mit feinem Anstand. Bis zum Irrsinn, bis zur Bewusstlosigkeit. Wie kann man alles Aalige und Journalige, alles Nette und Adrette, alles Vermoralisierte, Vertierte, Gezierte abtun? Indem man Dada sagt.“ Er wolle keine Worte, die andere erfunden haben. Er wolle seinen eigenen Unfug und Vokale und Konsonanten dazu, die diesem entsprächen. Und damit machte er deutlich, wofür er und seine Dada-Kollegen standen: Dada, die Anti-Kunst, die Zerstörung von gefestigten Idealen und Normen in Kunst und Gesellschaft, der Zufall als Schöpfungsprinzip und der Bruch mit Tabus. Doch Dada hatte noch einen anderen, tieferen Sinn: Es war eine Antwort auf den Irrsinn ein Protest und die künstlerische Reaktion auf die Erschütterungen des Krieges. Die Dadaisten stellten der Zerstörung des Ersten Weltkrieges und der daraus entstandenen kulturellen Leere ihre freie, respektlose Form des Ausdrucks entgegen. Auf den Krieg schien ihnen die vollständige Verweigerung aller Regeln und die Durchbrechung der bisherigen Schranken die angemessene Antwort und so proklamierten sie: „Nicht Dada ist Nonsens – sondern das Wesen unserer Zeit ist Nonsens.“ Aber woher kam eigentlich dieses Wort: „Dada“? Auf einen Namensgeber konnten sich die Dadaisten nicht einigen. So behauptete Hugo Ball im „Dadaistischen Manifest“, dass Dada aus dem Lexikon stamme. Im Französischen bedeute es „Steckenpferd“, im Rumänischen „Ja, wahrhaftig, Sie haben Recht, so ist es“. Hans Arp dagegen nannte in einer „Deklaration“ Tristan Tzara den Erfinder. Arp sei mit seinen 12 Kindern dabei gewesen und habe gerade eine Brioche im linken Nasenloch getragen, als Tzara zum ersten Mal dieses Wort im Café Terrasse nannte. Johannes Baader sollte jedenfalls recht behalten mit seinem Diktum: 7 „Was Dada ist, wissen nicht einmal die Dadaisten, sondern nur der Oberdada – und der sagt es niemandem!“. Doch die gewünschte Undefinierbarkeit wurde schnell zu einem Problem. Denn jede Art von Kunst hat ihre Schemata. So zeichnete sich das Lautgedicht dadurch aus, dass die Wörter in phonetische Silben zerlegt wurden. Durch das Zusammenfügen dieser Laute zu einem rhythmischen Klangbild wurde die Sprache ihrer Funktionalität beraubt – die Silben selbst standen nun im Vordergrund. Eine Steigerung dieser Form war das Simultangedicht, das von mehreren Personen gleichzeitig aufgeführt wurde, wodurch sich die verschiedenen Beiträge zu einem frenetischen Stimmengewirr überlagerten. Als dritte Gruppe wurde das Zufallsgedicht eingesetzt, dessen Herstellungsprinzip schon im Namen erklärt ist. Zu Beginn lösten die Veranstaltungen der Dadaisten noch den erwünschten Tumult im Publikum aus, es kam teils sogar zu Festnahmen der Künstler. Mit den steigenden Erwartungen der Zuhörer, sich durch Provokationen unterhalten zu lassen, verloren diese jedoch bald ihre Wirkung und liefen ins Leere. Das sarkastische Lachen Dadas, von dem die Dadaisten gerne sprachen, verkehrte sich in das vergnügte Lachen des Publikums. Und so bedeutete die Festigung des Dadaismus gleichzeitig seine Vernichtung. Die „Urdadaisten“ zogen sich aus Zürich zurück, gründeten aber eigene Dada-Gruppen. Spätestens die Abreise Tzaras aus Zürich im Januar 1920 bedeutete das Ende des dortigen Dadaismus. Zu diesem Zeitpunkt hatte der internationale Siegeszug Dadas in Berlin, Paris, New York aber auch Hannover und Köln gerade erst seinen Höhepunkt erreicht. Aber ist Dada nun zur Kunst geworden? Zu dem, was es nie sein wollte? Fest steht, dass der Dadaismus noch da ist. Seine ständige Neuerfindung in den verschiedensten Kunst- und Musikströmungen verhindert, dass er museal wird. Doch Anfang und Ende sind große Worte, denn: „Bevor Dada da war, war Dada da“. Hanneliese Lenk 190 waren die Beziehungen zwischen Russland und Frankreich vielfältig. Die beiden Länder waren politische Bündnispartner und pflegten einen kulturellen Austausch, der sich auf seinen Höhepunkt zubewegte, als Serge Diaghilev auf den Plan trat. Nachdem er schon in Russland als Organisator von Kunstausstellungen aufgefallen war, widmete er sich dem Export von russischer Kunst, ab 1906 speziell nach Paris. 1907 organisierte er die Konzerte russischer Musik mit der Beteiligung von Rimsky-Korsakow, Glasunow, Skrjabin, Rachmaninow, Nikisch und Schaljapin. Obwohl Musiker wie Dukas und Debussy die Bedeutung der russischen Musik kannten, war doch die Erstaufführung von Mussorgskys „Boris Godunow“ 1908 für die meisten Franzosen eine Offenbarung: sie glaubten in diesem Werk, das von Rimsky stark bearbeitet, ja verfälscht worden war, den Inbegriff dessen zu entdecken, was Debussy „die russische Seele“ nannte. Unter Diaghilev formierte sich das „Russische Ballett“, das nicht nur die denkbar besten Tänzer wie u.a. Nijinsky, die Pawlowa, die Karsawina und Ida Rubinstein präsentierte, sondern auch den Rahmen für viele denkwürdige Uraufführungen von Werken gab, die eigens von Diaghilev mitkonzipiert worden waren. Der Stil des Balletts internationalisierte sich zusehends während der zwanziger Jahre, und viele Künstler Westeuropas beteiligten sich an den meist neuartigen Produktionen. Doch die weitaus stärkste Persönlichkeit des Balletts war für alle Igor Strawinsky, der 1910 mit dem „Feuervogel“ Triumphe feierte, die sich ein Jahr darauf mit „Petruschka“ wiederholten. Die Übereinstimmung zwischen Strawinskys Schaffen und dem Geschmack des Pariser Publikums, schien vollkommen zu sein, bis 1913 das dritte Ballett, „Le Sacre du printemps“, den bis dahin heftigsten Skandal der Musikgeschichte auslöste. An diesen Tumult im brandneuen Théatre des Champs-Elysees, erinnerte sich Jean Cocteau: „Ich sah Maurice Delage (den Komponisten), der vor Entrüstung puterrot angelaufen war, den kleinen Maurice Ravel, der sich aufplusterte wie ein Kampfhahn, Leon-Paul Fargue, den Dichter, der die zischenden Logeninsassen mit vernichtenden Bemerkungen überschüttete. 9 Ich weiß nicht, wie es möglich war, dass dieses Ballett in einem solchen Aufruhr zu Ende getanzt wurde? Ich stand zwischen den beiden mittleren Logen, fühlte mich im Auge des Hurrikans ganz wohl und klatschte mit meinen Freunden. (…) So hörten wir dieses Geschichte machende Werk inmitten eines solchen Tumults, dass die Tänzer das Orchester nicht mehr hörten und dem Rhythmus folgen mussten, den ihnen der stampfende und schreiende Nijinsky in den Kulissen schlug. (…) Man müsste tausend Nuancen von Snobismus, Übersnobismus, Gegensnobismus aufzählen, die für sich allein ein ganzes Kapitel benötigen würden. Das Publikum spielte die ihm zugedachte Rolle, es empörte sich sofort. Man lachte, spuckte, pfiff, ahmte Tierlaute nach, und vielleicht hätte man es schon nach einiger Zeit aufgegeben, wenn nicht die Menge der Ästheten und einige Musiker in ihrem Übereifer das Publikum in den Logen beschimpft und sogar geschubst hätte. Der Lärm degenerierte zum Handgemenge. Stehend in ihrer Loge, mit verrutschtem Diadem, schwang die alte Gräfin de Pourtales ihren Fächer und schrie, ganz rot im Gesicht: ‚Das ist das erste Mal seit sechzig Jahren, dass man wagt, sich über mich lustig zu machen‘. Die brave Dame war ehrlich, sie glaubte an ein abgekartetes Spiel. (…) ‚Le Sacre du printemps‘ wurde im Mai 1913 in einem neuen Saal ohne Patina gespielt, der zudem noch zu bequem und kalt war für ein Publikum, das an Gefühlsaufwallungen in engen Sitzreihen, in einer Hitze aus rotem Samt und Gold gewohnt war. Ich glaube nicht, dass das ‚Sacre‘ in einem weniger bombastischen Theater adäquater aufgenommen worden wäre, aber dieser luxuriöse Saal symbolisierte im ersten Augenblick den Irrtum, der darin bestand, dass man ein kräftiges und jugendliches Werk mit einem dekadenten Publikum konfrontierte, mit einem verweichlichten Publikum, das in den Girlanden-Stil Ludwig XVI, den weichen Diwans und den Kissen von einem Orientalismus ruhte, für den man (sonst) das Russische Ballett tadeln muss. Unter diesen Umständen macht man einen Verdauungsschlaf in einer Hängematte, man verjagt das wahre Neue (…) Eine Provinz schlimmer als die Provinz, im Herzen von Paris …“ Strawinsky „Sacre“ Strawinsky „Sacre“ 8 Die Presse äußerte sich nach der Uraufführung meist negativ: wenn nicht gerade eine Musik voll Abscheu verurteilt wurde, die man ja wegen des Tumultes nicht richtig hatte hören können, so herrschte doch in den Berichten eine Mischung aus Bewunderung und Hass vor, die gerade jene Faszination ausmachte, der das Publikum gegen seinen Willen ausgesetzt war. Der Kritiker Leon Vallas prägte zwar das Bonmont vom „Massacre du printemps“, jedoch wusste er sich sehr klug über die Musik auszudrücken, die nicht nur von Cocteau, sondern auch von einigen anderen als „urgeschichtlich“ eingestuft wird. Es war wohl mehr ein Wunschbild, eine Sehnsucht nach ursprünglicheren Formen menschlichen Lebens – nach all den Verfeinerungen des Impressionismus und dem Pessimismus der wagnerschen Musikdramen –, was die Leute auf „Sacre“ projizierten, der im Grunde genommen ein höchst artifizielles Werk ist. Die Reduktion der Melodien auf einige tatsächlich sehr primitiv wirkende Formeln wird längst wettgemacht durch die äußerst kunstvolle rhythmische Struktur und das Raffinement der Orchestration, das weit über das bei Rimsky und Debussy Gewohnte hinausgeht. Als 1914 „Sacre“ im Konzert ohne alle skandalösen Begleitumstände gehört werden konnte, entdeckte Pierre Lalo, dass die Musik weder hässlich noch barbarisch sei. Strawinsky feierte nun als Meister des Klangs und des Rhythmus Triumphe. Der Skandal des vorausgegangenen Jahres wurde noch erwähnt, doch er war schon ein Stück Musikgeschichte. 1920 brachte Diaghilev den „Sacre“ in einer neuen choreographischen Version von Massine heraus, die nun sehr frei war und keine durchlaufende Handlung mehr aufwies. Ohne den ganzen ethnologischen Ballast von altrussischen Kostümen, der noch die Uraufführung ausgezeichnet hatte, traf nun „Sacre“ auf ein Publikum, das sich überhaupt nicht mehr feindselig verhielt und den „tollen Orkan dieser Musik“ genoss. Das Jahrhundertereignis „Le Sacre du printemps“ wurde vom Komponisten zunächst als Vision einer rituellen Frühlingshandlung gesehen, als er an 11 den letzten Seiten seines Feuervogel-Balletts arbeitete: Weise Männer sitzen im Kreis und schauen auf den Todestanz eines jungen Mädchens, das geopfert werden soll, um den Gott des Frühlings günstig zu stimmen. Unversehens hatte sich in ihm als Beigabe intensiver kompositorischer Arbeitsprozesse das Sujet eines neuen Balletts gebildet. Es sind Bilder aus dem heidnischen Russland, zusammengehalten von einer Hauptidee: dem Geheimnis des großen Impulses der schöpferischen Kräfte des Frühlings. Es gibt keine Handlung, aber eine choreographische Sukzession. Eine heidnische Komponente soll und kann man dem „Sacre“ nicht austreiben, die animalische Freude an kraftvollen Bewegungen und der Fanatismus der jäh wiederholten Gebärden machen aus diesem Werk ein berauschendes Fest der Vitalität und Lebenswut, das gerade in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als so viele Ideale des alten Europa zerbrochen waren, voll verstanden und bejaht wurde. Der Skandal um „Sacre“, der Strawinsky auch den Ruhm eines Neutöners eintrug, um den sich die Neugierigen und jugendlich Begeisterungsfähigen scharten, hat sich bei späteren Werken nicht wiederholt. In der endgültigen Fassung ist das volkstümliche Element zurückgedrängt worden. Was den Parisern beim ersten Kontakt mit der Musik Strawinskys als typisch russisch vorgekommen sein musste, ist nicht das Russland, in dem sich ein durchschnittlicher Russe wiedererkannt hätte. Es handelt sich dabei, außer bei den unüberhörbaren rhythmischen Impulsen, um einige Intervallkonstellationen im Bau der Melodien, die auf eine nicht zu definierende Urzeit der Menschheit zurückgehen und nicht einem bestimmten, engstirnigen Nationalismus zugeschrieben werden können. So klingt Strawinskys „Sacre“ irgendwie russisch und ist doch universal, er mag die Pariser zum Heimweh nach ursprünglicher Lebensfreude inspiriert haben und er ist doch unverwechselbar modern, ein authentischer Ausdruck des heutigen Menschen, der in einer brutalen und technisierten Welt überlebt, ohne zu resignieren. (Theo Hirsbrunner) Strawinsky „Sacre“ Strawinsky „Sacre“ 10 13 S i lv e r - G a r b u r g K l av i e r d u o Strawinsky „Sacre“ 12 Sacre ist: Abschaffung des Prinzips der Entwicklung, die Eliminierung der Wertigkeit von Akkordfunktionen, die Gestaltung von Sätzen auf der Basis reihender Motiv-Variation und über die Ablösung der homophonen oder polyphonen Anlage von Satzstrukturen durch das Prinzip der Schichtung mehrerer Material- und Gestaltungsebenen. Dass „Le Sacre du printemps“ bis heute eine größere Karriere als OrchesterPartitur machte, hat mit seiner immensen Energie zu tun. Die größten Choreographen haben sich dem Stück angenommen. Mary Wigman (1957), Maurice Béjart (1959), John Neumeier, Valery Panow, Martha Graham und Pina Bausch. Pierre Boulez schrieb: „Die überragende Bedeutung des Rhythmus’ schlägt sich nieder in der Reduktion von Polyphonie und Harmonik auf untergeordnete Funktionen. Strawinsky hat die Richtung des rhythmischen Impulses geändert. Bis dahin beruhte Musik wesentlich auf einem Grund-Metrum. Innerhalb dieses gleichförmigen Ablaufs wurden „Konflikte“ produziert: Überschneidungen, Überlagerungen und Verschiebungen rhythmischer Formeln, die meist untrennbar mit melodischen Einfällen und harmonischen Funktionen zusammenhingen. So ergab sich eine Art Ordnung und Regelmäßigkeit, die durch momentan auftretende Fremdkörper gestört wurde. Bei Strawinsky hingegen, und besonders im „Sacre“, existiert zunächst nur ein fast körperlich wahrnehmbarer Grundpuls. Dieser Grundpuls, der einer vorgegebenen Zählzeit entspricht, wird nun vervielfältigt, teils regelmäßig, teils unregelmäßig. Dabei entstehen natürlich die erregendsten Wirkungen durch die unregelmäßige Folge, das Phänomen des Unvorhersehbaren innerhalb eines vorhersehbaren Zusammenhangs“. Gernot Wojnarowicz In der hohen, oft unterschätzten Kunst des Duospiels auf ein oder zwei Flügeln setzen Sivan Silver und ihr Partner Gil Garburg Maßstäbe: Publikum und Kritiker feiern sie, hochkarätige Orchester, Festivals und Veranstalter laden sie immer wieder erneut als Gäste ein. Sie sind in der Carnegie Hall und im Lincoln Center, im Wiener Musikverein, im Sydney Opera House und in der Berliner Philharmonie aufgetreten, haben in rund 70 Ländern auf fünf Kontinenten konzertiert und spielen regelmäßig mit Orchestern wie dem Israel Philharmonic Orchestra, der St. Petersburger Philharmonie und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Ihre Aufnahme von Mendelssohns Konzerten für Klavierduo und Orchester mit der Bayerischen Kammerphilharmonie unter Christopher Hogwood, um nur eine von mehreren CDs zu erwähnen, nannten der Bayerische Rundfunk „atemberaubend“, die Süddeutsche Zeitung „höchst spannend“ und die Zeitschrift Rondo schlicht „brillant“. Der Kritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schwärmte von der „lyrischen Empfindsamkeit und der hinreißenden technischen Meisterschaft“ des Duos und meldete, dass S i lv e r - G a r b u r g K l av i e r d u o 14 man „derart spontane Bravorufe“ am Ende eines Konzerts nur selten erlebe. Und ein Kollege vom Independent formulierte als Fazit: „Was für ein wundersamer Abend!“ Die beiden Israelis, die in Berlin wohnen, gastieren in Nord- und Lateinamerika, in Ostasien und Australien und Neuseeland, in Israel und zahlreichen Ländern Europas – mit Orchestern oder in Klavierabenden. Tourneen mit dem Münchner Kammerorchester, dem Israel Kammerorchester und der Philharmonie Brünn standen in ihrem Kalender. Im Frühjahr 2015 erschien bei ihrem neuen Exklusivpartner Berlin Classics „Petruschka“ und „Le Sacre du Printemps“ von Strawinsky für Klavier zu vier Händen. Eine weitere CD wird sich den letzten Werken Schuberts widmen. Sivan Silver und Gil Garburg waren auf dem Weg in vielversprechende Solokarrieren, ehe sie privat – und dann auch am Klavier – ein Paar wurden. Dabei sind die Herausforderungen, die das Duospiel bietet, enorm. Sechs Stunden am Tag arbeiten die erklärten Perfektionisten mit Hingabe an ihrem „gemeinsamen Atmen“ und an Details, die man oft nicht hört – und die doch den Unterschied ausmachen. Das funktioniert nur mit blindem Verständnis. „Jeder von uns drückt sein eigenes und zugleich ein gemeinsames Empfinden aus. Wir sind eins und dennoch im Dialog miteinander – das ist Magie“, sagt Sivan Silver. 2014 berief die Kunstuniversität Graz sie auf eine der wenigen Professuren für Klavierduo. Zuvor unterrichteten Silver-Garburg an der Hochschule Hannover, wo sie selbst als Schüler von Arie Vardi 2007 ihr Studium abschlossen. Sivan Silver und Gil Garburg reizt der permanente Wechsel zwischen Duoabenden und Orchesterkonzerten, zwischen intimen Stücken, die sie als Einheit fordern, dialogisch angelegten Werken und solchen, in denen sie an zwei Flügeln die Klangmacht eines ganzen Orchesters evozieren. „Es ist leicht, als Klavierduo mit Virtuosität Effekt zu machen. Aber das allein ist uns viel zu wenig. Wir wollen die Zuhörer mit unserer Musik im Herzen berühren.“ www.silvergarburg.com 15 Christian Klischat, 1969 in Kirchheimbolanden geboren, aufgewachsen in Habitzheim bei Darmstadt, erlebte im Staatstheater zum ersten Mal die schönen Künste. Seine Lebensreise führte ihn dann nach Basel, Bonn – sei es mit dem E-Bass in der Hand in diversen Rockbands oder in Jobs: vom Bioladenverkäufer, Bauarbeiter, Altenpfleger bis hin zum Tongießer. Nach der Schauspielausbildung an der Mainzer-Theaterwerkstatt ging es von Senftenberg nach Berlin, wo er die letzten 14 Jahre mit seiner Familie lebte. In der Hauptstadt baute er sein Basiscamp auf, pendelte von da aus nach Potsdam, Weimar, Wien, Zürich, Worms und Rudolstadt durch die Theater, Kirchen und andere Spielstätten. Auch im Kino ist er zu sehen u.a. beim „Weißen Band“ oder im Fernsehen beim „Tatort“, bei diversen „SoKos“ sowie als Hausmeister Herbert bei der Serie „Siebenstein“. Er wirkt bei verschiedenen Hörspielen mit und leiht beim interaktiven Internet-Hörspiel „Kwerks, die Kunstwerke“ allen agierenden Figuren seine Stimme. Christian Klischat arbeitet u.a. mit Michael Haneke, Götz Brandt, Paulus Manker, Uwe Eric Laufenberg und Dieter Wedel. Sein Anliegen ist immer wieder der institutionell-staubfreie Spagat zwischen Theater und Theologie, zwischen Kunst und Kirche. Hier ist er deutschlandweit in verschiedenen Kirchen mit seinen eigenen Produktionen zu erleben. Seit der Spielzeit 2014/15 ist er festes Ensemblemitglied am Staatstheater Darmstadt. Stefan Schuster wurde 1976 in Aalen geboren und erhielt seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Während der Ausbildung arbeitete er bereits am Schauspiel Leipzig mit Konstanze Lauterbach und Peter Kastenmüller. Sein erstes Engagement führte ihn 2000 bis 2003 ans Düsseldorfer Schauspielhaus, wo er auf Regisseure wie Jürgen Gosch, Igor Bauersima und Peter Hailer traf. Weitere Stationen waren das Stadttheater Gießen und im Jahr 2014 die Burgfestspiele Bad Vilbel. Wichtige Rollen waren dort unter anderem Mackie Messer in der „Dreigroschenoper“, Truffaldino im „Diener zweier Herren“ und der „Tempelherr“ in „Nathan der Weise“. Seit 2005 gehört er zum Ensemble des Staatstheaters Darmstadt, wo er unter anderem „Peer Gynt“ in der Regie von Axel Richter und den „Valmont“ in Heiner Müllers „Quartett“ in der Regie von Patricia Benecke spielte. Konzerthinweise 16 5. Sinfoniekonzert Sonntag, 3. April 2016, 11.00 Uhr, Großes Haus Montag, 4. April 2016, 20.00 Uhr, Großes Haus Werke von Hindemith, Prokofjew, Zimmermann, Mozart und Haydn Das Staatsorchester Darmstadt Sprecher Mathias Znidarec Dirigent Simon Gaudenz 7. Kammerkonzert Donnerstag, 07. April 2016, 20.00 Uhr, Kleines Haus Werke von Brahms und Ligeti Violine Andrej Bielow Horn Felix Klieser Klavier Kit Armstrong 4. Konzert Soli fan tutti Sonntag, 10. April 2016, 11.00 Uhr, Großes Haus Werke von Glinka, Ravel und Martinů Mitglieder des Staatsorchesters Impressum Spielzeit 2015 | 16, Programmheft Nr. 26 | Herausgeber: Staatstheater Darmstadt Georg-Büchner-Platz 1, 64283 Darmstadt, Telefon 06151. 2811-1 | Intendant: Karsten Wiegand | Geschäftsführender Direktor: Jürgen Pelz | Redaktion und Texte: Gernot Wojnarowicz | Mitarbeit und Originalbeitrag zu Dada: Hanneliese Lenk | Fotos: Regina Recht | Zur Aufführung der Werke von Ernst Jandl: Ernst Jandl, poetische Werke von 6 Bänden (Neuausgabe) hrsg. v. Klaus Siblewski ©2016 Luchterhand Literaturverlage, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH | Sollte es uns nicht gelungen sein, die Inhaber aller Urheberrechte ausfindig zu machen, bitten wir die Urheber, sich bei uns zu melden | Gestalterisches Konzept: sweetwater | holst, Darmstadt | Ausführung: Hélène Beck | Herstellung: Drach Print Media, Darmstadt „Denn Kunst ist nichts anderes als Gestaltung mit beliebigem Material.“ Kurt Schwitters