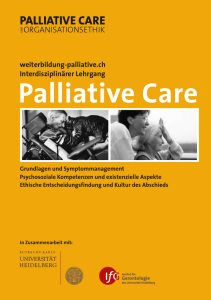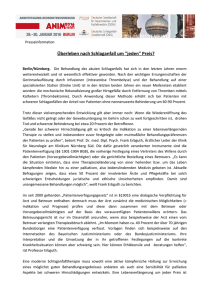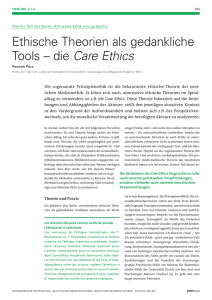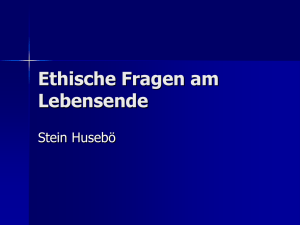Andreas Heller, Frank Kittelberger (Hg.) Hospizkompetenz und
Werbung
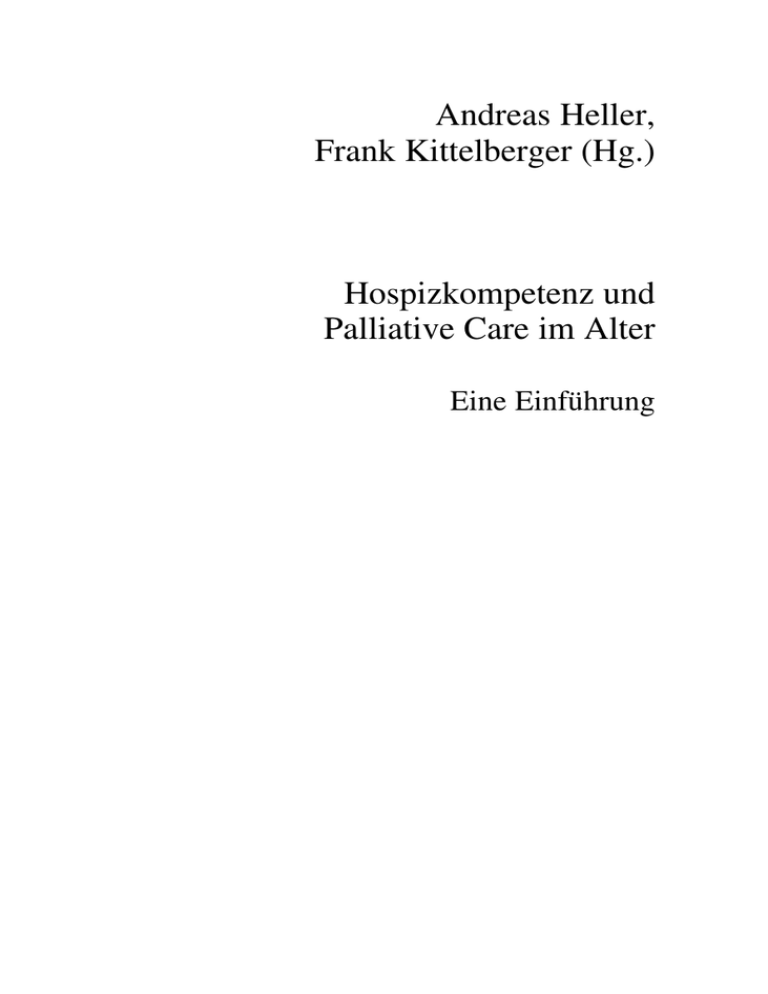
Andreas Heller, Frank Kittelberger (Hg.) Hospizkompetenz und Palliative Care im Alter Eine Einführung Für Wolf Hirche Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Alle Rechte vorbehalten © 2010, Lambertus-Verlag, Freiburg im Breisgau www.lambertus.de Umschlaggestaltung: Nathalie Kupfermann, Bollschweil Herstellung: Franz X. Stückle, Druck und Verlag, Ettenheim ISBN 978-3-7841-1967-0 Inhalt Palliative Kompetenz und hospizliche Kultur im Alter . . . . Andreas Heller, Frank Kittelberger 7 Kapitel 1: Verständigungen Hospizkultur und Palliative Care im Alter Perspektiven aus der internationalen Diskussion . . . . . . . . . 15 Palliative Care als konzeptionelle Grundlage für die Begleitung in der stationären Altenhilfe in der letzten Lebensphase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Palliative Care ist ein Zugang für hochbetagte Menschen – Ein erweiterter Blick auf die Who-Definition von Palliative Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Hospizarbeit im Alter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Spiritualität als Aufgabe des Alters? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Von der Akutgeriatrie zur Palliativen Geriatrie – Das Spektrum der Geriatrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Andreas Heller, Sabine Pleschberger Annette Riedel Marina Kojer, Katharina Heimerl Karin Wilkening Birgit Heller Thomas Frühwald Inhalt Kapitel 2: Konkretisierungen Brauchen demenzerkrankte alte Menschen Palliative Care? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Palliative Care bei Personen mit Demenz . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Schmerz im Alter – Ein vielschichtiges Problem . . . . . . . . . 166 „. . . Aber wer kümmert sich um mich?“ – Die „Häusliche Pflege“ meiner dementen Schwiegermutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Vulnerabilität und Resilienz von Partner/-innen demenziell erkrankter Menschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Hospizkultur und Mäeutik – Unser Umgang mit Fragen am Lebensende zu Hause, in Tageszentren und im Pflegeheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Ethische Voraussetzungen für eine gute Altenhilfe . . . . . . . . 222 Ethik in Pflegeheimen: Von der Berufsethik zur Organisationsethik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Ethische Entscheidungskultur am Lebensende: Einrichtung und Etablierung von Ethikberatung in der „Hilfe im Alter“, München . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Marina Kojer Monique Weissenberger-Leduc Roland Kunz Martina Schmidl Sabine Wadenpohl Christina Hallwirth-Spörk, Karin Weiler Ruth Schwerdt Thomas Krobath Stefan Dinges, Frank Kittelberger Inhalt Kapitel 3: Versorgungsherausforderungen Menschlich Sterben – Zwischen Ökonomie und Ethik . . . . . Susanne Reitze-Jehle 279 Das ökonomisch dominierte Spiel – Diakonie zwischen Glaubwürdigkeit und Wirtschaftlichkeit . . . . . . . . 293 „Hier ist ein Zuhause zum Leben – und zum Sterben . . .“ – Hospizkultur im Pflegeheim entwickeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Orte zum Leben – Orte zum Sterben. Palliative Care im Pflegeheim umsetzen . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Von Sterbebegleitung bis SAPV – Palliativbetreuung im Pflegeheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Wir managen keine Fälle, sondern erweitern die Handlungsmöglichkeiten mit Betroffenen . . . . . . . . . . . . . . . 351 Die Autorinnen und Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Arne Manzeschke Martin Alsheimer Katharina Heimerl Frank Kittelberger Michael Monzer Palliative Kompetenz und hospizliche Kultur im Alter Andreas Heller, Frank Kittelberger Dieses Buch zeigt, dass die fachliche und professionelle Auseinandersetzung mit dem Sterben älterer Menschen, mit ihrer Versorgung und der Begleitung ihrer Angehörigen in unseren mitteleuropäischen Ländern heute anders geführt wird als noch vor zehn Jahren. Inzwischen bestimmen neue und weit reichende Forderungen nach der Abschaffung der Pflegeheime den einen Pol der Diskussion. Alternativen zu Pflegeheimen sind wichtig, neue, auch intergenerative Wohnformen müssen gefördert werden. Der andere Pol ist jedoch, dass es wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Pflegeheime geben wird. Und es kann nicht genug qualifiziertes fachliches und öffentliches Interesse an diesen Einrichtungen und den Menschen, die in ihnen wohnen und arbeiten, geben. Je mehr öffentliche Durchlässigkeit von den Heimen selbst praktiziert wird, je mehr Austausch mit der Kommune und der Nachbarschaft gepflegt wird, je weniger abgeschlossen Heime sind und je mehr sie in das Zentrum der Aufmerksamkeit rücken, umso besser für die Bewohnerinnen und die Mitarbeiterinnen. Durch Projekte zur Integration von hospizlicher und palliativer Kompetenz in den Pflegeeinrichtungen (häufig wird diese Kulturarbeit immer wieder mit der technologischen Vokabel „Implementierung“ beschrieben), durch die weitsichtige Pionierarbeit von nicht wenigen Menschen, dem Mut von großen Trägerorganisationen und ihren Verantwortlichen wurden Meilensteine gesetzt, die den öffentlichen und fachlichen Diskurs nachhaltig stimuliert und auf eine andere Ebene transformiert haben. Auf diese Weise hat sich vor allem in der Praxis der Altenhilfe viel geändert. Hospizarbeit und Palliative Care sind eben keine Philosophien und Versorgungskonzepte, die nur in Kliniken praktiziert werden können. Die jahre- und jahrzehntelange Konzentration von Palliative Care auf Menschen mit Tumorerkrankungen hat sich in Deutschland, Österreich, der Schweiz, in Luxemburg und Südtirol sinnvoll aufgeweicht und ausgewei7 Vorwort tet. Es ist zunächst langsam, dann in einer rasanten Gesamtentwicklung gelungen, in zahlreichen Projekten, Publikationen, in Foren und Konferenzen, durch Initiativen und Stiftungen gefördert, das Thema eines menschenwürdigen Sterbens in Pflegeheimen zu setzen. Viele dieser Pioniere und Pionierinnen haben in diesem Band den Stand der Entwicklung eingebracht. Denn heute geraten die Träger und Einrichtungen unter Druck, die hier nicht auf der Höhe der Erkenntnisse von Palliative Care im Alter, einer hospizlich-palliativen Versorgung argumentieren und handeln. Die Politik nimmt die Themen auf und beeinflusst die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen. Es hat sich viel geändert. Aber es gibt auch bleibende Herausforderungen. In einem weniger bekannten Text hat der Soziologe Norbert Elias zu Beginn der 1980er Jahre sich Gedanken gemacht über die gesellschaftlichen Veränderungen im Umgang mit den alten und sterbenden Menschen. Er meinte beobachten zu können: „Heute schützt der Staat in industrialisierten Gesellschaften auch den einzelnen Alten, den einzelnen Sterbenden wie jeden anderen Staatsbürger vor offensichtlicher physischer Gewalt. Aber zugleich werden in immer höherem Maße die älter und schwächer werdenden Menschen aus der Gesellschaft und damit aus ihrem Familien- und Bekanntenkreis ausgesondert. Es gibt zunehmend Institutionen, in denen nur alte Menschen, die in ihrem früheren Leben gar nicht miteinander bekannt waren, zusammenleben. Auch bei hoher Individualisierung haben die meisten Menschen unserer Gesellschaft vor dem Ruhestand, vor dem Ende ihrer Berufstätigkeit Gefühlsbindungen nicht nur in der Familie, sondern auch an einen mehr oder minder umfassenden Kreis von Freunden, Freundinnen und Bekannten. Schon das Altwerden bringt gewöhnlich ein zunehmendes Absterben solcher Gefühlsbindungen außerhalb der engsten Familie mit sich. Außer im Falle von alten Ehepaaren bedeutet die Aufnahme ins Altersheim nicht nur gewöhnlich das endgültige Absterben früherer Gefühlsbeziehungen, es bedeutet zugleich auch das Zusammenleben mit Menschen, mit denen den einzelnen Mitbewohner des Altersheims keinerlei positive Gefühlsbeziehung verbindet. Die physische Betreuung durch Arzt und Pflegepersonal mag ausgezeichnet sein. Aber zugleich bedeutet die Aussonderung der Alten aus dem gewohnten Lebensbereich und die Zusammensiedlung der einander fremden Alten für den Einzelnen eine Vereinsamung. Es handelt sich dabei nicht nur um die Frage der sexuellen Bedürfnisse, die besonders bei Männern bis ins hohe Alter hinein noch rege sein können, sondern um die emotionalen Valenzen zwischen Menschen, deren 8 Vorwort Zusammenkommen ihnen Freude macht, die eine gewisse Zuneigung füreinander haben. Auch Beziehungen dieser Art verringern sich gewöhnlich mit dem Umzug ins Altersheim und finden nur selten dort einen Ersatz. Viele Altersheime sind daher Einöden der Einsamkeit“ (Elias 2002).1 Vereinsamung und Aussonderung der Alten und Sterbenden bleiben wichtige Herausforderungen. Auch wenn wir heute auf einem höheren interdisziplinären Niveau die Versorgung in der letzten Lebensphase diskutieren, ist die Vereinsamung geringer geworden? Trägt möglicherweise ein ausgearbeiteter Diskurs dazu bei, dass medizinisch-pflegerisch viel gemacht wird, sehr umsichtig Behandlungen aufgesetzt und ethisch auch verantwortet abgebrochen werden, die Aussonderung der Alten aber eher verlängert wird? Führt eine differenzierte Fachlichkeit vielleicht zur menschlichen und sozialen Distanzierung, zur rationalen Selbstrettung der Helfenden? In nüchterner Weise müssen die Mitarbeiterinnen in den Pflegeeinrichtungen schließlich auch unter schwierigen personellen und finanziellen Rahmenbedingungen, die nach wie vor zu konstatieren sind, sich selbst retten, ihr eigenes Leben, ihre Gesundheit, ihr Wohlergehen schützen in der Sorge um sich selbst. Die Aufmerksamkeit der Träger, der Leitungen um das Wohl der Mitarbeiterinnen muss deutlich machen, dass notwendige professionelle Distanzierung kein Gegensatz sein muss zur menschlichen Fähigkeit der Mitleidenschaft und Empathie, Hohe Fachlichkeit hängt mit Solidarität zusammen. Das ist nicht selbstverständlich. Aber daran werden wir den humanitären Charakter unserer Gesellschaften erkennen können. Wir müssen auch erkennen, dass das Sterben in Pflegeeinrichtungen eine qualitativ andere Perspektive auf das Sterben und die Sterbenden in unserer Gesellschaft lenkt. Der Tod kommt möglicherweise auch im Alter zu früh, oft genug nicht passend. Dennoch überrascht er weniger. Das Leben ist in seinen zeitlichen Dimensionen, vielleicht nicht in seinen qualitativen gelebt, oft ausgelebt im besten Sinne. „Es muss alsdann gestorben sein . . .“. 1 Norbert Elias, Altern und Sterben: Einige soziologische Probleme, in: Ders.: Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen = Norbert Elias, Gesammelte Schriften; hgg. im Auftr. der Norbert Elias Stichting Amsterdam von Reinhard Blomert, u.a., Bd. 6, Frankfurt: suhrkamp 2002, 69–90, 74–75. 9 Vorwort Wenige Monate nach ihrem Tod im Jahr 2003 wurden die letzten Texte der politisch wie poetisch anregenden Theologin Dorothee Sölle veröffentlicht. In der Erinnerung an das Sterben ihrer Mutter schrieb sie. „Meine Mutter ist mit 87 Jahren gestorben, und sie wollte nicht länger leben. Sie hatte ein Jahr zuvor einen Zusammenbruch, kam auf die Intensivstation und wurde so weit repariert, dass sie zwar zu Hause leben, aber nicht mehr die Treppe herunter zum Garten gehen konnte. Sie zitierte gern und lächelnd ein barockes Gedicht von Herzog Anton Ulrich: ,Ich habe nun genug gelebt, es muss alsdann gestorben sein.‘“ An ihrem Geburtstag rief sie mich morgens ungewöhnlich früh an und erzählte glückstrahlend, dass ihre Lieblingsenkelin ihr geschrieben habe: „Großmutter, ich wünsche dir keine weiteren Geburtstage.“ Endlich ein Mensch, der mich versteht, kommentierte sie. Wir vier Kinder wünschten ihr das nicht, hätten aber nie gewagt, es auszusprechen. Als meine Mutter im Sterben lag und seit Tagen nicht mehr sprach, kam der alte Familiendoktor, und ich sagte ihm: „Schmerzen sollte sie doch nicht mehr haben müssen.“ Er zögerte und fragte mich dann: „Oder meinen sie doch Krankenhaus?“ Meine Mutter, seit Tagen im Koma, schrie empört und plötzlich hellwach auf: „Nein, nur das nicht!“ Sie wollte gehen, ihre größte Angst war, noch einmal verlängert zu werden.2 „Es muss alsdann gestorben sein“, war das Motto des ersten Symposiums zu Fragen von Hospizarbeit und Palliative Care im Alter, das die IFFFakultät, Abteilung Palliative Care und Organsiationsethik der Universität Klagenfurt – Graz – Wien mit dem Diakonischen Werk in Bayern im Frühjahr 2009 in Nürnberg veranstaltete. In diesen Band sind wichtige Beiträge aus dem Kongress aufgenommen worden. Wir danken den Kolleginnen für die Bearbeitung und Überarbeitung ihrer Vorträge. Der Kongress wurde auch möglich, weil sowohl die IFF seit fast einem Jahrzehnt unermüdlich die Akteure und Vordenker in dieser Sache vernetzt, als auch weil das Diakonische Werk Bayern mit seiner Initiative Hospizarbeit und Palliative Care die Einrichtungen der Altenhilfe zur Beschäftigung mit diesen Fragen drängt und lockt. Wir danken ausdrücklich Wolf Hirche vom Diakonischen Werk in Bayern, der diesen Kongress möglich gemacht und uneingeschränkt gefördert und inspiriert hat. Seine Fähigkeit, sich uneigennützig in den Dienst der „Sache“ zu stellen, hat uns beeindruckt – wir widmen ihm dieses Buch. 2 Dorothee Sölle, Mystik des Todes, Stuttgart: Kreuz-Verlag 2003. 10 Vorwort Ilona Wenger hat die Manuskripte in unnachahmlicher Sorgfalt betreut, der Lambertus-Verlag setzt hiermit die Linie der Publikationen zum Thema Hospizarbeit fort. Dem Geschäftsführer Dr. Thomas Becker und der kooperationsfreudigen Lektorin Sabine Winkler sei für die gute Zusammenarbeit gedankt. München – Wien 2010 Andreas Heller Frank Kittelberger Hauptherausgeber der Buchreihe Palliative Care und OrganisationsEthik 11 Kapitel 1 Verständigungen Hospizkultur und Palliative Care im Alter Perspektiven aus der internationalen Diskussion Andreas Heller und Sabine Pleschberger Ausgehend von der Hospizidee Cicely Saunders in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts und den Arbeiten der US-amerikanischen Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross gibt es mittlerweile weltweit Bemühungen, die Versorgung unheilbar kranker und sterbender Menschen zu verbessern (Heller, Pleschberger 2006). Konsens scheint darin zu bestehen, Sterbende nicht abzuschieben und allein zu lassen; sie im Lebenszusammenhang mit ihren Angehörigen und Bezugspersonen zu unterstützen und ihnen eine angemessene medizinische, pflegerische, psychosoziale und spirituelle Behandlung bzw. Begleitung zukommen zu lassen. Vor allem aber, die Bedürfnisse radikal an den Betroffenen an ihrer Situation und den sich verändernden und aufschichtenden Problemlagen auszurichten (Heller 1999, Seymour, Hanson 2001, Schaeffer, Ewers 2005, Froggatt, Payne 2006 Heller, Knipping 2006). Im Jahr 2006 sind in Deutschland 821.627 Menschen gestorben. Davon waren etwa 46 Prozent 80 Jahre und älter1, und immerhin 28 Prozent waren 90 Jahre und älter (Statistisches Bundesamt 2007). Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt für Frauen derzeit bei knapp 82 Jahren, für Männer bei ca. 76 Jahren (Statistisches Bundesamt 2007). Es ist evident, dass Sterben ein Thema der alten, ja hochbetagten Menschen geworden ist. Ein Versorgungskonzept wie Palliative Care, das sich einem Umsorgen am Lebensende widmet, müsste sich daher zwangsläufig in erster Linie an den Bedürfnissen alter Menschen orientieren. Dies ist jedoch erst seit wenigen Jahren der Fall (Davies, Higginson 2004, Reitinger et al. 2004). Der Artikel erschien erstmals unter dem Titel Palliative Versorgung im Alter, in: Adelheid Kuhlmey, Doris Schaeffer (Hg.), Alter, Gesundheit und Krankheit, Bern: Huber 2008, 382–399. 1 Die altersbezogenen Daten stammen aus dem Jahr 2004, die Gesamtzahl an Gestorbenen betrug in diesem Jahr 818.271. 15 Hospizkultur und Palliative Care im Alter Was meint Palliative Care? Der Begriff „Palliativ“ leitet sich vom Lateinischen „pallium“ – der Mantel ab und wird in der deutschsprachigen Rezeption in erster Linie mit „Ummanteln, Umhüllen“, im Sinne von „fürsorglichem Beschützen“ wiedergegeben. Morris hingegen bietet in einem etymologischen Rekurs eine weitere Lesart an, wonach die indo-europäische Wurzel von „palliativ“ auf „pel“ verweist, was so viel wie „Fell“, „Tierhaut“ bedeutet, woraus die Bedeutung „pelte“, also waffenabwehrende Schilder für den kriegerischen Einsatz, entstand (vgl. Morris 1997, in: Clark, Seymour 1999). Dieser Doppelaspekt der „Mantelmetapher“ ermöglicht, an eine aktivere Rolle der Betroffenen zu denken und hält implizit eine kritische Dimension aufrecht: Denn in der palliativen Versorgung geht es sowohl um den Schutz der Betroffenen als auch um die Abwehr von sinnlosen und inadäquaten, meist medizinischen Maßnahmen und Interventionen. Konzeptionelle Perspektiven von Palliative Care Verschiedene Stichworte können das breite Spektrum möglicher Ausrichtungen von Palliative Care andeuten: Lebensqualität und Würde, Individualität und Sozialität, Autonomie (Selbstbestimmung) und Heteronomie (Fremdbestimmung), Beschleunigung des Sterbens (Euthanasie) und Verlangsamung (intensivmedizinische Maximaltherapie). Die Pionierin Dame Cicely Saunders definierte das Ziel anfangs so: „to die in dignity and character“. Und aus der Auseinandersetzung mit der Frage der Umsetzung entstand die Orientierung: „Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun“ – und vor allem zu lassen (Heller, Heimerl, Husebø 2007). Gemäß der weltweit rezipierten Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Palliative Care „. . . ein Ansatz, mit dem die Lebensqualität von PatientInnen und ihren Familien verbessert werden soll, wenn sie mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung und den damit verbundenen Problemen konfrontiert sind. Dies soll durch Vorsorge und Linderung von Leiden, durch frühzeitiges Erkennen, fehlerloser Einschätzung und Behandlung von Schmerzen und anderen physischen, psychosozialen und spirituellen Problemen erfolgen“ (WHO 2002, Übersetzung SP). 16 Andreas Heller, Sabine Pleschberger Dieser Definition werden erläuternd noch weitere Aspekte nachgestellt, in denen die Ausrichtung auf Angehörige, die Begleitung über den Tod hinaus einschließlich einer Resonanz auf die Trauer der Betroffenen, der Einsatz eines multiprofessionellen Teams und eine klare Abgrenzung zu aktiver Sterbehilfe formuliert sind (WHO 2002). In der überarbeiteten Fassung der ursprünglichen Definition aus dem Jahr 1990 wird dezidiert hervorgehoben, dass Palliative Care als Ansatz bereits sehr früh im Krankheitsverlauf, und zwar parallel zu kurativen Maßnahmen zur Geltung kommen sollte (ebd.). Wie diese konzeptionellen Bausteine in den verschiedenen Gesundheitssystemen umzusetzen sind, bleibt offen: Und so haben sich vielfältige Strukturen und Angebotsformen herausgebildet (vgl. Klaschik 2000, Heimerl, Heller 2001, Pleschberger 2001, Sabatowski et al. 2004). In Deutschland standen hierbei vor allem die spezialisierten Versorgungsangebote im Vordergrund, z.B. Palliativstationen und Hospize, Palliativkonsiliardienste sowie ambulante Palliativ- und Hospizdienste. Letztere sind ehrenamtliche Vereine und bilden gewissermaßen das Urgestein der Hospizbewegung (Pleschberger 2001). Die Anzahl an solchen Angeboten ist in Deutschland regional sehr unterschiedlich, gemeinsam ist der kontinuierliche Anstieg in den letzten zehn Jahren. Ein weiterer Ausbau wird von den Verbänden gefordert und auch gesetzlich gefördert, zuletzt etwa durch den Gesetzesbeschluss zur bundesweiten Finanzierung von spezialisieren Palliative Care Teams (GKV-WSG 2007). Über die spezialisierten Angebote hinaus erfolgt eine Umsetzung der Idee durch die Entwicklung der Grundversorgung, dort in erster Linie durch Kompetenzsteigerung bei den Health Professionals in Form von verbesserter Aus-, Fort- und Weiterbildung (Pleschberger, Heimerl 2005, Ewers 2006). Ein weiterer Ansatzpunkt richtet schließlich den Blick auf die Verzahnung und Verschränkung der Entwicklung von Personen mit der Entwicklung von Organisationen, ausgehend von der Einsicht, dass eine Kultur des Sterbens immer auch eine Organisationskultur des Sterbens ist (Heller 1994). Sie müsste logischerweise zur Entwicklung einer „Hospizkultur“ bzw. einer „Palliativen Kultur“ (Heller et al. 2002) führen, in und zwischen den Einrichtungen, aber auch in der individuellen und kollektiven Lebensausrichtung (Begemann 2006). 17 Hospizkultur und Palliative Care im Alter Entwicklung von Palliative Care in Deutschland Hospizarbeit und Palliative Care werden, vor allem im deutschsprachigen Raum, als Versorgungskonzepte mit unterschiedlichen Akzentuierungen rezipiert. Wiewohl international aus der Hospizidee und der Hospizarbeit das Konzept Palliative Care hervorgegangen ist, und zumeist kein konzeptioneller Unterschied mehr feststellbar ist, verlief die Entwicklung in Deutschland von Beginn an zweigleisig (Pleschberger 2001): professionsgeleitete, akademisch ausgerichtete Palliativmedizin hier und bürgerschaftlich orientierte Hospizbewegung da. Diese Polarisierung schlägt sich auch in der Terminologie nieder. In Deutschland wird Palliative Care in der Regel mit „Palliativmedizin“ übersetzt (Husebø, Klaschik 2006, Aulbert, Nauck, Radbruch 2007). In den meisten anderen Ländern jedoch werden Palliativpflege und Palliativmedizin als Teildisziplinen wahrgenommen, deren VertreterInnen sich genauso unter dem „umfassenden Dach“ Palliative Care versammeln, wie z.B. freiwillige HelferInnen im Rahmen der Hospizbewegung (vgl. Heller 2000). Palliative Care kann nach diesem Verständnis – will man nicht bei der englischen Terminologie bleiben – am ehesten mit „Palliativversorgung“ übersetzt werden. „Hospizarbeit“ bezieht sich in der Regel stärker auf die Hospizbewegung mit ihren bürgerschaftlichen Wurzeln, beinhaltet nicht zwangsläufig eine professionelle und wissenschaftliche Ausdifferenzierung und hat eine akademische Institutionalisierung nie wirklich als politisches Ziel verfolgt. Diese getrennte Entwicklung wird mittlerweile auch in Deutschland von beiden Seiten beklagt (van Oorschot 2000, Prönneke 2000). Es wird gefordert, das Erbe von Cicely Saunders nicht zuletzt durch integrative Begriffe (z.B. Hospizkonzept und Palliativversorgung als Synonyme) weiterzuentwickeln, zuletzt von Bundespräsident Köhler auf dem Hospizkongress in Würzburg 2006 (vgl. auch Albrecht, Orth, Schmidt 2006). Im internationalen Vergleich ist für die deutsche Entwicklung neben der zeitlichen Verzögerung auch ein starker Fokus auf die Schaffung von stationären Hospizen oder Palliativstationen charakteristisch (Pleschberger 2001). Die geringe Zahl von spezialisierten Angeboten mit pflegerischer und/oder medizinischem Versorgungsangebot ist u.a. auf die problematische sozialrechtliche Einordnung und Finanzierung zurückzuführen (Ewers, Schaeffer 2003). Der ambulante Sektor fristet in Deutschland 18 Andreas Heller, Sabine Pleschberger trotz Lippenbekentnissen traditionell ein Schattendasein (Schaeffer, Ewers 2002). Die Umsetzung der jüngsten legislativen Maßnahme zu einem flächendeckenden Ausbau ambulanter Palliativdienste bleibt abzuwarten, betrachtet man den gegenwärtigen Entwicklungsstand steht zu befürchten, dass alte Menschen nur am Rande in den Genuss dieser Leistungen kommen werden und eine Medikalisierung Platz greifen könnte (Clark 2002, Gronemeyer et al. 2004). Generell ist die Forschung im Bereich Palliative Care dünn und entwicklungsfähig, erst recht wenn man über die fachliche Spezialisierung der Palliativmedizin hinausgeht. Dies ist der im internationalen Vergleich rückständigen Akademisierung der Pflege (Schaeffer 2002, Ewers, Schaeffer 2005) geschuldet sowie einem Defizit an interdisziplinärer Versorgungsforschung. Die sich in den 1990er Jahren etablierenden Gesundheitswissenschaften richteten ihre Aufmerksamkeit qua Selbstverständnis zunächst stärker auf Aspekte der Gesundheitsförderung und -prävention denn der Versorgung pflegebedürftiger oder gar sterbender Menschen (vgl. Schwartz 1998, Hurrelmann, Laaser 1998). Vor diesem Hintergrund haben die zahlreichen Modellprojekte kaum eine Evaluierung erfahren, die wenigen Ausnahmen weisen allesamt auf den großen Bedarf nach einer Entwicklung der häuslichen Versorgung, einer besseren Verzahnung der spezialisierten Angebote mit jenen der Regelversorung sowie nach Maßnahmen mit denen der geforderten PatientInnen- bzw. NutzerInnenorientierung besser Rechnung getragen werden kann, als unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen2 (Ewers, Fuhr, Günnewig 2001, Schaeffer 2007, Rest, Michel 1995). Palliative Care – eine Frage des Alters? In der Entwicklung der Hospizidee wurde die Anwendbarkeit der konzeptionellen Bestandteile für chronisch kranke und alte Menschen nie grundsätzlich ausgeschlossen, ja von der Pionierin Cicely Saunders sogar dezidiert hervorgehoben (du Boulay 1984): „Terminal care should not be a facet of oncology, but of geriatric medicine, neurology, general practice and throughout medicine“ (Saunders, Baines 1983, 2). 2 Dazu gehören etwa Case und Care Management, Verfahren zur besseren Anleitung von Angehörigen, u.v.m. 19 Hospizkultur und Palliative Care im Alter Dennoch wurde das Konzept ausgehend und entlang von unheilbar krebskranken Menschen entwickelt. Die Beschäftigung mit dem Sterben von älteren Menschen hingegen ist über Jahrzehnte nahezu ein Ausfall auf der ganzen Ebene wissenschaftlicher Auseinandersetzung. Dies ist umso erstaunlicher, wenn man sich die Parallelen der beiden Felder vor Augen führt. Seymour und Hanson (2001) weisen auf die gemeinsamen Wurzeln und unterschiedlichen Entwicklungen von Palliative Care und Gerontologie hin: „Both attend to the pursuit of symptom control, while advising the judicious use of investigations and rejecting highly invasive and aggressive treatment modalities; both make the person and their family the unit of care, and have led the way in developing multidisciplinary and community-based models of care. In so doing they have developed parallel discourses of ,patient-centred‘ care, ,quality of life‘, ,dignity‘ and ,autonomy‘. Further, both disciplines focus on areas – ageing and cancer – that tend to provoke strong, even ,phobic‘ reactions from the public at large (Mount 1989). Seymour, Hanson (2001, 102) Seit einigen Jahren findet auf internationaler Ebene eine systematische Hinwendung im Palliative Care Diskurs zu anderen Zielgruppen statt,3 darunter auch zu alten Menschen (Seymour and Hanson 2001). Richtungsweisend ist das Erscheinen einer WHO-Publikation mit dem Titel „Better Palliative Care for Older People“ (Davies, Higginson, 2004). Darin werden Public Health Strategien auf nationaler Ebene eingefordert, mit dem Ziel der Verbesserung der Palliativversorgung für alte Menschen (ebenda.). Im deutschsprachigen Raum wurde mit dem Begriff Palliative Geriatrie (Heller, Heimerl, Husebø 1999, Kojer 2002) experimentiert, der freilich eine „Medikalisierungstendenz“ (Clark 2002, Heller, Heller 2003, Gronemeyer 2004) insinuiert, die sowohl die Praxis und den Alltag der Altenpflege als auch die interdisziplinäre theoretische Reflexion der Sorge und Versorgung älterer Menschen nicht angemessen aufnimmt. Die freien Übersetzungen internationaler Problembeschreibungen, wie „Palliative Care in the Elderly“ als „Palliative Care im Alter“ oder „Palliative Care und alte Menschen“, deuten einen offenen Klärungsbedarf an. Froggatt und Payne (2006) experimentieren vor dem 3 So gibt es auch eine verstärkte Auseinandersetzung um Palliative Care in der Pädiatrie (Goldman, Hain, Liben 2006), um Palliative Care und ,andere‘ chronische Erkrankungen (Addington-Hall, Higginson 2001, Morrison, Meier 2003). 20 Andreas Heller, Sabine Pleschberger Hintergrund der traditionellen Fokussierung von Palliative Care auf das Feld der Onkologie mit der Verwendung neuer Begriffe, etwa „End of Life Care“ im Feld von Pflegeheimen. Es kann somit allenfalls von einem sich entwickelnden Konzept gesprochen werden, dessen Prozess noch keinesfalls abgeschlossen ist. Dies wird durch die Frage verstärkt, wie es den einschlägigen Organisationen gelingen kann, Palliative Care zum Bestandteil ihrer Versorgung zu machen und kontextuell neu zu interpretieren (Heller, Heimerl, Husebø 2007). Internationale Entwicklung Der internationale Forschungsstand zu Palliative Care im Alter ist ein Produkt national sehr unterschiedlicher Ausgangslagen in diesem Bereich. Daher ist es an dieser Stelle erforderlich, kurz auf Schwerpunkte und Hintergründe einzelner Länder einzugehen. Im US-amerikanischen Kontext standen ältere Menschen schon relativ früh im Lichte der Aufmerksamkeit als Nutzergruppe für Palliative Care. Seit 1983 besteht die Möglichkeit, Hospice Care als Leistung der staatlichen Versicherung Medicare für Menschen ab 65 Jahre abzurechnen. Im Zuge dieser Regelung haben zahlreiche häuslichen Pflegedienste sowie Pflegeheime Hospice Care in ihr Angebot aufgenommen (Mahoney 1996), und auch gegenwärtig finanziert Medicare etwa 80 % aller Personen, die Hospice Care in Anspruch nehmen (Gazelle 2007). Die Integration von Hospizarbeit und Palliative Care in Pflegeheimen erfolgt auf Basis von Kooperationsverträgen zwischen den Pflegeheimen und Hospizdiensten, dies ist mittlerweile bei fast drei Viertel aller Pflegeheime der Fall (Moss, Moss, Connor 2003), und die Inanspruchnahme hat in den letzten Jahren enorm zugenommen (Gazelle 2007). Forschungsarbeiten zur Versorgung hochbetagter sterbender Menschen entstanden in diesem Umfeld ebenfalls wie das erste Handbuch zu „Geriatric Palliative Care“ (Morrison, Meier 2003). In Großbritannien erwuchs der Bedarf einer verstärkten Auseinandersetzung mit Palliative Care für alte und hochbetagte Menschen im Zuge erheblicher Mängel in der Versorgung von stationären Altenpflegeeinrichtungen. Dass in die Schaffung von einzelnen Hospizen investiert wurde, während die Situation in Pflegeheimen, wo eine Vielzahl alter Menschen sterben, sich kaum verbesserte, schien im Mutterland der Hospizbewegung aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit nicht länger vertret21 Hospizkultur und Palliative Care im Alter bar. So wird seit einigen Jahren vor allem dem Versorgungssektor der stationären Altenpflege wachsende Aufmerksamkeit zuteil (Hockley, Clark 2002; Katz, Peace 2003). Die zentrale Frage lautet dabei, wie in Pflegeheimen ähnliche Qualitätsstandards erreicht werden können, wie sie in Hospizen üblich sind (Frogatt et al. 2006). Über Pflegeheime hinaus lässt sich als weiterer Fokus eine Auseinandersetzung mit Palliative Care und Demenz ausmachen (Hughes 2006). Darüber hinaus gibt es in zahlreichen anderen Ländern auf der Ebene einzelner Modellprojekte Entwicklungen zur Umsetzung von Palliative Care in Pflegeheimen bzw. in der Geriatrie, etwa in der Schweiz (Kunz 2003a), Norwegen (Sangathe-Husebø, Husebø 2004), Österreich (Kojer 2002, Bitschnau 2003) und den Niederlanden (Baar 1999). Im Unterschied zum englischsprachigen Raum sind diese allerdings nur ansatzweise in eine wissenschaftliche Reflexion eingebettet. Palliative Care und Alter in Deutschland Dass auch in Deutschland die Potenziale von Palliative Care alte Menschen erst seit kurzem gesehen werden, hat seine Ursachen sowohl in der Entwicklung der Gerontologie und Geriatrie als auch der Palliativmedizin. Als Reaktion auf eine Verwahrpflege („sauber, sicher und satt“) und entsprechend einer gesamtgesellschaftlichen Stimmung, das Alter nicht mehr defizitär (Defizitheorie), sondern positiv als Chance, Aufgabe und Herausforderung zu besetzen, wurden Fragilität und Begrenztheit des Lebens, Multimorbidität, Sterben, Tod und Trauer über viele Jahre sozial und wissenschaftlich ausgeblendet. So orientierte die sich zunehmend auch universitär etablierende Gerontologie im Deutschland der 1980er Jahre an Konzepten wie „erfolgreich Altern“ (Baltes, Baltes 1989), „produktives Altern“ (Butler 1985) oder „die späte Freiheit“ (Rosenmayer 1983), dies war die Zeit, als auch die Hospizbewegung in Deutschland zögerlich Fuß zu fassen begann. Erst in den 90er Jahren wird am Heidelberger Institut für Gerontologie der Themenzusammenhang Altern und Sterben aufgenommen, und kontinuierlich weiter geführt (Kruse 1992, 2006). Auf Seiten der Palliativmedizin können die Gründe für die fehlende Zuwendung zum Alter einerseits in dem Bemühen engagierter PalliativmedizinerInnen gesehen werden, das neue Fach an den Universitäten und im 22 Andreas Heller, Sabine Pleschberger Konzert der medizinischen Fachgesellschaften zu etablieren. Hierfür schien ein enger Fokus erfolgsversprechender – es erfolgte der Aufbau der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, die Entwicklung der wissenschaftlichen Zeitschrift Palliativmedizin sowie ein Ausbau entsprechender Einrichtungen für Forschung, Lehre und Praxis in erster Linie an Krankenhäusern und Universitätskliniken. Nicht zu unterschätzen ist das Engagement der Deutschen Krebshilfe sowie jenes renommierter Pharmaunternehmen, das eine Fokussierung auf tumorerkrankte palliativ zu versorgende Menschen bekräftigte,4 und Schmerztherapie und Symptomkontrolle zu Kernkompetenzen palliativmedizinischen Handelns werden lässt.5 Bis heute kann sich Palliative Care allerdings nur schwer aus der „Umklammerung der Onkologie“ (Th. Binsack, zit. in Wegleitner, Reitinger 2004) befreien. In den einschlägigen Lehr- und Handbüchern dominiert eine aus der Tumortherapie stammende Schwerpunktsetzung in der Beschreibung der Symptome und ihrer medizinischen Behandlungsformen, auch wenn in den jüngeren Auflagen das Anwendungsfeld geriatrischer Krankheitsbilder aufgenommen wurde (Husebø, Klaschik 2006, Aulbert, Nauck, Radbruch 2007). Vor diesem Hintergrund setzt die Diskussion um Palliative Care im Alter hierzulande erst allmählich ein, und ist noch vorrangig auf Pflegeheime konzentriert (Pleschberger 2006), erweitert um besondere Herausforderungen rund um Palliative Care für Menschen mit Demenz (Kojer 2002, Kunz 2003a, Radzey 2006). Dies wird auch durch eine Initiative der Robert-Bosch-Stiftung (www.robert-bosch-stiftung.de) illustriert, die zum Ziel hat, in Deutschland auf breiter Ebene die Qualität und die Humanität der Begleitung von sterbenden Menschen in Heimen anzuheben bzw. weiter zu entwickeln. In einem ersten Schritt wurden Qualifizierungserfordernisse bei den MitarbeiterInnen der stationären und ambulanten Altenpflege erfasst (Ewers 2006), ein Curriculum erstellt und an MultiplikatorInnen weiter vermittelt (Klapper, Kojer, Schwänke 2007). Weitere Schritte im Sinne der Umsetzung organisationaler Entwicklungspro4 Vgl. dazu etwa die jüngste Initiative der Deutschen Krebshilfe zur Errichtung mehrerer Stiftungsprofessuren an deutschen Universitäten oder die von der Fa. Grünenthal finanzierten Stiftungsprofessur in Aachen und die von Mundipharma stipendierte Professur in Bonn. 5 Aktuell ist allerdings eine leichte Fokusverschiebung zu beobachten: Die Deutsche Krebshilfe junktimiert in einer Ausschreibung Anträge auf eine Professur für Palliativmedizin mit einer sinnvollen Netzwerkverknüpfung mit nicht-klinischer Hospiz- und Palliativversorgung in der Region. 23 Hospizkultur und Palliative Care im Alter zesse in den Pflegeheimen wurden 2007 durch eine Ausschreibung von Modellprojekten gesetzt (ebd.). Palliative Care in Pflegeheimen Pflegeheime entwickeln sich zu den gesellschaftlichen Orten des Sterbens (Streckeisen 2001, Salis Gross 2005, Pleschberger 2005). Daher ist natürlich in den Versorgungseinrichtungen der stationären Altenhilfe der Bedarf nach palliativen Versorgungskonzepten besonders evident. Das Konzept Palliative Care wurde im Umfeld der Hospize entwickelt, also Organisationen, die bewusst außerhalb der Regelversorgung geschaffen wurden, um den erforderlichen Freiraum für einen „anderen“ Umgang mit sterbenden Menschen, Hierarchien und Organisationsroutinen zu schaffen (Heller, Pleschberger 2006). Will man nun Palliative Care in Pflegeheimen umsetzen, ist es wichtig die unterschiedliche Ausgangslage zu berücksichtigen: · Die Bedürfnisse von Menschen in Pflegeheimen sind anders als die von Menschen im spezialisierten Palliative Care-Kontext, z.B. der verlängerte Sterbeprozess: nur etwa 9 Prozent der Leute die in Pflegeheimen sterben, sterben aufgrund einer todbringenden Erkrankung (abgesehen von Demenz), und weitere 50 Prozent sterben nach einer verlängerten Periode allgemeinen Abbaus (Sidell, Katz, Komaromy 1997). Froggatt und Payne (2006) liefern hierzu aktuelle Zahlen aus einer britischen Region (n = 660 Fälle), wonach etwa 15% der Todesfälle in einem Pflegeheim auf eine onkologische Erkrankung zurückzuführen waren. · Der Anteil an PflegeheimbewohnerInnen die in Krankenhäusern sterben ist relativ hoch. In der britischen Studie waren knapp 1/3 der Todesfälle von HeimbewohnerInnen in einem Krankenhaus verzeichnet (Froggatt, Payne 2006); für Deutschland liegen zwar keine Zahlen vor, die dokumentierte Praxis belegt dennoch eindrücklich, dass Überweisungen „zum Sterben“ ins Krankenhaus in vielen Einrichtungen üblich sind (Ewers 2006). Dies wird von den MitarbeiterInnen ambivalent, sowohl als belastend (Anspruch der Begleitung bis zuletzt) als auch entlastend (knappe Ressourcen und tw. fachliche Überforderung) erlebt (Pleschberger 2005). Ähnlich ambivalent ist hierzu auch die Haltung der BewohnerInnen und ihrer Angehörigen, wie erste Befunde zeigen (ebd.). 24 Andreas Heller, Sabine Pleschberger · · · · Die fachlichen und psychosozialen Anforderungen sind für die MitarbeiterInnen sehr hoch: Einige BewohnerInnen sind schon seit Jahren in der Einrichtung, hier gibt es oft engere Beziehungen, relativ viel Wissen über die Personen. Deshalb steigen die eigenen Ansprüche an eine gute Sterbebegleitung an. Gleichzeitig ist das Phänomen der Überweisung von sterbenden Menschen auch im ambulanten Versorgungssektor übliche Praxis (Ewers 2006, Wegleitner, Heimerl, Pleschberger 2006, Froggatt, Payne 2006). Das heißt, neu aufgenommene BewohnerInnen leben nur noch kurze Zeit, haben in diesen Tagen jedoch einen hohen Versorgungsbedarf. Von den MitarbeiterInnen erfordert diese Situation eine hohe Flexibilität und verstärkt Kompetenzen in Palliative Care (Pleschberger 2005, Ewers 2006, Heimerl, Heller, Kittelberger 2005). In jeder Hinsicht knappe Ressourcen prägen die Versorgung in der Langzeitpflege. Im Vergleich zu anderen Gesundheitseinrichtungen sind Heime mit durchwegs weniger und schlechter qualifiziertem Personal ausgestattet. Insbesondere Pflegehilfskräfte haben im Alltag wenig Möglichkeiten, sich mit dem Tod und dem Sterben und den Sterbenden und ihrer Angehörigen auseinanderzusetzen (Maddocks, Parker 2001). In vielen Ländern (z.B. UK, Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, etc.) werden PflegeheimbewohnerInnen von niedergelassenen AllgemeinmedizinerInnen – HausärztInnen – medizinisch betreut. In Phasen erhöhter Symptombelastung oder beim Sterben reicht diese Form der medizinischer Versorgung jedoch häufig nicht aus, gefordert sind erhöhte zeitliche Präsenz und kommunikative Intensität (Ewers 2006, Wegleitner, Heimerl, Wild 2007). HausärztInnen sind jedoch meist überlastet und nicht ausreichend sensibilisiert und qualifiziert, so der Tenor in der Literatur (Katz, Peace 2003 Ruppe, Heller 2007). Daher ist ein Augenmerk bei der Umsetzung von Palliative Care auf eine verbesserte medizinisch-ärztliche Versorgung in Pflegeheimen zu richten (ebd.). Pflegeheimbewohnerinnen haben meist keine (Ehe-)Partner mehr, womit die Last der Entscheidung ebenso wie die soziale Unterstützung auf die nachkommenden Angehörigen fällt (Parker et al. 2005. Viel zu wenig wird das Faktum thematisiert, dass PflegeheimbewohnerInnen häufig gar keine Angehörigen im Nahbereich haben, was eine weitere Herausforderung an die Betreuung und auch die ethische Entscheidungsfindung bedeutet, und bei den betroffenen Menschen vielfältige Sorgen und Ängste auslöst (Pleschberger 2005). 25 Hospizkultur und Palliative Care im Alter Um diese Aspekte aufzunehmen und dennoch Menschen in Pflegeheimen einen Zugang zu den Kernelementen von Palliative Care zu ermöglichen, wurden in den letzten Jahren unterschiedliche Modelle der Umsetzung entwickelt. Implementierung von Palliative Care in Pflegeheime Zweifelsohne wohnt dem Terminus „Implementierung von Palliative Care in Pflegeheimen“ ein sozialtechnologischer Zugang inne, etwa so, als ginge es darum, Palliative Care wie eine EDV-Verkabelung zu „montieren“. Der Begriff ist dennoch charakteristisch für das Anliegen, auch in Pflegeheimen Hospizkultur und Palliative Care integrieren zu wollen, unterstreicht aber auch die Offenheit, wie das bestmöglich erfolgen kann. So haben sich verschiedene Zugänge entwickelt (Heller, Heimerl, Husebø 1999, Heimerl 2006, Wilkening, Kunz 2003, Froggatt et al. 2006) die sich unterschiedlich systematisieren lassen (vgl. Heller, Wegleitner 2006, Heller et al. 2003, Ersek, Wilson 2003). Als zentrales Unterscheidungskriterium lässt sich jedenfalls erkennen, ob die Interventionen auf Ebene einzelner Individuen, Berufsgruppen, Organisationen oder sogar darüber hinaus (das Pflegeheim in einem Netzwerk der Versorgung) ausgerichtet sind. Hospizprogramme in Pflegeheimen Dieser Ansatz wird in den USA erprobt, dabei geht es darum, dass BewohnerInnen die in ein Hospizprogramm aufgenommen werden, besondere Leistungen erhalten. Andere Leistungen, z.B. akutmedizinischer Art werden hingegen unterlassen. Es gibt einige Evaluierungen die zeigen, dass die Versorgungsqualität für Menschen in Hospizprogrammen deutlich besser ist. Nicht zuletzt deshalb gibt es auch intensive Diskussionen darüber, wer wann in ein solches Programm aufgenommen wird (Miller, Mor 2002) Errichtung von spezialisierten Palliativeinheiten Der Weg, dass innerhalb eines Pflegeheimes gesondert Einheiten spezialisierter Palliativversorgung eingerichtet werden, wurde in Norwegen, in den Niederlanden, in der Schweiz sowie in einem britischen Projekt gegangen (Baar 1999, Sandgathe-Husebø, Husebø 2004). Auch hier stellt sich die Frage wer von den BewohnerInnen eines Pflegeheims tatsächlich 26 Andreas Heller, Sabine Pleschberger für diese Abteilung zugelassen werden soll, und wie solche Entscheidungsprozesse zustande kommen. Als positiver Aspekt lässt sich die Herausbildung spezifischen Know-Hows anführen, das dann der gesamten Einrichtung zugute kommen kann (Sandgathe-Husebø, Husebø 2004). Auch wird plausibilisiert, dass palliativ ausgerichtete Pflegeheime immer auch eine Stätte für Aus- und Weiterbildung, für Mentorat und Praktika ist und vor allem auch für Forschung.6 Beratungsangebote Bei diesem Typus bieten spezialisierte Palliative Care Kräfte auf Anfrage auch den MitarbeiterInnen in Pflegeheimen Beratung an. Allerdings handelt es sich in der Regel nicht um ein zugehendes Angebot, d.h. die Nutzung hängt in besonderem Maße von der Sensibilität und Bereitschaft der PflegeheimmitarbeiterInnen ab, diese Dienstleistung zu nutzen, was erst ansatzweise erfolgt (Froggatt, Hoult, Poole 2001). Dieses Modell setzt auch eine ausreichende Zahl an Palliative Care SpezialistInnen voraus, die Kompetenzen im Bereich der Versorgung alter Menschen. Das Modell wird vorwiegend in Großbritannien praktiziert, wo spezialisierte Palliative Care besonders häufig von spezialisierten Pflegekräften angeboten wird (Hirst 2004). Im deutschsprachigen Raum greifen Pflegeheime auf die Leistungen von spezialisierten Palliative-Care-Teams zurück (Heimerl, Pleschberger 2004), vorausgesetzt es gibt solche Angebote in der Region. Qualifizierungsmaßnahmen Hierbei handelt es sich wohl um eine der populärsten Maßnahmen im Bereich der „Implementierung“ von Palliative Care. Fort- und Weiterbildungen im Bereich der Grundprinzipien von Palliative Care werden als grundlegend für eine erfolgreiche Umsetzung des Konzeptes gesehen. Aus UK sowie USA liegen schon seit einigen Jahren elaborierte Unterlagen und Materialien zur Qualifizierung der MitarbeiterInnen in Pflegeheimen vor (exempl. Macmillan Cancer Relief 2004), in Deutschland 6 Diese Forderung wurde seit Beginn der Hospizbewegung ebenso an die Hospize gerichtet wie sie Bestandteil des Selbstverständnisses einer – meist an einer Universitätsklinik angesiedelten – Palliativstation ist. Faktisch wird dieses Potenzial angesichts der gravierenden Personal- und Finanzprobleme allerdings zu wenig genutzt, jedenfalls in den deutschen Pflegeheimen scheint der Alltag derzeit keine sinnvolle Forschung zu ermöglichen. Forschungs- und Projektpartnerschaften auf Zeit scheinen noch das innovativste Modell zu sein (Bartosch 2003). 27 Hospizkultur und Palliative Care im Alter wird im Rahmen des Programms „Palliative Praxis“ der Robert Bosch Stiftung an der Umsetzung eines bundesweiten Qualifizierungsprogrammes in den Altenpflegeheimen gearbeitet (Klapper 2007). Organisationsentwicklung In der deutschsprachigen Literatur wird die „Implementierung“ von Palliative Care in Pflegeheimen in der Regel als Prozess der Organisationsentwicklung der Einrichtungen beschrieben. Dieser Ansatz ist in der Einsicht begründet, dass Veränderungen in der Kultur und Politik der Einrichtungen erforderlich sind im Sinne einer Palliativen Kultur (Heller et al. 2002). Programmatisch wird in diesem durch die Organisationsentwicklung und den setting approach (J. M. Pelikan, R. Grossman) angeregte Diskussion, die Auffassung verfolgt, dass die betroffenen älteren Menschen oder ihre advokatorischen Repräsentanten in den Pflegeheimen bzw. ihre Angehörigen beteiligt sein müssen, um Antworten auf die Frage nach einem „guten Sterben“ zu finden (Partizipation), dass diese Frage nicht ohne die Trägerorganisation und die Leitung bearbeitet werden kann und dass konzeptionell die gesamte Organisation an der Philosophie von Palliative Care auszurichten ist, und ihre Grenzen zugunsten einer Einnetzung in die regionalen Versorgungsangebote durchlässig zu gestalten ist (Heimerl, Heller, Pleschberger 2006). Für die Durchführung wird ein projektbezogenes Vorgehen empfohlen, das ausgehend von einer Erhebung der Bedürfnisse auf Seiten der BewohnerInnen und ihrer Angehörigen die Beteiligung von VertreterInnen aller Hierarchieebenen vorsieht (vgl. Heller 1994, Heimerl, Heller, Stelling 2001, Heimerl, Heller, Kittelberger 2005.) Auf dieser Basis erfolgt auf Ebene der Organisationen eine Priorisierung der Ziele und die Entwicklung von Umsetzungsmaßnahmen, welche ebenfalls projektförmig durchgeführt werden. Hospizkompetenz (BAG) und Palliative Kultur werden heute als Bestandteil einer geriatrisch-gerontologischen Versorgung am Lebensende gesehen und gelten immer mehr als „state of the art“. Nach Pionierarbeiten Ende der 90er Jahre ist seit Anfang 2000 eine wachsende Zahl von Modellprojekten zu verzeichnen, mit dem Ziel, Palliative Care in Einrichtungen der stationären Altenpflege umzusetzen (vgl. Heller, Heimerl, Husebø 1999, Heimerl et al. 2000, Wilkening, Kunz 2003, Heimerl, Heller, Kittelberger 2005, Heller 2007). Bemerkenswert sind hier auch die 28 Andreas Heller, Sabine Pleschberger Bemühungen um Vernetzung, mit dem Ziel, die Erfahrungen und Inhalte möglichst flächendeckend zu verbreiten (BAG 2006, Kittelberger 2007). Palliative Care und Demenz Palliative Care im Alter bezieht sich wesentlich auf Palliative Care für Menschen mit demenziellen Veränderungen. Als unheilbare und damit todbringende Erkrankung erscheint für den Umgang mit Demenz ein palliativer Versorgungsansatz als angemessen, darüber besteht mittlerweile ein breiter Konsens (exempl. Kojer 2002, Hughes, Dove 2006, Small, Downs, Froggatt 2006). Nicht nur weil das Todesrisiko in Folge einer demenziellen Erkrankung erheblich ansteigt (ebd.) sondern auch, weil unter den hochbetagten Menschen am Lebensende immer mehr Menschen demenzerkrankt sind (Kuhlmey 2005), bedarf es eines sinnvollen Zueinanders von Palliative Care und Versorgungsansätzen für Menschen mit Demenz (Small, Downs, Froggatt 2006). Kunz nennt drei Herausforderungen im Zusammenhang mit Palliative Care für Menschen mit Demenz – Schmerzerfassung und -therapie, Ernährung sowie Entscheidungen am Lebensende (Kunz 2003b). Ergänzend dazu wird in besonderem Maße auf die spirituellen und psychosozialen Bedürfnisse der Betroffenen verwiesen sowie auf ihre Angehörigen, die schließlich mit einer längeren fortschreitenden unheilbaren Erkrankung konfrontiert sind (Bayer 2006, Hughes, Hedley, Harris 2006, Schütte 2006). Schließlich ist zu berücksichtigen, dass mit einer Demenz ein höheres Institutionalisierungsrisiko einhergeht, Menschen mit einer Demenz also häufiger in einem Pflegeheim leben müssen als andere.7 Was im Gesamtkontext nicht überrascht ist die enge Bezugnahme von Palliative Care und Demenz auf Pflegeheime (vgl. Abbey et al. 2006). Die Herausforderungen für Palliative Care in Pflegeheimen spitzen sich im Falle von Menschen mit Demenz zu und umgekehrt. Nur ein Beispiel – die Problematik dass PflegeheimbewohnerInnen bereits kurze Zeit nach Eintritt in das Heim sterben, ist bei Demenzerkrankten besonders folgenschwer, zumal ein Schlüsselaspekt für gute Versorgung darin liegt, die Person zu „kennen“ und nicht nur vieles „über sie zu wissen“ (Seymour, Hanson 2001, Froggatt, Payne 2006, Small, Downs, Froggatt 2006). Die 7 Diese Problematik beschäftigt vor allem die vielen pflegenden Angehörige und ihre Betroffenen, über deren Alltag das Damoklesschwert einer Einweisung ins Pflegeheim hängt (vgl. Wadenpohl 2001, Geister 2004). 29 Hospizkultur und Palliative Care im Alter Problematik rund um die Prognose angesichts einer vorliegenden Demenz lässt sich an einer Studie in US-Pflegeheimen illustrieren: Mitchell, Kiely und Hamel (2004) haben gezeigt, dass bei nur 1,1 % der BewohnerInnen mit einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung bei ihrer Aufnahme eine Lebenserwartung von weniger als 6 Monaten prognostiziert wurde, obwohl 71 % davon in diesem Zeitabschnitt verstarben. Die Forschungslücken hinsichtlich Palliative Care für Menschen mit Demenz außerhalb der Pflegeheime, zuhause, im Krankenhaus, oder in neuen alternativen Wohnformen sind beträchtlich (Cartwright 2002, Croucher, Hicks, Jackson 2006, Pleschberger, Reitinger, Schumann 2007). Im engeren medizinischen Diskurs wird das Fehlen evidenzbasierten Wissens über die Wirksamkeit von Palliative Care beklagt (Sampson et al. 2005, Hancock et al. 2006). Die Durchführung von randomisierten kontrollierten Studien stößt bei Menschen mit Demenz an ethische und methodische Grenzen (ebd.). Verlässt man den engen Pfad der Evidenzbasierung ist in den letzten Jahren eine zunehmende Fülle an Forschungsarbeiten und Beiträgen in diesem Feld zu verzeichnen, woraus sich eine Reihe an Instrumenten, Erkenntnissen und Handlungsempfehlungen für eine gute palliative Versorgung von Menschen mit Demenz ableiten lassen (vgl. Abbey et al. 2006, Radzey 2006, Perrar 2006, Kunz 2003a, Kojer, Schmidl 2007). Der Krankheitsverlauf einer Demenz bringt es mit sich, dass Fragen der Entscheidungsfindung im Kontext von Menschen mit Demenz zu einem Schlüsselthema werden. Die differenzierte Auseinandersetzung dazu, etwa aus den USA (vgl. Quill, McCann 2003), harrt im deutschsprachigen Raum noch einer umfassenden Rezeption. Den breitesten Raum scheinen noch Auseinandersetzungen um Formen der Selbstbestimmung zu sein, etwa ausgehend von den USA der Diskurs um Advanced Directives. Sampson et al. (2006) verweisen jedoch auf die gesetzlichen Bestimmungen in New York, wonach der Einsatz von Sondenernährung für Menschen mit Demenz bei Ernährungsproblemen gesetzlich verpflichtend ist, wenn keine Advance directive vorliegt (ebd.). Angesichts der großen Bedeutung die Fragen der Sondenernährung bei Menschen mit Demenz haben, ist es wichtig, unterschiedliche Ausgangslagen zu berücksichtigen und nicht vorschnell internationale Erkenntnisse auf die Situation hierzulande zu übertragen. 30 Andreas Heller, Sabine Pleschberger Ethische Aspekte von Palliative Care im Alter Palliative Care im Alter führt unweigerlich zu ethischen Fragestellungen, die einerseits die „großen“ Themen der Ethik, z.B. Würde, Selbstbestimmung, Verteilungsgerechtigkeit etc., wie auch die „kleinen“ ethischen Themen des Alltags (Heller, Reitinger, Heimerl 2007), z.B. Nahrungsverweigerung, Schutz der Intimität, Fixierung und Sedierung, usw. berühren. Charakteristisch ist für die Auseinandersetzung mit Ethik im Alter, dass Fragen der Entscheidungsfindung in besonderem Maße von sozialer und politischer Diskussion geprägt und begleitet sind (Seymour, Hanson 2001), beispielhaft sei hier auf die Sterbehilfedebatte verwiesen. Sie bewegt sich im Spannungsfeld zwischen der ökonomischen Rationalität, die die grundsätzliche Mittel- und Aufmerksamkeitsverteilung einer öffentlichen Fürsorge für alte, gebrechliche, sterbende Menschen im gesellschaftlichen Kontext zu thematisieren hat (Schernus, Bremer 2004) und der latenten Selbstentwertung und Selbstabwertung durch die Betroffenen (Pleschberger 2005), die aber nicht als Euthanasiewunsch missverstanden werden darf (ebd., Seymour, Hanson 2001). Grenzen des aktuellen Ethikdiskurses Der Ethikdiskurs, vor allem jener, der die „großen“ Themen betrifft, wird in der Regel von den wissenschaftlichen Disziplinen Medizin, Theologie, Philosophie, Recht und Ökonomie, etc. bestimmt/geführt. Dabei werden jedoch einige Aspekte nicht hinreichend aufgenommen, die bei Palliative Care im Alter von eminenter Bedeutung sind, nämlich die Organisationskontexte, in denen Menschen leben und sterben (z.B: Pflegeheim)8, die Kategorie Gender (männlich dominierter Ethikdiskurs trifft auf ein feminisiertes „Versorgungsfeld“) sowie die inhaltlichen Implikationen einer Care-Ethik und der geteilten Entscheidungsverantwortung (z.B. alte Menschen und ihre Anliegen und Bedürfnisse versus professionsethischer Diskurs). Parallel zu dem oben erwähnten Diskurs in den klassischen Disziplinen gibt es seit einigen Jahren auch im deutschsprachigen Raum eine Reihe 8 In der zweiten Auflage des Buches ,Ethik in Klinik und Pflegeeinrichtung‘ (Steinkamp, Gordijn 2005) wurde der Titel der ersten Auflage ,Ethik in der Klinik‘ zwar um ,Pflegeeinrichtung‘ erweitert, ohne aber im Text dieses ansonsten sehr verdienstvollen Buches spezielle ethische Themen der Pflegeeinrichtungen aufzunehmen. 31 Hospizkultur und Palliative Care im Alter an Publikationen zur Ethik der und in der Alten-Pflege. Darin lässt sich allerdings kaum ein themen- oder problembezogener Diskurs erkennen9, vielmehr haben diese Publikationen zum Ziel, Pflege als eingeständige Profession zu konstituieren, und einen Bogen über Grundsätze, Wertsysteme, Verfahren sowie Inhalte einer dazugehörigen Ethik zu spannen (Heller 1993, Arndt 1996, Steppe, 1989, Fry 1995, Remmers 2000, Ley 2004). Die beiden Arbeiten von Schwerdt (1998) und Blonski (1998) die sich konkret auf Pflegeethik und alte Menschen beziehen, zogen trotz differenzierter Ansätze keine weiteren Publikationen mit vergleichbarem Zuschnitt nach sich. Festzuhalten ist, dass es nur wenig Verschränkung zwischen den traditionellen (Medizin)-Ethikdiskursen und jenen in der Altenhilfe gibt. Ein gemeinsamer Nenner lässt sich dennoch finden und damit eine Brücke in das Feld Palliative Care schlagen: das ist die Darstellung und Bearbeitung ethischer Fragen entlang von Praxisbeispielen und Situationsanalysen, sog. „Fallbesprechungen“ (Arbeitsgruppe „Pflege und Ethik“ der Akademie für Ethik in der Medizin e.V. (Hg.) 2005, Henze, Piechotta 2004). Diese Form der Auseinandersetzung wird von verschiedenen Seiten empfohlen, sie stellt ein bewährtes Instrument für didaktische Zwecke, für die Integration von ethischer Reflexion in den Alltag einer Organisation dar, wie es auch ein unersetzbarer Prozess der Entscheidungsfindung in Dilemmasituationen zu sein scheint (Rabe 2005, Pleschberger, Dinges 2007). Letztendlich ist jedoch jede „Fall“-diskussion erneut an ethische Theorien bzw. Wertzusammenhänge gebunden. Es ist jedoch Vorsicht geboten, denn gerade Fallanalysen können Gefahr laufen, das innewohnende Anliegen zu konterkarieren: „Gerade bei der Behandlung des chronisch Kranken und schließlich bei der Begleitung des Sterbenden werden wir immer wieder daran erinnert, dass der Patient eine Person ist und kein ,Fall‘“. (Gadamer 1993, S. 130) 9 Dies ist noch am ehesten im Bereich der Pflegepädagogik der Fall, wo es darum geht, wie und in welcher Weise Ethik in der Pflege am besten vermittelt werden kann (z.B. Arbeitsgruppe ,Pflege und Ethik‘ der Akademie für Ethik in der Medizin e.V. (Hg.) 2005). 32 Andreas Heller, Sabine Pleschberger Themen und Besonderheiten Angesichts des wachsenden Anteils an demenziell veränderten Menschen im hohen Alter, ist die Frage der Entscheidungsfindung bei nicht mehr entscheidungsfähigen Menschen hinsichtlich therapeutischer oder pflegerischer Maßnahmen von großer Bedeutung. Wie kann das Anliegen der betroffenen Menschen selbst adäquat in einen Entscheidungsfindungsprozess einbezogen werden? Wie tragfähig ist die Figur des „mutmaßlichen Willens“ in dem Kontext? Konsensuell wird in der Literatur dazu betont, dass es hier um ein prozesshaftes Bemühen geht, und möglichst viele Facetten der jeweiligen Person und ihren nahe stehenden Menschen erfasst werden sollten (Quill, McCann 2003), wiewohl es immer um die Entscheidung einer anderen Person gehen wird. Durchaus von Seiten der Hospizbewegung und Palliativmedizin forciert werden in den letzten Jahre Verfahren und Instrumente zur Erklärung des Willens öffentlich diskutiert und finden verbreitet Anwendung, wie z.B. Patientenverfügungen. Die Idee, selbst im Voraus bestimmen zu können, was beispielsweise im Falle von Demenz passieren soll bzw. nicht passieren darf, findet in einer individualisierten Gesellschaft zahlreiche AnhängerInnen. Gerade am Beispiel von Menschen mit Demenz erfährt sie aber auch eine enorme Einschränkung. Der dem Instrument der Patientenverfügung innewohnende Autonomiebegriff greift hier zu kurz, und er läuft Gefahr, dass Lebensumstände, die in einer Phase von hoher Vitalität als gar nicht lebenswert erscheinen, auf diese Weise antizipativ ausgeschlossen werden (Dörner 2007, Rest 2006). In diesem Kontext ist vielmehr auf ein Verständnis von Autonomie hinzuweisen, das die Interdependenz des Menschen berücksichtigt (Roser 2005, Hughes, Dove 2006, Small, Downs, Froggatt 2006)10 und/oder jene Stimmen, die für eine Werteverschiebung von Autonomie hin zu anderen Konzepten wie z.B. Würde plädieren (Klie 2005, Reitinger et al. 2005, Pleschberger 2005, Hughes, Hadley, Harris 2006). Nicht nur für Menschen mit Demenz stellt der mit solchen Verfahren latent verbundene „Zwang zur Vorsorge“ eine gewisse Zumutung dar (Pleschberger 2005, Student 2006). Ebenfalls im Zusammenhang mit Demenz tritt das Problem der reduzierten Nahrungsaufnahme auf. Gerade im Endstadium einer Demenz10 Diesem Verständnis tragen andere Formen der Vorausbestimmung, z.B. Vorsorgevollmachten, Freundschaftsverträge, etc., die vor allem auf das Element sozialer Beziehungen setzen stärker Rechnung (vgl. Klie, Student 2001). 33 Hospizkultur und Palliative Care im Alter erkrankung scheint die Sondenanlage mehr Nachteile mit sich zu bringen als Gewinn für die Betroffenen (Perrar 2006), und auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie bei Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz zur Zurückhaltung bei der Anlage der perkutanen Ernährungssonde (Volkert et al. 2004). Dennoch wir in der Praxis noch häufig die Sorge vor einem Verhungern oder Verdursten zum Anlass genommen, invasiven Maßnahmen zu treffen, ohne dass eine Einwilligung seitens der Betroffenen nachvollziehbar wäre (Perrar 2006). Hier gilt es Erfahrungen und Wissen aus dem Bereich von Palliative Care gezielt in Versorgungskontexte der Altenpflege ebenso einzubringen (Kunz 2003a) wie generell einen differenzierten Zugang zum Umgang mit dem „Problem der Nahrungsverweigerung“ in der Praxis zu entwickeln (vgl. Kolb 2004). Wann beginnt das Sterben? Woran erkennt man das Sterben? Wann darf gestorben werden? In der geriatrischen Versorgung liegt die Schwierigkeit einer „Diagnostik des Sterbens“ insbesondere in der Vielfalt chronischer Erkrankungen und altersbedingter Abbauprozesse, wobei alte Menschen auch viele Perioden mit lebensbedrohlichen Komplikationen überleben können, bevor der Tod eintritt (Sandgathe-Husebø, Husebø 2003). Dennoch, nahezu altersunabhängig hängt der Eintritt des Todes heutzutage fast immer von einem Tun oder Unterlassen (notfall-)medizinischer Maßnahmen in einer bestimmten Situation ab (Pleschberger 2001). Gerade vor dem historischen Hintergrund der nationalsozialistischen Euthanasiepolitik in Deutschland (Dörner 2002) ist eine „Übervorsicht“, die sich zum Lebenszwang auswächst, verstehbar. Dennoch gilt es alles daran zu setzen, sowohl in gesellschaftspolitischer Hinsicht als auch mit Blick auf die betroffenen alten und oft hochbetagten Menschen jene Balance anzustreben, die im Konzept Palliative Care grundgelegt ist – das Sterben und Tod weder zu beschleunigen noch zu verzögern. Im Kontext von OrganisationsEthik wird bearbeitet, welche Fragen auf welcher Ebene der Organisationen und Anbieter wie zu prozessieren sind. In den Alten- und Pflegeheimen geht es daher immer und alltäglich auch um die ethische Haltung der Einzelnen (Arndt 2003) – hier gibt es eine Parallele zur Hospizarbeit (Graf 2005) – um deren ethisches Handeln und Unterlassen, und damit implizit auch um die ethische Dimension in Entscheidungen. Dies erfolgt aber im Rahmen einer Organisation, womit es auch um die Ethik eines Hauses, der Einrichtungen, und schließlich um die Ethik des Trägers (der Leitungs- und Aufsichtsorgane) geht (Dinges, Heimerl, Heller 2005). Mehr denn je braucht es geeignete 34 Andreas Heller, Sabine Pleschberger Prozeduren, also eine geregelte ethische Kommunikation wie z.B. Ethikberatung, BewohnerInnenbesprechungen, Hilfekonferenzen, „Runde Tische“, etc. (vgl. Heller 2005) mit der erforderliche Entscheidungen multiperspektivisch vorbereitet und vorgenommen werden können, aber auch retrospektiv reflektiert werden (Reitinger, Heimerl, Heller 2007). Neben den hier skizzierten Themen gibt es freilich eine Reihe weiterer relevanter Aspekte, die jedoch vorrangig im Kontext der Altenpflege diskutiert werden, wie z.B. spezielle Fragen der Körperpflege, des Umgangs mit der typisch motorischen Unruhe von Demenzerkrankten, Fixierung und Sedierung (Klie, Lörcher 1994, Hoffmann, Klie 2004), die Überweisung ins Krankenhaus, Notarztregeln, latenter Gewaltbereitschaft (Hirsch, Fussek 2001), der Umgang mit Scham und Ekel (Gröning 2000). Nimmt man Palliative Care für alte Menschen in den Blick, dann müssen auch solche Themen im Rahmen eines transdisziplinären ethischen Diskurses eine Bedeutung bekommen (Reitinger, Heimerl, Heller 2007). Synthetisierende Ausblicke Die Implikationen des Konzepts Palliative Care auf die Versorgung von alten, hochbetagten, demenziell veränderten Menschen sind noch längst nicht ausgelotet. Palliative Care ist im Bereich der Gerontologie und Geriatrie gut anschlussfähig und nimmt die Bedürfnisse der betroffenen Menschen und ihres sozialen Umfelds in unvergleichbarer Weise auf, ohne den Blick auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem nahenden Lebensende zu verlieren. Das Konzept selbst hat dennoch Blindheiten und Engführungen, die in der Auseinandersetzung mit dem Sterben älterer Menschen zu bearbeiten sind: · Der hospizliche und ethische Leitbegriff der Würde, der vor allem die unverrechenbare Subjektivität und nicht berechenbare Individualität der Betroffenen erinnert, kommt nicht vor, und wäre sinnvoller Weise in eine Spannung zu einer oft auf objektiver Messbarkeit basierenden Lebensqualitätsorientierung zu setzen (Klie 2005, Reitinger et al. 2004, Pleschberger 2005, Tadd, Bayer, Dieppe 2002). · Eine Geschlechterdifferenzierung findet in der aktuellen Rezeption von Palliative Care nicht statt (Beyer 2007). Diese Blindheit ist umso fataler, als es mit zunehmendem Alter um Frauen als Subjekte der Versorgung geht, deren Pflege wiederum in erster Linie vor allem von Frauen erbracht wird. Seien es Töchter und Schwiegertöchter oder professionell Pflegende. Frauen sind es auch, welche den Erhalt sozia35 Hospizkultur und Palliative Care im Alter ler Beziehungen und die Stabilisierung des Alltags sichern (Geister 2004, Pfeffer 2005, Gröning 2005). · Die Onkologieorientierung in Palliative Care wäre zu ergänzen durch eine Orientierung an den spezifischen Unterschieden in der Versorgung älterer Menschen. Hierfür gibt es seit kurzer Zeit vielversprechende Ansätze, die auch in diesem Kapitel vorgestellt wurden, es steht jedoch außer Zweifel, dass im Kontext von Palliative Care bislang die Entschiedenheit im Sinne einer deutlichen Verschiebung der Ressourcenzuteilung im Bereich von Forschung und Praxis fehlt. Entsprechend den demografischen Entwicklungen ist eine Diskussion um Palliative Care als Versorgungskonzept für alte und hochbetagte Menschen freilich auch eine Diskussion der Konzeption der Gesundheitsversorgung. Abgesehen von dem Aspekt, dass der Blick auf die Endlichkeit menschlichen Lebens auch die Werte verschiebt, lassen sich eine Reihe wichtiger Konzeptdimensionen von Palliative Care anführen, die über die Versorgung in der letzten Lebensphase hinaus für die als Forschungsperspektiven bedeutsam erscheinen: Zunächst einmal ist es das anthropologische Grundverständnis: Menschen als Frauen und Männer „holistisch“, „ganzheitlich“, „multidimensional“, also in einem biopsychosozialen und spirituellen Verschränkungszusammenhang zu sehen und entsprechend die Vieldimensionalität der Bedürfnisse11 aufzunehmen. Die herkömmliche theoretische Konstruktion der Gesundheitswissenschaften hat anders als die pflegewissenschaftliche Literatur (Käppeli 2001) bislang die Auseinandersetzung mit spirituellen Bedürfnissen von Betroffenen kaum systematisch-konzeptionell in ihrem Verständnis aufgenommen. Das mag verschiedene Gründe haben (Ideologieverdacht der Religion, fehlender Wissenschaftscharakter von Spiritualität, etc.), ist aber nicht mehr länger vertretbar, erst recht wenn unterschiedliche Weltanschauungen und plurale religiöse Traditionen in der Gesellschaft vorzufinden sind (Heller/Heller 2003), und in einer multikulturellen Versorgungslandschaft offensichtlicher werden. Der deutliche Akzent auf die Bedürfnisse der Betroffenen im Konzept Palliative Care nimmt die neuzeitliche Subjektdebatte auf und zwar in mehrfacher Hinsicht: Die Individualisierung der Gesellschaft führt in 11 Vgl hierzu auch die Kritik am Ganzheitsverständnis von Harrington 2002, Die Suche nach Ganzheit. Die Geschichte biologisch-psychologischer Ganzheitslehren: Vom Kaiserreich bis zur New Age-Bewegung. 36 Andreas Heller, Sabine Pleschberger letzter Konsequenz auch dazu, dass den Älteren eine Auseinandersetzung mit einer möglichen (oder faktischen) Pflegebedürftigkeit, ihrem Sterben und ihrem Tod nicht erspart wird. Auch wenn dies derzeit weitgehend ökonomisch verengt wird, als versicherungstechnische und finanzielle Absicherung des Alters. Sterben im Alter ist nicht allein ein Versorgungsproblem der Gesellschaft, sondern auch eine Frage der individuellen und kollektiven sozialen Vorsorge. Zum anderen wird im Palliative Care-Verständnis die Subjektzentrierung der Versorgung geweitet hin zu einer konstitutiv systemisch-territorialen Versorgungsinteraktion. Der soziale (verwandtschaftlich-nachbarschaftliche) und räumlich-territoriale Lebenszusammenhang wird profiliert und um neue gesellschaftliche Solidaritäten und Wahlverwandtschaftlichkeiten erweitert (Dörner 2007). Schließlich entstand das Konzept aus dem Bemühen, die gesamte Versorgungslandschaft und -politik um sterbende Menschen im Licht von „Hospice Care“ neu zu denken. Die Hospizbewegung ist gerade in Deutschland eine Bürgerbewegung mit nie vorher dagewesenem Engagement einer breiten Bevölkerung für die Nöte von sterbenden Menschen. Es wurden neue Angebote jenseits des etablierten Gesundheits- und Pflegesystems entwickelt, z.B. die Hospize, eine häusliche Versorgung mit Hilfe von ehrenamtlichem Engagement ermöglicht, noch lange bevor professionelle Strukturen ausreichend entwickelt waren (Gaßmann et al. 1992). Am Beispiel der Pflegeheime wird die Hospizbewegung im Hinblick auf einen Ersatz herkömmlicher und weniger an den Menschen denn an den Strukturen orientierten Organisationen auf eine harte Probe gestellt. Entsprechend der Erkenntnis von Erich Loewy (2003) kann man nicht gut handeln in Organisationen die „schlecht“ sind. Insofern ergeben sich viele der ethischen Fragen vor dem Hintergrund einer „Verbetriebswirtschaftlichung“ der Pflegeheime, und dem wachsenden Druck, schneller, besser und billiger, also mit weniger (gut qualifiziertem) Personal arbeiten zu müssen. Gleichwohl scheint klar zu sein, dass die Pflegeheime zu „Versorgungsfabriken“ degenerieren, wenn sie nicht die Differenz von Ökonomie und Ethik aufnehmen und entsprechend prozessieren. Insofern muss die Ethik der Pflegeheime und die Ethik im Pflegeheim Gelegenheiten schaffen, den Mitarbeiterinnen, aber auch den Betroffenen und Angehörigen Orientierung zu geben, auf welcher ethischen Basis, nach welchen ethischen Kriterien die Gesamtorganisation ausgerichtet ist, und wie diese Grundlagen in den Einzelsituationen zur Geltung kommen können (Reitinger, Heimerl, Heller 2007). 37 Hospizkultur und Palliative Care im Alter Im Kern geht es jedoch um eine Reorientierung der gesamten Versorgung im Alter. Erste Entwicklungen lassen erwarten, dass der gedanken- und visionslose Ausbau von stationären Kapazitäten (sprich Betten) in der Altenhilfe keine Zukunft haben wird. Flexiblere Betreuungs- und Versorgungsformen sind längst entwickelt, die näher am Bedarf einer Generation orientiert sind, für die weniger Sicherheit und Stabilität wie für die jetzige kriegs- und nachkriegstraumatisierten Jahrgänge 1910 bis etwa 1945 (Radebold 2005) im Vordergrund stehen sondern Autonomie und Flexibilität sind. Dementsprechend wird eine nachwachsende Alters- und Generationskohorte noch viel weniger, und wenn, dann noch viel später, den Einzug ins Pflegeheim – wenn dieses euphemistische Bild des „feierlichen Einzugs“ je gestimmt hat – vollziehen. Andere Mentalitäten und Bedarfe erzwingen andere Versorgungsformen, allerdings mit einem Verzögerungseffekt von zwei Jahrzehnten. Insofern ist die Suche nach neuen Netzwerken, einem „dritten Sozialraum“ (Dörner 2007) zwischen privat und öffentlich, der Neubelebung der Idee des Welfare-Mix (Evers, Wintersberger 1990, Klie, Roß 2005) eine der wichtigsten Forschungsperspektiven. Sie knüpft damit an die Hospizbewegung und Palliative Care an, weil sich an dieser Frage am Beispiel der Altenbetreuung die Transformation eines Versorgungssystems erweisen wird. Die „Zukleinstfamilie“ wird diese Herausforderungen nicht mehr allein schultern können. Und es liegt die Befürchtung nahe, dass sich unter der Signatur von würdigem und selbstbestimmten Sterben in Europa legalisierte Euthanasieangebote speziell für ältere Menschen ausbreiten werden. Welche Wege eingeschlagen werden, hängt sicher davon ab, ob die utilitaristische Pointierung der Diskussion um die Frage nach dem Nutzen (Schernus, Bremer 2007) konfrontiert wird mit den ethischen Prämissen eines Palliative Care Konzeptes. In jedem Fall lassen sich die Erfordernisse nicht mehr im Rahmen binnenstaatlicher Einzelmaßnahmen behandeln, sie bekommen eine europaweite und letztlich globale Qualität, und lassen die Frage nach einer guten Versorgung am Lebensende zu der sozialen, politischen und ethischen Herausforderung der industrialisierten Länder werden (Ewers, Schaeffer 2005). Für eine notwendigerweise interdisziplinäre Forschung in diesem Feld wird das auch bedeuten, die eigenen ethischen Positionen zu formulieren und zu artikulieren, um nicht im Lehnstuhl der Dauerreflexion Zeuge und Dokumentatorin von menschenfeindlichen und -verachtenden Entwicklungen zu werden. 38 Andreas Heller, Sabine Pleschberger Literatur Abbey, J., Froggatt, K., Parker, D., Abbey, B. (2006): Palliative care in long-term care: a system in change. International Journal of Older People Nursing, 1, 56–63. Addington-Hall, J. M., Higginson, I. J. (2001): Palliative Care for NonCancer Patients. Oxford: Oxford University Press. Albrecht, E., Orth, C., Schmidt, H. (2006): Hospizpraxis. Ein Leitfaden für Menschen, die Sterbenden helfen wollen. 5. neub. Aufl., Freiburg im Breisgau: Herder spektrum. Arbeitsgruppe „Pflege und Ethik“ der Akademie für Ethik in der Medizin e.V. (Hg.). „Für alle Fälle . . .“. Hannover: Brigitte Kunz Verlag. Arndt, M. (1996): Ethik denken – Maßstäbe zum Handeln in der Pflege. Stuttgart, New York: Thieme. Aulbert, E., Nauck, F., Radbruch, L. (2007): Lehrbuch der Palliativmedizin. Vol. 2. überarb. Stuttgart: Schattauer. Baar, F. (1999): Palliative Care for the terminally ill in the Netherlands: the unique role of nursing homes. European Journal of Palliative Care 6 (5). Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz e. V. (BAG) (2006): Hospizkultur im Alten- und Pflegeheim – Indikatoren und Empfehlungen zur Palliativkompetenz. Wuppertal: Der Hospiz-Verlag. Baltes, P. B., Baltes, M. M. (1989): Erfolgreiches Altern: Mehr Jahre und mehr Leben. Zeitschrift für Gerontopsychologie und -psychiatrie 2, S. 5–10. Bartosch, H. (2003): Sterbebegleitung – Palliative Versorgung. Ein Organisationsentwicklungsprozess in der Kaiserswerther Diakonie. In: Heller, A., Krobath, T. (Hrsg.): OrganisationsEthik. Organisationsentwicklung in Kirchen, Caritas und Diakonie. Reihe Palliative Care und OrganisationsEthik. Lambertus: Freiburg im Breisgau, S. 314–329. Bayer, T. (2006): Death with dementia – the need for better care. Age and Ageing, 35, S. 101–102. Begemann, V. (2006): Hospiz – Lehr- und Lernort des Lebens, Stuttgart: Kohlhammer. Beyer, S. (2007): Palliative Care und Gender – Sterbeprozesse von Frauen. Dissertation an der Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung. Universität Klagenfurt (eingereicht). 39 Hospizkultur und Palliative Care im Alter Bitschnau, K. W. (2003): Bestandsaufnahme der palliativen Versorgung und Entwicklungsperspektiven für Vorarlberg. Vorarlberg: Caritas, Hospizbewegung Vorarlberg. Blonski, H. (Hrsg.) (ca. 1998): Ethik in Gerontologie und Altenpflege. Leitfaden für die Praxis, Hagen: Brigitte Kunz Verlag o.J. (ca. 1998). Blonski, Harald, Hg. (1998): Ethik in Gerontologie und Altenpflege. Leitfaden für die Praxis. Hagen: Brigitte Kunz Verlag. Butler, R. N. (1985): Health, productivity and aging: an overview. In: Butler, R. N. und Gleason, H. P. (Hrsg.): Productive Aging, New York: Springer, S. 114–125. Cartwright, J. C. (2002): Nursing Homes and Assisted Living Facilities as places for dying. Annual Review of Nursing Research, 20, S. 231–264. Clark, D. (2002): Between hope and acceptance: the medicalisation of dying. BMJ, 324, S. 905–907. Clark, D., Seymour, J. E. (1999): Reflections on Palliative Care. Buckingham: Open University Press. Croucher, K., Hicks, L., Jackson, K. (2006): Housing with care for later life. A literature review. published by the Joseph Rowntree Foundation, S. 1–142. Davies, E., Higginson, I. (2004): Better Palliative Care for Older People? WHO Regional Office for Europe. WHO. Dinges, St., Heimerl, K., Heller, A. (2005): OrganisationsEthik in unterschiedlichen Beratungssettings. FoRuM Supervision, 13 (26), S. 25–41. Dörner, K. (2002): Tödliches Mitleid. Zur sozialen Frage der Unerträglichkeit des Lebens. 1988. Neumünster: Paranus Verlag, Edition Jakob van Hoddis. Dörner, K. (2007): Leben und Sterben wo ich hingehöre. Neumünster: Paraneus Verlag. Du Boulay, S. (1984): Cicely Saunders: The Founder of the Modern Hospice Movement. London: Hodder and Stoughton. Ersek, M., Wilson, S. (2003): The challenges and opportunities in providing end-of-life care in nursing homes. Journal of Palliative Medicine 6, S. 45–57. Evers, A., Wintersberger, H. (1990): Shifts in the Welfare Mix. Their Impact on Work, Social Services and Welfare Policies. Contributions from Nine European Countries. Frankfurt, New York: Campus. 40 Andreas Heller, Sabine Pleschberger Ewers, M. (2005): End-of-life-Care und Public Health – Konsens und Kontroversen. In: Ewers, M., Schaeffer, D. (Hrsg.): Am Ende des Lebens. Versorgung und Pflege von Menschen in der letzten Lebensphase. Reihe Gesundheitswissenschaften. Bern: Hans Huber Verlag, S. 41–67. Ewers, M., Schaeffer, D. (2005): Versorgung am Ende des Lebens – Einführung. In: Ewers, M., Schaeffer, D. (Hrsg.): Am Ende des Lebens. Versorgung und Pflege von Menschen in der letzten Lebensphase. Bern: Verlag Hans Huber, S. 7–18. Ewers, M. (2006): Palliative Praxis: Sichtweisen und Unterstützungsbedürfnsse von Mitarbeitern der ambulanten und stationären Altenhilfe und Altenpflege. Veröffentlichungsreihe des Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW). P06–132 Bielefeld: IPW. Ewers, M., Schaeffer, D. (2003): Palliativ-pflegerisch tätige Hausbetreuungsdienste in NRW. Ergebnisse der Begleitforschung. Veröffentlichungsreihe des Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld. P03–121 Bielefeld: IPW. Ewers, M., Fuhr, A., Günnewig, J. (2001): Palliativ-pflegerisch tätige Hausbetreuungsdienste in NRW – Teilergebnisse eines Modellprojekts. Veröffentlichungsreihe des Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW). Bielefeld IPW. Froggatt, K., Payne, Sh. (2006): A survey of end-of-life care in care homes: issues of definition and practice. Health and Social Care in the Community, 14 (4), S. 341–348. Froggatt, K., Hoult, L., Poole, K. (2001): Community work with nursing and residential care homes: a survey study of clinical nurse specialists in palliative care. London: Macmillan Cancer Relief. Froggatt, K., Wilson, D., Justice, Ch., MacAdam, M., Leibovici, K., Kinch, J., Thomas, R., Choi, J. (2006): End-of-life care in long-term care settings for older people: a literature review. International Journal of Older People Nursing, 1, S. 45–50. Fry, S. (1995): Ethik in der Pflegepraxis. Anleitung für ethische Entscheidungsfindungen; hgg. vom Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) e.V., Eschborn. Gadamer, H.-G. (1993): Über die Verborgenheit der Gesundheit, Frankfurt: Bibliothek suhrkamp 352, S. 130. Gaßmann, R., Hünefeld, A., Rest, F. und Schnabel, E. (1992): Versorgung Sterbender und ihrer Angehörigen. Düsseldorf: MAGS Nordrhein-Westfalen. 41 Hospizkultur und Palliative Care im Alter Gazelle, G. (2007): Understanding Hospice – An Underutilized Option for Life’s Final Chapter. New England Journal of Medicine, 357 (4), S. 321–324. Geister, Ch. (2004): „Weil ich für meine Mutter verantwortlich bin.“ Der Übergang von der Tochter zur pflegenden Tochter. Bern: Hans Huber. GKV-WSG (2007): Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz). Bundesrat. Drucksache 75/07. Goldman, A., Hain, R., Liben, St. (2006): Oxford Textbook of Palliative Care for Children. Oxford: Oxford University Press. Graf, G. (2005): Haltung als Quelle des Zusammenhalts der Hospizbewegung. Hospiz-Zeitschrift. Fachforum für Hospizarbeit (26), S. 4–7. Gronemeyer, R. (2004): Entsorgungspark. Die Kunst des Sterbens und die Verwaltung des Todes. Kampf der Generationen. München: Deutsche Verlags-Anstalt, S. 187–212. Gronemeyer, R., Fink, M., Globisch, M., Schumann, F. (2004): Palliative Care in Europa. In: Gronemeyer, R., Fink, M., Globisch, M., Schumann, F. (Hrsg.): Helfen am Ende des Lebens. Hospizarbeit und Palliative Care in Europa. Wuppertal: der hospiz verlag, S. 20–51. Gröning, K. (2000): Entweihung und Scham. Grenzsituationen in der Pflege alter Menschen. Frankfurt a. Main: Mabuse Verlag. Gröning, K. (2005): Perspektiven des feministischen Diskurses auf die familiale Pflege. Zeitschrift des Interdisziplinären Zentrums für Frauen- und Geschlechterforschung (IFF), 22 (29), S. 52–59. Hancock, K., Chang, E., Johnson, A., Harrison, K., Daly, J., Easterbrook, S., Noel, M. Davidson, P. M. (2006): Palliative Care for People with advanced Dementia: The Need for a Collaborative, Evidence-based Approach. Alzheimer?s Care Quarterly 7(1), S. 49–57. Harrington, A. (2002): Die Suche nach Ganzheit. Die Geschichte biologisch-psychologischer Ganzheitslehren: Vom Kaiserreich bis zur New Age-Bewegung, Reinbek b. Hamburg. Heimerl, K., Heller, A., Pleschberger, S. (2006): Implementierung der Palliative Care im Überblick. In: Knipping, C. (Hrsg.): Lehrbuch Palliative Care. Bern: Verlag Hans Huber, S. 50–57. Heimerl, K., Heller, A., Stelling, Ch. (2001): Regeln, Routinen, Rituale: OrganisationsKultur des Sterbens in den „Leben im Alter Zentren“ von Diakonie in Düsseldorf. In: Heimerl, K., Heller, A. (Hrsg.): Eine große Vision in kleinen Schritten. Aus Modellen der Hospiz- und Palliativbetreuung lernen. Freiburg i. Br.: Lambertus, S. 131–139. 42 Andreas Heller, Sabine Pleschberger Heimerl, K., Heller, A., Zepke, G., Zimmermann-Seitz, H. (2000): Individualität organisieren – OrganisationsKultur des Sterbens/Ein interventionsorientiertes Forschungs- und Beratungsprojekt des IFF mit der DiD. In: Heller, A., Heimerl, K., Husebø, St. (Hrsg.): Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun. Wie alte Menschen würdig sterben können. Freiburg i. Br.: Lambertus, S. 39–73. Heimerl, K. (2006): Palliative Care in Organisationen umsetzen. Habilitationsschrift zur Erlangung der Venia Legendi in Palliative Care und Organisationsentwicklung. Universität Klagenfurt. Heimerl, K., Pleschberger, S. (2004): Das Mobile Palliativteam in Vorarlberg. Analyse und Konzeption von Support Teams zur ambulanten Palliativversorgung. Expertise im Auftrag der Vorarlberger Landesregierung. Unveröffentlichter Bericht. Heimerl, K., Heller, A. (Hrsg.) (2001): Eine große Vision in kleinen Schritten. Aus Modellen der Hospiz- und Palliativbetreuung lernen. Freiburg i. Br.: Lambertus. Heimerl, K., Heller, A., Kittelberger, F. (2005): Daheim sterben. Palliative Kultur im Pflegeheim. Vol. 11. Reihe Palliative Care und OrganisationsEthik Freiburg i. Br.: Lambertus. Heller, A. (2000a): Die Einmaligkeit von Menschen verstehen und bis zuletzt bedienen. In: Heller, A., Heimerl, K., Husebø, St. (Hrsg.): Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun. Wie alte Menschen würdig sterben können. Freiburg i. Br.: Lambertus, S. 9–24. Heller, A., Pleschberger, S. (2006): Zur Geschichte der Hospizbewegung. In: Bernatzky, G., Sittl, R., Likar, R. (Hrsg.): Schmerzbehandlung in der Palliativmedizin. 2. überarb. Aufl. Wien, New York: Springer, S. 10–15. Heller, A., Wegleitner, K. (2006): Palliative Care in der stationären Altenhilfe – Ansätze der Implementierung. In: Knipping, C. (Hrsg.): Lehrbuch Palliative Care. Bern: Verlag Hans Huber, S. 73–80. Heller, A., Reitinger, E., Heimerl, K. (2007): Ethik in der Altenbetreuung. In: Reitinger, E., Heimerl, K., Heller, A.: Ethische Entscheidungen in der Altenbetreuung. Mit Betroffenen Wissen schaffen. Kursbuch palliative care 11/2007, S. 33–36. Heller, B. (2000b): Kulturen des Sterbens. Interreligiosität als Herausforderung für Palliative Care. In: Heller, A., Heimerl, K., Metz, Ch. (Hrsg.): Kultur des Sterbens. Bedingungen für das Lebensende gestalten. Freiburg i. Br.: Lambertus, S. 177–192. 43 Hospizkultur und Palliative Care im Alter Heller, B., Heller, A. (2003): Sterben ist mehr als Organversagen. Spiritualität und Palliative Care. In: Heller, B. (Hrsg.): Aller Einkehr ist der Tod. Interreligiöse Zugänge zu Sterben, Trauer, Tod. Freiburg i. Br.: Lambertus, S. 7–21. Heller, A. (1993): Ethik und Pflegewissenschaft. Fragmente für einen ausstehenden Dialog. In: Seidl, E. (Hrsg.), Betrifft: Pflegewissenschaft. Beiträge zum Selbstverständnis einer neuen Wissenschaftsdisziplin, Wien – München – Bern: Maudrich, S. 171–190. Heller, A. (Hrsg.) (1994): Kultur des Sterbens. Bedingungen für das Lebensende gestalten. Freiburg i. Br.: Lambertus. Heller, A., Dinges, St., Heimerl, K., Reitinger, E., Wegleitner, K. (2003): Palliative Kultur in der stationären Altenhilfe. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 36, S. 360–365. Heller, A., Heimerl, K., Huseb¢, St. (Hrsg.) (1999): Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun. Wie alte Menschen würdig sterben können. Freiburg i. Br.: Lambertus. Heller, A., Heimerl, K., Husebø, St (Hrsg.) (2007): Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun. Wie alte Menschen würdig sterben können. 3. aktual. Aufl., Freiburg i. Br.: Lambertus. Heller, A., Heimerl, K., Pleschberger, S., Husebø, St., Sandgathe Husebø, B. (2002): Palliative Kultur. kursbuch palliative care, 4, S. 5–11 Henze, K.-H., Piechotta, G. (Hrsg.): Brennpunkt Pflege. Beschreibungen und Analyse von Belastungen des pflegerischen Alltags. Mabuse Verlag. Frankfurt a. Main. Hirsch, R. D., Fussek, C. (2001): Gewalt gegen pflegebedürftige alte Menschen in Institutionen: Gegen das Schweigen. Berichte von Betroffenen. Bonner Schriftenreihe „Gewalt im Alter“. Band 4, Bonn. Hirst, P. (2006): Establishing specialist palliative care provision for care homes. Cancer Nursing Practice 3, S. 29–32. Hockley, J. M., Clark, D. (Hrsg.) (2002): Palliative Care for Older People in Care Homes. Buckingham: Open University Press. Hoffmann, B., Klie, Th. (2004): Freiheitsentziehende Maßnahmen. Unterbringung und unterbringungsähnliche Maßnahmen in Betreuungsrecht und -praxis. C. F. Müller Verlag. Hughes, J. C., Dove, Ph. (2006): The ethics of end-of-life decisions in severe dementia. In: Hughes, J. C. (Hrsg.): Palliative Care in Severe Dementia in association with Nursing and Residential Care. London: Quay Books, S. 45–53. 44 Andreas Heller, Sabine Pleschberger Hughes, J. C., (Hrsg.) (2006): Palliative Care in Severe Dementia in association with Nursing and Residential Care. London: Quay Books. Hughes, J. C., Hedley, K., Harris, D. (2006): The practice and philosophy of palliative care in dementia. In: Hughes, J. C. (Hrsg.): Palliative Care in Severe Dementia in association with Nursing and Residential Care. London: Quay Books, S. 1–11. Hurrelmann, K., Laaser, U. (1998): Handbuch Gesundheitswissenschaften. Weinheim: Juventa. Husebø, St., Klaschik, E. (Hrsg.) (2006): Palliativmedizin. Schmerztherapie, Gesprächsführung, Ethik. 3. Aufl. Wien/New York: Springer, S. 37–115. Käppeli, S. (2001): Mit-Leiden – eine vergessene Tradition der Pflege? Pflege, 14, S. 293–306. Katz, J., Peace, S. E. (2003): End of life in care homes. A palliative care approach. Oxford: Oxford University Press. Klapper, B., Kojer, M., Schwänke, U. (2007): Palliative Praxis. Ein Curriculum zur Begleitung alter Menschen am Ende des Lebens. In: Heller, A., Heimerl, K., Husebø, St. (Hrsg.): Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun. Wie alte Menschen würdig sterben können. 3. überarb. Auflage. Freiburg i. Br.: Lambertus. Klaschik, E. (2000): Entwicklung und Stand der Palliativmedizin in Deutschland. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung und Qualitätssicherung, 94, S. 538–540. Klie, T., Wilkening, K. (2003): In Würde sterben. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 36, S. 331–332. Klie, T. und Student, J.C. (2001): Die Patientenverfügung. Was Sie tun können, um richtig vorzusorgen. Freiburg i. Br.: Herder. Klie, Th. (2005): Würdekonzept für Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf, Balancen zwischen Autonomie und Sorgekultur. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 38, S. 268–272. Klie, Th., Roß, P.-St. (2005): Wie viel Bürger darf’s denn sein!? Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, 36 (4), S. 20–43. Klie, Th., Lörcher, U. (1994): Gefährdete Freiheit. Fixierungspraxis in Pflegeheimen und Heimaufsicht. Freiburg i. Br.: Lambertus. Kojer, M., Sramek, G. (2007): „Der Tod kommt und er geht auch wieder“. Demenzkranke Menschen und der Tod. In: Heller, A., Heimerl, K., Husebø, St. (Hrsg.): Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun. Wie alte Menschen würdig sterben können. 3. überarb. Auflage. Freiburg i. Br.: Lambertus. 45 Hospizkultur und Palliative Care im Alter Kojer, M. (Hrsg.) (2002): Alt, krank und verwirrt. Einführung in die Praxis der Palliativen Geriatrie. Freiburg i. Br.: Lambertus. Kolb, Ch. (2004): Nahrungsverweigerung bei Demenzkranken. PEGSonde – ja oder nein? Frankfurt a. Main: Mabuse. Kruse, A. (1992): Sterbende begleiten. In: Schmitz-Scherzer, R. (Hrsg.): Altern und Sterben, Bern: Huber, S. 63–105. Kruse, A. (2006): Das letzte Lebensjahr. Stuttgart: Kohlhammer. Kuhlmey, A. (2005): Demenz: Verbreitung, Versorgung, Belastungen der Pflegenden. Public Health Forum 13 (49), S. 3–4. Kunz, R. (2003a): Alltag im Pflegeheim. Sterbebegleitung ist Teil einer Lebenshaltung. Geriatrie Praxis (11–12), S. 16–18. Kunz, R. (2003b): Palliative Care für Patienten mit fortgeschrittener Demenz: Values Based statt Evidence Based Practice. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 36, S. 355–359. Lay, R. (2004): Ethik in der Pflege. Ein Lehrbuch für Aus-, Fort- und Weiterbildung. Schlütersche: Hannover. Loewy, E. (2003): Ein würdiges Leben und ein würdiges Sterben: ist Ethik ohne Politik oder Politik ohne Ethik denkbar? Unpublished Work. Macmillan Cancer Relief (2004): Foundations in Palliative Care. A program of facilitated learning for care-home staff. Macmillan Cancer Relief: London. Maddocks, I., Parker, D. (2001): Palliative Care in nursing homes. In: Addington-Hall, J. M., Higginson, I. J. (Hrsg.): Palliative Care for Non-Cancer Patients. Oxford: Oxford University Press, S. 147–157. Mahoney, J. J. (1996): International Update. In: Sheehan, D. C., Forman W. (Hrsg.): Hospice and Palliative Care: Concepts and Practice. Boston: Jones and Bartlett, S. 147–150. Maisch, H. Patiententötungen. Dem Sterben nachgeholfen, mit einem Vorw. v. Gerhard Mauz, München, Kindler. Miller, S. C., Mor, V. N. T. (2002): The role of hospice care in the nursing home setting. Journal of Palliative Medicine 5, S. 271–277. Mitchell, S. L., Kiely, D. K., Hamel, M. B. (2004): Dying with advanced dementia in the nursing home. Archives of Internal Medicine, 164 (3), S. 321–326. Mitscherlich, A., Mielke F. (1960): Doctors of infamy. The story of the Nazi medical crimes, New York 1949. Dt: Medizin ohne Menschlichkeit. Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses, Frankfurt. 46 Andreas Heller, Sabine Pleschberger Morrison, R. S., Meier, D. E. E. (2003): Geriatric Palliative Care. Oxford; New York: Oxford University Press. Moss, M. S., Moss, S. Z., Connor, S. R. (2003): Dying in long-term care facilities in the United States. In: Katz, J. S., Peace, S. (Hrsg.): End of life in care homes. A palliative care approach. Oxford University Press, Oxford, S. 157–174. Oorschot van, B. (2000): Hospizbewegung und Palliativmedizin – ein Streit um Kaisers Bart? Die Hospizzeitschrift, 2 (2), S. 3–6. Parker, D., Grbich, C., Brown, M., Maddocks, I., Willis, E., Roe, P. (2005): A Palliative Apporach or Specialist Palliative Care? What Happens in Aged Care Facilities for Residents With a Noncancer Diagnosis? Journal of Palliative Care, 21 (2), S. 80–87. Perrar, K. M. (2006): Palliativmedizinische Aspekte Demenzerkrankter in ihrer letzten Lebensphase. DeSSorientiert 02, S. 19–22. Pfeffer, Ch. (2005): Pflege: Die Arbeit der Frauen!? Die Hospiz-Zeitschrift 7 (24), S. 13–15. Pleschberger, S., Heimerl, K. (2005): Palliativpflege lehren und lernen. Die Pflege schwer kranker und sterbender Menschen im Kontext der Pflegeausbildung. In: Pleschberger, S., Heimerl, K., Wild, M. (Hrsg.): Palliativpflege. Grundlagen für Praxis und Unterricht. Wien: Facultas Universitätsverlag, S. 15–28. Pleschberger, S., Reitinger, E., Schumann, F. (2007). Leben und Sterben in der Demenz-WG. Ergebnisse einer explorativen Studie. Ersch. In Häusliche Pflege. Pleschberger, S. (2001) Palliative Care. Ein Versorgungskonzept für sterbende Menschen. Bielefeld IPW. Pleschberger, S. (2005): Nur nicht zur Last fallen. Sterben in Würde aus der Sicht alter Menschen in Pflegeheimen. Palliative Care und OrganisationsEthik. Vol. 13. Freiburg i. Br.: Lambertus. Pleschberger, S. (2006): Palliative Care in Pflegeheimen – Forschungsstand und Entwicklungsperspektiven. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 39, S. 376–381. Pleschberger, S., Dinges, St. (2007): „Ethische Fallbesprechung“. Planung, Ablauf und Reflexion der Workshops im Projekt. kursbuch palliative care, 11, S. 15–20. Prönneke, R. (2000): Hospiz-Palliativ: Eine Standortbestimmung tut Not. Die Hospiz Zeitschrift 2 (2), S. 7–8. 47 Hospizkultur und Palliative Care im Alter Quill, T. E., McCann, R. (2003): Decision Making for the Cognitively Impaired. In: Morrison Sean R. und Meier Diane E. (Hrsg.): Geriatric Palliative Care. New York: Oxford University Press, S. 332–341. Rabe, M. (2005): Strukturierte Falldiskussion anhand eines Reflexionsmodells. In: Arbeitsgruppe „Pflege und Ethik“ der Akademie für Ethik in der Medizin e.V. (Hrsg.): „Für alle Fälle . . .“. Hannover: Brigitte Kunz Verlag, S. 131–144. Radebold, H. (2005): Die dunklen Schatten unserer Vergangenheit. Stuttgart: Klett Cotta. Radzey, B. (2006): Diskussionsstand zum Thema „Menschen mit Demenz in ihrer letzten Lebensphase.“ DeSSOrientiert 2, S. 6–11. Reitinger, E., Heimerl, K., Heller, A. (2007): Ethische Entscheidungen in der Altenbetreuung. Mit Betroffenen Wissen schaffen. Kursbuch palliative care 11/2007. Reitinger, E., Heller, A., Tesch-Römer, C., Zeman, P. (2004): Leitkategorie Menschenwürde. Zum Sterben in stationären Pflegeeinrichtungen. Freiburg i. Br.: Lambertus. Remmers, H. (2000): Pflegerisches Handeln – Wissenschafts- und Ethikdiskurse zur Konturierung der Pflegewissenschaft. Bern: Hans Huber Verlag. Rest, F., Michel, S. (1995): Sterben zu Hause? Möglichkeiten und Grenzen der Arbeit der ambulanten Hospizdienste. Düsseldorf: MAGS. Rosenmeyer, L. (1983): Die späte Freiheit. Berlin: Severin & Siedler. Roser, T. (2005). Inszenierte Kommunikation. Vorsorgeverfügungen für Menschen mit Demenz aus theologisch-anthropologischer Perspektive. In: Meier, Ch., Borasio, G. D., Kutzer, K. (Hrsg.). Patientenverfügung. Ausdruck der Selbstbestimmung – Auftrag zur Fürsorge. Münchner Reihe Palliative Care, Band 1. Stuttgart: Kohlhammer, S. 45–55. Ruppe, G., Heller, A. (2007): Ärztliche Versorgung am Lebensende im Pflegeheim. In: Heller, A., Heimerl, K., Husebø, St. (Hrsg.): Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun. Wie alte Menschen würdig sterben können. 3. überarb. Auflage. Freiburg i. Br.: Lambertus. Sabatowski, R., Radbruch, L., Nauck, F., Roß, J., Zernikow, B., Steiner, F. (2004): Hospiz- und Palliativführer. Stationäre und ambulante Palliativ- und Hospizeinrichtungen in Deutschland. Neu-Isenburg: MediMedia. 48 Andreas Heller, Sabine Pleschberger Salis Gross, C. (2005): Der ansteckende Tod: Sterbeverläufe im Altersund Pflegeheim. In: Ewers, M., Schaeffer, D. (Hrsg.): Am Ende des Lebens. Versorgung und Pflege von Menschen in der letzten Lebensphase. Bern: Verlag Hans Huber, S. 155–174. Sampson, E. L., Richie, C. W., Lai, R., Raven, P. W., Blanchard, M. R. (2005): A systematic review of the scientific evidence for the efficacy of a palliative care apporach in advanced dementia. International Psychogeriatrics, 17 (1), S. 31–40. Sandgathe Husebø, B., Husebø, St. (2004): Old and Given up for Dying? Palliative Care Units in Nursing Homes. Illness, Crisis & Loss, 12 (1), S. 75–89. Saunders, C., Baines, M. (1983): Living with Dying: The Management of Terminal Disease. Oxford: Oxford University Press. Schaeffer, D. (2007): Versorgungswirklichkeit in der letzten Lebensphase: Ergebnisse einer Analyse der Nutzerperspektive. In: Ewers, M., Schaeffer, D. (Hrsg.): Am Ende des Lebens. Versorgung und Pflege von Menschen in der letzten Lebensphase. Reihe Gesundheitswissenschaften. Bern: Hans Huber Verlag, S. 69–91. Schaeffer, D., Ewers, M. (2002): Ambulant vor stationär. Perspektiven für eine integrierte ambulante Pflege Schwerkranker. Huber Verlag Bern. Schaeffer, D. (2002): Pflegeforschung: aktuelle Entwicklungstendenzen und -herausforderungen. Pflege und Gesellschaft, 7 (3), S. 73–79. Schernus, R., Bremer, F. (2007): Tyrannei des Gelingens. Plädoyer gegen marktkonformes Einheitsdenken in sozialen Arbeitsfeldern, Neumünster: Paranus. Schmidl, M. (2007): Schmerzen und Demenz. In: Heller, A., Heimerl, K., Husebø, St. (Hrsg.): Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun. Wie alte Menschen würdig sterben können. 3. überarb. Auflage. Freiburg i. Br.: Lambertus. Schütte, A. (2006): Würde im Alter im Horizont von Seelsorge und Pflege. Der Beitrag eines integrativen dialogischen Seelsorgekonzepts in der Palliativen Betreuung pflegebedürftiger Menschen in Altenpflegeheimen, Würzburg: echter. Schwartz, F. W. (1998): Das Public Health Buch. Gesundheit und Gesundheitswesen. München: Urban & Schwarzenberg. Schwerdt, R. (1998): Eine Ethik für die Altenpflege. Ein transdisziplinärer Versuch aus der Aueinandersetzung mit Peter Singer, Hans Jonas und Martin Buber, Bern – Göttingen, Torono – Seattle: Huber. 49 Hospizkultur und Palliative Care im Alter Seymour, J. E., Hanson, E. (2001): Palliative care and older people. In: Nolan, M., Davies, S., Grant, G. (Hrsg.): Working with older people and their families. Maidenhead; Philadelphia: Open University Press, S. 99–119. Sidell, M., Katz, J., Komaromy, C. (1997): Death and dying in residential and nursing homes for older people: examining the case for palliative care. Report for the Department of Health. Small N., Downs M., Froggatt K. (2006): Improving end-of-life care for people with dementia – the benefits of combining UK apporaches to palliative care and dementia care. In: Jones, G., Miesen, B. (Hrsg.): Care Giving in Dementia. Vol. 4. London: Routledge, S. 365–392. Statistisches Bundesamt (2007). Statistisches Jahrbuch 2006. Wiesbaden. Online-Zugriff. Steinkamp N., Gordijn B. (2005): Ethik in Klinik und Pflegeeinrichtung. Ein Arbeitsbuch, 2. überarb. Auflage. Neuwied – Köln – München. Streckeisen, U. (2001): Die Medizin und der Tod. Über berufliche Strategien zwischen Klinik und Pathologie. Opladen: Leske und Budrich. Student, J. C. (2006): Was nützen vorsorgliche Verfügungen für das Lebensende? Betreuungsmanagement (2), S. 68–71. Tadd, W., Bayer, T., Dieppe, P. (2002): Dignity in health care: reality or rhetoric. Reviews in Clinical Gerontology, 12, S. 1–4. Volkert, D., Lenzen-Großimlinghaus, R., Krys, U., Pirlich, M., Herbst, B., Schütz, T., Schroer, W., Weinrebe, W., Ockenga, J., and Lochs, H. (2004): Leitlinie Enterale Ernährung der DGEM und DGG. Aktuelle Ernährungsmedizin, 29, S. 129–225. Wadenpohl, S. (2001): Aber sie ist doch noch immer meine Mutter. Eine qualitative Studie zur Sichtweise pflegender Angehöriger auf Ressourcen und Probleme bei der Interaktion in demenziell veränderten Beziehungen. Wahlinger, F. P. (Hrsg.) (2001): Seneca. De brevtitate vitae. Die Kürze des Lebens, München: dtv tb. Wegleitner, K., Heimerl, K., Wild, M. (2007): Palliative Care in der Hauskrankenpflege – oder das Überwinden traditioneller Versorgungsmuster. In: Heller, A., Heimerl, K., Husebø, St. (Hrsg.): Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun. Wie alte Menschen würdig sterben können. 3. überarb. Auflage. Freiburg i. Br.: Lambertus. 50 Andreas Heller, Sabine Pleschberger Wegleitner, K., Reitinger, E. (2004): Palliativversorgung in der stationären Altenhilfe. Implementierung von Palliative Care in Alten- und Pflegeheimen. Dokumentation zur 1. internationalen IMM-IFF Fachkonsultation. Kursbuch palliative care. Wegleitner, K., Heimerl, K., Pleschberger, S. (2006): Gut versorgt bis zuletzt. Palliative Care in der Hauskrankenpflege des Österreichischen Roten Kreuzes. Projekt – Zwischenbericht. IFF – Wien: Eigenverlag. WHO (2002): National Cancer Control Programmes. Policies and managerial Guidelines. Geneva: World Health Organization. Wilkening, K., Kunz, R. (2003): Sterben im Pflegeheim. Perspektiven und Praxis einer neuen Abschiedskultur. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 51 Palliative Care als konzeptionelle Grundlage für die Begleitung in der stationären Altenhilfe in der letzten Lebensphase Annette Riedel „Ich habe mich bewusst der Versorgung von Tumorpatienten gewidmet. Ich wusste, dass es mir nicht gelingt, die Misere in der Versorgung unserer alten Mitbürger aufzugreifen. Das Problem ist mir zu groß gewesen“ (Cicely Saunders 1999 in: Husebø, S. 2006, 379). 1 Einleitung/Hinführung Nachdem Palliative Care lange Zeit auch in Deutschland den Fokus auf schwerkranke und sterbende Krebspatienten legte, ist zwischenzeitlich die Sensibilität für die Zielgruppe der älteren Menschen in unserer Gesellschaft gewachsen (vgl. Weihrauch 2009; vgl. Höfling 2007, 2; vgl. Wilkening & Kunz 2005, 31). Es herrscht zwischenzeitlich Einigkeit darüber, dass Palliative Care und die Fortschritte der Palliativmedizin auch anderen Zielgruppen zugute kommen soll und muss (vgl. Husebø, B. S. 2006, 379). Gerade ältere und alte Menschen, die die Mehrzahl der Sterbenden ausmachen, sollen zukünftig verstärkt von den Entwicklungen und Erkenntnissen profitieren (vgl. Weihrauch 2009). Dass die Thematik bezogen auf diese Zielgruppe in den vergangenen Jahren an Bedeutsamkeit gewonnen hat, wird in diversen Erklärungen und Äußerungen von Sachverständigen in unterschiedlichen Publikationen explizit. So haben zum Beispiel die WHO Publikation aus dem Jahr 2004: „Better Palliative Care for Older People“ (WHO 2004), die Grundsatzüberlegungen der Weltgesundheitsorganisation Regionalbüro für Europa (www.euro.who. int aufgerufen am 23.02.2009) und die internationalen Kernaussagen zum Welt Hospiz- und Palliative Care Tag am 6. Oktober 2007 (World Hospice & Palliative Care Day; Internationale Kernaussagen 2007; vgl. 52 Annette Riedel Internationale Kernaussagen 2008) deutliche Signale gesetzt. Die Empfehlung Rec (2003) 24 des Ministerkomitees an die Mitgliedsstaaten zur Strukturierung der palliativmedizinischen und -pflegerischen Versorgung hebt hervor, dass die palliativen Versorgungsstrukturen auf allen Ebenen und in der jeweils spezifischen Situation und Lebensphase den Betroffenen zugänglich sein sollten (Council of Europe 2004). Die Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz formulierte ihrerseits konkrete Indikatoren und Empfehlungen zur Palliativkompetenz für eine Hospizkultur im Alten- und Pflegeheim (Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz; www.hospiz.net/themen/hospizkultur.pdf.; aufgerufen am 23.02.2009). Der Dachverband „Hospiz Österreich“ publizierte seinerseits Grundprinzipien und Richtlinien zur Umsetzung und Entwicklung von Hospiz und Palliative Care im Pflegeheim (vgl. Hospiz Österreich; Stand 03.09.2008) Auch die großen Wohlfahrtsverbände haben sich zwischenzeitlich dem Thema zugewandt (zum Beispiel: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland 2006). Die Enquête Kommission Ethik und Recht in der modernen Medizin (2005) fordert im Jahr 2005, dass die „. . . palliativmedizinische und palliativpflegerische Kompetenz in den Alten- und Pflegeheimen zu integrieren . . .“ ist (Deutscher Bundestag 2005, 73). Der Deutsche Bundestag befasste sich – mehrfach Bezug nehmend auf den Bericht der Enquête Kommission – in seiner 169. Sitzung am 19. Juni 2008 mit einem Antrag „Leben am Lebensende – Bessere Rahmenbedingungen für Schwerkranke und Sterbende schaffen“ (Deutscher Bundestag 2008; Drucksache 16/9442). In dem Entwurf der Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbandes e.V., der deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin und der Bundesärztekammer (Stand 03.09.2008) ist bezüglich der „Besonderheiten der Versorgung alter Menschen“ zu lesen: „Die immer größer werdende Zahl von Menschen in hohem Lebensalter, die in stationären Pflegeeinrichtungen betreut werden, macht besondere Lösungen erforderlich“ (Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V., Bundesärztekammer 2008). In dieser Formulierung wird deutlich, dass diese Zielgruppe in den Einrichtungen der stationären Altenhilfe „besonderer Lösungen“ bedarf. Die Anforderungen und die „Besonderheiten“ werden im Folgenden herausgearbeitet und in den Kontext des Palliative Care Ansatzes gestellt. 53 Komponenten des Palliative Care Ansatzes als konzeptionelle Grundlage Deutlich wird einerseits, dass die Thematik in der Politik angekommen ist und der Handlungsbedarf in mehreren Publikationen und auf unterschiedlichen Ebenen hervorgehoben wird. Präsent ist andererseits, dass gerade im Bereich der stationären Altenhilfe noch keine durchdringende Neuorientierung in diese Richtung zu verzeichnen ist und es durchgeführten Projekten zum Teil an der Nachhaltigkeit fehlt, beziehungsweise wissenschaftliche Evaluationen noch ausstehen. Bezogen auf das Handlungsfeld der stationären Altenhilfe gilt es sich bewusst zu sein, dass Pflegeheime für einen beträchtlichen Anteil der Bevölkerung – neben dem Krankenhaus – einen zentralen Sterbeort darstellen. Somit gilt dem Palliative Care Ansatz – bezogen auf diesen Versorgungssektor – bereits unter politischen und quantitativen Gesichtpunkten eine besondere Aufmerksamkeit. Diese Argumentation soll an dieser Stelle jedoch noch nicht zufrieden stellen, vielmehr wird im Folgenden der Handlungsbedarf umfassender, das heißt sowohl an den pflegeberuflichen Anforderungen als auch an den Prämissen des Palliative Care Ansatzes orientiert, begründet. Offensichtlich wird das Interesse an der Gesamtthematik auch in der Recherche der Literatur – vornehmlich aus den Bereichen der Sozialwissenschaften und der Medizin wie auch aus dem Bereich der Pflegewissenschaft – die sich zwischenzeitlich zunehmend mit der spezifischen Zielgruppe der älteren Menschen im Kontext der Thematik befasst (vgl. Imhof u.a. 2008; vgl. Buchmann 2007; vgl. Pleschberger 2007, 2006, 2005; vgl. Heller u.a. 2007). In der Fachliteratur wird im Kontext der Thematik oftmals von Palliativer Geriatrie gesprochen (vgl. Müller & Zippel 2009; vgl. Kojer 2007; vgl. Kojer 2002, 21–31) oder von Palliativmedizin für alte Menschen und/oder der Palliativmedizin in der Geriatrie (vgl. Husebø, B. S. 2006, 379–416). Die Begrifflichkeiten Palliativmedizin in der Geriatrie und Palliative Geriatrie werden im Rahmen dieser Ausführungen bewusst nicht genutzt, da es sich bei der Geriatrie um einen ausgewiesenen Bereich der Medizin handelt. Konsequent wird auf die Begriffe Palliative Care oder palliative Pflege zurückgegriffen, da diese für die stationäre Altenhilfe angemessener sind. Bedauerlicher Weise ist in der Pflege und der Medizin zugleich das Verständnis von Palliative Care weder einheitlich noch eindeutig (vgl. Kloke 2009, 2–6; vgl. Steffen-Bürgi 2007, 30). So sind in der deutschen Übertragung des Begriffs „Palliative Care“ die Zuordnungen zur Palliativmedizin, zur Palliativbetreuung, zur Palliativversorgung oder zur Palliativpflege zu finden (vgl. Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) 2003, 97; vgl. Flieder 2007, 89–90). Besonders brisant ist diese Varianz vor dem Hinter54 Annette Riedel grund, dass den einzelnen Definitionen zu Palliative Care unterschiedliche Wertesysteme und theoretische beziehungsweise professionelle Modelle zugrunde liegen. Der Begriff der letzten Lebensphase wurde ausdrücklich für diesen Beitrag gewählt, um deutlich zu machen, es geht um einen Abschnitt im Leben. Denn auch ein sterbender alter Mensch lebt. Diese Formulierung bewahrt zudem vor der Tendenz stationäre Altenhilfeeinrichtungen von Lebensorten in Orte des Sterbens umzuwidmen. Deutlich wird in der Begrifflichkeit ferner, dass es sich hierbei um einen Lebensabschnitt handelt, der Entwicklungsaufgaben und -anforderungen an den jeweiligen Menschen stellt. Die letzte Lebensphase ist in der Perspektive des Gegenübers aus der Lebenslaufperspektive zu betrachten und setzt somit nicht erst mit der Zeit des Sterbens ein (vgl. Schaeffer 2005, 89). Diese Betrachtungsweise fordert die Pluralität der beteiligten Perspektiven und Werthaltungen ein. Der Bezug auf die letzte Lebensphase intendiert, dass die im folgenden aufgezeigten relevanten Komponenten des Palliative Care Ansatzes nicht erst in den letzten Lebenstagen Gegenstand des professionellen Pflegehandelns werden, denn „. . . die Versorgungsqualität in der Zeit des Sterbens könnte enorm verbessert werden, wenn die sich in den davor liegenden Verlaufsphasen vollziehenden Problemaufschichtungen vermieden werden“ (Schaeffer 2005, 89). Der Schwerpunkt der folgenden Ausführungen liegt darauf, zu erfassen, inwieweit Komponenten des Palliative Care Ansatzes als konzeptionelle Grundlage für die Begleitung von Bewohnerinnen und Bewohnern in der letzten Lebensphase dienen können. Bewusst erfolgt die Formulierung Komponenten des Palliative Care Ansatzes, da im Folgenden zu analysieren ist, ob alle Prämissen des Palliative Care Ansatzes für die Institution stationäre Altenhilfe umfassend sinnvoll zu implementieren und im Pflegealltag konsequent und Ziel führend umsetzbar sind. Der Beitrag zeigt den folgenden Aufbau: In einem ersten Teil wird die gegenwärtige Bedeutsamkeit der Thematik für die stationäre Altenhilfe hervorgehoben, zunächst quantitativ anhand aktueller Zahlen. Im zweiten Teil werden die zentralen Prämissen des Palliative Care Ansatzes aufgezeigt und die Komponenten herausgestellt, die für den Praxisalltag der professionellen Altenpflege von besonderer Relevanz sind. Die Auswahl orientiert sich hierbei an den gegenwärtigen Hausforderungen und Anforderungen in der stationären Altenhilfe. Gegenstand dieses Beitrages ist es somit nicht, eine mögliche Implementierung des Palliative Care Ansatzes in der stationären Altenhilfe zu beschreiben. Diesbezüglich gibt es zwischenzeitlich bereits Projekt-, Struktur- und auch einzelne Prozessbeschreibungen, wenngleich 55 Komponenten des Palliative Care Ansatzes als konzeptionelle Grundlage eine pflegewissenschaftliche Evaluation dieser Projekte zum Teil bislang noch aussteht. Ziel ist es vielmehr, den Fokus auf die inhaltliche Auseinandersetzung des Palliative Care Ansatzes zu lenken, inwiefern dieser und/ oder welche konkreten Komponenten der qualitätvollen und würdevollen Begleitung älterer Menschen in ihrer letzten Lebensphase dienen können. Es geht also nicht um die Wege und Strategien der Implementierung des Palliative Care Ansatzes in die stationäre Altenhilfe, sondern vielmehr um die (pflege-)fachliche Reflexion, den Nutzen für die professionelle, qualitätvolle und würdevolle Pflege in den Einrichtungen betreffend. Hierbei gilt es im Folgenden parallel deutlich zu machen, dass die Altenhilfe – wie alle Sektoren im Gesundheitswesen – Verbesserungspotenziale aufweist, aber dass von einer Misere der Versorgung in den überwiegenden Einrichtungen nicht die Rede sein kann und nicht sein darf. Vielmehr geht es um eine gesellschaftliche Aufwertung der äußerst anspruchsvollen Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der stationären Altenhilfe. Vielleicht ist es sogar möglich, dass durch die konsequente pflegefachliche Umsetzung des Palliative Care Ansatzes das Image der Altenhilfeeinrichtungen positiv beeinflusst wird, dann, wenn deutlich wird, dass dieser Ansatz eine menschenwürdige und an der Lebensqualität orientierte Begleitung in der letzten Lebensphase intendiert und unterstützt. Den Abschluss der Ausführungen bilden Thesen, die einerseits das Ziel verfolgen ergänzend zu sensibilisieren und andererseits nochmals zentrale Aspekte zusammenfassend hervorheben. Bezogen auf die Literaturauswahl wurde einerseits die zu der Thematik vorliegende pflege- und sozialwissenschaftliche Literatur genutzt sowie explizit Literatur aus der Gerontologie, die neben der Pflegewissenschaft eine der zentralen Bezugswissenschaften für die Altenpflege darstellt. 1.1 Stationäre Altenhilfe – Zahlen und Fakten Die demografische Entwicklung stellt die größte sozialpolitische und pflege- sowie medizinethische Herausforderung in den kommenden Jahrzehnten dar (vgl. Bundesministerium für Familien, Frauen, Senioren und Jugend 2007, 28–33; vgl. Baumann-Hölzle 2007, 237–327; vgl. Husebø, S. 2006, 122). Diesbezüglich ist die kontinuierlich steigende Lebenserwartung bedeutsam sowie die Zunahme hochaltriger Menschen. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko der Pflegebedürftigkeit, so sind derzeit von der Bevölkerung unter 60 Jahren 0,6 Prozent pflegebedürftig, 56 Annette Riedel von den 60- bis 80-Jährigen 3,9 Prozent und von den über 80-Jährigen 23,8 Prozent. Somit führt der steigende Anteil älterer Menschen in unserer Gesellschaft parallel zu einer Zunahme der Pflegebedürftigkeit (Bundesministerium für Gesundheit 2008, 97–98). Im stationären Bereich sind 76,7 Prozent der pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohner über 80 Jahre alt (Bundesministerium für Gesundheit 2008, 27). Diese zentralen Veränderungen sind konsequent zu reflektieren und auf ihre ethischen Implikationen hin zu analysieren. Die Modernisierung und die zunehmende Ausdifferenzierung in der Gesellschaft führen dazu, dass die stationären Altenhilfeeinrichtungen zunehmend zu Orte werden, in denen Menschen – vor allem Hochaltrige – ihre letzte Lebensphase verbringen (vgl. Bräutigam 2008, 2–5; vgl. Kruse 2007, 37–39; vgl. Bundesministerium für Familien, Frauen, Senioren und Jugend 2007, 25; vgl. Pleschberger 2005, 13, 257; vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2008, 59–60). Die Zahl der pflegebedürftigen älteren Menschen in den vollstationären Einrichtungen ist seit 1994 um 52 Prozent gestiegen (vgl. Bundesministerium für Familien, Frauen, Senioren und Jugend 2007, 57–59, 92; vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2008, 59–60). Der Umzug in die stationäre Altenhilfeeinrichtung erfolgt vielfach erst dann, wenn alternative Versorgungsformen nicht mehr ausreichen, formelle und informelle Hilfenetzwerke die begrenzte Alltagskompetenz des älteren Menschen nicht mehr kompensieren können und die Pflegebedürftigkeit bereits ein gewisses Ausmaß angenommen hat, so dass der Verbleib im häuslichen Umfeld nicht mehr vertretbar ist (vgl. Bräutigam 2008, 2; vgl. Bundesministerium für Familien, Frauen, Senioren und Jugend 2007, 26, 90–93; vgl. Bundesministerium für Familien, Frauen, Senioren und Jugend 2006, 108). Statistiken zufolge verstirbt mehr als ein Fünftel der Bewohnerinnen und Bewohner (22 Prozent) innerhalb der ersten sechs Monate und etwa ein Drittel innerhalb des ersten Jahres nach Umzug in die Institution. Bei ebenfalls einem Fünftel (22 Prozent) beläuft sich die Verweildauer auf fünf Jahre und länger. Im Vergleich zum Jahr 1994 hat sich die Verweildauer von durchschnittlich 56 Monate auf 41 Monate reduziert. Diese Durchschnittswerte variieren allerdings einrichtungsbezogen und regional (vgl. Bundesministerium für Familien, Frauen, Senioren und Jugend 2007, 130–133). Bezogen auf die gesamte Gruppe der Verstorbenen verbrachten nahezu 30 Prozent ihre letzte Lebensphase in einer Einrichtung der stationären Altenhilfe (vgl. Kruse 2007, 38). Die stationäre Altenhilfe wird somit sozial und kulturell zu einem „symbolischen Übergangsraum“, wie es Gross nennt, in dem die 57 Komponenten des Palliative Care Ansatzes als konzeptionelle Grundlage Trennungsarbeit und die Begleitung in der letzten Lebensphase Dauercharakter hat (Gross 2005, 159). Da alte Menschen in unserer Gesellschaft die Mehrzahl der Sterbenden ausmachen, ist die Bedeutsamkeit der Entwicklungen im Bereich der Palliative Care für diese Zielgruppe offensichtlich. Es wird anhand der Zahlen erkennbar, dass stationäre Pflegeeinrichtungen – nicht nur bislang – sondern auch zukünftig eine Institutionsform sein werden – unabhängig von den jeweils diskutierten konzeptionellen Ausrichtungen und Novellierungsbestrebungen – die vor der Herausforderung einer steigenden Pflege- und Betreuungsintensität stehen. Diese ist verbunden mit der Anforderung schwerstkranke und hochaltrige Bewohnerinnen und Bewohner in ihrer letzten Lebensphase qualitätvoll und würdevoll zu begleiten. Der Palliative Care Ansatz bietet für die Erfordernisse wertvolle Impulse und kann dazu beitragen, die pflegerischen Intentionen und Anforderungen fachlich zu stützen und zu untermauern. Der Ansatz bietet neben seinen Angeboten zur konzeptionellen Fundierung zugleich Optionen zum Perspektivenwechsel und zur pflegefachlichen Reflexion. 2 Komponenten des Palliative Care Ansatzes als konzeptionelle Grundlage in der stationären Altenhilfe 2.1 Relevanz eines Konzeptes Der Palliative Care Ansatz legt sich auf keinen Versorgungssektor fest (vgl. Kloke 2009, 6; vgl. Heimerl 2006, 124). Palliative Care wird auch als ein „interdisziplinäres, interprofessionelles und interorganisationales Versorgungskonzept“ beschrieben (Heller u.a. 2003, 361). „Konzeptionell würde eine Integration von Palliative Care in die Regelversorgung der stationären Pflegeeinrichtungen eine Transformation der strukturellen, der professionellen und ökonomischen Rahmenbedingungen in Richtung palliativer Kultur bedeuten“ (Heller u.a. 2003, 361). Dieser Schritt – die vollständige Implementation und Integration des Ansatzes in eine Institution der stationären Altenhilfeeinrichtung – ist vor dem Hintergrund, dass der Ansatz im Kontext der Hospizstruktur und Hospizkultur entwickelt wurde, im Kontext des Implementierungsprozesses konse58 Annette Riedel quent zu reflektieren. Denn es kann nicht per se davon ausgegangen werden, dass ein bestimmtes Konzept dieselbe Relevanz in unterschiedlichen Institutions- und Pflegekulturen hat. Zunächst gilt es infolgedessen die Kompatibilität zu analysieren, das heißt zu prüfen, welche der Prämissen des Palliative Care Ansatzes decken sich mit dem gegenwärtigen gesellschaftlichen und professionellen Auftrag an die Pflege und Versorgung älterer Menschen und welche der Prämissen können im Sinne einer würdevollen und an der Lebensqualität orientierten Versorgung zu einem Perspektivenwechsel oder sogar zu einer Steigerung der Pflege- und Lebensqualität für die älteren Bewohnerinnen und Bewohner beitragen. Somit wird einem potenziellen Transfer die verantwortungsvolle Analyse vorangestellt. Dies auch angesichts knapper Ressourcen und vorhandener (sozialgesetzlicher) Rahmenbedingungen, die kurzfristig nicht veränderbar sind. Praxisorientiert und nachhaltig erscheint es, nach der Analyse die erfassten Komponenten des Palliative Care Ansatzes im Rahmen eines Pflegekonzeptes – mit dem Ziel „Klarheit und Transparenz hinsichtlich des pflegerischen Handelns herzustellen“ (Elsbernd 2008, 56) – in die Pflegepraxis zu implementieren. Die theoretische Verankerung des Konzeptes orientiert sich folgerichtig an dem Palliative Care Ansatz und seinen fachlichen Bezügen. Der Einführung und Umsetzung würde demzufolge eine Analyse vorausgehen, die die Kompatibilität des Palliative Care Ansatzes für die stationäre Altenhilfe erfasst sowie die Entwicklung eines Pflegekonzeptes mit seinen spezifischen Elementen (vgl. Elsbernd 2008, 58). Somit werden die Komponenten des Palliative Care Ansatzes Teil eines handlungsleitenden Konzeptes in der stationären Altenhilfe. Dieses Konzept dient der Nachhaltigkeit, der Transparenz und der Orientierung in Institutionen, an die vielfältige pflegerische und qualitätsförderliche Anforderungen herangetragen werden. Dieses Vorgehen beschreibt einen konkreten Organisationsentwicklungsprozess, im Sinne einer „Lernenden Organisation“ (vgl. Haskamp & Remmers 2008, 37) – mit all seinen intendierten Schritten – mit dem Ziel, Veränderungen in der Organisationskultur zu bewirken und der Intention einer tief greifenden und fortwährenden Umsetzung der erfassten Komponenten des Palliative Care Ansatzes in der Einrichtung. Diese werden im Folgenden des Beitrages ausgeführt. An dieser Stelle ist es indiziert auf den erheblichen Druck der Pflegenden und der Pflegeeinrichtungen hinzuweisen, der ihnen durch extern definierte Kriterien der Pflegequalität auferlegt werden. Die an den Prüfkriterien orientierte Aufsichtsorgane der stationären Altenhilfe richten gegen59 Komponenten des Palliative Care Ansatzes als konzeptionelle Grundlage wärtig ihr Augenmerk noch auf objektiv messbare Einzelkriterien wie Gewichtsverlust, Hydrationszustand, Lagerungssequenzen oder den Anteil bettlägeriger Bewohnerinnen und Bewohner in den Einrichtungen (vgl. Medizinischer Dienst der Krankenkassen 2007). Die Prämissen der Qualität einer individuellen palliativen Pflege, orientiert an den zielgruppen- und einrichtungsbezogenen Komponenten des Palliative Care Ansatzes finden dabei noch wenig Berücksichtigung. In diesem Kontext ist die konzeptionelle Fundierung und die professionelle Pflegedokumentation von besonderer Relevanz um pflegefachlich – auch gegenüber den Prüfinstanzen – argumentieren zu können. Der Erfolg der Implementierung wie auch die Qualität der Umsetzung hängen wesentlich vom Gelingen des Zusammenspiels zwischen den bewohnerInnenbezogenen Bedürfnissen und den institutionellen Erfordernissen und Anforderungen ab. 2.2 Prämissen und Anforderungen des Palliative Care Ansatzes Die WHO definiert Palliative Care als „Lindern eines weit fortgeschrittenen, unheilbaren Leidens mit begrenzter Lebenserwartung durch ein multiprofessionelles Team mit dem Ziel einer hohen Lebensqualität für den Patienten und seine Angehörigen . . .“ (in: Wilkening und Kunz 2005, 84; vgl. WHO 2002 in: Radbruch, Nauck, Aulbert 2008, 2; vgl. WHO, Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin 2008, 14). Deutlich wird in der Definition, dass der Palliative Care Ansatz nicht eine bestimmte Altersgruppe hervorhebt oder ausschließt (vgl. Kloke 2009, 4) oder sich auf einen definierten Versorgungssektor festlegt (vgl. Kloke 2009, 6; vgl. Heimerl 2006, 124). Im Vordergrund steht der Erhalt oder sogar die Verbesserung der Lebensqualität für den Menschen. Offensichtlich wird ferner, dass sich Palliative Care nicht nur an Sterbende richtet, sondern an Menschen mit einer begrenzten Lebenserwartung und somit auch an Menschen mit fortschreitenden Krankheiten, die noch eine Lebenserwartung von Monaten oder sogar Jahren haben. Bewohnerinnen und Bewohner der stationären Altenhilfeeinrichtungen haben in der Regel nicht heilbare, progrediente Erkrankungen, eine begrenzte Lebenserwartung und die Hoffnung und den Wunsch die ihnen verbleibende Zeit würdevoll und mit größtmöglichster Lebensqualität zu erleben. Sie benötigen nicht nur menschliche Begleitung in ihrer letzten Lebensphase sondern fachlich 60 Annette Riedel kompetente Pflege, wie es unter anderem der Palliative Care Ansatz beschreibt. Die WHO erstellt 2002 eine Definition für ein Betreuungskonzept zur Begleitung von Sterbenden, das die folgenden Komponenten umfasst: „Palliative Care · lindert Schmerzen und andere belastende Beschwerden; · bejaht das Leben und betrachtet das Sterben als normalen Prozess; · will den Tod weder beschleunigen noch verzögern; · integriert psychische und spirituelle Aspekte; · bietet jede Unterstützung, um dem Patienten zu einem möglichst aktiven Leben bis zum Tod zu verhelfen; · steht den Familien bei der Verarbeitung seelischer Probleme während der Krankheit des Patienten und nach dessen Tod zur Seite; · arbeitet multi- und interdisziplinär, um den Bedürfnissen von Patienten und Angehörigen gerecht zu werden; · verbessert die Lebensqualität und kann so positiven Einfluss auf den Krankheitsverlauf nehmen; · kann frühzeitig in der Erkrankung angewendet werden in Kombination mit lebensverlängernden Maßnahmen, wie beispielsweise Chemo- und Radiotherapie; · beinhaltet auch die notwendige Forschung, um Beschwerden oder klinische Komplikationen besser verstehen und behandeln zu können“ (WHO 2002 in: Seeger u.a. 2007, 4; vgl. www.who.int/cancer/palliative/en/ aufgerufen am 23.02.2009; vgl. Steffen-Bürgi 2007, 31; vgl. WHO 2002 in: Radbruch, Nauck, Aulbert 2008, 2; vgl. WHO, Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin 2008, 14). Im Zentrum steht das „care“ versus dem „cure“. Care wird im Deutschen nur unzureichend mit „Fürsorge“ wiedergegeben. In deutschsprachigen Übersetzungen wird caring neben Fürsorge auch mit „menschlicher Zuwendung“ (Watson 1996) oder „Sorge“ (Benner & Wrubel 1997) in Verbindung gebracht. Caring wird für die „Beschreibung einer von Mitmenschlichkeit geprägten pflegenden Beziehung“ verwendet (Käppeli 2004, 69). Der Pflegetheoretikerin Watson zufolge bezeichnet Caring eine Grundhaltung, die seitens der Pflegenden „ein starkes persönliches, soziales, moralisches und spirituelles Engagement“ einfordert (Watson 1996, 46). Die aus dem Caring-Konzept heraus erwachsenden Haltungen sind der Pflegewissenschaftlerin Käppeli folgend „gleichzeitig emotional und ethischmoralisch sowie manchmal religiös motiviert“ (Käppeli 61 Komponenten des Palliative Care Ansatzes als konzeptionelle Grundlage 2004, 72). Wallner zufolge nimmt Care „den Menschen in seiner Fragmenthaftigkeit und Endlichkeit ernst und lässt ihn mit seinen Bedürfnissen nicht im Stich. Care nimmt (. . .) auch die sittliche Autonomie des Menschen ernst, d. h. den Anspruch, dem eigenen Leben Sinn und Ziel zu geben“ (Wallner 2004, 2; vgl. Eibach 2005, 23). Angelehnt an den Begriff „active total care“, der sich in der Originaldefinition der WHO wieder findet (vgl. WHO, Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin 2008, 14), sind zwei zentrale Aspekte des Ansatzes zu erfassen: die ressourcenorientierte und salutogenetische Ausrichtung der Betreuung von Menschen in der letzten Lebensphase und die und die Abkehr von einem paternalistischen Betreuungsverständnis (vgl. Steffen-Bürgi 2007, 32). Das heißt, die individuellen Ressourcen des Menschen, seine Anteile zur Selbsthilfe und seine Selbstbestimmung stellen zentrale Werte im Betreuungs- und Versorgungskontext dar. Es wird deutlich, dass bei diesem Ansatz ein hohes Maß professioneller Handlungskompetenz gefordert ist, es geht um eine pflegeberufliche Expertise, die Kommunikations-, Interaktionskompetenzen, Empathie und Reflexion einfordert. Im Ansatz der Palliative Care, wie ihn die WHO definiert und fordert (vgl. WHO 2002 in: Radbruch, Nauck, Aulbert 2008, 2; vgl. WHO, Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin 2008, 14), wird neben der physischen, psychischen und sozialen Unterstützung auch die spirituelle Begleitung aufgeführt. Die Berücksichtigung der spirituellen Bedürfnisse wird als genuiner Gegenstand bezüglich der höchstmöglichen Lebensqualität gewertet. Mehrfach wird in der Literatur auf die Relevanz des Ansatzes für Menschen mit Demenz hingewiesen (vgl. Heller & Pleschberger 2008, 22–23; vgl. Kojer 2008, 2629; vgl. Kostrzewa 2008, vgl. Buchmann 2007; vgl. Perrar 2007). Dieser Aspekt ist für die stationäre Altenhilfe vor dem Hintergrund bedeutsam, da der Anteil der Bewohnerinnen und Bewohner mit demenziellen Erkrankungen in den Einrichtungen mit etwas 69 Prozent sehr hoch ist (Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend 2007, 105). Die Besonderheit des Palliative Care Ansatzes besteht darin, dass dieser per se Wertvorstellungen beinhaltet, die einerseits die ethische Reflexion unterstützen und andererseits ethische Fragestellungen provozieren können. Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, die Wertesysteme des Ansatzes zu erfassen und zu reflektieren. Dies, um im Rahmen der Ethikberatung über ein (gemeinsames) Verständnis und die indizierte Sensibilität dahingehend zu verfügen. 62 Annette Riedel Als eine zentrale Zielsetzung und Aufgabe des Palliative Care Ansatzes wird die Verbesserung und/oder der Erhalt der Lebensqualität definiert (vgl. Voltz 2007, 6; vgl. Ohnsorge 2007, 106; vgl. Radbruch, Nauck, Aulbert 2008, 2, 10; vgl. Aulbert 2008, 15; vgl. Müller-Busch & Aulbert 2008, 46). Als Maßstab tritt nunmehr das subjektive Erleben und Befinden, die spezifische Individualität in den Mittelpunkt. Das heißt, es wird der Auftrag formuliert zu erfassen, was für den gepflegten und begleiteten älteren Menschen individuell und aktuell Lebensqualität bedeutet. Es geht um die Werteanamnese, die jeweils den individuumsbezogenen körperlichen, spirituellen, seelischen, sozialen und kulturellen Bereich erfasst. Allerdings muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass der vielfach strapazierte Begriff der Lebensqualität unbestimmt ist (vgl. Aulbert 2008, 16; vgl. Riedel 2007, 459–465; vgl. Peintinger 2008, 147–148). Der Begriff ist stets im Kontext des subjektiven Erlebens und der Bewertung des Individuums zu definieren, es handelt sich hierbei um einen multiplen und hochindividuellen Aspekt. Lebensqualität kann letztlich nicht von anderen erlebt, beschrieben und bewertet werden. Der Palliative Care Ansatz beansprucht die Verbesserung der Lebensqualität und erhebt somit die Lebensqualität – trotz der Problematik der Objektivierung – zur Bewertungsgröße. Das positive Bestreben kann zu einer ethischen Thematik werden, dann wenn ideologische und/oder ökonomische Argumente in die Bewertung der Lebensqualität einfließen und anstehende Entscheidungsfindungsprozesse – zum Beispiel Pflege- und Therapieentscheidungen – tangiert sind. Für die potenziellen Risiken der „Fremdbeurteilung von Lebensqualität“ (Aulbert 2008, 20) und der damit möglicherweise verbundenen Interessenskollisionen, gilt es konsequent zu sensibilisieren. Kompetenz genuiner Gegenstand professionellen pflegerischen Handelns ist. Ethische Fragestellungen tangieren zunehmend auch die stationäre Altenpflege und nicht erst dann, wenn es um die Fragestellung PEGSonde ja oder nein geht. Ethische Fragestellungen sind vor dem Hintergrund der sich verändernden Anforderungen an die stationäre Altenhilfe vielfältiger und komplexer. „Komplexe ethische und rechtliche Fragen am Lebensende bedingen sowohl einen ausführlichen gesellschaftlichen Dialog, als auch eine intensive Kommunikation aller Beteiligten im Einzelfall“ (Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, Deutscher Hospizund PalliativVerband e.V. 2008). Nimmt man diese Forderung der „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen“ ernst, ist die konsequente Implementierung von Ethikberatung im Altenhilfesektor anzustreben. 63 Komponenten des Palliative Care Ansatzes als konzeptionelle Grundlage So ist die reflexive Auseinandersetzung mit dem zentralen Spannungsfeld zwischen Autonomie und Fürsorge im Pflegealltag vielfach präsent, in besonderer Weise in der letzten Lebensphase eines Menschen (vgl. Müller-Busch & Aulbert 2008, 56–58). Die Autonomie der BewohnerInnen, ihr/sein Recht auf Selbstbestimmung spielen in der Pflegeethik eine entscheidende Rolle. Die Autonomie der BewohnerInnen wie auch die Fürsorge in der spezifischen Bedarfs- und Bedürfnislage der letzten Lebensphase werden zu zentralen Qualitätsdimensionen der professionellen Pflege. Unter ethischen Gesichtspunkten fordern diese beiden – häufig im Spannungsfeld befindlichen – Dimensionen einen dialogischreflexiven Pflegeansatz mit bewusster Subjekt- und Würdeorientierung. Grundlegend sind professionelle Formen der Aushandlung (vgl. Elsbernd & Stolz 2008, 57–58) und ethische Verfahren der Reflexion sowie eine konsequente und bewusste Wertorientierung. Wenngleich ethische Reflexion nicht alle ethischen Fragestellungen lösen kann, so kann sie doch zur Klärung, und zu einer wertorientierten intensiven fachlichen Auseinandersetzung beitragen, indem sie den beteiligten ihre Einstellungen und Überzeugungen bewusst macht. Die Achtung der Autonomie beschränkt sich in keinster Weise nur auf entscheidungsfähige Personen, vielmehr hat jeder Mensch einen „moralischen Anspruch auf die Achtung seiner Würde und Autonomie“ (Rehbock 2005a, 331–335; Rehbock 2005b, 383; vgl. Bobbert 2002, 227, 253). Denn in Situationen der Schwäche, der Unterlegenheit, der Verletzlichkeit und der Hoffnungslosigkeit ist die Würde besonders verletzbar. Die Achtung der Menschenwürde wird zu einem „übergeordneten Orientierungspunkt“ mit zwei Aspekten: „die Achtung der Autonomie und die Pflicht zu Fürsorge für das Wohl des Anderen“ (Rehbock 2005b, 384). Bezogen auf die Fürsorge geht es um eine „von vornherein nicht paternalistisch“ orientierte Fürsorge, die das Gegenüber in seiner Würde achtet und ihm Möglichkeiten zur „autonomen Selbstsorge“ eröffnet (Rehbock 2005a, 327–330; Hervorhebungen im Original), oder mit der ethischen Kategorie von Kruse gesprochen (vgl. Kruse 2007, 201) geht es um eine Fürsorge, die Möglichkeiten und Raum zur „Selbstverantwortung“ bietet. Pflegeethik wird umschrieben als „Nachdenken über menschliches Handeln aus der Perspektive der Menschenwürde“ (vgl. van der Arend & Gastmans 1996, 31). Dementsprechend fordert Ethik als Nachdenken über verantwortliches Handeln im Rahmen der Berufsausübung eine konsequente ethisch-moralische Reflexion. Ethik fragt nach den voraussehbaren Folgen des Tuns oder Unterlassens und verhindert durch rationale Abwägungsprozesse die Be64 Annette Riedel liebigkeit von Entscheidungen (vgl. van der Arend & Gastmans 1996, 36). So wird das ethische Nachdenken in der Palliative Care – vergleichbar zu anderen Situationen, die ethische Denk- und Abwägungsprozesse intendieren – durch moralische Irritationen ausgelöst, die die Gestalt eines Konfliktes oder eines Dilemmas annehmen können. Gerade Grenzsituationen bilden vielfältige Anlässe zur ethischen Reflexion. Vielfach geht es bezogen auf die letzte Lebensphase eines Menschen auch um die Fragestellung, ob all das was getan werden kann, auch getan werden soll. Der Palliative Care Ansatz gibt uns in vier Aussagen in sehr allgemeiner Form eine Orientierung zu potenziellen ethischen Fragstellungen: · lindert Schmerzen und andere belastende Beschwerden; · bejaht das Leben und betrachtet das Sterben als normalen Prozess; · will den Tod weder beschleunigen noch verzögern; · verbessert die Lebensqualität und kann so positiven Einfluss auf den Krankheitsverlauf nehmen; . . . (WHO 2002 in Seeger u.a. 2007, 4; vgl. www.who.int/cancer/palliative/en/ aufgerufen am 23.02.2009; vgl. Steffen-Bürgi 2007, 31; vgl. Student & Napiwotzky 2007, 10). Monteverde fasst diese Komponenten mit folgenden zwei Grundintuitionen zusammen: „Leiden lindern“ und „Warten können“ (Monteverde 2007, 523). Ethik in der Palliative Care fordert keinen spezifischen ethischen Problemlösungsprozess. Es können auf die bereits vorliegenden Instrumente der ethischen Entscheidungsfindung/Ethikberatung zurückgegriffen werden (vgl. Vollmann 2008). Ziel ist es, Entscheidungen so zu treffen, dass sie einen Beitrag zur Pflege- und Lebensqualität leisten und die Würde der Beteiligten sichern. Ethische Grundüberzeugungen und die konsequente ethische Reflexion des pflegeberuflichen Handelns sind konstitutiv für die pflegeberufliche Tätigkeit, die sich an den Komponenten des Palliative Care Ansatzes ausrichtet. Zentrale Prämissen sind hierbei der Respekt der Menschenwürde, der Schutz der Identität und Integrität der Person sowie die Achtung der Bewohnerinnen und Bewohner als Subjekte selbst bestimmten Verhaltens (vgl. Peintinger 2008, 25–26). Die ethisch-moralische Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist vor diesem Hintergrund obligat (vgl. Rabe 2009, 208–209). Ein ergänzender Ansatz im Kontext ethischer Fragestellungen in der letzten Lebensphase können die ethischen Kategorien der Selbstverantwortung sein (vgl. Kruse 2007, 202–211). Bezug nehmend auf das Zitat von 65 Komponenten des Palliative Care Ansatzes als konzeptionelle Grundlage Cicely Saunders „Wir werden alles tun, damit du nicht nur in Frieden sterben kannst, sondern damit Du leben kannst bis Du stirbst“ (in Kruse 2000, 31) knüpft der Gerontologe Kruse an die ethische Kategorie der Selbstverantwortung an. Gerade in der letzten Lebensphase eines Menschen spielen die Fragen nach den Möglichkeiten und Grenzen eines selbstverantwortlichen Lebens eine zentrale Rolle. Selbstverantwortung definiert der Gerontologe als „die Fähigkeit und Bereitschaft des Individuums, den Alltag in einem den eigenen Leitbildern eines guten Lebens entsprechenden, d.h. den eigenen Bedürfnissen, Normen und Werten folgenden Art und Weise zu gestalten und sich reflektiert mit der eigenen Person (. . .) sowie mit den Anforderungen und Möglichkeiten der persönlichen Lebenssituation auseinanderzusetzen“ (Kruse 2001, 38f.). Die Selbstverantwortung bezieht sich somit in besonderer Weise auf die Grundwerte des Menschen, den Wert des Lebens, des Bewusstseins, der Willensfreiheit, der Fähigkeit Ziele zu definieren und diese umzusetzen. Die Selbstverantwortung ist Kruse zufolge insbesondere dann bedeutsam, wenn der Mensch in „Grenzsituationen“ steht, da diese Situationen Antworten und Reaktionen des Menschen herausfordern (vgl. Kruse 2005, 282). Spirituelle Bedürfnisse Die zunehmende Hochaltrigkeit und die damit steigende Vulnerabilität des Organismus führen dazu, dass ältere Menschen im höheren und hohen Alter in einer immer größeren Dichte mit Grenzsituationen des Lebens konfrontiert werden. Vermehrt müssen in der letzten Lebensphase Verhaltensalternativen und Formen der Kompensation gesucht und trainiert werden. Das Leben stellt nun konkrete Entwicklungsaufgaben und -konflikte, wie zum Beispiel die „Auseinandersetzung mit Zeitlichkeit und Vergänglichkeit“ sowie der „Sinn- und Identitätsfindung“ (Peters 2004) und fordert eine reflektierte und verantwortliche Auseinandersetzung mit der letzten Lebensphase und der eigenen Endlichkeit (vgl. Kruse 2007; vgl. Lämmermann 2006, 302). Die letzte Lebensphase weckt unterschiedliche Vermutungen, führt zu Ängsten und ist zugleich von einer intensiven Beschäftigung mit dem eigenen Leben geprägt. Die Auseinandersetzung fordert neben einer ethisch-moralischen Haltung eine spirituelle Reflexion. Das Erleben des Alter(n)s, das Näherrücken des Todes und das Gewahrwerden der eigenen Endlichkeit sind starke Impulse sich mit der „Sinnfrage“ auseinanderzusetzen. Religiosität und Spiritualität beziehen sich auf die Sinnfrage. Wenngleich sie nicht die einzigen Ant66 Annette Riedel worten auf Sinnfragen im Alter sind, so sind sie doch wesentlich (vgl. Oser & Bucher 2005, 821). So deutet die Suche des Menschen auf eine letzte Antwort auf zentrale Fragen des Lebens, auf spirituelle Fragen hin (vgl. Kruse 2007, 133). In welchem Ausmaß Spiritualität in den Aufgabenbereich der professionellen Pflege gehört, ist noch offen. Eine erste Annäherung an das Thema bietet Stevens-Barnum (2002). Nur wenige Pflegetheorien greifen diesen Aspekt auf (vgl. Leininger 1978; vgl. Watson 1996). Die Gerontologie befasst sich seit geraumer Zeit mit der spirituellen Auseinandersetzung älterer Menschen (vgl. Bucher 2007; vgl. Utsch 2005; vgl. Sperling 2004; vgl. Lamprecht 2006; vgl. Kruse 2007). So sind im europäischen und deutschsprachigen Raum Ansätze einer „religiösen Gerontologie“ entstanden (vgl. Lehr 2007, 151). Religiosität und Spiritualität sind keine selbstverständliche Domäne des Alters oder der letzen Lebensphase, aber sie gehören zum Menschen, als Potenzial und Ressource (vgl. Sperling 2004, 633–641), die in dieser Lebensphasen von besonderer Bedeutung für den gelingenden Umgang mit Grenzsituationen sein kann (vgl. Lamprecht 2006, 253ff.; vgl. Sperling 2004, 636; vgl. Oser & Bucher 2005, 815, 820). Der Palliative Care Ansatz fordert explizit die Integration der spirituellen Aspekte. Somit erlangt diese zentrale Komponente in der Begleitung älterer Bewohnerinnen und Bewohner eine klare Verortung. Ergänzend findet sich die spirituelle Dimension im „Total Pain“ Ansatz (vgl. Steffen-Bürgi 2007, 32; vgl. Heller & Knipping 2007, 41). Symptom- und Schmerzlinderung Schmerzen spielen als häufiges Symptom älterer Menschen eine zentrale Rolle (vgl. Weyerer u.a. 2008, 191ff.). Selbst nach vorsichtigen Schätzungen gehen Expertinnen und Experten davon aus, dass 25 Prozent der älteren Menschen unter ständig vorhandenen oder rezidivierenden Schmerzzuständen leiden. Unbestritten ist auch, dass „in Pflegeheimen die Prävalenz von chronischen Schmerzen deutlich höher liegt, als in einer vergleichbaren Alterskohorte, die zu Hause lebt. Die Schätzungen reichen von 45–80 Prozent“ (Nikolaus & Schuler 2000, 377). Ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohnern litten gemäß den Angaben an kontinuierlichen Schmerzen, zwei Drittel gaben intermittierend auftretende Schmerzzustände an. Und obgleich die Inzidenz chronischer Schmerzen im Alter zunimmt, ist eine Reduktion der Zahl verordneter Analgetika zu verzeichnen (vgl. Nikolaus & Schuler 2000, 377). Deutlich wird, Schmerz bei älteren Menschen ist ein „unterbewertetes und unterbehan67 Komponenten des Palliative Care Ansatzes als konzeptionelle Grundlage deltes Problem“ (Welt Hospiz- und Palliative Care Tag 2007, Kernaussagen). Da Schmerzen in erheblichem Maße die Lebensqualität der betroffenen Menschen beeinflusst, ist deren Behandlung und Berücksichtigung im Pflegealltag von hoher Signifikanz. In besonderer Weise ist die Aufmerksamkeit auf die Schmerzerfassung und die Schmerztherapie von Menschen mit Demenz zu lenken (vgl. Husebø S. 2006, 359–404; vgl. Schmidl 2009, 235–245). Das Schmerzmanagement verlangt hier eine besondere Kompetenz der Schmerzbeobachtung und der Schmerzerfassung, das heißt, die Verhaltensweisen die auf Schmerzen hindeuten zu erfassen und angemessen zu interpretieren (vgl. Kojer 2007, 82–83; vgl. Wilkening & Kunz 2005, 89–93). Das Ziel des Palliative Care Ansatzes ist es, vorhandene Schmerzen und belastende Beschwerden/Symptome so weit wie möglich zu lindern. Somit formuliert der Ansatz für die professionelle Begleitung in der letzten Lebensphase einen klaren Auftrag, der Thematik zukünftig einen höheren Stellenwert im Pflegealltag beizumessen. Als hilfreich und unterstützend kann sich diesbezüglich die Implementierung des nationalen Expertenstandards erweisen (Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege, 2005). Trauerbegleitung Deutlich wird, dass ein Aspekt im Bereich der stationären Altenhilfe, im Vergleich zu den bereits aufgeführten Komponenten des Palliative CareAnsatzes, einen geringeren Stellenwert einnimmt: die Trauerbegleitung der Angehörigen über den Tod der BewohnerInnen hinaus. Dieser Anspruch ist in einem umfassenden, begleitenden Sinne in der stationären Altenhilfe nicht realisierbar. Relevant und unerlässlich ist jedoch die Begleitung der Angehörigen/Bezugspersonen im Verlauf der letzen Lebensphase der BewohnerInnen. Obligat ist ferner die Trauerarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – sowohl bezogen auf die Fach- als auch auf die Hilfskräfte, bezogen auf die Pflegekräfte wie auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Bereichen, die mit den Bewohnerinnen und Bewohnern im Kontakt sind. Unentbehrlich ist ergänzend eine Kultur der Trauer und des Trauerns mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, die eine gewisse (Lebens-)Zeit mit der Verstorbenen auf dem Wohnbereich verbracht haben. Respekt, Sensibilität und Offenheit sowie Raum für Emotionen und hilfreiche Rituale sind zentrale Aspekte einer zugewandten Trauer- und Abschiedskultur in der stationären Altenhilfe. 68 Annette Riedel Interdisziplinarität Eine weitere Komponente die aufgrund der Rahmenbedingungen in der stationären Altenhilfe Einschränkungen einfordert, ist die Arbeit im interdisziplinären Team. Dies entlastet allerdings nicht von den Bemühungen um eine konstruktive und verlässliche Zusammenarbeit mit kooperierenden Ärzten und Seelsorgern. Bezogen auf die inhaltliche Ausrichtung der Pflege, die unter Berücksichtigung der Komponenten des Palliative Care Ansatzes praktiziert wird, unterscheidet sich diese somit von der Pflege in anderen Versorgungskontexten teilweise prinzipiell, zum Teil graduell. Die Besonderheiten in der letzten Lebensphase verändern die Richtung und die Gewichtung bestimmter Prinzipien in der Pflege, die Berücksichtigung personenbezogener Konzepte erhält eine andere Bedeutung (vgl. Käppeli 2007, 119). Bewusst sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass es nicht das Ziel stationärer Altenhilfeeinrichtungen sein kann und sein darf, den Anspruch stationärhospizlicher Aufgaben vollständig in die Einrichtungen zu übertragen. Dies wäre auch vor dem Hintergrund unterschiedlicher Institutionskulturen, -strukturen und Organisationsformen mit den jeweils systemimmanenten Besonderheiten und den jeweils spezifischen rechtlichen und finanziellen Status problematisch und würde zwangsläufig an Grenzen stoßen. Vielmehr soll es darum gehen – im Sinne einer würdevollen und qualitätvollen Begleitung der BewohnerInnen in ihrer letzten Lebensphase – die einrichtungs- und zielgruppenbezogenen und somit praxisrelevanten Komponenten des Palliative Care Ansatzes eingebunden in ein Pflegekonzept in den Pflegealltag zu integrieren. Zusammenfassend werden im Folgenden die Herausforderungen an die qualitätvolle und würdevolle Begleitung älterer Menschen in der letzten Lebensphase den hilfreichen, zielgruppen- und praxisbezogenen und der Orientierung dienlichen Komponenten des Palliative Care Ansatzes gegenübergestellt. Diese Gegenüberstellung kann leitend sein für die Erstellung eines Pflegekonzeptes, das sich an den gegenwärtigen professionellen Anforderungen der stationären Altenhilfe orientiert. 69 Komponenten des Palliative Care Ansatzes als konzeptionelle Grundlage Zusammenfassende tabellarische Gegenüberstellung Herausforderungen an die qualitätvolle und würdevolle Begleitung älterer Menschen in der letzten Lebensphase · · · · · · · · 70 Alle Dimensionen des älteren Menschen im Blick: physisch, psychisch, sozial und spirituell Letzte Lebensphase des älteren Menschen: Entwicklungsaufgabe und Auseinandersetzung mit der Sinnfrage des Lebens (vgl. Kruse 2007) Selbstverantwortung (vgl. Kruse 2007, 201) Menschenwürde (vgl. Peintinger 2008, 23–28) Achtung der Autonomie und Verpflichtung zur Fürsorge (vgl. Rehbock 2005a) Prozesse ethischer Entscheidungsfindung/Ethikberatung (vgl. Vollmann 2008) professionelle lebensweltorientierte Aushandlungsprozesse bezogen auf das Alltagsleben in der letzten Lebensphase (vgl. Elsbernd & Stolz 2008, 57–58) Pflege- und Lebensqualität im Kontext einer angemessenen Symptom- und Schmerzbehandlung Hilfreiche, zielgruppen- und praxisbezogene, der Orientierung dienliche Komponenten und Prämissen des Palliative Care Ansatzes (vgl. Steffen-Bürgi 2007, 30–38) · · · · · · · Das Konzept der aktiven und ganzheitlichen Betreuung (Active Total Care) Ressourcen- und salutogenetischer Betreuungsansatz Schließt psychische und spirituelle Aspekte mit ein Abkehr von einem paternalistischen Betreuungsverständnis ! partizipative Gestaltung der letzten Lebensphase Bejaht das Leben und betrachtet Sterben als einen normalen Prozess Soll den Tod weder beschleunigen noch verzögern Konzept der Lebensqualität 1. Konzept der Lebensqualität 2. Konzept der Symptomkontrolle 3. „Total Pain“-Ansatz Annette Riedel 3 Zusammenfassende Thesen 1. Die erfassten Komponenten des Palliative Care Ansatzes unterstützen die pflegeberufliche Reflexion. Sie regen zu einer Betrachtung der pflegefachlichen Perspektiven und Wertorientierungen an und können für ethisch relevante Widersprüche und Spannungsfelder sensibilisieren. 2. Die erfassten Komponenten des Palliative Care Ansatzes können dazu beitragen, automatisierte Handlungsabläufe zu überdenken und zu ersetzen. 3. Die Komponenten des Palliative Care Ansatzes, die dem Pflegekonzept zugrunde liegen, müssen bezogen auf die Zielgruppe, die Organisationskultur und die Organisationsstruktur kompatibel sein und im Pflegealltag nachhaltig umsetzbar sein. 4. Die würdevolle und individuelle Begleitung älterer Menschen in der letzten Lebensphase bedingt pflegefachliche Kompetenzen. Sie bedarf der Wertorientierung, der konsequenten ethisch-moralischen Reflexion des pflegeberuflichen Handelns und eines stetigen lebenswelt-bezogenen professionellen Aushandlungsprozesses (vgl. Elsbernd & Stolz 2008, 57–58). 5. Trotz der Bedeutsamkeit des Palliative Care Ansatzes sind stationäre Altenhilfeeinrichtungen nicht als Sterbeeinrichtungen zu kategorisieren, denn Sterbebegleitung ist Lebensbegleitung bis zum letzten Atemzug. 6. Bei knappen Ressourcen und kontinuierlichen Deprofessionalisierungs- und Allokationsbestrebungen im Bereich der Gesundheitsversorgung ist es für die stationäre Altenhilfe von besonderer Relevanz, ihren gesellschaftlichen Auftrag transparent darzulegen und ihre pflegefachliche Kompetenz bezogen auf die würdevolle Begleitung älterer Menschen gegenüber der Sozialpolitik und der Gesellschaft zu kommunizieren. „Die Prüfung eines Menschen ist, wie er sich gegenüber den Alten verhält. Es ist einfach, Kinder zu lieben. Selbst Tyrannen und Diktatoren schmücken sich mit ihrer Zuneigung zu Kindern. Aber die Aufmerksamkeit und Fürsorge für alte Menschen, für die Unheilbaren und für die Hilflosen, diese sind die wirkliche Goldgrube einer Kultur“ (Roberts 1996 in: Husebø, S. 2006, 411). 71 Komponenten des Palliative Care Ansatzes als konzeptionelle Grundlage Literatur Aulbert, Eberhard; Nauck, Friedemann; Radbruch, Lukas (Hrsg.): Lehrbuch der Palliativmedizin. 1. Nachdruck der zweiten Auflage. Stuttgart, New York: Schattauer, 2008. Aulbert, Eberhard: Lebensqualität in der Palliativmedizin. In: Aulbert, Eberhard; Nauck, Friedemann; Radbruch, Lukas (Hrsg.): Lehrbuch der Palliativmedizin. 1. Nachdruck der zweiten Auflage. Stuttgart, New York: Schattauer, 2008. Baumann-Hölzle, Ruth: Moderne Medizin – Chance und Bedrohung. Eine Medizinethik entlang dem Lebensbogen. Bern: Peter Lang, 2007. Benner, Patricia und Wrubel, Judith: Pflege, Stress und Bewältigung. Gelebte Erfahrung von Gesundheit und Krankheit. Bern: Verlag Hans Huber, 1997. Bobbert, Monika: Patientenautonomie und Pflege. Begründung und Anwendung eines moralischen Rechts. Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2002. Bräutigam, Christoph: Die stationäre Altenhilfe. Situation, Herausforderung und beispielhafte Entwicklung. Institut Arbeit und Technik der Fachhochschule Gelsenkirchen. Forschung Aktuell (2008) Ausgabe 9. Bucher, Anton A.: Psychologie der Spiritualität. Handbuch. Weinheim, Basel: Beltz Verlag, 2007. Buchmann, Klaus-Peter: Demenz und Hospiz. Sterben an Demenz erkrankte Menschen anders? Wuppertal: der hospiz verlag, 2007. Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz: Hospizkultur im Alten- und Pflegeheim – Indikatoren und Empfehlungen zur Palliativkompetenz. www.hospiz.net/themen/hospizkultur.pdf ; aufgerufen am 23.02.2009. Bundesministerium für Familien, Frauen, Senioren und Jugend: Möglichkeiten und Grenzen selbstständiger Lebensführung in stationären Einrichtungen (MuG IV). München, November 2007. Bundesministerium für Familien, Frauen, Senioren und Jugend: Erster Bericht des Bundesministeriums für Familien, Frauen, Senioren und Jugend über die Situation der Heime und die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner. Stand: 15.08.2006. Bundesministerium für Gesundheit: Vierter Bericht zur Pflegeversicherung. Stand: 25. Januar 2008. 72 Annette Riedel Burkhardt, Heinrich; Sperling, Uwe; Gladisch, R. und Kruse, Andreas: Todesverlangen – Ergebnisse einer Pilotstudie mit geriatrischen Akutpatienten, in: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie (2003) 36: 392–400. Council of Europe: Empfehlung Rec (2003) 24 des Ministerkomitees an die Mitgliedsstaaten zur Strukturierung der palliativmedizinischen und -pflegerischen Versorgung. Verabschiedet durch das Ministerkomitee am 12. November 2003. Davy, John und Ellis, Susan: Palliativ pflegen. Sterbende verstehen, beraten und begleiten. 2., korrigierte und ergänzte Auflage. Bern: Verlag Hans Huber, 2007. Deutscher Bundestag: Ausschnitt aus dem Plenarprotokoll 16/169 (Stenografischer Bericht). 169. Sitzung; Berlin, 19. Juni 2008. Deutscher Bundestag: Zwischenbericht der Enquete Kommission Ethik und Recht der modernen Medizin. Verbesserung der Versorgung Schwerstkranker und Sterbender in Deutschland durch Palliativmedizin und Hospizarbeit. 22.06.2005. Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, Deutscher Hospiz- und Palliativverband e.V. und Bundesärztekammer: Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen (Entwurf). Stand: 03.09.2008. Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP): Begriffsdefinitionen, in: Zeitschrift für Palliativmedizin (2003) 4: 4: 95–99. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (NDV) (1965) 45: 6: 201–2002. Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (Hrsg.). Expertenstandard „Schmerzmanagement in der Pflege“ Entwicklung – Konsentierung – Implementierung. Osnabrück, 2005. Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.): Leben bis zuletzt. Die Implementierung von Hospizarbeit und Palliativbetreuung in Einrichtungen der stationären Altenhilfe. Eigenverlag, Oktober 2006. Eibach, Ulrich: Autonomie, Menschenwürde und Lebensschutz in der Geriatrie und Psychiatrie. Münster: LIT Verlag, 2005. Elsbernd, Astrid: Konzeptentwicklung in der Pflege. In: Stolz, Konrad; Warmbrunn, Johannes; Schmolz, Ulrich und Elsbernd, Astrid: Betreuungsrecht und Pflegemanagement. Konzepte – Beratung – Unterstützung. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2008. 73 Komponenten des Palliative Care Ansatzes als konzeptionelle Grundlage Elsbernd, Astrid und Stolz, Konrad: Zwangsbehandlung und Zwangsernährung in der stationären Altenhilfe? Pflegewissenschaftliche und rechtliche Aspekte. BtPrax (2008) 2: 57–63. European Parlament: Palliative Care in the European Union. Mai, 2008. Evangelischer Pressedienst: Dokumentation. Stellungnahme des Nationalen Ethikrates. Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebensende. Frankfurt am Main: 25. Juli 2006. Ewers, Michael und Schaeffer, Doris (Hrsg.): Am Ende des Lebens. Versorgung und Pflege von Menschen in der letzten Lebensphase. Bern: Verlag Hans Huber, 2005. Ewers, Michael: End-of-Life Care und Public Health – Konsens und Kontroversen. In: Ewers, Michael und Schaeffer, Doris (Hrsg.): Am Ende des Lebens. Versorgung und Pflege von Menschen in der letzten Lebensphase. Bern: Verlag Hans Huber, 2005. Filipp, Sigrun-Heide und Staudinger, Ursula M. (Hrsg.): Entwicklungspsychologie des mittleren und höheren Erwachsenenalters. Göttingen u.a.: Hogrefe Verlag für Psychologie, 2005. Flieder, Margret: Wenn Theorie und Praxis knallhart aufeinander prallt. Palliative Care im Spannungsfeld zwischen notwendigem Wissen und anwaltschaftlichem Handeln. In: Ostertag, Martin: Abschiede und neues Leben. 9. und 10. Loccumer Hospiztagung. Evangelische Akademie Loccum, 2007. Gastmans, Chris: Sorge für ein menschenwürdiges Lebensende in katholischen Pflegeeinrichtungen in Flandern (Belgien). Ethik in der Medizin (2005) 17: 4: 284–297. Graf, Gerda und Höver, Gerhard: Hospiz als Versprechen. Zur ethischen Grundlegung der Hospizidee. Wuppertal: der hospiz verlag, 2006. Gerstenkorn, Uwe: Hospizarbeit in Deutschland. Lebenswissen im Angesicht des Todes. Stuttgart: Kohlhammer, 2007. Gronemeyer, Reimer; Fink, Michaela; Globisch, Marcel; Schumann, Felix: Helfen am Ende des Lebens. Hospizarbeit und Palliative Care in Europa. Wuppertal: der hospiz verlag, 2004. Gross, Corina Salis: Der ansteckende Tod: Sterbeverläufe im Alters- und Pflegeheim. In: Ewers, Michael und Schaeffer, Doris (Hrsg.): Am Ende des Lebens. Versorgung und Pflege von Menschen in der letzten Lebensphase. Bern: Verlag Hans Huber, 2005. Gross, Corina Salis: Der ansteckende Tod. Eine ethnologische Studie zum Sterben im Altersheim. Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2001. 74 Annette Riedel Hallwirth-Spörk, Christina; Heller, Andreas; Weiler, Karin (Hrsg.): Hospizkultur & Mäeutik. Offen sein für Leben und Sterben. Freiburg: Lambertus, 2009. Haskamp, Maria und Remmers, Hartmut: Fürsorge auch für Sterbebegleiter. Belastungen und Bewältigungsstrategien von MitarbeiterInnen in Hospiz- und Palliativeinrichtungen. Dr. med. Mabuse (2008) 174: 34–37. Heimerl, Katharina: Orte zum Leben – Orte zum Sterben. Palliative Care in Organisationen umsetzen. Freiburg: Lambertus Verlag, 2008. Heimerl, Katharina: Ethik und Interventionsforschung in Palliative Care. In: Heintel, Peter; Krainer, Larissa; Ukowitz, Martina: Beratung und Ethik. Praxis, Modelle, Dimensionen. Berlin: Ulrich Leutner Verlag, 2006. Heintel, Peter; Krainer, Larissa; Ukowitz, Martina: Beratung und Ethik. Praxis, Modelle, Dimensionen. Berlin: Ulrich Leutner Verlag, 2006. Heller, Andreas: Der ethische Alltag im Pflegeheim. In: Hallwirth-Spörk, Christina; Heller, Andreas; Weiler, Karin (Hrsg.): Hospizkultur & Mäeutik. Offen sein für Leben und Sterben. Freiburg: Lambertus, 2009. Heller, Andreas: Unsicher sein dürfen. Orientierungen für eine Ethik in der Altenhilfe. Praxis Palliative Care (2008) 1: 4–7. Heller, Andreas und Pleschberger, Sabine: Menschen sterben nicht nach Schema. Palliative Care in der Pflege alter und demenzkranker Menschen. Praxis Palliative Care (2008) 1: 22–23. Heller, Andreas; Heimerl, Katharina und Husebø, Stein (Hrsg.): Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun. Wie alte Menschen würdig sterben können. 3., aktualisierte Auflage. Freiburg: Lambertus Verlag, 2007. Heller, Andreas und Knipping, Cornelia: Palliative Care – Haltungen und Orientierungen. In: Knipping, Cornelia (Hrsg.): Lehrbuch Palliative Care. 2., durchgesehene und korrigierte Auflage. Bern: Verlag Hans Huber, 2007. Heller, Andreas und Wegleitner, Klaus: Palliative Care in der stationären Altenhilfe – Ansätze der Implementierung. In: Knipping, Cornelia (Hrsg.): Lehrbuch Palliative Care. 2., durchgesehene und korrigierte Auflage. Bern: Verlag Hans Huber, 2007. Heller, Andreas u.a.: Palliative Kultur in der stationären Altenhilfe. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie (2003) 36: 360–365. Helmchen, Hanfried; Kanowski, Siegfried und Lauter, Hans: Ethik in der Altersmedizin. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2006. Heusser, Peter und Riggenbach, Björn (Hrsg.): Sterbebegleitung – Sterbehilfe – Euthanasie. Bern, Stuttgart, Wien: Verlag Paul Haupt, 2003. 75 Komponenten des Palliative Care Ansatzes als konzeptionelle Grundlage Hildenbrand, Bruno: Begleitung von Menschen in einer Sinnkrise – Erwartungen an ehrenamtliche Mitarbeiter im Hospizbereich. In: Ewers, Michael und Schaeffer, Doris (Hrsg.): Am Ende des Lebens. Versorgung und Pflege von Menschen in der letzten Lebensphase. Bern: Verlag Hans Huber, 2005. Hiemenz, Thomas; Kottnik, Roswitha (Hrsg.): Chancen und Grenzen der Hospizbewegung. Dokumentation zum 2. Ökumenischen Hospizkongress „Sich einlassen und Loslassen“ Würzburg 22.–24. Oktober 1999. Freiburg: Lambertus Verlag, 2000. Höfling, Wolfram; Brysch, Eugen (Hrsg.): Recht und Ethik der Palliativmedizin. Berlin: LIT Verlag, 2007. Hospiz Österreich: „Umsetzung und Entwicklung von Hospiz und Palliative Care im Pflegeheim. Richtlinien in der Fassung vom 03.09.2008. Husebø, Bettina Sandgathe: Palliativmedizin in der Geriatrie. In: Husebø, S. und Klaschik, E.: Palliativmedizin. Grundlagen und Praxis. 4., aktualisierte Ausgabe, Berlin: Springer 2006. Husebø, Stein und Klaschik, Eberhard: Palliativmedizin. Grundlagen und Praxis. 4., aktualisierte Ausgabe, Berlin: Springer 2006. Husebø, Stein: Ethik. In: Husebø, Stein und Klaschik, E.: Palliativmedizin. Grundlagen und Praxis. 4., aktualisierte Ausgabe, Berlin: Springer 2006. Imhof, Lorenz u.a.: Forschungsprioritäten der gerontologischen Pflege. Pflege (2008) 21: 435–451. Käppeli, Silvia: Bedeutung der Pflegediagnostik in der Palliative Care. In: Knipping, Cornelia (Hrsg.): Lehrbuch Palliative Care. 2., durchgesehene und korrigierte Auflage. Bern: Verlag Hans Huber, 2007. Käppeli, Silvia: Vom Glaubenswerk zur Pflegewissenschaft. Geschichte des Mit-Leidens in de christlichen, jüdischen und freiberuflichen Krankenpflege. Bern: Verlag Hans Huber, 2004. Klie, Thomas: Würdekonzept für Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf, Balancen zwischen Autonomie und Sorgekultur. In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie (2005) 38: 268–272. Klie, Thomas und Wilkening, Karin: In Würde sterben. In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie (2003) 36: 331–332. Klie, Thomas: Sterben in Würde – zwischen Autonomie und Fürsorge. Ein Beitrag zur aktuellen juristischen Diskussion. In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie (2003) 36: 347–354. Kloke, Marianne; Reckinger, Klaus, Kloke, Otto (Hrsg.): Grundwissen Palliativmedizin. Köln: Deutscher Ärzteverlag, 2009. 76 Annette Riedel Kloke, Marianne: Grundlagen der Palliativmedizin. In: Kloke, Marianne; Reckinger, Klaus, Kloke, Otto (Hrsg.): Grundwissen Palliativmedizin. Köln: Deutscher Ärzteverlag, 2009. Knipping, Cornelia (Hrsg.): Lehrbuch Palliative Care. 2., durchgesehene und korrigierte Auflage. Bern: Verlag Hans Huber, 2007. Knobloch, Hubert und Zingerle, Arnold (Hrsg.): Thanatosoziologie. Tod, Hospiz und die Institutionalisierung des Sterbens. Körtner, Ulrich H. J.: Frailty. Medizinethische Überlegungen zur Gebrechlichkeit des alten Menschen. Ethik in der Medizin (2006) 18: 108–119. Körtner, Ulrich H. J.: Sterben in der modernen Stadt. Gesellschaftliche, kulturelle und religiöse Rahmenbedingungen von Palliative Care. Vortrag beim 2. Symposium Herausforderung Palliative Care „Institutionen und Strukturen, die Zuversicht vermitteln?“ am 12.12.2003 in Freiburg. Kojer, Marina: Inwiefern sind demenzkranke alte Menschen palliativbedürftig? Die palliative Versorgung Demenzkranker ist umstritten. In: Praxis Palliative Care (2008) 1: 26–29. Kojer, Marina: Die Welt der Alten respektieren, ihre Sprache sprechen . . . Was ist Palliative Geriatrie? In: Heller, Andreas; Heimerl, Katharina und Husebø, Stein (Hrsg.): Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun. Wie alte Menschen würdig sterben können. 3., aktualisierte Auflage. Freiburg: Lambertus Verlag, 2007. Kojer, Marina (Hrsg.): Alt, krank und verwirrt. Einführung in die Praxis der Palliativen Geriatrie. Freiburg: Lambertus Verlag, 2002. Kojer Marina: Was ist Palliative Geriatrie? In: Kojer, Marina (Hrsg.): Alt, krank und verwirrt. Einführung in die Praxis der Palliativen Geriatrie. Freiburg: Lambertus Verlag, 2002. Kostrzewa, Stephan: Palliative Pflege von Menschen mit Demenz. Bern: Verlag Hans Huber, 2008. Kränzle, Susanne; Schmid, Ulrike und Seeger, Christa: Palliative Care. Handbuch für Pflege und Begleitung. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Heidelberg: Springer, 2007. Kunz, Roland: Palliative Care für Patienten mit fortgeschrittener Demenz: Values Based statt Evidence Based Practice. In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie (2003) 36: 355–359. Kruse, Andreas: Das letzte Lebensjahr. Zur körperlichen, psychischen und sozialen Situation des alten Menschen am Ende seines Lebens. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2007. 77 Komponenten des Palliative Care Ansatzes als konzeptionelle Grundlage Kruse, Andreas: Selbstständigkeit, bewusst angenommene Abhängigkeit, Selbstverantwortung und Mitverantwortung als zentrale Kategorien einer ethischen Betrachtung des Alters. In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie (2005) 38: 4: 273–287. Kruse, Andreas: Selbstständigkeit, Selbstverantwortung, Mitverantwortung als bedeutende Kategorien der Gerontologie. In: Naegele, Gerhard; Reichert, Monika; Maly, Nicole (Hrsg.): 10 Jahre gerontologische Forschung in Dortmund. Bilanz und Perspektiven. Münster, Hamburg, London: LIT Verlag, 2001. Kruse, Andreas: Menschenwürdig sterben, ethische, gesellschaftliche und fachliche Herausforderungen. In: Hiemenz, Thomas; Kottnik, Roswitha (Hrsg.): Chancen und Grenzen der Hospizbewegung. Dokumentation zum 2. Ökumenischen Hospizkongress „Sich einlassen und Loslassen“ Würzburg 22.–24. Oktober 1999. Freiburg: Lambertus Verlag, 2000. Lämmermann, Godwin: Einführung in die Religionspsychologie. Grundfragen – Theorien – Themen. Neukirchen-Vluyn: Neukirchner Verlag, 2006. Lamprecht, Annette M.: Christlicher Glaube im Alter. Eine Untersuchung zu Bedeutung und Funktion. Berlin: LIT Verlag, 2006. Lehr, Ursula: Psychologie des Alterns. Wiebelsheim: Quelle & Meyer, 2007. 11. Korrigierte Auflage. Leininger, Madeleine: Transcultural Nursing. Concepts, Theoreis and Practices. New York: Wiley, 1978. Mettner, Matthias; Schmitt-Mannhart, Regula (Hrsg.): Wie ich sterben will. Autonomie, Abhängigkeit und Selbstverantwortung am Lebensende. Zürich: NZN Buchverlag AG, 2003. Mielke, Leonie: Hospiz im Wohlfahrtsstaat. Unsere gesellschaftlichen Antworten auf Sterben und Tod – eine soziologische Bestandsaufnahme in Deutschland. Wuppertal: der hospiz verlag, 2007. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung; GABI vom 18. Oktober 1995: Ausbildungs- und Prüfungsordnung des Sozialministeriums an Berufsfachschulen für Altenpflege; 595–603. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg: Schulversuch 546512-2243/75 vom 24. Januar 2003. Lehrplane für die Berufsfachschule für Altenpflege. Monteverde, Settimio: Ethik und Palliative Care – Das Gute als Handlungsorientierung. In: Knipping, Cornelia (Hrsg.): Lehrbuch Palliative Care. 2., durchgesehene und korrigierte Auflage. Bern: Verlag Hans Huber, 2007. 78 Annette Riedel Müller, Dirk und Zippel, Christian: Palliative Geriatrie – ein junges Aufgabengebiet. In: Zippel, Christian und Kraus, Sibylle (Hrsg.): Soziale Arbeit für alte Menschen. Ein Handbuch für die berufliche Praxis. Frankfurt am Main: Mabuse Verlag, 2009. Müller-Busch, Christof; Aulbert, Eberhard: Ethische Fragen in der Palliativmedizin. In: Aulbert, Eberhard; Nauck, Friedemann; Radbruch, Lukas (Hrsg.): Lehrbuch der Palliativmedizin. 1. Nachdruck der zweiten Auflage. Stuttgart, New York: Schattauer, 2008. Nikolaus, Thorsten (Hrsg.): Klinische Geriatrie. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2000. Nikolaus, Thorsten. und Schuler, M.: Chronischer Schmerz. In: Nikolaus, Thorsten (Hrsg.): Klinische Geriatrie. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2000. Nübel, Gerhard; Kuhlmann, Heinz-Peter und Meißnest, Bernd (Hrsg.): Leben bis zuletzt. Das Ende neu entdecken. Frankfurt am Main: Mabuse Verlag, 2007. Oduncu, Fuat S.: In Würde sterben. Medizinische, ethische und rechtliche Aspekte der Sterbehilfe, Sterbebegleitung und Patientenverfügung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007. Ohnsorge, Kathrin: Ethische Fragen am Lebensende. In: Robert Bosch Stiftung (Hrsg.): Ethik und Recht. Bern: Verlag Hans Huber, 2007. Olbrich, Christa: Spiritualität in der Bedeutung für die Pflege. In: Pflege & Gesellschaft (2006) 11: 1: 31–41. Oser, Fritz und Bucher, Anton: Religiosität und Spiritualität. In: Filipp, Sigrun-Heide und Staudinger, Ursula M. (Hrsg.): Entwicklungspsychologie des mittleren und höheren Erwachsenenalters. Göttingen u.a.: Hogrefe Verlag für Psychologie, 2005. Ostertag, Martin: Abschiede und neues Leben. 9. und 10. Loccumer Hospiztagung. Evangelische Akademie Loccum, 2007. Peintinger, Michael: Ethische Grundfragen in der Medizin. Wien: Facultas, 2008. Perrar, Klaus Maria: Hospizliche und palliativmedizinische Begleitung von Menschen mit Demenz in ihrer letzten Lebensphase. In: Nübel, Gerhard; Kuhlmann, Heinz-Peter und Meißnest, Bernd (Hrsg.): Leben bis zuletzt. Das Ende neu entdecken. Frankfurt am Main: Mabuse Verlag, 2007. Peters, Meinolf: Klinische Entwicklungspsychologie des Alters. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004. 79 Komponenten des Palliative Care Ansatzes als konzeptionelle Grundlage Pfeffer, Christine: „Hier wird immer noch besser gestorben als woanders“. Eine Ethnographie stationärer Hospizarbeit. Bern: Verlag Hans Huber, 2005. Pleschberger, Sabine: Nur nicht zur Last fallen. Sterben in Würde aus der Sicht alter Menschen im Pflegeheim. Freiburg: Lambertus Verlag, 2005. Pleschberger, Sabine: Palliative Care in Pflegeheimen – Forschungsstand und Entwicklungsperspektiven. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie (2006) 39: 376–381. Pleschberger, Sabine: Palliative Care in Pflegeheimen. Forschungsstand und Entwicklungsperspektiven. In: Heller, Andreas; Heimerl, Katharina und Husebø, Stein (Hrsg.): Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun. Wie alte Menschen würdig sterben können. 3., aktualisierte Auflage. Freiburg: Lambertus Verlag, 2007. Pott, Gerhard: Ethik am Lebensende. Stuttgart: Schattauer, 2007 Rabe, Marianne: Ethik in der Pflegeausbildung. In: Zeitschrift für Ethik und Medizin (2006) 18: 4: 379–384. Radbruch, Lukas; Nauck, Friedemann; Aulbert, Eberhard: Grundlagen der Palliativmedizin. In: Aulbert, Eberhard; Nauck, Friedemann; Radbruch, Lukas (Hrsg.): Lehrbuch der Palliativmedizin. 1. Nachdruck der zweiten Auflage. Stuttgart, New York: Schattauer, 2008. Rehbock, Theda (2005a): Personsein in Grenzsituationen. Zur Kritik der Ethik medizinischen Handelns. Paderborn: Mentis Verlag, 2005. Rehbock, Theda (2005b). Achtung der Autonomie gegenüber „nicht einwilligungsfähiger“ Patienten? Zur ethischen Problematik von Patientenverfügungen. Pflege (2005) 18: 381ff. Riedel, Annette: Professionelle Pflege alter Menschen. Marburg: Tectum Verlag, 2007. Robert Bosch Stiftung (Hrsg.): Ethik und Recht. Bern: Verlag Hans Huber, 2007. Schaefer, Iris Luzie und Dorschner, Stephan: „Zu Hospiz gehört doch der ganze Mensch!“ – Ehrenamtliche Hospizbegleiter im Einsatz mit Demenzkranken. In: Pflege (2007) 20: 3: 129–136. Schaeffer, Doris: Versorgungswirklichkeit in der letzen Lebensphase: Ergebnisse einer Analyse der Nutzerperspektive. In: Ewers, Michael und Schaeffer, Doris (Hrsg.): Am Ende des Lebens. Versorgung und Pflege von Menschen in der letzten Lebensphase. Bern: Verlag Hans Huber, 2005. 80 Annette Riedel Schmidl, Martina: Schmerzen bei alten und demenzkranken Menschen. In: Hallwirth-Spörk, Christina; Heller, Andreas; Weiler, Karin (Hrsg.): Hospizkultur & Mäeutik. Offen sein für Leben und Sterben. Freiburg: Lambertus, 2009. Schockenhoff, Eberhard und Wetzstein, Verena: Rationale Anthropologie – Ethische Herausforderungen bei der Betreuung von dementen Menschen. In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie (2005) 38: 262–267. Schulze, Ulrike und Niewohner, Silke (Hrsg.): Selbstbestimmt in der letzten Lebensphase – zwischen Autonomie und Fürsorge. Münster: LIT Verlag, 2004. Schwerdt, Ruth: Autonomie als grundlegendes Werteprinzip. In: Robert Bosch Stiftung (Hrsg.): Ethik und Recht. Bern: Verlag Hans Huber, 2007. Sperling, Uwe: Religiosität und Spiritualität im Alter. In: Kruse, Andreas und Martin, Mike (Hrsg.): Enzyklopädie der Gerontologie. Alternsprozesse in multidisziplinärer Sicht. Bern: Verlag Hans Huber, 2004. Steffen-Bürgi, Barbara: Reflexionen zu ausgewählten Definitionen von Palliative Care. In: Knipping, Cornelia (Hrsg.): Lehrbuch Palliative Care. 2., durchgesehene und korrigierte Auflage. Bern: Verlag Hans Huber, 2007. Stevens-Barnum, Barbara: Spiritualität in der Pflege. Bern u.a.: Verlag Hans Huber, 2002. Stolz, Konrad; Warmbrunn, Johannes; Schmolz, Ulrich und Elsbernd, Astrid: Betreuungsrecht und Pflegemanagement. Konzepte – Beratung – Unterstützung. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2008. Student, Johann-Christoph und Napiwotzky, Annedore: Palliative Care. Wahrnehmen – verstehen – schützen. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2007. Tesch-Römer, Clemens und Zeman, Peter: Sterben und Tod im höheren Lebensalter. Die Hospiz-Zeitschrift (2003) 5: 16: 4–9. Utsch, Michael: Religionspsychologie. Voraussetzungen, Grundlagen, Forschungsüberblick. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer, 2005. van der Arend, Arie und Gastmans, Chris: Ethik für Pflegende. Bern: Verlag Hans Huber, 1996. Vollmann, Jochen: Klinische Ethikkomitees und Ethikberatung in Deutschland: Bisherige Entwicklungen und zukünftige Perspektiven. In: Bioethics Forum (2008) 1: 1: 33–39. Voltz, Raymond: Stand und Perspektiven der Palliativmedizin in Deutschland aus Sicht der Patientenschutzorganisation Deutsche Hospiz Stiftung. In: Höfling, Wolfram; Brysch, Eugen (Hrsg.): Recht und Ethik der Palliativmedizin. Berlin: LIT Verlag, 2007. 81 Komponenten des Palliative Care Ansatzes als konzeptionelle Grundlage Wallner, Jürgen: Ethik im Gesundheitswesen. Wien: Facultas, 2004. Watson, Jean: Pflege: Wissenschaft und menschliche Zuwendung. Bern: Verlag Hans Huber, 1996. Weiher, Erhard: Spirituelle Begleitung in der Palliativen Betreuung. In: Knipping, Cornelia (Hrsg.): Lehrbuch Palliative Care. 2., durchgesehene und korrigierte Auflage. Bern: Verlag Hans Huber, 2007. Weihrauch, Birgit: Hospizkultur und Palliativkompetenz in Pflegeinrichtungen. Bundes-Hospiz-Anzeiger 2009: 6: 33: 1. Weinmann, Arved; Körner, Uwe; Thiele, Felix (Hrsg.): Künstliche Ernährung und Ethik. Lengerich: Pabst Science Publishers, 2009. Wetzstein, Verena: Diagnose Alzheimer. Grundlagen einer Ethik der Demenz. Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2005. Weyerer, Siegfried; Ding-Greiner, Christine; Marwedel, Ulrike und Kaufeler, Teresa: Epidemiologie körperlicher Erkrankungen und Einschränkungen im Alter. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2008. WHO: Palliative Care. www.who.int/cancer/palliative/en/ aufgerufen am 23. Februar 2009. WHO und Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin: Palliative Care. Die Fakten. Bonn: Pallia Med Verlag, 2008. Wilkening, Karin: Ein „gutes Sterben“ für Menschen mit Demenz – Sterbeort und letzter Wunsch. In: Robert Bosch Stiftung (Hrsg.): Ethik und Recht. Bern: Verlag Hans Huber, 2007. Wilkening, Karin und Kunz Roland: Sterben im Pflegeheim. Perspektiven und Praxis einer neuen Abschiedskultur. 2., aktualisierte Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005. Wilkening, Karin und Martin, Mike: Lebensqualität am Lebensende: Erfahrungen, Modelle und Perspektiven. In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie (2003) 36: 333.338. World Health Organization Europe: What are the palliative care needs of older People and how might they be met? August 2004. World Health Organization Europe: Palliative Care. The solid Facts. 2004. World Health Organization Europe: Better Palliative Care for Older People. 2004. World Hospice & Palliative Care Day: Internationale Kernaussagen. 2007. World Hospice & Palliative Care Day: Internationale Kernaussagen. 2008. Zippel, Christian und Kraus, Sibylle (Hrsg.): Soziale Arbeit für alte Menschen. Ein Handbuch für die berufliche Praxis. Frankfurt am Main: Mabuse Verlag, 2009. 82