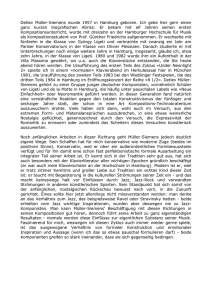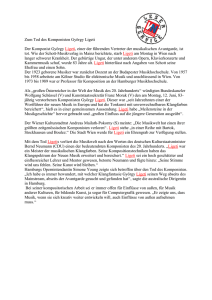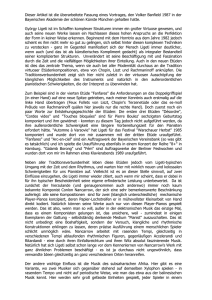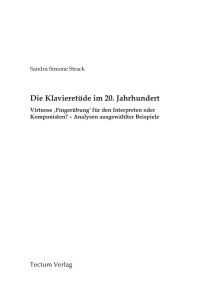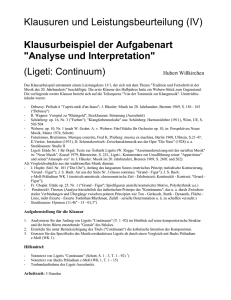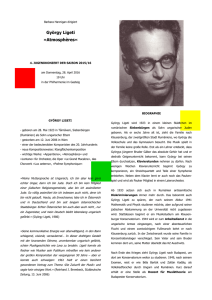pdf, 70 kb - Wien Modern
Werbung

«Bei Ligeti ist alles anders» Pierre-Laurent Aimard im Gespräch mit Stefan Fricke Stefan Fricke: Herr Aimard, wie läßt sich die Idee dieses «Ligeti-Projekts» umreißen? Pierre-Laurent Aimard: Der Wunsch ist, einen unvergleichbaren Komponisten zu feiern, dessen Werke man sehr liebt. Aber nicht auf eine zu monumentale Art und Weise. Keine pompöse Feier, sondern soweit wie möglich mit einer guten Leichtigkeit und hoffentlich mit der Phantasie und dem Hu­mor, wie sie uns György Ligeti und seine Kompositionen so stark vermitteln. Also ein kleines Festival im Festival. Wollen Sie die Gestaltung der Konzerte noch ein wenig weiter ausführen? Das Thema ist «Ligeti in Verbindung mit …». Also Ligeti und die Vergangenheit, Ligeti und die Musik der Welt sowie Ligeti und die ungarischen «Brüder». Eine weitere Idee ist: Solostücke an einem Abend, am anderen Ensemblestücke, am dritten Kammermusik. Das sind drei mal drei wichtige Dimen­sionen in seinem und für sein Werk. Das Programm spricht ansonsten für sich selbst. Es gibt zudem einen Klavierabend, weil ich eben weder Geiger noch Hornist bin. Hier möchte ich, das ist die Idee, Ligetis Verbin­dungen zu den verschiedenen Traditionen beleuchten, sein Verhältnis zum Erbe. Und zwar in der Art, wie er sich in seinen Études pour piano produktiv mit den Einflüssen beschäftigt hat, die von Chopin, Liszt, Rachmaninow, Skrjabin, Bartók und Messiaen herrühren. Deshalb wird es auch keine großen Blöcke geben wie erst zwölf Ligeti-Etüden, dann zwölf Chopin-Etü­den. Vielmehr sind alle Stücke programmatisch miteinander verzahnt, so daß man dieses Spielen mit Referen­zen und Ein­flüssen wirklich «homöopathisch» dosiert erleben kann. Ich bin überzeugt davon, daß eine Programmzusam­ men­stel­lung sehr kreativ sein kann und daß die Kunst des Program­mie­rens ein sehr wichtiger Teil der Tätigkeit ist. Ein Konzert ist ein komponierter Atem. Was hat Sie bei Ligetis Études pour piano, die Sie ja auch auf Compact Disc eingespielt haben, beim Kennenlernen direkt fasziniert? Was sehr beeindruckend an den Klavierstücken ist, wie er das Instrument erneuert hat. Er hat sich mit dem Klavier auf 18 Arten und Weisen auseinandergesetzt, so viele Etüden hat er ja geschrieben. Das Klavier klingt hier anders, es wird an­ders gespielt. Und er hat eine neue Virtuosität ge­funden. Er hat eine Vorstellungskraft und Freiheit für eine Erneuerung des Klaviers gefunden, die wirklich phantastisch ist. Und das nicht als ein Avantgardist, der das Erbe verbrennt. Er hat sich intensiv mit der Tradition beschäftigt, und man kann das auch wiederfinden, wie er zum Beispiel eine Geste oder eine Textur, eine Schreibweise aufgreift und das völlig transformiert oder verfälscht oder damit spielt. Bei vielen Komponisten, die sehr gut Klavier spielen können, sind die Klavierwerke oft das Initial für andere Stücke in größeren Besetzungen … … wenn nicht sogar das Zentrum des Komponierens. Bei Ligeti ist das anders. Das Klavier ist nicht das Instrument, das ihm zu Hause immer zur Verfügung stand, um zu experimentieren und um neue Felder zu erschließen. So wie das bei Arnold Schönberg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder bei Karlheinz Stockhausen und Pierre Boulez in den 50er Jahren der Fall war. Ligeti hat erst spät für Klavier geschrieben: Begonnen hat er Mitte der 70er Jahre mit den drei Stücken für zwei Klaviere Monument – Selbstportrait – Bewegung, und erst in den 80er Jahren kommen dann die Stücke für Klavier allein und das Klavierkonzert hinzu. Als ich ihn einmal gefragt habe, weshalb er sich in dieser Zeit dann doch dem Klavier zu­­wandte und sich sogar eines anschaffte, sagte er: «Weil ich mehr Geld und mehr Platz zu Hause hatte.» Hat sich in den Études Ligetis Komponieren grundlegend verändert? Nun, woher kommen all die Elemente, die eine solch reiche und reichhaltige Sammlung von Etüden nähren, die sie zur Welt kommen lassen? Es ist sehr interessant zu sehen, daß er sich in diesen Werken mit seinen ewigen Visionen beschäftigt. So ist in der zehnten Étude «Der Zauberlehrling» (1994) sein Continuum für Cembalo aus dem Jahr 1968 völlig präsent. Sein ewiger Wunsch, ein klangliches Kontinuum zu komponieren, ist auch hier gegenwärtig: Natürlich mit anderen ­Vor­schlägen, weil das Instrument verschieden ist, sein Ge­wicht ist anders, ebenso der Klang. Das Resultat ist eigenartig und neu, aber die Idee ist gleich. Man findet in den Klavieretüden auch Elemente aus den 80er Jahren wieder. Alles, was zum Beispiel vom Jazz kommt und Ligeti beschäftigt hat (etwa in der vierten Étude «Fanfares» von 1985) oder was aus der exotischen Musik kommt, die polyrhythmischen Spiele, Mischungen von verschiedenen Skalen usw. Die Études bieten ein sehr breites Panorama von seinen damaligen und heutigen Vorstellungen. Zugleich sind sie ein großes Zeichen, das sagt: Zurück zum Kla­vier. In den 70er Jahren hatte man schon geglaubt, das Kom­ponieren für das Klavier sei am Ende, Stichwörter sind Mikrointervallik, repetitive Musik, Spektralmusik. Man hat geglaubt, nur die Maschine, der Computer könnte diese Ideen realisieren. Und plötzlich ARCHIV WIEN MODERN | © WIEN MODERN | WWW.WIENMODERN.AT sind Ligetis Études gekommen. Sie sind riesig pianistisch, und wir haben ein neues Instrument. Es war ein Donnerknall – und ein neues, ein goldenes Zeit­alter für das Instrument brach an. Ligeti hat davon gesprochen, daß es in seinen Klavieretüden viele Allusionen gäbe zu den Chopin-Etüden, die jedoch seien eher unhörbar. Ist die intime Kenntnis der Chopinschen Werke wichtig für das praktische Studium der Ligetischen? Ich glaube, es ist immer reicher, wenn Sie die verschiedenen Schichten in der Geschichte eines Stückes kennen und seine Einflüsse. Debussy kann für sich selbst stehen. Wenn Sie aber die Einflüsse kennen, ist seine Musik noch reicher. Und auch die Zukunft. Sie haben so eine reichere Perspektive. Im Falle von Ligeti ist es ganz genauso. Und das ist etwas, was großen Genuß bringt. So nimmt Ligeti eine Geste, einen Archetyp, den Sie etwa in einer Etüde von Liszt oder Chopin finden können. So nimmt er vielleicht einen virtuosen Triller – und mit einem Trick verwandelt er das in ein neues klangliches Objekt. Da gibt es Typen von schnellen, hektischen Rhythmen, die vielleicht mit der ungarischen Tradition zu tun haben, etwas Verrücktes, Nervöses in sich tragen. Die Geste ist aus der Ver­ gangenheit, auch die chromatische Skala – und dann kommt Ligetis Trick. Die rechte Hand spielt Liszt oder Chopin, die linke Hand macht etwas anderes, eine komische Sache. Und das Resultat klingt wie Ligeti, ist eine Textur, wie er immer komponiert hat. Vor den Klavieretüden hat er solche Wir­kung­­en, sagen wir, mit einer Besetzung von sechs Instrumen­ten, er­zielen können, heute macht er so etwas mit dem Klavier. Es sind viele verschiedene Schichten in den Etüden, und diese stam­men von einem großen Manipulator. Das ist prima. Ist es für das Spielen, wenn solche Überschneidungen kommen, sinnvoll, rechts etwa den Chopin im Kopf zu haben und links zum Beispiel an Skrjabin zu denken? Man hat gewisse schizophrene Momente zu entwickeln, aber immer koordiniert. Zum Beispiel in den stark rhythmisch geprägten Etüden: Sie kriegen etwa ein Ostinato, salsaartig, der läuft dann eine gewisse Zeitlang, und die andere Hand macht dazu Fanfaren. Die bestehen aus derselben Art kleiner Zellen wie das Ostinato, aber sie besitzen immer einen Ton zuviel, so daß sich die beiden Verläufe verschieben. Und dann kommen nach einem Moment ganz andere Typen von Musik: eine Jazzimprovisation oder genau derselbe Ostinatotyp, der sich systematisch verschoben hat und weiter verschiebt. Dann müssen Sie wirklich ein Auge und ein Ohr haben, was sich all­ mählich in eine andere Richtung entwickelt. Das ergibt eine Art stilistischer Schizophrenie, aber die Stile sind nie konkret. Ligeti transformiert die Sachen immer. Zum Beispiel: Er legt in die eine Hand eine Ganztonskala und auch Debussyhafte Traumtöne. In der anderen Hand liegt die andere Ganzton­skala. Er komplementiert die beiden so, daß – wenn sich die Hände kreuzen – eine Art neues Seidentuch entsteht, sehr kom­plex. Und wenn er sie isoliert, entstehen womöglich zwei gleich­zeitige Debussy-Welten. Von Conlon Nancarrow und seiner Musik für das Selbst­spiel­klavier ist Ligeti fasziniert. Bei Ligeti ist der Klavierspieler aber keine Maschine … Manchmal ist er es oder ein Mechanismus oder ein Com­puter. Aber in der Komposition gibt es immer einen Moment, wo der Prozeß zu weit geht. Dann kommt das Menschliche. Anders gesagt: Der Teufel muß sich ein bißchen vermenschlichen. Zum Beispiel in der ersten Klavieretüde «Désordre» (1985), die mit einem Mechanismus ohne Mitleid anfängt. Nach und nach wird es dann so verrückt, daß nur eine mensch­­liche Präsenz dieser Verrücktheit noch Blut und Schweiß ge­ben kann. Der Interpret muß immer da sein. Nicht nur, weil es wunderbare oder poetische Gefühle sind, sondern weil hier alles Mechanische für einen Menschen gedacht ist. Aber Ligeti liebt die Grenzen. Er liebt die Gefahr für den Interpreten. Es gibt Stücke, die sind kaum spielbar. Und vor ein paar Jahren dachte man noch, sie wären nie zu spielen. Dann machen die Interpreten Fortschritte oder es kommt eine neue Generation von Musikern – und schon ist es spielbar. Das ist ein Spiel, das Ligeti liebt. Der «Teufel Metronom», den Ligeti benutzt, muß auf der Bühne von einem Menschen inszeniert werden. Der Pianist muß selbst zum Metronom oder zu vielen gleichzeitigen Metronomen werden. Ja, das kann man so sagen. Ligeti ist ja ein Meister der Groteske und der Ironie. Auch in den Klavieretüden? O ja. Die Études sind eine riesige Chance, einen großen Komponisten zu erleben, dessen Musik so tief ist und der sich nicht zu ernst nimmt. Auch das ist eine Konstante in Ligetis Komponieren. Es ist ein Genuß, einen Klavierabend zu haben und die Leute lächeln zu sehen oder gar lachen zu hören. Das sind Gag-Momente, sehr effektiv, sehr fein. Ligeti spielt mit uns. Müssen auch Sie gelegentlich lachen, wenn Sie solche Stücke aufführen? Nein, ich muß den Effekt hinkriegen. Wenn der Humorist kommt, und er lacht selbst, während er seine Geschichte erzählt (oder danach), ist das nicht sehr wirksam. Ligeti hat mal davon gesprochen, er wolle eine «schmutzige» Musik. Wissen Sie, was er damit meint? Das ist nicht leicht zu beantworten. Ich glaube, das bedeutet, daß er nicht an einer schönen, sondern an einer wahren Musik interessiert ist. Bloßer Ästhetizismus ist nicht seine Sache. Auch ist er sehr interessiert, an die Grenzen und auch dahinter zu gehen. Die musikalischen Prozesse, die er produziert, wirken manchmal wie «Verwesungen». Béla Bartók, György Ligeti, György Kurtág und Peter Eötvös – das sind die vier großen ungarischen Komponisten der neuen Musik. Gibt es so etwas wie eine typisch ungarische Musik­sprache? O ja. Vielleicht keine «langage», aber es gibt Permanenzen in der ungarischen Musik: Puls, Rhythmus und Artikulation. Und das ist verbunden mit der ungarischen Sprache und ihren Rhythmen – und daß das Ungarische nicht synthetisch funk­tio­niert, sondern immer mit Akkumulationen arbeitet. Man kann in der ungarischen Musik auch eine besondere Intensität und Härte finden. Für Ligeti sind diese Permanenzen der un­garischen Musik ganz wichtig, nicht nur in seiner ersten Kom­ponierphase in Ungarn vor seiner Flucht. Das zeigt man in den Interpretationen viel zu wenig. Und es gibt noch eine weitere Dimension, die für die ungarische Musik gilt: die Art und Wei­se der Beschäftigung mit den Tönen – als Intervalle und einfache Objekte (eine Skala, ein Tetrachord). Man findet hier die Haltung, einfach damit zu spielen und daraus ein Universum aufzubauen. Also gleichzeitig Klarheit und Komplexität in der modernen ungarischen Musik? Klarheit ist eine wichtige Dimension in Ligetis Werk. Es gibt Schöpfer, die haben die Fähigkeit, Komplexität mit sehr einfachen Grundelementen zu organisieren – und das auf eine sehr organische Art und Weise. Deswegen klingt Beethoven für alle so reich und kräftig und hat Kommunikationsfähig­keit. Des­wegen sind die besseren BartókStücke, die Sonate für zwei Kla­viere und Schlagzeug etwa, und die meisten der Ligeti-Stü­cke sehr reich. Aber sie schöpfen eine Komplexität, die man so­fort fühlen und verstehen kann. Das ist ein irrsinniges Talent. Gilt das auch etwa für Ligetis Horntio von 1982 – einem Werk, das die Gralshüter der Moderne als Verrat an der Avantgarde bewertet haben? Es wird viel Dummes gesagt. Ligeti ist wirklich der unabhängige Künstler par excellence. Er hat als Grundmaterial im Horntrio ein paar Intervalle genommen, die vor Jahren als verboten galten. Aber was er damit gemacht hat, ist Ligeti, ist neu, original und organisch. Was wollen Sie mehr. Hier wird Musik aus verschiedenen Horizonten und Momenten unserer Geschichte zusammengebracht, aber überhaupt ganz und gar ohne Zitate, nur als Erinnerungen, ohne je konkret zu sein. Das Material ist verschieden, jede Stimme beschreibt ein eigene Art von Tonverbindungen. Und die Überordnung ist wunderbar und kontrolliert. Das große Ziel von Komposition ist doch, verschiedene Typen zu einer «Organisation» zu formen. Ich erinnere mich, als der alte Olivier Messiaen und ich eine Probe von Ligetis Klavierkonzert besucht haben. Nach dem vierten Satz sagte er zu mir:«Pierre-Laurent, das ist wunderbar mit Ligeti: Er nimmt ganz dumme Sachen, dumme Terzen, dumme Melodien, das ist doch unmöglich – und am Ende klingt es wieder so verrückt wie eben ein Ligeti-Stück.» Apropos Klavierkonzert. Zum dritten Satz schreibt Ligeti: «Blickpunkte leuchten auf und verschwinden wieder in schneller Folge, ohne sich zu bewegen, doch es entsteht die Illusion bewegter Bilder.» Sind solche Hinweise seitens des Komponisten für Sie wichtig? Ich glaube, es gibt mehrere Stufen: die Vision des Kompo­nisten und seine Einflüsse, die Fakten, die Technik, alles, was der Text oder das Bewußtsein Ihnen sagt. Es sind die Wahl­mög­lichkeiten, die Sie haben, per Intuition, durch die Kenntnis und die kulturellen Assoziationen. Und auch die Art und Wei­se, wie ein Komponist lebt, ist wichtig. Er lebt sein Stück. Er lebt die eigene Geschichte, die eigene Verbindung mit dem Stück. Oder er trägt ein Stück weiter. Man erlebt, wie er drei­ßig Jahre später wieder ein Stück schreibt. Das sind viele Bei­spiele. Manchmal ist das alles sehr aufregend, manchmal we­niger. Es ist interessant, wie sich ein Komponist erklärt mit seinem Stück und sich manchmal auch damit entdeckt. Bei Ligeti, der nicht alles im voraus fixiert, nicht alles rational definiert, waren die ersten Stunden, in denen wir an einem neuen Stück gearbeitet haben, sozusagen die erste Verhand­lung über sein Werk, sehr, sehr faszinierend . Zu sehen, wohin er geht, bis etwas die richtige Textur bekommt, bis alle Refe­renzen und alle Elemente wirklich da sind und er sein Stück an einem gegebenen Moment «anfaßt». Und das ist es dann. Ich glaube, das ist das Privileg eines nahen Kontaktes zwischen Komponist und Interpret. Spüren Sie den afrikanischen Einfluß in dem Klavierkonzert? Sehr, in der Polyrhythmik. Er hat das rhythmische Element in seinem eigenen Werk immer gefühlt. Als er dann diese Mu­sik Afrikas kennengelernt hat, hat sie ihm gezeigt, welchen Weg er weitergehen muß. Er hat sich viel damit beschäftigt, und sie hat ihn zu einem ganz neuen und einzigartigen Typus von Musik und Technik inspiriert. Trotzdem ist er absolut er selbst geblieben, es gibt nie die Gefahr eines Exotismus. Und das ist wunderbar. Abschließend eine Frage zum Gestalten von Konzerten. Wie erklären Sie sich, daß viele Pianisten dieselben Programme, dieselben Haltungen haben …? Ich glaube, in der menschlichen Gesellschaft, in allen Be­ru­fen, gibt es gute Bewegungen, sie sind aber eine Minderheit. Ich habe viel mit Leuten aus anderen Berufen darüber gesprochen, mit Ärzten zum Beispiel. Es gibt in der Medizin so viele Fortschritte, die erlauben heute, eine Krankheit viel früher zu diagnostizieren und damit die Heilungschancen zu vergrößern als noch vor Jahren. Mentalitäten, Institutionen, die Regeln aber gestatten das nicht. Es dauert so lange, bis die Gesell­schaft etwas Neues akzeptiert, auch wenn deutlich ist, daß es das Bessere ist. Die menschliche Mentalität, überhaupt die kollektive Mentalität, kennt viele Widerstände und verhält sich Veränderungen gegenüber sehr zeitresistenz. Aber man muß sich unbedingt bewegen. Das Gespräch fand am 16. August 2003 in Köln statt. «Bei Ligeti ist alles anders». Pierre-Laurent Aimard im Gespräch mit Stefan Fricke, in: Katalog Wien Modern 2003, hrsg. von Berno Odo Polzer und Thomas Schäfer, Saarbrücken: Pfau 2003, S. 15-17.