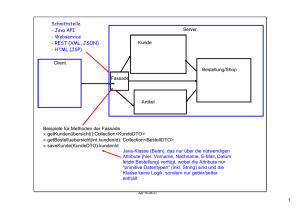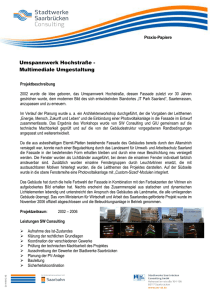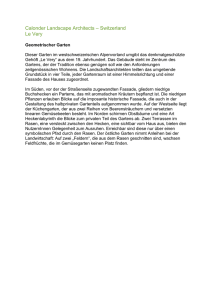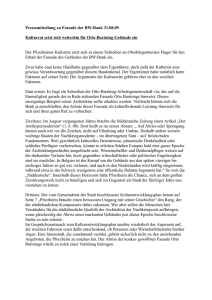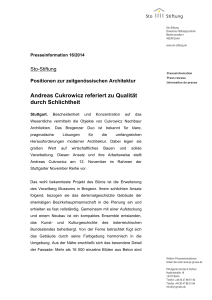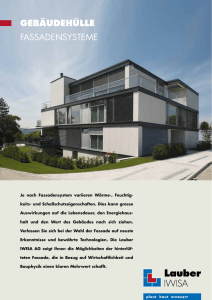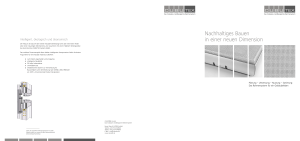Der Wandel der Fassade und ihrer Funktionen im 20. Jh.
Werbung

Der Wandel der Fassade und ihrer Funktionen im 20. Jh. [ Abstract Dissertation, Technische Universität Ostrava (Tschechien), Fakultät Bauingenieurwesen, Nr.: FAST16V/2006, Nov. 2005 ] Inhalt Einleitung Vorgehensweise der Untersuchung Ergebnisse Ausblick Einleitung Betrachtet man die Gesamtheit der gebauten Umwelt, so wird deutlich, dass sich der Wandel des Erscheinungsbildes unserer Städte im Laufe der Jahrhunderte nicht allein als eine Abfolge immer neuer Architekturmoden erklären lässt. Eine Vielzahl von Faktoren nimmt Einfluss auf die Gestalt und Bauweise der Gebäude. Prägend für das äußere Erscheinungsbild sind vor allem die Fassaden. Die Fassade trennt zwischen privatem und öffentlichem Raum, zwischen Innenraum und Außenraum. Ihr kommt als Schnittstelle des inneren Systems eines Gebäudes mit dem umgebenden System eine entscheidende Bedeutung zu. Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts lässt sich - u.a. ausgelöst durch die erste Energiekrise 1973 - eine deutliche Zunahme der Funktionen der Fassade beobachten. Dies wird in der vorliegenden Arbeit zum Anlass genommen, die Funktion der Fassade in den Mittelpunkt der Untersuchung zu stellen. An der Funktion der Fassade manifestieren sich die verschiedenen Auslöse- und Einflussfaktoren, die zu einer Veränderung der Konstruktion und Gestaltung führen. Der Begriff Funktion wird nicht eingeengt auf die klassischen, technisch messbaren Funktionen - wie z.B. statische Belastbarkeit oder Wärmedurchgangswiderstand - verstanden, sondern umfassend. Mithin wird in die Betrachtung beispielsweise auch der mit einer entsprechend gestalteten Fassade angestrebte Image- bzw. Prestigegewinn als Einflussfaktor auf die Fassadengestaltung in die Untersuchung einbezogen. Ziel dieser Arbeit ist das Erkennen der komplexen Wirkungszusammenhänge, die für den Wandel der Fassadengestaltung verantwortlich sind. Vorgehensweise der Untersuchung Die Untersuchung wird in drei Schritten vollzogen. Ausgangsbasis ist die Untersuchung der Auslöse- und Einflussfaktoren, die zu einer Veränderung der Fassadenkonstruktion bzw. -gestalt geführt haben. Hierbei wird zwischen unmittelbaren Auslösefaktoren, mittelbaren Auslösefaktoren, externen Einflussfaktoren und limitierenden Einflussfaktoren unterschieden. Unmittelbare Auslösefaktoren sind z.B. die Widrigkeiten der Natur (Wind, Regen, Kälte). Mittelbare Auslösefaktoren sind beispielsweise wirtschaftliche Interessen und gestalterische Präferenzen. Zu den externen Einflussfaktoren gehören kulturelle und gesellschaftliche Veränderungen sowie Katastrophen und Kriege. Unter den limitierenden Einflussfaktoren werden Faktoren verstanden, die die Entwicklung neuer Fassadensysteme einschränken bzw. begrenzen. Zu nennen sind hier z.B. Gesetze und Normen. Gesetze können technische Neuerungen auslösen, wenn sie durch ihre restriktive Formulierung einen Innovationsdruck auf die Bauindustrie ausüben. Als zweiter Schritt - nach der Analyse der Auslöse- und Einflussfaktoren - folgt eine Darstellung der Funktionen, die die Fassade erfüllt. Die Funktionen der Fassade werden von den Auslösefaktoren abgeleitet, mithin ist die Funktion der Fassade als Antwort auf die Auslöse- bzw. Einflussfaktoren zu verstehen. In einem dritten Schritt wird anhand von ausgesuchten Beispielen der Zusammenhang zwischen dem Wandel der Fassadenfunktionen im Laufe des 20. Jahrhunderts und der Änderung der äußeren Gestalt untersucht. Die Kausalkette zwischen Auslösefaktoren, angestrebter Funktionalität und gewählter Konstruktion und Gestalt wird mit Hilfe der Beispiele nachgezeichnet. Die Untersuchung beschränkt sich auf Wohn- und Geschäftshäuser, die beispielhaft für das Erscheinungsbild der Städte sind. Ergebnisse Die Konstruktion und Gestalt der Fassade hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts dramatisch gewandelt. Zu Beginn des Jahrhunderts war die Fassade in ihrer Materialität und Konstruktion durch Massivität und Monumentalität gekennzeichnet, am Ende des Jahrhunderts emanzipierte sie sich von der tragenden Funktion und wurde zu einer leichten und flexiblen dritten Hülle des Menschen. Der Wandlungsprozess ist durch einige grundlegende Entwicklungen im Bauwesen und in der Gesellschaft maßgeblich beeinflusst. Folgende Einzelaspekte werden in der Arbeit näher erörtert: Der Einfluss der wachsenden Städte und der zunehmenden Globalisierung, die Entwicklung der Bautechnik und der Planungsverfahren im 20. Jahrhundert, die Rolle des Architekten im Wandlungsprozess sowie grundlegende Mechanismen des Wandlungsprozesses. Der Wandel der Bedeutung einzelner Funktionen der Fassade im Laufe des 20. Jahrhunderts und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Gestaltung werden anhand von acht signifikanten Funktionen näher untersucht. Diese sind: - Schutz vor naturbedingten Widrigkeiten - Schutz vor zivilisationsbedingten Widrigkeiten - Sicherstellung elementarer Wohnanforderungen (Luftwechsel, Belichtung, Raumklima) - Herstellungskosten - Betriebskosten - Imagewert - Kulturelle und gesellschaftliche Identität - Nachhaltigkeit Schutz vor naturbedingten Widrigkeiten Die Bemühungen die Wärmeverluste zu minimieren, führten zu einer entscheidenden Verbesserung der Fassadenkonstruktion im 20. Jahrhundert. Bis Anfang der 70er Jahre wurde der Dämmung von Gebäuden nur eine geringe Bedeutung zugebilligt. Während des Zweiten Weltkrieges und in der Nachkriegszeit zwangen die ökonomischen Verhältnisse zu äußerst sparsamer Bauweise, die Wanddicken waren im Allgemeinen geringer als dies noch Anfang des 20. Jahrhunderts der Fall war. Die Einführung einer Energieeinsparverordnung und die Verschärfung der Verordnung im Laufe der Jahre führte zu stetig ansteigenden Dämmschichtdicken. Die Außenwand wandelte sich von einem weitgehend homogenen Bauteil zu einem hoch spezialisierten Schichtsystem. Schutz vor zivilisationsbedingten Widrigkeiten Die wesentlichen zivilisationsbedingten Widrigkeiten, mit denen der Mensch im 20. Jahrhundert zu kämpfen hatte und die sich auf die Konstruktion der Gebäude auswirkten, waren die erhöhte Brandgefahr und die Zunahme des Verkehrs. Das Wachstum der Großstädte erforderte eine ständige Verschärfung der Anforderungen, die an den Brandschutz der Gebäude gestellt wurden. Mit der Erforschung des Brandverlaufs traten neue Verordnungen in Kraft, beispielsweise musste ein Brandüberschlag zwischen zwei Geschossen durch konstruktive Maßnahmen an der Fassade verhindert werden. Auch die Sicherstellung eines zweiten Fluchtweges und die Verwendung nichtbrennbarer bzw. schwerentflammbarer Materialien zeitigten Auswirkungen auf die Fassade. In den achtziger und neunziger Jahren nahm die Lärmbelastung durch den Straßenverkehr erheblich zu. Dies führte zu der Entwicklung von Doppelfassaden, bei der die äußerste Schicht - meist Glas - die Funktion des Schallschutzes übernahm. Eine zweite Schicht hatte zudem den Vorteil, dass die Staub- und Schmutzpartikelbelastung sowie die Belastung durch giftige Abgase gesenkt werden konnte. Sicherstellung elementarer Nutzungsanforderungen Die im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts entstandenen Gründerzeithäuser prägten auch noch Anfang des 20. Jahrhunderts das Bild vieler europäischer Städte. Der Wohlstand des Großbürgertums ließ Gebäude mit hohen Decken und großen Fenstern entstehen. Im Vergleich zu der traditionellen Bauweise verbesserte sich die Belichtung und Belüftung erheblich. Die mit der zunehmenden Industrialisierung stattfindende Landflucht führte jedoch auch zu einer engen Hinterhofbebauung, hier war die Belichtungs- und Belüftungssituation deutlich schlechter. Entscheidend für die Belichtungssituation waren die verbesserten Verfahren der Glasherstellung, insbesondere die Erfindung von maschinengezogenem Flachglas und die Erfindung des Floatglases, bei dem ein flüssiges Zinnbad ein nachträgliches Schleifen der Oberflächen entbehrlich macht. Diese Innovationen ermöglichten die industrielle Fertigung großflächiger Fenster. Die dichtere Bebauung und die Zunahme des Verkehrs in den Großstädten und die dadurch verursachte Abgasbelastung erschwerten eine natürlich Belüftung. Die Fensterlüftung wurde im Büro- und Geschäftshausbau weitgehend durch Klimaanlagen ersetzt. Erst in jüngster Zeit wurden Konzepte entwickelt, die wieder eine direkte Belüftung erlauben. Herstellungskosten Die Wirtschaftlichkeit war seit Anbeginn der Architekturgeschichte eine der wichtigsten Funktionen der Gebäude. Aufwand und Nutzen wurden stets in Relation gesetzt. Auch bei der großbürgerlichen Bauweise am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde darauf geachtet, dass beim Bau der Gebäude keine Mittel verschwendet wurden. Die Herstellungskosten waren aber nicht das wichtigste Kriterium. Es überwog das Bedürfnis, das neu erlangte Selbstbewusstsein, den eigenen Wohlstand und den zunehmenden Einfluss in der Gesellschaft durch eine aufwendige Fassadengestaltung zum Ausdruck zu bringen. Der Erste Weltkrieg, die Hyperinflation in Deutschland und die wirtschaftliche Rezession in den dreißiger Jahren bremsten diesen Enthusiasmus. Mehr und mehr wurden die aufwendigen Verzierungen durch billige in Serie hergestellte Formgussteile ersetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Herstellungskosten zum alles entscheidenden Kriterium, gespart wurde am Material, an der Dekoration und am Standard. Es ging vor allem darum, Wohnraum zu schaffen. Die Kostenersparnis einer Serienproduktion wurde intensiv genutzt. Erst in jüngster Zeit traten Zweifel am Primat der Herstellungskosten auf. Die Verslumung von Vorstädten in Ballungsgebieten sowie unbewältigte gesellschaftliche Probleme führten zu einem Umdenken. Die auf Kostenminimierung zielende Unterbringung der Menschen in Hochhäusern wurde zugunsten einer maßstäblicheren, menschlicheren und abwechslungsreicheren Architektur verworfen. Betriebskosten Im Laufe des 20. Jahrhunderts wandelten sich die Determinanten der Wirtschaftlichkeit. Die weltweite Energiekrise Anfang der siebziger Jahre und die damit verbundene Verteuerung der Heizenergie rückten die Betriebskosten in den Fokus der Wirtschaftlichkeitsüberlegungen. Nicht mehr die Herstellungskosten, sondern die Baunutzungskosten, zu denen die Betriebskosten zählen, waren für die Investitionsentscheidungen der Bauherren ausschlaggebend. Verstärkt wurde diese Entwicklung durch den Umstand, dass der Bau einer Immobilie zunehmend als Investition betrachtet wurde, die sich ebenso verzinsen musste wie andere Kapitalanlagen auch. Mit diesem Wandel fand auch das betriebswirtschaftliche Instrumentarium Einzug in die Bauwirtschaft. Mit Hilfe der Kapitalwertmethode konnten die Einnahme- und Ausgabeströme über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes kapitalisiert werden. Es wurde deutlich, dass die kumulierten Ausgaben für den Betrieb des Gebäudes ein Vielfaches der Herstellungskosten betragen. Die Bedeutung der Betriebskosten für die Rentabilität setzte eine Reihe von Neuentwicklungen im Fassadenbereich in Gang. Die angestrebte Energieeinsparung ließ sich nur noch durch einen schichtweisen Aufbau der Fassade realisieren, bei der jede Schicht eine hoch spezialisierte Funktion übernahm. Heute wird nach Lösungen gesucht, die Betriebskosten eines Gebäudes nicht nur durch passive Maßnahmen zu senken, sondern die Fassade aktiv für die Energiegewinnung zu nutzen. Imagewert Die Funktion der äußeren Hülle menschlicher Behausungen beschränkte sich nie auf den Schutz vor Widrigkeiten der Natur, stets hatte sie auch einen schmückenden Charakter und traf eine Aussage über die Bewohner bzw. den Besitzer. Ein Gebäude wird von der Öffentlichkeit in erster Linie von Außen wahrgenommen, die Fassade entscheidet über die Repräsentativität, die Ästhetik und die Akzeptanz eines Gebäudes, sie ist ein wesentlicher Bestandteil des Image- und Vermarktungswertes. Die Anfang des 20. Jahrhunderts vom Baustil der Gründerzeit geprägte Architektur hatte einen hohen Imagewert. Die Fassaden sollten vom Wohlstand, Selbstbewusstsein und Kunstsinn der Bauherrn und Nutzer verkünden. Die zunehmenden wirtschaftlichen Zwänge, die durch den Ersten Weltkrieg und die weltweite Rezession verursacht wurden, veränderten die Architektur. Nach und nach wurden die in Handarbeit hergestellten Gesimse und Pilaster durch Formgussteile ersetzt. Der Schein, der aufrechterhalten werden sollte, stand zunehmend im Widerspruch zu den wirtschaftlichen Anforderungen und den modernen Konstruktionsmethoden. Die Glaubwürdigkeit der Gebäude im historischen Stil begann zu schwinden. Ihr Imagewert nahm ab. Die große Not und schwierige wirtschaftliche Lage nach dem Zweiten Weltkrieg führten zu einer Vernachlässigung der gestalterischen und dekorativen Aspekte. Gefragt waren pragmatische und vor allem ökonomische Lösungen. Dabei wurde verkannt, welche essentielle Bedeutung die kleidende Funktion der Fassade für den Menschen hat. Erst mit zunehmendem Wohlstand trat das unterdrückte Bedürfnis, sich durch die dritte Hülle (nach der Kleidung) als Individuum zu profilieren, wieder stärker in den Vordergrund. Heute ist eine vorsichtige Renaissance der schmückenden Funktion der Fassade zu beobachten. Die Entlastung der Fassade von der tragenden Funktion ermöglicht dabei neue Wege der Gestaltung. Eine Sonderstellung bezüglich des Imagewertes stellt die Moderne dar. Die mit dem historischen Fassadenstil verbundene Entkoppelung der kleidenden Hülle von den inneren Werten des Gebäudes war einer der wesentlichen Auslösefaktoren für diesen Architekturstil. Es wurde eine Einheit von Innen und Außen angestrebt. Den Reizen des äußeren Scheins wurde die Überzeugungskraft einer Identität und Authentizität gegenübergestellt. Der durch die Moderne eingeleitete Wertewandel zu mehr Ehrlichkeit bei der Fassadengestaltung hält bis heute an. Kulturelle und gesellschaftliche Identität Architektur hatte immer eine übergeordnete Funktion für die Menschheit, sie diente als kulturelles Gedächtnis, stabilisierte die Gesellschaft und förderte das Zusammengehörigkeitsgefühl. Die kulturelle und gesellschaftliche Identität der Menschen hängt in entscheidendem Maße von der gebauten Umwelt ab. Wie groß die Sehnsucht der Menschen nach Identifikationspunkten im Stadtgefüge ist, zeigt das Beispiel der Frauenkirche in Dresden. Mit Hilfe zahlreicher privater Spenden aus dem In- und Ausland wurde dieses Wahrzeichen der Stadt wieder aufgebaut. Der historisierende Stil am Anfang des 20. Jahrhunderts knüpfte an die über Jahrhunderte gewachsene kulturelle Identität der Gesellschaft an, dies führte zu einer breiten Akzeptanz dieses Stils. Dennoch ist zu hinterfragen, ob ein derart heterogener und rückwärtsgewandter Stil wie der Historismus, bei dem verschiedene Stilepochen zum Teil wahllos miteinander kombiniert wurden, tatsächlich zu einer echten kulturellen und gesellschaftlichen Identität führen kann. Die Moderne ging einen anderen Weg, sie versuchte eine neue Form von Identität zu entwickeln. Die Architekten der Moderne passten ein Gebäude nicht an den Stil der benachbarten Bebauung an, sondern gaben jedem Gebäude einen individuellen - dem Genius loci entsprechenden - Charakter. Die Bauwerke standen im Dialog mit der Umgebung, mitunter entwickelten sie auch eine oppositionelle Haltung. Mit der Moderne wurde der Versuch unternommen, eine ehrlichere Architektursprache zu entwickeln. Mietswohnhäuser sollten nicht länger als Renaissancepaläste und Fabriken nicht als Schlösser verkleidet werden. Der Zweck der Gebäude sollte ohne verschleierndes Dekor deutlich werden. Dieser radikale, revolutionäre Wandel der Architektur führte bei einem Großteil der Bevölkerung zu Akzeptanzproblemen. Eine Identität der Bewohner mit ihrer gebauten Umwelt konnte so nicht erreicht werden. Eine schleichende Entfremdung der Menschen von der Architektur nahm ihren Anfang. In der Nachkriegszeit führten die zunehmende Kommerzialisierung und Banalisierung der Architektur dazu, dass eine gemeinsame, verbindende kulturelle und gesellschaftliche Identität mit der gebauten Umwelt kaum noch vorhanden war. Das traditionelle Bauen, das durch überlieferte Konstruktionsmethoden und Gestaltungsmerkmale zu einem harmonischen Stadtbild beitrug, musste der Rationalität des industriellen Zeilenbaus weichen. Die asketische Zeit der Nachkriegsmoderne ist heute überwunden. Es ist eine neue Lust am Gestalten der Oberfläche zu spüren. Die jüngsten Beispiele von Fassadenkonstruktionen überraschen durch ihren experimentellen und phantasievollen Umgang mit Form, Farbe und Material. Die Betonung emotionaler Elemente in der Architektur versöhnt die Menschen mit der gebauten Umwelt und schafft eine neue Identität. Nachhaltigkeit Die Achtung der Natur, die untrennbar mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit verbunden ist, begleitete den Menschen seit Anbeginn. Doch es gab immer wieder Phasen in der Menschheitsgeschichte, in denen die Belange der Natur eine untergeordnete Rolle spielten, teils aus der Not heraus, teils aufgrund eines ungezügelten Gewinnstrebens, teils aufgrund einer dominierenden Technikbegeisterung. Der Gedanke der Nachhaltigkeit spielte erst im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts wieder eine Rolle. Die beiden Ölkrisen 1973/74 und 1977 verursachten ein Umdenken. Der Gesetzgeber reagierte in Deutschland mit einer Wärmeschutzverordnung, die im Laufe der Jahre ständig verschärft wurde. Hierdurch wurde die Entwicklung neuer bzw. verbesserter Fassadentechniken angeregt. Beispiele hierfür sind Wände mit transparenter Wärmedämmung, Vakuum-Röhren-kollektoren und photovoltaische Anlagen. Ausblick Ein Schwerpunkt zukünftiger Fassadenentwicklung wird die energieeffiziente und nachhaltige Fassadenbauweise sein. Die Rentabilität eines Gebäudes hängt entscheidend von der Höhe der Energiekosten für Klimatisierung und Beleuchtung ab. Die Bemühung diese Kosten zu senken übt einen starken Innovationsdruck auf die Fassadenindustrie aus. Die reinen Herstellungskosten rücken bei Investitionsentscheidungen mehr und mehr in den Hintergrund. Durch die Energieverteuerung haben sich die ökologischen und wirtschaftlichen Ziele einander angenähert. In Zukunft ist hier mit deutlich geringeren Zielkonflikten als in der Vergangenheit zu rechnen. Die jüngste Architekturgeschichte ist von einer Bedeutungszunahme des Images eines Gebäudes geprägt. Der wachsende Profilierungsdruck in den pluralistischen und multikulturellen westlichen Gesellschaften verstärkt den Drang, individuelle Merkmale herauszubilden, um sich von der Masse zu unterscheiden. In Zeiten eines unkontrollierten Städtewachstums, eines dominierenden Kapitalismus und einer latenten Demokratiemüdigkeit wächst die Sehnsucht der Menschen nach Kristallisationspunkten einer gemeinsamen verbindenden Identität. Die Architektur befindet sich in einem Dilemma, einerseits ist die Funktion der Architektur als generationsübergreifendes Speichermedium der menschlichen Kultur wichtiger denn je, andererseits entwickelt sich die Fassade zunehmend zum Imageträger und LifestyleAccessoire und ist damit dem schnell wandelnden Zeitgeschmack unterworfen. Hier wird es in Zukunft darauf ankommen, dass die Gesellschaft trotz der Heterogenität der Architektur zu einem gesamtgesellschaftlichen Konsens findet. Ansätze hierfür sind heute schon erkennbar. Museen, Konzerthallen und Kulturzentren tragen die individuelle Handschrift der Architekten und bereichern das Stadtbild gerade durch ihre polarisierende Wirkung. Das Guggenheim Museum in Bilbao von Frank O. Gehry, das Centre Pompidou in Paris von Richard Rogers und Renzo Piano und das Opernhaus in Sydney von Jörn Utzon sind Beispiele für die identitätsstiftende Wirkung individueller Bauwerke in den Brennpunkten der Städte. Nur wenn sich die am Planungs- und Bauprozess Beteiligten über die Vielzahl der Funktionen, die eine moderne Fassade zu erfüllen hat im Klaren sind – dazu gehören neben den technischen und wirtschaftlichen insbesondere auch die gesellschaftlichen Funktionen – kann das Risiko einer Fehleinschätzung der Marktchancen eines neu entwickelten Fassadensystems minimiert werden. Die in dieser Arbeit aufgezeigten komplexen Wirkungszusammenhänge, die für Änderungsprozesse in der Architektur verantwortlich sind, stellen eine Grundlage für die Entwicklung neuer Verfahren zur Chancen- und Risikoabschätzung von Fassadensystemen dar.