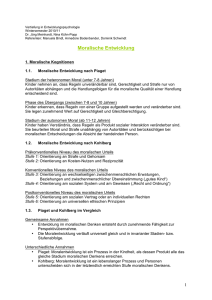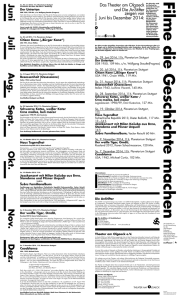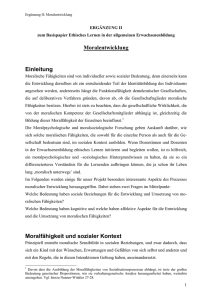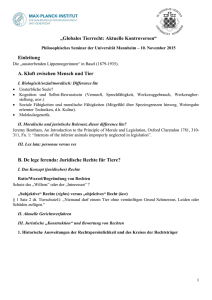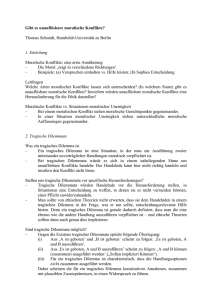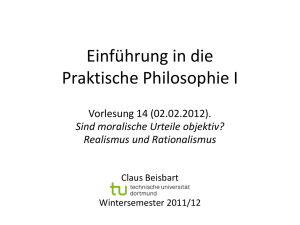Gefühle in Ernst Tugendhats Konzeption von
Werbung
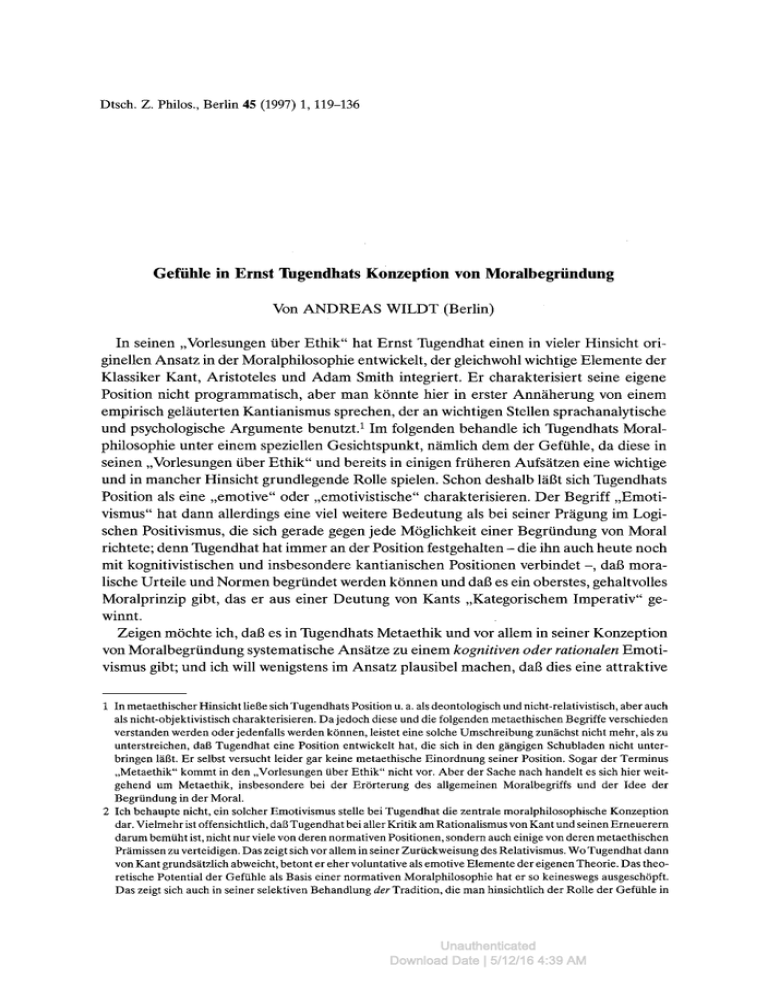
Dtsch. Ζ. Philos., Berlin 45 (1997) 1, 119-136 Gefühle in Ernst Tugendhats Konzeption von Moralbegründung Von ANDREAS WILDT (Berlin) In seinen „Vorlesungen über Ethik" hat Ernst Tugendhat einen in vieler Hinsicht originellen Ansatz in der Moralphilosophie entwickelt, der gleichwohl wichtige Elemente der Klassiker Kant, Aristoteles und Adam Smith integriert. Er charakterisiert seine eigene Position nicht programmatisch, aber man könnte hier in erster Annäherung von einem empirisch geläuterten Kantianismus sprechen, der an wichtigen Stellen sprachanalytische und psychologische Argumente benutzt. 1 Im folgenden behandle ich Tugendhats Moralphilosophie unter einem speziellen Gesichtspunkt, nämlich dem der Gefühle, da diese in seinen „Vorlesungen über Ethik" und bereits in einigen früheren Aufsätzen eine wichtige und in mancher Hinsicht grundlegende Rolle spielen. Schon deshalb läßt sich Tugendhats Position als eine „emotive" oder „emotivistische" charakterisieren. Der Begriff „Emotivismus" hat dann allerdings eine viel weitere Bedeutung als bei seiner Prägung im Logischen Positivismus, die sich gerade gegen jede Möglichkeit einer Begründung von Moral richtete; denn Tugendhat hat immer an der Position festgehalten - die ihn auch heute noch mit kognitivistischen und insbesondere kantianischen Positionen verbindet - , daß moralische Urteile und Normen begründet werden können und daß es ein oberstes, gehaltvolles Moralprinzip gibt, das er aus einer Deutung von Kants „Kategorischem Imperativ" gewinnt. Zeigen möchte ich, daß es in Tugendhats Metaethik und vor allem in seiner Konzeption von Moralbegründung systematische Ansätze zu einem kognitiven oder rationalen Emotivismus gibt; und ich will wenigstens im Ansatz plausibel machen, daß dies eine attraktive 1 In metaethischer Hinsicht ließe sich Tugendhats Position u. a. als deontologisch und nicht-relativistisch, aber auch als nicht-objektivistisch charakterisieren. Da jedoch diese und die folgenden metaethischen Begriffe verschieden verstanden werden oder jedenfalls werden können, leistet eine solche Umschreibung zunächst nicht mehr, als zu unterstreichen, daß Tugendhat eine Position entwickelt hat, die sich in den gängigen Schubladen nicht unterbringen läßt. Er selbst versucht leider gar keine metaethische Einordnung seiner Position. Sogar der Terminus „Metaethik" kommt in den „Vorlesungen über Ethik" nicht vor. Aber der Sache nach handelt es sich hier weitgehend um Metaethik, insbesondere bei der Erörterung des allgemeinen Moralbegriffs und der Idee der Begründung in der Moral. 2 Ich behaupte nicht, ein solcher Emotivismus stelle bei Tugendhat die zentrale moralphilosophische Konzeption dar. Vielmehr ist offensichtlich, daß Tugendhat bei aller Kritik am Rationalismus von Kant und seinen Erneuerern darum bemüht ist, nicht nur viele von deren normativen Positionen, sondern auch einige von deren metaethischen Prämissen zu verteidigen. Das zeigt sich vor allem in seiner Zurückweisung des Relativismus. Wo Tugendhat dann von Kant grundsätzlich abweicht, betont er eher voluntative als emotive Elemente der eigenen Theorie. Das theoretische Potential der Gefühle als Basis einer normativen Moralphilosophie hat er so keineswegs ausgeschöpft. Das zeigt sich auch in seiner selektiven Behandlung der Tradition, die man hinsichtlich der Rolle der Gefühle in Unauthenticated Download Date | 5/12/16 4:39 AM 120 Andreas Wildt, Gefühle in Tugendhats Moraltheorie moralphilosophische Position darstellt. 2 Es liegt mir viel daran, daß die Kritik, die ich an Tugendhats Durchführungen übe, stets in diesem affirmativen Rahmen verstanden wird. Darüber hinaus enthält sein Buch tiefschürfende Überlegungen zu Themen, die von den hier behandelten Fragen unabhängig sind, insbesondere seine Rekonstruktion des Standpunkts der modernen Moral, der Gerechtigkeit und der Menschenrechte 3 , seine Tugendlehre und seine Theorie der moralischen Motivation. Bei Tugendhats „Vorlesungen über Ethik" handelt es sich deshalb meines Erachtens um das bedeutendste deutschsprachige Werk unserer Zeit zur Moralphilosophie. Bei seiner Lektüre habe ich manchmal den Eindruck, die Moralphilosophie beginne mit Tugendhat erst. 4 Ich behandle hier erstens Tugendhats emotivistische Explikation des Begriffs einer Moral. Zweitens behandle ich seine Explikation des moralischen Begründens und Verpflichtetseins. Ich schließe mit einer Kritik an seinen Überlegungen zur inhaltlichen Reichweite der modernen Moral. 5 1. Zum Begriff einer Moral Tugendhat legt großen Wert darauf, daß die Moralphilosophie nicht mit der Frage nach der Begründung von moralichen Urteilen oder Normen, sondern mit der nach einem allgemeinen, formalen Moralbegriff oder, wie er mit vorbildlicher Klarheit sagt, mit dem Begriff - nicht so sehr „der" als - „einer" Moral zu beginnen habe; und er wirft der bisherigen Moralphilosophie vor, sie habe diese Frage zu ihrem eigenen Schaden vernacherster Linie als seine historische Quelle verstehen kann, nämlich der empiristischen Moralphilosophie, die von David H u m e und A d a m Smith entwickelt wurde. Dennoch bin ich der Meinung, das entscheidende Verdienst der moralphilosophischen Arbeiten von Tugendhat liegt gerade darin, Wege zu einem kognitiven oder rationalen Emotivismus eröffnet zu haben. 3 Zu diesen Themen vgl. Wildt (1996a, b). 4 Wie so oft bei bahnbrechenden philosophischen Werken zeigt sich dies mehr in der Eröffnung neuer Perspektiven als in einer voll befriedigenden Durchführung. An dieser Stelle möchte ich auf eine formale Schwäche von Tugendhats Buch hinweisen, die sich bis zu einem gewissen Grade aus ihrer literarischen Form von Vorlesungen erklärt. Tugendhat behandelt nämlich bestimmte Thematiken oft schon in früheren Vorlesungen und vollzieht dann später - manchmal überraschende - „Revisionen", Abschwächungen oder Verschärfungen seiner Thesen (u. a. in der 9., 11., 16. und 17. Vorl.), ohne dies vorher angekündigt zu haben und auch ohne es immer explizit zu machen. Daraus ergeben sich erhebliche Schwierigkeiten für die Lektüre und Interpretation. Nach meiner Erfahrung neigen gerade Leser, die mit Tugendhats Denken besonders vertraut sind, dazu, sein Buch quasi von hinten zu lesen, also von seiner Theorie der Gerechtigkeit, der Motivation oder der Tugenden her. Das mag Tugendhats eigenen Perspektiven entsprechen. (Eine theoretisch fundamentale Stellung der - kontraktualistisch verstandenen - Gerechtigkeit in der modernen Moral versucht Tugendhat in seinem neuesten Aufsatz aufzuweisen, s. auch u. Anm. 27.) Ich folge dem jedoch nicht, weil ich der Meinung bin, daß in den ersten Teilen des Buches systematische Ansätze enthalten sind, die durch die späteren Teile eher verdunkelt als in der Sache überholt werden könnten. Für Diskussionen zu diesem Aspekt danke ich Christoph Demmerling, Hilge Landweer und Christiane Voss. 5 Ein großer Vorzug von Tugendhats Arbeiten liegt darin, daß sie Grundfragen der Moralphilosophie in ungewöhnlicher Klarheit unterscheiden und in eigenständigen Gedankengängen beantworten, nämlich: die Frage nach dem allgemeinen Moralbegriff oder dem Begriff einer Moral; die nach dem Sinn des moralischen Sollens und Begründens, d. h. die nach dem Sinn von moralischer Verbindlichkeit, Gültigkeit oder Richtigkeit; die nach dem normativen Gehalt unserer modernen Moral, auch bzgl. der zugehörigen Tugenden; und schließlich die „Motivationsfrage" im Sinne der Frage nach den Gründen dafür, moralisch zu sein, sein zu wollen oder zu sollen. Aus diesen Unterscheidungen ergäbe sich ohne weiteres die Gliederung für eine umfassende Untersuchung der Rolle der Gefühle in Tugendhats Moralphilosophie. Aus Platzgründen muß ich mich jedoch im folgenden im wesentlichen auf die beiden ersten Punkte beschränken. Das ist bedauerlich, weil Tugendhat auch hinsichtlich der anderen Themen sehr wichtige Ideen zum zentralen Stellenwert von Gefühlen in der Moral entwickelt hat. Unauthenticated Download Date | 5/12/16 4:39 AM 121 Dtsch. Ζ. Philos. 45 (1997) 1 lässigt.6 Man vermißt jedoch bei Tugendhat eine überzeugende Aussage darüber, warum die Klärung des Begriffs einer Moral für die normativ gerichtete Moralphilosophie so wichtig sein soll. Seine explizite Begründung in den „Vorlesungen" lautet, daß deren Hauptaufgabe heute weniger in der Kritik am prinzipiellen Egoismus oder Amoralismus bestehe als in der Auseinandersetzung zwischen verschiedenen inhaltlichen Moralkonzeptionen; diese sei aber nur sinnvoll, wenn klar sei, was diese Konzeptionen eben zu Mora/konzcptionen mache. Das ist sicher ein korrektes Argument, aber relevant ist es doch nur, sofern' es ernsthafte Meinungsverschiedenheiten darüber gibt, welche Konzeptionen als solche von Moral anzuerkennen sind. Nun gibt es diese natürlich, aber sie ließen sich jedenfalls im Deutschen (kaum allerdings im Englischen oder Französischen) einfach durch Orientierung an der Umgangssprache vermeiden. Denn „Moral" ist hier immer (oder fast immer) etwas, was mit dem „Gewissen" zu tun hat; und das Wort „Gewissen" bezeichnet ziemlich eindeutig Moralität im engeren Sinne. Entsprechendes gilt für eine frühere Begründung von Tugendhat.7 Die genauere Lektüre seiner Schriften zeigt nun, daß für ihn die Klärung des Begriffs einer Moral deshalb so wichtig ist, weil sie entscheidende Vorklärungen dessen erlaubt, wie die Frage der Moraibegründung verstanden werden muß. Sie zeigt nämlich nach Tugendhat erstens, daß die moralspezifische Rede von „gut/schlecht" nur als implizite Rede über Personen als solche verstanden werden kann (55), und daß zweitens Moral immer etwas ist, was eine Gemeinschaft wechselseitiger Forderungen betrifft (41,59 ff.). An beiden Thesen werde ich Zweifel begründen, bin aber gleichwohl der Ansicht, daß die emotivistische Klärung des Begriffs einer Moral die entscheidende Vorarbeit für die Klärung der zentralen Frage ist, worin eine überzeugende Begründung von moralischen Normen und damit das moralische Verpflichtetsein selbst bestehen. Ich beginne jetzt mit der inhaltlichen Prüfung von Tugendhats Vorschlägen zur Explikation des Begriffs einer Moral. Zunächst sucht Tugendhat nach einem sprachlichen Kriterium zur Abgrenzung moralischer Urteile und findet es in der „grammatisch absoluten" Verwendungsweise von einerseits „müssen/sollen" (2. Vorl.) und andererseits von „gut/schlecht" (3. Vorl.). Er 6 Dieser Vorwurf ist zunächst erstaunlich; denn schon im angelsächsischen Empirismus hat man sich immer wieder bemüht, das Spezifische der moralischen Urteile und Normen gegenüber praktischen Urteilen und Werten im allgemeinen anzugeben (s. H u m e [1978], 210 f.; ders. [1984], 200 ff.; vgl. Wildt [1993a]; Smith, 2. Teil; Mill, 84 ff.; Westermarck; Strawson). U n d aus Kants Grundunterscheidung von „kategorischen" und „hypothetischen" Imperativen läßt sich, soweit sie überhaupt verständlich ist, dies Spezifikum ohne weiteres gewinnen. Vor allem aber besteht die Metaethik unseres Jahrhunderts wesentlich in dem Versuch, die Struktur moralischer Sätze aufzuklären - und damit auch den Begriff einer Moral. Wenn man dann allerdings die mageren Resultate dieser Debatte zur Kenntnis nehmen muß (z. B. Wallace/Walker; dazu Wildt [1993b)], 190), so wird man wohl zugeben, daß Tugendhats Vorwurf weitgehend berechtigt ist. Allerdings sollte dieser dann nicht so lauten, daß die bisherige Philosophie diese Frage „ignoriert", sondern daß sie diese „in ihrer Wichtigkeit bisher nicht begriffen habe" (46; Nachweise durch bloße Zahlen beziehen sich im folgenden auf die „Vorlesungen über Ethik"). Besonders im Umkreis der Diskursethik wird allerdings oft angemommen, daß sich die Frage des allgemeinen Moralbegriffs von den normativen Fragen gar nicht trennen läßt (s. Wingert, 24,69,159,163). 7 Hier begründet Tugendhat die Notwendigkeit der Klärung des formalen Moralbegriffs auch mit dem Argument, sie sei die Voraussetzung dafür, jene „Alternative überhaupt zu verstehen", die sich stellt, seitdem starke, nämlich absolute, traditionalistische oder metaphysische Moralbegründungen nicht mehr überzeugen können: „Beibehaltung einer Moral im bisher üblichen Sinn mit schwächerer Begründung oder Rekurs auf ein Moralsubstitut" (1989,316). Die Abgrenzung von einem Moralsubstitut verstehen wir schon dadurch, daß wir alltäglich verstehen, was es heißt, ein Gewissen zu haben. Natürlich ist es eine typisch philosophische Aufgabe zu explizieren, was das eigentlich bedeutet, aber diese Explikation ist nicht nötig dafür, daß wir verläßlich imstande sind, diesen Unterschied zu machen. Unauthenticated Download Date | 5/12/16 4:39 AM 122 Andreas Wildt, Gefühle in Tugendhats Moraltheorie beschreibt diese Verwendungsweise von „müssen" so, daß hier die Rückfrage „relativ wozu?" oder „und was würde passieren, wenn ich es nicht tue?" zurückgewiesen würde. (36) Das kann jedoch nicht die angemessene Beschreibung sein, da Tugendhat dann selbst zeigt, daß auch das moralische Müssen relativ ist auf eine soziale Sanktion und diese wiederum auf ein bestimmtes Selbstverständnis oder Sein-Wollen-wie. Die schlichte Zurückweisung der Nachfrage wäre demnach auch beim moralischen Müssen sinnwidrig, nämlich Ausdruck eines falschen Verständnisses dieser Art von Müssen.8 Trotzdem kann man wohl sagen: Beim moralischen Müssen gibt es eine wohlmotivierte Tendenz, die Nachfrage zurückzuweisen, da nämlich die Antwort auf diese Frage normalerweise (s. u.) gleich lauten müßte und insofern wenig informativ wäre.9 Um nun die genannten äußeren, sprachlichen Identifikationsmerkmale für moralische Urteile in ihrem Sinn zu explizieren, geht Tugendhat davon aus, daß jede Rede von „sollen/ müssen" auf eine Weise der Begründung und jede Rede von einem praktischen „sollen/ müssen" auf eine Sanktion verweist. Das zeigt bereits, daß diese Redeweisen keineswegs einen absoluten, sondern einen relativen Sinn haben. Für die Moral ist nun eine Weise der sozialen Sanktionierung spezifisch, die er als Zusammenspiel von Tadel, Empörung, „zentraler" Scham und Schuldgefühl beschreibt.10 Tugendhat neigt zu der Meinung, daß die genannten Phänomene seien jeweils bereits für sich genommen moralspezifisch.11 Das ist jedoch ein Irrtum, den er auch an späterer Stelle teilweise korrigiert. Hier sagt er, daß es nicht-moralische Formen von Tadel (47, 236 f.) und von einer Scham gibt, die insofern zentral ist, als sie die Person als solche und nicht bloß in einer Funktion oder Rolle trifft (237); aber das gilt meines Erachtens auch für Empörung und Schuldgefühl.12 8 Tugendhat spricht dementsprechend einmal von „der lediglich (! A. W.) grammatisch absoluten Form". (48) Andererseits spricht er dann wieder von der „grammatisch absolut verstandenen (! A. W.) Rede von >gut<". (79) 9 Ein Problem liegt weiterhin darin, daß Tugendhat die grammatisch absoluten Verwendungsweisen von „müssen" und „gut/ schlecht" zunächst als „äquivalent" behauptet, dann jedoch zugibt, jenes Müssen sei nicht notwendig mit diesem Werturteil verbunden, nämlich nicht bei bloßen sozialen Konventionen, den „Sitten". (47 vs. 237) Zweitens expliziert Tugendhat die moralspezifische Redeweise von „gut/schlecht" so, daß sie auch auf gewisse Formen des Selbstverhältnisses paßt, das in der modernen Moral meist gerade nicht als Gegenstand moralischer Urteile verstanden wird. (235 f.) Eine dritte Schwierigkeit besteht darin, daß Tugendhat gar nicht erwähnt, daß die Bedeutungen von „gut" und „schlecht" in der Moral nicht durch Negation ineinander überfuhrt werden können. Was moralisch noch nicht gut ist, ist deshalb noch lange nicht moralisch schlecht; und was moralisch nicht schlecht ist, ist deshalb - im naheliegendsten Sinne - noch lange nicht moralisch gut. Wenn alle Verletzungen moralischer Verpflichtungen moralisch schlecht sind, so sind deren Nicht-Verletzungen deshalb noch nicht „gut" im Sinne von lobenswert oder verdienstvoll (und das hieße vor allem: supererogatorisch gut). Jedes Handeln im Interesse anderer ist nur in einem schwachen Sinne moralisch „gut", sofern es weder moralische Verpflichtungen gegenüber Dritten noch fundamentale Interessen des Handelnden selbst verletzt. Es gibt aber einen Bereich des Moralisch-Guten, der jenseits aller Verpflichtungen und damit alles Müssens oder Sollens liegt. Dieser, wie ich sagen möchte, „superobligatorische" Bereich der Moral - es ist üblich, aber nicht korrekt (s. Fußn. 12), hier von „supererogatorisch" zu sprechen, - wird von Tugendhats Begriff einer Moral ausgegrenzt. Das scheint mir sowohl von der Umgangssprache als auch von den sachlichen Zusammenhängen her unangemessen, und es ist jedenfalls keine notwendige Folge davon, daß Tugendhat die Explikation des Moralbegriffs auf der des Müssens auftaut. Im folgenden werde ich den superobligatorischen Bereich der Moral jedoch nicht weiter berücksichtigen, um überkomplexe Formulierungen zu vermeiden. 10 Auf die Einzelheiten dieser Skizze für eine Moral-Phänomenologie kann ich hier leider nicht eingehen. Sie scheint mir in den verschiedenen Texten von Tugendhat im übrigen auch nicht ganz einheitlich. Die wichtigsten Sachprobleme habe ich in meinem Aufsatz Uber Moralspezifizität von Affekten diskutiert. (Wildt 1993b) 11 Zu Empörung: 20, zu Schuldgefühl: 21, zu zentraler Scham: 57 ff., zu Tadel: 58 f. 12 Wildt (1993b), 195 ff., 204 ff. Leider wird auch sonst in der Philosophie der Gegenwart meist unterstellt, daß das Gegenteil der Fall ist (etwa von Gibbard, 126 ff.). Tugendhat scheint zu glauben, all diese Sanktionen seien - Unauthenticated Download Date | 5/12/16 4:39 AM 123 Dtsch. Ζ. Philos. 45 (1997) 1 Tugendhats eigentliche Idee scheint jedoch zu sein, daß es erst die Korrelation der genannten fremdbezogenen Affekte und Praktiken mit den genannten selbstbezogenen Affekten ist, die eine Moral konstituiert. (59) Diese Korrelation beschreibt er so: „So gut sich die moralische Scham in das umfassendere Phänomen der Scham angesichts auch anderen Versagens (oder vermeintlichen Versagens) fügt, so deutlich ist die moralische Scham doch von der sonstigen Scham verschieden. Das wird besonders sichtbar, wenn wir uns fragen, wie die emotionale Reaktion des Gegenüber in beiden Fällen aussieht. Im gewöhnlichen Fall ist das Publikum entweder emotional unbeteiligt oder, wenn es doch eine Emotion empfindet, besteht diese im Sichlustigmachen über den Betreffenden. Wenn hingegen die Person moralisch versagt, ist das Gegenüber nie emotional neutral, und sie belustigt sich auch nicht, sondern sie reagiert empört und tadelnd." (58) Diese Beschreibung scheint mir nicht ganz zutreffend. Erstens ist die Reaktion der anderen im Falle nichtmoralischer Scham oft durchaus affektiv, insbesondere verachtend. Zweitens kann es sich auch bei Scham, die auf Empörung reagiert, um außer-moralische Scham handeln, z. B. wegen Faulheit, mangelnder Hygiene, Banausentum, Inkompetenz oder Unanständigkeit im Sinne von „schlechtem Benehmen". 13 Weiter führt jedoch eine Beschreibung, die Tugendhat allerdings nur in dem Aufsatz gegeben hat, der den „Vorlesungen über Ethik" am nächsten steht: „Insofern ist Empörung das genaue Spiegelbild moralischer Scham: Es ist die Empörung der anderen, die wir in der moralischen Scham fürchten (die Empörung gehört zum intentionalen Gehalt der Scham)." (1993b, 38) Was ist das Moralspezifische an dieser intentionalen Korrelativität? Die Rede vom „intentionalen Gehalt" besagt zunächst, das Subjekt der moralischen Scham glaubt, daß die anderen sich empören oder empören werden. Weiterhin bedeutet sie hier, daß das Subjekt diese Empörung fürchtet und d. h. auch, daß es wünscht, daß sie nicht geschieht. Entsprechend gilt, daß der Sich-Empörende glaubt, daß sein Gegenüber sich schämt, oder daß er wünscht, daß er dies tut.14 Scham und Schuldgefühl sind weiterhin nicht nur das selbstbezügliche „Pendant" 15 von fremdbezogenen Affekten, vor allem von Verachtung und Empörung, sondern sie sind auch von besonderen Funktionen in der Reaktion auf diese Affekte geprägt. So ist für Gibbards evolutionäre Deutung der moralischen Gefühle zentral, daß der Ausdruck von Schuldgefühl dazu geeignet ist, Zorn und Empörung zu besänftigen. Das liegt vor allem daran, daß zum Schuldgefühl eine Tendenz zur Wiedergutmachung gehört. Aber auch unmittelbar durch Gefühle oder deren Ausdruck - bei jeder Verletzung von gültigen moralischen Normen wohlmotiviert. Es gibt jedoch moralische Verpflichtungen, die nicht so stark sind, daß Empörung bei deren Verletzung angemessen wäre. Das gilt mindestens für die supererogatorischen Verpflichtungen, also die moralischen Verpflichtungen, die zu schwach sind, um Korrelate moralischer Rechte zu sein; diese schwachen Verpflichtungen werden von Tugendhat leider nicht berücksichtigt, obwohl ihm Verpflichtungen zu gewissen anspruchsvollen Tugenden - wie Versöhnlichkeit - wichtig sind, die man meines Erachtens nur als schwache, supererogatorische verstehen kann. Im folgenden werde ich jedoch mit Tugendhat nur die starken - man könnte sagen „erogatorischen" - Verpflichtungen berücksichtigen, für deren Sanktionierung Empörung angemessen ist. 13 Schmitz, 32; Wildt (1993b), 202 f. 14 Ähnlich Gibbard, 6,40 ff. Das wiederum könnte man als einen Grund dafür ansehen, die moralische Scham selbst als internalisierte Empörung zu verstehen, was Tugendhat in den „Vorlesungen" (60) auch tut. Das ist jedoch inadäquat (vgl. Gibbard, 139). Sicher enthält die moralische Scham eine Internalisierung der Anklage, die in der Empörung liegt, aber das gilt ebenso für moralische Schuldgefühle. U n d Schuldgefühle lassen sich eher als eine Art von Empörung oder Zorn beschreiben (s. Schmitz, 639 ff.), als Scham, aber k a u m als Empörung über sich selbst. 15 So Tugendhat (1989), 318. Unauthenticated Download Date | 5/12/16 4:39 AM 124 Andreas Wildt, Gefühle in Tugendhats Moraltheorie weitergehende Versöhnungsimpulse gehören dazu, insbesondere die Tendenz, Verfehlungen einzugestehen, um Verzeihung zu bitten und Strafen zu akzeptieren. 16 Solche volitiven Zusammenhänge zwischen sanktionierenden Fremd- und Selbstaffekten sind jedoch, für sich genommen, noch nicht geeignet, das Spezifische moralischer Sanktionen zu bestimmen. Wenn Tugendhat hier von einem „intentionalen" Zusammenhang spricht, so meint er damit wohl vor allem einen Zusammenhang durch Meinungen oder Urteile. Meines Erachtens handelt es sich hierbei nicht nur um Meinungen über das gegenwärtige oder zukünftige Vorkommen von entsprechenden Gefühlen bei anderen. Wenn ich Schuldgefühle habe, weil ich eine (starke, s. Fn. 12) moralische Verpflichtung verletzt habe, so glaube ich nicht notwendig, daß sich die anderen darüber empören oder empören werden, falls sie davon erfahren. Ich glaube aber, sie hätten gute Gründe, dies zu tun. Entsprechendes glaube ich von anderen, wenn ich darüber empört bin, daß ein anderer eine (starke) moralische Verpflichtung verletzt hat. Ich glaube dann nicht notwendig, daß der Täter Schuldgefühle hat oder haben wird und daß Dritte sich darüber empören werden, aber ich glaube, alle diese hätten Grund zu jenen Affekten. Solche Meinungen sind konstitutiv nicht nur für moralische Gefühle, sondern bereits für jede moralische Meinung. Wenn ich glaube, jemand hat eine moralische Verpflichtung verletzt, so glaube ich, daß dieser und andere Grund haben, bestimmte Affekte zu haben. Dieser Glaube an das Begründetsein bestimmter Affekte für gewisse - evtl. strikt alle - Personen scheint es zu sein, durch den moralische Urteile und folglich der Begriff einer Moral zu explizieren wäre. 17 Nun hat Tugendhat allerdings gar keinen Versuch gemacht, diesen Weg zu verfolgen. Vermutlich schienen ihm die Schwierigkeiten, die man hier sehen kann, unüberwindlich. Sein nächster Schritt ist vielmehr, daß moralische Urteile über Handlungen nur als implizite Werturteile über Personen als solche verstanden werden können und deshalb zur Explikation des Moralbegriffs auch nur das an den Gefühlen entscheidend ist, was sich auf die Bewertung von Personen als solchen bezieht. Tugendhat sagt selbst, daß er die Notwendigkeit dieser überraschenden Wendung nicht beweisen kann (56), und er erklärt sie lediglich narrativi Früher habe er den Versuch gemacht, die Frage nach dem Sinn des grammatisch alsoluten Guten „direkt" zu beantworten, nämlich durch „gleichmäßig gut für alle". Seitdem er aber erkannt habe, daß das höchstens für ein spezielles inhaltliches Moralkonzept angemessen sein könne, sei er zu der Auffassung gelangt, „daß es eine direkt zu verstehende Bedeutung der grammatisch absoluten Verwendungsweise von >gut< gar nicht gibt, sondern daß diese auf eine ausgezeichnete attributive Verwendungsweise zurückweist, die, in der wir sagen, jemand sei nicht als Geiger oder Koch, sondern als Mensch oder als Mitglied der Gemeinschaft, als Sozialpartner bzw. als Kooperationspartner gut. Das hieße, daß >gut< in diesem Sinne nicht primär auf Handlungen bezogen ist, sondern auf Personen. Daß >gut< im moralischen Sinn in dieser Weise zu verstehen ist, war schon die Auffassung von Aristoteles. Ich kann diesen Schritt 16 Vgl. Gibbard, 139; Wildt (1993b), 210. Gibbard Ubertreibt allerdings die genannte Eignung des Schuldgefühls. Schuldgefühle können auch verschließen, und der entsprechende Ausdruck kann Empörung gerade provozieren oder anheizen. Ausdruck von Scham ist demgegenüber viel besser geeignet, Empörung zu besänftigen, was im übrigen schon Schmitz (46 f.) beschrieben hat. 17 Ähnlich bereits Mill, 84. Es ist also eine falsche Voraussetzung, daß die empiristische These, Sanktionen seien für den Sinn des moralischen Sollens konstitutiv, mit dem Begründungsanspruch moralischer Normen unvereinbar sei. (So jedoch Habermas [1991], 144 ff.; Forst, 380 ff.) Unauthenticated Download Date | 5/12/16 4:39 AM 125 Dtsch. Ζ. Philos. 45 (1997) 1 nicht beweisen. Aber wir werden sehen, daß er eine Wirkliche Aufklärung der grammatisch absoluten Bewertung zuläßt. Gut, wie Aristoteles es versteht, ist eine Handlung dann, wenn sie die Handlung eines guten Menschen ist." (Ebd). Diese Strategie ist meines Erachtens undurchführbar. Es hilft nicht viel, eine moralisch gute Handlung als die Handlung eines moralisch guten Menschen zu definieren, weil man einen moralisch guten Menschen wiederum nur mit Rekurs mindestens auf moralisch gute Handlungen definieren kann, etwa als einen Menschen, für den (mindestens) gilt, daß er zuverlässig oder jedenfalls unter normalen Bedingungen moralisch gut handelt. Anscheinend gehört zu einem moralisch guten Menschen mehr als moralisch gute Handlungen, nämlich auch moralische Tugenden, Gefühle und Haltungen; und Tugendhat legt Wert darauf, daß diese Haltungen nicht zureichend als Dispositionen zur Befolgung moralischer Handlungsiegein gefaßt werden können. (11. und 13. Vorl.) Aber auch jene Handlungsdispositionen gehören zu einem guten Menschen. Mit deren Hilfe kann man aber natürlich nicht zirkelfrei explizieren, was eine moralisch gute Handlung ist.18 Ein weiterer Grund, warum für Tugendhat die aristotelische Strategie überzeugend ist, ist sicher, daß er immer wieder davon ausgeht, daß Scham - und nicht Schuldgefühl - der entscheidende selbstbezogene Affekt in der Moral ist. Es leuchtet in der Tat ein, daß die moralische Scham die Person zentraler, mehr in ihrem Kern, trifft als das moralische Schuldgefühl. Das sieht man vor allem daran, daß Schuldgefühle bestenfalls zu Verhaltenst nderungen motivieren, Scham jedoch als eine Art Bestürzung darüber, was für ein Mensch man ist, der entscheidende Motor zur Veränderung von Einstellungen und damit zur moralischen .S'e//wfveränderung ist. Genau das zeigt jedoch meines Erachtens, daß es problematisch ist, zur allgemeinen Explikation moralischer Urteile speziell auf den Affekt der Scham zu rekurrieren; denn dafür ist nur ihr Sanktionsaspekt relevant, der eher beim Schuldgefühl moralspezifisch ist. Nun gibt Tugendhat in der 11. Vorlesung zu, daß sich die zentrale Scham als negatives Gefühl der Selbstbewertung als Mensch auch auf die generellen nicht-moralischen, nämlich selbstbezogenen Tugenden beziehen kann und deshalb zur Explikation des Moralbegriffs ein Rekurs auf das Schuldgefühl erforderlich ist. (237) Damit gibt Tugendhat seine Orientierung an der Scham jedoch nicht auf, denn er berücksichtigt das (moralische) Schuldgefühl nicht als etwas, was voader Scham unabhängig sein kann und sich primär auf Handlungen bezieht, sondern lediglich als ein Moment in der moralischen Scham. (Ebd.).19 18 Vgl. den Beitrag von Christoph Demmerling in diesem Heft. Tugendhat könnte seine Strategie hier mit der These verteidigen, daß mindestens die wichtigsten moralischen Beurteilungen von Handlungen, die nämlich den Handelnden zugleich für seine Handlung moralisch verantwortlich machen, im G r u n d e schon Beurteilungen von Personen sind. Das sehe man auch an dem Affekt der Empörung, der nicht nur auf die Handlungen ziele, sondern durch diese hindurch auf die handelnden Personen, um diese nämlich zur Änderung ihrer Handlungsregeln, ihrer Einstellungen und ihrer Gesinnung zu motivieren. Das sind wichtige Klarstellungen. Sie ändern aber nichts daran, daß es moralische Beurteilungen von Handlungen gibt, die sich nicht in dieser Weise auf die Personen selbst beziehen, und daß sie dann, wenn sie das tun, sich nicht auf die Personen als solche oder im Ganzen beziehen, sondern nur so, wie diese sich in ihren Handlungen manifestieren. 19 Gibt es bei Tugendhat noch weitere G r ü n d e dafür, sich in der Explikation des Begriffs einer Moral durch selbstbezogene Affekte speziell an der Scham zu orientieren? Diese Frage stellt sich auch deshalb, weil sich Tugendhat gerade in dieser Hinsicht von Strawson unterscheidet, auf den er sich sonst in der Analyse der moralischen Gefühle gerne beruft. Tugendhat nennt in dem früheren Aufsatz den Grund, daß es in vielen Kulturen den Begriff des Schuldgefühls nicht gibt, aber stets den der Scham, der dabei auch vorzüglich die moralische Bedeutung hat. (1989,317 f.) Das scheint mir kein starkes Argument. Erstens könnte es sein, daß in diesen Kulturen Unauthenticated Download Date | 5/12/16 4:39 AM 126 Andreas Wildt, Gefühle in Tugendhats Moraltheorie Es scheint also keine überzeugenden Gründe dafür zu geben, Tugendhats Strategie einer „indirekten" Explikation der prädikativen Rede von „gut/schlecht" weiterzuverfolgen, sofern „indirekt" hier heißt: durch Explikation eines besonderen, attributiven Sinnes von „gut/schlecht". Wir müssen jetzt abschließend wenigstens im Ansatz klären, ob dieses Ergebnis das Programm einer emotivistischen Explikation des Begriffs einer Moral in Frage stellt. Wie schon deutlich geworden sein sollte, bin ich keineswegs dieser Meinung.20 Was soll es positiv heißen, daß Personen glauben, Grund zu haben, unter bestimmten Bedingungen bestimmte moralische Gefühle zu haben, wenn es - bei Strafe eines Zirkels gerade nicht heißen kann, daß sie glauben, es sei moralisch gut, daß sie diese Affekte haben? An diesem Punkt ist der Rekurs auf traditionalistische oder andere autoritative Moralkonzeptionen hilfreich, deren Berücksichtigung für Tugendhats Vorgehen charakteristisch ist. Im Rahmen einer religiös begründeten Moral bedeutet der Glaube, es sei moralisch schlecht, etwas Bestimmtes zu tun - also der Glaube, daß alle Grund haben, auf diese Tat mit bestimmten negativen Affekten zu reagieren - , der Glaube, Gott habe verboten, dies zu tun, oder ihn würde dies kränken. Der angenommene Grund für diese Affekte ist also ein angenommener Akt oder Affekt Gottes. Ähnliches gilt in einer traditionalistischen Moral für die traditionsbildenden Autoritäten. Nur ist hier ein weiterer Glaubensakt offensichtlich notwendig, der nämlich eine Instanz zu dieser bindenden Autorität macht. Daß Gottes Wille moralisch bindend ist, gilt demgegenüber meist als selbstverständlich. Die entscheidende Frage ist nun natürlich, was der Glaube, alle hätten Grund für moralische Affekte, in einer nicht-autoritätsgebundenen Moral bedeutet, die sich also - in einem das Wort für Scham eben auch Schuld b e d e u t e t - das versucht etwa Williams ([1993] 75 ff., u. a. 90,219 ff.) für das Griechische zu zeigen. U n d zweitens gehört eben zu einem entwickelten Moralverständnis die Möglichkeit, zwischen einer Bewertung von Handlungen und von Personen zu unterscheiden und die zugehörigen Affekte (insbesondere Empörung und Schuldgefühl vs. Verachtung und Scham) differenziert zu erfahren und zu benennen. 20 Der naheliegendste Vorbehalt gegen eine emotivistische Explikation des Moralbegriffs ist der Verdacht auf Zirkularität (Vgl. Wildt [1993b], 191 ff.; Gibbard, 128,148). D a moralspezifische Gefühle nur auf der Basis von moralischen Urteilen möglich scheinen, scheint es ausgeschlossen, diese Urteile durch Rekurs auf Gefühle zu explizieren, ohne dabei wiederum mindestens implizit moralische Urteile in Anspruch zu nehmen. Dieses Argument beruht jedoch auf der falschen Prämisse, die explizierenden Gefühle selbst müßten so verstanden sein, daß sie bereits moralische Urteile enthalten. Moralische Urteile über bestimmte Dinge, z. B. Sachverhalte oder Ereignisse, vor allem Handlungen, sind zwar Urteile darüber, daß Personen (einer bestimmten Art) Grund dazu haben, auf diese Entitäten mit gewissen Affekten zu reagieren, etwa mit Empörung oder Schuldgefühlen. In diesen Urteilen wird aber keineswegs unterstellt, diese Personen würden mit diesen Affekten wiederum moralische Urteile verbinden. Wenn ich etwa urteile, daß ich eine (starke, s. Fn. 12) moralische Verpflichtung verletzt habe, so urteile ich damit, daß ich Grund habe, deshalb Schuldgefühle zu haben, und daß alle (in einem noch zu klärenden Sinn) anderen Grund haben, deshalb empört zu sein. D a ß ich diese Affekte als moralische verstehe, heißt lediglich, ich verstehe sie als solche, die sich für alle diese Personen wechselseitig intentional implizieren. D e r Zirkularitätseinwand könnte allerdings durch den Verdacht motiviert sein, daß bereits die R e d e vom „Grund haben" hier implizit einen moralischen Sinn hat. Denn daß die Personen Grund zu diesen Affekten haben, meint doch, es ist gerade in moralischer Hinsicht angemessen, daß sie diese Affekte haben. Auch dieser Einwand beruht aber auf einem Mißverständnis. Die R e d e vom „Grund haben" hat hier den allgemeinen, moralunspezifischen Sinn. Das Besondere ist hier aber, daß nicht nur irgendwelche Personen Grund zu bestimmten Affekten haben, sondern daß dies für „alle Personen" in einem sehr weitgehenden Sinn gilt, der nun der Präzisierung bedarf. Ein erster Schritt ist die Abgrenzung von bloßen Sitten und Konventionen. Alle Personen, die sich mit solchen Konventionen identifizieren, haben damit Grund, auf deren Verletzung mit Gefühlen wie Empörung, Schuld oder Scham zu reagieren. A b e r das gilt eben nur für diese Personen, und deren Identifikation ist im Prinzip willkürlich und reversibel. Das ist offenbar in der Moral wesentlich anders. Hier ist nämlich der Umfang von „alle Personen" nicht durch pure Konvention begrenzt, und es kann zunächst offenbleiben, ob er überhaupt begrenzt ist oder sein kann. Unauthenticated Download Date | 5/12/16 4:39 AM 127 Dtsch. Ζ. Philos. 45 (1997) 1 weiten Sinn, s. u. - als rationale oder kritische Moral versteht. Die Antwort muß meines Erachtens so lauten, daß es der Glaube ist, daß alle (normalen Personen, s. u.) diese Affekte tatsächlich haben oder haben würden, falls sie nur gewisse kognitive Standard-Bedingungen erfüllen, nämlich ihre sämtlichen falschen oder unbegründeten, irrationalen Meinungen suspendieren und sich die fragliche Situation lebendig vergegenwärtigen. 21 An dieser Stelle wird erst klar, warum es für die Fragen der Moralbegründung so entscheidend ist, den Begriff einer Moral zu explizieren. Wenn nämlich ein moralisches Urteil in dem Glauben besteht, daß alle Personen - einer sehr weit bestimmten Art - in einer bestimmten Situation Grund haben, Affekte einer bestimmten Art zu haben, dann ist dieses Urteil genau dann wahr, wenn diese Personen in dieser Situation tatsächlich Grund haben, diese Affekte zu haben; und diesen Grund haben sie genau dann, wenn sie diese Affekte tatsächlich haben würden, falls sie die genannten kognitiven Standard-Bedingungen erfüllen würden. Meine emotivistische Explikation des Begriffs einer Moral führt also direkt zu einer kognitivistischen, nämlich deskriptivistischen Konzeption in der Explikation moralischer Gültigkeit. Dies scheint allerdings nicht die Konzeption von Tugendhat zu sein. Welche Konzeption von moralischer Begründung und Gültigkeit vertritt er aber dann? 2. Zur Begründung und Reichweite der universalistischen Moral Tugendhat beginnt sein Buch im wesentlichen mit folgender These: „Ein moralisches Urteil aber, also ein Urteil, daß eine bestimmte Art des Handelns gut oder schlecht und in diesem Sinn geboten oder verboten sei, läßt sich nicht empirisch begründen. Nirgends in der Erfahrung finden wir vor, daß ζ. B. das Foltern eines Menschen schlecht sei, ja es ließe sich gar nicht sagen, was damit gemeint sein sollte, so etwas empirisch begründen zu wollen. Das einzige, was wir empirisch begründen können, ist ein Urteil der Art, daß Menschen dieses oder jenes Kulturkreises oder dieser oder jener sozialen Klasse so ein Handeln für schlecht oder verwerflich halten (oder gehalten haben). Aber daraus folgt nicht, daß es verwerflich ist." (14) Hier behauptet er eine strikte Alternative zwischen dem - objektiven - Schlechtsein und dem - lediglich subjektiven - Nur-für-schlecht-Gehaltenwerden. Diese Alternative scheint auf den ersten Blick zwingend; aber wenn sie es wäre, so wäre es um die Möglichkeiten von Moralbegründung schlecht bestellt. Tatsächlich ist sie unvollständig; und Tugendhat macht auch gar keinen Versuch, das Gegenteil zu begründen. Die Voraussetzung dieser antiempiristischen Alternative ist offenbar seine Meinung, moralische Urteile seien durch einen starken Anspruch auf Objektivität, Allgemeingültigkeit und Irrelativität ausgezeichnet. Bei dieser Meinung handelt es sich um so etwas wie ein kantianisches Fundamentaldogma, das allerdings auch von den meisten Moralphilosophen geteilt wird, die ansonsten wenig mit Kant gemeinsam haben. 22 Dieses Fundamentaldogma besteht in der Annahme des zitierten Textes, moralische Urteile könnten in der Form „Dies ist schlecht" angemessen ausgedrückt werden, also ohne daß dabei auf irgendwelche Urteilende Bezug genommen wird, für die dies schlecht ist in 21 Vgl. Wildt (92 und 97). 22 Besonders dezidiert - und unkritisch - wird dies Dogma im Umkreis der Diskursethik vertreten. (Vgl. etwa Wingert, [1993] 25,30,163; Forst, 369, 384,402) Unauthenticated Download Date | 5/12/16 4:39 AM 128 Andreas Wildt, Gefühle in Tugendhats Moraltheorie dem Sinne, daß sie glauben, dies sei schlecht. Die Annahme besagt also: Moralische Urteile sind irrelativ - also absolut - gemeint. Man kann dieses Dogma auch so ausdrücken, daß das Urteil, eine bestimmte Person hat unter bestimmten Umständen eine bestimmte moralische Verpflichtung, logisch impliziert, jede andere (zurechnungsfähige) Person hat unter entsprechenden Umständen die gleiche Verpflichtung. Moralische Urteile erheben demnach den Anspruch, unbegrenzt allgemein oder universell zu gelten. Demgegenüber muß meines Erachtens der erste Schritt einer kritischen, ernsthaft modernen Moralphilosophie in der Einsicht bestehen, daß moralische Urteile immer nur den Sinn haben können, daß etwas für bestimmte Personen gilt.23 Das schließt keineswegs die Möglichkeit aus, daß unsere, die moderne Moral gelte in dem ganz anderen Sinne universell, daß sie uns gegenüber allen verpflichtet. Zur Verwechslung dieser beiden Bedeutungen trägt sicher auch bei, daß man in beiden Fällen von „gültig für" sprechen kann. 24 Nun muß man zugeben, daß wir unsere moralischen Alltagsurteile tatsächlich in gewisser Weise als personen-irrelativ und in diesem Sinne als objektiv verstehen. Das liegt aber daran, weil wir mit ziemlich gutem Recht voraussetzen, daß die implizierten Verpflichtungen für alle die Leute gelten, mit denen wir es in der Praxis zu tun haben. Diese pragmatisch sehr weitreichende Allgemeinheit impliziert natürlich nicht, diese Urteile würden auch für Personen und Gruppen gelten, die in einem besonders starken Sinne anormal oder fremd für uns sind. Nur eine solche prinzipielle Allgemeingültigkeit würde aber Folgerungen für den Begründungsanspruch moralischer Urteile zulassen, die philosophisch prinzipielle Bedeutung hätten. Tugendhats Haltung zur These des Universalitäts- oder besser: des Absolutsheitsanspruchs moralischer Urteile scheint mir nicht ganz eindeutig. Zunächst vertritt er sie offenbar ohne Einschränkungen und scheint sogar der Meinung zu sein, sie falle mit dem Wahrheitsanspruch moralischer Sätze zusammen. 25 Diese Auffassung scheint dadurch gestützt zu werden, daß Tugendhat dann mit der „grammatisch absoluten" Verwendungs23 Vgl. Wildt (1992), 63 ff. 24 Der verbreiteten Verwechslung dieser beiden Formen von Universalität in der Moralphilosophie wird zweifellos auch dadurch Vorschub geleistet, daß es bisher keine akzeptierte Terminologie gibt, um sie zu unterscheiden. Man könnte hier die Universalität hinsichtlich des Subjekts der Verpflichtung von der hinsichtlich ihres Objekts unterscheiden oder kurz - und mißverständlich - subjektive und objektive Universalität. Ich halte es jedoch für besser, von vornherein verschiedene Gattungsbegriffe zu verwenden. Man könnte so die These von der pcrsonen-irrelativen, also absoluten Geltung moralischer Verpflichtungen von der ihrer universellen Geltung unterscheiden. Die entgegengesetzten Positionen zur ersten Frage sind demnach „Absolutismus" und „Relativismus", zur zweiten jedoch „Universalismus" und „Partikularismus". 25 Tugendhat geht zu Recht davon aus, daß alle moralspezifischen Sätze durch einen Begründungs- oder Rechtfertigungsanspruch ausgezeichnet sind. Dasselbe behauptet er dann auch für einen Wahrheitsanspruch, obwohl er andererseits - meines Erachtens zu Unrecht - voraussetzt, daß moralische Sätze stets Forderungen sind, Forderungen jedoch offenbar gerade keinen Wahrheitsanspruch haben. Dieser Fehler scheint mir allerdings deshalb nicht gravierend, weil alle moral-spezifischen Forderungen auf moralische Urteile des gleichen Inhalts verweisen, die ihrerseits wieder einen Wahrheitsanspruch besitzen. Tugendhat geht nun zu Recht davon aus, daß dieser - wie jeder andere - Wahrheitsanspruch einen „personenirrelativen Sinn" hat (19), aber er scheint diese veritative Irrelativität dabei und auch später (22, 38, 49ff. usw.) mit dem moralspezifischen Allgemeinheitsanspruch einfach gleichzusetzen. Das wäre ein Fehler, von dem es mir - trotz aller Textevidenzen - schwerfällt, ihn Tugendhat zuzuschreiben. Deshalb kurz zur Sache, auch wenn sie trivial ist: Wenn es wahr ist, daß eine Person Ρ eine moralische Verpflichtung hat, dann gilt natürlich auch für alle anderen Personen, daß Ρ diese Verpflichtung hat, aber deshalb gilt noch lange nicht, daß auch diese anderen (unter entsprechenden Umständen) die gleiche Verpflichtung haben. Sie haben sie meines Erachtens dann nicht, wenn sie gar keine oder ganz andere Dispositionen für moralspezifische Gefühle haben als Ρ (s. u.). Unauthenticated Download Date | 5/12/16 4:39 AM Dtsch. Ζ. Philos. 45 (1997) 1 129 weise von „müssen/ nicht können" und „gut/ schlecht" der Aufweis eines Identifikationskriteriums für moralspezifische Urteile gelingt. (2. und 3. Vorl.) Er zeigt dann aber, daß diese Urteile gerade keinen irrelativen Sinn haben können, denn jener Sinn ist seiner Meinung nach erstens relativ darauf, daß die unterstellten Subjekte der entsprechenden Verpflichtungen die moralspezifischen Gefühle wirklich haben oder jedenfalls haben können, die bzw. deren Ausdruck als moralspezifische Sanktionen fungieren; und zweitens relativ darauf, daß diese Subjekte diese moralischen Gefühle haben wollen. (60 ff.) Diese doppelte Relativierung könnte man so formulieren, daß sich der Allgemeingültigkeitsanspruch moralischer Urteile nicht auf - affektive oder voluntative - „Amoralisten" bezieht, sondern nur auf „Moralisten" im Sinne von moralisch motivierten Personen.26 Diese prinzipielle Relativierung des Allgemeinheitsanspruchs moralischer Urteile auf Moralisch-Motivierte scheint mir die zentrale Einsicht von Tugendhats metaethischen Reflexionen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß Tugendhat sie inzwischen wieder aufgegeben zu haben scheint.27 Diese Einsicht ermöglicht es ihm, grundsätzlich die gängigen Vorstellungen zu verabschieden, das moralische Gewissen sei so etwas wie die Stimme Gottes, eine eingeborene Gesetzestafel, ein Organ oder eine Zwangsidee aller. Trotzdem scheinen sich seine Bemühungen in der Hauptsache darauf zu richten, einen damit drohenden weitergehenden „Relativismus" zu verhindern.28 26 Tugendhat spricht hier nicht von „Amoralisten", sondern von „Egoisten" oder „radikalen Egoisten". (91, 93) Das ist jedoch irreführend, denn ein Mangel an moralspezifischen Gefühlen bzw. deren Ablehnung ist - mindestens begrifflich - vereinbar mit altruistischen Neigungen und entsprechenden Handlungen, Absichten oder Einstellungen. Gravierender ist, daß er nicht klärt, welche Rolle die beiden genannten Aspekte der moralischen Motivation in der Konstitution des moralischen Verpflichtetseins spielen. Er redet so, als sei hier das einzig Entscheidende die „Option", also die Entscheidung dafür oder dagegen, den moral sense haben zu wollen. In der Sache scheint es mir jedoch viel plausibler, daß es für das moralische Verpflichtetsein von Ρ ausschließlich darauf ankommt, ob Ρ die entsprechenden (kritikresistenten, s. u.) moralischen Gefühle oder Gefühlsdispositionen hat oder nicht. Auch wenn man mit Tugendhat annimmt, es gibt die Möglichkeit, sich gegen das Haben dieser Dispositionen zu entscheiden, so hat doch Ρ meines Erachtens mindestens so lange die entsprechenden Verpflichtungen, als sie diese Dispositionen hat. Die Option dagegen ist demnach unmoralisch, und zwar offenbar sogar in einem besonders starken Sinn. Tugendhat ist demgegenüber der Meinung, die Entscheidung für die moralischen Gefühle fürs Verpflichtetsein sei konstitutiv. Unklar bleibt dabei, ob jene hierfür eine hinreichende Bedingung sein soll oder ob auch das Haben der Gefühle notwendig ist. Mir schiene die zweite Version jedenfalls moralisch plausibler. Außerdem scheint es psychologisch klarer, was es heißen soll, sich gegen Gefühle zu entscheiden, die man hat, als für Gefühle, die man nicht hat. Wenn ich im folgenden zusammenfassend von „Moralisch-Motivierten" vs. „Amoralisten" spreche, will ich damit jedoch die genannten Fragen keineswegs vorentscheiden. 27 In seinem neuesten Aufsatz („Gibt es eine moderne Moral?") geht Tugendhat auf seine ältere Konzeption aus „Probleme der Ethik" (1984) zurück, daß ein Moralsystem dann moralisch begründet ist, wenn „alle Mitglieder der Gemeinschaft ein gleichmäßiges rationales Motiv haben, das durch diese Norm bestimmte Forderungssystem einzugehen" (1996,331). Diese Konzeption ist meines Erachtens schon deshalb unhaltbar, weil sie mit zentralen Intuitionen unserer modernen Moral unvereinbar ist, sofern es nämlich bei starker Verschiedenheit der Individuen, wenn überhaupt irgendwelche, dann nur sehr wenige Normen gibt, deren moralische Geltung im gleichmäßigen rationalen Interesse aller wäre. Tugendhat beachtet hier nicht die Grenzen des (nicht-idealen) Kontraktualismus, die er in seinen „Vorlesungen" in anderen Hinsichten gerade betont hatte (Zum Kontraktualismus vgl. u. Anm. 34). 28 Leider findet sich bei Tugendhat keinerlei Klärung des Begriffs „Relativismus". Offenbar neigt Tugendhat dazu, eine Position so zu bezeichnen, die keinen Unterschied dazwischen begründen kann, daß sich Personen oder Gruppen für moralisch verpflichtet halten und daß sie so verpflichtet sind. Eine solche Position wäre aber nicht eigentlich relativistisch, sondern nonkognitivistisch oder bestenfalls radikal skeptisch. Relativistisch ist eine (metaethische) Position vielmehr auch oder besser erst dann, wenn sie annimmt, moralische Gültigkeit sei zwar keineswegs immer mit moralischer Meinung identisch, sie sei aber in moralischen Meinungen (unter bestimmten Umständen, s. u.) fundiert. Der metaethische Relativismus in diesem Sinne impliziert die Möglichkeit, daß Unauthenticated Download Date | 5/12/16 4:39 AM 130 Andreas Wildt, Gefühle in Tugendhats Moraltheorie Auf die notorischen Schwierigkeiten einer Moralbegründung, die nicht irgendwo willkürlich haltmacht, also einer Letztbegründung in einem erkenntnistheoretisch noch ganz offenen Sinn, gibt es meines Erachtens zwei sinnvolle Reaktionen der Selbstbeschränkung. Erstens kann man an dem üblichen, starken Verständnis des moralischen Sollens festhalten und die üblichen, starken Begründungsansprüche diesem gegenüber reduzieren. Oder man reduziert das übliche Verständnis des Geltungsanspruchs des moralischen Sollens und hält daran fest, daß es in einem starken Sinn begründet werden kann. Natürlich kann man auch beide Revisionsstrategien miteinander kombinieren, aber ohne Revision ist heute nichts Überzeugendes zu machen. Tugendhat vertritt seit einigen Jahren offensichtlich die erste Strategie, die er zunächst kritisiert hatte, vor allem bei Ursula Wolf.29 Er beansprucht nicht mehr, die moderne, universalistisch-egalitäre Moral zwingend begründen, sondern nur noch, sie „plausibel" machen zu können. Zu dieser Konsequenz wird Tugendhat hauptsächlich getrieben, weil er an dem gängigen, aber durchaus kantianischen Vorverständnis festhält, das moralische Sollen binde universell - allerdings, anders als bei den Kantianern, nur die Moralisch-Motivierten. Läßt man - im Sinne der zweiten Revisionsstrategie - dieses Dogma fallen, so ergeben sich ganz neue Möglichkeiten für eine durchaus starke Begründung des moralischen Sollens, nämlich mit empirischen Mitteln. Tugendhats neuere Strategie könnte durchaus Vorteile haben, wenn hinreichend klar würde, was mit „Plausibilisierung" gemeint ist. Das scheint mir jedoch nicht der Fall, insbesondere dann nicht, wenn er offenbar gleichbedeutend davon spricht, daß bestimmte Thesen „naheliegend" sind. Als „plausibel" oder „naheliegend" bezeichnet er nämlich sowohl Thesen, zu denen es gar keine vernünftige Alternative gibt, als auch solche, für die nichts spricht als Denkgewohnheiten. 30 Einige Formulierungen weisen darauf hin, daß Tugendhat auch seine Prämisse des Allgemeinheitsanspruchs aller Moralurteile (für Moralisch-Motivierte) nicht für zwingend, sondern nur für naheliegend und plausibel hält. In der zentralen 5. Vorlesung („Das plausible Moralkonzept") sagt er nämlich zur Kantschen Konzeption: „Gesucht ist ein Sinn von >gut<, der in dem Sinn allgemeingültig wäre, daß er von allen anerkannt werden könnte. Kant hingegen meinte beweisen zu können, daß es einen Sinn von >gut< gibt, der von allen (auf Grund ihres Vernünftigseins) anerkannt werden muß. Wenn wir diesen Anspruch in der Weise abmildern, daß sich gegebenfalls zeigen läßt, daß es einen Sinn von >gut< gibt, der verschiedene Personen alleine aufgrund ihrer unterschiedlichen (wohlüberlegten, s. u.) moralischen Meinungen und Gefühle unterschiedliche moralische Verpflichtungen haben. Dieser Relativismus untergräbt also den populären Glauben, daß sich spätestens dann, wenn alle einschlägigen Wahrheitsfragen von allen geklärt sind, auch ein moralischer Konsens - jedenfalls zwischen allen Moralisch-Motivierten und auf der E b e n e der Prinzipien - ergeben muß. Dieser Glaube ist es letztlich, was Tugendhat bei aller Kritik mit den meisten zeitgenössischen Positionen und insbesondere mit der Diskursethik gemeinsam ist. Vom metaethischen Relativismus muß man in der Moralphilosophie den „deskriptiven" und den „normativen" Relativismus unterscheiden (Vgl. Brandt). Zum Begriff „Relativismus" im metaethischen Sinn vgl. Fn. 24. 29 Vgl. Wolf; Tugendhat, „ R e t r a k t i o n e n " , in: ders. (1984) ,132 ff. 30 So sagt Tugendhat einerseits ausdrücklich, es sei lediglich „plausibel" - aber gleichwohl „gewiß" - , daß morgen die Sonne aufgeht. (30) „Plausibel" bedeutet hier offenbar soviel wie „nicht schon aus apriorischen Gründen wahr". Ähnlich hält es Tugendhat für einen wesentlichen Schritt zur Begründung seines kantischen Moralprinzips, daß das utilitaristische Beurteilungsprinzip „gegenüber dem Prinzip des kategorischen Imperativs unplausibel" ist, sagt dann aber - mit vollem Recht, das utilitaristische Prinzip sei „so wenig naheliegend, daß man sich umgekehrt fragen muß, wie man zu einem so sonderlichen Prinzip auch nur kommen konnte". (327) D a ß die R e d e von „plausibel" und „naheliegend" andererseits bei Tugendhat oft einen sehr schwachen Sinn hat, der es kaum rechtfertigt, hier von „Begründung" zu sprechen, wird sich im folgenden zeigen. Unauthenticated Download Date | 5/12/16 4:39 AM 131 Dtsch. Ζ. Philos. 45 (1997) 1 von allen nicht anerkannt werden muß, aber doch anerkannt werden könnte und kein anderer, würde ein wesentlicher Schritt über die relativen Begründungen hinaus geleistet sein, und das wäre erreicht, wenn sich zeigen ließe, daß es erstens einen Sinn von >gut< gibt, der als allgemein anzuerkennender naheliegt, der plausibel ist, und daß zweitens alle anderen bekannten Vorschläge nicht (oder weniger) plausibel sind." (80) Setzt Tugendhat hier voraus, daß das Moralisch-Gute strikt für alle gilt, und meint dann, daß sich selbst so eine inhaltliche Konzeption nicht zwingend ergibt, sondern lediglich nahelegt, derzufolge es das ist, was von allen anerkannt werden kann, weil es nämlich gleichmäßig gut für alle ist? Oder will er nur sagen, auch die Idee der Allgemeingültigkeit des Moralisch-Guten ist nicht zwingend, sondern lediglich plausibel, und muß so nicht von allen anerkannt werden, sondern könnte lediglich anerkannt werden? Für die erstere Deutung spricht, daß Tugendhat den Allgemeingültigkeitsanspruch des Guten nicht nur an früheren, sondern auch an späteren Stellen (81,85,86, 89,313,315,317) als gegeben unterstellt. Aber für die letztere Deutung könnte man außer ihrer Plausibilität in der Sache anführen, daß seine weitere These ansonsten allzu vorsichtig erscheint. Zwar ist richtig, daß sich auch aus der strikten Allgemeingültigkeit des Moralisch-Guten nicht analytisch zwingend folgern läßt, moralisch gut sei das, was - jedenfalls unter gewissen idealen Bedingungen (s. Wildt [1982], Kap. 1,1 und 1996) - gleichmäßig im Interesse aller ist. (85) Aber die entgegengesetzte Annahme, daß nämlich eine unegalitäre oder sogar partikularistische Moral gleichwohl strikt personenirrelativ gilt, wäre doch so erstaunlich und geradezu widersinnig, daß es zu wenig wäre zu sagen, daß sich dann die universalistisch-egalitäre Moral lediglich „nahelegt". Sie wäre unter dieser Voraussetzung vielmehr ohne Alternative, die ernsthaft diskutabel wäre. Was aber macht nun die Annahme so plausibel, das Moralisch-Gute (für Moralisch-Motivierte) gelte universell? Meines Erachtens höchstens dies, daß diese Annahme zu unserer, der universalistisch-egalitären Moral prima facie paßt. Demnach würde Tugendhats Rede von „Plausibilisierung" implizieren, daß er sich einfach auf unsere egalitären moralischen Intuitionen verläßt. Das scheint mir auch unvermeidlich, widerspricht aber Tugendhats Selbstverständnis, vor allem seiner scharfen Abgrenzung von Rawls' Methode des „Überlegungs-Gleichgewichts".31 Die generelle These vom radikalen Allgemeinheitsanspruch moralischer Urteile scheint mir jedenfalls grundlos, ein Dogma. Was bleibt von Tugendhats Konzeption von Moralbegründung, wenn man auf dieses Dogma verzichtet? Vielleicht nicht viel. Aber das spricht keineswegs gegen die Möglichkeit von Moralbegründung, sondern gegen ein Verständnis von deren Aufgabe, das Tugendhat anscheinend teilt. Tugendhats nähere Konzeption von Moralbegründung beruht auf seiner Unterscheidung von „traditionalistischen" und „natürlichen" Moralkonzepten. (4. Vorl.) Damit ist anscheinend eine vollständige Einteilung aller möglichen Moralkonzepte gemeint, aber die vorgeschlagene Terminologie scheint mir für diese Aufgabe nur teilweise geeignet. Was zunächst den Begriff „traditionalistisch" angeht, so spricht Tugendhat manchmal genauer von „religiösen (>transzendenten<) oder sonstwie traditionalistischen" Begründungen oder Konzepten. (23, 65) Diese Begriffe bedeuten aber nicht dasselbe, denn reli31 Vgl. das Register der „Vorlesungen" sowie die „Bemerkungen zu einigen methodischen Aspekten von Rawls' Eine Theorie der Gerechtigkeit", in: Tugendhat (1984) 10 -32. Unauthenticated Download Date | 5/12/16 4:39 AM 132 Andreas Wildt, Gefühle in Tugendhats Moraltheorie giöse Moralkonzepte brauchen nicht in Traditionen begründet zu sein, sie können - und müssen sogar primär - auf den Erfahrungen und dem Glauben je Einzelner beruhen. Tugendhat nennt allerdings selbst das, was diesen beiden Arten von Moralkonzepten gemeinsam ist, nämlich die Begründung im Glauben an eine Autorität. So wie in einer religiös begründeten Moralkonzeption das als moralisch gilt, was Gott will, so gilt in einer traditionsbegründeten Moral das, was die Tradition bzw. die sie repräsentierende Autorität will. Das Merkmal der Autoritätsgebundenheit besitzt allerdings auch noch eine dritte Gruppe von Moralen, die man als „charismatisch" bezeichnen könnte; zu dieser gehört insbesondere, mindestens in einigen Aspekten, die frühkindliche Moral, sofern sie nämlich unmittelbar in der Autorität der Eltern, also weder religiös noch traditionalistisch fundiert ist. Wohl in diesem weiten Sinne spricht er gegen Ende seines Buches von „autoritären" Moralen. (332, vgl. 88) Um die Konnotation autoritärer Moral Inhalte zu vermeiden, möchte ich lieber von „autoritätsgebundenen" oder „autoritativen" Moralen sprechen. Von diesen unterscheidet Tugendhat nun „natürliche" Moralkonzepte. Damit meint er Konzeptionen, die „auf die eine oder andere Weise auf die Natur des Menschen oder einen Teil von ihr" zurückgreifen (69), vor allem die Konzepte von Hume, Kant, der Mitleidsethik, des Kontraktualismus und dann auch sein eigenes Konzept und das des Utilitarismus. Das einzige Konzept, das sowohl ein natürliches als auch ein Mora/könzept darstellt, ist aber nach Tugendhats Diskussion sein eigenes Konzept der universellen und gleichen Achtung. 32 Spätestens damit wird aber klar, daß Tugendhats Einteilung der Moralen in traditionalistisch-transzendente und natürliche in entscheidendem Maße unvollständig bleibt. Sie berücksichtigt nämlich überhaupt nicht die Möglichkeit von inegalitären oder sogar partikularistischen Moralen, die nicht autoritätsgebunden sind. Nun mag es zutreffen, daß die inegalitären und partikularistischen Moralen, die wir empirisch vorfinden, alle traditionalistisch oder religiös oder charismatisch gebunden sind; aber das muß keineswegs so sein, und mindestens für frühe Stadien der phylogenetischen und teilweise auch der ontogenetischen Entwicklung ist es auch unwahrscheinlich. Das entscheidende Problem einer Begründung unserer universalistisch-egalitären Moral ist aber gerade die Möglichkeit von inegalitär-partikularistischen Moralen, die nicht autoritätsgebunden sind. Eine Kritik autoritätsgebundener Moralen ist demgegenüber gar kein ernsthaftes Problem. Denn da diese per definitionem in letzter Instanz auf einem Glauben an eine (personale) Autorität „begründet", und d. h. eben rational unbegründbar sind, sind sie für jemand, dem es auf Begründbarkeit ankommt, gar keine ernsthafte Alternative: Sie sind im wörtlichsten Sinne „irrational". Seine eigene, im weiteren Sinne kantische Konzeption bezeichnet Tugendhat nicht als „rationale", sondern nur als einzig „natürliche" (191) oder „sich natürlich nahelegende". (317,328)33 Seine eigene Erläuterung aber zeigt, daß dies erstens Rationalität impliziert und 32 D a ß Tugendhat Kants Vernunftmoral unter den Titel einer „natürlichen" Konzeption bringt, ist verwirrend; denn er betont andererseits, diese beruhe auf einer „transzendenten", also nicht-natürlichen Annahme. (70 ff.) U n d von den Konzeptionen von Hume, der Mitleidsethik und des Kontraktualismus versucht Tugendhat zu zeigen, daß sie in Wahrheit gar keine Konzeptionen von Moral sind. Dasselbe muß man aber auch vom Utilitarismus jedenfalls insofern sagen, als er keine moralischen Rechte begründen kann. (324, 327,127) 33 Tugendhat vermeidet es, die Moral der gleichen Achtung als einzig „rationale" Moral auszuzeichnen. Er bestreitet vielmehr auch noch gegen E n d e seines Buches, eine „rationale Begründung" eines Moralprinzips sei überhaupt möglich. Das scheint mir aber irreführend, denn Tugendhat versteht den Begriff der Rationalität selbst so, daß jedenfalls folgt, daß jede autoritative Moral irrational ist: „Wir sind irrational, wenn wir in unseren Unauthenticated Download Date | 5/12/16 4:39 AM 133 Dtsch. Ζ. Philos. 45 (1997) 1 zweitens betonen soll, wir würden nur so „zu einem unbeschränkt objektiven - allgemeingültigen - Konzept des Guten kommen". (317) Abgesehen davon, daß Tugendhat hier - und an vielen anderen Stellen - seine eigene Einschränkung der Allgemeingültigkeit des Moralisch-Guten auf Moralisch-Motivierte nicht mehr erwähnt, zeigt auch diese Stelle, daß er erstens diese Allgemeingültigkeit voraussetzt, zweitens die Möglichkeit von „natürlichen", also nicht-autoritätsgebundenen und auch sonst nicht-irrationalen (s. u.), aber dabei partikularistischen oder inegalitären Moralen nicht berücksichtigt und drittens annimmt, autoritative Moralen könnten nicht hinreichend allgemeingültig sein. Auch letzteres scheint mir nicht überzeugend. Eine autoritätsgebundene Moral hat schon genau dann ein „allgemeingültiges Konzept des Guten", wenn sie unterstellt, daß uneingeschränkt alle Grund haben, den Glauben an die sie legitimierende Autorität zu teilen. Das gilt etwa für die christliche Moral. Aber wie dem auch sei, es würde gegen eine autoritative Moral meines Erachtens nicht ohne weiteres sprechen, wenn sie nicht zu einem allgemeingültigen Konzept des Guten kommen könnte; gegen sie spricht aber in jedem Fall, daß sie autoritätsgebunden und damit irrational ist. Das ist jedoch für die Frage der Begründung der modernen Moral nebensächlich. Viel entscheidender ist, daß eine partikularistische oder inegalitäre Moral dann durchaus rational ist, wenn sie weder auf einem unbegründbaren Glauben noch auf falschen Meinungen beruht. Und das ist meines Erachtens genau dann der Fall, wenn die Vertreter dieser Moral die affektiven (und kognitiven) Fähigkeiten besitzen und benutzen, um an die Urteile dieser Moral auch dann noch zu glauben, wenn sie ihre Meinungen umfassend kritisch geprüft haben. Von einer solchen Konzeption von Moralbegründung ist Tugendhat nicht weit entfernt. Er lehrt mit allem Nachdruck, Personen können nur dann moralische Verpflichtungen haben, wenn sie über diejenigen moralischen Motive verfügen, die bei rationaler Prüfung ihrer Meinungen zu den entsprechenden Handlungen führen können. Wenn man nun das Dogma vom Allgemeinheitsanspruch moralischer Urteile (wenigstens für alle MoralischMotivierten) einmal aufgegeben hat, so spricht nichts mehr dagegen, die genannte notwendige Bedingung für moralisches Verpflichtetsein - zusammen mit gewissen, wohl unstrittigen kognitiven Bedingungen - als hinreichend zu betrachten. 34 Zum Schluß möchte ich noch kurz auf Tugendhats Versuche eingehen, die Reichweite des Universalismus der Moral gleicher Achtung genauer zu bestimmen. Das gibt mir Gelegenheit, auf Eigentümlichkeiten seines Ansatzes einzugehen, von denen ich bisher abstrahieren konnte. Dabei wird sich noch deutlicher zeigen, daß Tugendhat seine wertvollen Ansätze zu einem rationalen Emotivismus nicht immer fruchtbar gemacht hat. Während ich mit Tugendhat darin übereinstimme, daß die Moral der gleichen Achtung für uns, d. h. mindestens für alle die Personen unserer Gesellschaftsform normativ verbindlich ist, die in einem basalen Sinne affektiv und kognitiv normal sind, aber Tugendhats weitergehende Universalitätsansprüche mit Skepsis betrachte, sind seine Auffassungen über die inhaltliche Reichweite dieser Moral meines Erachtens zu restriktiv. Meinungen und Zielen inkonsistent sind oder sie nicht begründen können." (44) Tugendhats Abneigung, seine eigene Konzeption als „rationale" zu bezeichnen, ist sicher dadurch motiviert, daß u. a. die Kantsche und die utilitaristische Konzeption sich gerne als „rationale" auszeichnen, aber die erstere in Wahrheit irrational und die zweite gar keine originäre Moralkonzeption ist. A b e r das scheint mir keine Rechtfertigung für diese Zurückhaltung. 34 Zur Präzisierung dieses Ansatzes vgl. Wildt (1992 und 1997). Unauthenticated Download Date | 5/12/16 4:39 AM 134 Andreas Wildt, Gefühle in Tugendhats Moraltheorie Tugendhat geht davon aus, daß die Verpflichtungen der modernen Moral uns in zweifelsfreier Weise nur gegenüber allen kooperationsfähigen Subjekten - also im wesentlichen gegenüber allen zurechnungsfähigen Menschen - binden. E r kommt zu dieser Auffassung durch seine These, der attributive Sinn von „gut", durch den er glaubt, den grammatischabsoluten Sinn des Moralisch-Guten erklären zu müssen, bedeute soviel wie „gut als Kooperationswesen". Möglichkeit und Notwendigkeit der dabei vorausgesetzten, „indirekten" Strategie habe ich bereits im 1. Teil kritisiert. Jetzt geht es mir d a r u m , daß die besondere D e u t u n g von „gut als Mensch" durch „gut als Kooperationswesen" problematisch ist. M a n m u ß hier zwei Schritte deutlicher unterscheiden, als es Tugendhat tut. D e r erste Schritt ist die D e u t u n g von „gut als Mensch" durch „gut als Mitmensch" oder „gut als soziales Wesen". Dieser Schritt ist, wie Tugendhat später selbst bemerkt (236 ff.), keineswegs analytisch, aber für die Moral mindestens sehr naheliegend, da die Explikation des Begriffs einer Moral durch die moralspezifischen Affekte gezeigt hat, daß diese konstitutiv intersubjektiv sind. D a s ist übrigens ein weiteres A r g u m e n t dafür, daß der Rekurs auf die attributive Verwendung von „gut" von sich aus gar nicht geeignet ist, den Moralbegriff zu explizieren, sondern vielmehr ein intuitives Verständnis des Moralischen voraussetzt. M a n m u ß die Rede von „gut als soziales Wesen" allerdings verschieden verstehen, je nachdem wie die Subjekte oder die Objekte einer Moral charakterisiert sein sollen. Die Subjekte einer Moral sind alle durch diese motivierten Personen, die Objekte aber - jedenfalls der universalistischen Moral - Wesen, zu denen eine „soziale" Beziehung möglich ist. Voraussetzung f ü r letztere ist nicht die Möglichkeit von Kooperation oder von symbolischer Kommunikation, sondern von Mitgefühl, und die haben wir auch gegenüber Komatösen, (höheren) Tieren und (entwickelten) Föten. Moralisch gut handelt und ist derjenige, der als Mitfühlender wert ist, moralisch bejaht zu werden. Es gibt demnach keinen G r u n d dafür, mit Tugendhat in einem zweiten Schritt die moralisch relevante Rede von „gut als soziales Wesen" auf die Bedeutung von „gut als Kooperationswesen" einzuschränken. 3 5 Damit entfällt die Notwendigkeit, die Moral, zu deren Objekten zunächst angeblich nur die kooperationsfähigen Wesen gehören, auf alle Menschen (ab der Geburt) und dann auch auf Tiere und ggf. Föten auszudehnen. Die Einbeziehung dieser Subjekte in die Moral ist vielmehr durchaus zwingend und nicht nur „äußerst naheliegend", wie Tugendhat wiederum sagt. (189,193) 36 Allerdings hat Tugendhat ein auf den ersten Blick bestechendes Argument dafür, daß im strengen Sinne nur die kooperationsfähigen Wesen Objekte jedenfalls der universalistischen Moral sein können: Hier passen Form und Inhalt der Moral insofern zusammen, als die Subjekte der Moral auch genau ihre Objekte sind. (88,187) Diese suggestive These ist aber leider gerade im Lichte von Tugendhats Einsichten falsch. Diejenigen, die moralisch nicht motiviert sind, sind keine Subjekte der Moral im Sinne moralischer Verpflichtungen; 35 Diese Einschränkung hängt bei Tugendhat mit seiner partiellen Orientierung am - übrigens sehr eng verstandenen - Kontraktualismus zusammen, die mir in dieser Form unhaltbar zu sein scheint. Auf den Kontraktualismus kann ich hier leider nicht eingehen (vgl. aber Wildt 1997). 36 Vgl. die Kritik von Martin Seel, 267 ff. Es ist aber meines Erachtens nicht korrekt, wenn Tugendhat sagt, die Einbeziehung der Kinder ab der Geburt sei deshalb zwingender als die der Föten oder der Tiere, weil die Kinder der moralischen Gemeinschaft „partiell" zugehören (193), denn der „moralischen Gemeinschaft", so wie Tugendhat den Begriff eingeführt hat, gehören nur diejenigen an, die zu moralspezifischen Sanktionen fähig sind; und das gilt für Babys natürlich nicht, auch wenn sie bereits in humanspezifischer Weise kommunizieren. Unauthenticated Download Date | 5/12/16 4:39 AM 135 Dtsch. Ζ. Philos.'45 (1997) 1 aber es gehört sicher zum harten Kern des modernen Universalismus, daß sie gleichwohl Objekte der moralischen Rücksicht und somit Subjekte entsprechender Rechte sind. Da „Form" und „Inhalt" der modernen Moral also von vornherein auseinanderfallen, scheint es keinen Grund zu geben, warum sie nicht noch weiter auseinandertreten sollten, als auf den ersten Blick naheliegend scheint. Wenn sich die universalistische Moral von vornherein auf alle Wesen bezieht, mit denen wir mitfühlen können, fragt es sich natürlich, wie in einer anderen Weise, als Tugendhat dies tut, verständlich gemacht werden kann, daß wir ζ. B. gegenüber Komatösen oder kleinen Kindern stärkere Verpflichtungen anerkennen als gegenüber Tieren und Föten. Hier scheinen mir Argumente, die Tugendhat vorbringt, sehr hilfreich, vor allem das der humanspezifischen Kommunikation. Ich halte jedoch Tugendhats Prämisse für dogmatisch, bei solchen Fragen seien unsere moralischen Intuitionen irrelevant (187). Für einen rationalen Emotivismus, wie ich ihn hier auf dem Wege einer konstruktiven Kritik an Tugendhats Konzeption von Moralbegründung habe plausibel machen wollen, gibt es letztlich gar keine andere Basis für moralische Verbindlichkeit als unsere moralischen Gefühle, die wohlüberlegt und nicht nur privat, sondern sozialstrukturell induziert sind.37 Mir scheint, daß dies auch Tugendhat zugeben könnte, wenn er überzeugend schreibt: „Was wir in der Philosophie tun können, ist nicht mehr, als eben dieses gewöhnliche moralische Bewußtsein in seinen Voraussetzungen verständlich zu machen. Es wird sich zeigen, daß diese komplexer sind, als gewöhnlich angenommen wird, und das ist der Grund, warum es bisher so schwierig war, es zu explizieren. Die Philosophie kann nicht mehr tun, als ein vorhandenes Vorverständnis in seinen Voraussetzungen adäquat zu analysieren; sie hat keinen eigenen, extramundanen Bezugspunkt." (28) I'D Dr. Andreas Wildt, Freie Universität Berlin, Institut für Habelschwerdter Allee 30, D -14195 Berlin Philosophie, Literatur Brandt, R. B. (1976): „Zwei Formen des Relativismus", in: Texte zur Ethik, hg. v. D. Birnbacher/ N. Hoerster, 42-51. Forst, R. (1994): Kontexte der Gerechtigkeit. Gibbard, A. 1990: Wise Choices, Apt Feelings (Oxford: Clarendon). Habermas, J. (1991): Erläuterungen zur Diskursethik. Hume, D. (1978): Ein Traktat über die menschliche Natur, Bd. II. Hume, D. (1984): Eine Untersuchung über die Prinzipien der Moral. Mill, J. St. (1976): Der Utilitarismus. Schmitz, H. (1973): Der Rechtsraum. System der Philosophie, Bd. III, 3. Seel, M. (1995): Versuch über die Form des Glücks. Smith, A. (1985): Theorie der ethischen Gefühle. Strawson, E E (1978): „Freiheit und Übelnehmen", in: Freies Handeln und Determinismus, hg. v. U. Pothast. 37 Vgl. Wildt (1992 und 1997). Unauthenticated Download Date | 5/12/16 4:39 AM 136 Andreas Wildt, Gefühle in Tugendhats Moraltheorie Tugendhat, E. (1984): Probleme der Ethik. Tugendhat, E. (1989): „Zum Begriff und zur Begründung von Moral", zit. nach ders., Philosophische Aufsätze (1992), 315-33. Tugendhat, E. (1993a): Vorlesungen über Ethik. Tugendhat, E. (1993b): „Die Rolle der Identität in der Konstitution der Moral", in: Moral und Person, hg. v. W Edelstein u. a., 33-47. Tugendhat, E. (1996): „Gibt es eine moderne Moral?", in: Zeitschrift für philosophische Forschung 50, 1/2,323-38. Wallace, G./Walker, A. D. M. (1970): The Definition of Morality, London. Westermarck, E. (1907): Ursprung und Entwicklung der Moralbegriffe. Wildt, A. (1982): Autonomie und Anerkennung. Wildt, A. (1992): „Moralisches Sollen und seelisches Sein. Ein Programm zur empirisch-psychologischen Moralbegründung", in: Dialektischer Negativismus, hg. v. E. Angehrn u. a., 57-81. Wildt, A. (1993a): „Eine Humesche Konzeption von Moralphilosophie", in: Neue Realitäten. Herausforderung der Philosophie, 984-91. Wildt, A. (1993b): „Die Moralspezifizität von Affekten und der Moralbegriff", in: Zur Philosophie der Gefühle, hg. v. H. Fink-Eitel/G. Lohmann, 188-217. Wildt, A. (1996a): „Gleichheit, Gerechtigkeit und Optimierung für jeden. Zur Begründung von Rawls' Differenzprinzip", in: Politik und Ethik, hg. v. K. Bayertz. Wildt, A. (1996b): „Menschenrechte und moralische Rechte", in: Philosophie der Menschenrechte, hg. v. G. Lohmann/ St. Gosepath. Wildt, A. (1997): „Psychologische und rationale Moralbegründung", in: Analyomen 2, Bd. 3, hg. v. G. Meggle/E Steinacker. Williams, B. (1993): Shame and Necessity. Wingert, L. (1993): Gemeinsinn und Moral. Wolf, U. (1984): Das Problem des moralischen Sollens. Unauthenticated Download Date | 5/12/16 4:39 AM