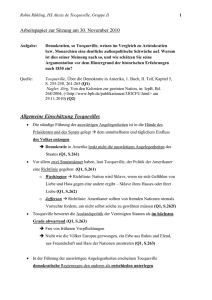1 Oliver Hidalgo BBE-Newsletter 3/2010 Religion und
Werbung

Oliver Hidalgo BBE-Newsletter 3/2010 Religion und Zivilgesellschaft – eine komplexe Symbiose in der Politischen Ideengeschichte Der moderne säkularisierte Staat befindet sich in einem Dilemma: Das für seinen Erhalt notwendige Sozialkapital muss er aus Ressourcen akquirieren, auf die er keinen Einfluss nehmen darf. Gemäß dem bekannten Böckenförde-Diktum würde der freiheitliche Staat unweigerlich gegen sich selbst agieren, wenn er die Freiheit der Bürger nicht mit Hilfe der moralischen Substanz des Einzelnen sowie des Zusammenhalts der Gesellschaft, sondern mit Mitteln des Rechtszwanges regulieren wollte. Insofern lebt er letztlich von „Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann“, wie es der frühere Verfassungsrichter pointiert formulierte. Es liegt auf der Hand, dass den Kirchen und Religionsgemeinschaften als traditionellen Wertestiftern dadurch eine besondere Verantwortung für die Zivilgesellschaft erwächst. Moralische Überzeugungen, die im Glauben verankert sind, ermöglichen den Bürgern offenbar jene Loyalität zum Gemeinwesen, die nicht auf Zwang, sondern auf freiwilliger Selbstverpflichtung beruht. Die Trennung von Kirche und Staat, die erst für den Bedarf an einer Legitimation politischer Herrschaft „von unten“ gesorgt hatte, ist demnach mit keiner unpolitischen Rolle der Religion zu verwechseln. Ideengeschichtlich geht diese Einsicht auf den französischen Demokratietheoretiker und Politiker Alexis de Tocqueville (1805-1859) zurück. Dieser fand seinerzeit in den USA das Vorbild einer sich autonom und subsidiär organisierenden Bürgergesellschaft, deren Engagement die Tätigkeit der Zentralgewalt ebenso entlastete wie beschränkte. Die Demokratie in Amerika galt Tocqueville dabei als Prototyp eines religiös geprägten Gemeinwesens, das die institutionelle Trennung zwischen Staat und Kirche entschieden bekräftigte. In Europa, das im 19. Jahrhundert mit den Nachwehen der Französischen Revolution zu kämpfen hatte und wo sich die (politisch entmachtete) katholische Kirche in den Reihen der Gegner von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten wiederfand, wurde eine solche Verbindung von Religion und Zivilgesellschaft weitaus skeptischer gesehen. In seinen Schriften versuchte Tocqueville deshalb, seine laizistischen Landsleute davon zu überzeugen, dass gerade die moderne Demokratie die Religion im besonderen Maße benötige, weil nur das religiös generierte Sozialkapital in der Lage sei, den egoistischen bzw. materialistischen Partikularwillen der Individuen zu überwinden und die mit ihren Privatangelegenheiten beschäftigten Bürger aus ihrer politi1 schen Apathie zu entreißen. In der Religion erkannte Tocqueville das soziale Band, das den Einzelnen an seine Pflichten gegenüber den Mitmenschen erinnerte und ihn dazu motivierte, sich am öffentlichen Leben zu beteiligen. Damit erweist sich der französische Aristokrat als klassischer Vordenker einer Zivilgesellschaft, in der christlich-kommunitaristische Wertbestände als eine Art Katechismus des Gemeinschaftsbezugs fungieren. Amerikanische Vordenker der (religiös fundierten) civil society wie Robert Bellah oder Robert Putnam haben sich ausgiebig auf Tocquevilles Thesen berufen1. In Europa ist die erwähnte Skepsis zwar nur langsam gewichen, doch selbst eigentliche Verfechter eines säkularen Modells der Zivilgesellschaft wie Claude Lefort oder Jürgen Habermas konnten sich weder der Faszination der Demokratie in Amerika2 noch dem Problem der Religion entziehen.3 Bemerkenswert daran ist, dass Tocqueville als Privatmann keinen religiösen Glauben besaß, was ihn nicht daran hinderte, die zivilgesellschaftliche Rolle der Religion zu propagieren. Diese Eigenschaft teilt er offensichtlich mit dem späten Habermas, der verstärkt die Bedeutung der Religion für die politische Öffentlichkeit (als Gegenpol zur diskursiven Vernunft) betont, wiewohl er sich in seiner Friedenspreisrede 2001 oder auch in der Diskussion mit dem damaligen Kardinal Joseph Ratzinger 2004 als „religiös unmusikalisch“ bezeichnete. Dass das Thema Religion und Zivilgesellschaft mittlerweile zum allseitigen Gegenstand avanciert ist, hat sicherlich verschiedene Gründe. Die Transformation und Demokratisierung in Mittel- und Osteuropa, die unter dem erheblichen Einfluss religiöser Akteure vonstatten ging, ist in diesem Zusammenhang ebenso zu nennen wie der Druck auf den Sozialstaat im Kontext der Globalisierung, die Suche nach neuen Partizipationsformen in postnationalen Konstellationen, die empirisch gesicherte Feststellung, dass die Motivation für (ehrenamtliches) bürgerliches Engagement überdurchschnittlich oft religiös motiviert ist sowie nicht zuletzt die Auseinandersetzung mit dem Islam. Die Studien des World Values Survey (Ronald Inglehart) legen außerdem einen signifikanten Wandel von materiellen zu immateriellen Werten in der westlichen Zivilisation nahe. Vormalige Zweifel, ob die heutige Gesellschaft auf ein religiöses Fundament angewiesen bleibt, treten angesichts der viel zitierten „Rückkehr“ des Religiösen sowie einer theologischen Deutung der Säkularisierung (Carl Schmitt, Charles Taylor) zurück. Dabei wird weniger in Abrede gestellt, dass ein bürgerschaftlicher Grundkonsens nicht auch auf Basis von geteilten Interessen, Chan1 Vgl. Robert Bellah et al.: Habits of the Heart. Individualism and Commitment in American Life, Berkeley 1985; Robert D. Putnam: Bowling Alone. America’s Declining Social Capital, in: Journal of Democracy 6.1, 1995: 65-78. 2 Vgl. Claude Lefort: De l’égalité à la liberté. Fragments d’interprétation de De la Démocratie en Amérique, in: Essais sur le politique, Paris 1986: 217-248; Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit, Frankfurt/M. 1990: 209-224. 3 Bei Lefort ist hier vor allem der Essay Fortdauer des Theologisch-Politischen? (1981) zu nennen, den er unter dem Eindruck der Solidarnosc-Bewegung in Polen schrieb, bei Habermas die Fülle an Überlegungen zur Religion, die er nach 2001 angestrengt hat und die v.a. im Band Zwischen Naturalismus und Religion (2005) dokumentiert sind. 2 cen und Interdependenzen sowie einer gemeinsamen (Kultur-)Geschichte und Sozialisation möglich sei; im Fokus steht vielmehr der Aspekt, dass sich ein solcher Konsens nicht ohne die Integration religiöser Überzeugungen herauszubilden vermag. Auch in dieser Hinsicht können wir uns zunächst auf Tocqueville berufen, der einen alle (christlichen) Konfessionen integrierenden consensus universalis zur normativen Grundlage jeder funktionierenden Demokratie stilisierte. Im Gegensatz zu John Rawls’ oder Martha Nussbaums Rede vom overlapping consensus, der Bürgern und Glaubensgemeinschaften weite Handlungsspielräume gewährt und damit sowohl religiösem Fundamentalismus wie einem dogmatischen Ausschluss der Religion aus dem öffentlichen Leben vorbeugen will, weist Tocqueville allerdings Grenzen auf, was die Akzeptanz nicht-religiöser bzw. nicht-christlicher Überzeugungen als moralische Ressourcen des Gemeinwesens anbetrifft. Indes war es in Europa damals schon sehr fortschrittlich, die institutionelle Trennung zwischen Kirche und Staat überhaupt mit der Vorstellung eines konstruktiven Zusammenwirkens von Christentum und Demokratie zu verbinden. Tocquevilles Vorgänger hatten diesbezüglich andere Wege eingeschlagen, sei es, dass sie wie Montesquieu oder Rousseau eine zivilreligiöse Reform des Christentums anregten, wie Michelet, Saint-Simon, Buchez oder Comte nach neuen sozialen Bindekräften (Brüderlichkeit, Nouvelle Christianisme, Esperanto-Religion) suchten oder aber wie Voltaire, Helvétius und d’Holbach die Religion im Namen der modernen Gesellschaft bzw. umgekehrt die moderne Gesellschaft im Namen des religiösen Reaktionismus (de Maistre, de Bonald) ablehnten. Tocqueville war demzufolge einer der ersten Europäer, die dem Christentum (sowie insbesondere dem Katholizismus) zutrauten, zwischen den Ansprüchen von Individuum und Gemeinschaft zu vermitteln und einen fundamentalen Beitrag zur Entstehung und zum Erhalt vitaler Bürgergesellschaften zu leisten. Dass wir uns heute darüber hinaus fragen müssen, wie sich der zivile Konsens vor dem Hintergrund eines zunehmenden Wertepluralismus, heterogenen kulturellen Erfahrungen sowie einer enormen Vielfalt von Religionen und Glaubensbekenntnissen jenseits des Christentums manifestieren soll, scheint evident. Der Grad an sozialer Homogenität, von dem das 19. Jahrhundert noch auszugehen vermochte, ist längst einem Ausmaß an sozialer Differenzierung gewichen, das seinerzeit kaum vorstellbar war. Kein Zufall ist es freilich, wenn die zivilgesellschaftliche Debatte gegenwärtig erneut von einem religiösen Problem dominiert wird, das sich an Fragen wie dem Moscheenbau, der staatlichen Ausbildung von Imamen sowie der allgemeinen Integration der Muslime in die demokratische Gesellschaft entzündet: Wie sieht der „richtige“ Umgang mit den islamischen Glaubensgemeinschaften aus? Mit Blick auf die Säkularisierung, die wie gezeigt konstitutiv auf das westliche Verständnis der civil society gewirkt hat, ist hier in erster Linie zu thematisieren, inwieweit eine institutionelle Separation der religiösen und politischen Sphäre für Muslime eine plausible Option bedeuten kann. Lässt sich der Islam als politischer Faktor in der skizzierten zivilgesell3 schaftlichen Manier verstehen oder ist ihm ein politischer Machtanspruch inhärent, wie es die Gleichsetzung zwischen Islam und Islamismus, die sowohl in der wissenschaftlichen wie auch in der öffentlichen Wahrnehmung verbreitet ist, aber auch der politisch-religiöse Begriff der Umma zumindest suggerieren. Dass sich der Islam gleichwohl einer Mäßigung nicht per se verschließt, davon zeugen gleichermaßen die historische Tradition islamischer Philosophie wie gegenwärtige Reformbemühungen, die von muslimischen Gelehrten im Sinne einer dialogfähigen, kritischen und reflexiven Lesart der theologischen Quellen unternommen werden. Und wenngleich es sich dabei zweifellos noch um eine Minderheit handelt, die in ihren Heimatländern nicht selten mit Repressalien und Verfolgung zu kämpfen hat, so belegt der Umstand immerhin eindrucksvoll die Relevanz des hier behandelten Themas: Religion und Zivilgesellschaft. Mit dem Islam, der aktuell damit konfrontiert ist, seine Rolle in einem multikulturell und demokratisch organisierten Gemeinwesen zu finden, ist ein neues Kapitel in dieser komplexen Beziehung aufgeschlagen. Dr. Oliver Hidalgo ist Akademischer Rat am Institut für Politikwissenschaft der Universität Regensburg sowie einer der Sprecher des Arbeitskreises Politik und Religion der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft. Außerdem engagiert er sich für das interdisziplinäre Wissenschaftlernetzwerk „Religion, Gesellschaft, Pluralismus“. Kontakt: [email protected] Weitere Informationen https://www.dvpw.de/gliederung/arbeitskreise/politikund-religion/homepage.html Ein Band des AK zum Thema Religion und Zivilgesellschaft (hg. von Antonius Liedhegener und Ines-Jacqueline Werkner) wird Ende 2010 erscheinen. 4