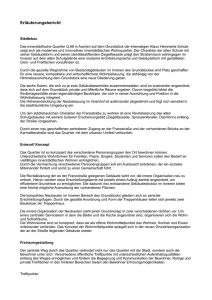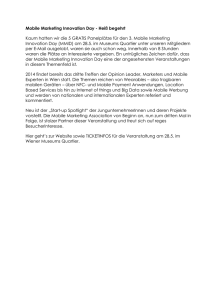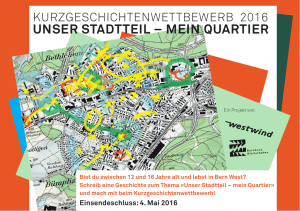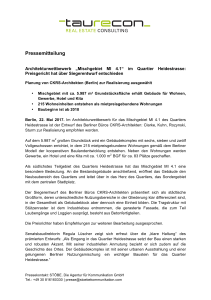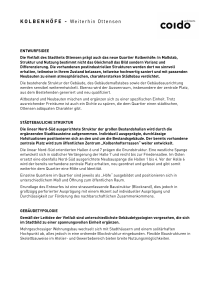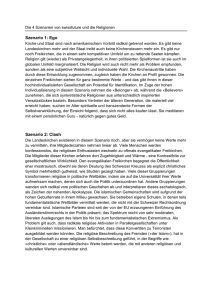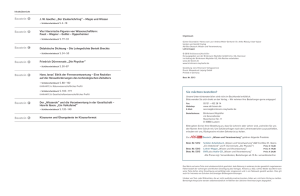Neue Ansätze und Wege zu einer sorgenden
Werbung

Caring Community Neue Ansätze und Wege zu einer Sorgenden Kommune für alle Lebensalter 6. November 2015 Landratsamt Ortenaukreis Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff 1 Gliederung 1. Weniger – älter – bunter – Facetten des demografischen Wandels 2. Gesellschaftliche Veränderungen und demografischer Wandel 3. Neue Ansätze und Wege zu einer Sorgenden Kommune für alle Lebensalter 2 1. weniger – älter – bunter Facetten des demografischen Wandels 3 weniger – älter - bunter Demografische Trendaussagen Die Zahl hochaltriger Menschen steigt – eine umfassende gesellschaftliche Herausforderung: bei den + 80jährigen wird eine Zunahme von 2,9 Mio (2000) auf 8 Mio (2050) prognostiziert. Die Zahl jüngerer Menschen geht deutlich zurück: während die Altenbevölkerung (65+) bis 2050 um 6,4 Millionen zunehmen wird, ist bei den Jüngeren (bis 65 Jahre) ein Rückgang um 18,7 Millionen zu erwarten Die “mittlere Generation” gewinnt trotz zahlenmässiger Abnahme relativ an Bedeutung “Sandwich-Generation” Die Bevölkerung in Deutschland wird insgesamt schrumpfen Aber aktuell: Wie wird sich die derzeitige Flüchtlings- und Einwanderungswelle langfristig auf die demografische Entwicklung in Deutschland auswirken? Werden damit demografische Trendaussagen relativiert? Bevölkerungsentwicklung im Ortenaukreis 2012-2030 6 Indikatoren Geburten und Sterbefälle Indikatoren Wanderungen bis 2030 Wegweiser Kommune Prognose 2012 - 2030 7 Indikatoren Alterung Wegweiser Kommune Prognose 2012 - 2030 Pflegebedarf in Deutschland: Szenarien gleich bleibender Gesundheitsstatus 2050 ** 4,35 Mill. 2030 2005 3,5 Mill. 3,36 Mill. 2020 * 2007 * verbesserter Gesundheitsstatus 2,91 Mill. 2,25 Mill. 2,13 Mill. Quellen : *Backes/ Clemens, Lebensphase Alter, 2008, ** Sachverständigenrat 2009 Weichenstellungen für Pflegeszenarien Pflegeszenarien Stand November 2012 Legende Angehörigenpflege Ambulante Pflege Stationäre Pflege Szenario 1 (Status quo): Es werden die Anteile der Pflegebedürftigen in den jeweiligen Versorgungsarten je Alter, Geschlecht und Region fortgeschrieben. Szenario 2 (formelle Pflege nimmt zu): Die Bereitschaft oder Möglichkeit zur Pflege durch Angehörige sinkt, wodurch der Bedarf an formeller Pflege steigt. Dieses Szenario schreibt damit bestehende Trends fort. Szenario 3 (häusliche Versorgungsformen werden gestärkt): Es wird unterstellt, dass Versorgungsformen und Unterstützungen installiert werden, die dazu beitragen, die häusliche Pflege so weit zu stärken, dass das Volumen der stationären Pflege auf Bundesebene konstant gehalten werden kann. Dieses Szenario ist damit ein „Wunschszenario“, das den in § 3 SGB XI normierten „Vorrang der häuslichen Pflege“ umsetzt, das aber auch mit der Schaffung neuer Wohnformen und Pflegesettings einher geht. 12 Pflegeszenarien November 2012 Legende Angehörigenpflege Ambulante Pflege Stationäre Pflege • Szenario 1 (Status quo): Es werden die Anteile der Pflegebedürftigen in den jeweiligen Versorgungsarten je Alter, Geschlecht und Region fortgeschrieben. Pflegeprognose für den Ortenaukreis Pflegeszenarien November 2012 Legende Angehörigenpflege Ambulante Pflege Stationäre Pflege • Szenario 2 (formelle Pflege nimmt zu): Die Bereitschaft oder Möglichkeit zur Pflege durch Angehörige sinkt, wodurch der Bedarf an formeller Pflege steigt. Dieses Szenario schreibt damit bestehende Trends fort. Pflegeprognose für den Ortenaukreis Pflegeszenarien November 2012 Legende Angehörigenpflege Ambulante Pflege Stationäre Pflege • Szenario 3 (häusliche Versorgungsformen werden gestärkt): Es wird unterstellt, dass Versorgungsformen und Unterstützungen installiert werden, die dazu beitragen, die häusliche Pflege so weit zu stärken, dass das Volumen der stationären Pflege auf Bundesebene konstant gehalten werden kann. Dieses Szenario ist damit ein „Wunschszenario“, das den in § 3 SGB XI normierten „Vorrang der häuslichen Pflege“ umsetzt, das aber auch mit der Schaffung neuer Wohnformen und Pflegesettings einher geht. Pflegeprognose für den Ortenaukreis Legende ambulante Pflege stationäre Pflege Pflegeprognose für den Ortenaukreis 16 von 2007 – 2013 ein Anstieg pflegebedürftiger Menschen um 350.000 Personen häusliche Pflege weitgehend stabil (schon seit 1999) mehr als 2 Drittel Angehörigenpflege – zunehmend in neuen Ausprägungen und Pflegesettings Zwischenfazit 1 Immer mehr Menschen werden immer älter – auch im Ortenaukreis. Das zahlenmäßige Verhältnis der Generationen verschiebt sich und die Zahl hochaltriger Menschen nimmt deutlich zu – im Ortenaukreis deutlich über dem Landesdurchschnitt. Der Hilfe- und Pflegebedarf wird insgesamt steigen – das Ausmaß ist dabei noch unklar. Die Auseinandersetzung mit diesem Phänomen stellt neue Fragen im Hinblick auf Ausrichtung und Konzeption von bedarfsgerechten Angeboten zur Unterstützung und Pflege. Trotz zahlenmäßiger Abnahme steigen die Belastungen der mittleren Generationen, die die Verantwortung für Kinder und Jugendliche, aber auch für die große Zahl der Älteren zu tragen haben. In einer Gesellschaft des langen Lebens wird deshalb die Schaffung von Strukturen immer notwendiger, die die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf möglich machen. In diesem Kontext geht es auch um spezifische Angebote zur Unterstützung pflegebedürftiger Menschen im sozialen Nahraum und um neue Formen von nachbarschaftlicher Solidarität. 18 3 Handlungsempfehlungen an die Enquete „Pflege in BadenWürttemberg zukunftsorientiert und generationengerecht gestalten“ • Bevölkerungswachstum bei gleichzeitigem Anstieg des Durchschnittsalters Trotz eines weiter moderaten Bevölkerungswachstums in Baden-Württemberg führen der prognostizierte Rückgang der 20 bis 59jährigen und der überproportionale Zuwachs der ab 80jährigen insgesamt zu einem erwartbar deutlichen Anstieg der Zahl pflegebedürftiger Menschen, bei einem gleichzeitigen Rückgang des benötigten Pflege- und Unterstützungspotenzials. Eine Zukunftsaufgabe wird also darin bestehen, trotz dieser Herausforderungen eine gute Pflege für eine wachsende Zahl von Menschen zu gewährleisten. Neben der Gewinnung von Nachwuchs in der Pflege und von unterschiedlichen Akteuren, die den Pflegeprozess im Sinne eines Pflegemix gestalten können, werden auch neue Konzepte gebraucht, die die bisherige Logik von ambulant versus stationär durchlässiger gestaltet. Die geschilderten Herausforderungen sind mit einem „einfachen Mehr vom immer Gleichen“ nicht zu bewältigen. • Unterschiedliche Entwicklungen im Stadt-Land-Vergleich Die Unterschiede zwischen Stadt und Land nehmen zu - das gilt auch für die Bedarfe und Bedingungen in der Pflege. Die Tatsache, dass die Städte und städtischen Regionen weiter wachsen werden, während ländliche Kommunen schrumpfen, führt zu einem starken Handlungsdruck in einigen Regionen. Im Bereich der Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf zeigen sich deutliche Muster, die für regionale Besonderheiten stehen. So ist beispielsweise die stationäre Pflegequote in den Stadtkreisen deutlich höher als in den Regionen mit ländlichen Siedlungsstrukturen. Dies spricht dafür, in der Pflegepolitik spezifische regionale Bedürfnisse stärker zu beachten und die Zuständigkeiten von Kommunen für die Sicherung der Pflege zu stärken. • Weichenstellungen in die Zukunft – Orientierung an Szenarien Die vorgestellten Szenarien für die Zukunft der Pflege machen deutlich, dass diese nicht nur einen prognostisch-beschreibenden Charakter haben, sondern auch Modelle für eine bewusste Orientierung in der Pflegepolitik sind. Die Entscheidung für ein Szenario II, wie es die Bertelsmann Stiftung skizziert, würde zu einer Ausweitung der Platzzahl in der stationären Pflege führen, damit aber andere Entwicklungen in Richtung Szenario III eher blockieren bzw. verhindern. Das bedeutet, dass hier augenblicklich Weichen für die Zukunft gestellt werden. Untrennbar damit verknüpft ist die zentrale Frage, wie die sich abzeichnenden Versorgungslücken geschlossen werden können und wie das, je nach Szenario unterschiedlich benötigte, zusätzliche Personal gewonnen werden soll. Vor diesem Hintergrund muss heute entschieden werden, wohin sich Kommunen und Landkreise im Bereich der Pflege künftig entwickeln wollen, was also ihr Leitbild in der Pflegepolitik ist. Damit verknüpft sind die notwendigen politischen Rahmensetzung und die entsprechende Förder- und Familienpolitik. 2. Gesellschaftliche Veränderungen und demografischer Wandel 22 Wandel der familiären Lebensformen Zunahme von Alleinstehenden und Alleinerziehenden “Patchwork-Familien” Oft große räumliche Entfernungen zwischen den Generationen „multilokale Mehrgenerationenfamilien“ (Bertram 2000) Erwerbstätigkeit von Männern und Frauen Auswirkungen auf familiäre Pflege und Betreuungsnotwendigkeiten für Kinder Hohe Erwartungen an die älteren Generationen 24 25 Wandel der Lebensbedingungen älterer Menschen Der Gesundheitszustand älterer Menschen hat sich in den letzten Lebensjahrzehnten stetig verbessert Die durchschnittliche Lebensdauer steigt seit 30 Jahren jährlich um 3 Monate Die materielle Situation hat sich stark verändert (ältere Menschen als wichtige Konsumentengruppe) aber: wieder wachsende Relevanz des Themas Altersarmut! Neue Bedürfnisse, neue Lebensformen (“aktive Senioren”) Leitbild des aktiven Alters – “active aging” Gesellschaftlicher Wandel und Generationen Gesellschaftliche Wandlungsprozesse bewirken auch einen kulturellen Wandel • Generationengrenzen verschieben sich Lebensstile und –entwürfe sind nicht länger eindeutig bestimmten Generationen zuzuordnen • Neue Generationen entstehen - Hochaltrigkeit – Generation der Urgroßeltern - „Sandwichgeneration“ Zwischenfazit 2 Familiäre Bindungen verändern sich, werden brüchiger oder sind mit der wachsenden Zahl von Singlehaushalten gar nicht erst vorhanden Soziale Angebote müssen also für alle Generationen die zunehmend fehlenden Ressourcen im sozialen Nahraum substituieren Die wachsende Zahl von Trennungen, neue Paar- und Familienbeziehungen führen verstärkt zum Phänomen der „Patchworkfamilien“ Daraus ergibt sich die zentrale Frage, wer für den wachsenden Bedarf an Pflege und Unterstützung künftig zuständig sein wird, vor allem im Hinblick auf Aspekte der intergenerationellen Solidarität Oft große räumliche Entfernungen zwischen den Generationen als Ergebnis von wachsender Mobilität und als Tribut an die Anforderungen der Arbeitswelt „Multilokale Mehrgenerationen-Familien (H. Bertram) haben spezifische Unterstützungs- und Entlastungsbedarfe – Beispiel „LongDistance-Caregiving“ Notwendig werden damit auch Formen von „Wahlverwandtschaften“ 28 3. Neue Ansätze und Wege zu einer Sorgenden Kommune für alle Lebensalter 29 Ausgangshypothesen Der demografische Wandel bietet für bürgerschaftliche und für nachbarschaftliche Beteiligung viele Ansatzpunkte und Herausforderungen. Damit bietet sich auch die Chance auf eine veränderte Gesellschaft, die getragen ist von Solidarität und gesellschaftlicher Mitverantwortung der einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Dabei geht es vor allem um eine Solidarität im Nahraum, um ermöglichende Strukturen für nachbarschaftliche Netzwerke, denn die Zukunft für gelingendes Altern liegt im Quartier oder in der Gemeinde. Mittlerweile existiert eine große Bandbreite und Vielzahl an formellen und bürgerschaftlich organisierten Unterstützungs- und Hilfsangeboten, die ein gelingendes Altern im Quartier/ in der Gemeinde möglich machen. Die Angebotsvielfalt garantiert jedoch nicht, dass diese Hilfe- und Unterstützungsstrukturen für den Bürger zugänglich sind und Hand in Hand gehen zum Wohl des einzelnen alten Menschen. Stattdessen gibt es unterschiedliche Zugangsbarrieren - formelle und bürgerschaftlich organisierte Angebote bestehen eher unverbunden nebeneinander und folgen verschiedenen „Logiken“, die sich gegenseitig oft eher behindern. Eine Zusammenarbeit „auf Augenhöhe“ findet kaum statt. Dadurch werden viele Ressourcen nicht so genutzt wie es sinnvoll und notwendig wäre. 31 VEGA im Freiburger Osten • Stadt Freiburg (Seniorenbüro), Heiliggeistspitalstiftung Freiburg und Katholische Hochschule Freiburg als „Impulsgeber“ seit 2010 • Modellhafte Entwicklung, exemplarische Erprobung und Evaluation des Konzepts der Lokalen Verantwortungsgemeinschaft • Förderliche Kommunikations-, Kooperations- und Aktionsformen • Fragestellung: Welche Form ist hierfür geeignet? – Wie kann diese Form aussehen? – Wie kann sie entstehen? 32 Übergreifende Ziele Vermeidung von Doppelstrukturen und kostspieligen Reibungsverlusten, Förderung der Übersichtlichkeit des Hilfesystems, Abbau von Zugangsbarrieren und Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten für alle Akteure im Quartier Förderung von Generationensolidarität Es geht also darum, förderliche Kommunikations-, Kooperations- und Aktionsformen zu identifizieren und in einem Konzept zusammenzuführen, das die Entstehung Lokaler Verantwortungsgemeinschaften im Quartier/ in der Gemeinde möglich macht. Dieser Ansatz geht zunächst von der Lebensphase Alter aus, nimmt aber die ganze Gemeinde/ das ganze Quartier und damit auch Jung und Alt gleichermaßen in den Blick. Methodisches Vorgehen / Projektverlauf Erhebung und Analyse der strukturellen Bedingungen und bestehenden Netzwerke Erarbeitung des Konzeptes Projektpartner: Stadt Freiburg / Seniorenbüro und Heiliggeistspitalstiftung Bürgernahe Umsetzung des Konzeptes in den beiden Stadtteilen Evaluation der exemplarischen Erprobung 35 Analysen auf kleinräumiger Ebene • Alter, Geschlecht, Haushalt, Migrationskontext, Erwerbstätigkeit, Transferleistungen, Wanderungsbewegung… • Bauliche Nutzungsformen, Alter und Struktur, Historie, Bauliche Maßnahmen, Mietspiegel, Dichte, • öffentliche Flächen Sozialstruktur Sozialraum • Aktivitäten und Aktionsräume Baustruktur Netzwerk • Informelle und formelle Netzwerke, lokale Akteure… 36 Studentisches Projekt: Sozialraumorientierung Stadtteilbegehung und Kartierung Interviews mit Stadtteil„Experten“ Diskussion der Ergebnisse/ Workshops im Rahmen einer Quartierstagung Stadtteilspaziergang mit BürgerInnen zu wichtigen Orten Abschlusspräsentation 37 Mix von Aktionsformen als Schlüssel zur Beteiligung von Profis und Freiwilligen 1. Tagung im Quartier 2. … daran anschließend und Fragestellungen und – Mischung von Bedürfnisse aufgreifen: informativen Vorträgen Workshop zum Thema und partizipativem „Gelingendes Altern im „Visions-Café Quartier – was bedeutet konsequent in das für MICH“ ZUGEHENDER Form…. (Diskussions- und Austauschbedürfnis) 3. … Einrichtung einer Homepage (Informationsbedürfnis) Engagierte BürgerInnen und Profis entwickeln gemeinsam Vorstellungen, was für sie „gelingendes Altern in ihrem Quartier bedeutet. 38 Bündelung von Ergebnissen und Erkenntnisse Sozialstrukturanalyse: Baustrukturanalyse: • • • • • z.B. alternde Bevölkerung bei gleichzeitigem Zuzug junger Familien – „intergenerationelle Erneuerung“: Generationenmix gestalten? Alleinlebende ältere Frauen Positives Klima der Engagementbereitschaft (Milieu, Stadtteilidentität) . . . . Sozialraumanalyse: • • • • Mangel an Orten der Alltags-begegnung (kleinräumige und “verbindende“ Treffpunkte) und des thematischen Austauschs Mangel an koordinierenden Schnittstellen Gute Rahmenbedingungen Fehlende zentrale Plätze Hanglagen „abgeschnitten“ Netzwerkanalyse: • • • Unkenntnis über Angebote/Institutionen Vernetzung kaum vorhanden Segmentorientierte Tätigkeit der Akteure 39 Chance für die modellhafte Initiierung und Begleitung von Prozessen! Baustein 1 Konzeption „Bürgertreffs“ Baustein 2 VEGA-mobil Baustein 3 Generationenspielplatz Laubenhof 40 40 41 Chance für die modellhafte Initiierung und Begleitung von Prozessen! Baustein 1 Konzeption „Bürgertreffs“ Baustein 2 VEGA-mobil Baustein 3 Generationenspielplatz Laubenhof PLUS: Start 2013: „Pflegemix in Lokalen Veranwortungsgemeinschaften“ 42 42 Landesmodellprojekt Pflegemix in Lokalen Verantwortungsgemeinschaften Freiburg Umkirch Gutach Denzlingen Entwicklung, Erprobung und Evaluation eines neuen Konzepts in 4 Modellkommunen in Baden-Württemberg (städtisch, stadtnah, ländlicher Raum) Lokale Verantwortungsgemeinschaften im Pflegemix Handbuch für Kommunen 44 Pflegemix – ein integratives Konzept Aufgabenteilungen der Akteure im Pflegemix Ziel: Gemeinsame Verantwortlichkeit Vision: „Caring Community“ Hilfen zur Alltagsbewältigung Ambulante, stationäre und teilstationäre Pflege Pflege Pflegende Angehörige und nahe stehende Menschen Ambulante Dienste Stationäre Versorgung Pflegebedürftiger Mensch Hilfen zur Alltagsbewältigung Nachbarschaftshilfe Informelles System (vgl. Bubolz-Lutz & Kricheldorff 2006, S. 26) Gesetzliche Betreuer Beratungsstellen Soz. Beratung / Begleitung Ehrenamtliche Betreuer Besuchsdienste Semi-professionelles System Semi-professionelles System Professionelles System Auf dem Weg zu einer „Caring Community“ • Zunahme älterer, pflegebedürftiger Menschen • sich wandelnde Familienstrukturen Ausgangslage • Stärkere Bedeutung des Wohnumfeldes und neuer Pflegesettings Vision Voraus- setzungen • Soziale Verbundenheit, Teilhabe, Mitwirkung • Initiierung und Stärkung lebendiger Nachbarschaften • Aufbau generationenübergreifender und personenbezogener Netzwerke • Motivierung zu Bürgerengagement und Mitverantwortung • Aktivierung zu Eigeninitiative und Förderung von Selbsthilfepotentialen • Öffnung der Träger und Institutionen für neue Pflegesettings und -formen Caring Community • Öffnung und neue Profilierung der Einrichtungen und Träger • Engagement • Mitwirkung & Mitgestaltung • Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung • Kooperation und Vernetzung Freiwillige Professionelle Akteure VERNETZUNG Bürger/ innen • Begleitung • Unterstützung • mehr Lebensqualität • Sicherung der Pflege Politik/ Kommunen • • Übernahme kommunaler Verantwortung • Schaffung ermöglichender Strukturen Ähnliche Ansätze und Orientierungen Quartier Solidaire Mehr-Generationen-Quartier Sorgende Gemeinschaft Quartiershäuser Sorgende Kommune Leitbild Bürgerkommune 49 Partizipation als Schlüssel – Schaffung von Bürgerbeteiligung und -engagement Themenwerkstätten Workshops Zukunftswerkstätten Zukunftskonferenz Open Space Planungszellen Aktivierende Befragung Fokusgruppen offene Versammlungen Runder Tisch Visionscafés 50 Landesmodellprogramm BEST Bürgerengagement sichert Teilhabe 51 Baustein I Netzwerkentwicklung Evaluationsbausteine & Thematische Schwerpunkte - Beteiligte – Skizze – Struktur - Anbindung Träger bzw. Kommune (Verortung) - Chancen, Stolpersteine, Herausforderungen aus Sicht der Beteiligten Baustein II Quartier partizipativ erarbeiten – Verläufe aufzeigen - Aktuelle Einbindung, Kennen und Gekanntwerden, Verankerung, Öffentlichkeitsarbeit, Identifikation, Bedarfsadäquatheit Baustein III Haupt- und Ehrenamt im Pflegemix/Wohlfahrtsmix Entlang der Projektbeschreibung (projektspezifisch): - Ausgangslage - Akteure, Initiativen, Kommune, Kooperation, Stärken, Lücken, aktueller Stand, Voraus-Schau, Entwicklungspotenzial, Wünsche und Vorstellungeny partizipativ erarbeiten – Entwicklungen sichtbar machen - Rahmenbedingungen, Struktur, Beteiligungsformen, Kommunikation, Augenhöhe, Rollen, Aufgaben, Balance, Qualifizierung Baustein IV (Neue) Zielgruppen - Wen warum wie erreichen? Hürden und Zugänge - Akzeptanz Baustein V - Monetarisierung 15 Standorte – 3 typische Ausprägungen Typ 1 Trägerorientierte Freiwilligengruppen Typ 2 Zusammenschlüsse von Freiwilligen mit kommunaler Steuerung Typ 3 Lokale Netzwerke mit informeller Steuerung • eher „traditionelles“ Ehrenamt • starke Identifikation mit dem Träger • deutliche Hierarchie zwischen Hauptamtlichen und Freiwilligen • deutliche Aufgabentrennung und -profile • Freiwillige eher im kommunalen „Auftrag“ tätig • lokale Führungspersonen (z.B. Bürgermeister) treten dominant in Erscheinung • Hauptamtliche werden nicht fachlich, sondern vor allem koordinativ tätig • Fragen zur Qualifizierung und fachlichen Begleitung der Freiwilligen stellen sich deutlich • hohes Maß an Selbstorganisation bei den Freiwilligen • keine sichtbare Steuerung • Frage der Zuständigkeiten für Qualifizierung und Begleitung – HA & EA kaum unterscheidbar Zentrale Herausforderungen und Entwicklungsbedarfe im Bereich zivilgesellschaftlicher Beteiligung Zentrale Erkenntnisse aus dem Projektkontext BesT Sozialraum/ Quartier Kooperation und Koproduktion Erreichbarkeit neuer Zielgruppen Nachhaltigkeit/ Kontinuität Traditionelle Profile und Konzepte Sozialer Einrichtungen müssen sich in diesem Kontext verändern Beispiel: Der eher gesellige Charakter von Seniorenbegegnungsstätten muss sich verändern - sie werden damit zu zentralen Kontakt-, Beratungsund Vermittlungsstellen Angeboten werden in diesem Rahmen dann auch Serviceleistungen, wie Wohnberatung, Vermittlung von Nachbarschaftshilfen etc. Im Kontext der neuen Aufgaben in der Pflegeberatung entstehen zusätzliche Aufgabenfelder (Pflegestützpunkte) Begegnungsstätten können sich so auch in Mehr-GenerationenHäuser oder Bürgerzentren wandeln, die für alle Bürger im Stadtteil oder Quartier offen sind. Von der Altenbegegnungsstätte zum Zentrum für bürgerschaftliche Beteiligung in einer Lokalen Verantwortungsgemeinschaft oder Sorgenden Kommune Neue Profile und Konzepte werden gebraucht… Ältere Migranten/innen sind nach aktuellen Bevölkerungsprognosen in den nächsten Jahren die am stärksten steigende Bevölkerungsgruppe In den Lebenslagen von Migranten/innen zeigen sich kumuliert typische Benachteiligungsfaktoren (materielle Benachteiligung, Zugangsbarrieren zu sozialen Diensten und Angeboten) Medikalisierung psychosozialer Probleme!!! Vor diesem Hintergrund müssen veränderte Profile und Konzepte für Bürgertreffs und Begegnungsstätten verstärkt auf eine kulturelle Vielfalt und Öffnung setzen, im Sinne Lokaler Verantwortungsgemeinschaften. Veränderte Profile und Konzepte Ein großer Vorteil besteht in der Erweiterung und Erneuerung des Profils bestehender Einrichtungen – ein wichtiger Aspekt in Zeiten knapper öffentlicher Kassen. Es werden erkennbare neue Bedarfe aufgegriffen, die sich aus gesellschaftlichen Wandlungsprozessen und einem sich verändernden Altersbild ergeben. Sie werden damit zu lebendigen Zentren im Stadtteil, im Quartier oder in der Gemeinde und sind an der Strukturbildung und Gestaltung aktiv beteiligt, im Sinne der Förderung Lokaler Verantwortungsgemeinschaften. Strukturelle Voraussetzungen • Begegnungsstätten und Bürgertreffs müssen, um die skizzierte Wirkung im Wohnquartier entfalten zu können, kleinräumig geplant werden, d.h. als wohnortnahe Kommunikations- und Begegnungsräume. • Dafür notwendige strukturelle Voraussetzungen und konzeptionelle Orientierungen sind: die Schaffung von Strukturen, in denen Mitbestimmung und Mitverantwortung tragende Elemente sind die Initiierung von Selbstorganisations- und Selbstlernprozessen 59 60 Vielen Dank!