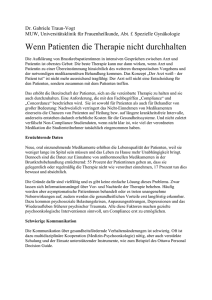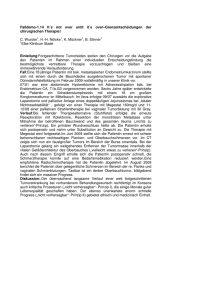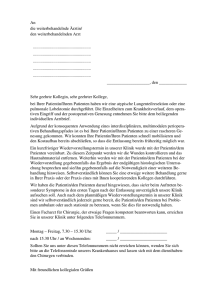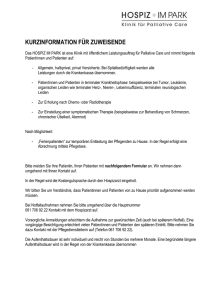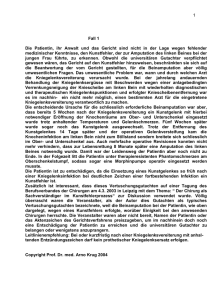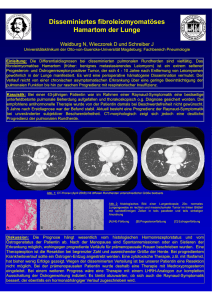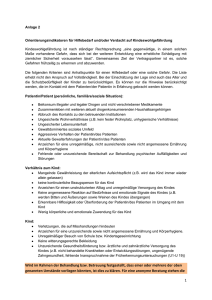Lehrtext Fortbildungsmodul für Indikation DMP
Werbung

Fortbildungsmodul für die DMP-Indikation Brustkrebs Schwerpunkt Psychoonkologie Lehrtext 1. Einleitung 3 2. Psychoonkologische Anforderungen im Rahmen des DMP Brustkrebs 3 2.1 Parallelen zum Nationalen Krebsplan..............................................................................................3 3. Die Arzt-Patient-Beziehung in der Onkologie 4 3.1 Voreinstellungen: Mythen der Onkologie........................................................................................4 3.2 Exkurs: „Krebspersönlichkeit“.........................................................................................................4 4. Kommunikation 5 5. Beratung 6 5.1 Diagnosemitteilung.........................................................................................................................6 5.2 Exkurs: Psychische Belastungen für den Arzt.................................................................................8 6. Psychische Belastungen bei Krebs 8 6.1 Psychische Komorbidität................................................................................................................8 6.2 Psychosozialer Distress .................................................................................................................9 6.3 Distress Screening........................................................................................................................12 7. Psychoonkologische Versorgung 13 7.1 Unterstützungswünsche von Krebspatientinnen...........................................................................13 7.2 Psychotherapeutische Behandlung...............................................................................................13 8. Exkurs: Psychotherapie und Überlebenslänge 14 9. Zusammenfassung 15 Literaturverzeichnis16 2 In diesem Text wird auf Therapeutenseite immer die weibliche Form mit eingeschlossen; bei den Patientinnen wird wegen des Krankheitsbildes immer die weibliche Form benutzt. 1. Einleitung 2008 erkrankten 71.660 Frauen in Deutschland an Brustkrebs (sowie 520 Männer), die Hälfte davon vor dem 65. Lebensjahr (Robert Koch-Institut); 86 Prozent der Betroffenen leben fünf Jahre nach der Diagnosestellung noch. International hat sich die Überlebensquote bei Brustkrebs von 75 Prozent in den Jahren 1975 bis 1977 über 79 Prozent zwischen 1984 und 1986 auf zirka 90 Prozent im Zeitraum 1999-2005 sehr positiv entwickelt. Sie ist damit deutlich günstiger als der Durchschnitt aller Krebserkrankungen von 68 Prozent (Kris 2010). Durch die steigende Lebenserwartung, die verbesserte Früherkennung und die wirksamer werdende Therapie wird künftig mit einer schnell wachsenden Zahl von sogenannten Survivors zu rechnen sein, also Krebspatientinnen, die als chronisch Kranke angesehen werden. 2. Psychoonkologische Anforderungen im Rahmen des DMP Brustkrebs Im gesamten DMP-Programm für Brustkrebs, insbesondere aber im Bereich der Nachsorge, werden vielfältige psychoonkologische Anforderungen an den koordinierenden Arzt gestellt. Diese beinhalten: die empathische Information der Patientin im Hinblick auf die Erkrankung und Behandlungsoptionen, Aufmerksamkeit für die psychosoziale Situation und emotionale Befindlichkeit der Patientin, insbesondere im Hinblick auf ausgeprägte Belastungsreaktionen und mögliche psychische Störungen sowie für Konflikte im sexuellen Bereich, die bedarfsgerechte Beratung und Unterstützung, die Indikationsstellung für psychotherapeutische Behandlung beziehungsweise die Vermittlung eines geeigneten Psychotherapeuten. Die hier geforderten Kompetenzen sind nur zu einem geringen Teil Gegenstand der ärztlichen Ausbildung und unterscheiden sich zudem auch von der klassischen Psychosomatik (und psychosomatischen Grundversorgung) und Psychiatrie. 2.1 Parallelen zum Nationalen Krebsplan Die oben skizzierten Kompetenzanforderungen beziehungsweise Behandlungsziele reihen sich ein in Anforderungen, die insgesamt an eine umfassende onkologische Behandlung gestellt werden. Sie sind auch Leitgedanken des Nationalen Krebsplanes. Die psychoonkologische Versorgung der Krebspatienten ist hier Gegenstand und Ziel der „Arbeitsgruppe Ziel 9“: „Alle Krebspatientinnen erhalten bei Bedarf eine angemessene psychoonkologische Versorgung“. Da die psychosoziale Unterstützung von Krebspatientinnen bisher begrifflich nicht gut eingegrenzt war, wird im Nationalen Krebsplan definiert: „Psychoonkologische Versorgung umfasst gestufte psychosoziale und psychotherapeutische Interventionen für Krebskranke und ihre Angehörigen. Psychosoziale Versorgung beinhaltet insbesondere Information, Beratung, Psychoedukation, Krisenintervention und supportive Begleitung. Psychotherapeutische Versorgung beinhaltet insbesondere Diagnostik, Krisenintervention und psychotherapeutische Behandlung von Patientinnen mit ausgeprägten psychischen Beeinträchtigungen oder komorbiden psychischen Störungen.“ Siehe auch: http:// www.bmg.bund.de/praevention/nationaler-krebsplan/was-haben-wir-bisher-erreicht/ziel-9-psychoonkologische-versorgung. html. Wir wollen auch hier diese Definition zugrunde legen. Die im Folgenden zusammengestellten Informationen orientieren sich an den oben genannten pychoonkologischen Anforderungen an den koordinierenden Arzt. Es handelt sich vor allem um zentrale Elemente der Arzt-Patient-Kommunikation, die Diagnostik und Einordnung psychischer Belastungen sowie psychoonkologische Versorgung beziehungsweise die Vermittlung von Psychotherapie. 3 3. Die Arzt-Patient-Beziehung in der Onkologie Der Aufbau einer guten Beziehung zwischen Therapeut und Patientin ist eine Grundlage für das Gelingen der Patientinnenbetreuung im Rahmen des DMP. Er ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Dazu gehören neben organisatorischen Faktoren Voreinstellungen des Arztes gegenüber Krebs und Krebspatientinnen im Allgemeinen, die eigene emotionale Verwundbarkeit beziehungsweise Betroffenheit und kommunikative Fähigkeiten. 3.1 Voreinstellungen: Mythen der Onkologie Es hat sich als hilfreich erwiesen, dass der Arzt und auch der Psychotherapeut der Krebspatientin bei der ersten Kontaktaufnahme unvoreingenommen begegnen. Dies gilt sowohl für eine mögliche eigene emotionale Betroffenheit oder auch Mitleid im Einzelfall, als auch für Haltungen und Einstellungen gegenüber Krebserkrankungen im Allgemeinen. Es gibt gerade in der Onkologie eine Reihe von verbreiteten Auffassungen, die nicht durch wissenschaftliche Evidenz gestützt sind, die aber das Verhalten im Arzt-Patient-Kontakt beeinflussen und den Arzt voreingenommen machen können. Im Folgenden sind einige dieser „Mythen“ aufgeführt: Krebs bedeutet Tod und Sterben. Die Diagnose Krebs ist ein Trauma. Krebs schränkt die Lebensqualität der Betroffenen massiv ein. Die Gefahr, eine Depression zu entwickeln, ist bei Krebspatienten groß. Psychische Faktoren haben Einfluss auf Krebsentstehung und –verlauf. Psychotherapie kann das Leben der Krebspatientinnen verlängern. Ein guter Onkologe macht den Psychotherapeuten überflüssig. Die Arbeit mit Krebskranken ist sehr belastend und macht keine Freude. Diese Mythen können hier jeweils nur kurz kommentiert werden (zur ausführlichen Würdigung vergleiche Herschbach & Heußner 2008). 4 Das Gespräch mit Krebspatientinnen umfasst je nach Krankheitsstadium ein breites Spektrum von individuellen Themen, die teilweise schwerwiegend und belastend sind, teilweise aber auch erfreulich, entspannt und humorvoll sein können. Das Thema Sterben nimmt in der Regel nur einen relativ geringen Umfang ein. Die Häufigkeit von traumatisierten Krebspatientinnen liegt unter zehn Prozent (Singer et al. 2007). „Lebensqualität“ beinhaltet eine sehr individuelle, subjektive Beurteilung des eigenen Lebens, die nur zum kleineren Teil durch die objektiven Krankheitsparameter beeinflusst ist. Die Lebensqualität einer Patientin kann hoch sein, obwohl die Krankheitssituation sehr ernst ist (und umgekehrt). Es gibt Krebspatientinnen, deren Lebensqualität höher ist als die der Durchschnittsbevölkerung (Herschbach 2002). Die Prävalenz von affektiven Störungen ist bei Krebspatientinnen gegenüber der Durchschnittsbevölkerung kaum erhöht (Mehnert et al. 2012). 3.2 Exkurs: „Krebspersönlichkeit“ Viele Krebspatientinnen fragen sich nach der Konfrontation mit der Krebsdiagnose: „Warum gerade ich?“ Sie versuchen eine Erklärung für die Erkrankung zu finden, um sie leichter bewältigen zu können. Manche Patientinnen (oder auch Angehörige) glauben, sie selbst seien Schuld an der Krebserkrankung, entweder weil sie falsch gelebt haben (zuviel Stress oder Aufopferung) oder weil sie eine typische „Krebspersönlichkeit“ haben (vgl. Schwarz 1994). „Also zunächst mal banaler: Wie kann ich so leben, damit ich damit zufrieden bin. Entscheidend ist, dass ich nach einer Bedeutung suche und ahne: es gibt keine Bedeutung. Warum muss es gerade mich treffen? Beziehungsweise – bekommt jeder in irgendeiner Form die Krankheit, mit der er am wenigsten umgehen kann?“ (aus Herschbach & Heußner 2008, Seite 20). Die Vorstellung, es gebe eine Charakterdisposition für Krebs, geht zurück bis in die Antike. Eine ganze Reihe guter prospektiver Studien hat allerdings keine Hinweise auf einen derartigen Zusammenhang ergeben. Es empfiehlt sich für den Arzt an dieser Stelle folgender „Spagat“: Einerseits das Ringen der Patien- tin um eine Erklärung und Akzeptierung der Erkrankung zu würdigen und zum Thema machen, aber ihm andererseits sehr klar zu sagen, dass es keine wissenschaftlichen Hinweise auf eine „Krebspersönlichkeit“ gibt. Eine beispielhafte Formulierung könnte sein: „Ich verstehe, dass Sie leichter mit Ihrer Situation zu Recht kommen würden, wenn Sie genau wüssten, warum es Sie getroffen hat. Ich möchte auch weiter mit Ihnen überlegen, welche persönlichen Gründe Sie hier sehen könnten. Trotzdem muss ich Ihnen ganz klar sagen, dass die Wissenschaft keine Belege für die direkte seelische Verursachung von Krebs gefunden hat.“ Dies führt nicht selten zu einer Entlastung der Patientin. Ebenso wenig Evidenz wie für die „Krebspersönlichkeit“ gibt es für andere spezifische und direkte psychische Verursachungsfaktoren für Krebs. Es konnte bis heute nicht zuverlässig belegt werden, dass Psychotherapie das Leben der Patientinnen verlängern kann, unstrittig ist hingegen der positive Einfluss auf die Lebensqualität. (siehe unten). Ein guter Onkologe beziehungsweise onkologisch tätiger Arzt unterstützt seine Patientinnen durch Information, Beratung, medizinische Behandlung, aber auch durch die Überweisung an einen qualifizierten Psychoonkologen, wenn die psychosoziale Belastung der Patientin oder seiner Familie hoch ist. Die Betreuung von Krebspatientinnen kann für den Arzt oder Psychoonkologen sehr befriedigend sein und Freude bereiten, auch wenn keine Heilung möglich ist, die Selbstreflexion (zum Beispiel mit Hilfe von Balint- oder Supervisionsgruppen) eigener Grenzen und Ziele vorausgesetzt. 4. Kommunikation Dabei wird häufig missachtet, dass Patienten in einem hohen Prozentsatz auch emotionale und soziale Aspekte mit ihren Ärzten besprechen wollen und erwarten, dass diese Themen von den Ärzten angesprochen werden (Detmar 2000). Die hier geforderten allgemeinen Fertigkeiten sind anspruchsvoll, aber erlernbar. Als Grundlage gelten die sogenannten „Rogers-Variablen“ (nach dem verstorbenen Begründer der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie): Kommunikation ist nur dann geglückt, wenn der Empfänger die Botschaft so interpretiert, wie es vom Sender beabsichtigt war. Die Arzt-Patient-Kommunikation ist gerade bei onkologischen Erkrankungen entscheidend, denn sie geht mit einer existenziellen Bedrohung bei der Patientin einher und damit mit einer Wirklichkeit, die Arzt und Patientin nicht unmittelbar teilen. Gute Kommunikation ist patientenzentrierte Kommunikation. Die patientenzentrierte Kommunikation umfasst hierbei eine für die Patientinnen verständliche Informationsvermittlung bezüglich Diagnose, Behandlungsmöglichkeiten und Verlauf der Erkrankung sowie eine empathische Mitteilung auch von ungünstigen Nachrichten (zum Beispiel bezüglich Diagnose, Rezidiv, Progress der Erkrankung). Unbedingte Wertschätzung (bedingungsfreies Akzeptieren): Respekt und Achtung für die Person des Patienten sowie Bereitschaft, ohne Vorurteile die Erlebniswelt der Patientin zu betreten. Empathie (einfühlendes Verstehen): Einfühlung in das Erleben der Patientin, die Welt mit ihren Augen sehen. Kongruenz (Echtheit): Entsprechung von Erfahrung, Bewusstsein und Kommunikation, Authentizität, keine (Arzt-)Rolle spielen. 5 5. Beratung Die moderne Beratung von Krebspatientinnen geht von einem veränderten Patientenbild aus, vom sogenannten mündigen Patienten, der informiert ist, Verantwortung übernimmt und die Behandlungsoptionen gemeinsam mit dem Arzt bespricht und mit entscheidet. Das Einbeziehen der Patientin bei medizinischen Entscheidungen (Shared Decision-Making; Partizipative Entscheidungsfindung) nimmt eine Mittelstellung ein zwischen der „paternalistischen Vorgehensweise“ des Arztes, bei der die Informations- und Entscheidungsmacht beim Arzt liegt, und dem Autonomie- beziehungsweise Informationsmodell, bei dem die Entscheidung in erster Linie bei der Patientin liegt. Die patientenzentrierte Kommunikation beziehungsweise das Gesprächs- und Handlungsmodell der Partizipativen Entscheidungsfindung stellen die Basis für den „informed consent“ und die gemeinsame Entscheidung mit den Patientinnen hinsichtlich diagnostischer und therapeutischer Schritte dar. Voraussetzung ist, dass die Patientinnen in der Lage sein müssen, komplexe medizinische Informationen zu verstehen und Vor- und Nachteile beziehungsweise Nutzen und Risiken der unterschiedlichen Behandlungsoptionen gegeneinander abzuwägen. Dies erfordert von Seiten des Arztes die Fähigkeit, die für die Patientin in Frage kommenden Behandlungsoptionen verständlich zu vermitteln. Hierzu gibt es inzwischen spezifische Fortbildungen. Es bestehen Unterschiede im Hinblick auf das Ausmaß der gewünschten Beteiligung bei den Krebspatientinnen (zum Beispiel bezüglich des Alters und der Bildung) und es ist eine wichtige Aufgabe für den Arzt, herauszufinden, in welchem Ausmaß die individuelle Patientin informiert werden und mitentscheiden will. Insgesamt gibt ein Großteil der Krebspatientinnen einen umfassenden Informationsbedarf an (vergleiche Loh et al. 2007). In der klinischen Praxis spielen Fragen nach sozialrechtlichen Unterstützungsmöglichkeiten ein große Rolle, etwa zum Krankengeld, zur häuslichen Krankenpflege, zu Haushaltshilfen, zur gesetzlichen Pflegeversicherung, zum Schwerbehindertenausweis, zur medizinischen Rehabilitation oder zu Erwerbsminderungsrenten. Gezielte und kompetente Beratungen bieten in der Regel die Sozialdienste in den Krankenhäusern, Krebsberatungsstellen oder auch der VdK (www.vdk.de). Weitere häufige Beratungsthemen sind Ernährungsfragen und Alternativmedizinische Maßnahmen, Fragen zu hereditärem Brustkrebs und zur Kommuni6 kation mit den eigenen Kindern („Wie erkläre ich meinem Kind meine Erkrankung?“). Oft sind scheinbar nüchterne Informationsfragen der vorsichtig tastende Einstieg in das Gespräch über die eigene seelische Not (vergleiche www.krebsinformationsdienst.de/leben/kindern-krebs-erklären und www.rvfs.de). 5.1 Diagnosemitteilung Zu den wichtigsten und schwierigen Beratungs- beziehungsweise Kommunikationsaufgaben, gehört es, den Patienten über die Diagnose und die Prognose der Erkrankung zu informieren. Patienten erinnern sich oft noch nach Jahren, wie dieses Gespräch für sie verlaufen ist. Es hat große Bedeutung für die weitere Krankheitsbewältigung. Diese Tätigkeit („breaking bad news“) hat sich als sehr belastend, nicht nur für die Patientin, sondern auch für den Arzt erwiesen. In der Regel wird sie nicht im Medizinstudium erlernt. Inzwischen gibt es jedoch zunehmend einschlägige Fortbildungsmöglichkeiten (zirka zwei- bis dreitägige Workshops mit Schauspielpatienten und Video-Feedback). Die allgemein anerkannte theoretische Grundlage dieser Fortbildungen ist das sogenannte SPIKES-Modell (Baile et al. 2000). Hier sind die wichtigsten Anforderungen an ein gutes Aufklärungsgespräch zusammengefasst: Setting up: Räumliche und zeitliche Rahmenbedingungen Es sollte ein persönliches Gespräch mit der Patientin stattfinden. Hilfreich sind ein ungestörter Raum sowie gleichrangige Sitzmöbel. Für das Gespräch sollte hinreichend Zeit eingeplant sein. Es sollte nicht abends oder vor dem Wochenende stattfinden. Die Patientin sollte zu Beginn über den Zweck des Gesprächs sowie den Zeitrahmen informiert werden. („Ich habe Sie heute hergebeten, um mit Ihnen über die Befunde zu sprechen; dazu habe ich mir heute 30 Minuten Zeit genommen“). Perception: Es ist für den Arzt wichtig, festzustellen, wo er die Patientin abholt, das heißt, er sollte herausfinden, was die Patientin zum Gesprächszeitpunkt selbst über ihre Erkrankungssituation weiß oder vermutet. („Sie haben ja jetzt eine ganze Reihe von Untersuchungen über sich ergehen lassen und wahrscheinlich viele Gespräche geführt – wovon gehen Sie denn selbst im Moment aus?“). Invitation: Hier gilt es für den Arzt zu erspüren, wie genau der Patient informiert werden möchte (eher global oder bis ins letzte Detail). („Es gibt ja Patienten, die möchten über jedes Detail – quasi über jeden Laborwert – genau informiert werden, anderen Patienten hingegen reicht eine grobe Orientierung. Zu welcher Gruppe gehören Sie denn am ehesten?“). Knowledge: Die Informationen sollten verständlich, strukturiert und in kleinen Portionen vermittelt werden. Das Wort Krebs sollte nicht vermieden werden. Besonders wichtig ist es, hier auf Pausen zu achten und immer wieder nachzufragen, was der Patient verstanden hat beziehungsweise ihn zu Fragen ausdrücklich zu ermutigen. („Wir haben jetzt viele Dinge besprochen. Ich möchte sichergehen, dass sie auch alles richtig verstanden haben. Gibt es im Moment irgendetwas, das Ihnen noch unklar ist?“). Emotions: Der Arzt sollte während seiner Informationsvermittlung kontinuierlich auf die (nonverbalen) emotionalen Reaktionen achten, die er beim Patienten auslöst. Diese Reaktionen müssen angesprochen werden, sie dürfen nicht ignoriert oder sachlich übergangen werden. Hier liegt der Kern dessen, was mit Empathie gemeint ist. („Ich kann gut verstehen, dass Sie im Moment sehr irritiert sind; wie fühlen Sie sich jetzt?“). Strategy and Summary: Am Ende des Gesprächs sollten eine Zusammenfassung des bisher Gesagten sowie die Planung des weiteren medizinischen Vorgehens stehen. Folgegespräche sollten unbedingt angeboten werden. Die affektive Situation des Patienten bedingt, dass er nur einen kleinen Teil der vom Arzt vermittelten Information rezipieren kann. Es kann lange dauern, bis eine Patientin wirklich verstanden, verarbeitet und akzeptiert hat, dass sie jetzt eine Krebspatientin ist. Deswegen erwachsen Fragen oft erst nach dem Verlassen des Arztzimmers. Aufklärung ist eher ein Prozess, als ein einmaliges Ereignis. („Wenn Ihnen später noch Fragen in den Sinn kommen, schreiben Sie sich diese bitte auf und sprechen Sie sie bei unserem nächsten Termin an.“). Aus Patientenbefragungen kristallisierten sich die folgenden fünf Kommunikationsmerkmale als besonders nützlich heraus: Das Gespräch fand an einem angenehmen Ort statt. Der Arzt sorgte dafür, dass keine Unterbrechungen stattfanden. Der Arzt saß nahe bei mir. Der Arzt bereitete mich in Worten darauf vor, dass schlechte Nachrichten kommen würden. Der Arzt versuchte mitzufühlen, was ich empfand (Ptacek & Ptacek 2001). 7 Neben diesen grundlegenden Kommunikationsanforderungen an den koordinierenden Arzt gilt es im gesamten Prozess der DMP-Betreuung, die psychosoziale Situation und Befindlichkeit der Patientin einzuschätzen, insbesondere auch im Hinblick auf das mögliche Vorliegen psychischer Störungen oder Krisen. 5.2 Exkurs: Psychische Belastungen für den Arzt Die Betreuung von Krebspatienten ist nicht nur eine sehr befriedigende Aufgabe, sie kann für den Arzt auch belastend sein. Studien weisen auf eine Burnout-Rate von 35 Prozent bei Onkologen hin (zum Beispiel Trufelli et al. 2007, Shanafelt & Dyrbye 2012). Die subjektive Belastung kann auf mehrere Aspekte der Arbeit zurückgehen. Da ist zum einen die Angst vor einer möglichen eigenen Krebserkrankung. Hinzu kann die Sorge kommen, den Patienten nicht heilen zu können und damit versagt zu haben, oder vielleicht den Vorwürfen der Angehörigen ausgesetzt zu sein. Besteht ein längerer persönlicher Kontakt zum Patienten, kann Mitleid, eine Identifikation mit seinem Leiden ein Pro- blem werden. Insgesamt erweist sich die Kommunikation mit Patienten und Angehörigen als belastend, insbesondere bezüglich der Diagnose- beziehungsweise Prognoseeröffnung und des Themas Tod und Sterben (siehe unten). Verglichen mit anderen medizinischen Arbeitsbereichen ist die Behandlung von Krebskranken nicht per se belastender, es unterscheidet sich aber wohl das Belastungsprofil (mehr emotionale Betroffenheit; vgl. Herschbach 1991). Besonders gefährdet sind in der Regel Individuen mit besonders hohem Arbeitsumfang und fehlendem Ausgleich in der Freizeit und solche Personen, für die die ärztliche Tätigkeit wesentlich zur Stabilisierung des eigenen Selbstwertgefühls dient. Die Selbstbeobachtung und Akzeptanz der eigenen Grenzen sowie die Sicherung eigener Ressourcen sind Grundlagen für die Verhinderung von Überlastung oder eines Burnout-Syndroms. Darüber hinaus empfiehlt sich immer der Austausch mit Kollegen, wie er in Qualitätszirkeln, Balint- oder speziellen Supervisionsgruppen gepflegt wird. 6. Psychische Belastungen bei Krebs Die Einschätzung der psychischen Befindlichkeit der Krebspatientin ist ausgesprochen schwierig beziehungsweise fehleranfällig, sogar für erfahrene Onkologen oder Psychoonkologen, wie eine ganze Reihe von Untersuchungen gezeigt hat (Newell et al. 2000; Fallowfield et al. 2001, Söllner et al. 2001; Keller et al. 2004; Werner et al. 2011). Unter anderem hat dies folgende Gründe. Grundsätzlich ist jede Krebspatientin belastet. Die Frage ist in der Regel, ob diese Belastung in einem nachvollziehbaren Rahmen bleibt. Viele Patientinnen schildern ihre innere Befindlichkeit nicht spontan beziehungsweise offen. Sie wollen stark und sachlich erscheinen, dem Arzt keine Last sein. Sie reißen sich zusammen oder reden sich die Situation schön („machen sich etwas vor“) und verleugnen ihre Belastungen. Nicht selten werden sie von ihrer Familie oder sozialen Umgebung unter Druck gesetzt, sich nicht gehen zu lassen, sich zusammenzureißen oder positiv zu denken. Der objektive Krankheitsbefund ist in der Regel nur gering mit dem subjektiven Befinden korreliert, sodass kaum von der Aktenlage oder den objektiven 8 Krankheitsparametern (wie Krankheitsstadium oder Behandlungsradikalität) auf die innere Verfassung geschlossen werden kann. In verschiedenen Phasen der Erkrankung kann die Befindlichkeit von Krebspatienten deutlichen Schwankungen unterliegen. Schließlich besteht noch nicht wirklich Einvernehmen darüber, mit welchen Konstrukten und Maßstäben der Arzt die Belastung benennen beziehungsweise einordnen soll: zum Beispiel „Befindlichkeit“, „Belastungsreaktion“, „Anpassungsstörung“, „Psychische Störung“, „Distress“, „Lebensqualität“. 6.1 Psychische Komorbidität Ein klassischer und versicherungstechnisch relevanter Ansatz, die Krankheitsbelastung einzuordnen, ist die Diagnose einer psychischen Störung (gemäß ICD oder DSM). Die folgende Tabelle gibt die Prävalenz psychischer Störungen (gemäß ICD 10) für Brustkrebspatientinnen wieder. Sie werden hier in Relation zur Normpopulation gestellt. Prävalenz psychischer Störungen für Brustkrebspatientinnen Mehnert & Koch 2008 Krebsregister Hamburg Singer et al. 2007 stationäre Akutmedizin Wittchen et al. 2011 Europäische Normalbevölkerung Posttraumatische irgendeine psychische Belastungsstörung Störung Angst-Störungen Major Depression 20,1 % 11,3 % 12,1 % 26,4 % 19,7 %* 10,5 % 9,2 % 32,9 % 14 % 6,9 % 2 % 38,2 % *Generalisierte Angststörungen und Panikstörungen Diese Angaben können nur der Orientierung dienen. Sie sind aufgrund unterschiedlicher Erhebungskriterien (Punkt- versus Jahresprävalenz; Interview- versus Fragebogenangaben) und Behandlungssituation (Akutklinik versus Krebsregister) nicht direkt vergleichbar. Insgesamt gehen wir davon aus, dass zirka ein Drittel aller Krebspatienten im Krankheitsverlauf eine psychische Störung entwickeln. Die häufigsten psychischen Erkrankungen sind im Allgemeinen Depressionen, Angst- und Anpassungsstörungen (Mehnert et al. 2012). 6.2 Psychosozialer Distress Die Anwendung der oben genannten Diagnosekriterien (ICD) für psychische Störungen auf Krebspatienten ist jedoch schwierig und problematisch. Die meisten der Kriterien sind für psychisch kranke Menschen konzipiert worden. Krebspatienten sind jedoch im Allgemeinen nicht psychisch krank. Viele der diagnostischen Kriterien kollidieren bei Krebspatienten zudem mit onkologischen Krankheits- und Behandlungssymptomen. Als Beispiel sei die Depressive Episode (F32) genannt. Zu den Kernsymptomen zählen unter anderem Antriebsminderung, Ermüdbarkeit, Konzentrationsverminderung, eine negative Zukunftsperspektive, Schlafstörungen und verminderter Appetit. Dies sind Symptome, die wir bei Krebspatienten als Folge der Erkrankung oder Behandlung antreffen, die hier aber nicht als Indikator für das Vorliegen einer depressiven Störung gewertet werden können. Würde man also das Vorliegen einer psychischen Störung zum einzigen oder zentralen Kriterium für die Indikationsstellung für psychotherapeutische Unterstützung machen, würde man viele belastete Krebspatienten „übersehen“. Unter anderem aus diesen Gründen – zudem kann auch die Etikettierung als „psychisch krank“ ein Problem sein – ist es sinnvoll, nach anderen Konstrukten zur Beschreibung des psychosozialen Befindens von Krebspatienten zu suchen. International hat sich hier inzwischen der Terminus „Psychosozialer Distress“ etabliert. Beschrieben wird hier die Art und Umfang krebsspezifischer psychosozialer Belastungen. Ein Beispiel für eine entsprechende Operationalisierung ist der Fragebogen zur Belastung von Krebskranken (FBK-R23; Herschbach et al. 2004). Es handelt sich um einen psychometrisch geprüften krebsspezifischen Belastungsfragebogen, der sich aus 23 potentiellen Belastungssituationen zusammensetzt, die jeweils nach Relevanz und Belastungsstärke beantwortet werden müssen. Die Antwortkategorien variieren zwischen „Trifft nicht auf mich zu“ (0) bis „Trifft auf mich zu und belastet mich sehr stark“ (5). Eine Untersuchung von 1670 Brustkrebspatientinnen erbrachte die in der folgenden Tabelle aufgeführten Ergebnisse (Herschbach et al. 2012). 9 Fragebogen zur Belastung von Krebskranken Mittelwert Standard- Stark belastet abweichung (in Prozent) Angst vor der Ausweitung/dem Fortschreiten der Erkrankung 2,80 1,77 39,5 Schlafstörungen 2,35 1,81 31,8 Sich schlapp/kraftlos fühlen 2,34 1,68 27,3 Angst vor nochmaligem Krankenhausaufenthalt 2,21 1,83 29,2 Angespannt sein 2,17 1,68 25,7 Angst vor Schmerzen 1,85 1,75 21,4 Weniger fähig sein, Hobbys nachzugehen 1,74 1,75 20,4 Angst vor Arbeitsunfähigkeit 1,64 1,84 21,3 Geringere sexuelle Aktivität 1,61 1,83 21,0 Unklare körperliche Beschwerden (zum Beispiel Kopf-/Kreuzschmerzen) 1,50 1,72 17,0 Wundschmerzen 1,48 1,57 13,4 Sich körperlich unvollkommen fühlen 1,36 1,69 16,1 Weniger unternehmungslustig sein 1,19 1,62 13,3 Nicht gut über soziale Unterstützungsmöglichkeiten informiert sein 1,15 1,58 12,5 Keine Möglichkeit, mit Fachmann über seelische Probleme zu sprechen 1,01 1,56 11,5 Der Partner ist weniger einfühlsam 1,00 1,53 10,9 Nicht gut über die Behandlung informiert sein 0,81 1,34 6,6 Sich unsicherer im Umgang mit anderen fühlen 0,81 1,30 6,4 In der Familie nicht offen sprechen können 0,74 1,42 8,1 Verständnislosigkeit von anderen 0,73 1,27 5,6 Unterschiedliche Meinungen verschiedener Ärzte hören 0,64 1,27 6,1 Sich weniger wertvoll fühlen 0,62 1,24 5,9 Körperpflege fällt schwerer 0,54 1,11 4,0 Quelle: Herschbach et al. 2012 Die rechte Spalte zeigt den prozentualen Anteil der befragten Patientinnen, die das jeweilige Problem als stark belastend bewertet haben. Die stärkste Belastung geht aus von der Angst, der Krebs könnte sich ausbreiten oder wiederkehren. Dieses zentrale onkologische Belastungsmoment wurde „Progredienzangst“ genannt (Waadt et al. 2011). Patienten beschreiben es zum Beispiel wie folgt: „Ich habe unheimlich Angst, wie noch nie in meinem Leben. Ich möchte doch noch meinen Enkel aufwachsen sehen. Glauben Sie, ich habe eine Chance? Ich weiß, es sagt einem niemand, kann auch keiner, aber ein kleiner Trost? Ich kann mich überhaupt nicht mehr zusammenreißen. Ich hab noch nie so geheult, wie in den letzten Wochen, sehe kein Land mehr. Ich denke so oft an den 10 Tod, will aber nicht, aber die Gedanken sind jeden Tag da. Ich kann für nichts mehr Freude empfinden, ich friere den ganzen Tag und habe immer noch Winterpulli an. So was hat es noch nie gegeben bei mir, ich und Pulli, mir war eher immer warm als kalt“. Es handelt sich bei Progredienzangst nicht um eine psychische Angststörung, sondern um eine reale Furcht, die in hoher Ausprägung die Lebensqualität der Patientinnen erheblich einschränken kann und damit behandlungsbedürftig wird. Die folgende Tabelle gibt wieder, welche Progredienzängste von Brustkrebspatientinnen (n = 1083, Hamburgisches Krebsregister; Mehnert et al. 2006) im Einzelnen genannt werden. Progredienzängste von Brustkrebspatientinnen Mittelwert Standardabweichung Ja (in Prozent) Vor Arztterminen oder Kontrolluntersuchungen bin ich ganz nervös. 3,28 1,34 86,9 Angst, im Alltag auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. 3,08 1,34 84,0 Ich habe Angst vor Schmerzen. 2,93 1,25 85,0 Wenn ich Angst habe, spüre ich das auch körperlich. 2,91 1,30 81,4 Angst, die Kinder könnten meine Krankheit auch bekommen. 2,91 1,54 67,0 Mich beunruhigt, was aus meiner Familie wird. 2,88 1,31 81,0 Angst, die Medikamente könnten meinem Körper schaden. 2,83 1,31 79,7 Ich habe Angst vor drastischen medizinischen Maßnahmen. 2,80 1,26 82,2 Wenn ich an den Verlauf meiner Erkrankung denke, bekomme ich Angst. 2,71 1,12 85,0 Angst, den eigenen Hobbys nicht mehr nachgehen zu können. 2,38 1,22 69,0 Angst vor verminderter Leistungsfähigkeit im Beruf. 2,14 1,39 49,1 Angst, nicht mehr arbeiten zu können. 2,09 1,32 50,4 Quelle: Hamburgisches Krebsregister; Mehnert et al. 2006 Die Tabelle weist darauf hin, dass die festgelegten Nachsorgetermine für die Patientinnen die größte Stressbelastung darstellen. Wir erfahren in der Praxis immer wieder, wie belastend der Zeitraum von zirka einer Woche vor dem Kontrolltermin bis zur Miteilung der Untersuchungsergebnisse für die Patientin ist. Es handelt sich oft um einen Ausnahmezustand für die gesamte Familie. An zweiter Stelle steht die Angst vor Autonomieverlust, also die Furcht, irgendwann auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Nicht immer fällt es der Patientin leicht, über ihre Ängste zu sprechen. Ein großer Teil aller Krebspatienten greift zu alternativmedizinischen Unterstützungsmitteln. Das Spektrum von entsprechenden Präparaten ist kaum mehr zu überschauen. An dieser Stelle wird auf zwei Aspekte der Beratung hingewiesen. Für den Arzt ist es wichtig, von der Patientin entsprechend informiert zu werden. Dies wird nur im Rahmen einer guten Arzt-Patienten-Kommunikation gewährleistet sein. Für viele Patienten ist die Suche nach zusätzlicher Alternativmedizin ein „Greifen nach jedem Strohhalm“, letztlich also ein Ausdruck von Angst beziehungsweise Progredienzangst. Auch in diesem Sinne ist es besonders wichtig, mit der Patientin über Ängste im Gespräch zu sein. Es empfiehlt sich, immer wieder „proaktiv“ nach aktuellen „Zukunftssorgen“ zu fragen, nach Lösungen zu suchen. Ein Vermei- den der Angst beziehungsweise des Sprechens über die Angst verstärkt sie längerfristig. Ein weiteres sehr bedeutendes Phänomen ist die Cancer Related Fatigue. Es handelt sich um ein häufiges, oft lange anhaltendes, noch nicht wirklich verstandenes Phänomen, das die Lebensqualität der Patienten massiv beeinträchtigen kann und nicht selten Gegenstand eines Rentenantrages wird. Cancer Related Fatigue ist ein nicht ohne weiteres beeinflussbares Erschöpfungs- und Müdigkeitssyndrom, das nicht durch eine psychische Störung (wie zum Beispiel Depression) erklärt werden kann. Singer et al. (2011) nennen für Brustkrebs eine Häufigkeit von zirka 43 Prozent nach Entlassung aus der stationären Akutbehandlung. Das Spektrum der Belastungen bei Brustkrebs ist insgesamt (siehe oben) breit gestreut und umfasst alle Bereiche des Alltagslebens. Häufig öffentlich zitierte Störungen des Körperbildes („body image“), der Sexualität und der Partnerschaft sind sehr vom Alter abhängig. Auch das Krankheitsstadium und die aktuelle Behandlungssituation können die oben genannten Befunde natürlich beeinflussen (Rowlan & Massie 2010). 11 6.3 Distress Screening Die Einschätzung von Ausmaß und Art psychosozialer Belastung bei Brustkrebspatientinnen im Einzelfall gehört zu den zentralen und schwierigen Aufgaben des Arztes im Rahmen des DMP. Sie dient als Grundlage für die Empfehlung und Vermittlung unterstützender Maßnahmen. Aus den oben genannten Gründen handelt es sich um eine relativ schwierige und fehleranfällige Aufgabe. Vor diesem Hintergrund hat die psychoonkologische Fachgesellschaft in der Deutschen Krebsgesellschaft (PSO) fünf kurze psychoonkologische Tests vorgeschlagen, die helfen sollen, erste Hinweise auf erhöhte Belastung beziehungsweise psychoonkologischen Versorgungsbedarf festzustellen. Für jeden der Tests wird ein Belastungsschwellenwert vorgeschlagen, der als Orientierung dienen kann. Die Tests sind in einer kostenlos zu beziehenden Broschüre beschrieben, siehe auch www.dapo-ev.de/ index.php?id=13 Empfohlen werden die folgenden Tests: 1. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) Es handelt sich hier um einen kurzen Patientenfragebogen, der in je sieben Items Ängstlichkeit und Depressivität erfasst. Der HADS ist kein krebsspezifisches Instrument und international weit verbreitet. (Der Einsatz der HADS, des FBK und der PO-Bado kann in Bayern mit 14,50 Euro beziehungsweise 15,- Euro abgerechnet werden.) 2. Hornheider Screening-Instrument (HSI) Das HSI besteht aus sieben krebsspezifischen Belastungsitems, die als Selbst- oder Fremdeinschätzungsinstrument eingesetzt werden können. 3. Das Distress-Thermometer (DT) Das Distress-Thermometer besteht aus einer linearen Analogskala sowie 40 Zusatzfragen nach den Quellen der Belastung. Es handelt sich um einen Patientenfragebogen. 4. Fragebogen zur Belastung von Krebskranken (FBK-R23 beziehungsweise -10) Der FBK (vergleiche Tabelle auf Seite 10) ist ein krebsspezifischer Patientenfragebogen, der in einer Langversion mit 23 Items und einer Kurzversion mit zehn Items vorliegt. 12 5. Psychoonkologische Basisdokumentation (PO-Bado beziehungsweise PO-Bado-KF) Die PO-Bado ist eine Fremdeinschätzungsskala, zu der ein Manual und ein Interviewleitfaden gehört (www.po-bado. med.tu-muenchen.de/index.html). In der Kurzform muss der Arzt die subjektive Patientenbelastung auf sechs Items beurteilen. Es liegt außerdem eine Spezialversion für Brustkrebs vor. Als Auswahlkriterium spielt unter anderem eine Rolle, ob die Patientin den Test in Eigenregie ausfüllen soll (HADS, DT, FBK, Hornheider Fragebogen) oder ob eine Fremdeinschätzung durch den Arzt (PO-Bado) präferiert wird. In der Praxis hat der Einsatz von Patientenfragebögen den Vorteil der Zeitersparnis für den Arzt. Die Patientin kann den Fragebogen selbstständig zum Beispiel im Wartezimmer ausfüllen und ihn dann zum Arztgespräch vorlegen. Wichtig ist es, die Ergebnisse mit der Patientin zu besprechen. Es empfiehlt sich nicht, die Patientin den Test in Gegenwart des Arztes ausfüllen zu lassen (Gefahr der Beantwortung im Sinne der „sozialen Erwünschtheit“). Die Fremdein- schätzung durch den Arzt (Po-Bado) auf der Basis des empfohlenen Interviewleitfadens erfordert einen Zeitaufwand von zirka zehn Minuten, hat aber zwei Vorteile. Zum einen fördert sie die Kommunikation mit der Patientin; zum anderen kann das mögliche Vorliegen von Verleugnung bei der Patientin (wenn offensichtlich belastete Patientinnen stark sein wollen und ihren inneren emotionalen Zustand nicht wahrnehmen oder mitteilen können) besser erkannt und berücksichtigt werden. sches Verfahren, wie die HADS hingegen erlaubt Vergleiche mit anderen Krankheitsgruppen und kann auch bei Patientinnen zu Einsatz kommen, bei denen die Krebsdiagnose noch nicht feststeht. Keiner der genannten Tests kann allerdings eine ausführliche Psychodiagnostik ersetzen. Sie dienen lediglich als erste Weichenstellung. Ihr Einsatz ist nicht aufwändig und ohne Computer möglich und hat sich in der Praxis bisher gut bewährt. Wichtig kann auch die Frage sein, ob ein krebsspezifischer Test einem unspezifischen vorgezogen wird. Ein krebsspezifischer Test wird von den Patientinnen im Allgemeinen leichter akzeptiert, weil er für sie näher am Alltagserleben ist. Ein unspezifi- 7. Psychoonkologische Versorgung 7.1 Unterstützungswünsche von Krebspatientinnen Patientinnen anfälliger, die jünger sind, eine psychische Vorerkrankung hatten und keine soziale Unterstützung haben. Wenn man Krebspatientinnen im Allgemeinen direkt danach fragt, zu welchen Themen sie Unterstützungsbedürfnisse haben, dann nennen sie (nach Harrison et al. 2009): Psychologische Themen (Sorgen, der Krebs könne sich ausbreiten, Sorge um die Ängste der Angehörigen, Unsicherheit der Zukunft), Information (über die Dinge, die man selbst tun kann, über Wirkung und Nebenwirkungen der Behandlung und über den Remissionsstatus) und körperliche Aspekte/Alltagsleben (Schmerzen, Energiemangel/Müdigkeit, gewohnte Dinge nicht tun können, Hausarbeit). Nicht selten öffnen „unverfängliche“ Themen wie zum Beispiel sozialrechtliche Unterstützungsmöglichkeiten die Tür zu persönlichen Themen wie Angst oder Scham. Es gibt inzwischen ein breites Spektrum von Interventionen, die in der Onkologie angewandt werden (zur Übersicht siehe Herschbach & Heußner 2008, Weis et al. 2006, Heußner 2009, Waadt et al. 2011; S3-Leilinie Brustkrebs). In der Praxis spielen neben Entspannungs- und Imaginationsverfahren Psychoedukationsprogramme eine große Rolle. Es handelt sich in der Regel um sehr strukturierte Gruppenprogramme (zirka zehn Patientinnen und zwei Gruppenleiter) von sechs bis zehn Doppelstunden Dauer. Jede Stunde ist einem praxisrelevanten Thema gewidmet. Als Beispiel sei hier das Programm von Weis et al. (2006) genannt, das die folgenden Inhalte umfasst: 7.2 Psychotherapeutische Behandlung Brustkrebspatientinnen, die sich als stark belastet erweisen (etwa durch Überschreiten der Schwellenwerte im Distress Screening, siehe oben) oder Hinweise auf das Vorliegen einer psychischen beziehungsweise psychosomatischen Störung oder akuten Krise erkennen lassen, sollten ein spezifisches psychotherapeutisch-psychoonkologisches Behandlungsangebot erhalten. Es gibt keine allgemeingültigen Risikofaktoren, die interindividuellen Unterschiede sind sehr groß. Im Allgemeinen sind jedoch 1. Stunde: Einführung – Gesundheitsförderung bei Krebs 2. Stunde: Krankheit und Stress 3. Stunde: Krankheitsverarbeitung als Weg 4. Stunde: Subjektive Bedürfnisse und personale Ressourcen 5. Stunde: Umgang mit belastenden Gefühlen 6. Stunde: Kontakt zu nahestehenden Personen 7. Stunde: Arzt-Patient-Kommunikation 8. Stunde: Bewältigung von Belastungen 9. Stunde: Möglichkeiten und Grenzen der Selbsthilfe 10. Stunde Abschluss – Bilanz der Erfahrungen in der Gruppe 13 Die psychoonkologischen Psychoedukationsprogramme wollen die Patientinnen informieren, ihnen das Gefühl der Mitverantwortlichkeit und Kontrolle vermitteln, ihnen aber auch Gelegenheit zur psychosozialen Unterstützung durch Gleichbetroffene geben. Die Programme sind insgesamt gut untersucht und sehr wirksam. Auch in der Onkologie lässt sich die Psychotherapie in die verhaltenstherapeutische und die tiefenpsychologische Orientierung unterteilen. Die kognitiv-behavioralen (verhaltenstherapeutischen) Therapien setzen an den irrationalen Einstellungen und Kognitionen der Patientinnen an. Die sogenannte supportiv-expressive Therapie (tiefenpsychologische Konzeption) hingegen stellt die Entwicklung emotionaler Konflikte in den Mittelpunkt der Behandlung. In der jüngeren Vergangenheit werden zunehmend spezifische, zeitlich umgrenzte Verfahren entwickelt, die auf bestimmte Problembereiche beziehungsweise Zielgruppen ausgerichtet sind. Beispiele sind: die Progredienzangsttherapie (Waadt et al. 2006) Paarkommunikation für Brustkrebspatientinnen mit ihren Partnern (Heinrichs & Zimmermann 2008) die „Meaning-Based Psychotherapy“ (Mehnert et al. 2011) Trauertherapie (Kissane & Boch 2002) Die meisten der genannten Therapieverfahren können als Einzel-, Paar- oder Gruppentherapie angewandt werden. Eine Vielzahl von Studien hat inzwischen die Wirksamkeit dieser und anderer Interventionen im Hinblick auf die Erleichterung der Krankheitsbewältigung und die Stützung der Lebensqualität belegt (Faller et al. 2013). Die letztgenannten psychotherapeutischen Behandlungen sollten nur von approbierten Psychotherapeuten mit psychoonkologischer Weiterbildung durchgeführt werden. Bei der Suche kann die KVB helfen oder auch der Krebsinformationsdienst, siehe auch www.krebsinformationsdienst.de/wegweiser/adressen/ psychoonkologen.php. 8. Exkurs: Psychotherapie und Überlebenslänge David Spiegel, ein amerikanischer Psychiater, hatte 1989 in LANCET publiziert (Spiegel 1989), dass metastasierte Brustkrebspatientinnen, die er etwa ein Jahr lang mit supportiv-expressiver Gruppenpsychotherapie behandelt hatte, signifikant länger überlebt hatten als eine randomisierte Vergleichsgruppe ohne Psychotherapie (36,6 Monate versus 18,9 Monate). Dieses Forschungsergebnis führte zu großen Hoffnungen bei Patienten und Wissenschaftlern. Sehr gründliche methodisch-statistische Re-Analysen der Studie führten zu der Erklärung, dass letztlich Randomisierungsprobleme verantwortlich waren (Nega- 14 tivselektion der Kontrollgruppe). In der Folge wurden bisher mindestens 13 vergleichbare Folgestudien durchgeführt. Von diesen konnten fünf einen Überlebensvorteil mit Psychotherapie finden, acht hingegen nicht (auch Spiegel in einer Replikationsstudie nicht!). Die wissenschaftliche Würdigung ist kompliziert und noch nicht endgültig abgeschlossen. Wir gehen heute davon aus, dass der endgültige Beleg für den Einfluss von Psychotherapie auf die Überlebenslänge nicht erbracht ist. Es empfiehlt sich, dies hoffnungsvollen Krebspatientinnen bei Nachfrage auch so mitzuteilen. 9. Zusammenfassung Psychoonkologische Basiskompetenzen sind eine wesentliche Grundlage für das Gelingen einer erfolgreichen Unterstützung von Brustkrebspatientinnen im Rahmen des DMP. An erster Stelle steht die Arzt-Patient-Beziehung, die wiederum wesentlich von der Kommunikationskompetenz des Arztes abhängt. Er informiert und berät die Patientin in vielfältiger Weise, vor allem über die Diagnose und ihre Folgen und mögliche Behandlungsoptionen. Grundlegend ist es, unvoreingenommen auf die Patientin zuzugehen und immer wieder auch die emotionalen Reaktionen zu thematisieren. dass der Patientin die Diagnose psychischer Störungen allein nicht gerecht wird. Die Beurteilung der konkreten Alltagsbelastung, etwa mit Hilfe von kurzen psychologischen Tests, ist entscheidend. Sie ist die Grundlage für die Behandlungsplanung. Je nach Art und Umfang der Belastung kann ein empathisches Informationsgespräch ebenso hilfreich sein, wie die Vermittlung einer spezifischen Psychotherapie. Diese hat sich als prinzipiell wirksam erwiesen – im Hinblick auf die Unterstützung der Krankheitsbewältigung, nicht jedoch auf die Verlängerung des Überlebens. Die Einschätzung der psychischen Befindlichkeit der Patientin ist an zweiter Stelle zu nennen. Hier sollte beachtet werden, 15 Literaturverzeichnis 1. Baile, W.F., Buckman, R., Lenzi, R., Glober, G., Beale, E.A., Kudelka, A.P. SPIKES – a six step protocol for delivering bad news: application to the patient with cancer. Oncologist 2000, 5, 302-311. 10. Herschbach, P. Stress im Krankenhaus – Die Belastungen von Krankenpflegekräften und Ärzten/Ärztinnen. Psychotherapie Psychosomatische Medizin medizinische Psychologie 1991, 5, 176-186. 2. Detmar, S.B., Aaronson, N.K., Wever, D.V., Muller, M., Schornagel, J.H. How are you feeling? Who wants to know? Patients’ and Oncologists’ preferences for discussing health-related quality of life issues. Journal of Clinical Oncology 2000, 18, 3295-3301. 11. Herschbach, P., Marten-Mittag, B., Book, K. Die Bedeutung der Psychoonkologie heute. Frauenarzt 2012, 53, 2-6. 3. Faller, H., Schuler, M., Richard, M., Heckl, U., Weis, J., Küffer, R. Effects of psycho-oncologic interventions on emotional distress and quality of life in adult patients with cancer: Systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Oncology 2013, 31, 782-793. 4. Fallowfield L, Ratcliffe D, Jenkins V, Saul J. Psychiatric morbidity and its recognition by doctors in patients with cancer. British Journal of Cancer 2001, 84, 1011–1015. 5. Heinrichs, N., Zimmermann, T. Bewältigung einer gynäkologischen Krebserkrankung in der Partnerschaft: Ein psychoonkologisches Behandlungsprogramm für Paare. Göttingen, Hogrefe 2008. 6. Harrison, J. D., Young, J. M., Price, M. A., Butow, P. N., Solomon M. J. What are the unmet supportive care needs of people with cancer? A systematic review. Social Support Cancer 2009, 17, 1117-1128. 7. Herschbach, P., Heussner, P. Einführung in die psychoonkologische Behandlungspraxis. Stuttgart, Klett- Kotta 2008. 8. Herschbach, P., Keller, M., Knight, L., Brandl, T., Huber, B., Henrich, G., Marten-Mittag B. Psychological problems of cancer patients: a cancer distress screening with a cancer-specific questionnaire. British Journal of Cancer 2004, 91,1 – 8. 9. Herschbach, P. Das „Zufriedenheitsparadox“ in der Lebensqualitätsforschung – wovon hängt unser Wohlbefinden ab? Psychotherapie Psychosomatik medizinische Psychologie 2002, 52, 141-150. 16 12. Heußner, P. et al. (Hrsg.). Psychoonkologie: Empfehlungen zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge. München: Tumorzentrum München und W. Zuckschwerdt GmbH 2009. 13. Keller, M., Sommerfeldt, S., Fischer, C., Knight, L., Riesbeck, M., Löwe, B., Herfarth, C., Lehnert, T. Recognition of distress and psychiatric morbidity in cancer patients: a multi-method approach. Annals of Oncology 2004, 15, 1243-9. 14. Kissane, D.W. & Bloch, S. Family Focused Grief Therapy. Open University Press, Maidenhead Philadelphia 2002. 15. Kris, M.G., Benowitz S.I., Adams, S., Diller, L., Gabnz, P., Kahlenberg, M.S., Le Q., Markman, M., Masters, G.A., Newman, L., Obel, J.C., Seidman, A.D., Smith, S.M., Vogelzang, N, Petrelli, N.J. Clinical Cancer Advances 2010: Annual Report on progress against cancer from the American Society of Clinical Oncology. Journal of Clinical Oncology 2010, 28, 5327-5347. 16. Koch, U., Faller, H., Härter, M., Keller, M., Schulz, H., Wegscheider, K., Weis, J., Brähler, E., Mehnert, A. 2012. The impact of clinical and treatment related characteristics on affective and anxiety disorders in cancer patients: results from a representative epidemiological study. Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology 2012, 8, 177. 17. Loh , A., Simon, D., Kriston, L, Härter, M. Patientenbeteiligung bei medizinischen Entscheidungen – Effekte der Partizipativen Entscheidungsfindung aus systematischen Reviews. Deutsches Ärzteblatt 2007, 104, 1483-1488. 18. Mehnert, P., Herschbach, P. Berg, G. Henrich, U. Koch. Progredienzangst bei Brustkrebspatientinnen – Validierung der Kurzform des Progredienzangstfragebogens (PA-F-KF). Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 2006, 52, 274-288. 27. Singer, S., Kuhnt, S., Zwerenz, R., Eckert, K., Hofmeister, D., Dietz, A., Giesinger, J., Hauss, J., Papsdorf, K., Briest, S., Brown, A. Age-and sex-standardised prevalence rates of fatigue in a large hospital-based sample of cancer patients. British Journal of Cancer 2011, 105, 445-452. 19. Mehnert, A. & Koch, U. Psychological comorbidity and health-related quality of life and ist association with awareness, utilization, and need for psychosocial support in a cancer register-based sample of long-term breast cancer survivors. Journal of Psychosomatic Research 2008, 64, 383-391. 28. Söllner, W., DeVries, A., Steixner, E., Lukas, P., Sprinzl, G., Rumpold, G., Maislinger, S. How successful are oncologists in identifying patient distress, perceived social support, and need for psychosocial counselling? British Journal of Cancer 2001, 84, 179–185. 20. Mehnert, A., Braack, K., Vehling, S. Sinnorientierte Interventionen in der Psychoonkologie. Psychotherapeut 2011, 56, 394-399. 21. Newell, S., Sanson-Fisher, R.W., Girgis, A., Bonaventura, A. How well do medical oncologists’ perceptions reflect their patients’ reported physical and psychosocial problems? Cancer 2000, 83, 1640-1651. 22. Ptacek J.T. & Ptacek J.P. Patients`perceptions of receiving bad news about cancer. Journal of Clinical Oncology 2001, 19, 4160-4164. 23. Rowland, J.H. & Massie M.J. Breast Cancer. In: Holland, J.C. et al. (Eds) Psycho-Oncology. Oxford University Press 2010, pp. 177-186. 24. Schwarz, R. Die Krebspersönlichkeit – Mythos und klinische Realität. Stuttgart Schattauer Verlag1994. 25. Shanafelt, T. & Dyrye, L. Oncologist burnout: Causes, consequences, and responses. Journal of Clinical Oncology 2012, 30, 1235-1241. 26. Singer, S., Bringmann, H., Hauss, J., Kortmann, R.D., Köhler, U., Krauß, O., Schwarz, R. Häufigkeit psychischer Begleiterkrankungen und der Wunsch nach psychosozialer Unterstützung bei Tumorpatienten im Akutkrankenhaus. Deutsche Medizinische Wochenschrift 2007, 132, 2071-2076. 29. Spiegel, D., Bloom, J.R., Kraemer, H.C., Gottheil, E. Effect of psychosocial treatment on survival of patients with metastatic breast cancer. Lancet 1989, 14, 888-891. 30. Trufelli, D.C., Bensi, C.G., Garcia, J.B., Narhara, J.L., Abrao, M.N., Dinitz, R.W., Da Costa Miranda, V., Soares, H.P., Del Giglio, A. Burnout in Cancer professionals: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Cancer Care 2008, 17, 524-531. 31. Waadt, S., Duran, G., Berg, P., Herschbach, P. Progredienzangst. Manual zur Behandlung von Zukunftsängsten bei chronisch Kranken. Stuttgart, Schattauer Verlag 2006. 32. Werner, A., Stenner, C., Schüzt, J. Patient versus clinician symptom reporting: how accurate is the detection of distress in the oncologic after-care? Psychooncology 2012, 21, 818-826. 33. Weis, J., Heckl, U., Brovai, D, Seuthe-Witz, S. Psychoedukation bei Krebspatienten. Stuttgart Schattauer Verlag 2006. 34. Wittchen, H.U., Jacobi, F., Rehm, J., Gustavsson, A., Svensson, M., Jönsson, B., Olesen, J., Allgulander, C., Alonso, J., Faravelli, C., Fratigioni, L., Jennum, P., Lieb, R., Mareker, A., van Os, J., Preisig, M., Salvador-Carulla, L., Simon, R., Steinhauen, H.C. The size and burden of metal disorders and other disorders of the brain in Europe. European Neuropsychopharmacology 2010, 21, 655-679. 17 Impressum Herausgeber: Kassenärztliche Vereinigung Bayerns Elsenheimerstraße 39 80687 München www.kvb.de Autor: Prof. Dr. Peter Herschbach Redaktion, Grafik und Layout: Qualitätssicherung/DMP Stabsstelle Kommunikation Bilder: iStockphoto.com Stand: Juli 2013