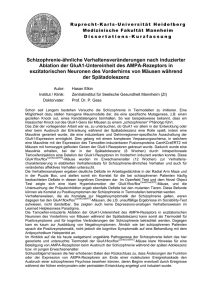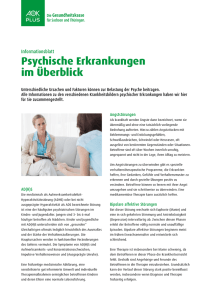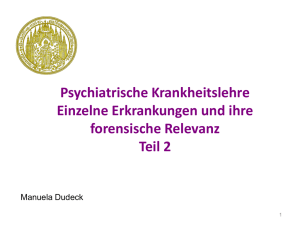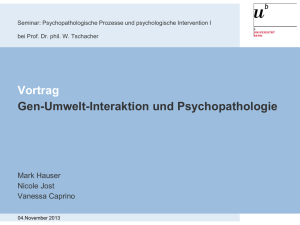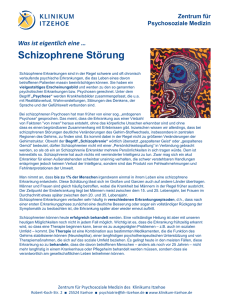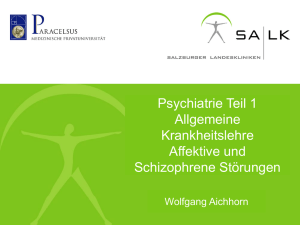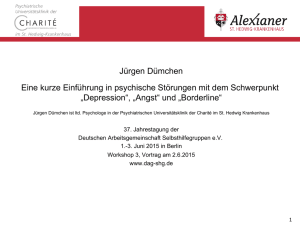Psychische Erkrankungen
Werbung

NOVEMBER 2006 Newsletter Thema Psychische Erkrankungen: Neues aus der Forschung Gesundheitsforschung: Forschung für den Menschen INHALT Psychische Krankheiten vom Stigma befreien 2 Psychosomatische Therapie: Jobprobleme in der Klinik lösen 3 Depressionen: Mit der richtigen Strategie das Suizidrisiko senken 4 Blick ins Blut verbessert Depressionsbehandlung 6 BMBF-Broschüre über Depressionsforschung aktualisiert 7 Schizophrenie: Bessere Behandlungserfolge bei frühem Therapiebeginn 8 Therapie schizophrener Störungen – auf die richtige Kombination kommt es an Interview mit Professor Dr. Wolfgang Gaebel 9 Schizophrenie frühzeitig begegnen 11 Hausbesuche vom Psychiater helfen Heimkindern 12 Erfolgreiche Raucherentwöhnung ist auch eine Frage der Psyche 14 NEWSLETTER THEMA Psychische Erkrankungen Gesundheitsforschung: Forschung für den Menschen Psychische Krankheiten vom Stigma befreien Psychische Erkrankungen sind fast so alt wie die Menschheit. Julius Cäsar, William Shakespeare, Kaiserin Maria Theresia, Robert Schumann und Albert Einstein sind nur einige der vielen berühmten Persönlichkeiten, denen Wissenschaftler eine affektive Störung nachsagen. Hinter diesem Sammelbegriff verbergen sich Depressionen und manisch depressive Erkrankungen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass etwa jeder Vierte in der westlichen Welt im Laufe seines Lebens unter einer seelischen Störung zu leiden hat – also mehrere 100 Millionen Menschen! In dem von der WHO im Jahr 2001 veröffentlichten World-Health-Report erscheinen in der Liste der zehn wichtigsten Erkrankungen gleich mehrere psychische Krankheitsbilder: bipolare Störungen, Depressionen, Schizophrenien und Suchterkrankungen. Gesundheitspolitisch und volkswirtschaftlich nehmen diese psychischen Störungen eine immer größere Bedeutung ein. Hierzulande stellen sie die häufigste Ursache für Frühberentungen dar. Zwischen 1983 und 2003 stiegen die psychisch bedingten Rentenfälle in Deutschland um mehr als das Dreifache an. Vorurteile drängen psychisch Kranke in die Ecke Doch die Kostenfrage ist nur die eine Seite der Medaille. Denn das Leid psychisch Kranker ist manchmal unermesslich und für Gesunde kaum vorstellbar. Nicht nur die Krankheit selbst macht den Betroffenen zu schaffen, sondern auch Stigmatisierungen und Diskriminierungen, die ihnen vielerorts entgegengebracht werden und denen oft die Grundlage fehlt. Etliche private Kranken-, Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen lehnen einen Vertragsabschluss mit Menschen ab, die bereits eine Psychotherapie hinter sich haben – selbst bei Ausschluss der psychischen Erkrankung aus dem Leistungskatalog. Psychisch Erkrankte gelten beispielsweise entgegen der wissenschaftlichen Erkenntnis als besonders gewalttätig, Schizophreniepatienten als unheilbar krank. Und viele unterstellen Patienten mit einer Depression die Schuld an der Erkrankung. Derartige Stigmatisierungen können schlimme Folgen haben. Etliche Erkrankte nehmen aus Scham ärztliche Hilfe zu spät oder gar nicht in Anspruch, was eine frühzeitige und damit besonders aussichtsreiche Therapie erschwert oder gar verhindert und sie immer weiter in die Isolation treibt. International und national machen sich daher verschiedene Organisationen für die Bekämpfung der Stigmatisierung und Diskriminierung psychisch Kranker stark – unter anderem auch das Kompetenznetz Schizophrenie und das Kompetenznetz Depression, Suizidalität. Förderung der Forschung zu psychischen Erkrankungen durch das BMBF Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert bereits seit mehreren Jahren Forschungsnetzwerke und Einzelprojekte zu psychischen Erkrankungen. Zu den großen Forschungsnetzwerken gehören das Kompetenznetz Depression, Suizidalität und das Kompetenznetz Schizophrenie. Im Kompetenznetz Depression, Suizidalität, das seit 1999 bis 2008 mit 15 Millionen Euro vom BMBF gefördert wird, arbeiten verschiedene Arbeitsgruppen daran, diagnostische und therapeutische Defizite depressiver Erkrankungen zu verbessern und Forschungslücken zu schließen. Die Kernarbeit des Kompetenznetzes Schizophrenie dreht sich um eine optimierte Prävention, Akut- und Langzeittherapie sowie die Rehabilitation schizophren Erkrankter. Das Kompetenznetz Schizophrenie wird seit 1999 bis 2009 mit insgesamt 15 Millionen Euro vom BMBF unterstützt. Projekte zu Suchterkrankungen werden vom BMBF im Förderschwerpunkt Suchtforschung gefördert. Dafür stellt das BMBF seit 1991 bis 2008 rund 47 Millionen Euro zur Verfügung. 2006 hat das BMBF einen neuen Förderschwerpunkt zur Psychotherapieforschung eingerichtet. Die geförderten Forschungsverbünde werden sich hauptsächlich mit der Wirksamkeit verschiedener Therapien bei sozialen Phobien, Psychosen, Panikstörungen, Essstörungen und ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom) beschäftigen. Für die ersten der beiden geplanten Förderphasen sind rund 13 Millionen Euro vorgesehen. Darüber hinaus wird Forschung zu psychischen Erkrankungen vor allem in den Förderschwerpunkten Rehabilitationsforschung, Versorgungsforschung und Präventionsforschung vom BMBF gemeinsam mit Krankenkassen und der Deutschen Rentenversicherung gefördert. 2 NEWSLETTER THEMA Psychische Erkrankungen Gesundheitsforschung: Forschung für den Menschen Psychosomatische Therapie: Jobprobleme in der Klinik lösen „Mein Job macht mich krank!” Dahinter steckt in vielen Fällen mehr als der Frust nach einem nervenaufreibenden Arbeitstag. Speziell die Psyche leidet, wenn Ärger mit Vorgesetzten und Kollegen, zunehmender Leistungsdruck oder ein kaum zu bewältigendes Arbeitspensum Stress bereiten. Bis zu zwei Drittel aller stationär behandelten Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen klagen über schwerwiegende berufliche Probleme. Sie machen diese auch als Ursache und aufrechterhaltenden Faktor für ihre Erkrankung verantwortlich, fühlen sich durch die Belastungen im Job gesundheitlich beeinträchtigt und erleben sich gleichzeitig in ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Spezielle, in das klinische Rehabilitationsprogramm integrierte, berufsbezogene Therapieprogramme können diesen Patienten helfen, nach der Entlassung im Berufsleben wieder stabil Fuß zu fassen und dieses besser zu bewältigen, fanden zwei süddeutsche Forscherteams heraus. Dazu verglichen sie unter anderem die Erwerbstätigkeitsquote, Absichten, sich bald berenten zu lassen und persönlich empfundene Arbeitszufriedenheit von Patienten aus zwei unterschiedlich ausgerichteten Therapiegruppen mit den jeweiligen Kontrollgruppen. Professor Manfred Beutel und Dr. Rudolf Knickenberg entwickelten für die Psychosomatische Klinik Bad Neustadt/Saale einen tiefenpsychologisch orientierten Ansatz, Privatdozent Andreas Hillert und Diplom-Psychologe Stefan Koch von der Medizinisch-Psychosomatischen Klinik in Prien am Chiemsee erforschten ein verhaltenstherapeutisches Behandlungsprogramm. Beide Untersuchungen wurden im Rahmen des gemeinsam vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Deutschen Rentenversicherung finanzierten Schwerpunkts Rehabilitationsforschung gefördert. „Nach unserer Erfahrung hilft der Abstand zum Alltag den Klinikpatienten dabei, ihre Belastungen genauer zu betrachten, Probleme zu benennen, Ziele zu formulieren und Lösungsansätze vorzubereiten”, beschreibt Beutel die Grundvoraussetzungen. Damit widerspricht er gleichzeitig der Meinung vieler Betroffener, dass sich mit einkehrender Ruhe und Erholung die Probleme im Job automatisch verflüchtigen. Zwei Wege – ein Ziel Im tiefenpsychologischen Ansatz der Interventionsstudie (TPI) teilten die Psychologen beruflich belastete Patienten in zwei nahezu gleich große Gruppen ein. Die eine erhielt eine psychosomatische Standardtherapie, die andere nahm zweimal wöchentlich über vier Wochen hinweg an einer berufsbezogenen Therapiegruppe (BTG) teil. Ärger mit Kollegen und Vorgesetzten war nur einer von vielen Inhalten dieses Ansatzes, der auf der Methode des emotionalen Lernens basiert. Beim emotionalen Lernen spielen in der Tiefenpsychologie sogenannte Übertragungen eine entscheidende Rolle. Die Betroffenen erlernen Verhaltensänderungen, indem sie sich Parallelen zwischen dem aktuellen Problem – beispielsweise Konflikte mit Kollegen – und ähnlich gelagerten Situationen aus der Vergangenheit – wie Ärger mit den Eltern – bewusst machen und so eine andere Haltung in der aktuellen Situation einnehmen können. Eine andere Herangehensweise verbirgt sich hinter dem verhaltenstherapeutischen Ansatz, den Hillert und Koch in der berufsbezogenen Therapiegruppe „Stressbewältigung am Arbeitsplatz” (SBA) verfolgen. In ihrer Interventionsgruppe ging es in vier Modulen à zwei Doppelstunden darum, ausgehend von der aktuellen beruflichen Problemsituation sowie ihrem Erleben und dem Verhalten einen individuellen Belastungskreislauf zu erstellen. Die konkrete Situation am Arbeitsplatz, aber auch biographische Aspekte, Einstellungen und ❯❯ 3 NEWSLETTER THEMA Psychische Erkrankungen Verhaltensmuster der Patienten wurden zusammengeführt, praktikable Lösungsmöglichkeiten konzipiert und geübt. Dazu nutzten die Therapeuten vielfach Rollenspiele. Die Kontrollgruppe erhielt eine verhaltenstherapeutische Standardtherapie. Gesundheitsforschung: Forschung für den Menschen Das Berufsleben besser in den Griff bekommen Interventionsgruppen eine höhere Behandlungszufriedenheit und eine geringere Erschöpfung an. Sie gingen besser mit beruflichen Belastungen um, äußerten weniger Rentenabsichten und waren im Vergleich zur Standardtherapie seltener arbeitsunfähig. Außerdem besaßen sie ein geringeres Risiko, aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Die Patienten füllten Fragebögen bei Aufnahme, Entlassung sowie nach drei und sechs Monaten aus. So erhielten die Wissenschaftler objektive Daten wie Arbeitsunfähigkeitszeiten und subjektive Einschätzungen, beispielsweise zur Befindlichkeit und beruflichen Belastung. Ergebnis: Die Patienten aus den berufsbezogenen Therapiegruppen – sowohl beim tiefenpsychologisch orientierten Ansatz TPI als auch beim verhaltenstherapeutisch ausgerichteten Ansatz SBA – kamen deutlich besser mit ihrem Arbeitsleben zurecht als die Teilnehmer aus den Kontrollgruppen. In einer Befragung ein Jahr nach der Entlassung gaben die Teilnehmer der „Diese Ergebnisse unterstreichen nachdrücklich die berufliche Problematik psychosomatischer Patienten und damit die Notwendigkeit entsprechender Behandlungsangebote”, erläutert der Arzt und Psychotherapeut Hillert. Seit Ende 2004 gehören berufsbezogene Therapien daher in Prien und Neustadt/Saale zum Standardangebot. Die Ergebnisse von Hillert, Beutel und Knickenberg ziehen weite Kreise. Derzeit untersuchen Wissenschaftler die beiden – entsprechend angepassten – Therapieansätze auch in der kardiologischen und orthopädischen Rehabilitation. Depressionen: Mit der richtigen Strategie das Suizidrisiko senken Niedergeschlagen, freudlos, ohne Energie und Hoffnung: Schwere Depressionen machen das Leben zur Qual. Oftmals sehen die Betroffenen in einem Suizid den letzten Ausweg aus dem für Gesunde kaum vorstellbaren Leid. Zehn bis 15 Prozent aller Patienten mit starken Depressionen nehmen sich im Laufe ihrer Erkrankung das Leben, bis zu 56 Prozent unternehmen zumindest einen Suizidversuch. Mit einem breit angelegten Interventionsprogramm gelang es dem „Nürnberger Bündnis gegen Depression”, die suizidalen Handlungen (Suizide und Suizidversuche) in Nürnberg innerhalb der zwei Untersuchungsjahre 2001 und 2002 um rund ein Viertel zu reduzieren. „Unsere neuesten Zahlen zeigen, dass nach drei Jahren der Intervention die suizidalen Handlungen sogar noch weiter gesenkt werden konnten”, schildert Professor Ulrich Hegerl von der Psychiatrischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität München den Erfolg des Bündnisses. Diese Zahlen zeigen, welch enorme Chancen in einer verbesserten Diagnostik und Behandlung stecken. Behandlungsbedürftige Depressionen bestehen in der Regel aus verschiedenen körperlichen und psychischen Krankheitszeichen und dauern meist meh- rere Monate an. „Depressionen, die nichts mit gelegentlichen Stimmungsschwankungen oder verständlicher Traurigkeit in schwierigen Lebenssituationen zu tun haben, sind eine ernst zu nehmende Erkrankung, die aufgrund der hohen Suizidgefährdung einen lebensbedrohlichen Verlauf nehmen kann”, erläutert Hegerl die Situation. Information auf mehreren Ebenen führt zum Erfolg Zusammen mit Kollegen aus Würzburg und Nürnberg entwickelte er für das zum Kompetenznetz Depression, Suizidalität gehörende Nürnberger Bündnis gegen Depression eine Vier-Ebenen-Interventionsstrategie zur Optimierung der Versorgung depressiv Erkrankter und zur Suizidprävention. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Interventionsprogramm umfasste im Raum Nürnberg Fortbildungen für Hausärzte (Ebene 1), Schulungen für Multiplikatoren wie Lehrer, Apotheker, Pflegekräfte, Polizisten, Beratungskräfte und Pfarrer (Ebene 2), Veranstaltungen für Betroffene und Angehörige (Ebene 3) sowie eine Aufklärungskampagne in der Öffentlichkeit (Ebene 4). Gegenüber dem Jahr 2000 und verglichen ❯❯ 4 NEWSLETTER THEMA Psychische Erkrankungen Gesundheitsforschung: Forschung für den Menschen Netzwerk rettet Leben Mit einer Plakataktion macht das „Deutsche Bündnis gegen Depression” deutschlandweit auf das Thema Depressionen aufmerksam. mit der Würzburger Kontrollregion gingen die suizidalen Handlungen in Nürnberg innerhalb der zwei Interventionsjahre (2001 bis 2002) um 24 Prozent zurück. Besonders auffällig war der Rückgang bei drastischen Methoden wie Erschießen, Erhängen und Springen aus großer Höhe. Inzwischen hat das Modellprojekt Schule gemacht: Über 35 Regionen und Städte engagieren sich bereits unter dem Dach des „Deutschen Bündnisses gegen Depression e.V.” (www.buendnis-depression.de) auf lokaler Ebene und nutzen das Nürnberger Konzept sowie die dort entwickelten Materialien. „Wir erhoffen uns langfristig ein flächendeckendes Netzwerk zur besseren Versorgung depressiv Erkrankter und damit auch bundesweit einen Rückgang der Suizidalität”, formuliert Hegerl die Wünsche. 2004 wurde zudem die European Alliance Against Depression (EAAD) gegründet, gefördert von der Europäischen Kommission. Basierend auf dem Bündnis-Konzept starteten in 18 europäischen Staaten landesspezifische Vier-Ebenen-Interventionen (www.eaad.net). Nähere Informationen auch unter: www.kompetenznetz-depression.de Depressionen: keine Altersfrage Ob alt, ob jung – Depressionen können jeden treffen. Dies gilt auch für Kinder: Hier gestaltet sich die Diagnose jedoch oft schwierig, da sich die Erkrankung hinter Aggressionen und anderen Verhaltensauffälligkeiten, Leistungseinbrüchen, Rückzugsneigungen und manchen körperlichen Symptomen wie Kopfschmerzen oder Schlafproblemen verbergen kann. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Kinder altersbedingt ihre psychische Befindlichkeit nicht differenziert schildern können. Bei der Behandlung mit Antidepressiva müssen die Ärzte den Vorteil der antidepressiven Wirksamkeit, der insbesondere bei Jugendlichen für einzelne Antidepressiva belegt ist, gegen mögliche Nachteile abwägen. So ist unklar, welche Auswirkung eine längerfristige Einnahme von Antidepressiva auf das sich entwickelnde Gehirn hat. Dem gegenüber stehen mögliche negative Einflüsse einer unbehandelten Depression. Häufig sind bei diesen Patienten psychotherapeutische Behandlungsansätze unter Einbeziehung der Familie sinnvoll. Bei Senioren treten Depressionen mit einer Häufigkeit von etwa fünf Prozent auf – also nicht öfter als im jungen Erwachsenenalter. Die Vorstellung, dass Depressionen bei Menschen im Alter, die mit dem Verlust der geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit und vielleicht auch der eigenen vier Wände konfrontiert sind, eine „natürliche” Begleiterscheinung seien, ist ein weitverbreitetes und auch gefährliches Vorurteil. Es verführt dazu, bei älteren Menschen die Depression zu akzeptieren und nicht ebenso konsequent zu behandeln wie im jüngeren Erwachsenenalter. Dies ist jedoch unbedingt nötig. Denn Depressionen haben gerade bei alten Menschen einen besonders lebensbedrohlichen Charakter, bedingt durch die mit der Erkrankung einhergehende Rückzugsneigung mit Bettlägrigkeit, durch depressionsbedingt vermindertes Durst- und Hungergefühl und die gerade im Alter erhöhte Suizidgefährdung. Quelle: Kompetenznetz Depression, Suizidalität 5 NEWSLETTER THEMA Psychische Erkrankungen Gesundheitsforschung: Forschung für den Menschen Blick ins Blut verbessert Depressionsbehandlung Für eine erfolgreiche Behandlung von Depressionspatienten zählt nicht nur der Blick in deren Seele, sondern auch in ihr Blut. Denn Patienten reagieren unterschiedlich auf Antidepressiva. Bei Messungen der Wirkstoff-Konzentrationen im Blut schwanken diese bei einer Standarddosis erheblich zwischen verschiedenen Personen. „Der Behandlungserfolg bei Depressionen hängt nicht zuletzt von einer optimalen Medikamentenauswahl und -dosierung ab. Schätzungen zufolge erhalten abhängig vom Zeitpunkt der Untersuchung zwischen 30 und 80 Prozent aller therapieresistenten Patienten zu niedrig dosierte Medikamente und würden von einer angepassten Dosis profitieren”, weiß Professor Christoph Hiemke von der Psychiatrischen Klinik der Universität Mainz. Ziel einer Dosisanpassung ist es, die optimale Wirkstoff-Konzentration im Blut, auch „therapeutisches Fenster“ genannt, zu erreichen. „Fenster“ meint jenen Konzentrationsbereich, bei dem die Patienten mit größter Wahrscheinlichkeit optimal auf die Therapie ansprechen. Genauso kann die Überprüfung der entsprechenden Blutwerte aber auch Hinweise auf Überdosierungen liefern oder dazu führen, auf ein anderes Präparat umzusteigen. Das „therapeutische Fenster” nutzen In dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützten Forschungsprojekt „Therapeutisches Drug-Monitoring bei Depressionen” belegten Hiemke und seine Kollegen den medizinischen Nutzen einer Kontrolle der Blutspiegel bei depressiven Klinikpatienten für alte und neue Antidepressiva. Ihre Ergebnisse flossen in eine aktuelle Leitlinie über das Therapeutische Drug-Monitoring (TDM) von Psychopharmaka ein. Für das Monitoring bei alten Antidepressiva, zu denen auch die trizyklischen Antidepressiva gehören, wiesen die Forscher deutliche Erfolge nach. Patienten, deren Blutspiegel mittels TDM auf die optimale therapeutische Konzentration eingestellt wurden, sprachen entschieden besser auf die Behandlung an als jene mit Werten außerhalb dieses Bereichs. Auch bei der Behandlung mit neueren Antidepressiva zeichnet sich ab, dass TDM zur Therapieverbesserung beitragen kann. „Wenn Patienten schlecht oder gar nicht auf ein Medikament ansprechen, über Verträglichkeitsprobleme klagen oder mehrere Arzneimittel gleichzeitig einnehmen, sollte ein Therapeutisches Drug-Monitoring erfolgen”, rät Hiemke. Gleiches gilt für Präparate, die bei zu hoher Dosierung unerwünschte Nebeneffekte hervorrufen können. Hinzu kommen eine Reihe von Einzelfallindikationen, bei denen die Wissenschaftler in ihrer Leitlinie zum Monitoring raten. Denn von den hierzulande rund vier Millionen Menschen mit einer behandlungsbedürftigen Depression erhalten nur maximal zehn Prozent eine ausreichende Therapie, beklagt das Kompetenznetz Depressionen, Suizidalität. Gründe dafür gibt es viele. Oftmals nehmen die Betroffenen ihre Medikamente nicht zuverlässig ein oder sie bekommen aus Angst vor Nebenwirkungen eine zu geringe Wirkstoffdosis. Hinzu kommen sehr individuelle Reaktionen auf Medikamente: Der eine Patient beispielsweise baut den Wirkstoff sehr schnell ab, der andere eher langsam – bei dem einen ist viel Wirksubstanz im Blut und es kommt damit viel im Gehirn an, beim anderen weniger. Die Leidensphase möglichst kurz halten Ärzte warten entsprechend den aktuellen Therapieleitlinien zur Depressionsbehandlung mit einem Dosisoder Medikamentenwechsel in der Regel bis drei oder vier Wochen nach Behandlungsbeginn. Hierzu brachte die TDM-Studie interessante Ergebnisse. „Bereits in der zweiten Behandlungswoche zeichnete sich bei unseren Studienteilnehmern ab, ob sie ansprechen werden oder ❯❯ 6 NEWSLETTER THEMA Psychische Erkrankungen nicht. Wir wussten also schon nach spätestens 14 Tagen, wie ein Antidepressivum anschlägt und konnten entsprechend schneller reagieren”, kommentiert Hiemke. Das Drug-Monitoring ermöglichte damit eine wesentlich frühere Therapieentscheidung, da sich die Wirkungstendenz im Blut bereits zeigte, lange bevor die volle klinische Wirkung der Präparate nach mehreren Wochen erreicht war. Von solch einem frühen Hinweis profitieren in erster Linie die Betroffenen, da eine zügig einsetzende, wirksame Therapie ihre Leidensphase verkürzt. Mit dem Ziel, die Behandlung von Depressionen und auch den Einsatz des Therapeutischen Drug-Monitorings künftig zu verbessern, brachte die Forschergruppe ihre Ergebnisse in eine Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft für Neuropsychopharmakologie und Pharmakopsychiatrie (AGNP) ein. Diese Leitlinie stellt nicht nur den aktuellen Wissensstand zu Wirkstoff-Konzentrationen im Blut und der therapeutischen Wirkung von Arzneimitteln dar und liefert praktische Anwendungstipps, sondern gibt auch konkrete Empfehlungen, in welchen Fällen solch ein Drug-Monitoring angewendet werden sollte. Gesundheitsforschung: Forschung für den Menschen Stimmt es, dass ... Antidepressiva die Persönlichkeit verändern und süchtig machen ? „Nein, beides sind leider noch sehr weitverbreitete Vorurteile. Die medikamentöse Behandlung mit antidepressiv wirkenden Medikamenten gilt inzwischen als unverzichtbares und wirksames Heilverfahren. Die Wirkstoffe sind in der Lage, die Menge der aus der Balance geratenen Botenstoffe wieder zu normalisieren und die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen zu fördern. Sie machen nicht süchtig, verändern nicht die Persönlichkeit und sind keine Aufputschmittel. Nimmt ein Gesunder ein Antidepressivum ein, so wird er nicht glücklicher oder fühlt sich sonst wohler. Denn Antidepressiva sind keine Glückspillen.” ! Professor Ulrich Hegerl, Psychologe an der Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität München, Sprecher des Kompetenznetzes Depression, Suizidalität BMBF-Broschüre über Depressionsforschung aktualisiert Rund vier Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Depression. Wie die Symptome der Krankheit aussehen, wie das Seelenleiden erforscht wird, welche Therapien verfügbar sind und wo sich Betroffene an lokale Bündnisse gegen Depression wenden können, sind einige Themen der BMBF-Broschüre „Es ist, als ob die Seele unwohl wäre ... Depression – Wege aus der Schwermut. Forscher bringen Licht in die Lebensfinsternis.” Die Erfahrungen einer Patientin stehen am Beginn der Publikation. Die Broschüre erschien erstmals 2001 und war lange Zeit vergriffen. Die nun verfügbare aktualisierte Fassung enthält auch Links zum Thema sowie einige Buchtipps. Bestelladresse: BMBF Referat Öffentlichkeitsarbeit 11055 Berlin oder per E-Mail: [email protected] 7 NEWSLETTER THEMA Psychische Erkrankungen Gesundheitsforschung: Forschung für den Menschen Schizophrenie: Bessere Behandlungserfolge bei frühem Therapiebeginn Schizophrenie verursacht enormes Leid und ist die teuerste psychische Erkrankung. Die durch schizophrene Psychosen entstehende Finanzlast gleicht den Ausgaben für Volkskrankheiten wie Diabetes oder Herzerkrankungen. Bei 35 bis 40 Prozent der Ersterkrankten kommt es zu einer chronischen psychischen und sozialen Behinderung, die hierzulande bei rund 200.000 bis 300.000 Menschen bereits in jungen Jahren zu Erwerbsunfähigkeit und frühzeitigem Rentendasein führt, und von den rund 800.000 Schizophreniepatienten in Deutschland nehmen sich circa zehn bis 15 Prozent das Leben. Das 1998 gegründete Kompetenznetz Schizophrenie hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, die Versorgungssituation der Betroffenen zu verbessern. Dazu trägt auch eine neue Untersuchung aus dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Kompetenznetz bei. Sie beleuchtet sowohl die psychopathologischen Charakteristika, die kognitiven Fähigkeiten als auch Therapieergebnisse von Schizophreniepatienten mit unterschiedlich langer Krankheitsgeschichte. Fazit: Patienten, die bereits während der ersten psychotischen Episode behandelt werden, sprechen besser auf die Therapie an als jene, die bereits mehrere Episoden durchlebt haben. Eine Forschergruppe um Dr. Michael Riedel von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität München verglich dabei den Behandlungserfolg und die Symptomatik von 121 Patienten mit einer schizo- phrenen Ersterkrankung mit 279 Betroffenen, die schon länger und chronisch an Schizophrenie litten. Um ein Bild der Symptomatik zu erhalten, wendeten die Wissenschaftler bei Krankenhauseinweisung und -entlassung eine weltweit etablierte, dreidimensionale Symptomskala an, die Positive and Negative Syndrom Scale (PANSS). Zu den positiven Symptomen mit ihrem produktiven Charakter gehören zum Beispiel Wahnvorstellungen, Halluzinationen oder Größen- und Verfolgungswahn. Die negativen Veränderungen entsprechen Defizitsymptomen wie Antriebsmangel, Apathie, sozialer Rückzug oder schlechte emotionale Ansprechbarkeit. Der dritte Bereich der PANSS umfasst eine Skala, die unter anderem Angst, Schuldgefühle, Depression, mangelnde Impulskontrolle oder Selbstbezogenheit beinhaltet. Weniger Medikamente bei Ersterkrankung Mithilfe dieser Skala ermittelten Riedel und sein Team, dass die Ersterkrankten bei der Klinikeinweisung deutlich stärker ausgeprägte Positivsymptome und signifikant niedrigere Negativsymptome aufwiesen als jene, die bereits mehrere Episoden einer schizophrenen Störung durchlitten hatten. Der generelle Schweregrad der Erkrankung lag in beiden Gruppen ungefähr gleich hoch. Die Ersterkrankten waren jünger, zeigten eine kürzere Krankheitsdauer und befanden sich häufiger in einer Partnerschaft und einem Arbeitsverhältnis als die bereits mehrfach Erkrankten. Der Behandlungserfolg war bei den erstmals erkrankten Patienten sowohl im Hinblick auf positive als auch negative Symptome allerdings weitaus besser als bei den Patienten mit mehrfachen Psychose-Episoden. Außerdem benötigten sie weniger Antidepressiva und stimmungsstabilisierende Medikamente. Denn depressive Symptome sind bei Schizophreniepatienten keine Seltenheit. „Diese Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig eine frühe Diagnose und Therapie sind und stellen Früherkennungs- und -interventionsprogramme auf eine breite wissenschaftliche Basis”, betont Psychiater Riedel. Außerdem untermauern sie die ❯❯ 8 NEWSLETTER THEMA Psychische Erkrankungen Betrachtungsweise, dass es sich bei Schizophrenie um eine degenerative Erkrankung des Gehirns handelt. „Der abnehmende Behandlungserfolg bei Patienten mit mehreren Krankheitsepisoden kann mit fortschreitenden neurobiologischen Störungen zusammenhängen”, so Riedel. Gesundheitsforschung: Forschung für den Menschen Im nächsten Schritt soll auf Basis der aktuellen Forschungsergebnisse eine wissenschaftlich abgesicherte (evidenzbasierte) Behandlungsempfehlung entstehen, um die Versorgung erstmals erkrankter Patienten in einer frühen und für den zukünftigen Krankheitsverlauf entscheidenden Phase dauerhaft zu verbessern. Daten und Fakten zur Schizophrenie Schizophrenie kommt in allen Kulturen der Welt mit gleicher Häufigkeit vor. Etwa ein Prozent der Bevölkerung erkrankt mindestens einmal im Leben an einer Schizophrenie. Die Krankheit tritt meistens zwischen dem 18. und 35. Lebensjahr erstmals auf. Bereits Jahre vor der Manifestation der Erkrankung bestehen bei etwa drei Viertel der Betroffenen Veränderungen ihres Erlebens und Verhaltensauffälligkeiten. Dieses sogenannte Prodromalstadium wird oft nicht als solches erkannt und deshalb fälschlich bestimmten Entwicklungsphasen oder Lebenskrisen zugeordnet. Die Schizophrenie verändert das Denken, Fühlen und Handeln der Betroffenen, oft sind auch Mimik, Gestik und die Bewegung davon betroffen. Die Hauptsymptome schizophrener Psychosen sind unter anderem Realitätsverlust mit Wahn, Halluzinationen und Ich-Störungen sowie sozialer Rückzug. Die Art und Schwere dieser psychischen Störung zeigt sich auch daran, dass es oft zu schweren biografischen Einschnitten kommt: Beziehungen werden aufgelöst, die berufliche Ausbildung abgebrochen. Die Krankheitsursachen sind bis heute nur unzureichend aufgeklärt. Nach dem heute als Krankheitsmodell weithin akzeptierten Vulnerabilitäts-Stress-Verarbeitungs-Modell basiert die Erkrankung auf einem ungünstigen Zusammentreffen einer vor allem genetisch oder durch frühkindliche Hirnschädigungen bedingten „Veranlagung” (Vulnerabilität) mit sozialen und psychischen Belastungsfaktoren. Diese können durch die eigenen Stressverarbeitungsfertigkeiten nur unzureichend kontrolliert werden – das heißt, nicht alle Menschen, die eine Veranlagung in sich tragen, entwickeln auch eine Schizophrenie. Quelle: Kompetenznetz Schizophrenie Therapie schizophrener Störungen – auf die richtige Kombination kommt es an Interview mit Professor Dr. Wolfgang Gaebel, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Sprecher des Kompetenznetzes Schizophrenie Herr Professor Gaebel, welche Verfahren stehen heute zur Behandlung schizophren Erkrankter zur Verfügung? Schizophren Erkrankte erhalten heute eine kombinierte Therapie aus Medikamenten und psychosowie soziotherapeutischen Maßnahmen. Basis der medikamentösen Therapie sind die typischen und atypischen Antipsychotika, die insbesondere die sogenannte Positivsymptomatik wie Wahn, Halluzinationen und Ichstörungen wirksam bekämpfen. Mit „typisch“ und „atypisch“ unterscheidet man dabei die älteren von den modernen Antipsychotika. Zu den psychotherapeutischen Maßnahmen zählen etwa Informationen über Krankheits- und Behandlungskonzepte sowie Möglichkeiten der Rückfallerkennung und -prophylaxe. Parallel hierzu wird versucht, soziale Kompetenz und Problemlösefertigkeiten zu stärken sowie Krankheits- und Stressbewältigung zu verbessern. Soziotherapeutische Maßnahmen zielen darauf ab, die Fähigkeit zur selbstständigen Lebensführung zu verbessern oder wiederherzustellen. Bei etwa 70 Prozent der Patienten kommt es mit all diesen Maßnahmen zu einem Abklingen der Symptome und Rückfälle können vermieden werden. ❯❯ 9 NEWSLETTER THEMA Psychische Erkrankungen Die Gewichtung der Behandlungsverfahren unterscheidet sich dabei je nach Krankheitsphase. Wichtig ist es, dem Patienten bereits zu Beginn der Therapie das Gesamtbehandlungskonzept zu erläutern. Bei der medikamentösen Therapie der Schizophrenie spielen sowohl atypische als auch typische Antipsychotika eine Rolle. Wann und bei welchen Patienten setzen Sie typische bzw. atypische Antipsychotika ein? Atypische Antipsychotika werden heute als Therapie der ersten Wahl empfohlen, da sie im Vergleich zu den typischen Antipsychotika ein günstigeres Nebenwirkungsprofil haben. Dabei treten insbesondere weniger Bewegungsstörungen auf; zudem werden die durch atypische Antipsychotika nur schwer veränderbaren, kognitiven Störungen und Negativsymptome, wie auch die depressive Symptomatik, unter Umständen günstig beeinflusst. Insbesondere für erstmals erkrankte Patienten, die für Nebenwirkungen anfälliger sind als mehrmals erkrankte Patienten, sehen die aktuellen Therapierichtlinien daher atypische Antipsychotika als Mittel der Wahl vor. Doch ob atypische Antipsychotika auch dann besser sind als typische Antipsychotika, wenn letztere in so niedrigen Dosierungen eingesetzt werden, dass motorische Nebenwirkungen weniger stark ausgeprägt sind, wurde bisher noch nicht ausreichend untersucht. Deshalb führen wir im Rahmen des Kompetenznetzes Schizophrenie gerade eine Studie zur Akutund Langzeittherapie bei ersterkrankten Patienten durch, bei der wir ein typisches mit einem atypischen Antipsychotikum in niedrigen Dosierungen vergleichen. Kann man einer Schizophrenie vorbeugen? Soweit es die sogenannte Primärprävention angeht – also Maßnahmen in der Allgemeinbevölkerung – leider nicht. Die Faktoren, die zum Ausbruch und der Entstehung einer Schizophrenie führen, sind dafür zu komplex. Es werden aber mögliche Ansatzpunkte für eine zukünftige sogenannte „Indizierte sekundäre Prävention” in Gruppen mit einem höherem Erkrankungsrisiko diskutiert. Zu den Risikofaktoren zählen insbesondere eine durch familiäre Erkrankungsfälle bekannte, genetische Vorbelastung sowie Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen. Auch das Vorliegen neurobiologischer Risikoindikatoren, etwa struktureller Veränderungen im Gehirn oder die gestörte Fähigkeit, sich kontinuierlich bewegende Gegenstände mit den Augen zu verfolgen, gehören dazu. Es ist jedoch noch intensive Forschungsarbeit nötig, um auf der Basis solcher Risiko- Gesundheitsforschung: Forschung für den Menschen faktoren wirklich gefährdete Personen zuverlässig erkennen und in Präventionsprogramme einbeziehen zu können. Am aussichtsreichsten erscheinen derzeit vorbeugende Maßnahmen im Frühstadium der Schizophrenie, wenn also das klinische Bild noch nicht voll entwickelt ist. Denn je früher eine sachgemäße Therapie einsetzt, desto besser sind die Chancen für einen günstigen Krankheitsverlauf. Dieser Forschungsbereich bildet einen der Schwerpunkte des Kompetenznetzes Schizophrenie. Welche Maßnahmen werden bei dieser Art von Sekundärprävention eingesetzt? Sofern die Symptomatik noch nicht sehr ausgeprägt ist, kommen in dieser frühen Phase der Erkrankung psychosoziale Therapiemaßnahmen zum Einsatz. Also Information und Aufklärung zu Risikofaktoren und Frühsymptomen der Schizophrenie sowie zu Bewältigungs- und Behandlungsmöglichkeiten. Außerdem erhalten diese Personen eine psychotherapeutische Kurzzeitbehandlung, mit der Stressbewältigung und Problemlösung trainiert werden. Sollten bereits leichte psychotische Symptome bestehen, kommen auch atypische Antipsychotika in Frage. Kann schon der Hausarzt solche Maßnahmen zur Sekundärprävention einleiten? Nein, es ist ganz wichtig, dass solche frühen Interventionsmaßnahmen nur in darauf spezialisierten Zentren vorgenommen werden, wie wir sie zum Beispiel im Rahmen des Kompetenznetzes aufgebaut haben. Denn eine zu früh gestellte Schizophreniediagnose kann eine Stigmatisierung bewirken und es besteht das Risiko, Menschen zu behandeln, die später gar nicht erkranken würden. Wo werden Patienten mit einer Schizophrenie behandelt? In der akuten Phase einer Schizophrenie und der sich anschließenden Stabilisierungsphase werden die Patienten meist stationär im Krankenhaus behandelt. Wenn der Patient sich stabilisiert hat, können wir ihn in eine teilstationäre Einrichtung, zum Beispiel eine Tagesklinik, überweisen. Oft ist jedoch auch eine Entlassung nach Hause oder in betreute Wohnformen möglich. Die Weiterbehandlung erfolgt in diesen Fällen ambulant durch den Hausarzt oder niedergelassene Psychiater. Sozialpsychiatrische Dienste und die Familie spielen dann bei der weiteren Rehabilitation und sozialen Reintegration eine wichtige Rolle. 10 NEWSLETTER THEMA Psychische Erkrankungen Gesundheitsforschung: Forschung für den Menschen Schizophrenie frühzeitig begegnen „Ich habe immer so einen Wirrwarr im Kopf.“ Was die Gedanken des Patienten so durcheinander bringt, ist nicht etwa Stress, sondern der Anfang einer schizophrenen Störung. Auch mit der Konzentration klappt es nicht mehr so recht, manchmal jagen die Gedanken oder blockieren, und Sätze von Gesprächspartnern kommen einfach nicht an. Schizophrenie beginnt meist schleichend und kündigt sich lange vorher an. Zwischen den ersten, eher unspezifischen Anzeichen und dem akuten Krankheitsbild einer schizophrenen Psychose liegen circa fünf Jahre. Eine schon bei frühesten Symptomen einsetzende Therapie kann den Verlauf der Erkrankung jedoch aufhalten und sogar die ersten Beschwerden mildern, ergab eine Untersuchung des Projektverbunds „Früherkennung und Frühintervention” des Kompetenznetzes Schizophrenie. nahen Stadium. In der psychosefernen Phase, also zu Beginn des Krankheitsverlaufs, treten bei den Betroffenen sehr diffuse erste Krankheitszeichen auf, zum Beispiel optische und akustische Wahrnehmungsstörungen oder die Tendenz, alles auf sich zu beziehen. Das psychoseferne Prodrom schließt auch Personen mit einem durch genetische Vorbelastungen oder Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen erhöhtem Psychoserisiko ein, die parallel an deutlichen sozialen Funktions- und Leistungseinbußen leiden. Derartige Einbußen betreffen vor allem den Beruf, die Partnerschaft oder die Haushaltsführung. Beim psychosenahen Prodrom zeigen sich schon deutlichere Symptome. Die Betroffenen leiden beispielsweise unter Wahnideen oder Halluzinationen, haben eigentümliche Vorstellungen oder ungewöhnliche Wahrnehmungen. Erste Anzeichen richtig deuten Frühe Intervention schwächt Erkrankung ab Das Team um Professor Joachim Klosterkötter vom Früherkennungs- und Therapiezentrum für psychische Krisen (FETZ) der Universität Köln unterteilte das Vorstadium der Erkrankung, Prodromalphase genannt (siehe Kasten auf Seite 9), erstmals in zwei Abschnitte: das psychoseferne und das psychosenahe Prodrom. Diese Bezeichnungen beziehen sich auf die Dauer bis zum Auftreten einer ersten akuten psychotischen Episode. Auf dieser Basis entwickelten sie unterschiedliche Interventionsstrategien – mit kognitiver Verhaltenstherapie beim psychosefernen und einem niedrig dosierten atypischen Antipsychotikum im psychose- „Mit der Definition eines zusätzlichen, psychosefernen Prodroms verfolgen wir das Ziel, Betroffene frühzeitig zu identifizieren, um massiven Symptomen und sozialen Behinderungen so früh wie möglich vorzubeugen”, erläutert Klosterkötters Kollege Dr. Andreas Bechdolf das Kölner Interventionsmodell. Es hat sich inzwischen auch an den Psychiatrischen Universitätskliniken Bonn, Düsseldorf und München etabliert. Dass dieser Ansatz Erfolg verspricht, zeigen die ersten Auswertungen der Interventionsstudien aus dem Kompetenznetz Schizophrenie, die mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) durchgeführt wurden. Patienten mit einem psychosefernen Prodrom, die ein Jahr lang an einer speziell entwickelten, kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) teilnahmen, waren danach psychisch stabiler und entwickelten seltener ein psychosenahes Erkrankungsstadium als jene, die eine unspezifische klinische Standardbehandlung erhielten. Die psychologische Intervention orientierte sich an den jeweils genannten Problemen und beinhaltete unter anderem Einzel- und Gruppentherapie, Training von sozialer Kompetenz und Fertigkeiten zur Problemlösung, Symptom- und Stressmanagement sowie eine Beratung der Familien und Bezugspersonen. Auch Patienten An Schizophrenie Erkrankte leiden manchmal an zwanghaftem Verhalten wie im psychosenahen Krankheits- ❯❯ einem übertriebenen Ordnungssinn. 11 NEWSLETTER THEMA Psychische Erkrankungen stadium, die neben einer begleitenden, psychologischen Unterstützung ein niedrig dosiertes, atypisches Antipsychotikum erhielten, ging es nach dieser zwölfwöchigen Frühintervention deutlich besser. Die Krankheitssymptome nahmen ab, das generelle Funktionsniveau stieg signifikant. „Die psychologische Frühintervention schon im psychosefernen Erkrankungsstadium eröffnet einen ganz neuen Ansatz in der Schizophreniebehandlung. Unsere bisherigen Ergebnisse deuten an, dass sich damit Ersterkrankungen abschwächen und vielleicht sogar verhüten lassen”, unterstreicht Psychiater Bechdolf die Bedeutung der Forschungsergebnisse. Nähere Informationen auch unter: www.kompetenznetz-schizophrenie.de Gesundheitsforschung: Forschung für den Menschen Stimmt es, dass ... Schizophrene eine gespaltene Persönlichkeit haben? ? „Nein, das ist ein weitverbreiteter Irrglaube. Er hängt mit der irreführenden, freien Übersetzung des aus dem Griechischen stammenden Begriffs Schizophrenie als „Bewusstseinsspaltung” zusammen. Die Annahme, dass an Schizophrenie erkrankte Patienten an einer Persönlichkeitsspaltung leiden oder viele verschiedene Persönlichkeiten in sich tragen, wie in der Geschichte „Dr. Jekyll and Mr. Hyde”, ist falsch. Der Begriff Schizophrenie bezeichnet das Charakteristikum dieser psychischen Störung: Denken, Affekt und Erleben passen nicht mehr zusammen und die Beziehung zwischen dem Selbst und der realen Welt geht verloren.” ! Privatdozent Wolfgang Wölwer, Kompetenznetz Schizophrenie Hausbesuche vom Psychiater helfen Heimkindern Für viele ist es die letzte Chance: Über 22.000 Kinder und Jugendliche kamen im Jahr 2004 in ein Heim. Die Gründe für die Aufnahme in solche stationären Jugendhilfeeinrichtungen reichen von Verwahrlosung und Misshandlungen bis hin zu sexuellem Missbrauch und Kontakten in die Straßenstrich- und Drogenszene. Bei derartigen Vorgeschichten wundert es nicht, dass weit mehr als die Hälfte der in Heimen Heranwachsenden psychische Störungen hat, die Klinikaufenthalte erfordern. Dass ein rechtzeitiges psychiatrisches Eingreifen direkt in den Heimen die Situation der Kinder wesentlich verbessern kann, zeigen erste Auswertungen einer an verschiedenen Studienzentren durchgeführten Untersuchung unter der Leitung von Dr. Lutz Goldbeck von der Universität Ulm. Sie wird im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und den Spitzenverbänden der gesetzlichen Krankenkassen gemeinsam finanzierten Schwerpunkts Versorgungsforschung gefördert. Goldbeck und sein Team entwickelten innerhalb eines Netzwerks aus Institutsambulanzen und sozialpsychiatrischen Praxen ein mehrgleisiges (multimodales) Behandlungsprogramm, das sich direkt vor Ort an die Heimkinder wendet. „Derzeit lässt die psychiatrische Versorgung dieser Hochrisikogruppe für psychische Erkrankungen sehr zu wünschen übrig, hier herrscht ein regelrechtes Versorgungsdefizit”, schildert Goldbeck von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm die aktuelle Situation. Die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie scheitert bisher oft schon an praktischen Problemen wie langen Anfahrtswegen zu jugendpsychiatrischen Praxen und Ambulanzen, begrenzten Zeitbudgets der begleitenden Betreuer und langen Wartezeiten auf Behandlungsplätze. „Derartige Versorgungsdefizite führen bei diesen Kindern und Jugendlichen vermehrt zu stationären Aufenthalten in psychiatrischen Einrichtungen, was die Heimbetreuung immer wieder unterbricht und negative psychosoziale Entwicklungen begünstigt”, erläutert Goldbeck den Teufelskreis, in dem die jungen Heimbewohner stecken. Krisen vor Ort begegnen und lösen Goldbeck und sein Team setzten sich daher zur Aufgabe, eine Therapiestrategie zu entwickeln, die die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und -psychiatrie verbessert, eine rechtzeitige Diagnose und leitliniengerechte Behandlung psychischer Erkrankungen sowie stabilere Entwicklungsverläufe ermöglicht. Ihr mehrgleisiges Behandlungsprogramm besteht aus einer kinder- und jugendpsychiatrischen Sprechstunde in den Heimen zur Diagnostik und psychotherapeutischen sowie medikamentösen Therapie, aus Mitarbei- ❯❯ 12 NEWSLETTER THEMA Psychische Erkrankungen Gesundheitsforschung: Forschung für den Menschen terschulungen der Heimpädagogen, sozialem Kompetenztraining für die Kinder sowie Kriseninterventionsplänen. Diese Interventionspläne sind zweistufig, sie sehen im ersten Schritt ein ambulantes Krisenmanagement durch die Erzieher und einen „reisenden” Psychiater für kritische psychische Situationen vor. Bleibt dies erfolglos, zielen kurzzeitige stationäre Maßnahmen darauf, die Kinder und Jugendlichen so schnell wie möglich wieder in ihr gewohntes Umfeld zu integrieren. Denn, so Goldbeck und seine Kollegen: Nur wenn die Heimbetreuung kontinuierlich In den meisten Heimen herrscht heute eine familiäre Atmosphäre, die Kinder abläuft, kommt es nicht werden in kleinen Gruppen betreut. zu belastenden Beziehungswechseln. Und das wiederum stabilisiert die Psyche und die soziale Kompetenz der Betroffenen. Das Umfeld erhalten „Die psychiatrische Vor-Ort-Betreuung der Kinder in ihrer alltäglichen Umgebung ist wesentlicher Bestandteil unseres Konzepts, bei dem die Kooperation mit ihren gewohnten Bezugspersonen eine entscheidende Rolle spielt. Auch Intensität und Kontinuität der Behandlung orientieren sich optimal am Versorgungsbedarf dieser Hochrisikogruppe”, begründet der Ulmer Psychologe seinen Ansatz. „Die Jugendlichen profitieren von der verbesserten Versorgung, da die Psychiater in den einmal wöchentlich oder 14-tägig stattfindenden Sprechstunden frühzeitig Diagnosen stellen und Behandlungen einleiten können.” Der Erfolg gibt Goldbeck recht: Die Wissenschaftler berichten – noch vor der ersten Datenauswertung im Spätherbst – von gut besuchten Sprechstunden, Erfolg versprechenden Mitarbeiterschulungen in den Heimen und verbesserter Zusammenarbeit zwischen Heimen und Psychiatrie. Auch die Vereinbarungen zur Krisenintervention zeigen bereits Wirkung: Die jungen Studienteilnehmer aus Heimen mit dem psychiatrischen Behandlungsprogramm benötigen deutlich seltener einen Klinikaufenthalt als Heimbewohner aus der Kontrollgruppe. Warum kommen Heimkinder häufiger in die Psychiatrie? Kinder und Jugendliche in Heimen verfügen über ein stark erhöhtes Risiko, psychisch zu erkranken. Die Ursache liegt in einer Anhäufung verschiedener Risikofaktoren, von denen bei diesen Kindern oft mehrere zusammentreffen. Dazu gehören: ❯❯ psychische Erkrankungen der Eltern (Psychosen, Sucherkrankungen, Stimmungserkrankungen, Persönlichkeitsstörungen), ❯❯ vorgeburtliche Schädigungen (zum Beispiel durch Rauchen, Alkohol und Drogenkonsum während der Schwangerschaft), Schädigungen während der Geburt, Frühgeburt, ❯❯ erzieherisches Versagen, ❯❯ Vernachlässigungen, ❯❯ familiäre Disharmonie, ❯❯ Misshandlungen, ❯❯ sexueller Missbrauch. Diplom-Psychologin Tanja Besier, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie, Ulm 13 NEWSLETTER THEMA Psychische Erkrankungen Gesundheitsforschung: Forschung für den Menschen Erfolgreiche Raucherentwöhnung ist auch eine Frage der Psyche „Es ist ganz leicht, sich das Rauchen abzugewöhnen, ich habe es schon hundert Mal geschafft.” So wie Mark Twain geht es vielen Rauchern, die einfach nicht vom Glimmstängel loskommen. Vor allem jenen mit psychischen Auffälligkeiten fällt es besonders schwer, ergab ein Forschungsprojekt an der Universität Tübingen unter der Leitung von Professor Anil Batra. „Die Teilnahme an leitliniengerecht durchgeführten Entwöhnungsprogrammen hält langfristig nur 20 bis 30 Prozent der Ausstiegswilligen vom erneuten Griff zur Zigarette ab”, weiß der Suchtexperte. Bei manchen Personengruppen wie Frauen, jüngeren Menschen oder Rauchern mit psychiatrischen Problemen liegt die Abstinenzquote noch niedriger. Diese bereits bekannten, unterschiedlichen Erfolgsaussichten nahm Batra zum Anlass, weitere Risikoprofile zu ermitteln, die mit einer erhöhten Rückfallgefahr einhergehen. In einer vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Untersuchung konzentrierten sich der Suchtexperte und sein Team dabei besonders auf die Psyche und das Rauchverhalten entwöhnungswilliger Raucher. „Psychologische Raucherprofile ermöglichen eine individualisierte Therapie. Sie erhöht die Chancen, dauerhaft Nichtraucher zu werden und zu bleiben”, erklärt der Tübinger Psychiater. Nikotinverzicht: besonders schwer für Depressive und „novelty seeker” Die Wissenschaftler identifizierten durch ihre Untersuchung mit über 200 Rauchern anhand psychologischer Messinstrumente wie Fragebögen vier verschiedene Typen: • unauffällige Raucher (normale Durchschnittsraucher), • depressive bzw. selbstunsichere Raucher, • körperlich stark abhängige Raucher und • Raucher mit gesteigerter Aktivität. Hinter der letzten Gruppe verbergen sich die sogenannten „novelty seeker” – Menschen mit extrovertierten Charakterzügen, die ständig auf der Suche nach neuen Eindrücken sind. Blutuntersuchungen und bildgebende Verfahren gaben zusätzlich Hinweise, ob möglicherweise eine Veranlagung für eine körperliche Nikotinabhängigkeit vorlag. Alle Probanden nahmen sechs Wochen lang einmal wöchentlich an verhaltenstherapeutischen Gruppensitzungen teil und erhielten persönlich zugeschnittene Empfehlungen zur Verwendung von Nikotinersatzmitteln wie Kaugummis oder Pflastern. Die Wahl und Dosierung dieser medikamentösen Ausstiegshelfer orientierte sich am Konsumverhalten und an der täglichen Zigarettenmenge. Wer über 30 Zigaretten täglich rauchte, erhielt eine Empfehlung zu einer Kombination aus Pflaster und Kaugummi; bis 20 Zigaretten täglich gab es nur Pflaster, alternativ Kaugummi bei einem unregelmäßigen Konsumverhalten. Diese Therapie führte in den verschiedenen Gruppen zu sehr unterschiedlichen Abstinenzraten. Bei den unauffälligen Rauchern waren nach einem Jahr 60 Prozent nikotinfrei. Von den stark abhängigen Rauchern schafften dies nur 35 Prozent, die depressiven und die überaktiven Raucher lagen bei 33 und 25 Prozent. Körperlich stark abhängige Raucher kommen demnach mit dem Nikotinverzicht im Vergleich zu den anderen beiden Risikogruppen besser zurecht – die meisten Rückfälle traten in allen Gruppen während der ersten drei Mo❯❯ nate auf. 14 NEWSLETTER THEMA Psychische Erkrankungen Gesundheitsforschung: Forschung für den Menschen Maßgeschneiderte Wege aus der Tabaksucht Auf dieser Basis entwickelt und untersucht Suchtexperte Batra nun spezifische Therapieprogramme für diese drei Abhängigkeitsgruppen, um den Problemfällen künftig den Ausstieg aus der Sucht zu erleichtern. Dabei steht bei den körperlich stark abhängigen Rauchern eine hoch dosierte Nikotinersatzbehandlung im Vordergrund, die Depressiven erhalten eine starke psychotherapeutische Unterstützung, die unter anderem die Bewältigung ihrer sozialen Ängste zum Ziel hat. Auch bei den „novelty seekern” hat die psychotherapeutische Hilfestellung einen hohen Stellenwert, damit die Betroffenen ihre Unruhe besser bewältigen lernen, die ja häufig den Griff zur Zigarette auslöst. Raucher: Wer ist abhängig? Etwa 27 Prozent der Bevölkerung ab dem 15. Lebensjahr rauchen – doch nicht alle sind abhängig. Zum Anteil der abhängigen Raucher existieren verschiedene Schätzungen. Plausible Untersuchungen gehen von einem Anteil von circa 60 Prozent aus. Merkmale der Abhängigkeit sind: ❯❯ Auftreten von Entzugssymptomen, ❯❯ starkes Rauchverlangen, ❯❯ fehlende Fähigkeit, abstinent zu leben, ❯❯ hoher Zigarettenkonsum (pro Tag mehr als 20 Stück), ❯❯ der Griff zur Zigarette kurz nach dem Aufstehen. Als Entzugssymptome bemerken Raucher neben dem starken Rauchverlangen Unruhe und Schlafstörungen, vermehrte Irritierbarkeit, Konzentrationsstörungen, Ärger, Aggressivität, Angst, einen gesteigerten Appetit und manchmal auch depressive Verstimmungen. Der Fagerström-Test (siehe rechts) erleichtert die Selbsteinschätzung der Abhängigkeit. Gelingt ein Abstinenzversuch nicht aus eigener Kraft, sollten sich abhängige Raucher in professionelle Behandlung begeben. Professor Anil Batra, Suchtexperte an der Universität Tübingen Test: Bin ich nikotinabhängig? (Fagerström-Test) 1. Wann rauchen Sie Ihre erste Zigarette nach dem Aufstehen? ■ innerhalb von 5 Minuten ■ innerhalb von 6 bis 30 Minuten ■ innerhalb von 31 bis 60 Minuten ■ es dauert länger als 60 Minuten 3 2 1 0 2. Finden Sie es schwierig, an Orten, wo das Rauchen verboten ist (in der Kirche, in der Bibliothek, im Kino usw.), darauf zu verzichten? ■ ja ■ nein 1 0 3. Auf welche Zigarette würden Sie nicht verzichten wollen? ■ die erste nach dem Aufstehen ■ eine andere 1 0 4. Wie viele Zigaretten rauchen Sie pro Tag? ■ mehr als 30 ■ 21 – 30 ■ 11 – 20 ■ 10 oder weniger 3 2 1 0 5. Rauchen Sie in den ersten Stunden nach dem Erwachen im Allgemeinen mehr als am Rest des Tages? ■ ja ■ nein 1 0 6. Kommt es vor, dass Sie rauchen, wenn Sie krank sind und tagsüber im Bett bleiben müssen? ■ ja ■ nein 1 0 Auswertung Raucher, die mindestens 3 Punkte erzielen, gelten als leicht abhängig, 5 Punkte sprechen für eine mittlere Abhängigkeit, 6–7 Punkte für eine starke Abhängigkeit und mehr als 7 Punkte für eine sehr starke Abhängigkeit. 15 NEWSLETTER THEMA Psychische Erkrankungen Gesundheitsforschung: Forschung für den Menschen ❯❯ Bilder und Grafiken können bei der Redaktion MasterMedia als Datei bestellt werden. Kontakt zu den Ansprechpartnern für die vorgestellten Projekte vermittelt ebenfalls die Redaktion. Impressum Herausgeber Redaktion Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Referat Öffentlichkeitsarbeit 11055 Berlin www.bmbf.de www.gesundheitsforschung-bmbf.de Projektträger im DLR Gesundheitsforschung Dr. Brigitte Hirner Dr. Rolf Geserick Dr. Hella Lichtenberg Heinrich-Konen-Straße 1 53227 Bonn Tel.: 0228 3821-205 Fax: 0228 3821-257 E-Mail: [email protected] Gestaltung MasterMedia, Hamburg Druck Dürmeyer – Digitale Medien und Druck, Hamburg Bildnachweis Titel: DAK/Wigger Seite 5: Deutsches Bündnis gegen Depression e. V. alle anderen Bilder: BMBF MasterMedia Jutta Heinze Schulterblatt 120 20357 Hamburg Tel.: 040 507113-55 Fax: 040 591845 E-Mail: [email protected] 16