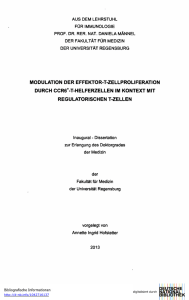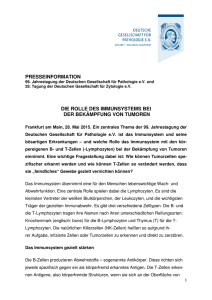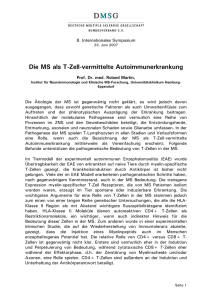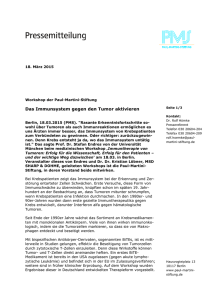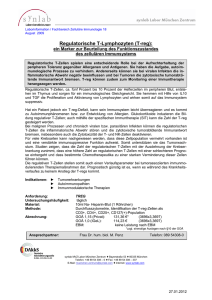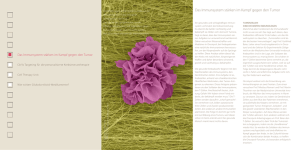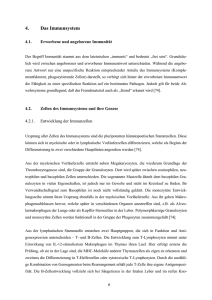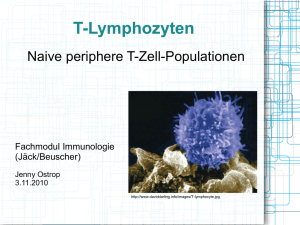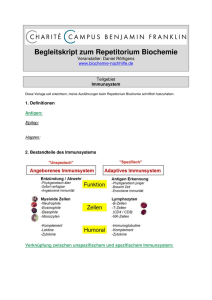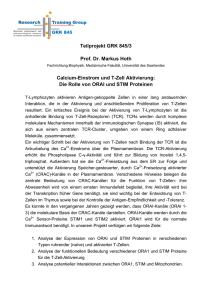Das Immunsystem gegen Krebs rüsten
Werbung

Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/das-immunsystem-gegenkrebs-ruesten/ Das Immunsystem gegen Krebs rüsten Lange Zeit schlummerte sie im Abseits – die Theorie, dass Immunzellen Tumoren angreifen können. Heute erfährt sie eine Renaissance. In Zukunft könnte es sogar möglich werden, TLymphozyten so zu verändern, dass sie bestimmte Tumortypen besser erkennen und bekämpfen können. Prof. Dr. Hanspeter Pircher und sein Team von der Universitätsklinik Freiburg versuchen, Verfahren zur passiven zellulären Immunisierung zu entwickeln: Welche Wege gibt es, einem Immunsystem von außen Waffen gegen Krebs in die Hand zu geben. Erst kürzlich kam die experimentelle Unterstützung: Genetisch veränderte Mäuse, denen zum Beispiel die T-Zellen des Immunsystems fehlen, bilden mehr Tumoren aus als unbehandelte Artgenossen. Damit ist die in den 60er-Jahren aufgestellte Theorie zur sogenannten Immunüberwachung wieder en vogue. In ihrer weiter entwickelten Form postuliert sie: Entartete Zellen aktivieren Zellen des Immunsystems. Diese halten den entstehenden Tumor in Schach. Doch die Tumorzellen mutieren bald und verändern ihre Oberflächenstruktur. Die körpereigenen Wächter erkennen sie nicht mehr und der Krebs kann ungestört wachsen. „Wir glauben, dass diese Theorie stimmt“, sagt Prof. Dr. Hanspeter Pircher vom Institut für Mikrobiologie und Hygiene der Universitätsklinik Freiburg. „Wir versuchen daher herauszufinden, wie man die immunologische Tumorabwehr stärken kann.“ Aktiv oder passiv immunisieren? Eine der Möglichkeiten ist die aktive Immunisierung. Es handelt sich dabei um ein Verfahren, das bei den Schutzimpfungen gegenüber zum Beispiel Grippeviren oder Wundstarrkrampf schon lange eingesetzt wird. Dabei applizieren Mediziner sogenannte Antigene in das Muskelgewebe der Patienten. Antigene sind Bestandteile der infektiösen Erreger und stellen gewissermaßen einen Identitätsausweis dar, den das Immunsystem erkennen kann. In den Lymphknoten aktivieren sie das Immunsystem und dieses produziert spezifische Antikörper, die den Erregern das Leben schwer machen. „Das Problem bei der aktiven Impfung ist, dass viele Impfstoffe nur die Produktion von Antikörpern in ausreichendem Maße auslösen können“, sagt Pircher. „Bei Krankheiten wie Aids, Malaria, Tuberkulose oder eben Krebs müssen aber auch T-Lymphozyten aktiviert werden, und diese sind mit den herkömmlichen Immunisierungsmethoden nur schwer zu induzieren.“ Weil das nur mit Hilfe von anspruchsvollen Tricks funktioniert, konzentrieren sich Pircher und sein Team auf das Verfahren der passiven zellulären Immunisierung durch direkte Gabe von Immunzellen. Hier sind im Falle von Tumoren grundsätzlich zwei Möglichkeiten denkbar. Entweder isolieren Wissenschaftler T-Lymphozyten direkt aus Tumorgewebe des betroffenen Patienten. Diese sind dann bereits auf den jeweiligen Tumortyp eingestellt und haben spezifische Rezeptoren ausgebildet, die die Tumorantigene erkennen. Die Forscher müssen sie dann in Gewebekultur anreichern, bevor sie sie den Patienten in einer erhöhten Konzentration wieder verabreichen können. Meistens liefern die heutigen Methoden noch keine ausreichende Menge an Zellen, die nach dem adaptiven Transfer in den Patienten genügend lange überleben. Daher untersuchen Pircher und seine Doktorandin Katja Müller, unter welchen Rahmenbedingungen die Zellen sich besonders gut anreichern lassen. Sie fanden zum Beispiel heraus, dass es auf die Anwesenheit eines bestimmten Proteins ankommt: des T-Zellfaktors Interleukin 15 (IL-15). Nicht so gemästet Mauslungen mit Tumorkolonien: ohne T-Zell-Transfer (oben), mit Transfer von IL-2-aktivierten T-Zellen (mitte) und mit Transfer von IL-15-aktivierten T-Zellen © Prof. Dr. Hanspeter Pircher Im Vergleich zu Zellen, die mit einem ähnlichen Molekül, dem Interleukin 2 (IL-2), gefüttert wurden, werden die mit IL-15 gefütterten T-Lymphozyten zwar relativ klein und auch nicht besonders aggressiv. Aber wenn die Wissenschaftler sie in lebende Mäuse spritzen, die einen Modelltumor tragen, dann entfalten sie eine wesentlich größere Effizienz: Die Mäuse entwickeln weniger Lungenmetastasen als ihre Artgenossen, deren T-Lymphozyten mit IL-2 hochgezogen worden sind. „Der Grund dafür ist vermutlich, dass IL-15 gefütterte T-Zellen nicht so gemästet sind“, sagt Pircher. „Sie sind im lebenden Organismus daher nicht so abhängig von Nahrung wie die mit IL-2 gefütterten T-Zellen und sterben nicht so leicht ab.“ Die andere Möglichkeit, passiv zu immunisieren, ist, die im Körper herumschwimmenden T-Lymphozyten, die noch keinen Kontakt zum Tumor hatten, von außen auf diesen zu „prägen“. Die Grundidee: Man gibt den naiven T-Zellen eine Sonde in die Hand, mit der sie Tumorzellen eines bestimmten Typs erkennen können. Denn gelingt ihnen das, dann leiten sie auch Kampfmaßnahmen ein. „Hierfür eignet sich das Verfahren des sogenannten retroviralen Gentransfers“, erklärt Pircher. Pirchers Kooperationspartner Prof. Dr. Wolfgang Uckert aus Berlin ist in der Lage, in das Genom von Retroviren die Gene für spezielle Antigenrezeptoren von T-Zellen einzubauen. Diese Rezeptoren sind ganz spezifisch und in Pirchers Modellsystem reagieren sie ausschließlich auf das kurze Proteinstück Gp33, das als Antigen auf der Oberfläche der Tumorzellen sitzt. Pircher und sein Team können die Retroviren dann in die Lymphozyten ihrer krebskranken Mäuse einführen. Retroviren sind dafür bekannt, dass sie ihr Genom in die DNA ihrer Wirtszellen einbauen können. Damit schleusen sie aber auch das Gen für den Antigen-Rezeptor ein, und die T-Zellen können ihn plötzlich selbst produzieren. Eine entsprechend mit Antigenrezeptoren beladene T-Zelle (oben) erkennt das Tumorantigen auf der Oberfläche einer Krebszelle (unten) nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip © Prof. Dr. Hanspeter Pircher „Dieses Verfahren ist jedoch noch nicht genügend ausgereift“, sagt Pircher. „Momentan ist die Dichte dieser transduzierten Rezeptoren auf der Oberfläche der T-Zellen nicht hoch genug.“ Die auf diese Weise erzeugten T-Zellen mit der Spezifität gegen den Modelltumor sind noch nicht in der Lage, einen Tumorschutz zu liefern. Das Problem besteht darin, dass die Tumorzellen nur wenige Antigene auf ihrer Oberfläche haben und die T-Zellen daher eigentlich sensibler sein müssten. Immerhin schützen sie aber schon vor Viren, die eine höhere Dichte an OberflächenAntigenen aufweisen. Für einen wirksamen Tumorschutz müssten die Wissenschaftler T-Zellen mit einer höheren Dichte von Antigen-Rezeptoren züchten. „In Zukunft möchten wir unsere beiden Verfahren kombinieren“, sagt Pircher. Das bedeutet: T-Zellen mit Retroviren behandeln und ihnen die entsprechenden Rezeptoren aufdrücken. Sie dann in der Kulturschale unter Optimalbedingungen und mit genügend IL-15-Nahrung züchten. Und schließlich diejenigen selektieren, die die höchste Rezeptordichte aufweisen. Den Tumor aushungern Gelingt den Forschern das, dann sind sie einen Schritt weiter gekommen auf dem Weg zu einer Immuntherapie gegen Krebs. Denn T-Lymphozyten sind in der Lage, Tumoren von innen zu zerstören, wie andere Experimente von Pircher und Co zeigen. Wie geht das. Möglich wäre, dass Lymphozyten bei Kontakt direkt die Membranen von Tumorzellen zerstören und sie damit töten. Oder sie locken andere Zellen des Immunsystems an, wie die gefräßigen Makrophagen oder die Natürlichen Killerzellen. Pircher und seine Mitarbeiter glauben jedoch, dass der Mechanismus ein indirekter ist. „Vermutlich schütten T-Zellen nach Tumorkontakt Botenstoffe wie Interferon Gamma aus“, sagt Pircher. „Und das führt dann dazu, dass die Blutgefäße im Tumor nicht mehr wachsen.“ Ohne ausreichende Blutzufuhr verhungert der Tumor, ihm wird im wahrsten Sinne des Wortes der Saft abgedreht. Alle diese Mechanismen spielen wahrscheinlich auch beim Menschen eine Rolle. Pircher und seine Mitarbeiter hoffen, dass ihre Erkenntnisse von klinischen Forschern aufgegriffen werden. „Vielleicht wird man eines Tages einen Kühlschrank haben, in dem für jeden Tumortyp die entsprechenden Retroviren mit den entsprechenden Antigen-Rezeptorgenen liegen“, sagt Pircher. Das ist momentan noch Zukunftsmusik. Außerdem kann die Immuntherapie Pirchers Ansicht nach niemals alleine wirksam sein. Bei soliden Tumoren liegt die Zukunft der Tumorbekämpfung in einer Kombination mit chirurgischen Verfahren und der Chemo- oder Strahlentherapie. Fachbeitrag 15.12.2009 mn BioRegion Freiburg © BIOPRO Baden-Württemberg GmbH Weitere Informationen Prof. Dr. Hanspeter Pircher Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene Abteilung für Immunologie Universität Freiburg Hermann-Herder-Str. 11 D-79104 Freiburg Tel.: +49 (0)761/203-6521 Fax: +49 (0)761/203-6577 E-Mail: hanspeter.pircher(at)uniklinik-freiburg.de Uniklinik Freiburg Der Fachbeitrag ist Teil folgender Dossiers Krebstherapie und Krebsdiagnostik