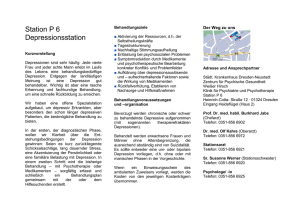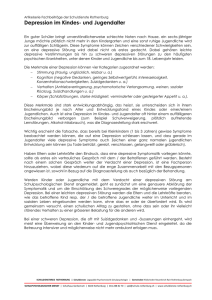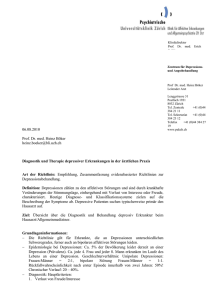Volltext herunterladen
Werbung

Diplomarbeit Neurobiologische Effekte sprechender Medizin eingereicht von Marie Isabell Linnemayr 0433579 zur Erlangung des akademischen Grades Doktorin der gesamten Heilkunde (Dr. med. univ.) an der Medizinischen Universität Graz ausgeführt an der Universitätsklinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie unter der Anleitung von Univ.- Prof. Dr. Walter Pieringer Ort, Datum ………………………….. (Unterschrift) Eidesstattliche Erklärung Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe, andere als die angegebenen Quellen nicht verwendet habe und die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Graz, am …… Unterschrift Hinweis bezüglich Gendering Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text auf einer Unterscheidung der weiblichen und männlichen Schreibweise verzichtet. Sofern nicht ausdrücklich auf Frauen oder Männer Bezug genommen wird, sind beide Geschlechter gleichermaßen angesprochen. i Vorwort "Der Arzt ist weder Techniker noch Heiland, sonder Existenz für Existenz, vergängliches Menschenwesen mit dem Anderen, im Anderen und sich selbst die Würde und die Freiheit zum Sein bringend und als Maßstab anerkennend." Karl Jaspers 1883 –1969 ii Danksagung Ich möchte mich bei Professor Dr. Pieringer bedanken, der mir die Möglichkeit gegeben hat in einem meiner größten Interessensgebiete eine Diplomarbeit zu schreiben. Er stand mir mit fachkundigem und darüber hinausgehendem Wissen zu jeder Zeit zur Seite und half mir einen roten Faden durch dieses sehr große Themengebiet zu legen. Auch gab er mir den Freiraum, meine eigenen Ideen und Vorstellungen zu verwirklichen und umzusetzen. Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen mich auch bei meiner Familie, meiner Mama und meiner Schwester zu bedanken, die mich durch mein ganzes Studium hindurch unterstützten und wertvolle Impulse zu Studium und Leben lieferten und liefern. Bedanken möchte ich mich auch bei meinem Freund Lukas, der sich einige Passagen meiner Diplomarbeit mehr als nur einmal anhören musste und mir trotzdem immer wertvolle Tipps und Gedanken lieferte. Danke! iii Zusammenfassung Aktuelle neurobiologische Studien belegen, dass sowohl Psychotherapie als auch Psychopharmakotherapie als Merkmale therapeutischer Prozesse strukturelle Veränderungen im Gehirn hervorrufen, die durch neuronale Bildgebung „sichtbar“ gemacht werden können. Von wissenschaftlichem Interesse sind nun die Fragen in wie weit diese neurobiologischen Befunde die Vielfalt der depressiven Erkrankungsformen spiegeln und in welchem Ausmaß diese Daten als fundierte Grundlage für Therapieerfolge gesehen werden können. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Frage, ob Menschen, die an unterschiedlichen Ausdrucksformen der Depression, d.h. an unterschiedlichen Formen schmerzlicher Bedrückung und Unterdrückung mit persönlichem Einbruch leiden, mit den gleichen neurobiologischen Mustern reagieren oder ob doch unterschiedliche neuronale Strukturen durch sprechende Medizin bzw. pharmakologische Medizin Aktivierung finden. Ergebnisse Depressive Menschen zeigen eine reiche Facette an Symptomen, die neurobiologisch nicht gut und gesichert zuordenbar sind. Der Überblick der aktuellen Literatur spricht also zunächst noch für eine Verneinung Hirnareale einer depressiven Symptomatik zuzuordnen, auch wenn die Verminderung, der für soziale Interaktion und Neuorientierung zuständigen Hippokampusregion als besonders relevant gesehen wird. Mittels neurobiologischer Bildgebung können jedoch spezifische Veränderungen vor und nach einer therapeutischen Behandlung aufgezeigt werden. Kritische Vorhersagen über ein Ansprechen von Therapien oder Therapieerfolge können aber nicht gemacht werden. In der Zusammenschau der Forschungsergebnisse von Psychotherapie und Neurobiologie wird sichtbar, dass die Depression eine Erkrankung mit einer Vielfalt an typischen neurobiologischen und psychologischen Ausdrucksformen ist. Die Summe der aktuellen Studien belegt die fast klassische These: Eine Therapie muss kombiniert und Disziplinen übergreifend, individuell auf den Patienten ausgerichtet angeboten werden um Menschen die an einer Depression leiden helfen zu können. Genetik, Entwicklung und Umwelt beeinflussen die Neurogenese, wie die Monoaminausschüttung und steuern die Reizweiterleitung. Diese Thesen einer biopsychosozialen Medizin gilt es demnach besonders in der Therapie der Depression zu berücksichtigen. iv Abstract The latest neurobiology studies indicate that both, psychotherapy and pharmacotherapy are able to induce structural changes in the human brain, which are visible by neuroimaging. Scientists are now trying to determine whether these neuronal changes are specific to depression. The huge range of depressive symptoms and the variability of symptoms individual patients manifest when suffering from affective disorder complicate making this determination. Another question of great interest to neurological scientists is how neuronal activity is affected by psychotherapy and pharmacotherapy. Are the same structures in the brain visible through neuroimaging? And which parts of the brain are specific activated by each form of therapy? Results Neuroimaging clearly demonstrate that both psychotherapy and pharmacotherapy affect brain chemistry. However how these changes relate specifically to the treatment to depression had yet to be determined. The effects of either or both treatments on all patients may be clearly seen. But these changes vary in each individual period. Given the wide range of symptoms manifested by person with an affected disorder neuroimaging can be a tool that will allow researchers to monitor the effects of treatment. Depression in its many forms is a complex illness which is affected by genetics such as neurogenesis an monoamine release and the environment, in which the person was raised and lives. A multidisciplinary approach is needed to understand and help people with depression. v Inhaltsverzeichnis Danksagung.......................................................................................................................... iii Zusammenfassung.................................................................................................................iv Abstract................................................................................................................................. v Inhaltsverzeichnis................................................................................................................. vi Glossar und Abkürzungen................................................................................................... vii Abbildungsverzeichnis....................................................................................................... viii Tabellenverzeichnis.............................................................................................................. ix 1 Einleitung...................................................................................................................... 1 1.1 Depression-Definition............................................................................................ 2 1.1.1 Ätiopathogenese............................................................................................ 4 1.1.2 Klassifikation..................................................................................................9 1.2 Fragestellung......................................................................................................... 11 2 Material und Methoden............................................................................................. 12 3 Ergebnisse -Resultate................................................................................................ 13 3.1 Neuronale Strukturen........................................................................................... 13 3.2 Kognitive Defizite................................................................................................ 16 3.3 Stress im Kontext von Angst und Depression...................................................... 18 3.4 Neurobiologische Veränderungen bei medikamentöser Therapie und bei Psychotherapie......................................................................................................................21 3.4.1 Neuronale Veränderungen unter medikamentöser Therapie........................25 3.4.2 Stellenwert der Psychotherapie....................................................................27 4 Diskussion..................................................................................................................32 5 Literaturverzeichnis................................................................................................... 39 vi Glossar und Abkürzungen bzw. beziehungsweise d.h. das heisst z.B. zum Beispiel WHO world health organisation ICD 10 international statistical classification of diseases and related health problems, 10 th revision DSM V Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth Edition etc. et cetera PET Positron Emission Tomography fMRT funktionelle Magnetresonanztomographie SPECT Single Photon Emission Computed Tomography SSRI selektive serotonin reuptake inhibitor s.o. siehe oben BF Blutfluss 5HT Rezeptor 5 Hydroxytryptamin Rezeptor (Serotoninrezeptor) VLPFC ventro lateraler präfrontaler Cortex AC anteriorer Gyrus cingulus Cd Nucleus caudatus TAU treatment as usual HHNA Hypothalamische-Hypophysäre Nebennierenachse vii Abbildungsverzeichnis Abbildung 1 Darstellung der Erwerbsunfähigkeit 2006 1 Abbildung 2 Visualisierung der Temperamente [20] 9 Abbildung 3 Lernen unter Stress [57] 20 Abbildung 4 Stellt die, bei der Depressionsforschung wichtigsten Zentren da [60] 23 Abbildung 5 Therapieerfolg bei schwerer Depression 29 viii Tabellenverzeichnis Tabelle 1 Anthropologisches Schemata: Gegenüberstellung der Grunddimensionen, persönlichen Verantwortungsbereiche und der Matrix der Charaktere und ihr Zusammenspiel [20] Tabelle 2 Zusammenschau 7 9 Tabelle 3 ICD 10 Kodierung bei unipolarer affektiver Störung.[21] 10 Tabelle 4 DSM V Kodierung bei unipolarer affektiver Störung.[22] 10 Tabelle 5 Antidepressiva und ihre neurobiologisch messbaren Veränderungen 26 ix 1 Einleitung Ein Viertel der österreichischen Bevölkerung leidet an einer psychischen Erkrankung bzw. an einer Störung der psychischen Gesundheit, und davon leiden ca. 400.000 Menschen an einer Depression [1]. Hauptmerkmale der Depression sind Freudlosigkeit, Interesselosigkeit, Mutlosigkeit, Traurigkeit, Angstzuständen, Schuldgefühlen, innere Unruhe, Schlafstörung, Gefühllosigkeit bis hin zu inhaltlichen Denkstörungen [2]. Phänomenologisch betrachtet sind diese Symptome menschlicher Bedrückung und Unterdrückung letztlich auch Ausdruck unterschiedlicher schmerzlicher Abschiedsprozesse. Die WHO geht weltweit von 121 Millionen Betroffenen aus, von denen aber nur 25% eine adäquate Therapie erhalten [3]. Psychische Krankheiten sind der zweithäufigste Grund für eine Erwerbsunfähigkeit [4]. Eine adäquate Therapie kann nicht nur dem Einzelnen helfen, sondern auch erheblich die Kosten minimieren - und Sozial-, Wirtschaft-, Bildungs-und Justizsystem entlasten[5]. Erwerbsunfähigkeit 26% 32% 12% 30% Abbildung 1 Darstellung der Erwerbsunfähigkeit 2006: 32%-Skelett, Muskeln und Bindegewebserkrankungen, 30%-Psychiatrische Erkrankungen, 26%-sonstige Erkrankungen, 12%-Herz-Kreislauferkrankungen. 1 Warum aber ist die Zahle der Unbehandelten oder unzureichend Behandelten so groß? Was ist eine Depression - und was macht es so schwierig eine passende Therapie zu finden? Mittels der neurobiologischen Forschung und besonders durch die funktionelle Bildgebung haben wir faszinierende Einblicke bekommen, wie Information aufgenommen und verarbeitet wird. Besonders faszinierend ist hierbei die Erkenntnis, dass nicht nur pharmakologische Therapie neuronale Strukturen verändern kann, sondern auch Psychotherapie; allein das Gespräch eine neuronale Modulierung hervorruft. Im ersten Teil möchte ich einen groben Überblick liefern, was unter Depression heute von uns verstanden wird, welche auslösenden Ursachen eine Depression haben kann und welche Klassifikationen für die Depression angewandt werden. Als die zwei großen Therapieoptionen stehen die pharmakologische Medizin und die psychotherapeutische Medizin im Fokus. Zentrale Fragen: Da aktuelle, neurobiologische Untersuchungen mit Hilfe von Neuroimaging belegt haben, dass beide Therapieformen strukturelle Veränderungen im Gehirn hervorrufen, stellen sich die wissenschaftlich interessanten Fragen: Was spiegeln diese Befunde wieder? Kann die Vielfalt depressiver Erkrankungsformen mittels funktioneller Bildgebung erkannt und benannt werden? Welche neuronalen Strukturen werden angeregt oder unterdrückt? Ziel meiner Arbeit soll es sein diese Fragen anhand der aktuellen Studienlage zu beantworten und die Resultate zu hinterfragen. 1.1 Depression – Definition Der Begriff Depression ist gleichbedeutend mit dem Begriff der unipolaren affektiven Störung. Affekt kommt vom lateinischen affectus [6] und bedeutet Gemütsverfassung. Unipolar heißt, dass sich die Stimmung, das Sein des Patienten in eine einengende, sich zurückziehende, negative Richtung verändert. 2 Auf psychischer Ebene werden vor allem „-losigkeits“ Symptome beschrieben, Symptome der Leere: Freudlosigkeit, Lustlosigkeit, Interessenslosigkeit, Sinnlosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Weiters werden Grübelneigung, Ängste, Gereiztheit und Schuldgefühle beschrieben. Auf psychomotorischer Ebene kann ein Gefühl der inneren Unruhe bestehen. Zusätzlich werden des Öfteren eine Hemmung von Antrieb, Energie und Kraft beobachtet. Auf somatischer Ebene kann eine Reihe von vegetativen Störungen auftreten: Im Vordergrund stehen Schlafstörungen. Physiologisch besteht eine Veränderung des Schlaf-Wachrhythmus [2]. Die ersten REM Phasen sind vorverlagert und verlängert, die erholsamen Tiefschlafphasen sind verkürzt. Hinzu kommt eine Störung des Biorhythmus – Morgenpessimismus, Tagesschwankungen, unruhiger Schlaf und frühes Erwachen. Obstipation, Diarrhöe, Verspannungen, Nachlassen von Libido und Potenz, Zyklusstörungen sind einige weiter vegetative Störungen bei einer Depression [2]. Jedoch sind die Symptome jedes Patienten unterschiedlich in Form und Ausprägung. Weiters sieht man auch einen Unterschied in der Ausprägung der Erkrankung zwischen Frauen und Männern. Laut einer aktuellen Studie wird bei Frauen doppelt so häufig eine Depression diagnostiziert wie bei Männern [5]. Dies liegt aber nicht daran, dass die Depression eine Frauenerkrankung ist. Hausmann, Rutz und Meise bieten eine Erklärung für diesen Unterscheid - Die männliche Depression (male depression)! [5]. Erkrankte Männer gehen weniger oft zum Arzt, und nehmen, der traditionellen Rolle wegen, weniger Hilfe an. Des Weiteren glaubt man, dass sie ihre Hilfsbedürftigkeit oft nicht erkennen. Bei der männlichen Depression stehen Symptome wie gesteigerte Aggressivität, Suchtverhalten (Alkohol, Spielsucht, Flucht in die Arbeit etc.), Feindseligkeit und antisoziales Verhalten im Vordergrund. Eine Studie in Skandinavien zeigte, dass durch gezielte Aufklärung von Ärzten über die männliche Depression, mehr Männer mit Depression diagnostiziert und behandelt werden konnten [7]. 3 Um detailliertere Überlegungen zu diesem speziellen Thema anzustellen, wäre eine eigene Arbeit gerechtfertigt. Ich möchte die männliche Depression aber trotzdem erwähnt haben um deutlicher zu machen, dass man auch das Geschlecht des Patienten nicht unberücksichtigt lassen darf. Wie man hier schon sehen kann, ist die Depression eine Erkrankung mit einer Fülle an möglichen Symptomen, die insgesamt einen schmerzlichen Wandel persönlicher Wertvorstellungen andeuten und den nötig gewordenen Abschied von bislang geliebten Werten (Menschen, Gütern, Positionen) sichtbar werden lässt. Die Unfähigkeit zu Trauern, d.h. die mangelnde Fähigkeit immer wieder neu Abschied zu nehmen, liebend loslassend zu leben, gilt bekanntlich sogar als Merkmal der westlichen Kultur [22, 41]. Gleich bleibt allen das Bild einer Störung der Affekte in Richtung einer „negativen“, noch schmerzlich leeren Gemütslage. Neuorientierung aus dieser negativen Gemütslage zu eröffnen erweist sich als gemeinsames Ziel jeder Therapie. Nicht zufällig scheint dann der Kult um „Achtsamkeit“, um „achtsame Leere“ als nötig gewordene Gegenströmung in unserer Kultur aufzutauchen. 1.1.1 Ätiopathogenese Was ist die Ursache einer Depression, bzw. was löst das Krankheitsbild „Depression“ aus? Eine Frage, auf die es nicht nur eine Antwort gibt. Hat doch letztlich jeder Mensch seine eigene persönliche Depression, seine eigene persönliche „Unterdrücktheit“, seine eigene nötig gewordene Abschiednahme von nicht mehr nötigen Lasten, Pflichten und Autoritäten zu verantworten. Die Ätiopathogenes der Depression unterliegt so keinem einfachen Ursache-Wirkung Prinzip sondern einem multifaktoriellen Prozess. Sie ist beeinflusst von Persönlichkeit und Lebensgeschichte, verwoben mit dem Erbgut und dem sozialen Umfeld. 1.1.1.1 Genetischer Einfluss Es gibt einige Studien über den Zusammenhang von erblicher Vulnerabilität und leichtere Empfänglichkeit für Depressionen. 4 Verwandte ersten Grades zeigen ein 1,5 bis 3 fach erhöhtes Risiko an einer Depression zu erkranken wie eine familiär unbelastete Person. Das bedeutet ein Risiko von 10-30% für ein Kind mit einem depressiven Elternteil selbst an einer Depression zu erkranken [8]. Bei monozygoten Zwillingen konnte eine 40-50% Wahrscheinlichkeit gezeigt werde, mit der beide an einer Depression erkranken [9]. Und auch in Adoptionsstudien konnte eine gewisse erbliche Vorbelastung nachgewiesen werden [10, 11]. Weiters liegen auch Studien über einzelne Gene und deren Mutationen vor. Caspi et al konnte beeindruckend zeigen, dass der Längenpolymorphismus des Serotonintransporters entscheidend für die Vulnerabilität des Individuum ist. Hetero- und Homozygoten des SAlles (short allel) zeigen bei belastenden Lebenssituationen eine stärkere Depressions- und Suizidalitätsneigung [12, 13]. Ein klares Ursache-Wirkungsprinzip konnte bis jetzt noch nicht gefunden werden. Aktuelle Theorien gehen davon aus, dass es genetische Faktoren gibt, die die Vulnerabilität erhöhen in einer belastenden Situation zu dekompensieren und an einer Depression zu erkranken - Eine Gen-Umwelt Interaktion besteht [14]. Die zurzeit wieder hoch aktuelle wissenschaftliche Diskussion um das Phänomen der Epigenetik kommt sogar zur Aussage, dass Umweltbedingungen die genetische Disposition prägen [15]. 1.1.1.2 Gestörte Neurotransmittersysteme Schon 1965 wurde die Idee verfolgt, dass ein Mangel an einem Transmitterstoff die grundlegende Ursache einer Depression sein könnte [16]. Über die Katecholaminmangelhypothese kam man zur Monoaminmangelhypothese. Monoamine wie Serotonin, Noradrenalin oder Dopamin [17] können Affekte positiv beeinflussen bei einer längeren Verweildauer im synaptischen Spalt oder einer geringeren / verlangsamten Wiederaufnahme aus dem synaptischen Spalt. Auf Grund dieser Hypothese entstand eine Vielzahl an Antidepressiva. Obwohl nach Einnahme der Medikamente eine sofortige Neurotransmittererhöhung messbar ist, zeigt die Affektmodulation eine Latenzzeit von mindestens zwei Wochen. Auch zeigen Medikamente wie Tianeptin, ein Medikament das die SerotoninWiederaufnahme steigert einen antidepressiven Effekt. 5 Diese Erkenntnisse zeigen uns, dass der Monoaminmangel nicht die Ursache einer Depression ist. Tierversuche konnten zeigen, dass sich die Rezeptorsensitivität bei längerer Antidepressiva Gabe verringert. Und somit nicht das Monoamin selbst sondern sein Rezeptor die entscheidende Rolle trägt. Neueste Forschungen erkannten Subtypen von Serotoninrezeptoren und ihren Agonisten und Antagonisten. Auf die Frage ob diese ausschlaggebende Faktoren bei der Entwicklung einer Depression sind stürzt sich zurzeit die aktuelle Forschung [14, 18, 19]. Weitere Studien zeigen, dass Veränderungen im Bereich der Transmitter und Rezeptoren eine Veränderung der Reizweiterleitung bewirken. Dies führt zu einer Veränderung der Hirnaktivität, die mit Hilfe der funktionellen Bildgebung aufgezeichnet werden kann. Auf die Veränderungen der limbisch-kortikalen Aktivität und deren Interpretationen werde ich genauer in den Bereichen Ergebnisse und Diskussion eingehen. 1.1.1.3 Neuroendokrinologische Störungen Großes Augenmerk wird auf die Bedeutung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren Achse gelegt. Bei ca. 80% der depressiven Patienten findet man einen pathologischen Dexamethason-CRH Test. Und in 50% der Fälle kann eine exogene Dexamethason Gabe die endogene Cortisolsekretion nicht hemmen [2]. Bewiesen ist, dass eine Stressreaktion eine Cortisolausschüttung provoziert. Diese könnte die endokrinen Regelkreise dysregulieren und auch plastische Prozesse im Gehirn modulieren [14,20]. Eine endokrine Störung ist also eher als Aufrechthalter und als Folge, nicht aber als auslösende Ursache einer Depression zu sehen. Eine detailliertere Beschreibung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren Achse und ihrer Wirkung ist im Kapitel 3.3 Stress im Kontext der Depression angeführt. 1.1.1.4 Psychosoziale Belastungsfaktoren Eine Belastung löst immer eine Stressreaktion in uns aus. Je nachdem wie gut wir mit Stress oder mit Stress in einer spezifischen Situation umgehen können ist unsere 6 Reizantwort adäquat und mit unserem sozialen Umfeld vereinbar oder es folgt eine Chronifizierung bis hin zur Dekompensation [20]. Belastungen wie Verlust eines geliebten Menschen, Scheidung, Arbeitslosigkeit, schwere körperliche Erkrankung, Entwurzelung können mitauslösende Ursachen einer Depression sein. 1.1.1.5 Persönlichkeit Die Psychologie sieht die Vulnerabilität einer Person in der Persönlichkeitsentwicklung verankert. Ein zu viel oder zu wenig an Bedürfniserfüllung in speziell der oralen Phase führe zu einem fragilen Selbstwert [14]. H. Tellenbach zeigt zwei Primärpersönlichkeiten auf, die für ihn Depressive zeigen - Der Typus Melancholikers und der Typus Asthenikus (Phlegmatikus) [2]. Das Konzept einer anthropologischen Krankheitsordnung [21] erkennt in der menschlichen Erkrankung immer auch ein umgreifendes Schema (siehe später), bzw. eine Dimension, die den ganzen Menschen samt seiner Umwelt betrifft. Als die vier primären Grunddimensionen des Lebens und der Krankheit werden in Europa seit der Antike Existenz, Struktur, Konstitution und Funktion gesehen [21]. Grunddimension des Grunddimensionen Verantwortungsbereich Charaktermatrix Leibes Existenz Struktur des Lebens zeitlos menschlich aktuell persönlich persönlicher Sinn persönlicher Wert schizoider Charakter depressiver Konstitution historisch, kausal Arbeit / Leistung Charakter zwanghafter persönliche Rolle, Charakter hysterischer Funktion zukunftsweisend, final Spiel Charakter Tabelle 1 Anthropologisches Schemata: Gegenüberstellung der Grunddimensionen, persönlichen Verantwortungsbereiche und der Matrix der Charaktere und ihr Zusammenspiel [21]. 7 Die Major Depression spiegelt ihr leitendes Schema (Sheppard, Teasdale), bzw. ihre Grunddimension in der Struktur des menschlichen Lebens wieder. Der innere Aufbau der Person steht hier im Zentrum der Krise, bzw. des persönlichen Wandels. Man kann es auch als Störung des inhaltlichen Lebensrhythmus bezeichnen. Depressive Menschen befinden sich in einer Ein- und Umbruchsituation ihres Lebens. Ja, die Depression zeigt ihnen die aktuelle Krise in ihrem sozialen Entwicklungsprozess schmerzlich auf. Aus der Sicht der dialektischen Erkenntnismethode wird die Erkrankung an einer Depression sehr deutlich als eine notwendig gewordenen Auseinandersetzung im Hier und Jetzt erkennbar: Der Betroffene kämpft um die Bewahrung seiner persönlichen Identität, bzw. um Neubildung persönlicher Werte [21, 22]. Die Tiefenpsychologie sieht in einem depressiven Grundkonflikt, die leidvolle, aber Werte bildende Auseinandersetzung mit den persönlichen Grenzen und dem sozialen Gegenüber. Laut ihr verkörpert die oral-aggressive Phase jene prägende Zeit in der ein Kind das Ich von Du unterscheiden lernt und mit ihr die Abgrenzung von der Mutter erfährt, aber damit auch erste persönliche Verantwortlichkeit zu entwickeln beginnt. Ausdruck für einen Konflikt in dieser Entwicklung findet sich in den Selbstschutzmechanismen Abspaltung, Projektion, Verleugnung und Autoaggression wieder [21]. Wesentliche Aufgabe der Psychotherapie und des Betroffenen ist es demnach sich mit der Umwelt wieder kritisch und beherzt auseinanderzusetzen, um einen Strukturwandel der gesamten Person zu fördern und zu ermöglichen. In Tabelle 2 soll einer Schemavorstellung folgend angedeutet werden, wie die orale Phase mit der dialektischen Erkenntnismethode und der Melancholie als Grundcharakter in Zusammenhang steht. Neurobiologische Studien belegen nun eindrucksvoll die Parallelität von emotionaler Entwicklung und spezifischer neuronaler Markreifung. Spezifische neuronale Strukturen mit ihren Neurotransmittern stehen in spezifischer Beziehung zu menschlichen Grundstimmungen (Temperamenten) und menschlichen Denkstilen (Erkenntnismethoden) [23]. Der Transmitter Serotonin spielt eine maßgebende Rolle in der melancholischen Affektmodulation. Und steht, wie hier abgebildet, in enger Verbindung mit der oralen Phase. 8 Transmitter Acetylcholin Serotonin Dopamin Norepinephrin Entwicklungstheorie oral-passiv oral-aggressiv anal-aggressiv früh-genital Erkenntnismethode Phänomenologisch Dialektisch Empirisch-analytisch hermeneutisch Temperament Phlegmatiker Melancholiker Choleriker Sanguiniker Tabelle 2 Zusammenschau Phlegmatiker Melancholiker Choleriker Sanguiniker Abbildung 2 Visualisierung der Temperamente [21]. 1.1.2 Klassifikation Aus naturwissenschaftlicher Sicht lassen sich Krankheiten recht gut nach Organbefunden allgemein beschreiben und in Gruppen enteilen. Diese Klassifikation ist somit für den Arzt ein Hilfsmittel, da er sich schnell orientieren kann um den Patienten die für ihn beste Hilfestellung zu gewährleisten. Der Patient selbst hat einen Begriff in den Händen, mit dem er sich leichter orientieren kann. Aus humanwissenschaftlicher Sicht, die den ganzen Menschen zu erfassen anstrebt ist dies differenzierter. So ist auch die Depression aus humanwissenschaftlicher Sicht vielschichtig und bunt in ihrer Erscheinungsform. Vor allem die auslösende Ursache lässt sich selten in fixe Cluster einteilen, da Erkrankung immer ein individuelles Zusammenspiel, ein biopsychosozialer Prozess ist. Eine Klassifikation ist in diesem Fall keine unmittelbare Hilfestellung. Man kann nur den Schweregrad erkennen, ansonsten bietet eine Einteilung der Depression noch keinen wirklichen Vorteil für den Patienten. Oft im Gegenteil, erweist sich die fachliche Benennung der Erkrankung für den Patienten selbst zunächst eher als eine Stigmatisierung, denn als eine Erleichterung. Ich habe hier den ICD 10 und DSM 5 aufgelistet um einen groben Überblick über die zwei heute am Häufigsten verwendeten Klassifikationen zu geben. 9 F30-F39 Mood [affective] disorders F32 Depressive episode F32.0 Mild depressive episode F32.1 Moderate depressive episode 00 Without somatic syndrome 01 With somatic syndrome 10 Without somatic syndrome 11 With somatic syndrome F32.2 Severe depressive episode without psychotic symptoms F32.3 Severe depressive episode with psychotic symptoms F32.8 Other depressive episodes F32.9 Depressive episode, unspecified F33 Recurrent depressive disorder F34 Persistent mood [affective] disorders Tabelle 3 ICD 10 Kodierung bei unipolarer affektiver Störung.[24] Depressive Disorder 296.2 major depressive disorder, single episode mild/moderate/severe/with or without psychotic features 296.3 major depressive symptoms, recurrent mild/moderate/severe/with or without psychotic features 300.4 dysthymic disorder 311 depressive disorder, no other specified Tabelle 4 DSM V Kodierung bei unipolarer affektiver Störung.[25] Auch von der Wissenschaft wird eine Überarbeitung der Klassifikationen gewünscht. In der Forschung besteht die Schwierigkeit, dass nach anderen Gesichtspunkten eingeteilt wird. Gerade in unserem heutigen Zeitalter wo Genetik und Neurotransmitter im Bereich der Depression im Zentrum stehen, stockt diese Einteilung den Prozess. Maser und Patterson meinen dazu „ researchers require a nosology that helps them to discover replicable facts and mechanisms regarding the description, etiology, and treatment of mental disorders . . . Clinicians want a nosology that accurately and simply defines a diagnosis“[26]. 10 1.2 Fragestellung Nach diesem kurzen Einblick zur Phänomenologie der Depression, ihrer vielseitigen Ätiopathogenese und Erscheinungsformen im Alltag, möchte ich mich nun den Fragen der Behandlung der Depression zuwenden. Mit dem Hintergrundwissen, dass sowohl Psychopharmaka als auch Psychotherapie die Fähigkeit besitzen Affekte zu modulieren und auf neuronalem Weg Veränderungen im Gehirn bewirken, möchte ich mit Hilfe einer kritischen Literaturrecherche folgende Fragestellungen untersuchen und diskutieren: 1. Wie weit spiegelt die aktuelle wissenschaftliche Literatur die Vielfalt depressiver Erkrankungsformen wieder und beachtet deren heterogene Ätiopathogenese. 2. Wie weit können neurobiologische Veränderungen mit Therapieerfolg/-misserfolg gleichgesetzt, bzw. als vergleichbar erkannt werden. 3. Wie weit werden durch klinische und neurobiologische Studien Befunde geliefert wonach Psychotherapie und Pharmakotherapie die gleichen neuronalen Strukturen anregen/ hemmen. 11 2 Material und Methoden Um diese Thematik zu hinterfragen und zu erörtern habe ich den Weg einer Literaturrecherche gewählt. Ziel war es mit dieser den aktuellen Stand der Forschung bezüglich „neurobiologischer Bildgebung in der Psychotherapie“ darzulegen und Vor- und Nachteile bzw. Sinnhaftigkeit der Ergebnisse zu diskutieren. Um eine wissenschaftlich anerkannte, Evidenz basierte Arbeit verfassen zu können hab ich als Hauptbezugsquelle die pubmed Datenbank gewählt mit Schwerpunkt auf den letzten zwanzig Jahren. Mit Hilfe des Zugangs über die Medizinische Universität Graz konnte ich auf die, von mir gesuchten Artikel und Ausgaben zugreifen. Des Weiteren verwendete ich die Online - Datensuche im Internet. Als Suchwörter bei der Online-Recherche wurden verwendet: „neurobiology, psychotherapy“, „psychotherapy, neurobiology imaging“, „psychotherapy and depression“, „depression, imaging“, „neurobiology imaging and depression“ Zusätzlich habe ich einschlägige Fachliteratur der Psychiatrie, Psychologie und Physiologie verwendet, um ein breit gefächertes Wissen um und über dieses Thema zu erwerben. 12 3 Ergebnisse – Resultate 3.1 Neuronale Strukturen In den letzten Jahren mehrten sich sprunghaft wissenschaftliche Studien zur Neurobiologie der Depression und zur Neuroplastizität des menschlichen Gehirns. Mittels PET und fMRT wurde versucht neuronale Veränderungen während einer depressiven Episode darzustellen. Es konnte aber kein spezifisches Areal gefunden werden, das sich spezifisch bei einer Depression verändert. Man konnte aber einige Strukturen mit vermehrten oder verminderten Aktivitätslevel herausfiltern. Abnorme neuronale Aktivität konnte im Gyrus cinguli anterior, im Cortex präfrontalis und im Lobus temporalis festgestellt werden [27, 28, 29]. Verminderte Aktivität konnte in den dorsal gelegenen Hirnstrukturen, z.B. im dorsolateralen präfrontalen Cortex, gemessen werden. Vermehrte Aktivität findet man meist in den ventralen Gehirnstrukturen: von großer Bedeutung sind hier der Gyrus cinguli ventralis und der ventrolaterale präfrontale Cortex. Von besonderem wissenschaftlichem Interesse sind Veränderungen im Hippokampus. Der Hippokampus zeigt bei depressiven Patienten eine Volumenminderung von 8% auf der linken und von 10% auf der rechten Seite [30]. Es konnte kein linearer Zusammenhang zwischen der Krankheitsdauer und der Volumenabnahme des Hippokampus gefunden werden [31]. Bewiesen ist, dass Patienten, die zum ersten Mal an einer Depression erkranken einen völlig normalen Hippokampus in der funktionellen Bildgebung zeigen. Patienten die mehrere depressive Episoden erlebt haben und nicht adäquat behandelt wurden, haben einen Hippokampus der in Funktion und Morphologie verändert ist. Lars B. Hviid [32] sieht eine Dysfunktion und eine Volumenreduktion des Hippokampus als eine Momentaufnahme der Depression, nicht aber als permanente Veränderung. Warum nimmt das hippokampale Volumen ab? Der brain derived neurotropic factor (BDNF) ist wichtig für die Neurogenese im Cortex und im Hippokampus [31]. Bei depressiven Patienten hat man eine Abnahme des BDNF in 13 der hippokampalen Region festgestellt. Eine Abnahme kann durch eine Veränderung des Adenosin 3’,5’- Monophosphat bewirkt werden. Dieses reguliert die Expression der Zielgene des BDNF. Eine verminderte Expression des BDNF führt zur verminderten Neurogenese und somit zu einer Wachstumshemmung des Hippokampus [33]. Chronischer Stress kann zu solch einer verminderten Expression und somit zu einer Atrophie des Hippokampus führen [33]. Ein vermindertes Volumen bedeutet eine verminderte Neurogenese und einen Verlust an Gliazellen. Die dendritischen Zellen ordnen sich um und versuchen sich an die aufgelockerten Strukturen anzupassen. Somit kommt es nicht nur zur Volumenminderung sondern auch zu einer erhöhten Verletzlichkeit gegenüber erneuten depressiven Episoden [31]. In bereits verkleinerten Hippokampi findet man interzellulär vermehrte Cholinansammlungen. Beim Abbau von neuronalen Membranen durch die Phosphotidylcholinhydrolase [34] wird als Nebenprodukt Cholin frei. Dieses wird nicht weiter abgebaut, sondern in den umgebenden Zellen gespeichert [34]. Vermehrt interzelluläres Cholin ist somit ein Zeichen für neuronalen Zelluntergang. Da man bei Patienten mit mehreren depressiven Episoden vermehrtes interzelluläres Cholin vorfindet, kann man einen vorhergegangen Zelluntergang nicht nur mittels Volumenabnahme sondern auch biochemisch belegen. Uma Rao et al [35] zeigt mit seiner Studie, dass ein klein angelegter Hippokampus ebenfalls ein Risiko darstellt an einer Depression zu erkranken. Er geht davon aus, dass die Verletzlichkeit des Hippokampus nicht durch die Depression ausgelöst wird, sondern dass bereits in sehr jungen Jahren (Entwicklungstheorie) die Empfindlichkeit durch eine Umwelt-Gen Interaktion definiert wird. Nach ihm könnte somit ein kleiner Hippokampus Auslöser einer Depression sein. Auf genetischer Ebene fand man auch ein Zusammenspiel von verminderter grauer und weißer Substanz und dem Serotonintransporter. Serotonin ist einer der großen biologischen Transmitter des Gehirns. Bei Serotonintransportern fand man einen Polymorphismus in der Promoterregion. Kurze (s) und lange (l) Allele konnten beschreiben werden. Bei Personen, homozygot für L-Allele konnte gezeigt werden, dass depressive Homozygote eine 14 deutliche Reduktion der grauen und weißen Substanz im Hippokampus zeigen, gesunde Homozygote keine Verminderung aufweisen [36]. Ausgegangen wird von einer Interaktion des serotonergen Systems und neurotropen Faktoren mit der neuronalen Transmission. In wie weit dies eine Bedeutung bei der Entstehung oder Behandlung einer Depression hat ist noch nicht bekannt. Auch im Thalamus können strukturelle Veränderungen beschrieben werden. Allerdings nicht wie im Hippokampus eine Verminderung, sondern eine Vermehrung bestimmter Neuronen [37]. In verstorbenen depressiven Patienten konnte im medio dorsalen Nukleus eine 37% -ige und im anteromedialen Nukleus eine 26% -ige Steigerung der Neuronenzahl gemessen werden. Eine Veränderung in Wahrnehmung und Ausdruck von Emotionen spiegelt sich in einer anormalen limbischen Schleife wieder. Es konnte deutlich gezeigt werden, dass die Verarbeitung von Emotionen bei Depressiven verändert ist. Depressive nehmen negative Impulse schneller war als positive und antworten auch auf negative stärker als auf positive – traurige Gesichter werden mehr beachtet als fröhliche. Beim Sehen von Traurigkeit wird sofort Traurigkeit empfunden, Fröhlichkeit wird jedoch fast wie ein neutraler Reiz unbeantwortet gelassen [38]. Diese Wahrnehmung kann mittels SSRI beeinträchtigt werden, so dass Patienten Positives wieder als Positives wahrnehmen können. Die unterschiedlichen Veränderungen des Hirnmetabolismus zeigen die enorme Vielfalt depressiver Erkrankungen. Brody et al [29] konnte zeigen, dass 1. eine vermehrte metabolische Aktivität im Gyrus cinguli anterior dorsalis zu einer psychomotorischen Retardierung, 2. eine vermehrte metabolische Aktivität im dorsolateralen präfrontalen Cortex zu einer Beeinträchtigung der Merkfähigkeit, 3. ein verminderter Metabolismus des Lobus frontalis ventralis zu innerer Anspannung, Angst, Müdigkeit und ebenfalls psychomotorische Retardierung, 4. ein verminderter Metabolismus im Gyrus cinguli anterior ventralis und des vorderen Teil der Insula zu Angst und innere Unruhe auffallend häufig führen kann. 15 Die verschiedenen Symptome können demnach bis zu einem gewissen Grad bestimmten Hirnregionen zugeschrieben werden. Symptome spezifisch zu behandeln ist aber schon deswegen unmöglich da nicht einzelne Transmitter, Rezeptoren, Transporte oder Neuronen sondern immer ganze Netzwerke betroffen sind. Transmitter wie Dopamin, Serotonin und Noradrenalin können die limbische, thalamische und kortikale Aktivität modulieren [39] und somit Netzwerk übergreifend agieren. 3.2 Kognitive Defizite Bei den meisten an Depression erkrankten Menschen besteht eine Einschränkung der Merk- und Konzentrationsfähigkeit. Im Besonderen sind die Reizaufnahme, Verarbeitung und Interpretation betroffen. Für die Verarbeitung eines Reizes stehen uns grob zwei Systeme zur Auswahl – der automatische Prozess und der kontrollierte Prozess [40]. Ein automatischer Prozess benötigt wenig Aufmerksamkeit. Meist läuft er unbewusst ab und ist dadurch nicht wirklich steuerbar. Zu den automatischen Prozessen zählen auch Kreisgedanken, die sehr viele Depressive plagen. Um einen automatischen Prozess zu ändern, muss der Betroffene es schaffen, sich der Gedankenschleife bewusst zu werden und somit einen automatischen Prozess in einen kontrollierten Prozess zu verwandeln. Glaubt man der Theorie des Entwicklungspsychologen Piaget, dass jeder Mensch sich sein eigenes mentales Model der Welt und wie er sie wahrnehmen möchte in einem Schema zurecht legt, hat Sheppard und Teasdale eine interessante Studie verfasst [41]. Die Fragestellung lautete: erhöht depressives Gedankengut den Zugang zu negativen Schemata oder verändert depressives Denken das bereits angelegte Schema? Sheppard und Teasdale kamen zu dem Schluss, dass negative Gedanken Veränderungen der Wahrnehmung bewirken und somit auch die Schemata, die wir verwenden um unsere Umwelt zu interpretieren ins Negative kehren. Um diesen automatischen Prozess zu durchbrechen braucht man Konzentration und Aufmerksamkeit. Beides sind Fähigkeiten die dem, an Depression Erkrankten fehlen. 16 Betrachtet man im fMRT den regionalen Blutfluss der Amygdala [42, 43], dem „Angstzentrum“ des Gehirns, kann man den neurobiologischen Hintergrund für Sheppard und Teasdales Theorie sehen. Eine emotionale Erfahrung führt zu einem vermehrten Blutfluss in der Amygdala. Dieses, entwicklungsbiologisch gesehen niedrige Zentrum leitet aber seine erhaltene Information an den Neocortex weiter. Die neokortikale Region bewertet die Emotion und hat die Fähigkeit, diese Urantwort auf die gemachte Erfahrung zu regulieren. -Man sieht einen Abfall des Blutflusses in der Amygdala und einen Anstieg der regionalen Durchblutung des präfrontalen Cortex [42].- Somit kann der Betroffene die Reizantwort aktiv steuern, die Sichtweise einer gemachten Erfahrung durch Interpretation und Einteilung modellieren und verändern. Diesen Ansatzpunkt könnte man auch als Basis der Psychotherapie sehen. Logisches Denken, Gedächtnis und Aufmerksamkeit werden von Depressiven auf einem Grundschullevel beherrscht [44]. Bei einer Levelsteigerung oder bei komplexeren Aufgaben fällt es dem Betreffenden schwer abstrakt zu denken oder seine Gedanken überhaupt zu fokussieren [44, 45]. Der Tower of London Test wurde entwickelt um die Exekutivfunktion des Menschen erfassen zu können. Selbstkorrektur, emotionale Regelung, Impulskontrolle, Planen, Handeln, Prioritätensetzen sind Funktionen die mit Hilfe dieses Planungstest dargestellt werden sollen [46]. Erstellung eines Plans und zielorientiertes Handeln ist bei Depressiven hier deutlich eingeschränkt. Kontrolliert man während eines solchen Tests den regionalen Blutfluss, zeigt sich ein deutlicher Unterschied der depressiven im Vergleich zu den nicht depressiven Probanden [46]. Bei Depressiven war eine Steigerung der Durchblutung des Cingulum und Striatum nicht messbar. In der präfrontalen und posterioren kortikalen Region war der Anstieg der Durchblutung im Vergleich zu nicht Depressiven nur minimal. Und bei einer Steigerung der Schwierigkeit der Aufgaben konnte man sehen, dass der Gyrus cinguli anterior, der Nukleus caudatus und die rechte präfrontale Region nicht aktiviert werden [46]. Eine präfrontale Dysfunktion drückt sich vor allem durch eine verminderte Wortflüssigkeit aus [47]. Verminderte Aktivität des dorsolateralen frontalen Cortex schlagen sich in einer gedrückten kognitiven Funktion und Affekt nieder, die ihrerseits zu einer Verminderung in Motivation und Antrieb führen [48, 49]. 17 Vergleicht man nur Depressive im Alter von 20 bis 30 sieht man, dass hier die Erfüllung der Testaufgaben keine starke altersabhängige Komponente hat. Auch junge Erkrankte zeigen eine kognitive Beeinträchtigung [50]. Eine verminderte Reaktionsantwort, eine eingeschränkte Fähigkeit sich auf gestellte Aufgaben zu fokussieren und Schwierigkeiten beim set-shifting [45, 51] waren am ausgeprägtesten. (set-shifting ist die Fähigkeit kognitive Einstellungen zu wechseln, also Objekte auf verschiedene Weisen zu sehen. Eine verminderte Fähigkeit des set-shifting bedeutet Unflexibilität im Denken und Handeln.) Verminderte Aufmerksamkeit und ein niederreguliertes aktives prozesshaftes Verarbeiten [40] von Eindrücken ist somit bei jeder Depression auffällig. Zusammenfassend kann man sagen, dass bei einer exekutiven Dysfunktion [52] der Patient 1. Schwierigkeiten hat alte Schemata zu unterdrücken, 2. Neue einzulernen und 3. Feedback anzunehmen und produktiv umzusetzen. Diese Fähigkeiten werden vornehmlich vom präfrontalen Cortex kontrolliert. Eine exekutive Dysfunktion kann somit durch einen Hypometabolismus im präfrontalen Cortex erklärt und gesehen werden [52, 53]. Nicht jeder Depressive leidet an einer exekutiven Dysfunktion. Es kann aber gezeigt werden, dass Patienten mit einer schweren kognitiven Beeinträchtigung ein nichtAnsprechen auf Fluoxetin aufweisen [52, 53]. Die Aussage, dass eine schwere kognitive Dysfunktion Non-Responder herausfiltert ist aber trotzdem zu gewagt und noch nicht wirklich bewiesen. Aber nicht nur Depressive zeigen eine Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit. Auch Patienten die an organischen Erkrankungen leiden können kognitive Defizite zeigen [54]. Eine einseitige Wahrnehmung und einen „Rückzug in sich selbst“ könnten somit auch einen, für das Gehirn gängigen Weg darstellen mit einer Erkrankung umzugehen. 3.3 Stress im Kontext von Angst und Depression Besondere gesundheitspolitische Bedeutung bekam in den letzten Jahren wieder die Frage der Beziehung von Stress, Angst und Erkrankung. Zeigt doch gerade die Stressforschung, dass der Mensch selbst großen Einfluss darauf habe, ob Stress als gesunder, ja Gesundheit 18 fördernder Eustress, oder als krankmachender Disstress erlebt werde. Ob stressinduzierte Angst als sinnvolles Warnsignal oder als schicksalhafte Einengung gesehen werden, bestimme den neurophysiologischen oder pathologischen Verlauf. Bei Stress werden im Gehirn vermehrt Neurotransmitter freigesetzt. Wenn wir einer Gefahr ins Auge sehen, wird eine große Menge an Katecholaminen ausgeschüttet. Die Herzfrequenz steigt, der Blutdruck steigt und wir fokussieren unsere Aufmerksamkeit auf die aktuelle Situation. Eine akute Stressantwort ist somit eine physiologische Reaktion, die unser Überleben sichert. Eine physiologische Stressantwort sollte aber nie lange andauern. Bei einer chronischen Stressantwort geht der protektive Effekt verloren und wir fügen uns selbst, zwar meist unbewusst, Schaden zu. Wo stressbedingte Angst, die physiologisch mit einem funktionellen Hypertonus einhergehe keine Wahrnehmung und Bewältigung erfahre, würde der persistierender arterieller Hypertonus im Weiteren zu einer Schädigung des Herzkreislaufsystems und im schlimmsten Fall über die Zeit zum Myokardinfarkt führen [55,56]. Cortisol ist dabei, neben Adrenalin das bedeutendste Stresshormon. Bei psychischer oder physischer Belastung wird über den Hypothalamus und die Hypophyse die Nebennierenrinde angeregt Cortisol auszuschütten. Ein steigender Cortisolspiegel im Blut hemmt wiederum den Hypothalamus und die Hypophyse in ihrer Aktivität [57]. Cortisol selbst stimuliert die Gluconeogenese und führt zu einer katabolen Stoffwechsellage. Cortisol stellt somit Glucose bereit um die physische und psychische Leistung zu fördern und zu verbessern. Weiters unterdrückt eine vermehrte Cortisolausschüttung das Immunsystem und hemmt somit Entzündungsprozesse [57]. Bei Chronifizierung dieser Antwort führt ein erhöhter Cortisolspiegel zu schwerwiegenden Veränderungen, vor allem der Immunlage des Menschen. Ich möchte in diesem Fall nur auf die Veränderungen des Gehirns eingehen. Bei ständig hohem Cortisol lösen sich, die miteinander verbundenen Synapsen im Hippokampus, die Funktion der Synapsen mit den Neuronen ist nicht mehr gegeben und die Neuronen vermindern sich [58]. Es kommt somit zu einer Atrophie des Hippokampus [54]. Wie oben erwähnt spielt eine Hippokampusatrophie eine markante Rolle in der Depressionsforschung. 19 Nach neueren Studien [54, 58] besitzt der Hippokampus die Fähigkeit die HypothalamischHypophysäre-Nebennierenachse (HHN-Achse) aktiv zu beeinflussen. Bei psychologischem Stress kann er die Stressantwort die über die HHN-Achse läuft verzögern oder minimieren. Weiters konnte man im Maus-Model [59] zeigen, dass chronischer Stress zu einer Erhöhung des Cortisols im Plasma führt aber zu einer Niederregulation der Glucocorticoidrezeptoren im Gehirn. Ridder et al [59] konnten in einem Versuch zeigen, dass eine verminderte GlucocorticoidRezeptordichte im Hippokampus zu einer vermehrten Hilflosigkeit und Stresssensitivität der Mäuse führen. Außerdem konnte man feststellen, dass weniger BDNF vorhanden war und somit der Hippokampus weniger Chancen hatte sich zu adaptieren und zu modellieren. Im Vergleich dazu zeigen Mäuse mit vermehrten Glucocorticoidrezeptoren eine eindeutige Resistenz gegenüber Stress. Misst man bei Depressiven das Cortisol im Blut zeigen 70-80% der Patienten eine Erhöhung des Cortisols [59]. Ein ständig hoher Cortisol-Spiegel beeinträchtigt auch die kognitive Leistungsfähigkeit. Verhilft Cortisol in einer akuten Stresssituation zu einer besseren Aufnahmefähigkeit und verbessertem Merken, blockiert es bei chronischer Erhöhung die Merkfähigkeit [54]. Abbildung 3 Lernen unter Stress [60]. 20 Ob aber die Erhöhung des Cortisols oder die veränderte Antwort der HHN-Achse der entscheidende Punkt ist, der zu neuronalen Umstrukturierung führt bleibt leider offen [54]. 3.4 Neurobiologische Veränderungen bei medikamentöser Therapie und bei Psychotherapie Mittels PET und fMRT können Neurophysiologie und Rezeptor-Bindungsstellen visuell sichtbar gemacht werden. Besondere Bedeutung kommt bei der Depressionsforschung dem regionalen Blutfluss und dem Glucosemetabolismus zu [61]. Mit Hilfe dieser können reversible, Stimmung abhängige, neurophysiologische Veränderungen aufgezeichnet werden. Aber auch irreversible Vernetzungs- und Verbindungsanomalien können so im Rahmen einer Depression aufgedeckt werden [61]. Die zwei am Häufigsten zitierten Studien, die ein psychotherapeutisches Verfahren und ein Antidepressivum miteinander vergleichen wurden von Martin et al [62] und Brody et al [63] publiziert. Martin et al [62] vergleicht die Wirkung von Venlafaxin-Hydrochlorid (SerotoninNoradrenalin Wiederaufnahmehemmer) mit der interpersonellen Psychotherapie. Insgesamt 28 Patienten mit einer schweren Depression wurden über sechs Wochen entweder der Psychotherapie mit einer wöchentlichen Sitzung oder der Pharmakotherapie, zweimal täglich 37,5 mg Venlafaxin-Hydrochlorid zugeteilt. Nach sechs Wochen konnte mit beiden Therapieverfahren eine Besserung der depressiven Symptomatik erzielt werden. Die Pharmakotherapie zeigte jedoch einen schnelleren Erfolg als die Psychotherapie Die heutige Studienlage beweist, dass die psychotherapeutische Behandlung in den ersten Wochen eine schlechtere Remission als die medikamentöse Therapie zeigt [64, 65, 66]. Die Psychotherapie holt aber innerhalb von vier Wochen auf. Und betrachtet man die Nachhaltigkeit beider Therapieformen nach 8 Monaten zeigt die medikamentöse Behandlung eine Rückfallrate von 60% und die der Psychotherapie eine von 30% [67]! Da Martin et al und Brody et al relativ kurze Therapieintervalle miteinander verglichen fällt in beiden Studien die Wirkung der Psychotherapie geringer aus als sie vermutlich ist. 21 Mittele SPECT wurden Veränderungen im Blutfluss gemessen. Das Hauptaugenmerk der Messung lag auf dem frontalen Cortex, dem Gyrus cinguli, den Basalganglien und dem temporalen Cortex. Laut Martin et al zeigte Venlafaxin eine Reduktion des Blutflusses im rechten posterioren Temporallappen und in den rechten Basalganglien. Die interpersonelle Psychotherapie zeigte ebenfalls Veränderungen des Blutflusses in den rechten Basalganglien an und zusätzlich noch im rechten posterioren Angulus des limbischen Systems [62]. Brody et al verglich die interpersonelle Psychotherapie mit Paroxetin (selektiver Serotonin Wiederaufnahmehemmer). 24 Patienten mit einer schweren Depression wurden über zwölf Wochen behandelt. Die Patienten konnten die Therapie selbst wählen. Auch hier erzielte die Pharmakotherapie einen schnelleren Erfolg als die Psychotherapie bezüglich der depressiven Symptomreduktion. Paroxetin reduzierte den neuronalen Metabolismus im präfrontalen Cortex bilateral und im anterioren Gyrus cingulus links. Und steigerte den Metabolismus im linken Temporallappen. Die interpersonelle Psychotherapie zeigte, laut Brody et al eine Reduktion des Metabolismus im rechten präfrontalen Cortex und im linken anterioren Gyrus cingulus und ebenfalls einen gesteigerten Umsatz links temporal[63]. 22 Abbildung 4 Stellt die, bei der Depressionsforschung wichtigsten Zentren dar [63]. Betrachtet man nur die Tatsache, dass die Patienten die Möglichkeit der Therapiewahl hatten zeigt die Studie von Mergl et al [68] ein wichtiges Resultat. Berücksichtigt man, die vom Patienten gewünschte Behandlungsart ist das Therapieergebnis signifikant besser. Sowohl bei medikamentöser Therapie als auch bei der Psychotherapie scheint die Erwartungshaltung des Patienten eine größere Rolle zu spielen als man gedacht hat. Besonders im Bezug auf die Psychotherapie ist die Motivation des Patienten entscheidend für das Ergebnis. Die interpersonelle Psychotherapie und die kognitive Verhaltenstherapie gelten zurzeit als „first line“ Psychotherapien im Rahmen einer Depression. 23 Die kognitive Verhaltenstherapie zeigte in einer PET - Studie mit 17 Probanden ebenfalls Blutflussveränderung nach der Behandlung auf [69]. Eine vermehrte Aktivität im Hippokampus, im dorsalen Cingulus und im ventral, medial frontalen Cortex konnte gemessen werden. Paroxetin zeigt in dieser Studie ein entgegengesetztes Ergebnis. Anstatt den Blutfluss im präfrontalen Cortex zu erniedrigen [63] wurde ein Anstieg des Blutflusses gemessen und ein Absinken im Hippokampus und im subgenualen Cingulus [69]. Hier fällt auf, dass die Psychotherapie die Aktivität im Hippokampus steigert und die medikamentöse Therapie die Aktivität reduziert und trotzdem erzielen beide Therapiearten einen antidepressiven Effekt! Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sowohl Psychotherapie als auch Pharmakotherapie Veränderungen im limbischen System und in frontalen und temporalen Regionen bewirken. Ob Regionen aktiviert oder gehemmt werden erweist sich aber von Studie zu Studie unterschiedlich. Und selbst Medikamente zeigen von Studie zu Studie unterschiedliche Wirkungen [63, 69]. Die psychotherapeutische Forschung hat nur sehr wenige Studien über neuronale Veränderungen und Psychotherapie hervorgebracht. Die Aussagekräftigsten habe ich oben genannt [62, 63, 68, 69]. Im psychotherapeutischen Bereich stehen vor allem Therapieergebnis und Rückfallrate im Mittelpunkt. Über neuronale Veränderung einer Therapie kontinuierlich gemessen und somit als Therapieverlauf sichtbar, sind zurzeit noch wenige aussagekräftigen Studien veröffentlicht, aber in Diskussion [70]. Kandel bezeichnet die Psychotherapie als Lernprozess. Mit dieser Auffassung steht er nicht allein da. Viele veröffentlichte Studien über die Funktion der Psychotherapie setzten sich mit der Frage nach dem Gedächtnis auseinander. Hauptaussage dabei ist, dass eine unterschiedliche kognitive Verarbeitung von Reizen, unterschiedliche limbische Aktivitätslevel stimuliert [71]. Das implizite und das explizite Gedächtnis sind die zwei von uns heute verstandenen Gedächtnissysteme. Das implizite Gedächtnis gilt als jener Anteil der menschlichen Intelligenz, welches unbewusst, instinkthaft unser Erleben und Verhalten steuert. Als 24 prozedurales Gedächtnis ist es auch für alle intuitiven, selbstgesteuerten oder automatisierten Handlungen, wie Gehen, Laufen oder auch Radfahren zuständig. Die tiefenpsychologische Psychotherapie sieht ihren Ansatz vor allem in der Neubestimmung impliziter Gedächtnisanteile. Das explizite/deklarative Gedächtnis speichert unsere Erinnerungen, unsere Emotionen und Gefühle die wir erlebt haben. Diesem Teil des Gedächtnissystems wird ebenfalls die Aufmerksamkeit in einer Psychotherapie geschenkt. Hier liegt der Angriffspunkt falsche Auffassungen zu falsifizieren und sich selbst kritisch zu betrachten. Allerdings muss man sich seiner Erinnerungen und Auffassungen erst bewusst werden um sie bearbeiten zu können [72, 73]. Diesen Weg soll eine erfolgreiche verhaltenstherapeutische Psychotherapie bahnen helfen. Ein weiteres großes Gebiet der neuropsychiatrischen Forschung dreht sich heute um das Thema der Spiegelneurone. Die Spiegelneurone werden heute als die ursprünglichsten neuronalen Strukturen für Empathie, soziale Verbundenheit und gemeinsame Welterfahrung erkannt. Auf Grund der Spiegelneurone werden erzählte Erlebnisse und beschriebene Emotionen von einem Gegenüber nicht nur gehört sondern, durch Studien bewiesen, leiblich mitempfunden. Ein Psychotherapeut, der sich in die Situation seines Klienten hineinversetzt, spielt sich somit diese Situation nicht nur vor sondern kann, Dank Spiegelneuronen, die Emotionen direkt durch Stimulation seiner eigenen Neuronen miterleben; die Neubewertung dieser Situation durch den Therapeuten, vermag ihrerseits die Resonanzfähigkeit des Patienten zu vertiefen [71]. 3.4.1 Neuronale Veränderungen unter medikamentöser Therapie Eine Vielzahl an Studien[74, 75, 76, 77, 78] wurde durchgeführt um die neuronalen Veränderungen unter Pharmakotherapie sichtbar zu machen. Es tauchen viele widersprüchliche Ergebnisse (s.o.) auf, aber einige sind konkordant. Ich habe diese in Tabelle 3 zusammengefasst. 25 Antidepressivum Angriffsort Venlafaxin Reduktion des BF des ventro lateralen Cortex Reduktion des BF des ventro lateralen Cortex, Reduktion des BF präfrontal Steigerung des BF im dorso lateralen präfrontalen Cortex Steigerung des BF im dorso lateralen präfrontalen Cortex Paroxetin Sertralin Fluoxetin Tabelle 5 Antidepressiva und ihre neurobiologisch messbaren Veränderungen. Solche Ergebnisse sind mit Vorsicht zu genießen, da die Depression bekanntlich nicht die Störung einer einzigen Struktur im Gehirn ist. Außerdem ist bei sehr vielen wirksamen Antidepressiva die exakte Wirkung nicht bekannt. Das Gehirn ist ein Organ, dessen Kreisläufe und Bahnen ineinander verflochten sind. Die Veränderung einer Struktur kann somit eine Kettenreaktion auslösen. Selektive Serotonin Wiederaufnahmehemmer beeinflussen z.B. den präfrontalen CortexBasalganglien-Thalamus Kreislauf. Veränderungen dieser wichtigen Schleife können bei Depressiven oft gesehen werde, aber sie sind kein Beweis für eine Depression. Wie oben erwähnt konnte auf der Promotorregion des Serotoninrezeptors ein Längenpolymorphismus festgestellt werden [36] der die Vulnerabilität herabsenken kann. Murphy et al [79] untersuchte die Wirksamkeit und Verträglichkeit der Antidepressiva Mirtazapin und Paroxetin in Bezug auf den Polymorphismus. Untersucht wurden 246 Patienten über acht Wochen. Die Resultate waren markant. Homozygote S-Allel Träger benötigten unter Paroxetin Therapie niedrigere Dosierungen des Medikaments um eine antidepressive Wirkung zu erzielen, hatten aber viele Nebenwirkungen. Unter Mirtazapin zeigten homozygote S-Allel Träger weniger Nebenwirkungen, benötigten aber eine höhere Dosierung von Mirtazapin um den gewünschten antidepressiven Effekt zu erzielen. Die Forschung steht hier noch in den Kinderschuhen, bietet aber schon spannende Einblicke in mögliche zukünftige Therapieansätze für Wirkung und Verträglichkeit von Antidepressiva. 26 Die bereits erwähnte Glucocorticoid-Hypothese [57, 58, 59] bietet ebenfalls einen medikamentösen Ansatzpunkt. Cortisol kann den Hippokampus angreifen und zu einer verminderten Zellintegrität führen. Ein vermindertes hippokampales Volumen ist bei Depressiven fast immer vorhanden und wird für eine schlechtere Merkfähigkeit und Aufnahmefähigkeit verantwortlich gemacht. Weiters spielt der Hippokampus eine wichtige Rolle bei einer exekutiven Dysfunktion [51] und Kommunikation der unterschiedlichen zerebralen Kreisläufe. Die Idee das Cortisol zu senken um somit die Kaskade zu stoppen funktioniert in vivo leider nicht wie erhofft. In einer Studie [80] wurde Metyrapon (hemmt die Corticosteroidsynthese in der Nebennierenrinde) mit wahlweise Nefazodon (Serotonin- Noradrenalin Wiederaufnahmehemmer) oder Fluvoxamin (selektiver Serotonin Wiederaufnahmehemmer) verabreicht. Hemmt man die Steroidsynthese mit Metyrapon bei zusätzlicher Gabe eines Antidepressivums zeigt sich ein schnellerer Wirkungseintritt des Antidepressivums. Die depressive Symptomatik konnte innerhalb von sieben Tagen verbessert werden. Jedoch blieb der Cortisolplasmaspiegel gleich. Es konnte nur ein Anstieg von Corticotropin und Desoxycortisol gemessen werden. Auch wird keine bessere Verträglichkeit oder höhere Remissionsrate beschrieben. Auch die Serotonin Synthese steht im Forschungsmittelpunkt. Obwohl sich die Serotoninhypothese nicht halten konnte, ist Serotonin einer der wichtigsten Botenstoffe im menschlichen Gehirn. Um die Serotonin Synthese zu evaluieren wurde mittels PET -[11 C]-methyl-Ltryptophan visualisiert. -[11 C]-methyl-L-tryptophan spielt bei der Serotoninsynthese eine Hauptrolle. Die Menge an -[11 C]-methyl-L-tryptophan korreliert somit mit der Serotoninmenge. Das Ergebnis dieser Untersuchung [81] ist aber ernüchternd. Es wurde zwar ein deutlicher Mangel im anterioren Gyrus cingulus und im mesialen temporalen Cortex gefunden. Aber es besteht keine Korrelation zwischen der Schwere einer Depression und einem Mangel. 3.4.2 Stellenwert der Psychotherapie Die kognitive Verhaltenstherapie und die interpersonelle Psychotherapie werden häufig als die „first line“ Verfahren bei der Depressionsbehandlung angeführt [2, 82]. (-Dies hat vor allem damit zu tun, dass z.B. psychoanalytische Studien typischer Weise als 27 subjektorientierte Einzelfallstudien durchgeführt werden und dadurch bei statistischen Metaanalysen keine Berücksichtigung finden.) Unter dem sogenannten „treatment as usual, TAU“ [83], der normalen Behandlung, wird eine Therapie verstanden, bei der der Patient Medikamente und Hilfestellungen bezüglich seiner Depression bekommt, jedoch keine psychotherapeutischen Gespräche. Der Patient hat die Möglichkeit mit Pflegern und Ärzten zu sprechen und sich seinem sozialen Umfeld anzuvertrauen. Eine psychotherapeutische Therapie ist für ihn aber nicht zugänglich. Ein TAU wird in Studien oft als zweite Therapiewahl gewählt um somit einen Vergleich zu einem psychotherapeutisch behandelten Patienten herzustellen. Vergleicht man eine interpersonelle Psychotherapie mit einem TAU sieht man eine eindeutige Verbesserung der Symptome und vor allem eine Verbesserung der sozialen Fähigkeiten des Patienten [83]. 2010 überprüfte Schramm et al die Wirkung der kognitiven Verhaltenstherapie mit der interpersonellen Psychotherapie [84]. Auf den ersten Blick zeigten beide Behandlungen eine gleich gute Verbesserung der depressiven Symptomatik. Nach einem Jahr fiel aber auf, dass Patienten die eine kognitive Verhaltenstherapie erhalten hatten einen besseres Ergebnis zeigten. Es gab weniger Therapieverweigerer und auch weniger Abbrüche. Beeindruckend war auch, dass die Patienten, die eine kognitive Verhaltenstherapie hatten ihre Behandlung als wirksamer und hilfreicher erlebten als Patienten der interpersonellen Psychotherapie [84]. Weiters konnte gezeigt werden, dass die interpersonelle Therapie eine gleich starke Wirkung wie die kognitive Verhaltenstherapie hat wenn: die Patienten eine interpersonelle Therapie in Kombination mit Medikamenten bekamen und einen starken sozialen, vor allem familiären Rückhalt hatten. Mc Cullough von der Virginia Commonwealth University entwickelte speziell für chronisch Depressive eine Psychotherapieform, die CBASP (cognitive behavioral analysing system of psychotherapy). Diese Therapie ist eine Kombination aus Ideen der behavioralen, kognitiven, psychodynamischen und interpersonellen Psychotherapien. 28 Mc Cullough sieht die Grundproblematik Depressiver im nicht positiven Wahrnehmen seiner Umwelt. Taten und deren Konsequenzen könne nicht erkannt werden oder werden verkannt. Die Grundidee der CBASP ist dem Depressiven die Konsequenzen seines Verhaltens sichtbar und erkennbar zu machen [82]. Keller et al [85] konnte zeigen, dass CBASP und Nefazodon bezüglich der Remission sehr gut und sehr ähnlich wirken. CBASP hatte eine Remissionsrate von 24% und Nefazodon von 22%. In Kombination erreichten sie sogar eine Rate von 42%. Da die CBASP für die Behandlung von schweren Depressionen angedacht ist, ist eine 42% Remission außerordentlich gut. 45% 40% 35% Remission 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Nefazodon CBASP Nefazodon+ CBASP Therapieform Abbildung 5 Therapieerfolge bei schwerer Depression Bei leicht bis mittelschweren Depressionen führt eine Kombination von Psychotherapie und Antidepressivum zu keiner verbesserten Remission [82]. Das Ansprechen in einer Akutphase ist bei beiden Therapieformen gleich gut. Die Psychotherapie aber hat keine Nebenwirkungen wie ein Antidepressivum und somit auf längere Sicht gesehen – einen Vorteil. Schwere Depressionen zeigen eine deutliche Verbesserung unter einer kombinierten Therapie. Es zeigen sich eine bessere Compliance, eine kürzere Behandlungsdauer bis zur Remission und ein schnelleres Wiedererlangen der Arbeitsfähigkeit [82]. 29 Patienten, die an einer klinisch schweren Depression leiden zeigen sowohl im stationären Bereich als auch ambulant ein schlechteres Ansprechen auf therapeutische Interventionen. Um das Ansprechen zu verbessern gibt es die Möglichkeit die Psychotherapie mit Antidepressiva zu kombinieren und die des Feedbacks. Es konnte gezeigt werden, dass im stationären Kontext ein tägliches Feedback für Patienten mit schwerer Depression im Verlauf günstig ist. Sie zeigten ein gebessertes Ansprechen und ein besseres Endergebnis als feedbacklose Kontrollgruppen. Ein verbessertes Ergebnis bei leicht bis mittelschweren Depressionen durch Feedback konnte allerdings nicht gezeigt werden [86]. Teasdale [87] konnte der Gruppenpsychotherapie, im speziellen der „mindfulness based cognitive behavioral therapy”, sogar nachweisen als Rezidivprophylaxe zu wirken. Patienten mit drei oder mehr depressiven Episoden zeigten gegenüber rein medikamentöser Nachbehandlung eine fast 50%-ige Rezidivsenkung. Patienten mit nur einer depressiven Episode scheinen von solch einer Nachbehandlung allerdings nicht zu profitieren. 3.4.2.1 Psychotherapieformen 3.4.2.1.1 Kognitiv verhaltenstherapeutische Psychotherapie Primär besteht hier die Grundannahme, dass Verhalten gelerntes Verhalten ist und somit auch wieder verlernbar ist. Psychotherapie ist somit ein Lernprozess. Die Verhaltenstherapie hat ihre Wurzeln bei Skinner und Lewinsohn. Die kognitive Therapie beruht vornehmlich auf Beck. Der Therapieverlauf wird hier in Phasen aufgeteilt [2]: 1. Problemanalyse 2. Beziehungs- und Motivationsanalyse 3. Zielanalyse 4. Durführung der Verhaltensänderung 5. Evaluation / Stabilisierung Die Depression wird als Vulnerabilitäts-Stress-Genesemodell gesehen, das multifaktoriell bedingt ist [82]. 30 Die kognitive Verhaltenstherapie ist eine Evidenz basierte Therapie bei Depressionen. Mehrere Studien konnten eine Überlegenheit gegenüber Placebo und abwartender Kontrollgruppen zeigen [88]. Hauptmerkmale sind längerfristige Effektivität und eine geringere Rückfallrate [88]. 3.4.2.1.2 Interpersonelle Psychotherapie Die interpersonelle Psychotherapie ist ein integratives Psychotherapieverfahren. Sie wurde von Klerman und Weissman als Kurzzeittherapie für Patienten mit unipolarer Depression entwickelt [88]. Verhaltenstherapeutische, analytische und systemische Ansätze liefern das Grundgerüst [2]. Besondere Bedeutung wird der interpersonellen Schule von Sullivan und der Bindungstheorie nach Bowlby beigemesse. Die Therapie wird grob in drei Phasen aufgeteilt [88]: 1. Entlastung von Schuld und Insuffizienzgefühlen 2. Ressourcenaktivierung, interpersonelle Strategien und Problembewältigung 3. Trauer und Abschiedsprozess Im Mittelpunkt steht der zwischenmenschliche Konflikt, der als ein Auslöser für die Entstehung der Depression gesehen wird. Der Fokus liegt hier auf der Bearbeitung von Verlusterlebnissen und Partnerschaftskonflikten, sowie im Einüben von Rollenwechsel [2, 82]. Auch die interpersonelle Therapie ist für die Behandlung von Depressionen evidenzbasiert. 3.4.2.1.3 CBASP – cognitive behavioral analysing system of psychotherapy Das CBASP wurde von Mc Cullough entwickelt [82]. Er begann Mitte der 70er Jahre mit schwer Depressiven zu arbeiten und anhand seiner Erfahrung konstruierte er das CBASP. Die Kerntheorie ist, dass Depressive die Konsequenz ihres eigenen Verhaltens nicht gut erkennen. Der Therapieprozess gliedert sich daher in folgenden vier Stationen [89, 90]: 31 1. Erkennen der Konsequenzen des eigenen Verhaltens 2. Erwerb von authentischer Empathie 3. Problemlösefertigkeiten, Bewältigungsstrategien erarbeiten 4. Heilungsprozess früherer Traumata Mc Cullough nimmt als Schwerpunkt für das CBASP interpersonelle Strategien zur Gestaltung der therapeutischen Beziehung. Situationsanalyse und Verhaltenstraining sind die therapeutische Grundlage des CBASP [89]. 4 Diskussion Dass sowohl die Pharmakotherapie als auch die Psychotherapie neurobiologische Veränderungen hervorrufen ist eindeutig bewiesen [62, 63, 75, 77]. Die Forschungsergebnisse zeigen aber keine konstanten Befunde welche Strukturen genau betroffen sind. Areale wie z.B. der präfrontale Cortex spielen mit Sicherheit eine tragende Rolle in der Reizverarbeitung. Ergebnisse bezüglich Aktivitätsabnahme oder Aktivitätszunahme in diesem Gebiet unterscheiden sich in den Studien [63, 69]. Trotz ähnlichen antidepressiven Effekts scheinen Antidepressiva und Psychotherapie zunächst unterschiedliche Bahnen und Strukturen anzuregen [70]. Betrachtet man die zwei aussagekräftigsten Studien über neuronale Bildgebung bei Depressionen [75, 76] detaillierter, fallen die geringe Studienteilnehmerzahl und der kurze Abstand bis zur Nachkontrolle auf (6-12 Wochen) [91]. Außerdem wird auch nicht bei jedem Teilnehmer eine auffällige neuronale Veränderung bei Therapieanfang beschrieben. Damit eine Studie auch aussagekräftig ist muss eine Randomisierung gewährleistet sein. Bei einem Vergleich von zwei Medikamenten ist das nicht so schwer. Eine Gruppe erhält das Medikament, die andere ein Placebo, beides in gleicher Form. Wie aber soll man einer Gruppe eine Psychotherapie zukommen lassen und der anderen nicht ohne dass der Unterschied offensichtlich ist? Bei einer Studie über die Wirkung von Psychotherapie muss das Triumvirat aus Patient, Behandlung und Therapeut beachtet werden [92]. 32 Was ist im realen Kontext ausschlaggebend für den Patienten einen Psychotherapeuten aufzusuchen? Mergl et al [68] hat bereits gut belegt, dass die Motivation des Patienten sich im Endergebnis der Therapie wiederspiegelt. Ist es für den Therapieerfolg auch wichtig welcher Therapeut aufgesucht wird, wie der Patient zu dem Therapeuten überhaupt kommt? Wie wird dieser bezahlt? Wie denkt das Umfeld des Patienten über dessen Therapie? Welche Auswirkungen hat das auf das soziale Leben des Patienten und umgekehrt? Diese Parameter können in einer randomisierten Studie niemals alle beachtet und vorallem kontrolliert werden. Parameter, die in einer Studie aber kontrolliert werden könnten sind der Therapeut und seine Kompetenz. Eine Studie [93] untersuchte die Kompetenzen der verschiedenen Therapeuten. Sie ergab, dass 15% des Therapieerfolges von dessen Kompetenz abhängt, ungeachtet der Schwere der Depression. Einige Studien verwenden das TAU (-treatment as usual-) als Vergleichsparameter. Auch hier ist wissenschaftlich nicht festgelegt, was genau unter TAU, gewöhnlicher Behandlung, verstanden wird. Es ist aber ein Parameter, der ebenfalls kontrollierbar wäre um Studien valider und miteinander vergleichbar zu machen [94]. Interdisziplinär erkennt man viele Streitigkeiten und Vorwürfe der verschiedenen Studiengruppen über die Aussagekraft der Studien anderer [95, 96]. Eine wissenschaftliche Diskussion über die Randomisierung psychotherapeutischer Studien wäre also fällig. Gleichzeitig soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass gerade für psychotherapeutische Studien dem wissenschaftlichen Modell der Einzelfallstudie höhere Gültigkeit zukomme. In meiner Arbeit habe ich mich mit der Neurobiologie der Psychotherapie beschäftigt. Bei der Literaturrecherche fiel auf, dass die Neurobiologie die Tendenz hat den Menschen von seiner Umwelt zu trennen. Neuropsychiatrische Erkrankungen werden vorrangig als Dysfunktion des menschlichen Gehirns angesehen [97]. Die Neurobiologie betrachtet die Depression als neuronale Erkrankung während die Psychotherapie sie deutlicher als einen interpersonellen Prozess sieht. 33 Die Psychotherapie ihrerseits stützt sich auf das gesammelte Endresultat einer Therapie. In der Psychotherapie wird der ganze Mensch in seiner Beziehung zu Umwelt betrachtet und nicht nur ein Teilaspekt bewertet. [92]. Um also die Frage beantworten zu können welche Strukturen bei einer Psychotherapie angeregt oder gehemmt werden, müssen Psychotherapie und Neurobiologie noch konkreter zusammengeführt werden und gemeinsam Studienprojekte planen und untersuchen. Bezüglich der Aussagekraft und Vorhersagbarkeit des Therapieerfolges gibt es eine dünne Studienlage. Wie Schramm [64] oder Schulberg [66] schon beschrieben haben zeigen die Patienten ein gutes Ansprechen auf die Therapie, die in den ersten vier Wochen neurobiologische Veränderungen in der funktionellen Bildgebung aufweisen. Patienten, die nach zwölf Wochen noch immer keine Veränderung zeigten, konnten auch keine Besserung in ihrer depressiven Symptomatik angeben und zeigten nur sehr selten eine Remission. Bei einer Desensibilisierung bei Spinnenphobie [71] sieht man relativ schnell einen Verminderung der Aktivität in der Amygdala und damit auch eine Reduktion der Angst bei dem Patienten. Die Amygdala ist uns als Angstzentrum bekannt. Wir wissen hier etwas besser wo wir im MRT oder PET hinsehen müssen. Im Zusammenhang mit der Depression sind uns solche Hirnareale aber noch nicht bekannt und von Patient zu Patient unterschiedlich ausgeprägt. Ich glaube, bevor wir mittels neuronaler Bildgebung den Therapieerfolg voraussagen können, müssen wir den Grund und die bewegenden Ursachen der Depression verstehen. Dank der hohen Plastizität neuronaler Strukturen haben viele das Potenzial einer Veränderung in sich. Da der Hippokampus eine zentrale Rolle in der Depression zu spielen scheint, kann man an seinem Volumen einen möglichen Therapieerfolg sehen. Ein vermindertes hippokampales Volumen in der Bildgebung korreliert mit einem verminderten Ansprechen auf medikamentöse und psychotherapeutische Hilfestellung. Aber es korreliert auch mit der Schwere der Depression, dem Alter bei der ersten Episode, unbehandelten Tagen, Missbrauch in der Kindheit, genetischer Polymorphismus, Angstlevel und weiteren neuropsychiatrischen Zuständen wie Demenz, posttraumatisches Syndrom und Psychosen. Ein direkter Schluss zwischen Hippokampusvolumen und Non-Response kann also nicht getroffen werden. 34 Bei Studien über Antidepressiva fällt auf, dass naturgemäß sehr viele von Pharmafirmen gesponsert sind. So hat die Pharmaindustrie auch einen großen Einfluss auf die psychiatrische Forschung [99]. Bei 37 von 43 Studien über den Einsatz von Duloxetin bei Depression ist mindestens ein Autor bei dem sponsernden Pharmakonzern angestellt [100]. In dieser Studie konnte man auch sehen, dass ein sogenanntes „salami slicing“ betrieben wird. Ein erhobener Datensatz wird in Stücke geschnitten und in mehreren Artikeln beschrieben. Das bringt für die Autoren Publikationspunkte und für z.B. ein Medikament eine nicht zu unterschätzende Werbung, da der Name nicht nur in einem, sondern gleich in mehreren Papers erwähnt wird. Bei der genannten Studie [100] wurden aus einem Datensatz 20 Artikel publiziert. Weiters ist auch auffällig, dass sehr viele positive Medikamentenstudien publiziert werden und man nur selten Studien mit wirklich negativen Endresultaten findet. Pigott et al [101] fasste in einer, 2010 publizierten Studie seine Ergebnisse zusammen: Von 75 Studien waren 38 mit positivem und 37 mit negativem Ergebnis. Von den 38 positiven wurden 37 Studien publiziert. Von den 37 negative wurden 3 publiziert! Auf Grund der Methode meiner Diplomarbeit, nämlich einer Literaturrecherche, ist es mir nur möglich einige auffallende Fakten zu präsentieren. Die Problematik der Randomisierung bei Psychotherapiestudien, das Interesse von Pharmakonzernen und die Eigenheit des „salami slicing“ sind mir bewusst und in der Interpretation der Studien in meiner Arbeit berücksichtigt. Zum Schluss möchte ich meine gestellten Fragen zusammenfassend noch einmal beantworten: 1. Können Psychotherapie und Pharmakotherapie die gleichen neuronalen Strukturen anregen/ hemmen? Auf Grund der von mir durchgeführten Literaturrecherche kann ich feststellen, dass einige Studien dies bestätigen und einige dies noch unbeantwortbar sehen. 35 Der Metabolismus im Cortex frontalis, Cortex temporalis und im limbischen System wird sowohl bei Pharmakotherapie als auch bei Psychotherapie angeregt bzw. gehemmt. Die exakte Lokalisation und ob die Struktur aktiviert oder gehemmt wird ist bei Psychotherapie und Pharmakotherapie und von Studie zu Studie unterschiedlich. Bestätigt wird aber, dass die Pharmakotherapie Mittellinie nahe Strukturen, wie Hirnstamm oder limbische Strukturen anregt. Medikamente beeinflussen auf diese Weise das Schlafverhalten, Angst oder den affektiven Grundtonus [71]. Man spricht in diesem Fall von einer bottom up Steuerung. Die niedrigeren Strukturen werden beeinflusst und diese stimulieren ihrerseits höher liegende Zentren wie den Cortex. Psychotherapie zeigt eher den umgekehrten Weg. Stimuliert werden vor allem der frontale Cortex und kortikal übergreifende Mechanismen [71]. Man kann also von einer top down Steuerung sprechen, wo die Hemmung oder Aktivierung des z.B. limbischen Systems vom frontalen Cortex selbst gesteuert wird. Die Kreisläufe in die beide Therapien eingreifen scheine aber gleich zu sein! 2. Findet sich die Vielfalt depressiver Erkrankungsformen in der neurobiologischen Forschung wiedergespiegelt? Der Überblick der aktuellen Literatur spricht zunächst noch für eine Verneinung. Depressive zeigen eine reiche Facette an Symptomen, die neurobiologisch nicht gut und gesichert zuordenbar sind. Da das Gehirn ein in sich sehr vernetztes Organ ist werden wir wahrscheinlich immer nur gewisse Zeichen einer Region zuordnen können. Erfolgsversprechender wird es sein die kommunizierenden Netzwerke und Schaltkreise zu beschreiben und zu erforschen. 3. Können neurobiologische Veränderungen mit Therapieerfolg /-misserfolg gleichgesetzt werden? Die Literatursuche und die vergleichende Prüfung dieser Studien erbrachte ein sehr heterogenes Bild zu dieser Frage. Teilweise kann man Rückschlüsse auf Non-Responder und Responder ziehen. Eine exakte Evaluierung mittel MRT, SPECT oder PET ist allerdings nicht möglich. 36 Non-Responder zeigen oftmals ein geringeres hippokampales Volumen als Responder [98]. Auch zeigt ein Hypermetabolismus im ventral anterioren Gyrus cingulus ein schlechteres Therapieergebnis, sowohl bei medikamentöser Therapie mit Venlafaxin als auch bei kognitiver Verhaltenstherapie [102]. Eine vermehrte Aktivität im gesamten anteriorem Gyrus cingulus spricht allerdings für einen besseren Therapieerfolg [98]. Rückschlüsse dürfen nicht gezogen werden. Ein kleiner Hippokampus beweist nämlich noch nicht eine Therapieresistenz (s.o.)! Die Psychotherapie ist ein Entwicklungs- und Lernprozess, ein Prozess der Integration und Organisation, der mit Hilfe der Neurobiologie zunehmend differenzierter visualisiert und optimiert werden kann. Ich persönlich glaube, dass die Cortisol-Hypothese im Zusammenhang mit einer GenUmwelt Interaktion als auslösende Ursache einer Depression gesehen werden kann. Allein die Tatsache, dass Mäuse, die von ihrer Mutter nicht ausreichend umsorgt wurden ein erhöhtes Stress- und Cortisollevel aufweisen und damit eine höhere Anfälligkeit in einer belasteten Situation eine Depression zu entwickeln, zeigt die enge Verbindung der Gen-Umwelt Interaktion [72]. Aber, und das find ich beeindruckend, wenn diese Mäusekinder zu allumsorgenden Mäusepflegeeltern kamen, entwickelten sie sich weiter und waren fähig eine Stressresistenz aufzubauen. Somit kann ein anerzogenes teilweise angeborenes Stressverhalten durch die Umgebung modelliert, gefördert oder unterdrückt werden. Von psychotherapeutischer Seite hat hier die Entwicklungspsychologie große Bedeutung. In der therapeutischen Arbeit muss also unbedingt auf die persönliche Entwicklung eingegangen werden. In Verbindung mit der Neurobiologie wäre hier interessant Patienten nach ihrer Entwicklungsgeschichte einzuteilen. Vielleicht würde man Entwicklungsphasen spezifische Defizite vorfinden. Die Depression könnte dann auch nach ihrer auslösenden Ursache und nicht nur nach ihren Symptomen eingeteilt werden. Die Psychotherapie fokussierte immer schon diese psychosozialen und damit auch neurobiologischen Entwicklungsdefizite gezielt aufzuarbeiten und nachzuholen. Eine Studienidee wäre somit neurologische Bildgebung mit den vom Patienten geschilderten Belastungen und möglichen Auslösern zu vergleichen. 37 Eine weiter interessante Studie würde ich finden, wenn man den Psychotherapeuten selbst mittels Neuroimaging beobachtet. Dank der Entdeckung der Spiegelneuronen, weiß man, dass der Therapeut sich die erzählten Gedanken und Erlebnisse nicht nur Vorzustellen vermag sondern wirklich auch miterlebt. Die gleichen Neuronen also angesprochen und aktiviert werden. Hier wäre ein Vergleich von Therapeutengehirn und Patientengehirn fesselnd. Vielleicht sind die Gedankengänge gleich oder man sieht die Region wo ein depressiver Patient anders verschaltet, obwohl mittels der Spiegelneuronen eine sehr ähnliche Aktivierung stattfinden sollte. Die Erkrankung an einer Depression ist vor allem in der westlichen Welt besonders häufig anzutreffen. Gerade in Ländern, deren Wohlstand sehr gut ist, scheint die Bevölkerung von Lustlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, innerer Unruhe und schlaflosen Nächten gequält zu sein. Wir sollten daher im Sinne einer Gen-Umwelt Interaktion auch unser aufgebautes Kultursystem begutachten. Beschreiben Depressive die gleichen krankmachenden Systemstrukturen oder findet sich eine große Variabilität was als krankmachend beschrieben wird? Und wie sehen nicht Depressive diese gesellschaftlichen Strukturen? Kann man hier einen unterschiedlichen Verarbeitungsprozess erkennen? Mittels meiner Literaturrecherche habe ich manche Fragen beantworten können; viele Fragen sind offen geblieben. Ich werde mit Spannung dieses Forschungsfeld weiter beobachten und vielleicht kann ich selbst einmal eine meiner Fragen wissenschaftlich bearbeiten. 38 5 Literaturverzeichnis 1 Depressionen.at. Homepage im Internet, zitiert 2011, Jänner 15. www.depressionen.at/content/2/2/de/was-ist-eine-depression.html 2 Rothenhäusler, H-B., Täschner, K-L.(2007): Kompendium praktische Psychiatrie. Springer-Verlag, WienNewYork. p.326-356 3 World health organization: Disorders management: Depression. Homepage im Internet, zitiert 2011, Jänner 15. http://www.who.int/mental_health/management/depression/definition/en/ 4 Finanzportal.at. Homepage im Internet, zitiert 2011, März 2. www.finanzportal.at/show/versichern2/berufsunfähigkeit/verstehen/ 5 Hausmann, A., et all.(2008):Frauen suchen Hilfe- Männer sterben! Ist die Depression wirklich weiblich? Neuropsychiatrie.2008; 2,1:43-48 6 Psyrembel: Klinisches Wörterbuch. Auflage 260.Walter de Gruyter, Berlin.2004; 260:27 7 Rutz, W., Walinder, J., Eberhard, G., et al. (1989): An educational program on depressive disorders for general practitioners in Gotland: background and evaluation. Acta Psychiatr Scand. 1989; 79(1): 19-26 8 Tsuang, MT., Faraone, SV. (1990): The genetics of mood disorders. The Johns Hopkins University Press, Baltimore 9 Kendler, KS., Pedersen, N., Johnson, L., et al. (1993): A pilot Swedish twin study of affective illness, including hospital- and population-ascertained sub- samples. Arch Gen Psychiatry. 1993; 50:699–706 10 Cadoret, R. (1978): Evidence for genetic inheritance of primary affective disorder in adoptees. Am J Psychiatry. 1978; 133: 463–466 39 11 Wender, PH., Kety, SS., Rosenthal, D., et al. (1986): Psychiatric disorders in the biological and adoptive families of adopted individuals with affective disorders. Arch Gen Psychiatry. 1986; 43: 923–929 12 Kendler, KS., Kessler, RC., Walters, EE., et al. (1995): Stressful life events, genetic liability and onset of major depression in women. Am J Psychiatry. 1995; 152:833–842 13 Caspi, A., Sudgen, K., Moffitt, TE., et al. (2003): Influence of life stress on depression: moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene. Science. 2003; 301: 291–293 14 Brakemeier, E.-L., Normann, C., Berger, M. (2008): Ätiologie der unipolaren Depression. Neurobiologische und psychosoziale Faktoren. Springer Medizin Verlag, Budesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz. 2008; 51:379-391 15 Bauer, J. (2002): Das Gedächtnis des Körpers: wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern. Frankfurt a.M.: Eichborn. 2002. Erweiterte Taschenbuchausgabe München: Piper. (10. Aufl. 2007) 16 Bunney, W.E., Davis, JM. (1965): Norepinephrine in depressive reactions. A review. Arch Gen Psychiatry. 1965; 13:483–494 17 Ebert, D., Lammers, C.-H. (1997): Das zentrale dopaminerge System und die Depression. Springer-Verlag, Nervenarzt. 1997; 68:545-555 18 Chen, G., Hasansat, KA., Bebchuk, JM., et al. (1999): Regulation of signal transduction pathways and gene expression by mood stabilizers and antidepressants. Psychosomatic Med. 1999; 61:599–617 19 Krishnan, V., Nestler, E.J. (2008): The molecular neurobiology of depression. Nature. 2008; 455(7215): 894-902 20 Bruce, S., McEwen, Mirsky, A.E., Hatch, H., Hatch, M.M. (2007): Physiology and neurobiology of Stress and adaption: central role of the brain. Physiol Rev. 2007; 87:873904 40 21 Pieringer, W., Fazekas, Musiol, Verlic (2011): Medizinische Psychologie (Psychosomatik und Psychotherapie). Skriptum zur Vorlesung Medizinischer Psychologie, Graz. 22 Pieringer, W., Ebner F. (2000): Zur Philosophie der Medizin. Springer, Wien. 23 Hüther, G., Krens, I. (2010): Das Geheimnis der ersten neun Monate. Unsere frühesten Prägungen. Neuaufl. Weinheim: Beltz 24 International statistical classification of diseases and related health problems, 10 th revision. Homepage im Internet, zitiert 2011, Februar 12. www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10 25 Hompage der American Psychiatric Association. 2010: DSM5 Development. www.dsm5.org/ProposedRevisions/Pages/MoodDissorders.aspx 26 First, M.B. (2010): Paradigm shift and the development of the diagnostic and statistical manual of mental disorders: past experiences and future aspirations. La Revue canadienne de Psychiatry. 2010; 55:11:692-700 27 Brody, A.L., et al. (2001): Regional brain metabolic changes in patients with major depression treated with either Paroxetin or interpersonal psychotherapy. Arch Gen Psychiatry. 2001; 58:631-640. 28 Sackheim, H.A. (2001): Functional brain circuits in major depression and remission. Arch Gen Psychiatry. 2001; 58:649-650 29 Brody, A.L., et al. (2001): Brain metabolic changes associated with symptom factor improvement in major depressive disorder.Biol. Psychiatry. 2001; 50:171-178 30 Videbech, P., Ravnkilde, B. (2004): Hippocampal Volume and Depression: A metaanalysis of MRI studies. Am J Psychiatry. 2004; 161:11:1957-1966 41 31 MacQueen, G.M., Campbell, S., McEwen, B.S., et al. (2003): Course of illness, hippocampal function, and hippocampal volume in major depression. PNAS. 2003; 100:3:1387-1392 32 Hviid, L.B., Ravnkilde, B., Ahdidan, J., et al. (2010): Hippocampal visuospatial function and volume in remitted depressed patients: An 8-year follow-up study. Journal of affective Disorders. 2010; 125:177-183 33 Duman, R.S., Heninger, G.R., Nestler, E.J., et al. (1997): A Molecular and Cellular Theory of Depression. Arch Gen Psychiatry. 1997; 54(7):597-606 34 Milne, A., MacQueen, G.M., Yucel, K., et al. (2009): Hippocampal metabolic abnormalities at first onset and with recurrent episodes of a major depressive disorder: A proton magnetic resonance spectroscopy study. Neuroimage. 2009; 47:36-41 35 Rao, U., Chen, L-A., Bidesi, A.S., et al. (2010): Hippocampal Changes Associated with Early-Life Adversity and Vulnerability to Depression. Biol Psychiatry. 2010; 67:357-364 36 Frodl, T., Meisenzahl, E.M., Zill, P., et al. (2004): Reduced Hippocampal Volumes Associated With the Long Variant of the Serotonin Transporter Polymorphism in Major Depression. Arch Gen Psychiatry. 2004; 61:177-183 37 Young, K.A., Holcomb, L.A., Yazdani, U., et al. (2004): Elevated Neuron Number in the Limbic Thalamus in Major Depression. Am J Psychiatry. 2004; 161:1270-1277 38 Victor, T.A.., Furey, M.L., Fromm, S.J., et al. (2010): Relationship Between Amygdala Responses to Masked Faces and Mood State and Treatment in Major Depressive Disorder. Arch Gen Psychiatry. 2010; 67(11):1128-1138 39 Drevets, W.C., Raichle, M.E.(1992): Neuroanatomical circuits in depression: implications for treatment mechanisms. Psychopharmacol Bull. 1992; 28(3):261-74 40 Hartlage, S., Alloy ,LB., Vázquez, C., Dykman, B. (1993): Automatic and effortful processing in depression. Psychol Bull. 1993 Mar; 113(2):247-78 42 41 Sheppard, LC., Teasdale, JD.(1996): Depressive thinking: changes in schematic mental models of self and world. Psychol Med. 1996 Sep; 26(5):1043-51 42 Hariri, AR., Bookheimer, SY., Mazziotta, JC. (2000): Modulatoring emotional response: effects of a neocortical network an the limbic system. NeuroReport. 2000; 11(1):43-48 43 Dolan, RJ., Bench, CJ., Brown, RG., Scott, LC., Frackowiak, RS. (1994): Neuropsychological dysfunction in depression: the relationship to regional cerebral blood flow. Psychol Med. 1994 Nov; 24(4):849-57 44 Silberman, EK., Weingartner, H., Post, RM. (1983): Thinking disorder in depression. Arch Gen Psychiatry. 1983 Jul; 40(7):775-80 45 Austin, MP., Mitchell, P., Wilhelm, K., Parker, G., Hickie, I., Brodaty, H., Chan, J., Eyers, K., Milic, M., Hadzi-Pavlovic, D.(1999): Cognitive function in depression: a distinct pattern of frontal impairment in melancholia? Psychol Med. 1999 Jan; 29(1):73-85 46 Elliott, R., Baker, SC., Rogers, RD., O'Leary, DA., Paykel, ES., Frith, CD., Dolan, RJ., Sahakian, BJ. (1997): Prefrontal dysfunction in depressed patients performing a complex planning task: a study using positron emission tomography. Psychol Med. 1997; 27(4):93142 47 Trichard, C., Martinot, JL., Alagille, M., Masure, MC., Hardy, P., Ginestet, D., Féline, A. (1995): Time course of prefrontal lobe dysfunction in severely depressed in-patients: a longitudinal neuropsychological study. Psychol Med. 1995 Jan; 25(1):79-85 48 Austin, M-P., Mitchell, P., Goodwin, GM. (2001): Cognitive deficits in depression: Possible implications for functional neuropathology. The British Journal of Psychiatry. 2001; 178:200-206 49 Veiel HO, V. (1997): A preliminary profile of neuropsychological deficits associated with major depression. J Clin Exp Neuropsychol. 1997 Aug;19(4):587-603 43 50 Purcell, R., Maruff, P., Kyrios, M., Pantelis, C. (1997): Neuropsychological function in young patients with unipolar major depression. Psychol Med. 1997 Nov; 27(6):1277-85 51 Channon, S., Green, PSS.(1999): Executive function in depression: the role of performance strategies in aiding depressed and non-depressed participants. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1999;66:162–17 52 Dunkin, JJ., Leuchter, AF., Cook, IA., Kasl-Godley, JE., Abrams, M., RosenbergThompson, S. (2000): Executive dysfunction predicts nonresponse to fluoxetine in major depression. Journal of Affective Disorders. 2000; 60:13 – 23 53 Alexopoulos, GS., Kiosses, DN., Klimstra, S., Kalayam, B., Bruce, ML. (2002): Clinical Presentation of the “Depression–Executive Dysfunction Syndrome” of Late Life. Am J Geriatr Psychiatry. 2002; 10:1:98-106 54 Mialet, JP., Pope, HG., Yurgelun-Todd, D. (1996): Impaired attention in depressive states: a non-specific deficit? Psychol Med. 1996 Sep;26(5):1009-20 55 McEWEN, BS., Mirsky, AE. (2007): Physiology and Neurobiology of Stress and Adaptation: Central Role of the Brain. Physiol Rev. 2007; 87: 873–904 56 Musselman, DL., Evans, DL., Nemeroff, CB. (1998): The Relationship of Depression to Cardiovascular Disease. Epidemiology, Biology, and Treatment. Arch Gen Psychiatry. 1998; 55:580-592 57 Golenhofen, K. (2004): Basislehrbuch Physiologie. Lehrbuch, Kompendium, Fragen und Antworten. 3.Auflage. Elsevier GmbH, München; 2004; 373-391 58 McEwen, BS. (2010): Epigenetic and Neuropsychiatric Diseases. Stress, sex, and neural adaptation to a changing environment: mechanisms of neuronal remodeling. New York Academy of Sciences. 2010; 1204: 38-59 44 59 Ridder, S., Chourbaji, S., Hellweg, R., Urani, A., Zacher, C., Schmid, W., Zink, M., Hörtnagl, H., Flor, H., Henn, FA., Schütz, G., Gass, P. (2005): Neurobiology of Disease. Mice with Genetically Altered Glucocorticoid Receptor Expression Show Altered Sensitivity for Stress-Induced Depressive Reactions. The Journal of Neuroscience. 2005; 25(26):6243– 6250 60 Joels, M., Pu, Z., Wiegert, O., Oitzl, MS., Krugers, HJ. (2006): Learning under stress: how does it work? Trends Cogn Sci. 2006; 10:152–158 61 Drevets, WC. (1998): Functional neuroimaging studies of depression: the anatomy of melancholia. Annu Rev Med. 1998; 49:341-61 62 Martin, SD., Martin, E., Rai, SS., Richardson, MA., Royall, R. (2001): Brain Blood Flow Changes in Depressed Patients Treated With Interpersonal Psychotherapy or Venlafaxine Hydrochloride. Preliminary Findings. Arch Gen Psychiatry. 2001; 58:641-648 63 Brody, AL., Saxena, S., Stoessel, P., Gillies, LA., Fairbanks, LA., Alborzian, S., Phelps, ME., Huang, SC., Wu, HM., Ho, ML., Ho, MK., Au, SC., Maidment, K., Baxter, LR. Jr. (2001): Regional Brain Metabolic Changes in Patients With Major Depression Treated With Either Paroxetine or Interpersonal Therapy Preliminary Findings. Arch Gen Psychiatry. 2001; 58:631-640 64 Schramm, E., van Calker, D., Dykierek, P., et al. (2007): An intensive treatment program of Interpersonal Psychotherapy plus pharmacotherapy for depressed inpatients: acute and long-term results. Am J Psychiatry. 2007; 164:768–777 65 Dunner, DL. (2001): Acute and maintenance treatment of chronic depression. J Clin Psychiatry. 2001; 62:10–16 66 Schulberg, HC., Block ,MR., Madonia, MJ., et al. (1996): Treating major depression in primary care practice. Eight month clinical outcomes. Arch Gen Psychiatry. 1996; 53(10):913–919 45 67 Gloaguen, V., Cottraux, J., Cucherat, M., Blackburn, I. (1998): A meta-analysis of the effects of cognitive therapy in depressed patients. J Affect Disord. 1998; 49(1):59–72 68 Mergl, R., Henkel, V., Allgaier, AK., Kramer, D., Hautzinger, M., Kohnen, R., Coyne, J., Hegerl, U. (2011): Are Treatment Preferences Relevant in Response to Serotonergic Antidepressants and Cognitive Behavioral Therapy in Depressed Primary Care Patients? Results from a Randomized Controlled Trial Including a Patients’ Choice Arm. Psychother Psychosom. 2011; 80:39–47 69 Goldapple, K., Segal, Z., Garson, C., Lau, M., Bieling,P., Kennedy, S., Mayberg, H. (2004): Modulation of Cortical-Limbic Pathways in Major Depression Treatment-Specific Effects of Cognitive Behavior Therapy. Arch Gen Psychiatry. 2004; 61:34-41 70 Schiepek, G. (1994): Is systemic psychotherapy research possible? Z Klin Psychol Psychopathol Psychother. 1994; 42(4):297-318 71 Beutel, M. (2009): Vom Nutzen der bisherigen neurobiologischen Forschung für die Praxis der Psychotherapie. Psychotherapeutenjournal. 2009; 4:384-392 72 Gabbard, GO. (2000): A neurobiologically informed perspective on psychotherapy. The British Journal of Psychiatry. 2000; 177: 117-122 73 Beutel, ME. (2002): Neurowissenschaften und Psychotherapie. Neuere Entwicklungen, Methoden und Ergebnisse. Psychotherapeut, Springer-Verlag. 2002; 47:1–10 74 Baxter, LR., Schwartz, JM., Phelps, ME., Mazziotta, JC., Guze, BH., Selin, CE., Gerner, RH., Sumida, RM. (1989): Reduction of prefrontal cortex glucose metabolism common to three types of depression. ArchGenPsychiatry. 1989;46:243-250 75 Martinot, J-L., Hardy, P., Feline, A., Huret, J-D., Mazoyer, B., Attar-Levy, D., Pappata, S., Syrota, A. (1990): Left prefrontal glucose hypometabolism in the depressed state: a confirmation. AmJPsychiatry. 1990;147:1313-1317 46 76 Brody, AL., Saxena, S., Silverman, DHS., Alborzian, S., Fairbanks, LA., Phelps, ME., Huang, S-C., Wu, H-M., Maidment, K., Baxter, LR. (1999): Brain metabolic changes in major depressive disorder from pre- to post-treatment with paroxetine. PsychiatryRes Neuroimaging. 1999; 91:127-139 77 Little, JT., Ketter, TA., Kimbrell, TA., Danielson, A., Benson, BE., Willis, MW., Dunn, RT., Frye, MA., Post, RM. (1997): Anterior paralimbic blood flow decreased after venlafaxine response. BiolPsychiatry. 1997;41(suppl 7):79-80 78 Little, JT., Ketter, TA., Kimbrell, TA., Danielson, A., Benson, BE., Willis, MW., Post, RM. (1996):Venlafaxine or bupropion responders but not nonresponders show baseline prefrontal and paralimbic hypometabolism compared with controls. PsychopharmacolBull. 1996; 32:629-635 79 Murphy, GM., Hollander, SB.. Rodrigues, HE., Kremer, C., Schatzberg, AF.(2004): Effects of the Serotonin Transporter Gene Promoter Polymorphism on Mirtazapine and Paroxetine. Efficacy and Adverse Events in Geriatric Major Depression. Arch Gen Psychiatry. 2004; 61:1163-1169 80 Jahn, H., Schick, M., Kiefer, F., Kellner, M., Yassouridis, A., Wiedemann, K. (2004): Metyrapone as Additive Treatment in Major Depression. A Double-blind and PlaceboControlled Trial. Arch Gen Psychiatry. 2004; 61:1235-1244 81 Rosa-Neto, P., Diksic, M., Okazawa, H., Leyton, M., Ghadirian, N., Mzengeza, S., Nakai, A., Debonnel, G., Blier, P., Benkelfat, C. (2004): Measurement of Brain Regional [11C]Methyl-L-Tryptophan Trapping as a Measure of Serotonin Synthesis in MedicationFree Patients With Major Depression. Arch Gen Psychiatry. 2004; 61:556-563 82 Berger, M., Brakemeier, EL., Klesse, C., Schramm, E. (2009): Depressive Störungen. Stellenwert psychotherapeutischer Verfahren. Springer Medizin Verlag, Nervenarzt. 2009; 80:540–555 47 83 Mufson, L., Dorta, KP., Wickramaratne, P., Nomura, Y., Olfson, M., Weissman, MM. (2004): A Randomized Effectiveness Trial of Interpersonal Psychotherapy for Depressed Adolescents. Arch Gen Psychiatry. 2004; 61:577-584 84 Schramm, E., Zobel, I., Dykierek, P., Kech, S., Brakemeier, E-L., Külz, A., Berger, M. (2011): Research report Cognitive behavioral analysis system of psychotherapy versus interpersonal psychotherapy for early-onset chronic depression: A randomized pilot study. Journal of Affective Disorders. 2011; 129:109–116 85 Keller, MB., McCullough, JP., Klein, DN. et al. (2000): A comparison of nefazodone, the cognitive behavioral-analysis system of psychotherapy, and their combination for the treatment of chronic depression. N Engl J Med. 2000; 342(20):1462–1470 86 Newnham, EA., Hooke, GR., Page, AC. (2010): Progress monitoring and feedback in psychiatric care reduces depressive symptoms. Journal of Affective Disorders. 2010; 127: 139–146 87 Teasdale, JD., Segal, ZV., Williams, JM., et al. (2000): Prevention of relapse/recurrence in major depression by mindfulness – based cognitive therapy. J Consulting Clin Psychol. 2000; 68: 615-623 88 M. Hautzinger, M. (2008): Psychotherapie der Depression. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, Springer Medizin Verlag. 2008; 51:422–429 89 Arbeitsgemeinschaft wissenschaftliche Psychotherapie. Homepage im Internet, zitiert 2011, Februar 20. www.cbasp.awp-depression.de/CBASP/index.html 90 Mc Cullough, JP. (2000): Treatment of chronic depression. Cognitive behavioural analysing system of Psychotherapy. Guilford, Press New York. 91 Thase, ME. (2006): Neuroimaging Profiles and the Differential Therapies of Depression. Arch Gen Psychiatry. 2001; 58: 631-633 48 92 Thurin, JM., Briffault, X. (2006): Distinction, limits and complementarity between efficacy and effectiveness studies: new perspectives for psychotherapy research. Encephale. 2006; 32:402-412 93 Kuyken, W., Tsivrikos, D. (2008): Therapist Competence, Comorbidity and CognitiveBehavioral Therapy for Depression. Psychother Psychosom. 2009; 78:42–48 94 Mohr, DC., Spring, B., Freedland, KE., Beckner, V., Arean, P.,. Hollon, SD., Ockene, J., Kaplan, R. (2008): The Selection and Design of Control Conditions for Randomized Controlled Trials of Psychological Interventions. Psychother Psychosom. 2009;78:275–284 95 Leichsenring, F., Rabung, S. (2011): Double Standards in Psychotherapy Research. Psychother Psychosom. 2011; 80:48–51 96 Coyne, JC., Bhar, SS., Pignotti, M., Tovote, KA., Beck, AT. (2011): Missed Opportunity to Rectify or Withdraw a Flawed Metaanalysis of Longer-Term Psychodynamic Psychotherapy. Psychother Psychosom. 2011; 80:53–54 97 Brenner, HD., Roder, V., Tschacher, W. (2006): The Significance of Psychotherapy in the Age of Neuroscience. Schizophrenia Bulletin. 2006; 32:10–11 98 Glenda M. MacQueen, GM. (2009): Magnetic resonance imaging and prediction of outcome in patients with major depressive disorder. J Psychiatry Neurosci. 2009; 34(5):343-349 99 Fava, GA. (2009): The Decline of Pharmaceutical Psychiatry and the Increasing Role of Psychological Medicine. Psychother Psychosom. 2009; 78:220–227 100 Spielmans, GI., Biehn, TL., Sawrey, DL. (2010): A Case Study of Salami Slicing: Pooled Analyses of Duloxetine for Depression. Psychother Psychosom. 2010; 79:97–106 101 Pigott, HE., Leventhal, AM., Alter, GS., Boren, JJ. (2010): Efficacy and Effectiveness of Antidepressants: Current Status of Research. Psychother Psychosom. 2010; 79:267–279 49 102 Konarski, JZ., Kennedy, SH., Segal, ZV., Lau, MA., Bieling, PJ., McIntyre, RS. , Mayberg, HS. (2009): Predictors of nonresponse to cognitive behavioural therapy or venlafaxine using glucose metabolism in major depressive disorder. J Psychiatry Neurosci. 2009; 34(3): 175-180 50 51