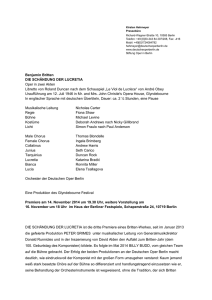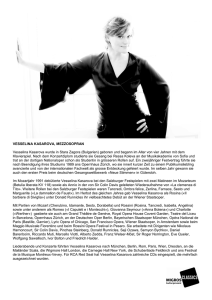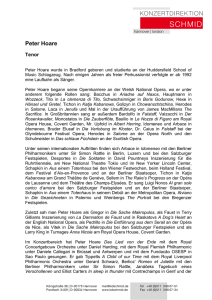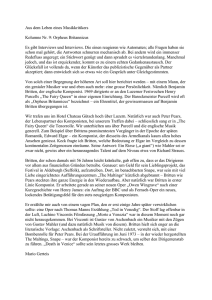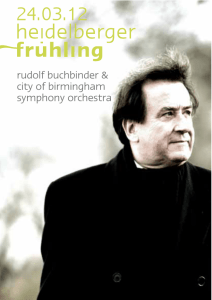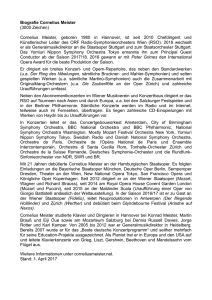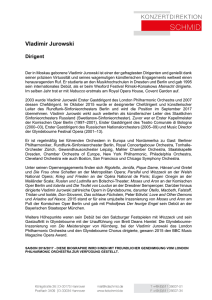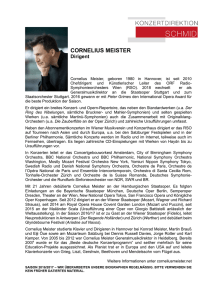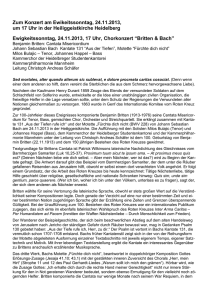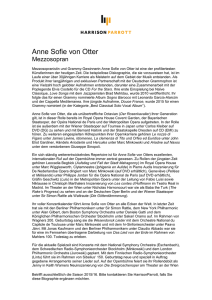Liebe, Leben und Tod 3 Benjamin Britten The Rape of Lucretia
Werbung

8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Liebe, Leben und Tod 3 Benjamin Britten The Rape of Lucretia Donnerstag 3. April 2008 20:00 Seite U1 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite U2 Bitte beachten Sie: Ihr Husten stört Besucher und Künstler. Wir halten daher für Sie an der Garderobe Ricola-Kräuterbonbons bereit und händigen Ihnen Stofftaschentücher des Hauses Franz Sauer aus. Sollten Sie elektronische Geräte, insbesondere Handys, bei sich haben: Bitte schalten Sie diese zur Vermeidung akustischer Störungen aus. Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass Bild- und Tonaufnahmen aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet sind. Wenn Sie einmal zu spät zum Konzert kommen sollten, bitten wir Sie um Verständnis dafür, dass wir Sie nicht sofort einlassen können. Wir bemühen uns, Ihnen so schnell wie möglich Zugang zum Konzert zu gewähren. Ihre Plätze können Sie spätestens in der Pause einnehmen. Sollten Sie einmal das Konzert nicht bis zum Ende hören können, helfen wir Ihnen gern bei der Auswahl geeigneter Plätze, von denen Sie den Saal störungsfrei und ohne Verzögerung verlassen können. 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 1 Liebe, Leben und Tod 3 Benjamin Britten The Rape of Lucretia Ian Bostridge Tenor (Männerchor) Emma Bell Sopran (Frauenchor) John Relyea Bassbariton (Collatinus, ein römischer General) James Rutherford Bariton (Junius, ein römischer General) Christopher Maltman Bariton (Tarquinius, Sohn des Tyrannen Superbus) Angelika Kirchschlager Mezzosopran (Lucretia, Collatinus’ Frau) Jean Rigby Mezzosopran (Bianca, Lucretias Amme) Malin Christensson Sopran (Lucia, Lucretias Zimmermädchen) Klangforum Wien Robin Ticciati Klavier und Leitung Donnerstag 3. April 2008 20:00 19:00 Einführung durch Bernd Feuchtner KölnMusik gemeinsam mit dem Konzerthaus Wien Gefördert durch das Kuratorium KölnMusik e.V. 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 2 2 Benjamin Britten 1913 – 1976 The Rape of Lucretia op. 37 (1946; rev. 1947) Kammeroper in zwei Akten Libretto von Ronald Duncan Konzertante Aufführung in englischer Sprache Pause nach dem ersten Akt gegen 20:50 Ende gegen 22:00 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 3 3 Synopsis Erster Akt 1. Bild: Tenor- und Sopranchorus, die beiden Erzähler, erläutern die Ausgangslage des Geschehens: Rom im Jahr 509 vor Christus, die Stadt wird von einem etruskischen Despoten regiert. Sein Sohn, der Etruskerprinz Tarquinius, zecht in einem Feldlager vor der Stadt mit den beiden Generälen Collatinus und Junius. Es ist ein schwül-heißer Sommerabend, und die Gespräche drehen sich um die Untreue der römischen Frauen. Am Vorabend waren mehrere Offiziere nach Rom geritten, um ihre Frauen zu überraschen und ihre Treue zu prüfen. Keine, bis auf Lucretia, Collatinus’ Gattin, hatte den »Test« bestanden. Zwischen dem Junggesellen Tarquinius und dem gehörnten Junius bricht ein Disput aus, in dessen Verlauf Junius den Prinzen anstachelt, Lucretia auf die Probe zu stellen. Collatinus schlichtet den Streit und begibt sich dann zur Ruhe – nicht ahnend, dass Tarquinius’ Gedanken obsessiv um die vermeintlich unnahbare Lucretia kreisen. Schließlich verlangt Tarquinius nach seinem Pferd. Im Zwischenspiel schildert der Tenor-Chorus Tarquinius’ Ritt nach Rom. 2. Bild: Lucretia ist in Gesellschaft ihrer alten Amme Bianca und der Dienerin Lucia, die beide am Spinnrad sitzen. Sie selbst näht und sehnt sich nach ihrem Gatten. Als die drei Frauen im Begriff sind, sich zur Ruhe zu begeben, tritt Tarquinius ein und erbittet sich in Lucretias Haus ein Nachtlager. Nur widerwillig gewährt sie ihm Gastfreundschaft und zeigt ihm ein Zimmer, wo er die Nacht verbringen könne. Zweiter Akt 1. Bild: Tenor- und Sopran-Chorus sowie andere Stimmen berichten vom wachsenden Widerstand der römischen Bevölkerung gegen den etruskischen Herrscher. Tarquinius schleicht sich in Lucretias Schlafgemach, weckt sie mit einem Kuss und versucht sie zu verführen. Sie weist ihn 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 4 4 ab, aber er lässt nicht locker, wird immer zudringlicher und vergewaltigt sie schließlich. Im Zwischenspiel kommentieren Tenor- und Sopran-Chorus aus christlicher Sicht die Anfechtung der Tugend durch die Sünde. 2. Bild: Am nächsten Morgen schmücken Bianca und Lucia das Haus mit Blumen. Lucretia verlangt, nach ihrem Mann zu schicken. Aufgrund von Junius’ Andeutungen hat Collatinus bereits dunkle Ahnungen. Er kommt dem Boten zuvor und begibt sich umgehend nach Rom. Tief verstört und gedemütigt tritt Lucretia ihm im Trauergewand gegenüber und erzählt, was ihr widerfahren ist. Ihr Mann versucht sie zu trösten, doch trotz seines Verständnisses kann Lucretia ihre Schande nicht ertragen. Sie sieht keinen anderen Ausweg als den Tod und ersticht sich vor Collatinus’ Augen. Epilog: Tenor- und Sopran-Chorus forschen nach dem Sinn dieser Tragödie und verweisen auf die Erlösung Christi durch das Kreuz. 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 5 5 Benjamin Britten: The Rape of Lucretia op. 37 »Ich bin in erster Linie und am meisten Künstler, und als Künstler will ich der Gemeinschaft dienen, nichts ins Leere hineinschreiben. Ich finde es als Komponist wertvoll, zu wissen, wie die Zuhörer auf die Musik reagieren«, bemerkte der britische Komponist Benjamin Britten auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Dass er »in erster Linie Künstler« werden sollte, zeichnete sich schon früh ab. Klavierunterricht erhielt er von seiner Mutter; im Alter von fünf Jahren begann er zu komponieren, und indem er den Alltag seiner Familie in Klang widerzuspiegeln versuchte, deutete sich an, was für Brittens gesamtes Wirken charakteristisch wurde: das Leben in seiner ganzen Breite in die schöpferische Arbeit zu integrieren und auf das Publikum zuzugehen, statt im Elfenbeinturm der »Avantgarde« zu entschwinden. 14-jährig wurde er dem Komponisten Frank Bridge vorgestellt, der sich als idealer Lehrer erwies. Bridge ließ ihm die Freiheit zum Experimentieren, achtete aber stets penibel auf ideelle Glaubwürdigkeit und kompositionstechnischen Anspruch – was Britten, der seine Ausbildung bei Ralph Vaughan Williams am konservativ geprägten Royal College of Music als weit weniger fruchtbar empfand, zeitlebens zu schätzen wusste: »Durch seinen [Bridges] Ekel vor aller Schlampigkeit und Unprofessionalität gab er mir Maßstäbe an die Hand, die ich niemals vergessen habe.« Maßstäbe in jeder Hinsicht setzte Britten auch mit seiner ersten Kammeroper The Rape of Lucretia op. 37. Er schrieb sie 1946 im Alter von 33 Jahren; kurz nach Peter Grimes, einer »großen Oper«, die auf enorme Resonanz stieß und ihm den Ruf eines »Orpheus Britannicus« einbrachte. Gleichwohl erkannte Britten, dass sich hohe szenentechnische Anforderungen wie in Peter Grimes vor dem Hintergrund der Situation der englischen Oper, die ohne öffentliche Subventionen auskommen musste, kaum mehr realisieren ließen, zumal er Gastspiele in zahlreichen Städten anstrebte. So schuf Britten mit The Rape of Lucre- tia ein Werk für lediglich acht Gesangssolisten, die auch chorische Aufgaben übernehmen, und zwölf Instrumentalisten. Die Uraufführung fand am 12. Juli 1946 in Glyndebourne, im Kammertheater des millionenschweren Mäzens John Christie, statt – und sie geriet zur Initialzündung für die Gründung der English Opera Group, die Britten ein Jahr später mit ins Leben rief und der er bis zu seinem Tod im Dezember 1976 verbunden blieb. Das Uraufführungsensemble von Glynde- 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 6 6 bourne, zu dem auch der Tenor Peter Pears gehörte, bildete den Kern für diese reisende Truppe, die am 17. Oktober 1947 im Londoner Covent Garden-Theatre bereits die 100. Aufführung von The Rape of Lu- cretia feiern durfte. »Ins Leere hinein« hat Britten seine Kammeroper also wahrlich nicht komponiert. Indes, es gab neben dem pragmatischen Ansatz auch triftige künstlerische Gründe für die kleine Besetzung. Schließlich knüpfte Britten solcherart an die Reduktion des bombastischen, spätromantischen Orchesterapparates zugunsten kammermusikalischer Stringenz nach dem Vorbild von Arnold Schönbergs erster Kammersinfonie op. 9 (1906) an, an der sich viele Komponisten des 20. Jahrhunderts schöpferisch orientierten. Nun wäre eine Musikalisierung des tragischen Schicksals Lucretias gewiss auch im schwerblütigen Orchestergewand vorstellbar. Gerade in der klanglichen Zuspitzung eines Solistenensembles erfährt es jedoch markante Wirkung, zumal Britten mit virtuoser und höchst variabler Instrumentierung das ganze Spektrum von fast tonloser Begleitung über harsche Akzentuierung bis zu überraschend satter Klangfülle erschloss. Das Sujet des Werks reicht über Shakespeare bis zu den römischen Dichtern und Geschichtsschreibern Ovid und Livius zurück. Sehr beliebt war die Titelfigur vor allem in der Renaissance und im Frühbarock. Als Sinnbild konsequentester Keuschheit und Strenge der Sexualmoral, die trotz subjektiver Schuldlosigkeit nach der Schändung kein Weiterleben duldet, zieht sie sich durch die Kulturgeschichte. Und indem Britten einen in der Antike angesiedelten Stoff mit christlich eingefärbten Kommentaren versah – was oft als widersprüchlich kritisiert wurde –, trug er dem Umstand Rechnung, dass viele antike Motive unter christlichen Vorzeichen umgedeutet wurden. Angelegt ist dies im Libretto von Ronald Duncan, der freilich eng mit dem Komponisten zusammenarbeitete. Nur acht Monate waren seit dem Vorschlag des Regisseurs Eric Crozier, sich der »Lucretia« anzunehmen, bis zur Uraufführung vergangen. Als Vorlage griff Duncan auf André Obeys Schauspiel Le viol de Lucrèce von 1931 zurück, in dem die Konstellation mit einem »Chorus« aus zwei Erzählern bereits vorgeprägt ist. In The Rape of Lucretia ist deren Funktion allerdings noch erheblich erweitert, indem Tenor- und Sopransolist (Male and Female Chorus) das Drama aktiv steuern, sich mit den Protagonisten identifizieren und 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 7 7 – im Spannungsfeld aus Nähe und Distanz – das Geschehen sowohl emotional verdichten als ihm auch eine mythische, überzeitliche Dimension verleihen. Brittens Forderung, das Libretto müsse »einfach, knapp und kristallklar« sein, wurde Duncan gerecht, ohne die »Macht des Wortes« als Anstoß für musikalisch-sinnliche Interpretation zu unterschätzen. Der Anfang des Werks führt dies sogleich eindringlich vor Ohren: Nachdem der »Chor« den Ausgangspunkt der Handlung skizziert und seine eigene Rolle definiert hat, verwandelt sich die reflexive Ebene unmittelbar in szenische Schilderung – und die unheilvolle Atmosphäre eines schwülen und gewittrigen Abends geht vom Text auf die Musik über. Vage sind in ostinaten Harfenfigurationen zirpende Grillen und in gezupften Glissandi des Kontrabasses quakende (Ochsen-) Frösche auszumachen, während das Stampfen der Pferde, von dem ebenfalls die Rede ist, zunächst unberücksichtigt bleibt. Die gespannte Klanglichkeit ruft vor dem geistigen Auge ein traumhaft-düsteres Stimmungsbild hervor, in dem Tarquinius’ Fantasien ebenso aufscheinen wie die fernen, verlockenden (Fackel-) Lichter Roms. Eingeflochten sind auch dramatische Signale, etwa wenn eine einzige schneidende Phrase der Holzbläser die Schreckensherrschaft des etruskischen Emporkömmlings, unter der die Stadt leidet, zum Ausdruck bringt. Die Mittel, die Britten in dieser Eröffnungsszene wie in der Oper überhaupt aufwendete, sind vielschichtig und strahlen auf seine künstlerische Identität zurück. Als bekennender »Eklektiker« gehörte er nie zur Speerspitze der so genannten »Avantgarde«. Seine Anleihen an die klassisch-romantische Tonsprache sind aber von spezifischen Farben und Stilelementen des 20. Jahrhunderts durchdrungen. Wie kaum ein anderer verstand er es, musikalische Anregungen aufzusaugen, ohne sein eigenes Gesicht zu verlieren. Von Richard Wagner übernahm er die Leitmotivtechnik, die er indes samt psychologisierender Vertiefung seinen Bedürfnissen anpasste. Vertraut war ihm auch der »impressionistische« Klangzauber eines Claude Debussy, der in seinem Schaffen – wohl dosiert und doch bis an seine Grenzen ausgereizt – Widerhall fand. So sind in The Rape of Lucretia unterschiedliche Bausteine und Einflusssphären vereinigt, die sich dennoch zu einem höchst individuell ausgestalteten musikalischen Universum formieren. 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 8 8 Ein weiteres zentrales Moment im Klangkosmos dieser Kammeroper ist das »Lokalkolorit«, realisiert zumal in der »Schlafmusik« ( Alle- gretto comodo) im zweiten Akt. Britten komponierte als »Schlafmusik« ein archaisierendes Wiegenlied (Lullaby), das an die englische Musik des 16. Jahrhunderts gemahnt. Bereits in der instrumentalen Einleitung unterstreichen Bassflöte, gedämpftes Horn und Bassklarinette den »altertümlichen« Klangcharakter. Die hohe Bedeutung der »Schlafmusik« für Britten lässt sich allein schon daran ermessen, dass sie nicht nur kurz vor der Vergewaltigung Lucretias durch Tarquinius, der sich der Schlafenden nähert, zitatartig wieder anklingt, sondern auch bevor Lucretia ihrem Ehemann Collatinus berichtet, was passiert ist. Zwar repräsentiert sie die wohl direkteste Verbindung zu alter englischer Musik in dem Werk. Britten schlägt aber in dramatischem Gestus und Intensität der lyrischen Empfindungen auch den Bogen zu Henry Purcell (1659 – 1695) und dessen Oper Dido and Aeneas. Ferner sind Zusammenhänge mit dem englischen Madrigalismus offensichtlich, die vor allem im Personalmotiv des Etruskerprinzen und Vergewaltigers Tarquinius hervorstechen. Die fallende Tonskala es-d-c-h, die ihm zugeordnet ist, ist identisch mit dem Beginn eines von John Dowland 1597 komponierten Lautenliedes, dessen Text mit sanften, ruhigen Worten die Hoffnung auf Liebe thematisiert. Ob diese Anspielung im Kontext von Tarquinius’ Tat zynisch gemeint ist, sei dahingestellt. Innermusikalisch verweist das Personalmotiv auf die strenge strukturelle Disposition der Kammeroper, die sich aus wenigen, eng verzahnten Keimzellen entfaltet. Das Terz-Intervall versinnbildlicht das weibliche Element (Lucretia) und seine Verknüpfung mit fallender (oder auch steigender) Stufenmelodie die männliche Seite. Britten bediente sich aber auch des Kunstgriffs, beide Sphären zu einem choralartigen Hymnus zu vereinen, der immer dann erklingt, wenn weiblicher und männlicher Chorus aus christlicher Perspektive kommentieren. Solcherart wird der christliche Versöhnungsgedanke spitzfindig auf die Aussöhnung der Geschlechter übertragen, die vom Geschehen und dessen Folgen indes krass konterkariert wird. Schließlich ist es um »Versöhnung« gerade in Kriegszeiten schlecht bestellt. Gewiss nicht zufällig befasste sich Britten unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs mit diesem Stoff, der als Plädoyer auch an die Verteidigung der Menschenwürde appelliert. Von seiner Brisanz hat The 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 9 9 Rape of Lucretia allerdings bis heute nichts verloren, denn der Zusammenhang von Krieg und Vergewaltigung ist immer noch von brennender Aktualität. Mit welch hochgradiger Ausdifferenzierung sich Britten des Themas annahm und wie viel dramatisches Potenzial er dem stark reduzierten musikalischen Material entlockte, kann an mannigfaltigen Details abgelesen werden – etwa wenn der männliche Chorus im Form eines Melodrams mit rhythmisch fixierter Sprechstimme Tarquinius’ Weg an Lucretias Bett beschreibt, und die instrumentale Begleitung dieser Szene allein dem »barbarisch« anmutenden Schlagzeug obliegt; dann das durch »gierige« Synkopen geprägte knappe Duett von Lucretia und Tarquinius, in dem sie sich verweigert und das mit ihrer Vergewaltigung endet. Dieser Katastrophe folgt die Fokussierung auf den Trauermarsch, der freilich zwei ganz unterschiedliche Erscheinungsformen zeitigt. Der erste ist wiederum ein Duett, nun von Collatinus und Lucretia, das Britten nach dem Vorbild der barocken Klagearie baute und das von einem gefühlvoll konzertierenden Englischhorn eingeleitet wird. Der zweite Trauermarsch schließt sich dem Selbstmord Lucretias an und ist als Passacaglia mit 14 Variationen konzipiert. Die Einbindung dieser altehrwürdigen musikalischen Form in einen musikdramatischen Zusammenhang konnte der Komponist in Alban Bergs Wozzeck und Paul Hindemiths Cardillac beobachten; vor allem Wozzeck gilt noch heute als Referenzwerk des Musiktheaters des 20. Jahrhunderts. Auch Britten war von Bergs Oper nachhaltig beeindruckt, für ihn war Wozzeck aber nur ein Orientierungspunkt unter vielen, ja, The Rape of Lucretia stellt gerade den Versuch dar, klanglichstilistische Widersprüche, ohne ihre Gegensätze zu kaschieren, zwingend zueinander in Beziehung zu setzen. Insofern ist diese Kammeroper ein Schlüsselwerk im Schaffen Brittens, der es selbst als sein »Lieblingsstück« bezeichnete. Das war indes nicht von Anfang an so, denn nach der Uraufführung hatte er einige Teile der Partitur revidiert, ganze Nummern gestrichen, neue hinzukomponiert und vermeintliche Längen eliminiert. Britten fand es eben nicht nur »wertvoll, zu wissen, wie die Zuhörer auf seine Musik reagieren«, sondern er hörte sich vor allem selbst kritisch zu und zog seine künstlerischen Konsequenzen daraus. Egbert Hiller 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 10 10 Ian Bostridge Ian Bostridge studierte Geschichte, bevor er sich seiner Karriere als Sänger widmete. Regelmäßig tritt er in den international bedeu tendsten Konzerthäusern sowie bei den Festivals in Salzburg, Edinburgh, München, Wien und Aldeburgh auf. Als Opernsänger war er u. a. an der English National Opera, am Royal Opera House, an der Wiener Staatsoper, an der Bayerischen Staatsoper und in New York zu hören. In Konzerten arbeitete er u. a. mit den Berliner Philhar moni kern, den Wiener Philharmonikern, dem Boston und dem Chicago Symphony Orchestra, dem London Symphony Orchestra, dem London Philharmonic, dem BBC Symphony Orchestra, dem New York Philharmonic, dem Los Angeles Philharmonic und dem Königlichen Concertgebouw orchester Amsterdam sowie unter Dirigenten wie Sir Simon Rattle, Sir Colin Davis, Sir Andrew Davis, Seiji Ozawa, Riccardo Muti, Mstislaw Rostropovich, Philippe Herreweghe, Daniel Barenboim, James Levine, Daniel Harding und Antonio Pappano. Seine Aufnahme von Brittens The Turn of the Screw wurde 2003 mit einem Gramophone Award ausgezeichnet. Zuletzt hat Ian Bostridge zusammen mit dem Orchestra of the Age of Enlightenment unter Harry Bicket eine CD mit Händel-Arien aufgenommen. Ian Bostridge wurde u. a. mit dem Ehrendoktortitel der University of St. Andrews und der Ernennung zum Commander of the British Empire ausgezeichnet. In der Kölner Philharmonie war er zuletzt im September 2007 zu Gast. 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 11 11 Emma Bell Emma Bell erhielt ihre Ausbildung an der Royal Academy of Music und am National Opera Studio sowie anschließend bei Joy Mammen. Sie ist Preisträgerin des Kathleen Ferrier Prize 1998 und wurde 1999 von der BBC in die Reihe New Generation aufgenommen. 2002 erhielt sie ein Engagement an der Komischen Oper in Berlin. In Rollen wie Rodelinda, Vitellia, Leonore, Violetta, dem Frauenchor in The Rape of Lucretia und der Gouvernante in Brittens The Turn of the Screw war sie an namhaften Opernhäusern zu hören, so u. a. in Paris am Théâtre du Chatelet, an der Mailänder Scala, am Barbican, an der English National Opera, am Royal Opera House in London, in Bilbao, Lausanne und Genf. Jüngst sang sie die Titelrolle in Händels Alcina in Paris. Ihre Konzertauftritte, bei denen sie mit Dirigenten wie Andrew Davis, William Christie, Sir Charles Mackerras, Antonio Pappano und Leonard Slatkin zusammenarbeitete, führten sie darüber hinaus u. a. in die Londoner Wigmore Hall, ins New Yorker Lincoln Center, zu den BBC Proms und zum Mostly Mozart Festival. Emma Bell wirkte u. a. an der CD-Einspielung von Händels Saul unter René Jacobs mit und veröffentliche zwei Solo-CDs mit Liedern von Richard Strauss, Joseph Marx und Bruno Walter sowie Opern-Arien von Händel. In der Kölner Philharmonie gibt sie heute ihr Debüt. 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 12 12 John Relyea John Relyea, der 2003 den Richard Tucker Award gewann, zählt zu den international herausragenden Bass-Baritonen. Als Opernsänger gastierte er u. a. an der Metropolitan Opera in New York, an den Opernhäusern von San Francisco, Santa Fe, Seattle, am Royal Opera House in London, in Paris, an der Bayerischen Staatsoper in München und an der Wiener Staatsoper. Er verkörperte u. a. den Figaro in Le nozze di Figaro, den Raimondo in Lucia di Lammermoor, Giorgio in I Puritani , Escamillo in Carmen , Don Basilio in Il barbiere di Siviglia, Colline in La Bohème , die Titelrolle in Herzog Blaubarts Burg und Garibaldo in Rodelinda . In Konzerten sang er u. a. mit Klangkörpern wie dem New York Philharmonic, dem Cleveland Orchestra, den Sinfonieorchestern von Boston, Pittsburgh, Minnesota, Atlanta und Montreal, dem Israel Philharmonic, dem Philharmonia Orchestra und den Berliner Philharmonikern. Zu den Dirigenten, mit denen er arbeitete, zählen Harry Bicket, Sir Colin Davis, Christoph von Dohnányi, Christoph Eschenbach, Bernard Haitink, Mariss Jansons, James Levine, Lorin Maazel, Sir Charles Mackerras, Sir Neville Marriner, Zubin Mehta, Sir Roger Norrington, Seiji Ozawa, Antonio Pappano, Sir Simon Rattle, Donald Runnicles, Esa-Pekka Salonen und Wolfgang Sawallisch. Zuletzt nahm er zusammen mit Sir Simon Rattle und dem City of Birmingham Symphony Orchestra Mahlers achte Sinfonie auf. Bei uns war er zuletzt im Januar 1999 zu Gast. 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 13 13 James Rutherford James Rutherford wurde in Norwich geboren und studierte zunächst Theologie, bevor er am Royal College of Music und am National Opera Studio in London seine Ausbildung als Sänger begann. Mit mehreren Stipendien und Preisen ausgezeichnet, wurde er im Jahr 2000 BBC New Generation Artist. 2006 gewann er den internationalen Wagner-Wettbewerb der Seattle Opera. Engagements als Opernsänger führten ihn nach Paris, London, Berlin, Wales, Montpellier, Innsbruck und Chicago. Auf der Konzertbühne trat er u. a. mit dem BBC Symphony Orchestra und Leonard Slatkin, dem BBC National Orchestra of Wales, dem London Symphony Orchestra und Sir Colin Davis, dem Royal Scottish National Orchestra, den Berliner Philharmonikern, dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR und dem Orchestra of the Age of Enlightenment auf. Seine Liederabende führten ihn u. a. in die Londoner Wigmore Hall, in die Bridgewater Hall in Manchester und zu den internationalen Festivals in Bath, Buxton und Chester sowie auf die Isle of Man. Zu den Rollen dieser Saison gehören u. a. der Wolfram ( Tannhäuser ) in San Francisco und Lotario in Händels Flavio zusammen mit der Academy of Ancient Music. Seine aktuellen Konzertengagements umfassen u. a. Brahms Ein Deutsches Requiem mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra, Brittens War Requiem in Stockholm sowie Konzerte mit dem Scottish Chamber Orchestra unter Sir Charles Mackerras und dem dem Hallé Orchestra Manchester unter Mark Elder. Bei uns war er zuletzt im November 2006 zu Gast. 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 14 14 Christopher Maltman Christopher Maltman, Gewinner des Lieder-Preises beim BBC Cardiff Singer of the World 1997, studierte Biochemie an der Warwick University sowie Gesang an der Royal Academy of Music. Als Opernsänger sang er u. a. am Royal Opera House in London, beim Glyndebourne Festival, an der Bayerischen Staatsoper in München und an der Deutschen Staatsoper in Berlin, beim Aldeburgh Festival, an der English National Opera, an der Welsh National Opera, an den Opernhäusern in Wien und Turin sowie an der Metropolitan Opera New York, in San Francisco, Seattle und San Diego. Zu seinen Rollen zählten dabei u. a. Papageno ( Die Zauberflöte ), Guglielmo ( Così fan tutte), Ramiro (L’heure espagnole), Malatesta (Don Pasquale), die Rolle des Sebastian in der Uraufführung von Thomas Adès’ The Tempest , Figaro und Graf Almaviva (Le nozze di Figaro), Sid ( Albert Herring ), Tarquinius ( The Rape of Lucretia ), Guglielmo, Marcello ( La Bohème ), Albert ( Werther ), Aeneas ( Dido and Aeneas ) und der Figaro in Il barbiere di Siviglia . Christopher Malman gab Liederabende bei den Festivals in Aldeburg, Edinburgh und Cheltenham, im Wiener Konzerthaus, im Concertgebouw Amsterdam, im Mozarteum Salzburg, an der Alten Oper Frankfurt, in der Carnegie Hall und im Lincoln Center in New York, in der Londoner Wigmore Hall sowie bei der Schubertiade Schwarzenberg Hohenems. Auf CD erschienen u. a. Schumanns Dichterliebe und der Liederkreis op. 24. Bei uns war er zuletzt im März 2004 mit einem Liederabend zu Gast. 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 15 15 Angelika Kirchschlager Die in Salzburg geborene Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager zählt zu den führenden Sängerinnen ihres Fachs und ist im Opernwie im Konzertbereich auf allen großen Bühnen zu Hause. Einen besonderen Namen machte sie sich als Mozart-Interpretin, aber auch als Octavian in Strauss’ Rosenkavalier oder in der Titelpartie von Nicholas Maws Sophie’s Choice sorgte sie für Furore. Im Juni 2007 wurde sie zur aktuell jüngsten Kammersängerin der Wiener Staatsoper ernannt. Wichtige Dirigenten in ihrer Karriere waren und sind Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Claudio Abbado, Sir Colin Davis, James Levine, Kurt Masur, Kent Nagano, Donald Runnicles und Sir Simon Rattle. Sie sang an Häusern wie der Mailänder Scala, dem Royal Opera House in London, der Metropolitan Opera in New York, der Opéra Bastille in Paris, der Wiener und der Münchner Staatsoper, der Deutschen Oper Berlin, der San Francisco Opera, im Salle Pleyel und in der Cité de la Musique in Paris, in der Avery Fisher und der Carnegie Hall in New York, in der Boston Symphony Hall, im Barbican Centre und in der Wigmore Hall in London. Im Sommer 2007 erschien ein Operettenalbum, auf dem sie an der Seite von Simon Keenlyside zu hören ist. Im November erschien ihre CD Angelika Kirchschlager singt Weihnachtslieder . Ihre CD-Aufnahmen erhielten u. a. dreimal den ECHO Klassik sowie einen Grammy Award. Bei uns war sie zuletzt im Oktober 2007 zu Gast. 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 16 16 Jean Rigby Jean Rigby studierte an der Birmingham School of Music und anschließend an der Royal Academy of Music bei Patricia Clarke. Seit langem ist sie der English National Opera eng verbunden. Regelmäßig gastiert sie beim Glyndebourne Festival, wo sie u. a. die Irene ( Theodora ), Genevieve (Pelleas et Melisande ), Eduige ( Rodelinda ) und die Emilia ( Otello ) sang. Am Royal Opera House in London verkörperte sie Nicklausse und Dryade in Ariadne auf Naxos . Beim Buxton Festival sang sie die Isabella (L’Italiana in Algeri) und an der Garsington Opera die Angelina (La Cenerentola ) und Idamantes ( Idomeneo ). Darüber hinaus führten sie Engagements an die Nederlandse Opera, an die Vlaamse Opera sowie an die Opernhäuser in Seattle und San Diego. In jüngerer Zeit sang sie u. a. in Waltons Troilus and Cressida mit dem Philharmonia Orchestra, Mahlers zweite Sinfonie mit dem Royal Philharmonic Orchestra sowie am Théâtre du Chatelet die Eduige in Rodelinda. Als Konzertsängerin tritt sie regelmäßig bei den BBC Promenade Concerts auf. In jüngerer Zeit arbeitete sie mit Dirigenten wie Sir Neville Marriner, Trevor Pinnock, Mikhail Pletnev, Robert King, Sir Andrew Davis, Sir Charles Mackerras und Leonard Slatkin zusammen. Ihre Diskographie umfasst u. a. auch die Titelrolle von The Rape of Lucretia , Mahlers Das Lied von der Erde sowie Bergs Wozzeck . In der Kölner Philharmonie war sie zuletzt im Mai 1996 zu Gast. 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 17 17 Malin Christensson Die schwedische Sopranistin Malin Christensson schloss 2002 ihr Studium am Royal College of Music ab und setzte anschließend ihre Studien an der Benjamin Britten International Opera School fort. Zurzeit studiert sie bei Lillian Watson. In der Saison 2005/06 gab sie als Barbarina (Le nozze di Figaro) ihr Debüt bei Glyndebourne on Tour und sang unter der Leitung von Daniel Harding die Papagena in Wien und beim Festival in Aix-en-Provence. 2007 sang sie in Aixen-Provence unter Daniel Harding die Susanna ( Le nozze di Figaro). Zudem gab sie als Blumenmädchen in Parsifal ihr Debüt am Royal Opera House. Als Konzertsängerin arbeitete sie u. a. mit dem Orchestra of the Age of Enlightenment unter René Jacobs, mit dem sie in Paris, London und New York Händels Solomon aufführte. In Stockholm sang sie mit Sveriges Radios Symfoniorkester in Schumanns Das Paradies und die Peri. Malin Christensson gab Liederabende in der Londoner Wigmore Hall, bei den Festivals in Innsbruck, Bath und Oxford sowie in Spanien, begleitet von Roger Vignoles und Malcolm Martineau. Mit dem Trio Sonore unternahm sie eine Konzertreise durch Schweden. Auf dem Podium der Kölner Philharmonie ist sie heute zum ersten Mal zu hören. 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 18 18 Klangforum Wien Das Klangforum Wien wurde 1985 von Beat Furrer als Solistenensemble für zeitgenössische Musik gegründet. Es besitzt einen Kern von 24 Mitgliedern, die ein Mitspracherecht bei allen wichtigen künstlerischen Entscheidungen haben. Zentral für das Selbstverständnis der Musiker und Musikerinnen ist die gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen Interpreten, Dirigenten und Komponisten, ein Miteinander-Arbeiten, das traditionell-hierarchische Strukturen in der Musikpraxis ablöst. Hinzu kommt die intensive Auseinandersetzung mit unterschiedlichen ästhetischen Facetten des zeitgenössischen Komponierens, um so auch ein Forum authentischer Aufführungspraxis für die Werke der Moderne zu schaffen. Das Repertoire des Klangforums Wien umfasst eine große stilistische Vielfalt und zielt auf die Präsentation aller zentralen Aspekte der Musik unseres Jahrhunderts – von den bedeutenden Werken der klassischen Moderne, besonders der Zweiten Wiener Schule, über Werke junger, vielversprechender Komponisten und Komponistinnen bis hin zu experimentellem Jazz und freier Improvisation. Das Klangforum Wien veranstaltet regelmäßig Komponistenworkshops und verfolgt musikdidaktische Aktivitäten. Einmal jährlich richtet es einen programmatisch ambitionierten Zyklus im Wiener Konzerthaus aus. Daneben wirkt das Ensemble an Musiktheater-, Film- und Fernsehproduktionen sowie CD-Einspielungen mit. Seit 1997 ist Sylvain Cambreling Erster Gastdirigent des Klangforums Wien. Bei uns war das Klangforum Wien zuletzt im April 2007 im Rahmen der MusikTriennale Köln zu Gast. Das Klangforum Wien spielt mit freundlicher Unterstützung von Erste Bank. 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 19 Die Besetzung des Klangforums Wien Eva Furrer Flöten Markus Deuter Oboe, Englischhorn Bernhard Zachhuber Klarinetten Christoph Walder Horn Sophie Schafleitner Violine Annette Bik Violine Andrew Jezek Viola Benedikt Leitner Violoncello Ciro Vigilante Kontrabass Virginie Tarrête Harfe Björn Wilker Schlagwerk Robin Ticciati Leitung und Klavier 10:10 Uhr Seite 19 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 20 20 Robin Ticciati Robin Ticciati, seit dieser Spielzeit bereits in seinem zweiten Jahr Musikdirektor des Gävle Symfoniorkester, wurde in London geboren und erlernte zunächst das Spiel auf der Violine, auf dem Klavier und dem Schlagzeug, bevor er im Alter von 15 Jahren – noch als Mitglied des National Youth Orchestra of Great Britain – zum Dirigieren wechselte. Seine Lehrer waren dabei Sir Colin Davis und Sir Simon Rattle. 2002 erhielt er die Arthur-Belgin-Medaille und 2005 ein Stipendium des Borletti-Buitoni Trust. Bereits während seiner Studien an der St. Pauls School dirigierte er die John Colet Singers. Schnell folgten Engagements von Orchestern wie der Sächsischen Staatskapelle Dresden, Göteborgs Symfoniker, dem Royal Liverpool Philharmonic, der Northern Sinfonia, dem Orchestra of the Age of Enlightenment, der Accademia Nazionale di Santa Cecilia sowie Opernaufführungen in Stuttgart, Zürich und Klagenfurt. Mit seinem Debüt beim Orchester der Mailänder Scala im Jahr 2005 war er der jüngste Dirigent an diesem Opernhaus. Im Sommer 2006 dirigierte er in Salzburg Mozarts Il sogno di Scipione – der Mitschnitt erschien auf CD. In der vergangenen Saison gab er neben erneuten Einladungen des Orchesters der Mailänder Scala, der Bamberger Symphoniker und des Royal Liverpool Philharmonic seine Debüts beim Gewandhausorchester Leipzig und beim BBC Philharmonic Orchestra. Im vergangenen Herbst leitete er Verdis Macbeth in Glyndebourne. In der Kölner Philharmonie dirigiert er heute zum ersten Mal. 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 21 21 KölnMusik-Vorschau Sonntag 06.04.2008 16:00 Donnerstag 10.04.2008 20:00 Rising Stars – die Stars von morgen 6 Nominiert von der Cité de la Musique, Paris Piano 5 Trio Chausson Joseph Haydn Klaviertrio Nr. 27 C-Dur Hob. XV:27 Johannes Brahms Klaviertrio Nr. 2 C-Dur op. 87 Mitsuko Uchida Klavier Franz Schubert Sonate für Klavier c-Moll D 958 György Kurtág Játékok (Auswahl) York Bowen Klaviertrio e-Moll op. 118 Johann Sebastian Bach Contrapunctus I aus: Die Kunst der Fuge BWV 1080 Ernest Chausson Klaviertrio g-Moll op. 3 Sarabande aus: Französische Suite Nr. 5 G-Dur BWV 816 Die Reihe wird gefördert durch die Europäische Kommission Robert Schumann Zwölf sinfonische Etüden op. 13 15:00 Einführung in das Konzert durch Bjørn Woll in Zusammenarbeit mit Fono Forum Sonntag 06.04.2008 20:00 Klassiker! 4 Chamber Orchestra of Europe Pierre-Laurent Aimard Klavier und Leitung Freitag 11.04.2008 20:00 Jazz-Abo Soli & Big Bands 5 Philharmonie für Einsteiger 5 Louis Sclavis cl Médéric Collignon tp, voc Vincent Courtois cello Hasse Poulsen g Joseph Haydn Konzert für Klavier und Orchester G-Dur Hob. XVIII:4 Mittwoch 16.04.2008 20:00 Sinfonie Es-Dur Hob. I:22 »Der Philosoph« Die Kunst des Liedes 6 György Ligeti Ramifications für 12 Solostreicher John Mark Ainsley Tenor Roger Vignoles Klavier Wolfgang Amadeus Mozart Konzert für Klavier und Orchester Nr. 23 A-Dur KV 488 Benjamin Britten Winter Words op. 52 19:00 Einführung in das Konzert durch Bjørn Woll in Zusammenarbeit mit Fono Forum Canticle I »My beloved is mine« op. 40 Franz Schubert Ganymed D 544 Atys D 585 Mittwoch 09.04.2008 20:00 Köln-Zyklus der Wiener Philharmoniker 2 Wiener Philharmoniker Riccardo Muti Dirigent Joseph Haydn Sinfonie Es-Dur Hob. I:99 »10. Londoner« Anton Bruckner Sinfonie Nr. 2 c-Moll WAB 102 KölnMusik gemeinsam mit der Westdeutschen Konzertdirektion Köln – Kölner Konzert Kontor Heinersdorff Die Götter Griechenlands D 677 u. a. Zu diesem Konzert findet in Schulen ein Jugendprojekt der KölnMusik statt. Gefördert vom Kuratorium KölnMusik e.V. 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 22 22 Ihr nächstes Abonnement-Konzert Donnerstag 17.04.2008 12:30 Liebe Konzertbesucher, PhilharmonieLunch mit dem heutigen Konzert endet Ihr Abonnement »Liebe, Leben und Tod«. Für die kommende Saison haben wir ein attraktives Nachfolge-Abonnement aufgelegt, das wir »Konzertant« genannt haben. Darin haben Sie die Möglichkeit wiederum ausgezeichnete Interpreten in dramatischen Werken zu erleben. WDR Sinfonieorchester Köln Jukka-Pekka Saraste Dirigent KölnMusik gemeinsam mit dem WDR Sinfonieorchester Köln Sonntag 20.04.2008 16:00 Sonntags um vier 4 Serge Zimmermann Violine Münchener Kammerorchester Alexander Liebreich Dirigent Felix Mendelssohn Bartholdy Die Hebriden op. 26 Konzert für Violine und Orchester e-Moll op. 64 Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Spielzeit als Abonnenten begrüßen zu können! Weitere Einzelheiten zu dieser Reihe entnehmen Sie bitte unserer neuen Vorschau »Kölner Philharmonie 2008/2009«, die am 9. Mai 2008 erscheinen wird. In der neuen Vorschau finden Sie neben den Konditionen für Ihren Erwerb eines Abonnements ebenfalls Informationen zu unserer Aktion »Abonnenten werben Abonnenten!« Frank Martin Passacaille Franz Schubert Sinfonie Nr. 5 B-Dur D 485 Donnerstag 24.04.2008 12:30 PhilharmonieLunch Gürzenich-Orchester Köln Markus Stenz Dirigent KölnMusik gemeinsam mit dem Gürzenich-Orchester Köln Sonntag 27.04.2008 18:00 Kölner Sonntagskonzerte 5 Bastian Fiebig Altsaxophon Henning Sieverts Jazz Bass Bochumer Symphoniker Steven Sloane Dirigent Dmitrij Schostakowitsch Moskva, Cheryomushki op. 105 Moritz Eggert Number Nine VI: A Bigger Splash Foto: Lefebvre Sergej Rachmaninow Sinfonie Nr. 2 e-Moll op. 27 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 Rotter 10:10 Uhr Seite 23 Uraufführung Oper in zwei Akten von Torsten Rasch | Text von Katharina Thalbach und Christoph Schwandt nach dem gleichnamigen Stück von Thomas Brasch Dirigent: Hermann Bäumer | Regie: Katharina Thalbach | Bühne: Momme Röhrbein | Kostüme: Angelika Rieck | Choreografie: Darie Cardyn | Chorleitung: Andrew Ollivant Vorstellungen: 2., 8., 14., 16., 18. März, 5., 11., 13. April 2008 Foto: Lefebvre Karten: 0221 / 221 28400 gefördert von: www.buehnenkoeln.de 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite 24 Philharmonie Hotline +49.221.280280 www.koelner-philharmonie.de Informationen & Tickets zu allen Konzerten in der Kölner Philharmonie! Kulturpartner der Kölner Philharmonie Herausgeber: KölnMusik GmbH Louwrens Langevoort Intendant der Kölner Philharmonie und Geschäftsführer der KölnMusik GmbH Postfach 102163, 50461 Köln www.koelner-philharmonie.de Redaktion: Sebastian Loelgen Textnachweis: Der Text von Egbert Hiller ist ein Originalbeitrag für dieses Heft. Fotonachweise: Dario Acosta S. 12; Sussie Ahlberg S. 17 und 20; Lukas Beck S. 15; Levon Biss S. 14; EMI Classics/Simon Fowler S. 10; Claudia Prieler S. 18; Brian Tarr S. 13 Corporate Design: Rottke Werbung Umschlaggestaltung: Hida-Hadra Biçer Gesamtherstellung: adHOC Printproduktion GmbH 8431_KM_03-04-08_b:07/08 02.04.2008 10:10 Uhr Seite U4 Foto: Klaus Rudolph Matthias Pintscher L’Espace dernier Sonntag 18.05. 2008 20:00 Roncalliplatz 50667 Köln Philharmonie Hotline 0221/280 280 www.koelner-philharmonie.de in der Mayerschen Buchhandlung Neumarkt-Galerie 50667 Köln Marisol Montalvo Sopran Alexandra Lubchansky Sopran Barbara Zechmeister Sopran Claudia Mahnke Mezzosopran Peter Marsh Tenor Ashley Holland Bassbariton Isabell Menke Sprecherin (La Femme) Christoph Waltz Sprecher (L’Homme) SWR Vokalensemble Stuttgart Frankfurter Museumsorchester Paolo Carignani Dirigent Christian Cluxen Live-Elektronik Matthias Pintscher L’Espace dernier Musiktheater en quatre parties sur des textes et images autour de l’œuvre et de la vie d’Arthur Rimbaud Konzertante Auführung KölnMusik gemeinsam mit der Oper Frankfurt € 25,– zzgl. Vorverkaufsgebühr