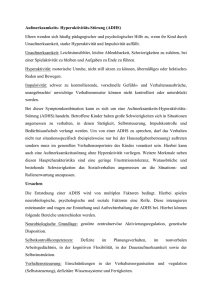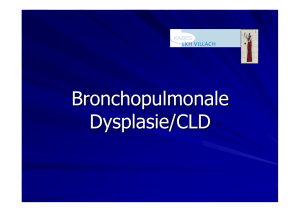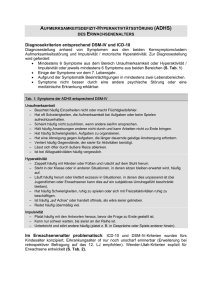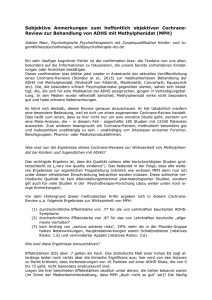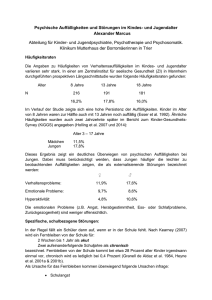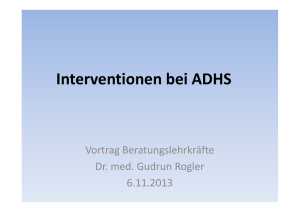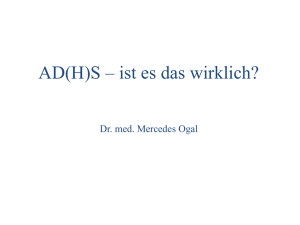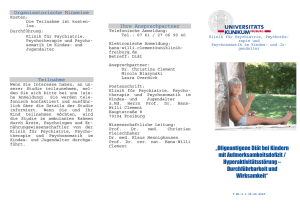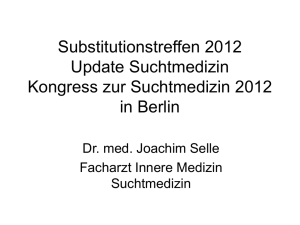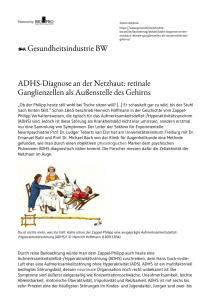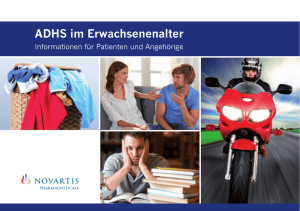Zur Rolle frontobasaler Schleifensysteme bei psychiatrischen
Werbung

1 Aus der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychosomatik Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Zur Rolle frontobasaler Schleifensysteme bei psychiatrischen StörungenEine quantitative MRI-Studie INAUGURAL-DISSERTATION zur Erlangung des Medizinischen Doktorgrades der Medizinischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau vorgelegt: 2003 von: Kerstin Frauke Hägele geboren in: Pforzheim 2 Dekan: Prof. Dr. med. J. Zentner 1.Gutachter: Prof. Dr. D. Ebert 2.Gutachter: PD Dr. H. W. Clement Promotionajahr: 2004 3 für Christoph 4 I.EINLEITUNG I.1. Zur Klinik der Aufmerksamheitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung im Erwachsenenalter I.2. Zur Klinik der Borderline Persönlichkeitsstörung I.3. Anatomie der untersuchten Areale I.3.1 Frontalhirn I.3.2 Gyrus cinguli I.3.3 Präfrontaler Cortex (PFC) I.4. Zur Funktion des PFC I.5. Wichtige Transmittersysteme I.5.1 Dopamin I.5.2 Serotonin I.5.3 Noradrenalin I.5.4 Glutamat I.5.5 GABA I.6. Ergebnisse bisheriger Forschung I.6.1 ADHS I.6.2 BPD I.7. Fragestellung der Arbeit 5 II.MATERIAL UND METHODE II.1. Patienten und Kontrollen II.2. Bildgebung II.2.1. Volumetrie II.2.2. Untersuchte Areale- Regions of Interest (ROI) II.3. Normalisierung der Einzelvolumina (ROI) II.4. Reliabilitätsbestimmung II.5. Statistik 6 III.ERGEBNISSE III.1 Patienten und Kontrollen III.2 Volumetrische Ergebnisse III.2.1 Reliabilität III.2.2 Volumetrie III.2.2.1 Gesamthirnvolumen III.2.2.2 Volumen des DLPFCs III.2.2.3 Volumen des OFCs III.2.2.4 Volumen des ACCs III.2.2.5 Volumen des Cerebellums III.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 7 IV.DISKUSSION IV.1 Methoden IV.1.1 Auswahl der Patienten und Kontrollen IV.1.2 Datenaquisition IV.1.3 Validität und Reliabilität IV.2 MRI-Befunde IV.3 Epikrise 8 I.EINLEITUNG I.1. ZUR KLINIK DER AUFMERKSAMKEITSDEFIZIT-/ HYPERAKTIVITÄTSSTÖRUNG IM ERWACHSENENALTER Prävalenz Das Hyperkinetische Syndrom bzw. die Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist immer noch vornehmlich eine Diagnose des Kindes- und Jugendalters. Die Prävalenz zu diesem Zeitpunkt liegt zwischen 3-10% 18 . Mittlerweile weiß man, dass das Störungsbild durchaus bis ins Erwachsenenalter persistieren kann. So bleiben laut MANUZZA bei 4-11% die Symptome vollständig bis ins Erwachsenenalter bestehen, bei 36% verbleiben noch einige behindernde Symptome und 80% weisen immerhin noch persistierende Restsymptome auf 35 . Anderen Studien zufolge zeigen ein Drittel der betroffenen Kinder auch im Erwachsenenalter Symptome der ADHS. WENDER schätzt die Prävalenz im Erwachsenenalter auf 2-6% 59 . Andere Studien hingegen sehen die, bei MANUZZA angewendeten Kriterien als zu restriktiv und geben eine um einiges niedrigere Prävalenzrate an 30 . Diagnostische Merkmale/ Klinisches Bild Patienten mit ADHS zeigen seit Kindheit (laut DSM-IV, Krit. B müssen sich einige Symptome schon vor dem 7 Lebensjahr manifestieren 2 ) Auffälligkeiten bezüglich Kognition, Motorik, Verhalten sowie Affekt. Die Krankheitssymptome lassen sich durch die so genannten „Utah-Kriterien“ weiter unterteilen 59 . Diese beziehen sich auf die folgenden Bereiche: 1. Aufmerksamkeitsstörung: erhöhte Ablenkbarkeit, Unfähigkeit sich (länger) zu konzentrieren, mit den Gedanken stets woanders, Lesefaulheit (teils auch Ausdruck einer persistierenden Teilleistungsstörung vom Typ der Legasthenie) 2. Motorische Hyperaktivität: motorische Unruhe, Unfähigkeit sich zu entspannen oder still zu sitzen, repetitive Extremitätenbewegungen (z.B. Trommeln der Finger) 9 3. Affektlabilität: Wechsel zwischen normaler und niedergeschlagener Stimmung sowie leichtgradiger Erregung, (anmutende) depressive Grundverfassung, geringes Selbstwertgefühl 4. Desorganisiertes Verhalten: ungenügende Planung und Organisation, Unordnung 5. Mangelhafte Affektkontrolle: verminderte Frustrationstoleranz, Wutausbrüche, andauernde Reizbarkeit 6. Impulsivität: Dazwischenreden, Unterbrechen anderer, unbedachte Entschlüsse 7. Emotionale Übererregbarkeit: kein adäquater Umgang mit Stressoren, impulsive Ausbrüche in Streßsituationen. Im DSM-IV, Krit. A werden als Hauptkriterien Unaufmerksamkeit und / oder Hyperaktivität und Impulsivität, mit noch weiterer Untergliederung, genannt. Außerdem kann die ADHS noch weiter in Subtypen differenziert werden: den so genannten Mischtypus mit Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität / Impulsivität (F90.0), den vorwiegend unaufmerksame Typus (F98.8) und den vorwiegend hyperaktiv-impulsive Typus (F90.1)16. Als Zuordnungskriterien gelten dabei die vorherrschenden Symptome der letzten 6 Monate. Patienten (v.a. Erwachsene und Jugendliche), die zum gegenwärtigen Zeitpunkt Symptome zeigen, aber nicht mehr alle Kriterien erfüllen, werden als teilremittiert spezifiziert 2. Von weiteren häufig auftretenden Merkmalen sollen hier nur kurz einige genannt werden: Frustrationsintoleranz, Herrschsucht, Widerspenstigkeit, übermäßiges und häufiges Bestehen auf Erfüllung der eigenen Forderungen, Demoralisierung, Dysphorie, Ablehnung durch Gleichaltrige und damit häufig auch einhergehendes geringes Selbstwertgefühl, verstimmte Familienbeziehung und weitere. 10 Mit der ADHS assoziierte Symptome/ Komorbidität Mit der ADHS sind häufig gleichzeitig auch noch weitere Störungen assoziiert. Dazu gehören z.B. - Teilleistungsstörungen wie Lese und Rechtschreibschwäche, Dysgraphie und Dyskalkulie - Lernstörungen - Verhaltensstörungen wie oppositionelles Trotzverhalten, Störung des Sozialverhaltens, Angststörung, Affektive Störung, Kommunikationsstörung, Eßstörung, Zwangsstörung, und andere. - Tourette Syndrom (Patienten mit Gilles de la Tourette Syndrom haben in ca.70% der Fälle auch eine ADHS), mit Tics und Koprolalie 30 - Missbrauch und Abhängigkeit von psychotropen Substanzen (tritt bei 20-60% der Kinder mit ADHS auf) - Dissoziale Persönlichkeitsstörung (12-30%) - Hysterische Persönlichkeitsstörung - Narzistische Persönlichkeitsstörung - Emotional-instabile Persönlichkeitsstörung Ätiologie und Pathogenese Durch zahlreiche Studien, vor allem aber durch Zwillings- und Adaptationsstudien, konnte eine genetische Disposition der ADHS festgestellt werden 61 . Es scheint sich dabei um einen autosomal-dominanten Gendefekt mit noch unbekanntem Genlokus zu handeln 61 . Der Einfluss von Erziehung und Umwelt sei laut Adaptationsstudie nur gering 61. Es ist anzunehmen, dass die Beeinträchtigung der motorischen Kontrolle, der Impulsivität sowie der Reizwahrnehmung auf eine Dysfunktion der Katecholamine im frontostriatalen System (und hier v.a. Dopamin) zurückzuführen ist Patienten mit ADHS molekulargenetische Auffälligkeiten 29 .Es wurden bei speziell des Dopamintransporter-Gens sowie beim D2-und D4-Dopaminrezeptor-Gen gefunden 29 . Dopamin ist im präfrontalen Cortex, im Striatum sowie in den Assoziationsbahnen zu den temporalen und parietalen Lappen stark vertrete n. Produktionsort sind Kerngebiete im Mittelhirn (ventrales Tegmentum und Pars compacta der Substantia nigra) 29 . Dopamin spielt eine wesentliche Rolle für Antrieb und Motivation. 11 Noradrenalin ist ein weiterer wichtiger Neurotransmitter, der seine dichteste Verteilung in der primären visuellen, auditiven, somato-sensorischen und motorischen Regionen aufweist. Produktionsort sind Neurone im Locus coeruleus und präfrontaler Cortex 29. Die noradrenergen Neurone zeigen in Phasen mit verminderten kognitiven Anforderungen (Schlaf, verminderte Aufmerksamkeit) eine reduzierte Aktivität, woraus man folgern kann, dass Noradrenalin bei der Aufmerksamkeitsleistung eine Rolle spielen muss 29 . Ein weiterer pathogentisch wichtiger Transmitter ist Serotonin, das mit der Impulssteuerung in Zusammenhang gebracht wird. Letztlich kann man das für die Aufmerksamkeit zuständige „System“ in einen hinteren 29 und einen vorderen Anteil gliedern . Der hintere Teil besteht aus dem rechten Parietallappen, den Coliculi superiores und dem Pulvinar (hinterer Thalamusanteil): diese Strukturen dienen dem Erkennen neuer Stimuli 29 . Der vordere Teil setzt sich aus dem Cingulum und dem präfrontalem Cortex zusammen und ist für das Arbeitsgedächtnis, die nicht fokussierte Aufmerksamkeit, Reizhemmungs- mechanismen und exekutive Funktionen (wie Organisation, Setzen von Prioritäten und Selbstkontrolle) zuständig 29 . Eine Modulation und Kontrolle all dieser Funktionen wird überwiegend durch das Striatum und den Thalamus erreicht 29 . Die rechte und die linke Hemisphäre weisen bezüglich der Funktion „Aufmerksamkeit“ eine gewisse Seitendifferenz auf: so sorgt die linke Großhirnhälfte für die fokussierte, selektive Aufmerksamkeitsleistung, während die rechte mehr für die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit und die Zuwendung zu neuen Reizen sorgt 29. Patienten mit ADHS zeigen einige Defizite (wie impulsiv bedingte Fehler, längere Reaktionszeiten bei Entscheidungsprozessen, Probleme der Aufrechterhaltung spezieller Lösungsstrategien), die auf eine Dysfunktion des präfrontalen Cortex schließen lassen 29. 12 Therapie Heute kann man Patienten mit ausgeprägter ADHS gut durch eine medikamentöse Therapie, gegebenenfalls Behandlung, helfen. in Die Kombination mit einer psychotherapeutische psychotherapeutischen Behandlung ist meist verhaltenstherapeutischer Art, mit dem Ziel einer verbesserten Selbstorganisation sowie dem Herstellen eines besseren Selbstbewusstseins . Bei komorbiden, affektiv psychiatrischen Störungen kann der Einsatz von trizyklischen Antidepressiva angezeigt sein, ansonsten sind Stimulanzien das Mittel der ersten Wahl. Die Nebenwirkungen der Stimulanzien sind gering. Typisch sind hierbei: Appetitminderung, Schlafstörung, Sedation, Agitation, gelegentliche Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Dysphorie und eine leicht Erhöhung von Blutdruck und Herzfrequenz 28. Ein häufig in der Therapie zum Einsatz kommendes Stimulanz ist Methylphenidat (Ritalin®). Dieses ist als Amphetaminderivat ein indirekt wirkendes Sympathomimetikum mit einer relativ kurzen Wirkdauer von nur 3-4 Stunden. Dieses erklärt die Notwendigkeit der mehrmaligen täglichen Gabe. Die orale Tagesdosis beträgt zwischen 10-90 mg (zum Teil sogar bis 120 mg). Über die Aufmerksamkeitsund Konzentrationssteigerung wird eine Reduktion der Hyperaktivität erwirkt. Durch Noradrenalin-Freisetzung im Gehirn wird über a - und \ß-Rezeptoren vermittelt die Müdigkeit reduziert, durch Dopamin-Freisetzung (v.a. im Nucleus accumbens und Nucleus caudatus) über D1-5 Rezeptoren Euphorie erzeugt. Pemolin (Tradon®) ein weiteres Stimulanz hat generell auch eine sehr gute Wirksamkeit, kommt aber durch seine potentielle Lebertoxizität (2%) in Deutschland nicht mehr zur Behandlung der ADHS bei Erwachsenen zum Einsatz 28 . 13 I.2. ZUR KLINIK DER BORDERLINE PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG Prävalenz Die Borderline-Störung oder auch Borderline Personality Disorder (BPD) tritt mit einer Prävalenz von 1,5-2% der Gesamtbevölkerung auf. 10% aller stationären und 20% aller ambulanten psychiatrischen Patienten leiden an BPD 3. Der Anteil aller stationär auf Persönlichkeitsstörungen behandelten Patienten liegt sogar bei 30% 3 . WIDINGER und WEISSMAN nahmen 1991 an, dass es sich hierbei in 70% der Fälle um weibliche Patienten handle 3 . Es stellt sich die Frage, ob diese Relation zu vertreten ist, da erfahrungsgemäß Männer eher zu fremd-aggressiven Impulsen neigen 3 . Die strafrechtlichen Verfahren, die dieses Verhalten nach sich zieht, führen unweigerlich zu einer Selektion des Patientenspektrums in den Kliniken und niedergelassenen Praxen 3. Diagnostische Merkmale/Klinisches Bild Im ICD-10 wird die Borderline Störung unter F 60 als spezifische Persönlichkeitsstörungen zusammengefasst. Dort wird sie wiederum unter F60.3 bei den emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen eingeordnet. Hierunter fallen Störungen mit einer deutlichen Tendenz impulsiv zu handeln ohne Berücksichtigung von Konsequenzen 16. Es werden zwei Erscheinungsformen dieser Persönlichkeitsstörung näher beschrieben: - F 60.30 impulsiver Typus mit den Unterformen: -aggresive Persönlichkeit(sstörung) -reizbare (explosive) Persönlichkeit(sstörung) - F 60.31 Borderline Typus mit Zeichen der emotionalen Instabilität, sowie Störung des eigenen Selbstbildes, der Ziele und der „inneren“ Präferenzen 16. Das DSM-IV gibt als Hauptmerkmale der BPD ein „tiefgreifendes Muster von Instabilität in zwischenmenschliche n Beziehungen, im Selbstbild und in den Affekten sowie von deutlicher Impulsivität“ an. Sie habe den Beginn im frühen Erwachsenenalter und zeige sich in verschiedenen Situationen, beziehungsweise in verschiedenen Lebensbereichen. Dieses ist als erster Schritt der Diagnosestellung und Zuordnung in die Kategorie „Persönlichkeitsstörungen“ anzusehen. 14 In einem zweiten Schritt erfolgt die Spezifizierung der Störung und die Zuordnung zur Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ. Dazu werden 9 diagnostische Kriterien genannt, von denen mindestens 5 erfüllt sein müssen. Dazu gehören: 1. Bemühungen ein tatsächliches oder erwartetes Verlassenwerden zu vermeiden 2. Muster instabiler, aber intensiver Beziehungen; die Bezugsperson / der Liebhaber wird von Anfang an idealisiert, von Beginn an teilt der Borderline-Patient intime Einzelheiten über sich mit. Es kommen plötzliche Änderungen der Sichtweise vor. So kann die Idealisierung auf einmal in eine Entwertung der Person umschlangen. 3. Identitätsstörung: instabiles Selbstbild, instabile Selbstwahrnehmung, drastische Wechsel in Zielsetzung, Wertvorstellungen und weiteres. 4. Impulsivität bei mindestens zwei potentiell selbstschädigenden Aktivitäten 5. Suizidgedanken, -andeutungen, -drohungen und –handlungen (vollendete Suizide bei 8-10% der Betroffenen) 6. Affektive Instabilität infolge einer ausgeprägten Reaktivität der Stimmung. Patienten mit BPD haben eine niedrige Reizschwelle für interne oder externe emotionale Ereignisse. Sie sind um den Faktor zehn sensitiver in ihrer Wahrnehmung, haben aber mit dem Ausdrücken ihrer Gefühle (Codieren) große Schwierigkeiten. Unterschiedliche Emotionen werden teils auch undifferenziert wahrgenommen und häufig als aversive Spannungszustände erlebt. 7. Chronisches Gefühl der Leere 8. Unangemessen heftiger Zorn und Schwierigkeiten seine Wut zu kontrollieren, gefolgt von Phase von Scham und Schuldgefühlen 9. Paranoide Vorstellungen oder dissoziative Symptome Mit der BPD assoziierte Symptome / Komorbidität Die BPD kommt sehr häufig zusammen mit anderen psychiatrischen Störungsbildern vor. Wie zum Beispiel mit: - Affektiven Störungen - Störungen im Zusammenhang mit psychotropen Substanzen - Eßstörungen (v.a. Bulimie) - Posttraumatische Belastungsstörung - ADHS - Panikstörungen (10-25%) 15 Besonders hoch ist die Komorbidität mit anderen Persönlichkeitsstörungen und hierbei vor allem: - Narzistische Persönlichkeitsstörungen (45%) - Paranoide Persönlichkeitsstörungen (41%) - Abhängige oder Histrionische Persönlichkeitsstörung (30%) 3. Ätiologie und Pathogenese Die Ätiologie der BPD ist im Wesentlichen noch unbekannt. Nach psychoanalytischer Auffassung ist die BPD ist ein Störungsbild, welches einer Fixierung auf einem entwicklungsgeschichtlich frühen Stadium entspricht 3. Nach MAHLER (1975) ist hierbei die Separations- oder Individualphase des 2.-4. Lebensja hres ausschlaggebend 3. Diese Stufe der Entwicklung geht der Ausbildung einer Ich-EsÜber-Ich Teilung voraus 3 . Störungen in dieser Phase führen somit zu einer mangelhaften Integration primitiver Selbst- und Objektvorstellungen und der zugehörigen primitiven Affekte 3. 86% der Borderline-Patienten berichten über Mißbrauchserlebnisse der Kindheit. Hierbei handelt es sich häufig um sexuellen Mißbrauch, sowie psychologischen Terror oder starke Vernachlässigung und das meist durch jemand aus der eigenen Familie. Entscheidend ist bei diesen Traumata der Zeitpunkt und die Dauer, sowie die Frage, ob es noch eine andere sichere Bezugsperson gab und ob das Kind seinen eigenen emotionalen Wahrnehmungen trauen durfte und diese auch mitteilen konnte. Häufig war dieses jedoch nicht möglich und das Kind mußte mit seinen ambivalenten Gefühlen dem Täter gegenüber leben. Der Täter wurde damit zur geliebten, benötigten und gleichzeitig aber auch gehaßten Bezugsperson. Die Kinder negieren ihre Gefühle und verkehren diese: Wut, Haß, Ekel, Scham werden nicht auf den Täter gerichtet, sondern gegen sich selbst 3. Die Traumatisierung bewirkt auf neurobiologischer Ebene eine Hypersensitivierung des libischen Systems. Diese führt letztlich zu einer ausgeprägten Sensibilität, die wiederum eine rasche Generalisierung der Auslöser nach sich zieht. Dieser Teufelskreis setzt dann über neue Traumata eine noch stärkere emotionale und neurologische Reaktion frei, die schließlich so genannte „freezing Prozesse“ auslöst 3 . 16 Die Betroffen lernen meist relativ schnell, dass autoaggressive Hand lungen diese Zustände unterbrechen können 3 . Therapie Es gibt letztlich zwei etablierte Behandlungskonzepte für die BPD. Die erste Form ist die psychodynamisch orientierte expressive Psychotherapie nach KERNBERG. Diese versucht durch Analyse von Übertragung- Gegenübertragungsprozessen einen Zusammenhang zu früheren Ereignissen herzustellen. Der Patient soll lernen situationsadäquate Deutungs- und Klärungstechniken zu finden. Die dialektisch-behaviorale Psychotherapie (DBT) nach LINEHAM ist die zweite Form. Hier werden über die Dauer von 2 Jahren, in einer Art kognitiven Verhaltenstherapie, die Aufmerksamkeitsfokussierung in der gegenwärtigen Situation geübt. Dabei gibt es jede Menge verschiedener Techniken, die dieses bewirken können (z.B. Hypnotherapie, Zen-Meditation, Körpertherapie und andere). Die Therapie verläuft in 4 Phasen: eine Vorbereitungsphase Therapiephasen, die jeweils übergeordnete Ziele besitzen 3. und drei 17 I.3. ANATOMIE DER UNTERSUCHTEN AREALE Um die Funktionen des menschlichen Gehirns zu verstehen, ist die Kenntnis der topographischen sowie funktionellen Anatomie unerlässlich. I.3.1 Lobus frontalis Der Lobus frontalis umfasst alle Rindengebiete vor dem Sulcus centralis, also die primär somatomotorische Rinde im Bereich des Gyrus praecentralis (Area 4), die prämotorischen Felder (Areale 6aa , 6aß und 8), die präfrontalen Areale 9, 10, 11, 12, 45, 46 und 47), sowie die motorische Sprachregion Area 44 17 . Er liegt gleichsam auch vor und über dem Sulcus lateralis, der die Abgrenzung zum Lobus temporalis darstellt. Die weitere Untergliederung des Frontallappens wird durch drei Sulci bewirkt. Der Sulcus praecentralis dient, zusammen mit dem schon erwähnten Sulcus centralis der Abgrenzung des Gyrus praecentralis. Die Sulci frontalis superior, -medius und inferior teilen den Gyrus frontalis superior, -medius und –inferior ab. Der Polus frontalis ist ein Gebiet von komplexer anatomischer Struktur. Es beinhaltet die Gyri frontopolares transversi superior, -medius und –inferior. Der Sulcus frontomarginalis erstreckt sich zwischen dem Gyrus frontopolaris transversus auf der dorsalen Seite und dem Gyrus frontomarginalis ventralerseits. So bildet er gleichermaßen die Grenze zwischen dem dorsolateralen präfrontalen Cortex (DLPFC) und dem orbitofrontalen Cortex (OFC). Die genaue Abgrenzung der letztgenannten Strukturen, als in der Arbeit gemessene Areale, wird (in Material und Methoden II.1.2) noch genauer erläutert. I.3.2 Gyrus cinguli Der Gyrus cinguli ist einer der zum limbischen System gehörenden kortikalen Bezirke. Seine Windung verläuft parallel zum Corpus callosum zwischen dem Sulcus cinguli und dem Sulcus corporis callosi. Er gilt als Randgebiet des Archicortex (Periarchicortex) 27 . 18 I.3.3 Präfrontaler Cortex (PFC) Zum präfrontalen Cortex gehören die 3 Gyri frontales, die Gyri orbitales, der Großteil des Gyrus frontalis mediales und ein Teil des Gyrus cinguli. Dieses Rindengebiet erhält zahlreiche Zugänge aus dem Temporal– und Parietallappen über Bahnen im Cingulum cerebri, über ein Bündel langer Assoziationsfasern, welches im Gyrus cinguli verläuft 38. Auf einige der Verbindungen wird im nächsten Unterpunkt noch detaillierter eingegangen. 19 I.4. ZUR FUNKTION DES PRÄFRONTALEN CORTEX (PFC) Schon 1986 fand ALEXANDER heraus, dass es fünf anatomische Regelkreise gibt, die die Region des frontalen Cortex mit der des Striatums, des Globus pallidus, der Substantia nigra und des Thalamus verbinden 1, 13. Die genannten Regelkreise sind: 1. der motorisch- subcorticale Kreis 2. der oculomotorisch- subcorticale Kreis 3. der dorsolaterale präfrontale- subcorticale Kreis 4. der lateral orbitofrontale- subcorticale Kreis 5. der anterior cinguläre- subcorticale Kreis Die zwei Erstgenannten haben motorische Funktion, während die anderen kognitive Funktionen (wie Wahrnehmung, Denken, Erkennen, Erinnern), Persönlichkeitsformation und Motivation inne haben 1, 13 . Dysfunktion des dorsolateralen präfrontalen-, lateralen anterioren cingulären- subcorticalen Regelkreis führt orbitofrontalen- und zu exekutiver Dysfunktion, Disinhibition, Obsessive-compulsive Disorder und Apathie. Obsessive-compulsive disorder (OCD) ist eine den Zwangserkrankungen zugehörige Störung, die mit einer vermehrten Kontrolle des Verhaltens, einer übermäßigen Beschäftigung mit dem Sozialverhalten sowie Angepaßtheit einhergeht einer pathologischen Wertlegung auf einer 20, 23 sozialen . Die Prävalenz beträgt 2-3% der Bevölkerung 23 . Bei Probanden mit OCD besteht eine vermehrte metabolische Aktivität im Bereich des OFC und des Caudatus 23. Jeder der oben genannten Regelkreise enthält (offene) afferente und efferente Elemente. Diese entstammen oder führen zu Regionen mit denselben oder ähnlichen Funktionen und dienen der Umsetzung bestimmter Verhaltensweisen. Alle Regelkreise benutzen in den jeweiligen anatomischen Regionen die selben Neurotransmitter. In I.5 wird auf die Funktion und die Verteilung der wichtigsten Neurotransmitter noch weiter eingegangen. 20 Frontallappen Glutamat (+) Striatum Indirekte Verbindung GABA (-) Direkte Verbindung (+) Globus pallidus externus GABA, Substanz P (D1-Rez.) Enkephalin, GABA(-),(D2-Rez.) Nucleus subthalamicus Glutamat(+) Globus pallidus internus Substantia nigra(Pars reticulata) GABA (-) Thalamus Von Bedeutung für die Aufrechterhaltung eines mittleren Erregungsniveaus ist die Tatsache, dass die direkte und die indirekte Verbindung kontrahent sind. Läuft die direkte Verbindung über zwei GABA-erge Synapsen und ist letztlich enthemmend, so verläuft die indirekte Verbindung so, dass sie schlußendlich hemmenden Charakter besitzt 4. 21 Dorsolateral präfrontal- subcorticaler Regelkreis Der Ursprung des dorsolateral präfrontal- subcorticalen Regelkreis ist die Brodmann Area 9 und 10 (also die laterale Oberfläche des vorderen Frontallappens). Die Verbindung erfolgt über eine direkte Projektion zum dorsolateralen Kopf des Nucleus caudatus und von dort zum lateralen Teil des Globus pallidus internus/ rostrolaterale Substantia nigra (pars reticulata). Es besteht außerdem eine indirekte Verbindung (siehe Diagramm). Die Aufgabe dieses Kreises besteht in exekutiven Funktionen, wie: − Fähigkeit der Organisation einer verhaltensgesteuerten Antwort, so dass diese zur Lösung eines komplexen Problems beitragen kann - Aktivierung länger zurückliegender Gedächtnisinhalte - Selbstbeherrschung und Selbstorganisation - Unabhängigkeit von Umweltfaktoren - Anpassung oder Beibehaltung von Verhaltensmustern - Generierung von motorischen Abläufen - Benutzung von Sprache zur Steuerung des Verhaltens Pathologische Veränderungen dieses Systems führen daher zu vielfältigen Defiziten. Wie z.B.: - verminderter Redefluß, verminderte Redegewandheit - verminderte gestalterische Fähigkeiten - Beeinträchtigung der Repetition gewisser Sequenzen - häufiges Imitieren von Personen, Gesten und ähnlichem - eingeschränkte, insuffiziente Lernstrategien - eingeschränkte Fähigkeit auf gelernte Inhalte zurückzugreifen Lateral orbitofrontal- subcorticaler Regelkreis Der lateral orbitofrontal- subcorticale Regelkreis entspringt der Brodmann Area 10 und 11. Seine Verbindungen führen zum ventromedialen Caudatus und von dort via direkter und indirekter Verbindung zum mediodorsalen Globus pallidus internus, zum Thalamus und zurück zum Kortex. Funktionell ist er für ein soziales und 22 empathisches Verhalten wichtig. Seine Dysfunktion führt zu Persönlichkeitsänderungen, wie: - Irritierbarkeit - Labilität - Taktlosigkeit - Albernheit - Euphorie - Unpassende Vertrautheit - Unfähigkeit Gefühle anderer zu verstehen - Launenhaftigkeit - Ziellose Anwendung von Gebrauchsgegenständen ( „utilization behavior“) - Automatische Nachahmung anderer (bei größeren Läsionen) - Obsessive compulsive disorder (OCD) Anterior cingulär- subcorticaler Regelkreis Der der Brodmann Area 24 entspringende anterior cingulär- subcorticale Regelkreis ist für die Erzeugung und Aufrechterhaltung von Motivation bedeutend. Eine Dysfunktion führt zu: - Apathie - Gefühl psychischer Leere - Armut der Spontansprache - bilaterale Läsionen zum akinetischen Mutismus 13. Interessant ist auch die Betrachtung der Einbindung des Gyrus cinguli in den Neuronenkreis von PAPEZ. Die efferenten Fasern des Hippocampus erreichen das Corpus mamillare über den Fornix. Hier werden die Impulse auf das Vinq d´Azursche Bündel (Tractus mamillothalaris) umgeschaltet, welches zum Nucleus anterior thalami zieht. Dieser projiziert zur Rinde des Gyrus cinguli und von dort über das Cingulum zurück zum Hippocampus Grundlage von Emotionen an 4. 27 . PAPEZ sah diesen Neuronenkreis als 23 I.5. WICHTIGE TRANSMITTERSYSTEME I.5.1 Dopamin (DA) Die pars compacta der Substantia nigra dient als Kerngebiet der Dopaminproduktion im Gehirn. Von ihr ziehen die Fibrae nigrostriatales zum Striatum. Dopamin kann im Gehirn sowohl inhibitorische postsynaptische Potentiale (IPSPs) wie auch exitatorische postsynaptische Potentiale (EPSPs) auslösen und mehrere Wirkungen haben; so spielt es z.B. für Antrieb und Motivation eine entscheidende Rolle. Es gibt D1-D5 Rezeptoren; dazu kommt noch, dass die einzelnen Rezeptoren einen genetischen Polymorphismus aufweisen. Postsynaptisch wirkt Dopamin über D1- sowie D2-Rezeptoren, präsynaptisch über D2- Rezeptoren. Die Wirkung des Dopamins hängt aber, außer vom Rezeptortyp, auch noch von second messengern und deren Wirkung in der entsprechenden Zelle ab. Die beiden wichtigsten Dopaminsysteme sind das mesolimbische und das nigrostriatale System 4. Es gibt aber auch noch viele andere Systeme, die sich des Dopamins als Transmitter bedienen. 1980 entdeckten PYCOCK und BLANC die Existenz einer inversen Beziehung zwischen dem Dopamin-Metabolismus des PFC und des striatalen Endfeldes. Sie manipulierten die Gebiete des PFC so, dass dieses zu einer reduzierten Dopaminkonzentration führte und stellten fest, dass damit gleichzeitig eine upRegulation des DA-Metabolismusses der striatalen Region assoziiert war. Da diese Systeme nur sehr unwahrscheinlich direkt präsynaptisch verknüpft sind, geht man heute vielmehr von einer funktionellen Interaktion aus 63. Inwieweit sich diese Versuche und die daraus gewonnenen teils hypothetischen Erkenntnisse, auf physiologische Bedingungen übertragen lassen, ist noch nicht ausreichend geklärt. Dopamin spielt jedoch höchstwahrscheinlich für die Funktion des PFC eine wichtige Rolle. Dysfunktion im DA-System kann somit zu dem Krankheitsbild des ADHS führen. CASTELLANOS postulierte, dass bei ADHS in zwei dopaminergen Regionen Abnormalitäten vorliegen müssen:verringerte Aktivität in einer corticalen Region (wie Z.B. Gyrus cinguli), woraus kognitive Defizite herrühren, sowie Überaktivität in einer subcorticalen Region (z.B. Nucleus caudatus), was zu Hyperaktivität führt scheint auch bei Schizophrenie eine Dysfunktion des DA-Systems vorzuliegen. 54 . So 24 I.5.2 Serotonin Serotonin spielt eine bedeutsame Rolle für Verhalten wie die der Nahrungsaufnahme, des Aktivitätsrhythmusses, des Sexualverhaltens und der emotionalen Befindlichkeit. Durch Interaktionen mit dem cholinergen, glutaminergen, dopaminergen sowie GABAergen System kommt Serotonin auch für Lernen und Gedächtnis eine signifikante Rolle zu; dabei sollen laut MENESES alle Serotoninrezeptorarten (5-HT1 bis 5 -HT7) involviert sein 9. Es ist anzunehmen, dass das 5-HT System entscheidend ist für die Aufrechterhaltung einer normalen kognitiven Funktion, bzw. bei Dysfunktion für die Entstehung kognitiver Störungen. DAVIS et al. fanden heraus, dass in gewissen Hirnarealen zwischen Serotonin und Dopamin eine inverse Beziehung besteht 15 . Dysfunktionen im Serotoninsystem treten z.B. bei Borderline Persönlichkeitsstörung auf 8, 44, 51 . Diese Patienten haben eine verminderte Antwort auf serotonerge Stimulierung von Arealen des PFC 51 . In I.6.2 wird noch etwas genauer auf die Bedeutung von Serotonin bei BPD eingegangen werden. I.5.3 Noradrenalin (NA) Noradrenerge Neurone bilden den Locus coeruleus, sowie Zellgruppen im lateralen Teil der Formatio reticularis der Medulla oblongata 27 . Die dichteste Verteilung von Noradrenalin herrscht in der primären, visuellen, auditiven, somatosensorischen und motorischen Regionen vor 29 . Noradrenalin weist über 14 verschiedene Wirkungen auf, wenn man seine a -und ß Wirkungen zusammenzählt. Ein Großteil der NA-Effekte, die über ß -Rezeptoren vermittelt werden, sind als erregend anzusehen. Mittlerweile schreibt man dem Noradrenalin eine immer größere Bedeutung für die Funktion v.a. des PFC zu 39 . Dabei spielen sowohl a2- Adrenorezeptoren wie auch NA-uptake-Mechanismen eine entscheidende Rolle 39 . 25 I.5.4 Glutamat Glutamat ist eine häufig von den Pyramidenzellen als Transmitter gebrauchte erregende Aminosäure. Glutamat ist in limbischen Kernen und Hippocampus, sowie im Neocotex und Striatum vorhanden. V.a. Fasersysteme, die vom Neocortex in subcorticale Regionen projizieren, sowie Basalganglien und Thalamus benützen Glutamat als Transmitter. Daraus kann man schließen, dass Glutamat an der Regelung der Informationsverarbeitung, der ersten corticalen Reizanalyse und der Steuerung des Kurzzeitgedächtnisses beteiligt ist 4 . I.5.5 y-Aminobuttersäure (GABA) GABAerge Neurone bilden häufig lokale Verschaltungen (Interneurone). V.a. die kleinen Interneurone (Golgi-, Stern- und Korbzellen) benutzen GABA als Überträger; häufig auch in Kombination mit Peptiden (CCK, VIP, Substanz P, Enkephaline und weitere). Vom Spinalmark bis zum Kortex (also auf allen Ebenen des ZNS) ist GABA zu finden. Besonders hohe Konzentrationen finden sich in den Kernen der Basalganglien, im Cerebellum, Hippocampus, Thalamus, Hypothalamus und Schicht IV des Neocortex 57 . Bis jetzt konnten zwei Arten von GABA-Rezeptoren identifiziert werden: GABA-A Rezeptoren und GABA-B Rezeptoren. GABA-A Rezeptoren entfalten mit den Benzodiazepienen synergetische Wirkung 4. Sowohl der GABA-A Rezeptor wie auch der Benzodiazepin-Rezeptor verstärken die Polarisation im Inneren der Nervenzelle, indem sie den Einstrom negativ geladenen Ionen (v.a. Chlorid-Ionen) erhöhen. Diese Hyperpolarisation erklärt die membranstabilisierende, deaktivierende Wirkung von GABA wie auch von Benzodiazepinen. 26 6.ERGEBNISSE BISHERIGER FORSCHUNG I.6.1 ADHS Aufmerksamkeit Das limbische System und der PFC können als funktionelle Einheit angesehen werden. Aus Sicht mancher Autoren ist das „telezephale limbische System“ in drei Hauptregionen zu gliedern: 1. hippocampaler Assoziationskortex 2. die damit verbundenen Assoziationkortizes (Gyrus cinguli, PFC und perhinaler Kortex) 3. subkortikaler septoamygdaler Komplex (SAC) 4. Die thalamischen Kerne sind das „Tor“ zum Kortex und spielen daher eine zentrale Rolle in der Steuerung von Aufmerksamkeitsverhalten. So ist z.B. der Nucleus reticularis des Thalamus wesentlich für die Selektion der Weiterleitung ankommender Information verantwortlich. Ihm fällt somit eine sogenannte „gating“ Funktion zu 4. Dies führt zu einer gewissen Steuerung der Aufmerksamkeit. Denn so können unwichtige Reize vor Aufmerksamkeitsresourcen ihrer vor Weiterverarbeitung einer Übersättigung gehemmt mit und die Nebensächlichkeiten geschützt werden 4. Zur Fokussierung gerichteter Aufmerksamkeit benötigt man neben dem Nucleus reticularis thalami noch den PFC und den Gyrus cinguli. Diese müssen die Informationen aus dem Neocortex (v.a. rechter inferior-parietaler Assoziationskortex) erhalten und diese mit der motivationalen Bedeutung, die das limbische System meldet, koppeln 4 . Vom Neocortex läuft dann eine Rückmeldung über die bestehende Erregungsverteilung (des Cortex) zurück an die Basalganglien. Nur so kann verhindert werden, dass bereits erregte Areale weiter stimuliert werden (was sonst in einer Übererregung enden könnte) 4. Störungen in einem dieser weitverzweigten Systeme, gehen daher mit Bewußtseinsund / oder Aufmerksamkeitsstörungen einher. Zerstörung der Basalganglien führt zu Bewußtlosigkeit. Inkomplette Ausfälle, wie z.B. der dopaminergen Projektion der Substantia nigra zum Striatum führen zu Reduktion der Bereitschaftspotentiale und zu Aufmerksamkeitsstörungen. Bei Ausfall des PFC kommt es zu schweren 27 Störungen der „Selektivität“, der Patient wird von unmittelbar gegenwärtigen Reizen gesteuert 4 . Ergebnisse vorhergehender Studien Wie bereits erwähnt, kann Aufmerksamkeit nur durch ein komplexes System erzeugt und aufrecht erhalten werden. POSNER et al. postulierten die Existenz von drei „Aufmerksamkeits-Netzwerken“: 1. ein selektierendes, selektives Aufmerksamkeitssystem 2. ein ausführendes Netzwerk, das in dem vorderen Teil des Gyrus cinguli und den Basalganglien lokalisiert ist und dessen Funktion es ist, „entdeckte“ Gegenstände ins Bewußtsein zu rücken 3. ein vigilantes Netzwerk; lokalisiert im rechten Frontallappen (v.a. vorderer Anteil der Brodmann Area 6 ); dieses gewährt die Aufrechterhaltung des 19 Wachheitszustandes . Defizite der Aufmerksamkeit, wie beispielhaft beim ADHS, müssen sich also in diesem komplexen System verbergen. FILIPEK et al versuchten morphologische Anomalien bei ADHS nachzuweisen. Sie bezogen sich dabei u.a. auf Studien mit funktionellen Aufnahmetechniken, die über einen Unterschied der Caudatus und posterioren Hirnregionen zwischen ADHSPatienten und Kontrollgruppe berichten: so sei z.B. der Cerebrale Glucose Metabolismus (18F-Desoxyglucose, FDG) während einer anhaltenden Beschäftigung bei Erwachsenen mit ADHS geringer als bei der Kontrollgruppe 19 . Gebiete mit der ausgeprägtesten Verringerung waren: bilateral, die Prämotorregion, PFC, Gyrus cinguli, rechter Thalamus, Caudatus und Hippocampus 19. In MRI-basierenden morphologisch volumetrischen Messungen konnten FILIPEK et al keinen signifikanten Unterschied im Hemispherenvolumen der ADHS-Patienten gegenüber der Kontrollgruppe feststellen 19 . Hingegen seien die Volumina der rechten anterior-superior frontalen Region und bilateral der anterior-inferioren Region sowie der retrocallosalen weißen Substanz beiderseits kleiner 19 . Das linke Caudatuskopf und Caudatusgesamtvolumen sei kleiner und es bestehe eine inverse links-rechts Asymmetrie (d.h. rechts > links, statt normalerweise links < rechts) 19 . Andere MRI-Studien brachten ähnliche Ergebnisse 11, 42. 28 So kam eine Studie der Psychiatrischen und Psychobiologischen Abteilung der Universität von Barcelona nach quantitativer MRI-Messung verschiedener Hirnareale von 11 Patienten mit ADHS und 19 Kontrollpersonen zu dem Ergebnis, dass bei Patienten mit ADHS einen inverse Asymmetrie der Frontallappen bestehe (rechts < links, statt links < rechts) 42 . Dabei sei insbesondere das Volumen des rechten PFC betroffen. Des Weiteren sei auch der rechte Nucleus caudatus größer als der linke (statt normalerweise links > rechts). Sie folgerten daraus, dass die Vergrößung des rechten Nucleus caudatus auf einen Fehler im Prozeß der synaptischen Verschaltung ("synaptic pruning“) deuten könnte und dass sich dadurch während der Entwicklung Probleme in der Übertragung von Aufmerksamkeitsfunktion von den Basalganglien zu den frontalen Regionen ergeben könnten 42. Auch CASTELLANOS et al kamen in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass sich bei ADHS das totale Hirnvolumen mit 4,7% nur minimal verringere 11 . Der rechte Globus pallidus sowie die rechte anterior- frontale Region seien verringert. Das Cerebellum sei bei ADHS-Patienten kleiner und die normal lateral- ventriculäre Asymmetrie umgekehrt. Die Autoren folgerten, dass man somit bei ADHS von einer rechtsseitigen Dysfunktion des präfrontal- striatalen Systems sprechen könne 11 . Ein anderer Aspekt ist die genauere Betrachtung der neurophysiologischen Aufgaben, bzw. deren Defizite. Hierunter sind höherrangige ausführende Kontrollfunktionen, wie z.B. die Beendigung einer Tätigkeit (response inhibition) und motorisch-zeitliche Koordination (bzw. die Störungen hierbei) zu verstehen. Personen mit ADHS haben Schwierigkeiten bei der Ausführung so genannter „go-nogo“ und „Stop“ Aufgaben 29 . Desgleichen ist die Bewältigung von Aufgaben, die eine exakte zeitliche Koordination der Bewegung erfordern, schlecht. Es konnte durch RUBIA et al. nachgewiesen werden, dass Patienten mit ADHS bei oben genannten Aufgaben eine geringere Hirnaktivität als die Kontrollpersonen zeigten 45 . Dabei waren v.a. der rechte mesiale frontale Cortex und während der „Stop“ Aufgabe der rechte inferiore PFC und der linke Nucleus caudatus betroffen. Dies könnte als Grund für die schlechte inhibitorische Kontrolle bei ADHS angesehen werden 45. Eine Studien von PLIS ZKA et al. kam zu den selben Ergebnissen – sie fanden ebenfalls rechts betonte Abnormalitäten bei ADHS 41. Eine neuere Studie der Universität Freiburg (HESSLINGER et al.) brachte mittels Wasserstoffprotonen (1 H)-Magnetresonanzspektroskopie mit kurzen Echozeiten (TE =30ms, TR =3000ms) interessante Ergebnisse 24 . Sie konnten im linken DLPFC 29 von Patienten mit hyperaktiv-impulsiven Typus der ADHS verminderte Konzentrationen von N-Acetylaspartat (NAA) nachweisen. Bei Patienten des vorwiegend unaufmerksamen Typs der ADHS war dies hingegen nicht der Fall. Diese Studie berichtet somit über eine linksseitige, präfrontale Störung bei einer Untergruppe der ADHS. I.6.2 BPD Ergebnisse vorhergehender Studien Im Gegensatz zu Krankheitsbildern wie ADHS, Schizophrenie oder Epilepsie gibt es zur BPD bislang nur wenige Studien zu volumetrischen Messungen. In einer CTStudie der University of California im Jahre 1989 wurden das VentrikelHirnvolumenverhältnis, die Größe des dritten Ventrikels sowie das Vorhandensein einer Froantallappenatrophie untersucht 33 . Es konnten keine Unterschiede zwischen der BPD- und der Kontrollgruppe festgestellt werden. Somit wurde gefolgert, dass bei der BPD kein Anhalt auf eine strukturelle Veränderung bestehe. LYOO et al. belegen 1998 mit ihrer MRI-volumetrischen Studie hingegen einen signifikanten Volumenverlust ( 6,2%) des linken frontalen Cortex bei BPD. Sie wählten ihr Studienkollektiv, im Gegensatz zu den vorangegangenen CT-Studien, nach sehr genau festgelegten Kriterien aus, um Indifferenzen durch andere komorbide Störungen zu vermeiden 34. Wesentlich mehr Studien beschäftigen sich mit der Rolle der Neurotransmitter bei BPD. Hierbei fällt besonders Serotonin ins Gewicht. Schon 1982 fanden BROWN et al. heraus, dass aggressives Verhalten sowie suizidale Neigung mit einer Verringerung der 5-Hydroxyindolessigsäure (5-HIAA), einem Serotoninmetaboliten, assoziiert sind 8. Weitere Ergebnisse lieferte eine Studie von RINNE et al.: sie fanden heraus, dass die Cortisol und Prolactin Antworten, auf eine Stimulierung mit dem Serotonin Agonisten Meta-Chlorphenylpiperazin (m-CPP), bei Patienten mit BPD signifikant niedriger ist, als bei Kontrollpersonen 44 . Dabei zeigt die Prolaktin Antwort eine inverse Korrelation zur Häufigkeit des physischen oder sexuellen Mißbrauchs der Patienten in der 30 Kindheit. Daraus resultiert die Annahme, dass traumatische Ereignisse in der Kindheit das Serotoninsystem, v.a. die 5-HT(1A) Rezeptoren, beeinflussen 44 . In einer PET-Studie von GOYER et al. wurde bei BPD-Patienten in Arealen des frontalen Kortex eine Verringerung der cerebral metabolischen Glucoserate (CMRG) festgestellt 21 . Da diese Veränderung sehr genau lokalisiert werden konnte, stellt sich nun die Frage, ob nicht doch eine strukturelle Veränderung in dieser Region nachgewiesen werden kann. Eine neue MR-spektroskopische Studie von TEBARTZ VAN ELST et al. 58 fand in der Region des DLPFC bei Patienten mit BPD eine um 19% verringerte NAcetylaspartat (NAA) Konzentration. Dieses kann als Anzeichen einer reduzierten neuronalen Dichte oder einer gestörten neuronalen Vernetzung angesehen werden 14, 26 . Reduzierte NAA-Konzentrationen im präfrontalen Cortex wurden auch bei anderen Störungsbildern, die mit den Syndromen Impulsivität, emotionale Instabilität und aggressivem Verhalten einhergehen, beobachtet. 31 I.7. FRAGESTELLUNG DER ARBEIT In dieser Arbeit soll untersucht werden, ob bei Patienten mit ADHS und bei BPDPatienten eine volumetrische Veränderung des DLPFC, OFC, ACC oder Cerebellums vorliegt. Nach den Ergebnissen vorangegangener Studien wäre bei ADHS ein rechtsseitig reduziertes Frontalhirnvolumen zu erwarten, während bei BPD keine Volumenveränderung vorauszusehen wäre. Allerdings zeigen neuere Studien gerade bei BPD Abweichungen der Transmitter- und Glucosekonzentrationen, so dass eine volumetrische Änderung einer definiten Region nicht auszuschließen wäre. Des Weiteren zeigten andere psychiatrische Erkrankungen, die mit den Symptomen Impulsivität, Aggression und emotionaler Instabilität einhergehen, Veränderungen des präfrontalen Hirnvolumens. Dieses spräche wiederum volumetrische Änderung in den zu untersuchenden Arealen. eher für eine 32 II. MATERIAL UND METHODE II.1.PATIENTEN UND KONTROLLEN Nach Stellungsnahme und Einverständnis des lokalen Ethikausschusses konnte mit der Auswahl der Patienten und Kontrollpersonen begonnen werden. Alle in die Untersuchung eingeschlossenen Patienten stammen aus der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Freiburg. Sie wurden dort untersucht und nach den üblichen diagnostischen Kriterien (DSM-IV, ICD-10) den entsprechenden Krankheitsbildern zugeordnet. Alle Patienten, sowie die Kontrollen nahmen auf freiwilliger Basis, nach vorangegangener Aufklärung über die Art, Risiken und Ziel der Untersuchung, an der Studie teil. Die Gruppe der Kontrollpersonen bestand aus klinisch gesunden Personen ohne psychiatrische Erkrankungen in der Vorgeschichte. Die Aufnahmekriterien in die Studie waren (v.a. für die BPD-Patientinnen) sehr strikt: für die Borderline-Patientinnen galt, dass sie keine Medikamente nehmen durften und in den letzten 6 Monaten kein Hinweis auf Alkohol- oder Drogenabusus bestand. Patientinnen mit Zeichen von Anorexie, Vorliegen einer bipolaren Störung oder einer Major Depression, Lernstörung oder einer persitierenden Schizophrenie wurden ausgeschlossen. Die Patientinnen mussten einen bestandenen Schulabschluss vorweisen können. Außerdem mussten die Patientinnen die Kriterien für eine Borderline- Persönlichkeitsstörung gemäß DSM-IV und ICD-10 erfüllen. Darüber hinaus wurde eine Klassifizierung gemäß dem strukturierten klinischem Interview für DSM-IV Persönlichkeitsstörungen (SCID II) sowie der revierdierten Version des diagnostischen Interviews für BPD (DIB -R) vorgenommen. Die Patientinnen mussten ein Minimum von 8 der 10 Punkte des DIB -R erfüllen. Für die ADHS Patienten galt ähnliches. Sie waren auch allesamt zum Zeitpunkt der Untersuchung unmediziert. Ein Teil der Patienten waren dem vorwiegend unaufmerksamen Typus (F98.8), der andere Teil dem vorwiegend hyperaktivimpulsiven Typus (F90.1) zuzuordnen. Die Patienten mussten alle DSM-IV Kriterien für ADHS erfüllen. Es durfte keine Achse I Störung als Komordibität vorliegen, da diese sich möglicherweise auf die Bildgebung interferierend auswirken könnte; d.h. 33 Substanzenmißbrauch jeglicher Art, bipolare Störung, bestehende depressive Störung, Schizophrenie oder geistige Behinderung galten als Ausschlußkriterium. Achse II Störungen waren hingegen zulässig. Unter Achse I Störungen versteht man persistierende oder rezidivierende Krankheitsbilder aus dem Bereich der affektiven Störungen, Psychosen, Abhängigkeitssyndrome und geistige Behinderungen. Achse II Störungen beinhalten im wesentlichen Persönlichkeitsstörungen. 34 II.2.BILDGEBUNG II.2.1.VOLUMETRIE Die der Volumetrie zugrunde liegenden MRI-Bilder entstanden zwischen 1998 und 2000 in der radiologischen Abteilung der Universitätsklinik Freiburg auf einem 2Tesla Ganzkörperscanner (Medspec S200, Bruker, Ettlingen). Der hochaufgelöste 3D-Datensatz wurde mit der MDEFT (modified driven equilibrium fourier transfer) akquiriert und bezüglich des Kontrastes von grauem und weißem Parenchym optimiert. Die Repetitionszeit (TR) betrug 17ms und die Echozeit (TE) 5,5ms. Die Bilder waren T1 gewichtet mit einer inversion recovery Volumen Akquisition ( IRSPGR: TI / TR / flip = 450 / 15 / 4,2 ). Es handelte sich um 124 angrenzende 1,8mm dicke coronare Schichten mit einer Matrix von 256 x 192 x 96; 24cm x 18cm x 23cm als FOV. Daraus ergibt sich eine Voxelgröße von 0,70312mm x 0,93750mm x 1,79688mm. Das FOV wurde trotz unterschiedlichen Kopfumpfangs der Patienten nicht verändert, sondern konstant auf oben genanntem Wert gehalten. Ein erfahrener Radiologe befundete die Bilder bezüglich möglicher pathologischer Veränderungen. Nach Ausschluß selbiger wurden die Bilder mittels entsprechender Software (brucker to Mreg) konvertiert und über das Klinikumsnetzwerk auf eine SUN-Workstation (Silicon Graphics, O2-Workstation) der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie transferiert. Bevor die Bearbeitung der Bilder erfolgen konnte, wurde in einem so genannten Reslicingprozeß die Matrix so verändert, dass man 128 Schichten von 1,8mm Dicke und quadratrische Voxel mit einer Seitenlänge von 0,93750mm erhielt. Die nun folgende volumetrische Bearbeitung erfolgte durch die, am Institute of Neurology in London, für MRI-Volumetrie entwickelte Software, MRreg 154(http://www.erg.ion.uucl.uk/Mrreg.html). Dieses Programm enthält die Funktion „region growing“, mit der mittels eines über die Maus gesteuerten Cursors, die entsprechende ROI (region of interest) angeklickt werden konnte. Nun wurde das ganze durch den Cursor gekennzeichnete Areal markiert. Durch das Setzen von Grenzlinien (sog. Borders), konnte man die Markierung auf das gewünschte Areal begrenzen. Durch die Funktion „manual tracing“ kann das gewünschte Areal mit der Maus manuell umfahren werden; diese Funktion wurde zur Messung des Kleinhirn- und Gesamtvolumens verwendet. Voxel innerhalb der so gesetzten Grenzen wurden automatisch vom Computer gezählt und mit der Anzahl der Kubikmilimeter pro Voxel multipliziert, so dass man 35 ein Schichtvolumen erhielt. Nach diesem Schema wurde nun Schicht für Schicht gemessen. Die Volumina der einzelnen Schichten wurden automatisch addiert. Auf diese Art erhielt man am Ende der Messung das Gesamtvolumen der Region. Die Bearbeitung der Bilder erfolgte bei einer Vergrößerung um den Faktor 2. II.2.2.ZU MESSENDE AREALE –REGIONS OF INTEREST (ROI) Als zu vermessende Areale wurden 3 Regionen bestimmt: der Dorsolaterale Präfrontalcortex und der Orbitofrontale Cortex, die zusammen den Präfrontalcortex bilden, sowie der Anteriore Cinguläre Cortex. Die Grenzen dieser ROI wurden nach dem Meßprotokoll von RAZ et al., definiert und aufgesucht 43 . Jede Hemisphere wurde getrennt vermessen, um somit auch seitenvergleichende Aussagen anstellen zu können. Von der am meisten ventral gelegenen Schicht des Gehirns bis zur letzten Schicht, in der noch kein Corpus callosum zu erkennen ist, wurden in 1,8mm Abstand die ROI abgegrenzt und mit der Option „region growing“ markiert. Im Gegensatz zu RAZ et al. gab es keinen Ausschluß der weißen Substanz; in dieser Studie sind die ROI somit Areale aus der Gesamtheit von grauer und weißer Substanz. Der DLPFC wurde durch den Sulcus orbitales vom OFC getrennt. Dabei wurde der Sulcus orbitales markiert und eine von ihm ausgehende Verbindungslinie senkrecht auf die Mittellinie, zwischen den Hemispheren, gezogen. In den letzten rostral vor dem Genu copus callosum gelegenen Schichten, stellte sich auch der ACC dar. Er ist durch den inferioren und superioren Sulcus begrenzt. Die 36 Funktion „sagital reconstruction“ ermöglichte, mittels zusätzlicher Sagitalschnitte, eine bessere Lokalisation des ACC. Die letzte Region, der OFC, wurde zum einen lateral durch den Sulcus orbitales (bzw. Sulcus frontomarginales) zum anderen medial durch den Sulcus olfactorius begrenzt. Der Sulcus olfactorius stellt die Grenze zum Gyrus rectus dar. Dieser ist durch seine charakteristische Form sehr einfach zu identifizieren und dann zu separieren. Zur Normalisierung der einzelnen Areale war die Bestimmung des gesamten cerebralen Volumens von großer Relevanz. Da es sich hierbei in gewissermaßen nur um einen Korrekturfaktor handelte, reichte die Messung jeder zehnten Schicht. Das Gesamthirnvolumen beinhaltete dabei das Cerebrum und dem Hirnstamm kranial der Pons. Das Cerebellum wurde separat, seitengetrennt gemessen (hierbei wurde genauigkeitshalber die Messung jeder fünften Schicht vorgenommen). Sowohl für das Gesamtvolumen wie auch für das Cerebellum wurde die Funktion manual tracing gewählt und das gewünschte Areal mittels Cursor umfahren und markiert. DLPFC 37 OFC ACC 38 II.3.NORMALISIERUNG DER EINZELVOLUMINA (ROI) Um die Unterschiede zu korrigieren, die sich aus den unterschiedlichen Gehirnvolumina zwischen den Gruppen ergaben, wurden die ROIs in Hinblick auf das Gehirnvolumen normalisiert. Als Berechnungsgrundlage diente hierbei, die von CENDES vorgeschlagene Methode 12 . Dabei wurde das gemessene Volumen der entsprechenden ROI mit dem Mittelwert der Gesamthirnvolumina der gesunden Kontrollen multipliziert und durch das individuelle Gesamthirnvolumen dividiert: V (korrigiert) = V (ROI) x MBV / IBV MBV (mean brain volume) = Mittelwert des Gehirnvolumens der gesunden Kontrollen IBV (individual brain volume) = individuelles Gehirnvolumen 39 II.4.RELIABILITÄTSBESTIMMUNG Voraussetzung präziser Meßergebnisse ist eine hohe Reliabilität, d.h. die Ergebnisse müssen auch reproduzierbar sein. Im vorliegenden Fall ist die sog. „Intra-rater-repeatability“ entscheidend. D.h. ein Beobachter muss, wenn er zu unterschiedlichen Zeitpunkten dasselbe MRI-Bild mißt, eine möglichst hohe Übereinstimmung der gemessenen Volumina erreichen. In der vorliegenden Arbeit wurde ein Zeitabstand von 3 Wochen zwischen den Messungen eingehalten, damit die zweite Messung unabhängig von der ersten erfolgt (bei zu kurzen Zeitspannen kann ein sog. “Memory Effekt“ die Messung beeinflussen). Als Maß dieser Reproduzierbarkeit wurde nun der Intraclass Correlation Coefficient (ICC) nach STREINER und NORMANN bestimmt 5, 53 . Der ICC berechnet sich als Quotient der Varianz aus den Unterschieden zwischen zwei (oder mehr) Beobachtungen in Bezug zu der Varianz aus Unterschieden zwischen Einzelwerten innerhalb einer Gruppe: ICC = (S between – S within) / S between ICC = Intraclass Correlation Coefficient Sbetween = Varianz zwischen den Individuen Swithin = Varianz zwischen erster und zweiter Messung 40 II.5.STATISTIK Die gemessenen Volumina wurden zunächst in eine SPSS Datei eingegeben und durch klinische Patientendaten (Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Studiengruppe) ergänzt. Die Daten waren während der Messungen nicht bekannt, um die Messergebnisse nicht zu beeinflussen. Die korrigierten Volumina wurden ebenfalls hinzugefügt. Zur sta tistischen Auswertung wurde ein sog. T-Test für unabhängige Stichproben durchgeführt. Methodisch wurde dabei wie folgt vorgegangen: Man unterteilte die gemessenen MRI-Daten in 2 separate Untersuchungen: 1.Männliche Kontrollen versus Patienten mit ADHS (ausschließlich maskuline Patienten in der Studie) 2.Weibliche Kontrollen versus Patientinnen mit BPD (ausschließlich feminine Patienten in der Studie) Die Patienten und Kontrollen waren somit jeweils gematched auf Alter und Geschlecht. Die Ergebnisse der MRI-Untersuchung wurden für die einzelnen Parameter - Gesamthirnvolumen - Volumen des linken DLPFC (korrigiert) - Volumen des rechten DLPFC (korrigiert) - Volumen des linken OFC (korrigiert) - Volumen des rechten OFC (korrigiert) - Volumen des linken ACC (korrigiert) - Volumen des rechten ACC (korrigiert) - Volumen des linken Cerebellum (korrigiert) - Volumen des rechten Cerebellum (korrigiert) - Alter mittels T-Test bei unabhängigen Stichproben verglichen. 41 III.ERGEBNISSE III.1.PATIENTEN UND KONTROLLEN Es wurden insgesamt n = 41 Personen untersucht; davon waren 17 männliche und 8 weibliche Kontrollpersonen, 8 männliche Patienten mit ADHS und 8 Patientinnen mit BPD. Die männlichen Kontrollen und die ADHS-Patienten ergaben die 1.Untersuchungsgruppe, die weiblichen Kontrollen und die BPD-Patientinnen die 2.Gruppe. Das durchschnittliche Alter der männlichen Kontrollen betrug 30,18 Jahre (SD 4,43 Jahre), das der ADHS-Patienten 31,38 Jahre (SD 7,89). Die weiblichen Kontrollpersonen waren im Mittel 30,50 Jahre alt (SD 5,10), die BPD-Patientinnen 33,50 Jahre (SD 6,50). Es ergibt sich kein signifikanten Unterschied hinsichtlich des Alters. Die beiden Untersuchungsgruppen bestanden jeweils aus Personen des gleichen Geschlechts, somit waren die beiden Gruppen auf Alter und Geschlecht gematched. Gruppenverteilung Anzahl 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Con.m. ADHS 1.Gruppe Con.m.=männliche Kontrollen Con.f. =weibliche Kontrollen ADHS =Patienten mit ADHS BPD =Patienten mit BPD Con.f. 2.Gruppe BPD 42 Altersverteilung 40 35 Jahre 30 25 20 15 10 5 0 Con.m. ADHS Con.f. BPD Con.m =männliche Kontrollen Con.f. =weibliche Kontrollen ADHS =Patienten mit ADHS BPD =Patienten mit BPD III.2.VOLUMETRIE III.2.1.RELIABILITÄT Die Intra-Rater Reliabilität wurde anhand wiederholter Messung von 15 MRI-Bildern bestimmt. Dabei lagen zwischen den beiden Messungen mehr als 3 Wochen. DLPFC Der Intraclass Correlation Coefficient (ICC) betrug für den rechten DLPFC 0,99 und für den linken DLPFC 0,98. OFC Für den rechten OFC betrug der ICC 0,96, für den linken OFC 0,98. ACC Der ICC des rechten ACC lag bei 0,94 der des linken bei 0,91. Sämtliche ICC zeigen Werte > 0,9 und damit ist eine verlässliche Reliabilität angezeigt. Unter diesen Voraussetzungen konnte mit der Messung der MR-Bilder der Patienten und Kontrollen begonnen werden. 43 III.2.2 VOLUMETRIE III.2.2.1 GESAMTHIRNVOLUMEN Die Messung der Gesamthirnvolumina ergab bei der 1.Untersuchungsgruppe einen Mittelwert von 1075,04cm3 (SD 118,54, KI 1018,68; 1131,39) bei den Kontrollen und im Mittel 1174,34cm3 (SD 187,76, KI 1044,23; 1304,45) bei den Patienten mit ADHS. In der 2.Gruppe lag das Durchschnittsvolumen der Kontrollen bei 1176,92cm3 (SD 216,26, KI 1027,06; 1326,78), das der BPD-Patientinnen bei 1236,04cm3 (SD 140,62, KI 1138,60; 1333,49). Der T-Test für unabhängige Stichproben ergab für die 1.Gruppe p =0,119, T-Wert von ? 1,618 und einen df (degree of freedom)-Wert von 23 und für die 2.Gruppe p =0,527, T = - 0648 und df =14. Die Gesamthirnvolumina waren somit in keiner der Gruppen signifikant gegenüber den Kontrollen verschieden. Da die Gruppen jeweils auf Geschlecht gematched waren, musste man keine geschlechtsspezifischen Volumenunterschiede berücksichtigen. Totalhirnvolumen (95%KI) Volumen in ccm 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 Con.m. ADHS Con.m. =männliche Kontrollen Con.f. =weibliche Kontrollen ADHS =Patienten mit ADHS BPD =Patienten mit BPD Con.f. BPD 44 III.2.2.2 DLPFC Die Volumina der dorsolateralen präfrontalen Cortices betrugen bei den gesunden männlichen Kontrollen links 52,78cm3 (SD 9,95cm3; KI 48,06; 57,50) und rechts 50,34cm3 (SD 9,12; KI 46,01; 54,67). In der Gruppe der ADHS-Patienten betrug das linke DLPFC-Volumen 53,71cm3 (SD 4,37, KI 50,69; 56,73) und das rechte 48,53cm3 (SD 11,18, KI 40,79; 56,27). Bei den weiblichen Kontrollpersonen betrugen das Volumen des linken DLPFC im Mittel 56,13cm3 (SD 9,06, KI 49,86; 62,40) und des rechten 49,21cm3 (SD 12,28, KI 40,70; 57,72). Die BPD-Patientinnen hatten ein durchschnittliches DLPFC-Volumen von 49,15cm3 links (SD 9,73, KI 42,40; 55,89) und rechts von 45,22cm3 (SD 12,91, KI 36,27; 54,17). Somit besteht weder zwischen den männlichen Kontrollen und den Hyperkinetischen Patienten noch zwischen den weiblichen Kontrollen und den Borderline-Patientinnen in Bezug auf den linken oder rechten DLPFC ein signifikanter Volumenunterschied. T-Test für unabhängige Stichproben: Gruppe 1: p (links) =0,804, T (links) = -0,324, df (links) =22,98, p (rechts) =0,671, T (rechts) =0,430, df (rechts) =23. Gruppe 2: p (links) =0,160, T (links) =1,485, df (links) =14, p(rechts) =0,537, T (rechts) =0,633, df (rechts) =14. 45 DLPFC li.( 95% KI) 70 Volumen in ccm 60 50 40 30 20 10 0 Con.m. ADHS Con.f. BPD Con.m. =männliche Kontrollen Con.f. =weibliche Kontrollen ADHS =Patienten mit ADHS BPD =Patienten mit BPD DLPFC re.(95% KI) 70 Volumen in ccm 60 50 40 30 20 10 0 Con.m. ADHS Con.m. =männliche Kontrollen Con.f. =weibliche Kontrollen ADHS =Patienten mit ADHS BPD =Patienten mit BPD Con.f. BPD 46 III.2.2.3 OFC Bei den Kontrollen der Gruppe 1 wurde ein durchschnittliches Volumen von 14,04cm3 (SD 1,85, KI 13,16; 14,92) für den linken OFC und 12,98cm3 (SD 2,13, KI 11,96; 13,99) für den rechten OFC gefunden. Die Patienten mit ADHS hatten ein linkes OFC-Volumen von 12,39cm3 (SD 1,65, KI 11,24; 13,53) und ein rechtes von 11,94cm3 (SD 2,33, KI 10,33; 13,55). Das Volumen des OFC der weiblichen Kontrollen betrug links 13,79cm3 (SD 1,52, KI 12,73; 14,84),rechts 12,12cm3 (SD 1,93, KI 10,77; 13,46). Das mittlere Volumen des linken OFC der BPD-Patientinnen lag bei 10,50cm3 (SD 1,41, KI 9,53; 11,48) und das des rechten bei 10,59cm3 (SD 1,38, KI 9,63; 11,54). Hier ist der T-Test für den linken OFC in beiden Fällen signifikant –in Gruppe 2 sogar hochsignifikant. T-Test für unabhängige Stichproben ergab: Gruppe 1: p (links) =0,040, T (links) =2,151, df (links) =23, p (rechts) =0,281, T (rechts) =1,103, df (rechts) =23. Gruppe 2: p (links) =0,001, T (links) =4,479, df (links) =14, p (rechts) =0,090, T (rechts) =1,824, df (rechts) =14. 47 OFC li. (95% KI) 16 Volumen in ccm 14 12 10 8 6 4 2 0 Con.m. Con.m. Con.f. ADHS BPD ADHS Con.f. BPD =männliche Kontrollen =weibliche Kontrollen =Patienten mit ADHS =Patienten mit BPD OFC re. (95% KI) 16 Volumen in ccm 14 12 10 8 6 4 2 0 Con.m. ADHS Con.m. =männliche Kontrollen Con.f. =weibliche Kontrollen ADHS =Patienten mit ADHS BPD =Patienten mit BPD Con.f. BPD 48 III.2.2.4 ACC Die männlichen Kontrollpersonen hatten ein mittleres ACC-Volumen links von 1,90cm3 (SD 0,54, KI 1,64; 2,16) und rechts von 2,05cm3 (SD 0,71, KI 1,72; 2,39). Das Volumen bei den ADHS-Patienten lag bei 1,92cm3 links (SD 0,60, KI 1,50; 2,33) und 2,14cm3 rechts (SD 0,49, KI 1,81; 2,48). Bei den Kontrollen der zweiten Gruppe betrug das Volumen des linken ACC 2,23cm3 (SD 0,63, KI 1,79; 2,66) und des rechten 2,36cm3 (SD 0,44, KI 2,06; 2,67). Die ACC der BPD-Patientinnen waren links durchschnittlich 1,94cm3 (SD 0,28, KI 1,74; 2,13) und rechts 1,73cm3 (SD 0,39, KI 1,46; 2,00) groß. Somit liegt in Gruppe 1 kein signifikanter Unterschied zwischen Patienten und Kontrollpersonen vor. T-Test für unabhängige Stichproben: Gruppe 1: p (links) =0,941, T (links) = -0,075, df (links) =23, p (rechts) =0,750, T (rechts) =? 0,323, df (rechts) =23. In der zweiten Gruppe gab es jedoch einen signifikanten Unterschied im Volumen des rechten ACC. T-Test für unabhängige Stichproben: Gruppe 2: p (links) =0,247, T(links) =1,208, df (links) =9,599, p (rechts) =0,008, T (rechts) =3,073, df (rechts) =14. 49 ACC li. (95% KI) Volumen in ccm 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Con.m. ADHS Con.f. BPD Con.m.=männliche Kontrollen Con.f. =weibliche Kontrollen ADHS =Patienten mit ADHS BPD =Patienten mit BPD ACC re. (95% KI) Volumen in ccm 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Con.m. ADHS Con.m.=männliche Kontrollen Con.f. =weibliche Kontrollen ADHS =Patienten mit ADHS BPD =Patienten mit BPD Con.f. BPD 50 III.2.2.5 CEREBELLUM In Gruppe 1 betrug das Volumen des Cerebellums bei den Kontrollen links 76,98cm3 (SD 6,12, KI 74,07; 79,89 ) und rechts 77,40cm3 (SD 5,74, KI 74,67; 80,13 ), bei den ADHS-Patienten lag das Volumen links bei 75,15cm3 (SD 6,66, KI 70,54; 79,76 ) und rechts bei 74,50cm3 (SD 8,14, KI 68,86; 80,14 ). Die weiblichen Kontrollen hatten ein Kleinhirnvolumen von 77,27cm3 links (SD 10,35, KI 70,10; 84,44 ) und 75,29cm3 rechts (SD 11,30, KI 67,46; 83,12 ). Die BPD-Patientinnen wiesen ein mittleres Cerebellarvolumen von links 68,48cm3 (SD 6,71, KI 63,83; 73,13 ) und rechts 67,78cm3 (SD 7,27, KI 62,74; 72,82 )auf. In Gruppe 1 liegt somit kein signifikanter Unterschied zwischen Patienten und Kontrollen vor. T-Test für unabhängige Stichproben: Gruppe 1: p (links) =0,503, T (links) =0,680, df (links) =23, p (rechts) =0,312, T (rechts) =1,033, df (rechts) =23. Für die weiblichen Kontrollen und die BPD-Patientinnen besteht bezüglich des rechten Kleinhirnvolumens kein signifikanter Unterschied. Bezüglich des linken Cerebellarvolumens findet sich ein grenzwertig signifikanter Befund. T-Test für unabhängige Stichproben: Gruppe 2 : p (links) =0,063, T (links) =2,015, df (links) =14 p (rechts) =0,136, T (rechts) =1,581, df (rechts) =14. 51 Cerebellum li. (95% KI) Volumen in ccm 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Con.m. ADHS Con.f. BPD Con.m. =männliche Kontrollen Con.f. =weibliche Kontrollen ADHS =Patienten mit ADHS BPD =Patienten mit BPD Cerebellum re. (95% KI) 85 Volumen in ccm 80 75 70 65 60 55 50 Con.m. ADHS Con.m. =männliche Kontrollen Con.f. =weibliche Kontrollen ADHS =Patienten mit ADHS BPD =Patienten mit BPD Con.f. BPD 52 III.3 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE Die Messungen wurden in zwei Studiengruppen (Gruppe 1 und 2) geteilt, welche jeweils wieder aus einer Patienten und einer Kontrollgruppe bestanden. Auf diese Art wurden die Gruppen auf Geschlecht (Gruppe 1: ausschließlich maskuline Personen; Gruppe 2: nur feminine Individuen) sowie auf Alter (kein signifikanter Unterschied im T-Test) gematched. Die Hauptbefunde der Studie waren: 1. Signifikant kleinerer OFC links der ADHS-Patienten gegenüber den Kontrollen 2. Signifikant kleinerer OFC links der BPD-Patienten gegenüber den Kontrollen 3. Signifikant kleinerer ACC rechts der BPD-Patienten gegenüber den Kontrollen 4. Andeutungsweise signifikant kleineres Cerebellum links der BPD-Patienten gegenüber den Kontrollen 5. Ansonsten keine signifikanten Volumenänderungen. 53 IV. DISSKUSSION IV.1 METHODEN IV.1.1 AUSWAHL DER PATIENTEN UND KONTROLLEN LYOO et al. beschreiben in ihrer Arbeit von 1998 die erste MRI-Studie, die sich mit strukturellen Änderungen des Gehirns bei Patienten mit der Diagnose BPD befasste 34 . Sie untersuchten dabei 25 Patienten mit BPD sowie 25 auf Alter und Geschlecht gematchte gesunde Kontrollpersonen. Mittels T1- und T2-gewichteten MRTSequenzen wurden die Volumina der Frontallappen, der Temporallappen, der Seitenventrikel und der Hemispheren untersucht. Im Vergleich zu vorangegangene n CT-Studien wurden in der oben erwähnten Studie, die Patienten mit BPD und gleichzeitig anderen komorbiden psychiatrischen Erkrankungen von der Studie ausgeschlossen. In den zuvor erfolgten Studien hatte man aufgrund der hohen Komorbidität von BPD und anderen Achse I oder Achse II Störungen auf eine strikte Trennung des Störungsbildes verzichtet oder es wurden keine detaillierten Angaben zur Auswahl der Patienten gemacht 33, 48, 50. In der hier vorliegenden Studie wurden nur BPD-Patienten, die zuvor nach ICD-10 und DSM-IV diagnostiziert worden waren und die Kriterien des DIB -R mit mindestens 8 von 10 Punkten erfüllten, ausgewählt. Diese Selektion geschah in Anlehnung an eine Arbeit von ZANARINI et al., der eine Unterscheidung von BPD-Patienten zu anderen Patienten mit einer Achse II Störung diskutiert und erörtert 65 . Die Patienten wurden nur dann in die Studie integriert falls ebenfalls kein Hinweis auf einen Alkohol- oder Drogenabusus bestand. Des Weiteren durfte keine bipolare Störung, Anorexie, Lernstörung, pesistierende Schizophrenie oder Major Depression vorliegen. Zur weitern Abgrenzung des Krankheitsbildes versus möglicher artefizieller Effekte mussten die Patienten in der vorliegenden Studie unmediziert sein. So konnte, in Entsprechung zu der Arbeit von LYOO und im Gegensatz zu den Studien von Schulz et al., ein möglicher Einfluß anderer psychiatrischer Erkrankungen auf die gemessenen Areal auf ein Minimum reduziert werden. Die strenge Selektion wirkte sich auf die Fallzahl aus. Bei LYOO konnten am Ende von 118 BPD-Patienten letztlich nur 25 die Studienbedingungen erfüllen. In der vorliegenden Arbeit wurden nach Anwendung der Ausschlußkriterien n =8 Patienten mit BPD in die Studie eingeschlossen. 54 Somit ist das Kollektiv der BPD Patientinnen in sich sehr homogen und mögliche indifferierende psychiatrische Erkrankungen waren weitestgehend, soweit sie bekannt waren, ausgeschlossen worden. Trotz der insgesamt kleinen Fallzahl zeigten die Ergebnisse dieser Arbeit signifikante Volumensabweichungen einzelner Areale. Der a-Fehler (oder Fehler 1. Art ) ist unabhängig von der Stichprobenzahl und liegt bei einem in dieser Studie gewähltem 95% Konfidenzintervall bei 5%. Das sind bei einer Gaußschen- Normalverteilung die Ereignisse, die auf beiden Seiten jenseits der doppelten Standardabweichung liegen (je 2,5%) und somit als sehr unwahrscheinlich als Zufallbefund gewertet werden können. Im Gegensatz dazu steht der so genannte ß -Fehler (oder auch Fehler 2. Art ). Dieser ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, bei einer Studie einen falsch negativen Befund zu bekommen, d.h. die Messungen fallen nicht signifikant aus, obwohl die Möglichkeit einer Signifikanz gegeben ist. Bei relativ kleinen Stichprobengrößen muss man sich dieser Fehlerquelle immer bewusst sein- v.a. wenn keine signifikanten Ergebnisse vorliegen. Wenn jetzt auch noch das Studienkollektiv nicht restriktiv gewählt wird, ist die Wahrscheinlichkeit eines ß -Fehlers größer. IV.1.2.DATENAQUISITION Um der Frage der Volumenänderung definiter Hirnareale bei ADHS und BPD nachgehen zu können, ist man auf das Vorliegen geeigneter 3D-MR-Datensätze angewiesen. Diese müssen alle nach einem standardisierten Verfahren aufgenommen werden. Die hier angewendete MR-Aufnahmetechnik wurde bereits in anderen Studien genutzt 24, 58 . Durch ein festgesetztes FOV konnte eine bessere Vergleichbarkeit der einzelnen MRI-Datensätze erreicht werden. Die Patienten waren für die Messungen hochmotiviert und kooperativ. Die Qualität der Aufnahmen war in der Regel gut. Somit waren die für die Messung notwendigen Voraussetzungen erfüllt. 55 IV.1.3.VALIDITÄT UND RELIABILITÄT Die Festlegung der Grenzen der ROI erfolgte nach dem durch RAZ et al. etablierten Protokoll 43 . In der oben erwähnten Studie wurden verschiedene Hirnareale von 148 gesunden Freiwilligen vermessen, an denen eine Hirnsubstanzabnahme einzelner Areale mit dem Altern in Korrelation gesetzt wurde. Neben der Unterteilung in einzelne ROI erfolgte eine Untergliederung in graue und weiße Substanz 43 . In der hier vorliegenden Studie wurde für die Messung die graue und weiße Substanz nicht separiert, sondern es erfolgte vielmehr die komplette Messung einer ROI, bestehend aus grauer und weißer Substanz. Dadurch legte man die Lage einer möglichen Veränderung vor Messbeginn nicht fest. Die ausgewählte Computersoftware zum Messen der einzelnen Areale war ebenfalls different zu der von RAZ verwendeten. RAZ benutzte eine JAVA Software (Jandel Scientific Co., San Rafael, CA). Aufgrund technischer Limitationen mussten die gewonnenen MRI-Bilder zunächst auf VHS Kassette übertragen werden und konnten erst in einem zweiten Schritt digitalisiert werden. Solch eine Vorgehensweise führt unweigerlich zu einem erheblichen Qualitätsverlust der Aufnahmen. In der vorliegenden Arbeit erfolgte im Gegensatz dazu eine direkte Datenaquisation und –verarbeitung. So konnte eine Bearbeitung von MRI-Datensätzen von hoher Bildqualität erfolgen. Bei RAZ mussten die auf Video übertragenen Bilder helligkeits- und kontrastkorregiert werden, anschließend konnten die so genannten Areas of interest (AOI) umfahren werden, die dann wiederum an die JAVA-Software übertragen wurden. Die AOI wurden über ein Basisvolumen-Berechnungsprogramm addiert und mit dem Schichtabstand multipliziert. Aus zeittechnischen Gründen wurde nur jede 3.Schicht vermessen. Bei einem Schichtabstand von 4,5mm, wurden also nur alle 13,5mm die AOI „nachkorrigiert“. Diese Art der Auswertung führt zu einer erheblichen Ungenauigkeit, kleinere Änderungen zwischen den relativ weit auseinander liegenden Schichten konnten nicht registriert werden. In der hier vorliegenden Arbeit wurden die gewonnenen MRI-Datensätze direkt über eine speziell entwickelte Software (brucker to Mreg) an die für die volumetrische Messung verwe ndete Software (MRreg)transferiert. Die Anwendung der Software MRreg war zuvor durch multiple Studien getestet und etabliert worden 31, 32, 56, 62 . In dieser Studie erfolgte eine kontinuierliche Messung jeder Schicht, bei einer 56 Schichtdicke von 1,8mm. Insofern liegt die Sensitivität dieser Methode deutlich überhalb der vo n RAZ. Die Ergebnisse der Messung des Intraclass Correlation Coefficient (ICC) lagen mit Werten zwischen 0,91 und 0,99 in dem Bereich einer hohen Reliabilität, vergleichbar mit entsprechenden Werten anderer Studien 43, 56 . IV.2.MRI-BEFUNDE Mit der volumetrischen Messung von Frontalhirnarealen bei ADHS und BPD haben sich bereits andere Studien beschäftigt. Diese Arbeit ist jedoch nach zum Zeitpunkt der Fertigstellung vorliegenden Literaturrecherchen, die erste Studie, die das Frontalhirnvolumen bei ADHS und BPD sehr präzise in Subregionen untergliedert und diese dann einzeln quantifiziert. In einer von SHELINE et al. 1996 veröffentlichten Arbeit geht es um den Vergleich MRT-volumetrisch gemessene n Frontalhirnareale versus stereologischer Techniken auf dem Prinzip von Cavalieri basierend 49, 60 . Der Frontallappen wurde dabei nicht weiter unterteilt und lediglich als Hirngewebe vor der vorderen Kommisur unter Ausschluß des Temporallappens definiert. Die Autoren behaupten von sich, in der angewendeten Methode sehr präzise sogar kleine Volumenunterschiede registrieren zu können. LYOO et al. vermaßen MRT-technisch ebenfall das Volumen des gesamten frontalen Kortex 34 . Die zuletzt erwähnte Studie unterlag auch methodischen Limitationen wie einer zwei-dimensionalen Dartenaquisition und einer dicken Schichtdicke. Im Gegensatz dazu wurde in der hier vorliegenden Arbeit eine um vieles genauere Untergliederung in Substrukturen vorgenommen. Dadurch konnten auch sehr kleine 57 Änderungen in einem einzelnen Areal registriert werden. Während das Gesamthirnvolumen sich für die beiden Störungsbilder sich nicht signifikant gegenüber den Kontrollen unterscheidet, ergaben sich in den einzelnen ROIs durchaus Veränderungen. Dies kann man sich durch eine Verminderung des ? -Fehlers (falsch negatives Ergebnis) bei genauerer Begrenzung der Regionen, erklären. Je präziser die ROIs begrenzt werden, desto eher wird eine vorhandene Volumenänderung auch entdeckt. Für Regionen, die keine signifikante Veränderung aufweisen, stellt sich immer noch die Frage, ob es sich vielleicht nur um ein falsch negatives Ergebnis handelt oder ob tatsächlich keine Änderung vorliegt. Durch die Blindung während der Messung (d.h. zum Zeitpunkt der Messung war nicht bekannt, welcher Studiengruppe der MRI-Datensatz gehört) konnte die so genannte „rater bias“ vernachlässigt werden. Diskussion der Ergebnisse: 1. Gesamthirnvolumen: Bei einem Volumen von durchschnittlich 1075,04cm3 (männl. Kontrollen), 1174,34cm3 (ADHS), 1176,92cm3 (weibl. Kontrollen) und 1236,04cm3 (BPD) ist die normale Streuung schon so groß, dass erst sehr große Abweichungen zur Signifikanz führen würden. Mit einer so drastischen Änderung des Volumens ist jedoch bei den untersuchten Krankheitsbildern nicht zu rechnen 49 . Insofern ist eine fehlende signifikante Abweichung nicht verwunderlich. 2. DLPFC: Es ergaben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Kontrollen und ADHS, bzw. Kontrollen und BPD. Zeichen von umgedrehter Frontallappenasymmetrie rechts < links (statt links < rechts ), wie sie von einer Gruppe (PUEYO et al.) der Universität Barcelona festgestellt worden war, konnten in dieser Studie bei ADHS nicht im signifikanten Niveau nachgewiesen werden 42 . Allerdings war bei PUEYO auch die Unterteilung in die gemessenen Areale verschieden. Er traf seine Aussagen für den ganzen PFC, eine weitere Unterteilung in DLPFC, OFC und ACC fand bei ihm nicht statt. TEBARTZ VAN ELST et al. konnten in einer [1H]-MR-Spektroskopie bei Patienten mit BPD eine signifikante 19%-ige Reduktion der absoluten N-Acetylaspartat (NAA) Konzentration im Bereich des DLPFC nachweisen 58 . Ein Hinweis auf 58 eine Änderung der N-Acetylaspartat / Kreatin und Phosphokreati n oder Cholin / Kreatin Quotienten ergaben sich nicht. In einer weiteren MR-spektroskopischen Studie (HESSLINGER et al. ) wurden die NAA-Konzentrationen des DLPFC bei Patienten mit ADHS vermessen. Hierbei erfolgte eine weitere Differenzierung in ADHD (hyperaktiver-impulsiver Typ ) und ADD (unaufmerksamer Typ ) 24 . Es zeigte sich eine signifikante Verminderung der absoluten NAA-Konzentration bei der ADHD- Untergruppe. JENKINS et al. hatten in einer Arbeit gezeigt, dass die NAA-Konzentrationen in Zusammenhang mit einer Zellintegrität stehen und dass eine NAA-Verminderung als Zeichen eines stattgehabten Zelluntergangs zu sehen ist 26 . Obwohl anhand dieser Studienergebnisse eine Volumenänderung des DLPFC zu erwarten wäre, konnte diese in der hier vorliegenden Arbeit nicht nachgewiesen werden. Im Gegensatz zu HESSLINGER et al. wurden in dieser Arbeit die Patienten mit ADHS auch nicht weiter untergliedert, um bei insgesamt schon kleinem Studienkollektiv (n =8 Patienten mit ADHS) die Fallzahl nicht noch weiter durch Zerteilung zu reduzieren. Die Arbeit von HESSLINGER basierte auf jeweils n = 5 Probanden pro Gruppe (ADHD, ADD und gesunde Kontrollen). MRS Studien zu den anderen Frontalhirn Subregionen bei BPD und ADHS sind nach dem Stand der Literaturrecherche bei Fertigstellung dieser Arbeit nicht bekannt. 3. OFC: In beiden Studiengruppen war der OFC links signifikant kleiner gegenüber den entsprechenden Kontrollen. Der OFC rechts wies keine signifikante Änderung auf. In einer von LYOO durchgeführten Studie wurde bei 25 Patienten mit BPD und 25 gesunden auf Alter und Geschlecht gematchte Kontrollen MRI morphologisch das Gesamthirnvolumen, der Frontallappen, der Temporallappen und der laterale Ventrikel vermessen 34 . Das Ergebnis eines verminderten Frontallappens links, lässt sich nicht ganz problemlos mit der in dieser Arbeit gefundenen Reduktion des OFC links vergleichen. In dieser Arbeit handelt es sich um die Änderung einer definierten Subregion, während LYOO von einer Volumenreduktion des gesamten linken Frontallappens berichtet. Dabei ist als technische Limitation der zitierten Arbeit die Schichtdicke von 5mm sowie das Bestehen der Messung erwähnenswert 34. des Frontallappens aus nur ca.6 -9 Schichten 59 Eine Reduktion des Volumens des OFC wurde bereits bei anderen psychiatrischen Störungsbildern beschrieben. SZESZKO et al. fanden eine orbitofrontale Volumenabnahme bei OCD (obsessive- copulsive disorder) 55 . Eine Korrelation zwischen einem verminderten OFC-Volumen und Depression wurde in einer Arbeit von BREMNER et al. gefunden 7. Aufgrund dieser so genau lokalisierte Volumenabnahme einer Subregion und der entsprechenden Pathophysiologie ist eine Einbeziehung des lateral-orbitofrontal-subcorticalen Regelkreises anzunehmen 1. Da dieser funktionell für ein soziales, empathisches Verhalten von Bedeutung ist, führt eine Dysfunktion zu diversen Persönlichkeitsänderungen wie beispielsweise Impulsivität, Irritierbarkeit und Gefühlsstörungen, die auch bei ADHS und BPD vorliegen 13. Ob die gemessenen Veränderungen als typisch für die untersuchten Krankheiten angesehen werden können oder ob sie vielmehr Ausdruck der mit den Symptomen einhergehenden Störungsbildern sind, ist noch nicht mit letzter Sicherheit zu sagen. Die Vielzahl unterschiedlicher Störungen, die mit einer Verminderung des OFC- Volumen einhergehen und gleichzeitig eine Teilübereinstimmung der krankheitstypischen Symptome aufweisen, könnte jedoch die Hypothese untermauern, dass die morphologische Veränderung durch die Symptome und entsprechende physiologische Dysfunktion zurückzuführen ist. 4. ACC: Es stellte sich eine signifikant kleineres ACC-Volumen der BPDPatientinnen gegenüber den gesunden Kontrollpersonen dar. Der ACC ist als Teil des limbischen Systems zu sehen 27 . Früher führte man bei Angst- und Aggressionszuständen neurochirurgisch eine Cingulektomie durch und erreichte dadurch den Rückgang dieser Symptome 57 . Allerdings entwickelten diese Patienten dann häufig schwere Persönlichkeitsveränderungen. Sie wirkten verlangsamt und es mangelte ihnen an psychomotorischem wie an lokomotorischem Antrieb. Deswegen kam man schnell wieder von diesem operativen Verfahren ab 57 . Der Gyrus cinguli steht mit anderen Strukturen des limbischen Systems, sowie afferent wie auch efferent mit fast allen Bereichen der Großhirnrinde und dem Striatum in Verbindung 1, 13 . Daher kann man davon ausgehen, dass Störungen in diesem Bereich vielfältige Auswirkungen haben können. So wird eine Beteiligung des ACC bei akinetischem Mutismus, apatischen Zustandsbildern sowie dem Gefühl einer psychischen „Leere“ 60 angenommen 36, 37 . Bei der BPD kommt es durch die in den meisten Fällen bestehende Traumatisierung in der Kindheit zu einer Hypersensitivierung des limbischen Systems 3, 6 . In wieweit diese Sensitivierung zu einer quantitativen Veränderung führen kann, bleibt noch o ffen. Neuere Studien postulieren eine Beteiligung des ACC an der Verarbeitung der Wahrnehmungs- und Gefühlskomponente von Schmerzen (HOFBAUER et al, OLAUSSON et al, SAWAMOTO et al) 25, 40, 47 . Inwiefern diese Schmerz- wahrnehmungen mit dem selbstverletzenden Verhalten von BPD-Patienten in Zusammenhang stehen, ist noch nicht ausreichen geklärt und ist Gegenstand der Forschung 6, 52 . Hingegen ist schon länger bekannt, sowohl aus klinischen als auch aus experimentellen Beobachtungen, dass bei BPD eine Störung des Schmerzempfindens vorliegt 3, 6, 46 . So hätten Patienten mit BPD und selbstverletzendem Verhalten meist eine verminderte Schmerzwahrnehmung 6, 46 . Das Ergebnis der vorliegenden Arbeit mit einer Verminderung des rechtsseitigen ACC-Volumens bei Patientinnen mit BPD deckt sich somit sehr gut mit den Beobachtungen aus den oben erwähnten Studien, die dem ACC eine Beteiligung der Schmerzverarbeitung zuschreiben und die Beobachtung, dass bei Patienten mit BPD eine Störung des Schmerzempfindens vorliegt 3, 6, 25, 40, 46, 47 . Ein Zusammenhang zwischen einer volumetrischen Veränderung des ACC in der vorliegenden Arbeit und dem selbstverletzenden Verhalten bei Patienten mit BPD kann jedoch aus den in dieser Studie gewonnenen Daten nicht gezogen werden. Dazu wären weitere Studien mit anderen Fragestellungen und Untersuchungen nötig. 5. Cerebellum: Es zeigte sich ein tendenziell verkleinertes Cerebellarvolumen links bei den BPD-Patientinnen. Die Hirnforschung beschäftigte sich schon lange mit der Erforschung des Cerebellums. Dabei wurde bislang jedoch vornehmlich Funktionen wie: - Steuerung und Modulation der stützmotorischen Anteile von Haltung und Bewegung - Steuerung der Feinabstimmung der Blickmotorik im Sinne der Stabilisierung des Blicks auf ein Blickziel - Koordination und Feinabstimmung der im Großhirn entworfenen Zielmotorik vor allem der Extremitäten 61 fokussiert. In neuerer Zeit werden zunehmen auch mnestische Funktionen sowie der Zusammenhang von Abweichungen des cerebellaren Volumens zu psychiatrischen und neurologischen Krankheitsbildern diskutiert 10, 22, 64 . Über vielfältige Verbindungen u.a. zum Thalamus, muss das Cerebellum als nicht unerheblicher Teil des Gesamtsystems verstanden werden 27, 57 . In einer Studie von CASTELLANOS et al. konnte bei 50 Mädchen mit ADHS im Gegensatz zu der Kontrollgruppe, die aus 50 jungen, gesunden, weiblichen Kontrollpersonen bestand, eine signifikante Volumenreduktion Kleinhirnwurms festgestellt werden des posterior-inferioren 10 . Er verweist dabei auch auf seine vorhergehende Studie, welche das entsprechende Ergebnis bei Jungen mit ADHS zeigte 11 . In der vorliegenden Arbeit konnte im Gegensatz zu den Studien von CASTELLANOS et al. keine signifikante Änderung des cerebellären Volumens bei Patienten mit ADHS nachgewiesen werden. Bei der jedoch nur kleinen Gruppengröße ist auch das mögliche Vorliegen eines falsch negativen Befundes in Erwägung zu ziehen. Dafür zeigte sich in dieser Arbeit ein tendenziell kleineres Volumen des linksseitigem Cerebellums bei Patienten mit BPD. Zusammenfassend sind bei beiden Krankheiten genau zu lokalisierende Volumenabweichungen nachgewiesen worden. Bei ADHS- Patienten ein signifikant kleinerer OFC links, bei BPD-Patientinnen ein signifikant kleinerer OFC links, ACC rechts und ein andeutungsweise kleineres Cerebellum links. Weitere Untersuchungen an größeren Stichproben sind nötig um - wie bereits diskutiert- die Spezifität dieser Befunde zu überprüfen. Darüber hinaus muß in longitudinalen Studien geprüft werden, ob es sich bei den gefundenen volumetrischen Auffälligkeiten um Epiphänomene zur Psychopathologie („skate marker“) oder aber etwa um Vulnerabilitätsfaktoren handelt. Im letzteren Fall könnten die Ergebnisse dieser Studie langfristig auch von klinischer Relevanz sein, indem ein bestimmtes morphologisches Muster prädiktive Hinweise in Hi nblick auf ein Erkrankungsrisiko geben könnte und damit die Möglichkeit einer präventiven Intervention gegeben wäre. 62 ZUSAMMENFASSUNG Die hier vorgestellte Arbeit ist eine quantitative MRI-Studie. Es wurde der präfrontale Cortex in weitere Subareale unte rgliedert: in den dorsolateralen präfrontalen Cortex, den orbitofrontalen Cortex, den anterioren cingulären Cortex. Des Weiteren wurden das Cerebellum sowie das Gesamthirnvolumen vermessen. Bei einem Kollektiv von 1) n =8 männlichen Patienten mit Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätssyndrom und dazu gematched (auf Geschlecht und Alter) n =17 Kontrollen 2) n =8 weiblichen Patienten mit Borderline Persönlichkeitsstörung und dazu auf Geschlecht und Alter gematched n =8 Kontrollen wurden die oben genannten Areale seitengetrennt volumetrisch vermessen. Es zeigten sich eine signifikante Reduktion des linken orbitofrontalen Cortex der Patienten mit Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätssyndrom gegenüber den entsprechenden Kontrollen, sowie eine hochsignifikante Reduktion des linken orbitofrontalen Cortex, ein signifikant kleineres Volumen des anterioren cingulären Cortex sowie ein tendenziell kleineres linkes Cerebellarvolumen der Patientinnen mit Borderline Persönlichkeitsstörung gegenüber den zugehörigen Kontrollen. 63 LITERATUR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Alexander, G.E., M.R. DeLong, and P.L. Strick, (1986) Parallel organization of functionally segregated circuits linking basal ganglia and cortex. Annu Rev Neurosci, 9: p. 357-81. Association, A.P., (1994) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Dissorders-DSM-IV. American Psychiatric Association,Washington DC. Berger, M., Psychiatrie und Psychotherapie. Birnbaumer and Schmidt, Biologische Psychologie. (3. Auflage). Bland, J.M. and D.G. Altmann, (1996) Measurement errors and Correlation coefficients,Statistic notes. BMJ, 313: p. 41-42. Bohus, M., et al., (2000) Pain perception during self-reported distress and calmness in patients with borderline personality disorder and self-mutilating behavior. Prychiatry Research, 95: p. 251-260. Bremner JD, V.M., Vermetten E, Nazeer A, Adil J, Khan S, Staib LH, Charney DS, (2002) Reduced volume of orbitofrontal cortex in major deression. Biol Psychiatry, 51: p. 273-279. Brown, G.L., et al., (1982) Aggression, suicide, and serotonin: relationships to CSF amine metabolites. Am J Psychiatry, 139(6): p. 741-6. Buhot, M.C., S. Martin, and L. Segu, (2000) Role of serotonin in memory impairment. Ann Med, 32(3): p. 210-21. Castellanos, F.X., et al., (2001) Quantitative brain magnetic resonance imaging in gils with attention-deficit/hyperactivity disorder. Arch Gen Psychiatry, 58(3): p. 289-295. Castellanos, F.X., et al., (1996) Quantitative brain magnetic resonance imaging in attention-deficit hyperactivity disorder. Arch Gen Psychiatry, 53(7): p. 607-16. Cendes, F., et al., (1993) MRI volumetric measurement of amygdala and hippocampus in temporal lobe epilepsy. Neurology, 43(4): p. 719-25. Cummings, J.L. and M.S. Mega, (1994) Fronta l-subcortical Circuits and Neuropsychiatric Disorders. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience, 6: p. 358,370. Dauntry, C., (2000) Early N-acetylaspartate depletion is a marker of neuronal dysfunction in rats and primates chronically treated with mitochondrial toxin 3nitropropionic acid. Journal Cerebral Blood Flow Metab, 20: p. 789-799. Davis, J.M., N.L. Alderson, and R.S. Welsh, (2000) Serotonin and central nervous system fatigue: nutritional considerations. Am J Clin Nutr, 72(2 Suppl): p. 573S-8S. Drilling, H., W. Mombour, and M.H. Schmidt, Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD 10. 2. Auflage ed. Duus, P., (1995) Neurologisch topische Diagnostik. Ebert, D. and B. Heßlinger, (2000) Forensische Beurteilung der ADH/ADHS des Erwachsenenalters. Psycho, 26 (4): p. 225-228. Filipek, P.A., et al., (1997) Volumetric MRI analysis comparing subjects having attention-deficit hyperactivity disorder with normal controls. Neurology, 48(3): p. 589-601. Geller, D.A., et al., (2003) Does comorbid attention-deficit/hyperactivity disorder impact clinical exprssion of pediatric obsessive -compulsive disorder. CNS Spectr., 8(4): p. 259-264. 64 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Goyer, P.F., et al., (1994) Positron-emission tomography and personality disorders. Neuropsychopharmacology, 10(1): p. 21-8. Hagemann, G., et al., (2002) Cerebellar volumes in newly diagnosed and chronic epilepsy. Journal of Neurology, 249(12): p. 1651-1658. Hemmings, S.M.J., et al., (2003) Investigating the role of dopaminergic and serotonergic candidate genes in obsessive-compulsive disorder. European Neuropsychopharmacology, 13(2): p. 93-98. Hesslinger, B., et al., (2001) Attention-deficit disorder in adults with or without hyperactivity: where is the difference? A study in humans using short echo (1)H-magnetic resonance spectroscopy. Neurosci Lett, 304(1-2): p. 117-9. Hofbauer, R.K., et al., (2001) Cortical representation of the sensory dimension of pain. J Neurophysiol, 86: p. 402-411. Jenkins, B.G., et al., (2000) Nonlinear decrease over time in N-acetyl aspartate levels in the absence of neuronal loss and increases in glutamine and glucose in transgenic Huntington's disease mice. J Neurochem, 74(5): p. 2108-19. Kahle, W. and M. Frotscher, (2001) Taschenatlas der Anatomie. Krause, J. and D. Ryffel-Rawak, (2000) Therapie der Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung im Erwachsenenalter. Pscho, 26(4): p. 209-223. Krause, K.-H., J. Krause, and S. Dresel, (2000) Neurobiologie der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Psycho, 26(4): p. 199-208. Krause, K.H., J. Krause, and G.E. Trott, (1998) [Hyperkinetic syndrome (attention deficit-/hyperactivity disorder) in adulthood]. Nervenarzt, 69(7): p. 543-56. Lemieux, L. and G.J. Barker, (1998) Measurement of small inter-scan fluctuations in voxel dimensions in magnetic resonance images using registration. Med Phys, 25(6): p. 1049-54. Lemieux, L., et al., (1998) The detection and significance of subtle changes in mixed-signal brain lesions by serial MRI scan matching and spatial normalization. Med Image Anal, 2(3): p. 227-42. Lucas, P.B., et al., (1989) Cerebral structure in borderline personality disorder. Psychiatry Res, 27(2): p. 111-5. Lyoo, I.K., M.H. Han, and D.Y. Cho, (1998) A brain MRI study in subjects with borderline personality disorder. J Affect Disord, 50(2-3): p. 235-43. Mannuzza, S., et al., (1998) Adult psychiatric status of hyperactive boys grown up. Am J Psychiatry, 155(4): p. 493-8. Mega, M.S. and J.L. Cummings, (1994) Frontal-subcortical circuits and neuropsychiatric disorders. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 6(4): p. 358-70. Mega, M.S., et al., (1997) The limbic system:an anatomic, phylogentic, and clinical perspective. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 9: p. 315-330. Netter, F., (1987) Farbatlas der Medizin; 5 Nervensystem I: Neuroanatomie und Physiologie. Nutt, D.J., et al., (1997) Noradrenergic mechanisms in the prefrontal cortex. J Psychopharmacol, 11(2): p. 163-8. Olausson, H., et al., (2001) Cortical activation by tactile and painful stimuli in hemispherectomized patients. Brain, 124: p. 916-927. Pliszka, S.R., M. Liotti, and M.G. Woldorff, (2000) Inhibitory control in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: event-related potentials identify the processing component and timing of an impaired right-frontal responseinhibition mechanism. Biol Psychiatry, 48(3): p. 238-46. 65 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Pueyo, R., et al., (2000) [Attention deficit hyperactivity disorder. Cerebral asymmetry observed on magnetic resonance]. Rev Neurol, 30(10): p. 920-5. Raz, N., et al., (1997) Selective aging of the human cerebral cortex observed in vivo: differential vulnerability of the prefrontal gray matter. Cereb Cortex, 7(3): p. 268-82. Rinne, T., et al., (2000) Serotonergic blunting to meta -chlorophenylpiperazine (m-CPP) highly correlates with sustained childhood abuse in impulsive and autoaggressive female borderline patients. Biol Psychiatry, 47(6): p. 548-56. Rubia, K., et al., (1999) Hypofrontality in attention deficit hyperactivity disorder during higher-order motor control: a study with functional MRI. Am J Psychiatry, 156(6): p. 891-6. Russ, M.J., et al., (1992) Pain perception in self-injurious patients with borderline personality disorder. Biol Psychiatry, 32: p. 501-511. Sawamoto, N., et al., (2000) Expectation of pain enhances responses to nonpainful somatosensory stimulation in the anterior cingulate cortex and parietal operculum/posterior insula: an event-related functional magnetic resonace imaging study. J Neurosci, 20: p. 7438-7445. Schulz, S.C., et al., (1983) Ventricular enlargement in teenage patients with schizophrenia spectrum disorder. Am J Psychiatry, 140(12): p. 1592-5. Sheline, Y.I., et al., (1996) Stereological MRI volumetry of the frontal lobe. Prychiatry Research, 67: p. 203-214. Snyder, S., W.M. Pitts, Jr., and Q. Gustin, (1983) CT scans of patients with borderline personality disorder. Am J Psychiatry, 140(2): p. 272. Soloff, P.H., et al., (2000) A fenfluramine -activated FDG-PET study of borderline personality disorder. Biol Psychiatry, 47(6): p. 540-7. Stiglmayr, C.E., et al., (2001) Experience of aversive tension and dissociation in female patients with borderline personality disorder--a controlled study. J Pychiatr Res., 35(2): p. 111-118. Streiner, D.L. and G.R. Normann, (1995) From Health Measurement Scales: A Practical Guide to their Developement. second Edition ed. Oxford Medical Publications. 104-126. Swanson, J., et al., (1998) Cognitive neuroscience of attention deficit hyperactivity disorder and hyperkinetic disorder. Curr Opin Neurobiol, 8(2): p. 263-71. Szeszko PR, R.D., Alvir JM, Bilder RM, Lencz T, Ashtari M, Wu H, Bogerts B, (1999) Orbito frontal and amygdala volume reduction in obsessive-compulsive disorder. Arch Gen Psychiatry, 56: p. 913-919. Tebartz Van Elst, L., et al., (2002) Amygdala pathology in psychosis of epilepsy: A magnetic resonance imaging study in patients with temporal lobe epilepsy. Brain, 125(Pt 1): p. 140-9. Trepel, (1995) Neuroanatomie: Struktur und Funktion: Urban & Schwarzenberg. van Elst, L.T., et al., (2001) Subtle prefrontal neuropathology in a pilot magnetic resonance spectroscopy study in patients with borderline personality disorder. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 13(4): p. 511-4. Watson, C., C.R. Jack, Jr., and F. Cendes, (1997) Volumetric magnetic resonance imaging. Clinical applications and contributions to the understanding of temporal lobe epilepsy. Arch Neurol, 54(12): p. 1521-31. Weibel, E.R., (1979) Stereological Methods.Practical Methods of Biological Morphometry. Academic Press, New York, 1: p. 1-413. 66 61. 62. 63. 64. 65. Wender, P.H., (2000) Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Aktivitätsstörung (ADHD) im Erwachsenenalter. Psycho, 26 (4): p. 190-198. Wieshmann, U.C., et al., (1997) Development of hippocampal atrophy: a serial magnetic resonance imaging study in a patient who developed epilepsy after generalized status epilepticus. Epilepsia, 38(11): p. 1238-41. Wilkinson, L.S., (1997) The nature of interactions involving prefrontal and striatal dopamine systems. J Psychopharmacol, 11(2): p. 143-50. Woodruff-Pak, D.S., et al., (2001) MRI-Asseessed Volume of Cerebellum Correlates with Associative Learning. Neurobiology of Learning and Memory, 76(3): p. 342-357. Zanarini MC, G.J., Frankenburg FR, et al., (1989) The revised diagnostic interview for borderlines:discriminating BPD from other axis II disorders. J Pers Disord, 3: p. 10-18. 67 Danksagung: Herzlichen Dank für die gute Betreuung der Doktorarbeit und den wissenschaftlichen Beistand bei anfallenden Fragen an Prof. Dr. D. Ebert sowie an Dr. L. Tebartz van Elst. Für die liebevolle Motivation und das Vertrauen in mich und meine Arbeit möchte ich von ganzem Herzen Dr. C. A. Stückle danken, dem deshalb auch diese Arbeit gewidmet ist 68 Lebenslauf Geboren wurde ich, Kerstin Frauke Hägele, am 4.12.1975 in Pforzheim. Nach dem Besuch des städtischen Kindergartens in Filderstadt, besuchte ich von 1982 bis 1986 die Grundschule in Weingarten. 1995 beendete ich meine gymnasiale Ausbildung am Hermann Hesse-Gymnasium in Calw mit dem Abitur. Im Oktober 1995 begann ich mein Studium der Humanmedizin an der AlbertLudwigs-Universität in Freiburg. Mein Physikum absolvierte ich im August 1997 und setzte meine klinische Ausbildung direkt im Anschluss fort. Nachdem ersten Staatsexamen im August 1998 vertiefte ich für ein halbes Jahr in der Chirurigschen Klinik der Universität Jerusalems meine chirurgischen Kenntnisse. Im August 2001 absolvierte ich mein 2. Staatsexamen und legte im November 2002 meine ärztliche Prüfung ab. Seit dem 1.Januar 2003 arbeite ich als Ärztin im Praktikum in der Medizinischen Klinik der Universitätsklinik Marienhospital.