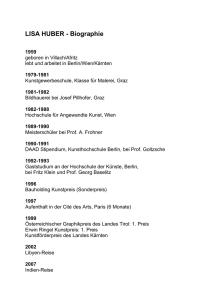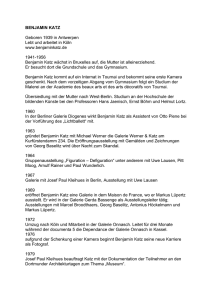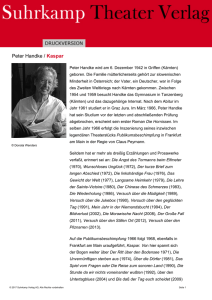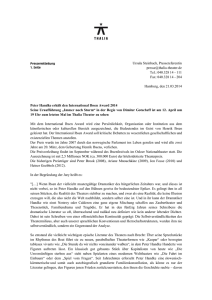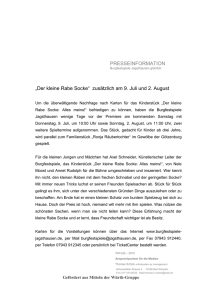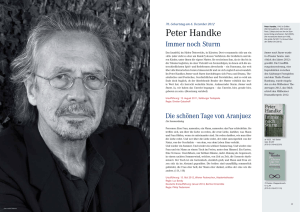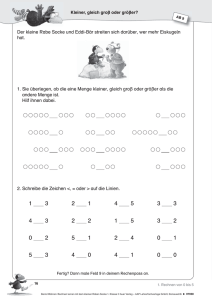Düsternisse im Rittersaal
Werbung

Kunst Düsternisse im Rittersaal SPIEGEL-Redakteur Jürgen Hohmeyer über den Maler und Bildhauer Georg Baselitz Ein Bild ist keine Socke, doch das Loch in der Socke ist fast schon ein Bild. Baselitz ls Kind sah er, im Traum, ein „großes Haus voller dunkler Bilder“. Was auf den Bildern dargestellt war, konnte er nicht erkennen. Aber er wußte: Er selber hatte sie gemalt. Für Georg Baselitz, 56, mußte es wohl so kommen: Er bewohnt ein wahrhaft großes Haus, Schloß Derneburg bei Hildesheim, und malt dort so ausdauernd, ja besessen, als wollte er den Riesenbau tatsächlich mit seinen Bildern füllen – mit mächtigen Leinwänden von zunehmend schwärzlichem Kolorit und auch von dunklem Sinn. Die Motive des Malers sind, sogar für ihn selbst, oft ähnlich schwer zu fassen wie Traumvisionen oder frühe Erinnerungen. „Mir fliegt das nicht zu“, sagt Baselitz und führt den Besucher vor die jüngsten 13-Quadratmeter-Formate im turnhallengroßen Rittersaal, „ich nehme das von unten.“ Er schürft im Verschütteten. Unruhige Farbgründe lassen spüren, daß sich in ihnen viele Schichten überlagern wie auf den Grabungsfeldern von Archäologen. Über dem düsteren Fond spannt sich zumeist ein Liniennetz figürlicher Strichzeichnungen. Und an der Oberfläche schwimmen dann wohl dicke weiße Farbtupfer wie Sahnehäubchen auf der Suppe – ein beliebiges, abstraktes Muster? Da widerspricht der Maler. Noch in dem Getüpfel sieht er „Punkt, Punkt, Komma, Strich“, also das Einmaleins der Welt- und Figurendarstellung. Vom Motiv kommt Baselitz nicht los, auch wenn er gern behauptet, es sei „als Inhalt uninteressant“, und wenn die Substanz der Bilder angeblich nur im formalen Aufbau, in Kontrast oder Zusammenklang der Farben und in der ruppigen Pinselführung liegt. Werner Schmalenbach, Ex-Direktor der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, schwärmt: „Ein toller Maler!“ Aber einfach ist bei Baselitz gar nichts. Das Untergründige, Schwerblütige seiner Kunst, das bisweilen als „teutonisch“ empfunden wird, hat schon manchen Kritiker verschreckt, freilich auch – und zu Recht – einen großen Kreis Bewunderer angezogen. A 162 DER SPIEGEL 6/1994 Atelierecke mit „Bildsechzehn“ (1993) Künstler Baselitz in Derneburg, Werke: Mit Punkt, Punkt, Komma, Strich und Auf den Besten- und Bestsellerlisten zeitgenössischer Kunst rangiert Baselitz in der Spitzengruppe (Hauptwerke erzielen Preise bis über eine Million Dollar), und in den Schausälen ist er ein internationaler Star. Vorigen Sommer hat das hochangesehene dänische Louisiana-Museum seine neuen Bilder gezeigt, für 1996 plant das Guggenheim Museum in New York eine Retrospektive. Diesen Monat sind deutsche Ausstellungsmacher dran. So eröffnet das Saarland-Museum in Saarbrücken am kommenden Sonntag einen Überblick mit Baselitz-Werken der achtziger und neunziger Jahre. Außer Gemälden, Zeichnungen, Druckgrafiken sind dort auch Holzskulpturen „Männlicher Torso“ (1993) Vor seinem „Bildeinundzwanzig“ (1993) „Mädchen kommt – Markus“ (1987) „Hose“ (1990) „Mutter und Kind“ (1985) Spaghetti aus der Farbtube werden die Helden und Plagegeister von einst noch einmal beschworen, kopfüber und gezähmt zu sehen – eine erst 1980 angefangene, doch seither erblühte Nebenproduktion des Künstlers. Ganz den Skulpturen ist vom 18. Februar an eine Ausstellung der Hamburger Kunsthalle gewidmet*. * Saarbrücken bis 4. April. Katalog (Verlag Hatje) 256 Seiten; 48 (im Buchhandel 88) Mark. Hamburg bis 17. April. Katalog (Verlag Cantz) 88 Seiten; circa 30 (58) Mark. Der Bildhauer-Autodidakt mutet sich dicke Brocken zu – so mächtige Baumstämme, daß er damit im Hof seines Schlosses, das ursprünglich ein Kloster war, schon in mittelalterliche Äbtissinnengräber eingebrochen ist. Erst mit der Plastik wird der Kosmos des Künstlers rund: Massig ausladende Form von körperlicher Schwere steht gegen taumelnde Phantasiegespinste und stellt die Baselitz-Bilderwelt auf kräftige Füße. Denn auf Leinwand und Papier zeigt er (seit 1969) ja alle Figuren oder Gegenstände kopfüber – wer jemals auch nur flüchtig von Baselitz gehört hat, weiß zumindest dies. Ungezählt sind die sarkastischen Kommentare über die eigentümliche DER SPIEGEL 6/1994 163 KULTUR Maler-Gewohnheit, ungezählt die Layout-Pannen bei der Wiedergabe der Werke. In Ausstellungen verrenken die Besucher sich die Hälse, Katalogleser drehen die Bildseiten rasch mal um. Doch Baselitz besteht darauf, sich mit seinem Kunstgriff neue Sehweisen und Maler-Freiheiten zu eröffnen: Die herrschende Oben-Unten-Konvention sei „Beschiß“, eine Verwechslung von Bild und Wirklichkeit. Zeichnende Kinder fielen darauf nicht herein und drehten ihr Blatt nach Belieben; nur Erwachsene machten „Papier mit Nägeln fest“. Konsequenterweise ist das von Baselitz gesuchte „Neusehland“ (so jetzt der Saarbrücker Ausstellungskatalog) keineswegs bloß ein Reich der sturen Antipoden. Es ist eine verwirrende Kunstwelt: Da scheinen die Haare eines „Orangenessers“ auch einmal der Schwerkraft außerhalb des Bildes nachzugeben; oder das Getränk eines „Buckligen Trinkers“ kleckert nach unten, obwohl im Bildmotiv das wahre Unten oben wäre. Solange Baselitz seine Großformate malt, sind Oben und Unten ohnehin aufgehoben. Er breitet die Leinwand auf den Boden des Rittersaals, pinselt und schüttet Malschicht über Malschicht, verteilt Farbe mit den Händen oder drückt sie spaghettiartig aus der Tube, kratzt mit Fingern oder Pinselstiel Konturen in den weichen Grund. Unvermeidlich tritt dabei, aus wechselnden Richtungen, der Künstler selbst ins Bild und hinterläßt den Abdruck seiner Turnschuhsohlen. Malerei wird Spurensicherung. „Ich bin in keinem Streß“, sagt Baselitz versonnen. „Meistens sitze ich rum und grübele.“ Kein Modell erwartet ihn, seine Motive entnimmt er dem eigenen Werk und malt sie „irgendwie flatterig und losgelöst, offener, dekorativer“ noch einmal, nämlich ohne die „Zappligkeit“ von früher, ohne den wütenden Drang zur Provokation. Unterwegs zum Alterswerk? „Das Gefühl habe ich.“ Sein Gedächtnis funktioniert fast fotografisch. Baselitz mußte ein 1975 entstandenes „Schlafzimmer“-Bild, das ihn und Ehefrau Elke als Kopfüber-Akte darstellt, noch sehr genau vor Augen und im Handgelenk haben, um die Komposition direkt aus der Farbtube nachzuzeichnen, während er auf der Großleinwand „herumtapste“, die er gar nicht recht überblicken konnte. Auch dieses Werk, nun trocken als „Bildsechzehn“ einer 1991 begonnenen Reihe katalogisiert, ist in Schichten angelegt. An einer Stelle öffnet sogar eine Art „Loch im Vorhang“ (Baselitz) den Blick in die Tiefe, als ziele er auf die bald 20 Jahre ältere Malerei. Auch die Metapher von einer durchgewetzten Socke, die gestopft wird oder eben nicht, drängt sich auf. 164 DER SPIEGEL 6/1994 „Orangenesser III“ (1981) „Sonderling“ (1993) „Tanz ums Kreuz“ (1983) in der Kirche in Luttrum Baselitz-Werke: Bildermalen statt Psychoanalyse „Die Geister plagen nicht mehr, aber sie sind noch da.“ Als schemenhafte Strichfiguren irrlichtern durch Baselitz’ neue Bilder jene „Helden“ oder „Freunde“, die, noch kopfoben, zuerst Mitte der sechziger Jahre erschienen waren: heruntergekommene Prototypen zwischen Wandervogel und Kriegsheimkehrer. Nur genaueres Zusehen offenbart, daß solch ein Kerl auch in einer grüngesäumten „Hose“ von 1993 steckt – und daß die, wieder mal, offensteht. In seinen „Helden“ hat Baselitz damals Halbgötter verketzert (und buch- stäblich zerstückelt), wie sie dem in der D D R Heranwachsenden aus sowjetischen Bürgerkriegsromanen von Isaak Babel bis Michail Scholochow entgegengetreten waren. Die Unversöhnlichkeit, mit der er sich immer wieder von den Autoritäten seiner Jugend lossagte, verrät ein schweres Trauma. Seltsam unentschlossen freilich hat der Künstler sein Pseudonym gewählt. Den ererbten, mit lästigen Schulerinnerungen verknüpften Familiennamen, Kern, wollte der Lehrersohn gern lossein; auch ersparte das den Angehöri- „Das Motiv: Giraffe“ (1988) gen Schande, wenn er anderswo „Krakeel“ machte. Aber dann nannte er sich nach seinem sächsischen Heimatdorf Deutschbaselitz. Der klare Schnitt blieb aus. „Was der Region zugehört“, will der Maler „nicht löschen“. Obwohl er ganze Monate an seinem Zweitwohnsitz in einer italienischen Riviera-Villa verbringt, sieht er seine Figuren immer nur im „Norden“ und „Osten“ zu Hause. Doch selber heimzukehren, auch nur besuchsweise, dazu lädt ihn der Bürgermeister von Deutschbaselitz vergebens ein. Der Zynismus der DDR-Obrigkeit bündelt sich für Baselitz in der grotesken Schlußepisode seines Ost-Berliner Kunststudiums: In der Gesellschaftskunde-Klausur hatte er gelehrig die erwünschten Sprüche hingeschrieben und dafür eine Eins kassiert. Als er jedoch in den anschließenden Semesterferien Bilder à la Picasso malte, war auch die Klausur nur noch Fünf. Der Student, dem der Tagebau empfohlen wurde, ging, 1957, lieber nach Westen. Angepaßt hat Baselitz sich auch dort nicht. Unter der Vorherrschaft der internationalen Abstraktion suchte er sich seine Anregungen bei Außenseitern wie dem französischen „art brut“-Verkünder Jean Dubuffet und dem exzentrischen Dichter Antonin Artaud, bei den Naiven und psychisch Kranken. Auf Baselitz-Bildern wucherten anatomische Fragmente, reckten und ringelten sich obskure Phalluskolonien. Das Gemälde „Die große Nacht im Eimer“, auf dem ein beige-graues Männchen sichtlich unfroh seinen stabartigen Penis handhabt, erregte 1963 einen West-Berliner Staatsanwalt. Schlichte Illustrationen aus der Innenwelt des Malers waren die anstößigen Visionen kaum, sondern vor allem Bilder nach Bildern; aber doch auch Signale für Obsession, Frustration und seeliDER SPIEGEL 6/1994 165 KULTUR sche Spannung. Im Kopfstand der Motive und in der Lockerheit des reifen Baselitz-Stils werden alle Zeichen versteckt und entschärft, ohne wirklich zu verschwinden. Ginge er zum Psychoanalytiker, so vermutet der Künstler, könnte er gleich das Malen aufgeben. Er selber jedenfalls hat keine Erklärung dafür, daß von ihm geschätzte Kollegen, die er nicht eigentlich porträtiert, sondern eher wie auf Ikonen darstellt, sich bei dieser Prozedur allemal in blonde Frauen verwandeln. Freund Lüpertz etwa wurde bei „Mädchen kommt – Markus“ mit dieser Metamorphose verfremdet. Baselitz in Person hängt als androgyne „Giraffe“ mit dunklem Bart und maisgelber Tolle ins Bild – wobei der Stengelhals obendrein an obszön sprießende Motive der Frühzeit gemahnt. Das Phallische ist auch dann ein Leitmotiv des Künstlers, wenn es, am Ende, wegfällt. Bei seiner Bildhauerarbeit hat der Künstler voriges Jahr einen „Männlichen Torso“ glatt kastriert. Baselitz rückt seinem Skulpturen-Material mit Kettensäge und Axt zuleibe, um wuchtige Großformen und expressiv zersplitterte Oberflächen bemüht. Trotz der rabiaten Technik war es ihm gelungen, dem rauhen Rumpf ein Geschlechtsteil stehenzulassen. Nur stach das Ding, wie er dann fand, formal allzu grob hervor und mußte deswegen fallen. Das Ergebnis der Operation ist ein packendes Stück Skulptur, doppelt irritierend neben seinem Pendant, einem „Weiblichen Torso“, von dem es sich nur diskret unterscheidet, vor allem durch etwas kantigere, für einen Mann aber verblüffend volle Brüste. Beide Werke hat der Maler-Bildhauer partienweise blutrot eingefärbt: Geburt, Menstruation und Verstümmelung werden suggestiv angedeutet. Kaum verwunderlich, daß dieser Künstler Ärgernis erregt, wenn er nun auch noch in den sakralen Raum vordringt. Über die Kunstgeschichte, nicht über die Kirche, hat er sich religiöse Motive angeeignet, und ein mutiger Gemeindepfarrer hat ihn bewogen, ein Kreuzigungsbild in die Dorfkapelle von Luttrum nahe bei Schloß Derneburg zu schenken. Da hängt der Heiland nun kopfüber, so wie traditionell nur der gemarterte Apostel Petrus dargestellt wird. Das Altarbild stört durch ungeschlachte Formen und laute Farben die Harmonie des bescheidenen, spätbarock dekorierten Raumes und regt viele Landleute auf. So unangemessen ist das gar nicht: Den Umsturz haben Religion und Kunst im besten Fall gemeinsam. Die Küsterin weiß es von einem auswärtigen Besucher: „Jesus hat auch alles auf den Kopf gestellt.“ Y Theater Festliches Schweigen Peter Handke beklagt die Sprachlosigkeit der Welt in einem Kinofilm und in seinem Erfolgsstück, das Luc Bondy neu gedeutet hat. em Dichter, so scheint es, gehen die Worte aus. Vor zwei Jahren hat Peter Handke die Theaterwelt mit dem Schau-Spiel „Die Stunde da wir nichts voneinander wußten“ überrascht – einem ganz und gar sprachlosen Stück, in dem die Schauspieler nur gestikulierend über die Bühne schnüren. D Nach dem vertrödelten Nachmittag auf der Piazza schrieb Handke in gut zwei Sommerwochen sein „Stunden“Stück, und auf einmal bedeutete die Piazza tatsächlich die ganze Welt – jedenfalls auf dem Theater. Knapp 60 Seiten lang gibt Handke wortreich Regieanweisungen für sein stummes Schau-Spiel. Hunderte von Menschen kommen und gehen. Sie bewegen sich aufeinander zu, blicken sich an und wieder aneinander vorbei, berühren sich, erstarren, verachten, begehren sich, kämpfen, lieben – und sagen kein einziges Wort. Feuerwehrleute, ein Koch, ein Chirurg, Schwangere, Soldaten, Bergsteiger, Gören, Greise. Dazwischen tummeln sich ein paar sehr alte Bekannte: Abraham und Isaak, Moses und Äneas, Tarzan und Papageno – auch sie rücksichtslos zum Schweigen gebracht. Nach der grellen Uraufführung in Wien durch Claus Peymann vor knapp zwei Jahren und zwei weiteren Deutun- Bondys Berliner Handke-Inszenierung: Und sagen kein einziges Wort Und diese neue schweigende Welt beschwört Handke, 51, nun auch in einem aktuellen Film, der unter dem Titel „Die Abwesenheit“ demnächst in deutsche Kinos kommt. In beiden KunstStücken zelebriert der österreichische Sensibilissimus die Unfähigkeit der Menschen, sinnvoll miteinander zu kommunizieren. Die Vision einer verstummenden Menschheit suchte den Dichter ausgerechnet auf einem belebten italienischen Kleinstadt-Platz heim. Stundenlang saß er dort bei kühlem Wein und kam „ins Schauen“. Plötzlich wurde für den Voyeur des Alltäglichen „alles zeichenhaft“, als ob „die kleinsten Vorgänge“ des Lebens auf einmal „die Welt bedeuteten“. gen in Bochum und Freiburg wagte Starregisseur Luc Bondy in der Berliner Schaubühne am vergangenen Donnerstag eine tragikomische Version von Handkes Hommage auf das Schweigen. Gilles Aillaud baute ihm dafür einen großflächigen Bühnen-Raum, weit entfernt von der flirrenden Heiterkeit italienischer Idylle, wie sie Karl-Ernst Herrmann in Wien beschwor. Aillauds Szenerie erinnert an die fahle Ärmlichkeit nordafrikanischer Küstenorte. Kein kurzfristiges Urlaubs-Utopia für zivilisationsmüde Gesamtschullehrer, mehr ein verstörender Elendsort: links ein weißer, fensterloser Kubus mit einer Tür, rechts eine halb unter einer schmutzigen Plane versteckte CitroënDER SPIEGEL 6/1994 167