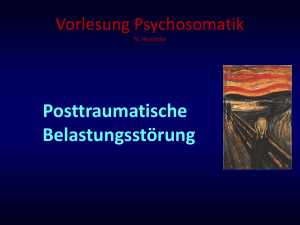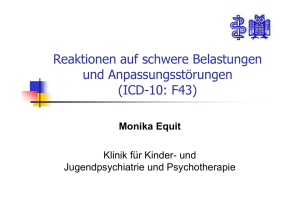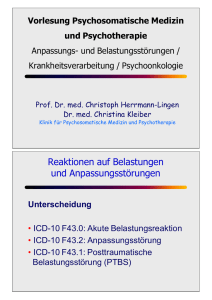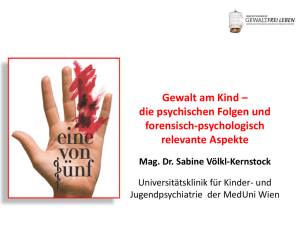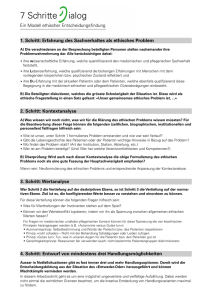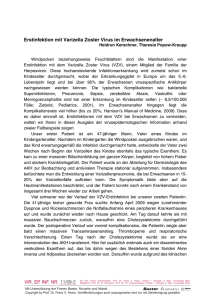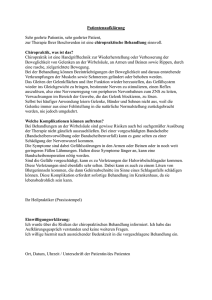Posttraumatic Stress Disorder
Werbung

Posttraumatic Stress Disorder (Posttraumatische Belastungsstörung) Fachbereichsarbeit zur schriftlichen Reifeprüfung im Fach Psychologie und Philosophie am Bundesgymnasium Gänserndorf Marianne Zier, 8a Schuljahr 2000/01 Inhaltsverzeichnis Teil 1 - Stress 1 GRUNDLAGEN 9 2 DIE STRESSOREN 13 2.1 Arbeitsdefinition von „Stressor“ 13 2.2 Ablauf der Stressreaktion 17 2.3 Stressformen 2.3.1 Psychischer Stress 2.3.2 Chronischer Stress 2.3.3 Akuter Stress 18 18 18 19 3 STRESSREAKTION DES ORGANISMUS 20 3.1 Biochemische Stressvorgänge 21 3.2 Was geschieht nach dem Einsetzen der Notfall-Reaktion? 22 3.3 Wann wird die Stressbewältigung problematisch? 23 3.4 Stress macht krank 24 Teil 2 Posttraumatic Stress Disorder 4 BESCHREIBUNG DES STÖRUNGSBILDES PTSD 28 4.1 Entwicklung des Begriffes ‘PTSD’ - Historischer Hintergrund 4.1.1 Zeitraum ohne Definition des PTSD 4.1.2 Das erste Auftauchen der Symptombeschreibung und Einordnung des PTSD in einer Klassifikation 4.1.3 Der Begriff ‘Posttraumatic stress disorder’ wird im DSM aufgenommen 28 29 4.2 Definiton ‘Psychisches Trauma’ 36 4.3 Symptome des PTSD 36 4.4 Was macht einen Stressor traumatisch ? 37 4.5 Diagnostische Kriterien nach ICD-10 bzw. DSM-IV 39 4.6 Auffällige, psychische Symptome des PTSD 4.6.1 Autonome Übererregbarkeit und intensives Wiedererleben 4.6.2 Emotionale Überreaktionen und Schlafprobleme 41 41 41 31 33 Seite 1 4.6.3 Lernstörungen 4.6.4 Erinnerungsstörungen und Dissoziation 4.6.5 Aggressionen und Autoaggressionen 4.6.6 Betäubung der psychischen Reaktivität 4.6.7 Abhängigkeit der psychischen und biologischen Reaktion auf das Trauma vom Entwicklungsstand 41 42 42 43 43 4.7 Stressreaktion und die Psychobiologie von PTSD 4.7.1 Aktivierung und Reaktion auf Gefahrensignale 4.7.2 Betäubtsein 4.7.3 Psychosoziale Folgen 44 44 45 45 5 SITUATIONEN, IN DENEN PTSD ENTSTEHEN KANN 47 5.1 Gefährdete Personen 47 5.2 Der Krieg, die Quelle posttraumatischer Belastungsstörungen für die gesamte Bevölkerung48 5.2.1 Vorbemerkung 48 5.2.2 Auswirkungen des Krieges auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung 49 5.2.3 Psychische Krankheiten, die durch Kriegshandlungen entstehen und ihre Häufigkeit in einem Kriegsgebiet 50 5.2.4 Todeszahlen in den einzelnen Kriegen 50 5.2.5 Neue Betrachtungen zu den psychischen Folgen von Kriegshandlungen 52 6 EPIDEMIOLOGIE DES PTSD 56 6.1 Bevölkerung 56 6.2 Die Helfer 57 7 PRÄVENTION DES PTSD 54 7.1 Grundsätzliches Fehler! Textmarke nicht definiert. 7.2 Gemeinsame Ziele aller CISM - Maßnahmen 60 7.3 Übersicht über die einzelnen Interventionen des CSIM 62 8 DIE THERAPIE DES PTSD 63 8.1 Implikationen für die Behandlung von PTSD 63 8.2 Pharmakologische Behandlung 8.2.1 Vorbemerkungen 8.2.2 Psychopharmaka und Nebenwirkungen 8.2.3 Wirkung der Psychopharmaka auf das PTSD 8.2.4 Antidepressiva 8.2.5 Antiepileptika 8.2.6 Benzodiazepine 64 64 66 67 68 69 69 8.3 Psychotherapie 8.3.1 Allgemeines 8.3.2 Psychotherapie des PTSD 70 70 71 9 FALLGESCHICHTE 86 9.1 Zusammenfassung 86 Seite 2 9.2 Einleitung 86 9.3 Kasuistik 9.3.1 Aktuelle Symptomatik zu Therapiebeginn 9.3.2 Biographische Vorgeschichte 9.3.3 Krankheitsentwicklung 87 87 87 87 9.4 Behandlungsplan 9.4.1 Therapieverlauf 9.4.2 Katamnese 89 89 91 9.5 Diskussion 92 10 ZUSAMMENFASSUNG 94 Anhang 11 DEFINITION DES PTSD NACH INTERNATIONALEN KLASSIFIKATIONSSYSTEMEN98 11.1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 99 11.2 Allgemeines zum DSM 11.2.1 Geschichte: 11.2.2 Merkmale 99 99 99 11.3 Kriterien der Stress-Erscheinungen nach DMS III-R 100 11.4 DMS-IV 11.4.1 Einfaches PTSD (DSM IV) 11.4.2 Kompliziertes PTSD 101 101 102 11.5 Das Klassifikationssystem ICD10 11.5.1 Internationale Klassifikation der Krankheiten 10. Revision 11.5.2 Die Beschreibung des Störungsbildes im ICD10 104 104 104 Seite 3 Einleitung Seite 4 Einleitung zur Fachbereichsarbeit Fast alle Menschen kennen aus eigener Erfahrung Situationen, in denen sie sich beruflich oder privat überfordert fühlen; wo sie überlastet, gereizt, hektisch oder nervös sind. Das Gleichgewicht zwischen An- und Entspannung, Aktivität und Ruhe, Stress und Erholung ist heute allzu oft gestört.1 Stress entsteht überall: im Beruf, in der Gesellschaft, in der Familie - ja, er verfolgt uns sogar noch bis in den Schlaf! Klagen über Stress am Arbeitsplatz nehmen ständig zu. Sowohl die Jobs am Fließband als auch die Positionen in der Chefetage sind mit Stress verbunden. Weil jeder schon einmal Stress erfahren hat, meinen die meisten auch zu wissen, was Stress ist. Aber Stress ist nicht gleich Stress. Viele Menschen betrachten Stress als einen rein negativen Einfluss, der ihre Energie und Entscheidungsfähigkeit schwächt, ihre Leistung mindert und sie anfälliger für Krankheiten macht. Es kommt darauf an, wie die Person den Stress selbst sieht und bewertet. Stress ist keine objektive Größe, Stress ist, was man dafür hält. Was den einen stresst und ihn womöglich handlungsunfähig macht, kann auf den anderen wie ein belebendes Elixier wirken, seine Geister erst recht wecken und zu neuen Taten anspornen. Wissenschaftlich wurde jedoch nachgewiesen, dass Stress auch positive Auswirkungen hat — mehr noch, dass ein gewisses Maß an Stress notwendig ist, um ein glückliches und erfülltes Leben führen zu können. Ob Stress einen Menschen aber vorwiegend positiv oder negativ beeinflusst, hängt in erster Linie davon ab, wie er StressSituationen aufnimmt und verarbeitet. Beides, das Erkennen und die erfolgreiche Bewältigung von Stress, sind Dinge, die man erlernen kann.2 An ständigen, übermäßigen Stress kann man sich nicht gewöhnen. Kein Feuerwehrmann wird irgendwann resistent gegen solche Stressoren, wie die Gefahr für das eigene Leben im Einsatz oder den Anblick von schweren Verletzungen oder Verstümmelungen. 3 Seiner vielfältigen, körperlichen Auswirkungen wegen, ist Stress ein bedeutsamer Risikofaktor für unterschiedlichste Erkrankungen. Doch wird bei weitem nicht jeder krank, der starker Belastung ausgesetzt ist.4 Lebende Systeme verfügen über Mechanismen, sich an ungünstige Veränderungen ihrer Umwelt anzupassen - schließlich ist dies auch eine Voraussetzung, damit Lebewesen sich neu organisieren und nach dem Prinzip der Evolution weiterentwickeln können. Auch für das Individuum kann Stress eine Herausforderung sein; es kann Erfahrungen im Umgang mit ihm speichern und Wege finden, um neue Belastungen zu bewältigen.5 1 WAGNER-LINK, Angelika: Verhaltenstraining zur Streßbewältigung. Pfeiffer, München, 1995. S. 0. 2 TIME LIFFE: „Wie erkennt man Stress“. Stress-Bewältigung. Amsterdam, 1990. S. 6. 3 BESTE, Dieter: „Editorial“. Spektrum der Wissenschaft. Dossier 3/1999. S. 3. 4 KALUZA, Gert: „Stressbewältigung und Gesundheit“. Spektrum der Wissenschaft. Dossier 1999/3. S. 54. 5 HÜTHER, Gerald: „Der Traum vom stressfreien Leben“. Spektrum der Wissenschaft. Dossier 1999/3. S. 6. Seite 5 Einleitung zur Fachbereichsarbeit Menschen können in Situationen hineinschlittern, die weit über das gewohnte Maß einer Belastung hinausgehen. Unfälle, Krankheiten oder Gewalttaten sind nur eine kleine Auswahl an schrecklichen Erlebnissen, die über manche Menschen hereinbrechen. Sie sind außergewöhnliche Ereignisse mit einem besonders hohen Stress-Potential. „Es werden Ereignisse erlebt, die außerhalb jeder normalen menschlichen Erfahrung liegen und bei fast jedem Menschen enormen Streß auslösen würden.“6 Körperliche Verletzungen durch Unfälle, Opfer von Straftaten, schwere Krankheiten und Begegnungen mit Sterbenden sind zwar Teil des menschlichen Daseins, aber der einzelne Mensch empfindet solche Lebenssituationen — auch und gerade weil sie eher selten auftreten — als sehr belastend. Sie führen bei vielen Menschen, über die aktuelle Bedrohung und Belastung hinaus, häufig zu gravierenden Einschränkungen der Lebensqualität.7 Bei den Betroffenen dieser schrecklichen Ereignisse wird zunächst grob zwischen zwei Personengruppen unterschieden: Da sind zunächst jene Personen, die selbst das Ereignis erlebt haben, bzw. selbst die Verletzungen oder Gewalttaten erleiden mussten. Die andere Personengruppe besteht aus jenen Menschen, die aus verschiedenen Gründen das Unglück ansehen mussten; zum einen, weil sie zufällig am Ort des Geschehens waren, zum anderen, weil sie den verletzten und/oder bedrohten Menschen geholfen haben. Das sind die Retter oder Helfer bei diesen schrecklichen Ereignissen. Beide Personengruppen, die Geschädigten und die Helfer, können von besonders stark stressenden Erlebnissen einen bleibenden, psychischen Schaden davontragen. Man nennt dieses Phänomen ‘Posttraumatische Belastungsstörung’ oder engl. ‘Posttraumatic Stress Disorder’ (Abk.: PTSD). „Feuerwehrleute, Sanitäter, Notärzte und Polizisten - oft riskieren sie ihr eigenes Leben, um das anderer zu retten. Die Leiden und Schrecken, die ihnen dabei begegnen, übersteht weniger als ein Viertel der Helfer unversehrt: Über 75 % entwickeln im Laufe ihres Lebens psychische Auffälligkeiten. 40 % leiden unter depressiven Verstimmungen, und 60 % zeigen Defizite im sozialen Kontakt. Die Hälfte klagt häufiger über körperliche Beschwerden als der Rest der Bevölkerung, und 20 % haben Probleme mit Alkohol, Medikamenten und anderen Drogen. Jeder fünfte Feuerwehrmann entwickelt eine sogenannte Posttraumatische Belastungsstörung.“8 Grob skizziert ist diese Posttraumatische Belastungsstörung ein wiederholtes, intensives Erinnern im Wachen und auch im Traum an das Ereignis. Auch wird das eigene Gefühlsleben eingeschränkt und das Interesse und die Beteiligung am Alltagsgeschehen lässt nach. Zusätzlich sind noch Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen und Schlafstörungen vorhanden. Des Weiteren führt es zur Vermeidung von Situationen ähnlich 6 KORITTKO, Alexander: „Trauma: Wenn nichts mehr ist, wie es war“, Psychologie heute. 20. Jhrg., 1993/4. S. 55. 7 STEPHAN, Egon: „Hilfe für Helfer: Prävention von Stress und Traumatisierung“. Spektrum der Wissenschaft. Dossier 1999/3. S. 60. 8 MIESEN, Jana: „Viele Helfer brauchen selbst Hilfe“. Psychologie heute. 26. Jhg., 1999/8. S. 12. Seite 6 Einleitung zur Fachbereichsarbeit des belastenden Ereignisses, was für Menschen in helfenden Berufen besonders erschwerend ist, weil sie ihre meist ehrenamtliche Tätigkeit nicht mehr ausüben. 9 In den westlichen Zivilisationen sind meist Unfälle oder Naturkatastrophen der Anlass für plötzlich auftretende, psychische und/oder physische Gewalteinwirkungen. Die Häufigkeit dieser Ereignisse ist gering und im Grunde genommen, betrifft es einen eng begrenzten, überschaubaren Teil der Bevölkerung. Trotzdem werden wir täglich mit Nachrichten konfrontiert, in denen Menschen Opfer von Gewalt werden. Die Toten werden betrauert, und die Überlebenden sind scheinbar mit einem Schock oder einem ‘blauen Auge’ davongekommen. „Ihr weiteres Schicksal ist schon am nächsten Tag kaum noch eine Nachricht wert.“10 Die nicht betroffenen Menschen können schon nach der Rezeption der Nachrichten zur Tagesordnung übergehen. Völlig anders ist dies in Kriegsgebieten: In kriegsbelasteten Landstrichen wird fast die gesamte Bevölkerung mit Gewalttaten konfrontiert. Weniger durch die kämpfenden Truppen, als viel mehr durch Bombardements, Vertreibungen und extremen Mangel an Lebensmitteln und Unterkünften. Europa hat im vergangenen Jahrhundert zwei schreckliche Kriege erlebt, mit ca. 60 Millionen Toten. Man müsste meinen, dass diese Völker einen besonders hohen Wissensstand über die psychischen Folgen der Bewohner von Krieg führenden Nationen hätten, aber dem ist nicht so. Europa hat sich nach den Kriegen mit dem Aufbau beschäftigen müssen und deshalb keine Ressourcen für die Erforschung der psychischen Kriegsfolgen bereitstellen können. Brigitte LUEGER-SCHUSTER, Ass. Professorin des Institutes für Psychologie der Universität Wien, sieht die Erforschung der Kriegstraumata in der Nachkriegszeit folgendermaßen: „Bedenkt man, dass die traumatisierte Nachkriegsgesellschaft in Deutschland und in Osterreich primär damit beschäftigt war, den Wiederaufbau des Landes zu tätigen (...) nimmt es nicht Wunder, dass die psychotraumalologische Forschung in Europa bis zu den 80er Jahren brach lag und eher widerwillig die Erkenntnisse aus USA zur Kenntnis genommen wurden (...). Auch die USA taten sich mit der Thematik schwer, doch konnte speziell nach Vietnam das Ausmaß traumatisierter Männer nicht mehr übersehen werden.“11 In den letzten 10 - 15 Jahren kamen die humanitären Hilfseinsätze hinzu, bei denen die Helfer aus ihrer gewohnten Lebenssituation von einem Tag auf den anderen in Kriegsgebiete kamen und mit schrecklichen Gräueltaten konfrontiert wurden, die die psychische Gesundheit der Helfer massiv beeinträchtigten. Das Fallbeispiel dieser Arbeit beschreibt die Lebensgeschichte einer Krankenschwester. Sie war beim internationalen Hilfseinsatz in mehreren Krisengebieten tätig, so auch in Afghanistan und Tschetschenien. Ihr engagierter Einsatz wurde wegen massiver psychischer Probleme (als PTSD 9 KORITTKO, Alexander: „Trauma: Wenn nichts mehr ist, wie es war“, Psychologie heute. 20. Jhrg., 1993/4. S. 54. 10 a. a. O. 11 LUEGER-SCHUSTER, Brigitte: „Psychotraumatologie“. Psychologie in Österreich.20. Jhrg. 12/2000. S. 276. Seite 7 Einleitung zur Fachbereichsarbeit diagnostiziert) beendet. In der Heimat konnte das PTSD erfolgreich mit Psychotherapie behandelt werden. Es entsteht der Eindruck, dass die psychischen Folgen von Kriegshandlungen lange Zeit unterschätzt wurden. Auch heute noch werden die Folgen von Bombardements der Zivilbevölkerung verzerrt eingeschätzt. Der deutsche Psychoanalytiker SCHMIDBAUER sieht dies sogar optimistisch: „Der Luftkrieg schien selbst in einer so massiv betroffenen Bevölkerung wie der deutschen nur in extremen Fallen dauerhafte psychische Schaden ausgelöst zu haben. Daher ist davon auszugehen, dass auch in Jugoslawien (=Ex-Jugoslawien, Serbien, Anmerk. d. Verfasserin) bleibende seelische Schäden in der breiten Bevölkerung eher die Ausnahme sein werden. Betroffen sind vorwiegend die, welche verschüttet oder verletzt wurden, Kameraden oder Angehörige verloren haben.“12 Ganz anders stellt sich die Situation der Vertriebenen dar: „Einige Wochen Flucht in einem Kriegsgebiet reichen aus, um Menschen vollständig zu demoralisieren. Sie werden aus jeder Sicherheit herausgerissen. Ihre sozialen Strukturen sind oft völlig zerstört, Unbewaffnete sind Freiwild für jeden Bewaffneten, Mütter werden vor ihren Kindern vergewaltigt. Was die Vertreiber nicht raubten, wird von Banditen geplündert. Die Heimat und oft jede Hoffnung auf Rückkehr sind verloren; die Wehrlosen fühlen sich extrem gedemütigt. Wer wochenlang in seinen Kleidern geschlafen hat nur noch besitzt, was er tragen kann, und erschöpft einem ungewissen Schicksal entgegengeht, trägt zeitlebens an den seelischen Folgen dieser Situation, auch wenn er sie überlebt und materielle Sicherheit gefunden hat.“13 Aber nicht nur, dass die Betroffenen für ihr ganzes Leben mit psychischen Schäden weiterleben müssen, sogar ihre eigenen Kinder erleben die Folgen der schrecklichen Lebensereignisse noch lange nach der Katastrophe: „Während die Erwachsenen das Durchlittene meist verdrängen und verbissen ein neues Leben aufbauen, fühlen sich die Kinder Vertriebener oft ihrer Kindheit beraubt. Sie stecken in einem Käfig, dessen Stäbe die negative und defensive Sicht der Welt bilden, die ein unverarbeitetes Flüchtlingsschicksal mit sich bringt. Diese Kinder schwanken zwischen Rebellion und depressiver Anpassung und enttäuschen zwangsläufig ihre Eltern, die nie verstehen, weshalb ihre Erben so undankbar sind.“14 Der amerikanischer Psychologe Richard F. MOLLICA, Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School in Cambridge, konnte erkennen, dass bisher die psychischen Kriegsfolgen unterschätzt wurden. Die große Mehrheit der Bevölkerung in einem Kriegsgebiet erfährt länger anhaltende seelische Probleme. Damit eine Gesellschaft gesunden kann, darf diese Mehrheit keinesfalls übersehen werden. In dieser Arbeit werden die wichtigsten Erkenntnisse von MOLLICA und sein Resumé dargestellt. Das PTSD wird jetzt als Krankheit anerkannt. Erstmals wurde es 1980 in das diagnostic and statistical manual of mental disorders der AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (Abk.: APA) aufgenommen. In den darauffolgenden Revisionen, bis zur jetzt aktuellen Version IV, 12 SCHMIDBAUER, Wolfgang: „Unter Bomben, auf der Flucht“. Psychologie heute. 26. Jhg., 1999/9. S. 36. 13 a. a. O. 14 a. a. O. Seite 8 Einleitung zur Fachbereichsarbeit wurde die Klassifikation PTSD angepasst und erweitert. Die Diskussion der Klassifikation ist noch im Laufen. Außerdem gibt es einen ähnlichen Katalog von psychischen Störungen, die ICD-10 der WORLD HEALTH ORGANISATION, in dem das Störungsbild einer Posttraumatischen Belastungsstörung beschrieben wird, sich aber nicht mit der Definition der APA vollständig deckt. Als Therapiemöglichkeiten bieten sich die medikamentöse Therapie und die Psychotherapie an. Von den Psychopharmaka sind es vor allem die Antidepressiva, die vielversprechende Forschungsergebnisse vorweisen. Aus dem breit gefächerten Gebiet der Psychotherapien zeigt besonders der behaviorale-kognitive Therapieansatz gute Erfolgschancen, hingegen die psychodynamischen Therapien sind eher weniger von Erfolg gekrönt. Im Kapitel ‘Die Therapie des PTSD’ werden die wichtigsten Behandlungschancen von Psychopharmaka gegen das PTSD beschrieben. Ebenfalls, aber etwas breiter, wird die Psychotherapie skizziert. Auch in der Fallgeschichte wird die Heilung eines PTSD mittels Psychotherapie dargestellt und diskutiert. Viel wichtiger sind jedoch jene Ansätze, die ein umfassendes Versorgungsystem gegen das PTSD darstellen. In den USA hat sich vor allem das critical incident stress management von MITCHELL bewährt. Es zielt darauf ab, ziemlich bald nach dem belastenden Ereignis mittels Gruppensitzungen die Festigung des PTSD zu verhindern. In Österreich wird es zum Teil schon eingesetzt. Beim Roten Kreuz ist eine ensprechende Organisation schon weit entwickelt.15 Für die österreichischen Freiwilligen Feuerwehren wird das critical incident stress management derzeit aufgebaut.16 Wie critical incident stress management abläuft, wird in einem Teil dieser Arbeit beschrieben. Teil 1 Stress 1 Grundlagen Begriffsklärung 15 BINDER-KRIEGELSTEIN, Cornel: „Stessbearbeitung nach belastenden Ereignissen (SbE) und Krisenintervention (KIT) in österreichischen Einsatzorganisationen“. 20. Jhg., 5/2000, S. 258. 16 WEISSGÄRBER, Wilfried, Landesbranddirektor: „Zum Thema“. BRAND AUS. 1/2001, S. 5. Seite 9 Stress Unter den Laien wird Stress häufig mit Arbeitsüberlastung, Hektik, wachsendem Zeit- und Termindruck gleichgesetzt. Häufig versteht man darunter auch eine psychische Anspannung. Das Duden Fremdwörterbuch beschreibt Stress als eine „den Körper belastende, angreifende, stärkere Leistungsanforderung“17. Mittlerweile ist Stress unser ständiger Begleiter geworden. Er taucht im Beruf, in der Gesellschaft, in der Familie und auch im Schlaf auf. „Es ist sogar zu vermuten, dass man, ohne es zu wissen, gestresst ist.“18 Ursprünglich stammt der Begriff „Stress“ aus der Physik. „Das Hooksche Gesetz aus dem Jahre 1676 beschreibt ein Phänomen aus der Physik: Eine »Last« oder physischer »Stress« übt eine physische Belastung auf anderes Material aus. 1926 entdeckte der österreichische Endokrinologe Hans Selye (Selye, 1974, S.14)19 etwas, das seiner Meinung nach ein starres Muster von Geist-Körper-Reaktion war. Er nannte Streß eine »unspezifische Reaktion des Körpers auf jegliche Anforderung«. Später bezog sich Selye auf dieses Reaktionsmuster und beschrieb es als den totalen »Verschleiß des Körpers« (Selye, 1976)20. Am Anfang seiner beruflichen Laufbahn wurde Selye einmal zu einer Diskussion über das Thema an das Collège de France21 eingeladen. Auf der Suche nach einem Wort, das die genannten Gedanken am besten beschreiben könnte, lieh er sich das Wort Stress aus der Physik. So wird das Wort Stress — dank Selye — heute noch definiert als »unspezifische Reaktion des Körpers auf jegliche Anforderung, der er ausgesetzt wird«.“22 Der Auslöser und die Kraft, die diese unspezifische Reaktion auslösen, werden als „Stressoren“ bezeichnet.23 Schematisch wird dieser Zusammenhang in folgender Grafik dargestellt: Stressor (Anforderungsreiz) Reiz-ReaktionsMechanismus Stress (Reaktion) 17 DUDEN: Das Fremdwörterbuch. Band 5, Mannheim, 1982. S. 730. 18 SCHULZ, Peter: „Wenn Stress chronisch wird“. Spektrum der Wissenschaft, hrsg. von Schulz Peter, Dossier 3/1999. S. 13. 19 SELYE, H.: Stress without distress. Philadelphia: Lipincott, 1974. 20 SELYE, H.: Stress in health and disease. Boston: Butterworth, 1976. 21 Collège de France: wissenschaftliches Institut in Paris mit einem Lehrkörper von (1995) 52 Gelehrten aller Fachrichtungen. 22 MITCHELL, Jeffrey, T.; EVERLY, George, S.: „Streßbearbeitung nach belastenden Ereignissen“. Hrsg.: Andreas Igl; Joachim Müller-Lange, Susanne Fassmann (Übers.), Ingeborg Schiwek (Textbearb.). - Edewecht; Wien: Stumpf und Kossendey, 1998. S. 33. 23 KROHNE, Heinz Walter: „Streß und Streßbewätligung“. Gesundheitspsychologie, hrsg. Von Ralph Scharzer. 2. Aufl., Göttingen: Bern; Toronto, Seattle: Hogrefe, Verl. für Psychologie, 1997. S. 267. Seite 10 Stress Bei den Stressreaktionen gibt es verschiedene Erlebnisweisen. Manche Stressreaktionen werden als angenehm, andere als unangenehm erlebt. Daher wird zwischen „Eustress“ und „Distress“ unterschieden. Eustress bezeichnet im Großen und Ganzen erwünschte Auswirkungen eines Stressors, z. B.: Leichter, angenehmer Sport und auch Spiel. Eustress Eustress niedrig Distress hoch Stresserregung Quelle: MITCHELL, Jeffrey, T., EVERLY, George, S.: Streßbearbeitung nach belastenden Ereignissen, Hrsg.: Andreas Igl; Joachim Müller-Lange. Susanne Fassmann (Übers.). Ingeborg Schiwek (Textbearb.). - Edewecht ; Wien: Stumpf und Kossendey, 1998, S.33 ist auch notwendig um ein Mindestmaß an Aktivierung des Körpers zu gewährleisten und wird größtenteils als angenehm erlebt. Distress beschreibt im Wesentlichen krankmachende Ereignisse, unangenehme Erlebnisse und führt zu Leistungsminderung. Die oben stehende Grafik (Seite 11) stellt den Zusammenhang schematisch dar. Die Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen Stressbelastung, -erregung und Leistungsfähigkeit. Daraus ist ersichtlich, dass bei einer mittleren Stressbelastung die Leistungsfähigkeit am höchsten ist. Dies wird auch angenehm erlebt. In dieser Belastungssituation ist einerseits eine sehr hohe Kreativität möglich und anderseits wird die auszuführende Tätigkeit als angenehm erlebt. Ist die Stresserregung gering und damit der Anreiz auch sehr schwach, entsteht Langeweile, Müdigkeit und Unzufriedenheit. Andererseits entwickelt sich bei einer zu hohen Stressbelastung ein starker Einbruch der Leistungsfähigkeit. Eine Problemlösung gelingt nur unzureichend und dadurch kann sich als langfristige Folge ein geringes Selbstwertgefühl entwickeln. Eine langandauernde Stressbelastung, die noch dazu wenig Erholungsphasen erlaubt, fördert die Entstehung von Krankheiten, wie z. B. Herz-Kreislaufschäden oder auch Magen-Darmprobleme. Kognitive Bewertung als Bindeglied zwischen Stressor und Stress „Epiket, ein Philosoph des Altertums (um das Jahr 50 n. Chr.), prägte den Satz: »die Menschheit wird nicht von Dingen gestört, sondern von der Meinung, die sie dazu hat.« Seite 11 Stress Ähnliches erklärt Hans Selye: »Es kommt nicht darauf an, was einem Menschen zustößt, sondern darauf, wie er damit umgeht.«“ 24 Stressreaktionen laufen trotz gleicher Situation bei verschiedenen Menschen recht unterschiedlich ab. Es ist die kognitive Bewertung der Situation, die hier als vermittelnde Variable auftaucht. LAZARUS, ein amerikanischer Mediziner, hat dies erkannt und diesen Zusammenhang in seinem transaktionalen Stressmodell vorgestellt. Darin wird eine bestimmte Beziehung zwischen Person und Umwelt beschrieben: „Psychologischer Stress bezieht sich auf eine bestimmte Beziehung mit der Umwelt, die vom Individuum im Hinblick auf sein Wohlergehen als bedeutsam bewertet wird, aber zugleich Anforderungen an das Individuum stellt, die dessen Bewältigungsmöglichkeiten beanspruchen oder überfordern.“25 Der jeweilige Stressprozess wird durch ein spezifisches Muster kognitiver Bewertungsvorgänge erzeugt und gesteuert. Es gibt im Prinzip eine Primärbewertung und eine Sekundärbewertung. Bei der Primärbewertung wird der Stressor anhand der eigenen Einstellungen, Normen und Werthaltungen beurteilt. Es wird mittels dieser Konzepte entschieden, ob eine Beeinträchtigung entstehen könnte. In der Sekundärbewertung vollzieht das Individuum eine Abschätzung seiner Ressourcen und Möglichkeiten die stressende Situation positiv zu bewältingen. Resultieren aus beiden Bewertungen negative Ergebnisse, entstehen Stressreaktionen. Gerade in diesen Bewertungsmechanismen liegen einerseits die Ursachen für heftige Stressreaktionen, aber auch die Chancen zu einer positiven Stressbewältigung. Außerordentlich belastende Erlebnisse, wie sie im Kapitel „Postraumatic Stress Disorder“, Seite 28, beschrieben werden, können diese kognitiven Bewertungsmechanismen verändern. 24 MITCHELL, Jeffrey, T.; EVERLY, George, S.: „Streßbearbeitung nach belastenden Ereignissen“. Hrsg.: Andreas Igl; Joachim Müller-Lange, Susanne Fassmann (Übers.), Ingeborg Schiwek (Textbearb.). - Edewecht; Wien: Stumpf und Kossendey, 1998. S. 37. 25 LAZARUS, R.S. & FOLKMAN, S.: Stress, appraisal, and coping. New York: Springer, 1984. S. 268. Seite 12 Stress Das transaktionale Stressmodell (nach Lazarus) 2. Sekundäre Bewertung: Beurteilung der Bewältigungskompetenz und Ressourcen. Vorhanden? 1. Primäre Bewertung des Stressor Stressors (Einstellungen, Normen, Werthaltungen) Beeinträchtigung? Ja! Nein! Nein! Ja! Keine Stressreaktion Stress Quelle: Seminarunterlagen zu „Critical Incident Stress Management (CISM)“ von WILLKOMM, Bernd; Dipl.-Psychologe; Unveröffentlichtes Manuskript, 1999 2 Die Stressoren 2.1 Arbeitsdefinition von „Stressor“ Innerhalb dieser Arbeit wird für ‘Stressor’ folgende Arbeitsdefinition gewählt: Ein Stressor ist eine Umweltbedingung, die eine Stressreaktion auslöst. Wobei beachtet werden muss, dass die Stressreaktion individuell unterschiedlich erlebt werden kann. Ein und der selbe Stressor kann von einem Menschen als positiv, angenehm erlebt werden. Hingegen kann ein anderer Mensch denselben Stressor negativ empfinden. Es kommt besonders auf die kognitive Verarbeitung des Stressors an. (Siehe Seite 11, „Kognitive Bewertung als Bindeglied zwischen Stressor und Stress“) Stressverursacher werden in zwei Kategorien eingeteilt: 26 1. biochemische Stressoren Beispiele von biochemischen Stressoren: Drogen (z. B.: Koffein, Alkohol, Amphetamine, Nikotin, Phenylpropanolamin) Umwelt (Hitze, Kälte, Wind, Lärm, Sonnenstrahlen, Radioaktivität) 2. psychosoziale Stressoren Beispiele von psychosozialen Stressoren Familiensituation, zwischenmenschliche Situation Einsamkeit Beruf, Situation am Arbeitsplatz, am Weg zum Arbeitsplatz, Konkurrenz mit den 26 MITCHELL, Jeffrey, T.; EVERLY, George, S.: „Streßbearbeitung nach belastenden Ereignissen“. Hrsg.: Andreas Igl; Joachim Müller-Lange, Susanne Fassmann (Übers.), Ingeborg Schiwek (Textbearb.). - Edewecht; Wien: Stumpf und Kossendey, 1998. S. 36. Seite 13 Stress Kollegen, etc. politische Situation finanzielle Situation Viele psychosoziale Situationen können potentiell Stress verursachen, aber nur wenn sie als herausfordernd, bedrohlich oder aggressiv wahrgenommen werden, entwickeln sie sich zu psychosozialen, negativen Stressoren. Die wichtigsten psychosozialen Stressoren sind in einer Grafik auf Seite 15 dargestellt. Inwieweit eine psychosoziale Situation als Stressor wirkt und tatsächlich eine Stressreaktion auslöst, hängt vor allem von der kognitiven Bewertung der Situation ab. Ein und dieselbe psychosoziale Situation kann bei verschiedenen Menschen die gesamte Bandbreite der Stresssreaktionen auslösen. Beginnend von unangenehmen, bis hin zu besonders angenehmen Erlebnisformen des Stressors sind möglich. Allein auf der körperlichen, endokrinen Ebene betrachtet, ist nicht zu unterscheiden, ob ein Stressor positiv oder negativ erlebt wird. Im Gegensatz dazu wirken die biochemischen Stressoren in den meisten Fällen als Stressauslöser und bewirken deutliche Stresssymptome.27 Obwohl die individuelle Erlebnisweise eines psychosozialen Stressors breit gestreut ist, gibt es eine Übereinstimmung der Forschungsgemeinschaft über die Verschiedenartigkeit in puncto Stresspotential von unterschiedlichen Lebenssituationen. Die nachstehende Tabelle (auf Seite 16) bietet eine Übersicht über die subjektiv erlebte Belastung diverser Situationen. Die Spalte ‘Mittlerer Wert’ gibt den Mittelwert des Ratings der Fachleute an. Durch eine Normierung wurden die Werte so gesetzt, dass dem höchsten Stresspotential der Wert ‘100’ zugeordnet wurden und einem Ereignis, das keinerlei Stressqualität enthält, wurde der Wert ‘0’ zugeteilt. 27 MITCHELL, Jeffrey, T.; EVERLY, George, S.: „Streßbearbeitung nach belastenden Ereignissen“. Hrsg.: Andreas Igl; Joachim Müller-Lange, Susanne Fassmann (Übers.), Ingeborg Schiwek (Textbearb.). - Edewecht; Wien: Stumpf und Kossendey, 1998. S. 33. Seite 14 Stress Quelle: Gerald HÜTHER: „Der Traum vom stressfreien Leben“, Spektrum der Wissenschaft, Dossier Stress, Nr.3/1999 S. 9. Seite 15 Stress Bewertung lebensverändernder Ereignisse28 (Social Readjustment Rating Scale) Lebensereignis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 28 Tod des Ehepartners Scheidung Trennung vom Ehepartner Gefängnisstrafe Tod eines nahen Angehörigen Eigene Verletzung oder Krankheit Eheschließung Verlust des Arbeitsplatzes Versöhnung mit dem Ehepartner Rückzug aus dem Arbeitsleben Verschlechterung des Gesundheitszustandes eines Angehörigen Schwangerschaft Sexuelle Schwierigkeiten Hinzukommen eines neuen Familienmitgliedes Geschäftliche Veränderung Änderung der finanziellen Verhältnisse Tod eins guten Freundes Wechsel der Branche Häufigkeit der Auseinandersetzungen mit dem Ehepartner nimmt zu Hypothek über 10.000 Dollar Verfallserklärung Hypothek/Darlehen Andere Aufgaben am Arbeitsplatz Sohn oder Tochter verlässt das Haus Schwierigkeiten mit der Schwiegerfamilie Herausragende eigene Leistung Ehefrau nimmt Arbeit auf / gibt Arbeit auf Schulbeginn oder -abschluss Änderung der Lebensverhältnisse Änderung der persönlichen Gewohnheiten Ärger mit dem Vorgesetzten Geänderte Arbeitszeiten oder -bedingungen Wohnungswechsel Schulwechsel Neue Freizeitgewohnheiten Vermehrte/verminderte Beteiligung am kirchlichen Leben Veränderungen in den sozialen Aktivitäten Hypothek oder Darlehen von weniger als 10.000 Dollar Änderung der Schlafgewohnheiten Änderung der Häufigkeit der Familienzusammenkünfte Änderung der Essgewohnheiten Urlaub Weihnachten Geringfügige Gesetzesübertretungen mittlerer Wert 100 73 65 63 63 53 50 47 45 45 44 40 39 39 39 38 37 36 35 31 30 29 29 29 28 26 26 25 24 23 20 20 20 19 19 18 17 16 15 15 13 12 11 HOLMES, T. H.; RAHE, R. H: „The Social Readjustment Rating Scale“. Journal of Psychosomatic Research 11, 1967. S. 213-218. Seite 16 Stress 2.2 Ablauf der Stressreaktion Obwohl die Umstände oder Ereignisse, die zu Stressreaktionen führen, von Mensch zu Mensch verschieden sind, ist man in der Psychologie der Meinung, dass der Organismus auf Stress im Wesentlichen stets gleich reagiert. Lange Zeit sah man Stress als körperliche Reaktion, als eine den Körper bedrohende Gefahr. Einer der ersten Erforscher der StressPhysiologie „Hans Selye (...) hat dieses Verhalten als Allgemeines Adaptionssyndrom 29 bezeichnet“ . Dieses Syndrom, das von fast jedem Stressor ausgelöst wird, lässt sich in drei Abschnitte gliedern: 1. Alarm 2. Widerstand 3. Erschöpfung ad 1: Die Alarmphase ruft Veränderungen im Gehirn und in den endokrinen Drüsen hervor. Die stärkste dieser physiologischen Reaktionen ist die sogenannte Notfall-Reaktion, die den Körper zum Angriff oder zur Flucht mobilisiert. Diese Notfall-Reaktion regt den Körper an, sich auf die Gefahr einzustellen, ihr zu entfliehen oder Verletzungen zu heilen. Dies kostet viel Energie und ist eine große Belastung für den Organismus ad 2: Währt ein Stressor über längere Zeit, so passt sich der Körper an und tritt in die Widerstandsphase ein. In diesem Stadium normalisiert sich der Organismus, bleibt aber in Alarmbereitschaft, um gegebenenfalls auf den Stressor zu reagieren. ad 3: Ist der Stressor sehr intensiv oder lange wirksam, kommt es schließlich zur Erschöpfungsphase. In diesem Stadium kann sich der Organismus nicht mehr gegen den Stressor zur Wehr setzen und wird anfällig für Fehlverhalten und Krankheiten. Zusätzlich zu der Bedrohung muss der Körper auch seine Kraftressourcen, die mehr oder minder in Mitleidenschaft gezogen wurden, wieder auftanken. Dies geht aber nicht, weil der Organismus sich gegen die Bedrohung wehren oder Verletzungen, bzw. Krankheiten, heilen muss — es werden weiterhin viele Energiereserven verbraucht. Ein Teufelskreis beginnt. Wenn sich daran nichts ändert, bzw. nichts ändern lässt, erlahmt der körperliche und geistige Widerstand und es folgt die totale Erschöpfung. Die Notfall-Reaktion ist in einer Gefahrensituation eindeutig von großem Nutzen. Sie hilft aber auch bei weniger bedrohlichen Herausforderungen, etwa bei einem sportlichen Wettkampf oder bei Termindruck. Es gibt aber durchaus ungünstige Effekte der Notfall-Reaktion: Wenn es nicht auf irgendeine Art gelingt, den Stressor zu bewältigen, kann das Unterdrücken der AlarmReaktion zu physischen und psychischen Schäden führen. 30 29 TIME LIFE: „Wie erkennt man Stress“. Stress-Bewältigung. Amsterdam, 1988. S. 13. 30 a. a. O. S. 13. Seite 17 Stress 2.3 Stressformen 2.3.1 Psychischer Stress Menschen reagieren auf verschiedene Belastungen mit den unterschiedlichsten Gefühlen. Angst vor Verletzung, Angst vor Versagen oder Angst sich zu blamieren sind fast immer Auslöser von starkem Stress. Gefühle von Überforderung, Hilflosigkeit und Einsamkeit münden ziemlich sicher in Angst. Aus diesen, meist alltäglichen Ängsten entstehen Gedanken und Gefühle. Diese werden als psychischer Stress bezeichnet. Wie sehr der oder die Betroffene darunter leidet, ist von Fall zu Fall verschieden. So meinen die Autoren des Buches ‘TIME LIFE’ Dr. Med. Christian RAAB, Herbert BENSON (M.D.), Ann GRANDJEAN (M.S), Paul J. ROSCH (M.D.), Kenneth R. PELLETIER (Ph.D.; M.D.), John WHITE (Ph.D.) und Myron WINICK: „Das Stress-Potential (...) hängt von mehreren Faktoren ab: von der Art, wie jemand mit solchen Problemen fertig wird, von der Persönlichkeit, vom sonstigen Tagesverlauf und letztlich auch vom Zwischenfall selbst.“31 In manchen Fällen lässt sich dieser Stress durch Planung vermeiden. Beispielsweise sollte jemand, der an Höhenangst leidet, nicht unbedingt auf die Drehleiter geschickt werden oder jemand, der vor kurzer Zeit einen ihm nahestehenden Menschen verloren hat, zur Bergung eines Toten eingesetzt werden. Diese Punkte lassen sich beliebig um weitere Beispiele erweitern. 2.3.2 Chronischer Stress „Der eigentliche, durch Alltagsärger verursachte Stress liegt jedoch in seiner Anhäufung. Im Gegensatz zu einschneidenden Ereignissen, die meist in größeren Abständen auftreten und durch die Zeit gemildert werden, handelt es sich bei kleinen Ärgernissen, um täglich wiederkehrende Stressoren, die chronisch werden und dadurch einen Langzeiteffekt haben.“32, Die große Gefahr entsteht dadurch, dass der menschliche Körper diesen ununterbrochenen Stress verdrängt. Der Körper reagiert mit körperlichen Störungen, die auch unter dem 33 Begriff psychosomatische Beschwerden bekannt sind. 31 a. a. O. S. 10. 32 a. a. O. S. 10. 33 „Psychosomatik, psychosomatische Medizin: [gr. psyche Seele, soma Körper], medizinisch-ps. Krankheitslehre, die psychischen Prozessen bei der Entstehung körperlicher Leiden wesentliche Bedeutung beimißt.“ Quelle: DORSCH, Friedrich: Psychologisches Wörterbuch / Dorsch. Hrsg. von Friedrich Dorsch. Red.: Horst RIES. 11., erg. Aufl.; Bern, Stuttgart, Toronto: Huber, 1987. Seite 18 Stress Eine ganz besondere Art von Stressbelastung stellen viele kleine Stressoren dar. Laut Wissenschaftlern der University of California34 hat sich gezeigt, „daß eine Anhäufung von lästigen Kleinigkeiten (...) weit mehr Stress erzeugen kann als ein einziges großes Ereignis.“35 Gründe, die chronischen Stress hervorrufen:36 1. Arbeitsüberlastung 2. Unzufriedenheit mit der Alltagsarbeit 3. Soziale Belastung 4. Mangel an sozialer Anerkennung 5. belastende Erinnerung 6. Sorgen und Besorgnis 2.3.3 Akuter Stress Quelle: Time Life: „Wie erkennt man Stress?“. Stress-Bewältigung, Amsterdam, 1988. S. 11. Peter SCHULZ, ein Psychologie-Professor der Universität Trier, definiert akuten Stress folgendermaßen: „Als akuten Stress bezeichnet man Belastungen, die einmalig sind, distinkte Ereignisse darstellen, abrupt beginnen, ein erkennbares Ende haben mit neuen Anforderungen verbunden sind und einen Anlaß bieten, besondere Bewältigungsreaktionen zu initiieren.“37 Der Verfasser dieser Definition will damit eine Abgrenzung zum chronischen Stress herstellen. Er meint: „Die Stressforschung hat sich seit ihren Anfängen in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts vorrangig mit den Auswirkungen von akutem Stress beschäftigt. Vermutlich ist dies ein Grund dafür, warum die in empirischen Untersuchungen ermittelten Zusammenhänge zwischen Stress und Gesundheit relativ inkonsistent und wenig aussagekräftig sind.“38 Deshalb wurden Kriterien entwickelt, um chronischen Stress von akutem Stress unterscheiden zu können. Üblicherweise wird zwischen akutem und chronischem Stress aufgrund der Häufigkeit des Wirkens von Stressoren unterschieden: Häufiger Stress gilt als chronischer Stress. Peter SCHULZ meint, dass dies aber eine zu einfache Kategorisierung sei. Er gibt zwei wichtige Gründe an: 34 nicht näher genannt, zit. in TIME LIFE:„Wie erkennt man Stress“. Stress-Bewältigung, Amsterdam, 1988. S. 11. 35 TIME LIFE: „Wie erkennt man Stress?“. Stress-Bewältigung. Amsterdam, 1988. S. 11. 36 SCHULZ, Peter: „Wenn Stress chronisch wird“. Spektrum der Wissenschaft. Heidelberg: Scientific American, Dossier 3/1999. S. 13. 37 a. a. S. 12. 38 a. a. O. Seite 19 Stress 1. „Zum einen wird nicht berücksichtigt, dass man sich an wiederkehrenden Stress gewöhnen kann.“39 2. „Zum anderen können auch einmalige, aber außergewöhnliche Ereignisse noch Stressreaktionen auslösen, obwohl der Stressor nicht mehr wirksam ist (zum Beispiel die wiederkehrenden Folgebelastungen traumatischer Ereignisse)“.40 Die Unterscheidung von chronischem und akutem Stress ist auch deshalb sehr wichtig, weil zur Bewältigung dieser verschiedenen Stressformen andere Strategien notwendig sind. Bei chronischen Stresssituationen sind von vornherein „wegen ihres schleichenden Beginns keine Tendenzen zur Aktivierung besonderer Bewältigungsmaßnahmen (zu) erkennen“.41 3 Stressreaktion des Organismus Stress und Angst haben zum Ziel, den Organismus für die bevorstehende Belastung vorzubereiten und sie erfolgreich zu bewältigen. Dies kann entweder durch Kampf mit der Bedrohung oder Flucht geschehen. Es werden im Organismus alle zur Verfügung stehenden Ressourcen aktiviert, die eine positive Bewältigung der Bedrohung ermöglichen. Diese Reaktionsform wird auch als „Stressreaktion“ bezeichnet. 39 a. a. O. 40 a. a. O. 41 a. a. O. Seite 20 Stress Es lassen sich die Stressreaktionen auf außergewöhnliche Belastungen in vier Bereichen des Menschen beobachten: 42 Im kognitiven Bereich: - gedankliche Verwirrung - reduzierte Entscheidungsfähigkeit - Konzentrationsschwierigkeiten - Gedächtnisschwierigkeiten - Reduzierung der höheren kognitiven Funktionen Im körperlichen Bereich: - starkes Schwitzen - Sprachstörungen - Herzrasen - erhöhter Blutdruck - schnelles Atmen Im emotionalen Bereich: - emotionaler Schock - Wut - Trauer - Depression - Gefühl, überwältigt zu sein Im verhaltensmäßigen Bereich - Änderungen der vertrauten Verhaltensmuster - verändertes Essverhalten - Vernachlässigung der Körperhygiene - Distanz zu anderen Menschen - längeres Schweigen 3.1 Biochemische Stressvorgänge Bei allen möglichen Stressoren laufen im Körper dieselben biochemischen Vorgänge ab. Es ist an Hand dieser Vorgänge nicht möglich, die verschiedenen Stressoren zu identifizieren. Der einzige Unterschied der biochemischen Vorgänge, hinsichtlich der Stressoren, besteht lediglich in einer verschieden hohen Ausschüttung der Stresshormone. (Stresshormone sind: Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol) Nachstehende Grafik (Seite 23) stellt diese Vorgänge schematisch dar. „Praktisch jedes Stress-Ereignis löst eine Kette von neuralen und biochemischen Reaktionen aus, die Kräfte zur Stress-Bewältigung mobilisieren. Zunächst aktiviert das Gehirn den Hypothalamus. Dieser scheidet das sogenannte CRF 43 aus, ein Neuronensekret, das über zwei Bahnen Informationen an den Organismus weiterleitet. Entlang der einen Bahn werden durch Nervenzellen im Hirnstamm und im Rückenmark 42 MITCHELL, Jeffrey, T.; EVERLY, George, S.: „Streßbearbeitung nach belastenden Ereignissen“. Hrsg.: Andreas Igl; Joachim Müller-Lange, Susanne Fassmann (Übers.), Ingeborg Schiwek (Textbearb.). - Edewecht; Wien: Stumpf und Kossendey, 1998. S. 33. 43 CRF: Abkürzung für Corticotropin Releasing Faktor (Neurosekret des Hypothalamus: identisch mit CRH: Corticotropin Releasing Hormon. Quelle: PSCHYREMBEL, Willibald [Begr.]; Zink, Christoph [Bearb]; Dornblüth, Otto [Begr.]: Klinisches Wörterbuch, 255. Aufl. Berlin, New York: de Gruyter, 1986. S. 314. Seite 21 Stress Impulse an die Nebennierenrinde übermittelt, die die Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin bewirken, die den Körper aufs Handeln vorbereiten: Sie verstärken den Herzschlag und die Atmung, erhöhen den Muskeltonus und schärfen die Sinne. Man nennt diese Kette neurologischer Abläufe Notfall-Reaktion, mitunter auch Angriffs- oder Fluchtreaktion. Gleichzeitig regt das vom Hypothalamus abgesonderte CRF die Hirnanhangdrüse, die an der Basis des Gehirns sitzt, zur Produktion von ACTH 44 an. Dieses Hormon veranlaßt die Nebennierenrinde zur Ausschüttung von Cortisol in den Blutstrom. Cortisol wiederum setzt die Reaktionen in Gang, die den Stoffwechsel des Körpers beschleunigen. Beide Bahnen besitzen eine Rückkoppelung zur Hirnanhangdrüse, so dass die Stress-Reaktion auch weiterhin gesteuert wird. Zwar kann dieser biochemische Prozeß die Stress-Bewältigung unterstützen; zu häufig ausgelöst, hat er jedoch physische und psychische Schäden zur Folge.“45 3.2 Was geschieht nach dem Einsetzen der NotfallReaktion? Ein längerdauernder Stressreiz bewirkt, dass sich der Körper an diese Stressreaktion anpasst und in die Widerstandsphase eintritt. Zwar normalisiert sich der Organismus, bleibt aber in Alarmbereitschaft um gegebenenfalls auf den Stressor zu reagieren. Diese Phase kann nicht allzu lange dauern, ohne bleibende Schäden mit sich zu tragen. Ist der Stressor sehr intensiv und lange wirksam, kommt es schließlich zur Erschöpfungsphase. Es wird für den Organismus schwierig, sich adäquat gegen den Stressor zu schützen und er wird anfällig für Fehlverhalten und Krankheiten. Die Notfall-Reaktion ist in einer Gefahrensituation sehr wichtig und hilft auch bei weniger bedrohlichen Herausforderungen, etwa bei einem sportlichen Wettkampf oder bei Termindruck. Leider kommt es heutzutage immer öfter vor, dass die Notfall-Reaktion ausgelöst wird, wenn sie weder erforderlich noch sinnvoll ist, z. B. im Stau auf der Autobahn oder in einer Warteschlange vor einer Kassa in einem Supermarkt. Der Körper befindet sich dann in einem ständigen Alarmzustand, hat aber keine Möglichkeit die aufgeladenen Energien bei einem entsprechenden Verhalten (wie Kampf oder Flucht) abzubauen. Langfristig kann dieses Unterdrücken zu physischen und 44 ACTH: Abkürzung für Adrenocorticotropes Hormon, Quelle: a. a. O. S. 14. 45 TIME LIFE: „Wie erkennt man Stress“. Stress-Bewältigung. Amsterdam, 1988. S. 12. Seite 22 Stress psychischen Schäden führen. Einige dieser möglichen physischen Schäden, zum Teil auch psychisch bedingt, sind: Kopfschmerzen, Hautprobleme, Herzerkrankungen, geschwächtes Immunsystem, Rückenschmerzen, Magen- und Darmbeschwerden, Bluthochdruck und Potenzstörungen. Psychische Schäden, die durch ungünstige Stressbewältigung verursacht werden, können z. B. sein: Depressionen, Angst- und Panik-Attacken, Chronisches Müdigkeitssyndrom und Schlafstörungen. 3.3 Wann wird die Stressbewältigung problematisch? Quelle: Time Life: “Wie erkennt man Stress?“. Stress-Bewältigung, Amsterdam, 1988. S. 12. Die Belastungsintensität, die von Stressoren ausgeht, hängt in hohem Maße von Häufigkeit und Dauer ab. Ein kurzer akuter Stressreiz, z. B. ein Zahnarztbesuch oder eine wichtige Rede halten, dauert nur kurze Zeit an. Wird er überwunden, gibt es dann anschließend Gelegenheit sich zu entspannen. Gelingt die Entspannung hinterher, kann sich der Betroffene neuen Belastungen zuwenden und sie erfolgreich meistern. Solange es also gelingt, akute Stressreize sofort zu verarbeiten, bleibt ihre Wirkung begrenzt und sie richten vermutlich kaum Schaden an. Seite 23 Stress Es ist durchaus möglich, dass einzelne, akute Stresssituationen rasch hintereinander auftreten und dazwischen keine Gelegenheit zur Entspannung besteht. Oder ein Stressreiz, der schlecht vermeidbar ist, wiederholt sich in regelmäßigen Abständen, wie beispielsweise die Fahrt zur Arbeit während des Stoßverkehrs. Es gibt dann auch noch chronische Stresssituationen, die als konstante Stressoren auftreten, wie etwa ständige Spannungen zu Hause und/oder am Arbeitsplatz. Unter diesen Bedingungen summieren sich die einzelnen Stressreaktionen und können sich zu einem massiven, krankmachenden Faktor aufschaukeln. 3.4 Stress macht krank Stress scheint Krankheiten und körperliche Beschwerden zu begünstigen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei vielleicht die stressbedingte Beeinträchtigung des Immunsystems. So ergab eine Forschung mit Studenten, die unter Examensdruck standen, dass ihr Blut weniger Antikörper enthielt als in Normalzeiten — dass sie also infektanfälliger waren.46 Wissenschaftlich bestätigt ist inzwischen auch der enge Zusammenhang zwischen Stress und Herzerkrankungen. Viele Beschwerden des Magens und Verdauungstraktes sind eine Folge von Nervosität und Erregungszuständen. Auch Kopf- und Rückenschmerzen gehen oft auf Stress zurück. Bei einem Vergleich von Testpersonen, die häufig über Kopfschmerzen Kontrollgruppe, wesentlich klagten, wiesen stärkere die mit einer gesunden Kopfschmerzpatienten Stressreaktionen auf. Ähnliche Ergebnisse zeigten sich bei Menschen mit chronischen Rückenschmerzen. Sie hatten gegenüber den Gesunden in allen Bereichen erhöhte Stresswerte.47 Auf Stress gehen vermutlich auch viele Hautprobleme zurück. So fand man heraus, dass Psoriasispatienten48 unter starkem Leistungsdruck einen sehr viel höheren Stress-Hormonspiegel hatten als gesunde Testpersonen. Quelle: Time Life: „Wie erkennt man Stress“. Stress-Bewältigung, Amsterdam 1988. S. 15. 46 a. a. O. S.15. 47 a. a. O. 48 „Psoriasis [zu gr = Krätze, Räude] w; -; ...ia|sen (in fachspr. Fügungen; ... iases): ‘Schuppenflechte’, chronisches Hautleiden mit Bildung silberweißer, geschichteter Schuppen, bei deren Entfernung es zu punktformigen Blutungen kommt.“ Quelle: DUDEN: Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke. hrsg. u. bearb. von d. Red. Naturwiss. u. Medizin d. Bibliograph.; 3., vollst, überarb. u. erg. Aufl.; Mannheim, Wien, Zürich: Bibliographisches Institut; Stuttgart: Thieme, 1979. S. 580. Seite 24 Stress Stress ist auch ein ernstzunehmender Risikofaktor für Leute mit chronischem Bluthochdruck. So war bei einem schwierigen Wortzuordnungstest der Stresshormonspiegel von Patienten mit hohem oder labilem Blutdruck höher als der von Versuchspersonen mit normalem Blutdruck. Selbst Potenzstörungen können mit Stress in Verbindung stehen. Als man einer Reihe von männlichen Testpersonen erotische Filme vorführte, wiesen die Männer, die dabei kaum sexuelle Erregung spürten, den höchsten Spiegel des Stress-Hormons Cortisol auf.49 Eine Reihe von Krankheitsbildern ist im Laufe der Jahrzehnte, in denen der Begriff ‘psychosomatische Krankheiten’ vermehrt diskutiert wird, als besonders typisch für psychosomatische Zusammenhänge in den Vordergrund getreten.50 SCHAEFER u. BLOHMKE haben bei ihrer Analyse Stress als Entstehungsursachen des Herzinfarktes erkannt. Sie schreiben:51 „Die emotional wirksamen Faktoren mag man unter dem Schlagwort des psychosozialen Stress zusammenfassen. Man darf nicht vergessen, wie vielfältige Aspekte solch ein Stress-Konzept liefert. Sie reichen von den emotionalen Reaktionen auf eine sich wandelnde soziale Welt bis zu den Reaktionen auf die alltägliche Umwelt in Beruf und Familie. In dieser Auseinandersetzung ist die Persönlichkeit deshalb der dominierende Faktor, weil von ihr der Grad der Emotionalität dieser Reaktionen abhängt." 49 TIME LIFE: „Wie erkennt man Stress“. Stress-Bewältigung. Amsterdam, 1988. S. 15. 50 STROTZKA, Hans: Tiefenpsychologie und Psychotherapie. Wien, New York: Springer, 1982. S. 162. 51 SCHAEFER, H., BLOHMKE, M.: Herzkrank durch psychosozialen Streß. Heidelberg: Hüthig. 1977. S. 176. zitiert in STROTZKA, 1982, S.167. Seite 25 Stress Psychosomatische Erkrankungen sind:52 Geschwürserkrankungen des Magens (Ulcus ventriculi und duodeni) Geschwürserkrankungen des Darmes (Morbus Crohn und Colitis ulcerosa) Koronarerkrankungen, Herzinfarkt, Hypertonie Asthma bronchiale Immunstörungen (Herpes, alle allergischen Erkrankungen) Neurodermitis Rheumatische Erkrankungen, Anorexie Fettsucht, Diabetes. Die Ursachen von psychosomatischen Beschwerden werden erkannt und bestimmen die Therapie. Aber wichtig ist, dass psychosomatische Beschwerden als ‘Krankheit’ anerkannt werden und der Mensch nicht isoliert betrachtet wird, sondern als Wesen, das in einer Umwelt mit Gefährten eingebettet ist. Walter BRÄUTIGAM, Paul CHRISTIAN und Michael von RAD, Fachärzte für psychosomatische Medizin schreiben: „Psychosomatik bedeutet, daß der kranke Mensch als erlebendes und handelndes Wesen in seiner mitmenschlichen Umwelt und in Wechselwirkung mit dieser und mit den kulturellen Werten und Normen der Zeit gesehen wird.“53 Korrekte Behandlung und fachmännische psychotherapeutische Betreuung werden gegen oftmals sehr langwierige und schwierige Beschwerden eingesetzt: „Bei der Behandlung psychosomatisch Kranker kommt die gesamte Breite psychotherapeutischer Verfahren zu Anwendung, die bei den einzelnen Kranken in der notwendigen Verbindung mit somatischen Behandlungsformen aber auch ohne diese angewendet werden: Einzel-, Gruppen-, Familienpsychotherapie, aufdeckende, supportive, übende Verfahren, körperzentrierte und bildhaft gestaltende Verfahren. Spezifische Modifikationen, wie z.B. homogene oder gemischte langfristige Gruppentherapie haben sich häufig als nützlich erwiesen, um dem körperlich Kranken mit seiner zunächst organorientierten Krankheitsauffassung und seiner oft mangelnden Selbstwahrnehmung und Schwierigkeit, sich emotional auszudrücken, eine Hilfe zu geben.“54 52 STROTZKA, Hans: Tiefenpsychologie und Psychotherapie. Wien: New York: Springer, 1982. S. 162. 53 BRÄUTIGAM, Walter; CHRISTIAN, Paul; VON RAD, Michael: Psychosomatische Medizin. 6. Aufl.; Stuttgart, New York: Thieme, 1992. S. 14. 54 a. a. O. S. 4. Seite 26 Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) Teil 2 Posttraumatic Stress Disorder Einleitung Entsetzliche Ereignisse, die jäh unser Gefühl der Sicherheit und Unverwundbarkeit durchbrechen, können den Umgang mit den eigenen Gefühlen und der Umwelt tiefgreifend beeinträchtigen. Kriegstraumata, körperliche und sexuelle Übergriffe, Unfälle und andere natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen können zum Auslöser des PTSD genannten Syndroms werden (engl. 'Post Traumatic Stress Disorder', dt. 'Posttraumatische Belastungsstörung'). Die Hilflosigkeit und Wut, die solche Erlebnisse in der Regel begleiten, können den Umgang eines Menschen mit Stress nachhaltig beeinflussen, sein Selbstwertgefühl beeinträchtigen und die Wahrnehmung von der Welt als einem im Wesentlichen sicheren und verläßlichen Ort empfindlich stören. Ein gewisses Gefühl von Sicherheit und Verlässlichkeit ist Grundvoraussetzung für zweckorientiertes, individuelles Handeln. Menschen scheinen Willkür und sinnlose Zerstörung seelisch nicht hinnehmen zu können. Sie suchen nach einer Erklärung, um eine erlebte Katastrophe verstehen zu können — normalerweise dadurch, dass sie jemanden finden, dem die Schuld zu geben ist: sich selbst oder einem Täter. 55 Die meisten psychisch traumatisierenden Ereignisse treten plötzlich und unerwartet ein. Egal, ob sie nur einmal kurz oder über Jahre hinweg immer wieder passieren, sie überfordern unsere Kapazität, die erlebten Eindrücke zu verarbeiten und richtig in unseren Erfahrungsschatz einzugliedern. Zu psychischen Traumatisierungen können alle bedrohlichen Ereignisse führen, die außerhalb der normalen Erfahrung liegen und denen ein Mensch wehr- und hilflos ausgeliefert ist.56 Erinnerungen an Ereignisse, die von uns Menschen innerlich nicht verarbeitet worden sind, können ganz unvermittelt in die tägliche Gedanken- und nächtliche Traumwelt eindringen. Diese plötzlichen Rückerinnerungen stören den Schlaf, die innere Ruhe und die Konzentration. Oft sind sie mit Gefühlen von Niedergeschlagenheit, Angst und andauernder innerer Spannung verbunden. Sind sie einmal aufgetreten, dann verschwinden sie ohne Behandlung nicht so schnell. Sie können sich um so mehr verschlimmern, je öfter sie durch neue traumatische Erfahrungen wachgerufen werden.57 55 VAN DER KOLK, Bessel A.: http://traumatherapie.de/kolk.htm. 56 Quelle: http://traumatherapie.de/therapie.htm. 57 Quelle: http://traumatherapie.de/therapie.htm. Seite 27 Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) Ist die Stresssituation überwältigend genug, konditioniert das resultierende Trauma eine emotionale Reaktion, bei welcher der Körper schon beim geringfügigsten Reiz in Kampfoder Fluchtbereitschaft oder Erstarrung verfällt. Der Alltag traumatisierter Menschen steht unter dem Vorzeichen des Traumas, gegenüber dem sie in ständiger Alarmbereitschaft verharren. Selbst wenn sie später das Trauma bewusst verarbeitet haben, empfinden sie auch weiterhin Angst. Bei den an das Trauma erinnernden Situationen oder auch nur lauten Geräuschen stellt sich erhöhte körperliche Erregung ein. Sie reagieren mit Kampf- oder Fluchtbereitschaft, oft ohne die Herkunft solcher extremen Reaktionen zu kennen. 58 4 Beschreibung des Störungsbildes PTSD 4.1 Entwicklung des Begriffes ‘PTSD’ - Historischer Hintergrund Einleitung Schon immer wurden Naturkatastrophen, Menschen Kriegen, in Krankheiten ihrer und ca. 200.000-jährigen anderen Evolution schrecklichen mit Ereignissen konfrontiert. Aber die individuellen Erlebnisse und Nachwirkungen dieser Vorfälle wurden auch sehr unterschiedlich beschrieben. Es dauerte bis in die 80er-Jahre, ehe eine brauchbar einheitliche Klassifikation entstand. Phillip A. SAIGH, Professor der City University New York, meint dazu: „Insgesamt gesehen ist unverkennbar, daß traumatisierte Menschen häufig unter weitreichenden und langanhaltenden emotionalen Problemen leiden. Offensichtlich ist auch, daß im Laufe der Zeit verschiedene Bezeichnungen zur Beschreibung dieser Pathologie benutzt wurden, was leider in beträchtlichem Umfang Verwirrung stiftete und einem raschen Fortschritt von Wissenschaft und Praxis auf diesem Gebiet bisweilen im Wege stand.“ 59 KARDINER beklagte diese Situationen mit den unklaren, verschiedenen Beschreibungen der emotionalen Problemen mit den Worten, dass „sich trotz der großen Menge an verfügbaren Daten (...) kaum ein weiteres Gebiet in der Psychiatrie finden wird, auf dem es undisziplinierter zugeht als auf diesem. Es gibt praktisch überhaupt keine Kontinuität, und die Literatur kann nur als anarchisch bezeichnet werden. Jeder Autor hat seinen eigenen Bezugsrahmen, daran ändern auch noch so umfangreiche Bibliographien nichts.“ 60 58 VAN DER KOLK, Bessel A.: http://traumatherapie.de/kolk.htm. 59 SAIGH, Philip, A.: Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. Aus dem Engl. Übers. von Matthias Wengenroth; Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber, 1995. S. 17. 60 KARDINER, A.: Traumatic neurosis of war. In S. Arietie (Ed.) American handbook of psychiatry. New York: Basic Books, 1969, zit. SAIGH, 1995. S. 11. Seite 28 Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) 4.1.1 Zeitraum ohne Definition des PTSD Es wird schon Jahrhunderte über die Auswirkungen traumatischer Erlebnisse berichtet. Ein anschauliches Beispiel findet sich im Tagebuch von Samuel PEPYS, der Zeuge des Londoner Großbrandes des Jahres 1666 geworden war. Sechs Monate später schrieb er: „Wie merkwürdig, daß ich bis zum heutigen Tag keine Nacht schlafen kann, ohne von großer Angst vor dem Feuer erfaßt zu werden; und in dieser Nacht lag ich bis fast zwei Uhr morgens wach, weil mich die Gedanken an das Feuer nicht losließen“.61 Anke EHLERS fand Beschreibungen des PTSD: „Erste systematische Beschreibungen der Symptome, die nach traumatischen Erlebnissen auftreten, wurden am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts anhand von Überlebenden schwerer Eisenbahnunglücke, Soldaten der beiden Weltkriege und Überlebenden des Holocausts vorgelegt. In diesen Beschreibungen finden sich die typischen Symptome, wie wir sie auch heute noch als charakteristisch für Reaktionen auf traumatische Erlebnisse betrachten: ungewolltes Wiedererleben von Aspekten des Traumas, zum Beispiel in Form von „Flashbacks" oder Albträumen; Anzeichen einer erhöhten Erregung, zum Beispiel Schreckhaftigkeit und Schlafstörungen; Vermeidung von Situationen, Gesprächen und anderen Reizen, die an das Trauma erinnern; sowie Symptome einer emotionalen Taubheit, zum Beispiel Interesselosigkeit oder Entfremdung von anderen Menschen.“ 62 Emil KRAEPELIN benutzte im 19. Jahrhundert „den Begriff ‘Schreckneurose’ zur Bezeichnung eines bestimmten klinischen Zustandes, bei dem es sich um ein aus mannigfaltigen nervösen und psychischen Erscheinungen zusammengesetztes Krankheitsbild [handelt], welches sich in Folge von heftigen Gemüthserschütterungen, plötzlichem Schreck, grosser Angst ausbildet und daher nach schweren Unfällen und Verletzungen, besonders nach Feuersbrünsten, Explosionen, Entgleisungen oder Zusammenstössen auf der Eisenbahn u. dergl. beobachtet wird.“63 (KRAEPELIN, 1899. S. 520) Es wurde nicht immer vom PTSD gesprochen, sondern für die Symptome, die in der Folge traumatischer Erlebnisse auftreten, wurden zunächst viele andere diagnostische Bezeichnungen vorgeschlagen, z. B. „Schreckneurose", „Kampf- oder Kriegsneurose" (combat/war neurosis), „Granatenschock" (shell shock) oder „Überlebenden-Syndrom" (survivor syndrome). 64 61 DALY, R. J.: „Samuel Pepys and posttraumatic stress disorder“. British Journal of Psychiatry. 143, 64-68, 1983. S. 66. zit. SAIGH, 1995. S. 11. 62 EHLERS, Anke: Posttraumatische Belastungsstörung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe 1999. S. 2. 63 KRAEPELIN, E. Psychiatrie. Bd. 2 (6. Auflage). Leipzig: Barth. 1899. zitiert in SAIGH, 1995. S. 11. 64 EHLERS, Anke: Posttraumatische Belastungsstörung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, 1999. S. 2. Seite 29 Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) Lange wurde bezweifelt, dass das traumatische Ereignis die wesentliche Ursache für die Symptome darstellt. Anke EHLERS, eine Psychologie-Professorin der Universität am Department of Psychiatry der Universität Oxford, fand sogar ziemlich skurrile Ideen, wie sich die Menschen früher das Entstehen eines PTSD vorstellten: „So wurde zum Beispiel vorgeschlagen, dass eine Rückenmarksverletzung dem ‘Eisenbahn-Rückgrat-Syndrom’ (railway spine syndrome) zugrunde liegt oder dass ins Gehirn gelangte kleinste Teile explodierter Bomben die Ursache des ‘Granatenschocks’ darstellen.“65 Es wurde auch die Echtheit der berichteten Symptome bezweifelt und man hielt in den meisten Fällen Simulieren und den Wunsch nach anderen Vorteilen (wie z. B. das Einliefern in ein Lazarett) für die wesentliche Ursache der Symptome. Der Erste Weltkrieg war Anlass zu besonders häufigen Konfrontationen mit Zerstörung und Leid. Bei MOTT (1919) findet sich der folgende autobiografische Bericht eines britischen Oberleutnants, der sich in England erholte, nachdem er auf feindlichem Gebiet in der Falle gesessen war: „In den fünf Tagen in Rouex war ich ununterbrochen dem Granatenfeuer meiner eigenen Leute ausgesetzt und schwebte ständig in der Gefahr, vom Feind entdeckt zu werden, der ebenfalls den Ort besetzt hielt. Jede Nacht versuchte ich, durch die feindlichen Linien hindurchzukommen, ohne dabei gesehen zu werden, schaffte es aber nicht. Am vierten Tag wurde mein Sergeant direkt neben mir durch eine Granate getötet. Am fünften Tag wurde ich bewußtlos von meinen Leuten gerettet. In der ganzen Zeit hatte ich nichts zu trinken und zu essen außer etwa einem halben Liter Wasser. Heute werde ich von Träumen verfolgt, in denen ich die Granaten explodieren und pfeifend durch die Luft fliegen höre. Immer wieder sehe ich meinen Sergeant, tot und lebendig, und ich habe deutlich die Bilder vor Augen, wie ich versuche, zu unseren Leuten zurückzukommen. Manchmal spure ich in den Träumen den großen Hunger und Durst, den ich damals hatte. Wenn ich aufwache, habe ich das Gefühl, als ob mir alle Kraft aus den Knochen gewichen wäre, und bin schweißgebadet. Zuerst weiß ich gar nicht, wo ich bin, und meine Umgebung nimmt die Form der Ruinen an, in denen ich mich so lange versteckt hielt. Manchmal meine ich, gar nicht richtig aufzuwachen, und wieder einzudösen, und dann denke ich manchmal, daß ich im Krankenhaus bin, und dann wieder, daß ich noch in Frankreich bin. Den Tag über, wenn ich so dasitze und nichts besonderes mache und merke, wie ich vor mich hindöse, kehre ich in Gedanken immer sofort nach Frankreich zurück.“ 66 Einige Zeit später unterschied MYERS67 zwei Arten der Symptome: Granatenkonkussion (shell concussion) Granatenschock (shell shock). 65 EHLERS, Anke: Posttraumatische Belastungsstörung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, 1999. S. 2. 66 MOTT, F. W.: War neurosis and shell schock. London: Oxford University Press, 1919. S. 126-127. zit. SAIGH, 1995, S. 11. 67 MYERS, C. S.: Shell Shock in France: 1914-1919. Cambridge University: 1940. zit. in SAIGH, 1995. Seite 30 Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) Granatenkonkussion betrachtete er als neurologische Störung in der Folge einer physischen Verletzung, wohingegen Granatenschock in seinen Augen eine psychische Störung war, hervorgerufen durch extreme Belastung. Es wurde auch über psychische Störungen nach Naturkatastrophen berichtet. Im Jahr 1935 lieferte PRASAD68 eine allgemeine Beschreibung der emotionalen Probleme, unter denen Menschen in Indien nach einem katastrophalen Erdbeben zu leiden hatten. 1943 schilderte A. ADLER69 die ‘post-traumatischen psychischen Komplikationen’ der Überlebenden des Bostoner Coconut Grove-Brandes. In ADLER’s Artikel wird explizit auf traumabedingte Vorstellungen, Albträume, Schlaflosigkeit und Vermeidungsverhalten eingegangen. Im Zweiten Weltkrieg wurden Tausende von Kriegsopfern mit psychiatrischen Störungen von Klinikern behandelt. In ihrem einflussreichen Buch ‘Men under Stress’, zählten GRINKLER und SPIEGEL70 die Symptome von zurückgekehrten Kriegsteilnehmern auf, die unter ‘Gefechtsneurosen’ litten. Diese Symptome bestanden aus Unruhe, Aggressionen, Depressionen, Gedächtnisstörungen, Überaktivität des Sympathikus, Konzentrationsstörungen, Alkoholismus, Albträumen, Phobien und Misstrauen. 4.1.2 Das erste Auftauchen der Symptombeschreibung und Einordnung des PTSD in einer Klassifikation Philip A. SAIGH meint, dass der Zweite Weltkrieg einen besonderen Impuls für die Einordnung der Symptome nach dem Erleben von belastenden Ereignissen gab. Daraufhin wurde 1952 das erste ‘Diagnostische und statistische Manual psychischer Störungen’ (Abk.: DSM-I)71 erstellt. SAIGH berichtet dazu: „Aufgrund der Häufigkeit kriegsbedingter psychiatrischer Störungen in der Folge des Zweiten Weltkrieges sah sich der Nomenklatur- und Statistikausschuß der Vereinigung der amerikanischen Psychiater (American Psychiatric Association, Abk.: APA, Anmerk. der Verfasserin) veranlaßt, die «schwere Belastungsreaktion» (gross stress reaction) als psychiatrische Kategorie in ihr «Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen» (DSM-I) aufzunehmen. Dieser Nosologie zufolge war die Diagnose gerechtfertigt, wenn es zu »starken physischen Anforderungen oder extremen Belastungssituationen wie etwa bei Kriegsgefechten oder Naturkatastrophen» (S. 40) gekommen war.“72 68 PRASAD, J.: „Psychology of rumors: A study of the great Indian earthquake of 1934“. British Journal of Psychology, 26, 1-15, 1934. zit. in SAIGH, 1995. 69 ADLER, A.: „Neuropsychiatric complications in victims of Boston’s Coconut Grove disaster“. Journal of the American Medical Association, 123, 1098-1102, 1943. zit. SAIGH, 1995. 70 GRINKER, R. R. & SPIEGEL, J. P.: Men under stress. Philadelphia: Blaksiton, 1945. zit. SAIGH, 1995. 71 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington, DC: American Psychiatric Association, 1952. 72 SAIGH, Philip, A.: Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. Aus dem Engl. Seite 31 Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) In diesem ersten Klassifikationssystem der APA wurde auch anerkannt, dass „diese Diagnose in vielen Fällen auf vorher mehr oder weniger 'normale' Personen zutrifft, die unerträglichen Belastungen ausgesetzt gewesen sind.“ 73 In den fünfziger und sechziger Jahren begann man auch mit der Erforschung der psychischen Folgen von Natur- und Industriekatastrophen.74 Etwas später, 1968, trat der Nomenklatur- und Statistikausschuss der amerikanischen Psychiatervereinigung erneut zusammen und brachte das DSM-II heraus. Philip A. SAIGH sieht darin eine wichtige Marke. Er beschreibt folgende Entwicklung: „Obwohl die 1952 eingeführte Kategorie der schweren Belastungsreaktion internationale Anerkennung gefunden hatte, wurde sie aus der 1968er Nosologie wieder gestrichen, und es wurde die Kategorie «vorübergehende situationsabhängige Störung» (transient situational disturbance) in das DSM-II eingeführt. Diese Bezeichnung war reserviert für «Störungen jeglichen Schweregrades (einschließlich solchen mit psychotischen Anteilen), die bei Individuen ohne zugrundeliegende psychische Störungen auftraten und in denen eine akute Reaktion auf überwältigende äußere Belastungen zum Ausdruck kommt»“75 BURGESS und HOLMSTROM76 beschäftigten sich mit dem ‘Vergewaltigungstraumasyndrom’ und veröffentlichten im Jahr 1974 einen einflussreichen Artikel. Ihr Bericht basierte auf Interviews, die sie innerhalb eines Jahres mit 146 Vergewaltigungsopfern geführt hatten. Ihre Analyse brachte sie zu dem Schluss, dass sich die Folgen, unter denen die Vergewaltigungsopfer leiden, in eine akute Phase und eine langfristige Phase einteilen lassen. Die akute Phase wurde durch eine allgemeine physische Angegriffenheit durch den Überfall, Spannungskopfschmerzen, Schlafstörungen, Albträume, gastrointestinale Schmerzen, urogenitale Beschwerden, Ängste, Wut und Schuldgefühle charakterisiert. Die langfristige Phase ging mit vergewaltigungsbezogenen Albträumen, Vorstellungen, Vermeidungsverhalten (45,6 % zogen um), Ängsten und sexuellen Störungen einher. Übers. von Matthias Wengenroth; Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber, 1995. S. 14. 73 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington, DC: American Psychiatric Association, 1952. S. 40. zit SAIGH, 1995. 74 QUARANTELLI, E. L.: „An assessment of conflicting values on mental health: The consequences of traumatic events“. in C. R. FIGLEY (Ed.): Trauma and its wake, New York: Brunner / Mazel,1985. zit. SAIGH, 1995. 75 SAIGH, Philip, A.: Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. Aus dem Engl. Übers. von Matthias Wengenroth; Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber, 1995, S. 15. 76 BURGESS, A. W. & HOLSTROM, L. L.: „Rape trauma syndrome“. Amercan Journal of Psychiatry, 133, 413-418, 1974. zit. SAIGH, 1995. S. 15. Seite 32 Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) 4.1.3 Der Begriff ‘Posttraumatic stress disorder’ wird im DSM aufgenommen Es wurde Ende der 70er Jahre ein DSM-III-Ausschuss ‘Reaktive Störungen’ gebildet, der auf klinische Erfahrungen und die vorliegende Literatur zurückgriff, um diagnostische Kriterien für diejenige Störung zu formulieren, die die Bezeichnung ‘posttraumatic stress disorder (dt.: Posttraumatische Belastungsstörung, Abk.: PTBS) erhielt.77 Damit taucht dieser Begriff erstmals in einem Klassifikationssystem auf. Der 1980er Taxonomie zufolge liegt eine PTBS dann vor, wenn sich in der Folge eines traumatischen Ereignisses, „das im allgemeinen außerhalb des menschlichen Erfahrungsbereiches liegt, bestimmte charakteristische Symptome entwickeln.“78 Des Weiteren hieß es, dass „der Stressor, der das Syndrom auslöst, bei den meisten Menschen schwere Belastungssymptome hervorrufen würde, und außerhalb des Bereiches solch üblicher Erfahrungen wie Trauer, chronische Krankheit, geschäftliche Verluste oder eheliche Konflikte liegt.“79 SAIG betont in diesem Kontext die Auswirkungen von starken Stressoren auf die psychische Gesundheit. Es wurde „eindeutig anerkannt, daß starke Stressoren (z. B. Gefechte, Vergewaltigung und Naturkatastrophen) sehr ähnliche psychopathologische Muster bedingen können.“80 Im Jahr 1983 wurde begonnen, an der Revision des DSM-III zu arbeiten, die dann im Jahr 1987 als ‘DSM-III-R’ veröffentlicht wurde. Wie schon im DSM-III wurde auch im DSM-III-R davon ausgegangen, dass sich bei einem PTSD die Symptome in der Folge eines „psychisch belastenden Ereignisses entwickeln, das außerhalb der üblichen menschlichen Erfahrung liegt“.81 Anders als beim DMS-III, gab das DSM-III-R Beispiele für verschiedene Klassen von Traumata, die ein PTSD verursachen können. Sie lassen sich in drei Kategorien einteilen: 82 77 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (3rd ed), Washington, DC: American Psychiatric Association, 1980. zit. SAIGH, 1995, S. 18. 78 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (3rd ed), Washington, DC: American Psychiatric Association, 1980. Dt. Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen: DMS-III, Weinheim: Beltz 1984. S. 248. 79 a. a. O. 80 SAIGH, Philip, A.: Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. Aus dem Engl. Übers. von Matthias Wengenroth; Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber, 1995, S. 18. 81 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (3rd ed), Washington, DC: American Psychiatric Association, 1980. S. 247. 82 SAIGH, Philip, A.: Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. Aus dem Engl. Übers. von Matthias Wengenroth; Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber, 1995, S. 18. Seite 33 Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) Die direkte Konfrontation mit schweren Belastungssituationen, in der „das eigene Leben oder die körperliche Integrität bedroht ist“. 83 Die Beobachtung bestimmter Ereignisse, wie etwa den „Anblick eines anderen Menschen, der bei einem Unfall oder durch eine Gewalttat ernsthaft verletzt oder getötet wird bzw. wurde“.84 Eine dritte Klasse von Traumata, bei der die verbale Vermittlung die ent-scheidende Rolle spielt, etwa zu erfahren, dass „einem engen Freund oder Verwandten etwas Schlimmes zugestoßen ist oder zuzustoßen droht (z. B. die Mitteilung zu bekommen, daß das eigene Kind entführt oder mißhandelt worden ist.“85 Es stellte sich heraus, dass die Kriterien für das Auftreten eines PTSD im DSM-III-R zu streng gefasst wurden. Anke EHLERS begründet dies wie folgt: „Die Verfasser der revidierten dritten Auflage des Diagnostischen und Statistischen Manuals psychischer Störungen forderten (...), dass ein traumatischer Stressor außerhalb der normalen menschlichen Erfahrung liegen müsse (DSM-III-R; American Psychiatrie Association, 1987. S. 250). Dieses Kriterium erwies sich jedoch als zu streng. Epidemiologische Studien zeigten, dass einige der Stressoren, die zu einem PTSD führen, weit verbreitet sind, wie z. B. Verkehrsunfälle (NORRIS, 1992) oder sexuelle Gewalt (RESNICK et al., 1993).“86 Die Entwicklung des DSM ging weiter und 1994 kam eine weitere Version heraus. Die Verfasser des DSM-IV87 versuchten, eine spezifischere Definition zu formulieren. 88 Sie orientierten sich an Forschungsergebnissen, nach denen das Gefühl einer Lebensbedrohung als einer der konsistentesten Prädiktoren des PTSD eingeordnet wurde. PTSD nur für psychisch Labile? Früher gab es die vorherrschende Meinung, dass psychische Reaktionen auf traumatische Ereignisse normalerweise vorübergehend sind, und dass daher nur Personen mit labilen Persönlichkeiten, mit bereits bestehenden, neurotischen Konflikten oder Geisteskrankheiten, chronische Symptome entwickeln. Heute wird das anders gesehen. Es hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass auch Personen mit stabiler Persönlichkeit klinisch bedeutsame, psychische Symptome entwickeln können, wenn sie außergewöhnlich schrecklichen Erlebnissen ausgesetzt sind. Hierzu hat 83 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (3rd ed), Washington, DC: American Psychiatric Association, 1980. Dt. Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen: DMS-III, Weinheim: Beltz 1984. S. 247. 84 a. a. O. S. 247f. 85 a. a. O. S. 248. 86 EHLERS, Anke: Posttraumatische Belastungsstörung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle; Hogrefe 1999. S. 4. 87 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (4rd ed., Rev.), Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994. 88 EHLERS, Anke: Posttraumatische Belastungsstörung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, 1999. S. 4. Seite 34 Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) unter anderem die Beobachtung beigetragen, dass viele Veteranen des Vietnam-Krieges langwierige psychische Probleme entwickelten, und dass die psychischen Auswirkungen sexueller Gewalt im Rahmen der Frauenbewegung verstärkt thematisiert wurden. Die zehnte Auflage der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen (Abk. ICD10) bildete eine gesonderte Kategorie der ‘Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen (F43)’. Es wird angenommen, dass die psychischen Symptome als direkte Folge der akuten schweren Belastung oder des kontinuierlichen Traumas eintreten. „Das belastende Ereignis ... (ist) der primäre und ausschlaggebende Kausalfaktor, und die Störung wäre ohne seine Einwirkung nicht entstanden"89 Der wesentliche Effekt der Entwicklung des Begriffes ‘PTSD’ liegt in seiner Anerkennung der Gesellschaft als Krankheit. Die Symptome eines PTSD werden nun von den Fachleuten nicht mehr als Simulation abgetan, sondern als psychische Störung betrachtet und behandelt. Betroffene Menschen, in helfenden Berufen tätig, werden eher weniger als ‘Schwächling’ oder als ‘unfähig, eine derartige Tätigkeit auszuüben’ diskreditiert. Alles in allem ist die Klassifikation des PTSD ein deutliches Zeichen, dass unsere Gesellschaft bereit ist, sich mit den psychischen Folgen von Gewalttaten auseinanderzusetzen. 89 DILLING, H.; MOMBOUR, W.; SCHMIDT, M. H. (Hrsg.): ‘Weltgesundheitsorganisation: Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F) Klinischdiagnostische Richtlinien', Bern: Verlag Hans Huber, 1991. S. 155. zit. EHLERS, 1999, S. 3. Seite 35 Posttraumatic Stressdisorder (PTSD) 4.2 Definiton ‘Psychisches Trauma’ Im Brockhaus (Die Enzyklopädie des Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG) findet sich folgende Definition:90 „Psychisches Trauma: Bez. für eine psych. >Verletzung< (griech. trauuma), verursacht durch Erlebnisse, die weit außerhalb normaler seel. Belastungen liegen, z. B. Folterung, Vergewaltigung, Krieg, Konzentrationslager, Geiselnahme, natürl. (Erdbeben) oder techn. (Unfälle, Brände) Katastrophen. Wird ein psychisches Trauma nicht bewältigt (es wiegt i. d. R. schwerer, wenn es von Menschen verursacht wurde, z. B. bei Folterungen, KZErlebnissen), spricht man von posttraumatischer Belastungsstörung (engl. post-traumatic stress disorder, Abk. PTSD), die sich im Wiedererleben im Schlaf- (Albträume) oder Wachzustand (Dissoziation), in Angst, Depression, Schreckhaftigkeit, Zerfall der familiären und Arbeitsbeziehungen, Alkohol- und Drogenabhängigkeit äußern kann. Allg. als behandlungsbedürftiger Zustand erkannt und anerkannt wurde die posttraumat. Belastungsstörung am psych. und sozialen Zusammenbruch sehr vieler Vietnamveteranen nach Kriegsende.“ 4.3 Symptome des PTSD Für das PTSD gibt es eine typische Erscheinungsform: „Das charakteristischste Symptom der PTB ist das ungewollte Wiedererleben von Aspekten des Traumas. Die Betroffenen haben die gleichen sensorischen Eindrücke (z. B. Bilder, Geräusche, Geschmack, Körperempfindungen) und gefühlsmäßigen und körperlichen Reaktionen wie während des Traumas.“91 Z. B. hörte eine Frau nach einem Autounfall immer wieder das Geräusch des Aufpralls. Bei diesem Wiedererleben gibt es ein weiteres auffälliges Phänomen. Diesen Gedächtnisfetzen fehlt eine Zeitperspektive: „sie werden so erlebt, als ob sie im ‘Hier-und-Jetzt’ geschehen würden.“92 Situationen oder Personen, die an das traumatische Erlebnis erinnern, werden als sehr belastend erlebt und rufen starke körperliche Reaktionen hervor. Sie werden dementsprechend vermieden. Auch dem Sprechen über das Ereignis wird möglicherweise ausgewichen. Die Betroffenen versuchen, Erinnerungen an das Erlebnis aus dem Kopf zu drängen und nicht an die schlimmsten Momente des Traumas zu denken. 93 Wenngleich der Erinnerung an das belastende Ereignis möglichst nicht nachgegangen wird, so grübeln doch viele über das Zustandekommen und die Konsequenzen des Traumas 90 Brockhaus, Online Version: Buchvorlage: Auf Grundlage der 20., neu bearbeiteten Auflage 1996-1999, Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, http://www.xipolis.de. 91 EHLERS, Anke: Posttraumatische Belastungsstörung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, 1999. S. 3. 92 a. a. O. S. 3. 93 a. a. O. S. 3. Seite 36 Posttraumatic Stressdisorder (PTSD) nach, z. B. darüber, warum das Ereignis passiert ist, wie es hätte verhindert werden können, wie sie sich rächen könnten oder inwiefern ihr Leben ruiniert ist. 94 Die Emotionen der Patienten reichen von intensiver Furcht, Ärger, Trauer, Schuld oder Scham bis zu emotionaler Taubheit. Oft beschreiben sie, dass sie sich von anderen Menschen entfremdet fühlen und geben Kontakte und Aktivitäten auf, die ihnen vorher wichtig waren. Sie zeigen eine Reihe von Symptomen autonomer Übererregung, z. B. eine erhöhte Vigilanz (Wachsamkeit), starke Schreckreaktionen, Reizbarkeit, Konzentrationsund Schlafstörungen.95 4.4 Was macht einen Stressor traumatisch ? Es gibt viele Lebensereignisse, die als belastend erlebt werden, z. B. Scheidung, Verlust des Arbeitsplatzes oder Durchfallen bei einer Prüfung. Ihr Schweregrad ist abgestuft. Eine Liste der möglichen, belastenden Ereignisse findet sich im Teil ‘Stress’. Viele dieser Ereignisse werden in der Umgangssprache als ‘traumatisch’ beschrieben. Eine Feldstudie96 fand jedoch, dass solche ‘schwachen’ Stressoren nur bei 0,4 % der Betreffenden zu den charakteristischen Symptomen eines PTSD führen. Es erscheint daher notwendig, den Begriff „Trauma" in der Diagnose der PTB relativ eng zu fassen. Die Verfasser des DMS-III-R (revidierte 3. Auflage des Diagnostischen und statistischen Manuals psychischer Störungen) forderten daher, dass ein traumatischer Stressor außerhalb der normalen menschlichen Erfahrung liegen müsse97. Dieses Kriterium erwies sich jedoch als zu streng. Epidemiologische Studien zeigten, dass einige der Stressoren, die zu einem PTSD führen, weit verbreitet sind, wie z. B. Verkehrsunfälle98 oder sexuelle Gewalt.99 Die ICD-10 benutzt eine breitere Definition: 94 a. a. O. S. 4. 95 a. a. O. S. 4. 96 KILPATRICK et al., 1991, zit. in: McNALLY, R.J. „Posttraumatic stress disorder“. In T. MILLON, P. H. BLANEY & R. D. DAVIS (Eds.), Oxford textbook of psychopathology, Oxford, UK: Oxford University Press, 1998. zit. in EHLERS, 1999. 97 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (3rd ed), Washington, DC: American Psychiatric Association, 1980. Dt. Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen: DMS-III-R: Weinheim: Beltz, 1989. S. 250. 98 NORRIS, F.H.: „Epidemiology of trauma: Frequency and impact of different potentially traumatic events on different demographic groups“. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1992. 60,409-418. zit. EHLERS, 1999. 99 RESICK, P. A. & SCHNICKE, M. K. Cognitive processing therapy for rape victims. Newbury Park, CA: Sage. 1993. zit. EHLERS, 1999. Seite 37 Posttraumatic Stressdisorder (PTSD) „ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes (kurz- oder langanhaltend), die bei fast jedem eine tiefe Verstörung hervorrufen würde" 100 Die Verfasser des DSM-IV101 versuchten, eine spezifischere Definition zu formulieren. Sie orientierten sich an Forschungsergebnissen, nach denen das Gefühl der Lebensbedrohung einer der konsistentesten Prädiktoren der PTSD ist102. Um das PTSD nach dem DSM-IV diagnostizieren zu können, muss der Betroffene eine Situation erlebt/beobachtet haben oder damit auf andere Weise konfrontiert worden sein, die Tod, Lebensgefahr oder starke Körperverletzung beinhaltet hat oder bei der die körperliche Unversehrtheit der eigenen oder einer anderen Person bedroht war. Bei Kindern werden Entwicklungsstand unangemessene sexuelle Erfahrungen eingeschlossen. weiterhin 103 dem Ein weiterer wichtiger Schritt bestand darin, traumatische Stressoren nicht allein an Hand der Situation zu definieren, sondern die subjektive Reaktion auf diese Situation als weiteres Kriterium aufzunehmen. So muss der Betroffene mit intensiver Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen reagiert haben (bei Kindern: chaotisches oder besonders unruhiges Verhalten)104. Potentiell traumatische Erlebnisse nach DSM-IV wären also zum Beispiel Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, Geiselnahme, körperlicher Naturkatastrophen, Angriff, schwere Kriegseinsatz, Unfälle, Folter, Kriegsgefangenschaft, aber auch körperliche Krankheiten oder belastende medizinische Eingriffe (z. B. Herzinfarkt, Operation unter unvollständiger Narkose oder gefährlich verlaufende Kindesgeburt). 105 Anke EHLERS106 berichtet, dass die Stressor-Kriterien des DSM-IV weiter diskutiert werden und die Definition erweitert werden sollte. Sie schlägt vor, dass verstärkt die subjektive Wahrnehmung als Auslöser eines PTSD anerkannt werden sollten: Die Bedrohung der Wahrnehmung, ein autonom handelnder und denkender Mensch zu sein, wirkt ebenfalls traumatisierend. Ein Sich-Aufgeben und der wahrgenommene Verlust jeglicher Autonomie, hat genauso einen starken Effekt, ein PTSD auszulösen. 100 DILLING, H., MOMBOUR, W., SCHMIDT, M.H. (Hrsg.) ‘Weltgesundheitsorganisation: Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F) Klinischdiagnostische Richtlinien’. Bern: Verlag Hans Huber. 1991. S. 157. zit. EHLERS, 1999. 101 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (4rd ed., Rev.), Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994. S. 427. 102 MARCH, J. S.: „What constitutes a Stressor? The ‘Critenrion A’ issue“. in J.R.T. DAVIDSON & E.B. FOA (Eds.), Post-traumatic stress disorder: DSM-IV and beyond (pp. 37-56). American Psychiatrie Press, Washington, 1993. zit. in EHLERS, 1999. S. 4. 103 EHLERS, Anke: Posttraumatische Belastungsstörung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, 1999. S. 5. 104 a. a. O. S. 5. 105 a. a. O. S. 5. 106 a. a. O. S. 5. Seite 38 Posttraumatic Stressdisorder (PTSD) 4.5 Diagnostische Kriterien nach ICD-10 bzw. DSM-IV Das DSM-IV stimmt mit der ICD-10 hinsichtlich der Kernsymptomgruppen des PTSD überein: Wiedererleben, Vermeidung, emotionale Taubheit und Übererregung. Um die Diagnose zu stellen, sollte also eine Kombination dieser Symptome vorliegen. Die diagnostischen Systeme unterscheiden sich hinsichtlich der Gewichtung der Symptome. Während die ICD-10 den Schwerpunkt auf die Symptome des Wiedererlebens legt, betont das DSM-IV die Vermeidungs- und Taubheits-Symptome, da mindestens drei dieser Symptome für eine Diagnose vorliegen müssen. Insgesamt sind die DSM-IV-Kriterien strenger. Das zeigen auch die Ergebnisse von ANDREWS et al. (1999)107. In einer großen Stichprobe fanden sie eine PTB-Prävalenz nach ICD-10 von 7 % und nach DSM-IV von 3 %. Die Übereinstimmung zwischen den beiden diagnostischen Systemen betrug nur 35 %. Anke EHLERS bedient sich der ICD-10 zur Darstellung der diagnostischen Richtlinien des PTSD. Die nachstehende Tabelle (Seite 40) zeigt eine Kopie dieser Richtlinien. 108 Im Anhang (Seite 97) wird ein Auszug aus der ICD-10 angeführt. Es handelt sich um eine Kopie des Deutschen Institutes für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). Auch werden auszugsweise Texte aus dem DSM-IV im Anhang dargestellt. 107 ANDREWS, G.; SLADE, T. & PETERS, L.: „Classification in psychiatry: ICD-10 versus DSM-IV“. British Journal of Psychiatry, 1999, 174,3-5. zit. EHLERS, 1999. 108 EHLERS, Anke: Posttraumatische Belastungsstörung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, 1999. S. 6. Seite 39 Posttraumatic Stressdisorder (PTSD) Tabelle 1 Kriterien für die Posttraumatische Belastungsstörung nach den ICD-10 diagnostischen Leitlinien: 109 Kriterien Stressor 1. Ereignis oder Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes 2. würde bei fast jedem eine tiefe Verstörung hervorrrufen Symptome Notwendige Symptome: 1. Wiederholte unausweichliche Erinnerung oder Wiederinszenierung des Ereignisses in Gedächtnis, Tagträumen oder Träumen Andere typische Symptome: 2. Andauerndes Gefühl von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit, Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, Teilnahmslosigkeit gegenüber der Umgebung, Anhedonie (Fehlen des sexuellen Lustgefühls) 3. Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten Gewöhnliche Symptome: 4. Vegetative Übererregtheit mit Vigilanzsteigerung110, übermäßiger Schreckhaftigkeit und Schlaflosigkeit 5. Angst und Depression Seltene Symptome: 6. Dramatische, akute Ausbrüche von Angst, Panik oder Aggression Zeitlicher Rahmen Symptome treten üblicherweise innerhalb von 6 Monaten nach dem belastenden Ereignis auf 109 a. a. O. S. 6. 110 „Vigilanz [zu lat. vigil=wach, munter] w; -: a) Aufmerksamkeit; b) Zustand erhöhter Reaktionsbereitschaft (Psychol.)“. Quelle: DUDEN: Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke. hrsg. u. bearb. von d. Red. Naturwiss. u. Medizin d. Bibliograph.; 3., vollst, überarb. u. erg. Aufl.; Mannheim, Wien, Zürich: Bibliographisches Institut; Stuttgart: Thieme, 1979. S. 733. Seite 40 Posttraumatic Stressdisorder (PTSD) 4.6 Auffällige, psychische Symptome des PTSD Unabhängig von der Angstursache antwortet das Zentralnervensystem (ZNS) auf überwältigende, erschreckende und nicht kontrollierbare Erlebnisse mit konditionierten, emotionalen Reaktionen. Z. B. können Vergewaltigungsopfer auf konditionierte Stimuli, etwa das Herannahen eines unbekannten Mannes, mit Panik reagieren, als ob sie wieder vergewaltigt werden würden. 4.6.1 Autonome Übererregbarkeit und intensives Wiedererleben Während Menschen mit PTSD gegenüber ihrer Umwelt zu einem emotional gehemmten Verhalten neigen, reagiert ihr Körper auf bestimmte physische und emotionale Stimuli so, als ob die Vernichtungsdrohung noch immer präsent wäre. Die mit dem Trauma assoziierten Stimuli verursachen eine konditionierte, autonome Erregung. (Normalerweise hat diese Erregung die überlebenswichtige Funktion, den Organismus auf potentielle Gefahren aufmerksam zu machen.) Die herabgesetzte Auslöseschwelle somatischer Stressreaktionen bewirkt jedoch auch, dass Menschen mit PTSD ihren Körperempfindungen als Maß für drohende Gefahr nicht mehr vertrauen können. So verlieren die Empfindungen ihre Funktion als vorzubereiten. Warnsignale, um den Organismus auf angemessenes Handeln 111 4.6.2 Emotionale Überreaktionen und Schlafprobleme Personen mit PTSD haben Probleme, ihre eigenen Affekte zu regulieren. Traumatisierte Menschen gehen unmittelbar vom Reiz zur Reaktion über, ohne zuvor zu merken, was sie so erregt. Auch bei kleineren Stimuli neigen sie zu heftigen Empfindungen von Furcht, Angst, Wut oder Panik. Das lässt sie entweder überreagieren und andere einschüchtern oder sich verschließen und erstarren. Sowohl Kinder als auch Erwachsene mit einer solchen Übererregbarkeit haben häufig unter Schlafproblemen zu leiden. Entweder sind sie unfähig, sich vor dem Einschlafen zu entspannen, oder sie fürchten, Albträume zu bekommen. Viele traumatisierte Menschen berichten von ‘Traumabbruchsschlaflosigkeit’. Sobald sie anfangen zu träumen, wachen sie auf — aus Angst, der Traum werde sich zu einem traumatischen Albtraum entwickeln. Außerdem neigen sie zu Überwachsamkeit, erhöhter Schreckhaftigkeit und Ruhelosigkeit. 4.6.3 Lernstörungen Physiologische Übererregung stört die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und aus Erfahrungen zu lernen. Neben Amnesien112, die sich auf Aspekte des Traumas beziehen, haben 111 VAN DER KOLK, Bessel A.: http://traumatherapie.de/kolk.htm. 112 Amnesie: Störungen der Gedächtnisleistung, Erinnerungslücke. Quelle: PSCHYREMBEL, Willibald [Begr.]; Zink, Christoph [Bearb]; Dornblüth, Otto [Begr.]: Klinisches Wörterbuch, 255. Aufl.; Berlin, New York: de Gruyter, 1986. S. 62. Seite 41 Posttraumatic Stressdisorder (PTSD) traumatisierte Menschen auch Schwierigkeiten, sich an gewöhnliche Ereignisse zu erinnern. Durch traumabedingte Auslösereize leicht in einen Zustand der Übererregtheit versetzt und von Konzentrationsschwierigkeiten geplagt, können sie Symptome einer pathologisch verminderten Aufmerksamkeit entwickeln. Nach einer traumatischen Erfahrung verlieren viele der traumatisierten Menschen entwicklungsgemäße Fertigkeiten und regredieren auf frühere Formen der Stressbewältigung. Bei Kindern können bereits erlernte Fähigkeiten wieder verschwinden, etwa bei der Nahrungsaufnahme oder bei der Körperhygiene. Bei Erwachsenen drückt sich die Regression eher in übermäßiger Abhängigkeit und dem Verlust der Fähigkeit aus, überlegte und autonome Entscheidungen zu treffen. 113 4.6.4 Erinnerungsstörungen und Dissoziation Die erhöhte autonome Erregbarkeit beeinträchtigt nicht nur das psychische Wohlbefinden. Jede erregende Situation kann Erinnerungen an lange zurückliegende traumatische Erlebnisse auslösen und Reaktionen provozieren, die in der Gegenwart unangemessen sind. Neben Übererregung und aufdringlichen Erinnerungen können chronisch traumatisierte Menschen, vor allem Kinder, Amnesiesyndrome bezüglich des traumatischen Ereignisses entwickeln. Werden Kinder in einer Lebensphase, während der sie ihrem Entwicklungsstadium entsprechend unterschiedliche Identitäten in ihrem täglichen Spiel erproben, Opfer eines nachwirkenden und schweren Traumas, können sie manchmal ganze Persönlichkeitsanteile abspalten, um mit den traumatischen Erlebnissen fertig zu werden. Langfristig kann das zu einer multiplen Persönlichkeitsstörung (Multiple Identity Disorder) führen. (In den USA bei etwa 4 % der Patienten in stationärer, psychiatrischer Behandlung zu beobachten) Bei manchen Erlebnissen entwickeln diese Opfer eine Amnesie: Auf das Gefühl der Bedrohung reagieren sie mit Kampf oder Flucht — später vergisst die Person die Bedrohung und kann sich auch nicht mehr an Kampf oder Flucht bewusst erinnern. 114 4.6.5 Aggressionen und Autoaggressionen Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass traumatisierte Kinder und Erwachsene dazu neigen, ihre Aggression gegen andere oder sich selbst zu wenden. Missbrauch im Kindesalter erhöht erheblich die spätere Wahrscheinlichkeit von Delinquenz115 und kriminellem Verhalten. Probleme mit Fremdaggression sind besonders gut bei Kriegsveteranen, traumatisierten Kindern und Häftlingen mit einer frühen Traumatisierung dokumentiert.116 113 VAN DER KOLK, Bessel A.: http://traumatherapie.de/kolk.htm. 114 VAN DER KOLK, Bessel A.: http://traumatherapie.de/kolk.htm. 115 Delinquenz: Straffälligkeit. Quelle: DUDEN: Fremdwörterbuch. Bearb. v. Marion Müller, 4. Auflage; Mannheim, Wien, Zürich. Bibligraphisches Institut 1982; S. 170 116 VAN DER KOLK, Bessel A.: http://traumatherapie.de/kolk.htm. Seite 42 Posttraumatic Stressdisorder (PTSD) 4.6.6 Betäubung der psychischen Reaktivität Da traumatisierte Menschen sich ihrer Schwierigkeiten bewusst sind, ihre Emotionen unter Kontrolle zu halten, scheinen sie ihre Energien eher darauf zu verwenden, quälenden inneren Empfindungen aus dem Weg zu gehen, als auf die Anforderungen ihrer Umwelt einzugehen. Hinzu kommt, dass sie den Gefallen an Dingen verlieren, die ihnen früher ein Gefühl von Befriedigung verschafft haben und sie fühlen sich, als ob sie ‘der Welt abhanden gekommen’ wären. Dieses emotionale Betäubtsein kann sich als Depression, als Lustlosigkeit und Antriebsschwäche, in psychosomatischen Reaktionen und dissoziativen Zuständen117 äußern. Unter Schulkindern, die von einem Heckenschützen angegriffen worden waren und unter Opfern von physischer Misshandlung und sexuellem Missbrauch, waren derartige Betäubungsmechanismen zu beobachten. Diese Kinder sind weniger an spielerischer, sozialer Interaktion beteiligt, ziehen sich häufig zurück und werden isoliert. 118 Psychosomatische Reaktionen, chronische Angst und emotionale Taubheit behindern auch das Lernen, Gefühle und Wünsche zu identifizieren und zu artikulieren. In ihrer Kindheit traumatisierte Menschen leiden häufig an Alexithymie119. Diese Unfähigkeit, Körperempfindungen in Worte und Symbole zu fassen, hat zur Folge, dass sie Emotionen lediglich als physische Probleme erleben. Dies richtet vor allem in intimer und vertrauter zwischenmenschlicher Kommunikation verheerende Schäden an. Solche Menschen leiden an psychosomatischen Störungen und sind mit der Welt in erster Linie durch ihren Körper verbunden: Kommunikation verläuft eher über Körperorgane als über emotionale Bindungen.120 4.6.7 Abhängigkeit der psychischen und biologischen Reaktion auf das Trauma vom Entwicklungsstand Die moderne Psychiatrie hat allmählich begonnen, die unterschiedlichen Traumafolgen für verschiedene Altersstufen zu bestimmen. So hat man neu überdacht, wie fehlende Zuwendung oder traumatische Trennungserfahrungen den Entwicklung stören können. Ein günstiges Bindungsverhalten Organismus in seiner hat zu allererst eine überlebenswichtige biologische Funktion, die für Fortpflanzung und Überleben in gleicher Weise unverzichtbar ist. In verschiedenen Forschungen konnte aufgezeigt werden, dass 117 dissoziative Reaktionen: Es gibt vier Arten von dissoziativen Reaktionen: Gedächtnisstörungen (Ort, Zeit, Raum), Nicht an einen Ort gebunden sein, Schlafwandeln, Multiple Persönlichkeit, Quelle: DAVISON, Gerald C. u. NEALE, John M.: Klinische Psychologie, München, Wien, Baltimore: Urban und Schwarzenberg, 1979. S. 156. 118 VAN DER KOLK, Bessel A.: http://traumatherapie.de/kolk.htm. 119 „Alexithymie, [gr. a..., lexis Sprechen, thymos Gemüt, Gefühl], Unvermögen, Gefühle angemessen wahrnehmen und beschreiben zu können. Alexithymie wird besonders von einer frz. Schule als wichtiger Faktor für die Entwicklung psychosomatischer. Störungen betrachtet.“ Quelle: FREYBERGER, H.: Psychosomatik des Kindesalters und des erwachsenen Patienten. München 1977. zit. nach RIES. H: in DORSCH, Friedrich: Psychologisches Wörterbuch / Dorsch. Hrsg. von Friedrich Dorsch, Red.: Horst Ries,11., erg. Aufl., Bern, Stuttgart, Toronto: Huber, 1987. 120 VAN DER KOLK, Bessel, A.: http://traumatherapie.de/kolk.htm. Seite 43 Posttraumatic Stressdisorder (PTSD) gestörte Bindungen in der Kindheit langfristige neurophysiologische Folgen haben können. Misshandlung, Vernachlässigung und Trennung in der Kindheit können weitreichende biopsycho-soziale Folgen haben. Dazu gehören anhaltende biologische Veränderungen (werden im nachfolgenden Text beschrieben), die die Gefühlsmodulation beeinträchtigen können und Schwierigkeiten, neue Verarbeitungsstrategien zu entwickeln. Des Weiteren kann die Immunkompetenz herabgesetzt werden; auch die Fähigkeit, sinnvolle soziale Bindungen einzugehen, kann reduziert werden. 121 Es gibt kritische Entwicklungsphasen des Zentralnervensystems, während derer Kinder besonders anfällig für die Entwicklung bleibender Störungen infolge von Missbrauch, Vernachlässigung und Trennung sind. Traumata in frühem Alter haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Affektregulation und Bewusstseinszustände. Traumata beeinflussten ungünstig, wie Erfahrungen auf der somatischen Ebene organisiert werden und wie sich die Persönlichkeit an das chronische Erleben von Gefahr und Furcht anpasst. (Deshalb wurde auch von der PTSDGutachterkommission im Rahmen der Vorbereitung von DSM IV eine erweiterte Definition von PTSD empfohlen und eine Definition von ‘Schwerem PTSD’ vorgeschlagen). 122 4.7 Stressreaktion und die Psychobiologie von PTSD Die biologische Grundlage der Reaktion auf Traumata ist zwar äußerst komplex. In den letzten vierzig Jahren haben jedoch Forschungen an Menschen und Säugetieren gezeigt, dass insbesondere frühe Stressreaktion haben — Traumata u.a. auf langfristige Folgen für die neurochemische die Ausschüttung von Katecholaminen, auf Cortisolausschüttung und auf eine Reihe anderer biologischer Systeme wie die Regulation von Serotonin und endogenen opioiden Peptiden. Hier ein kurzer Überblick über einige dieser traumatisch bedingten, biologischen Veränderungen: 4.7.1 Aktivierung und Reaktion auf Gefahrensignale Der Körper reagiert auf erhöhte physische oder psychische Anforderungen mit der Freisetzung von Noradrenalin aus dem Locus Coeruleus und von Corticotropin (ACTH) aus dem Hypophysenvorderlappen. Zwar hat man viele Details der Wechselwirkung zwischen den Hormonen der Achse Hypothalamus- Hypophyse-Nebennierenrinde (HHN-Achse) und den Katecholaminen in der Stressantwort noch kaum völlig verstanden. Dennoch helfen diese unterschiedlichen Hormone dem Körper, die nötige Energie für die Antwort auf Stressoren zu mobilisieren. Das reicht von einer erhöhten Freisetzung von Glukose bis zur Stimulierung des Immunsystems. In einem gut funktionierenden Organismus führt Stress zu schnellen und ausgeprägten hormonellen Reaktionen. Chronisch anhaltender Stress jedoch reduziert die Wirksamkeit der Stressreaktion und führt zur Desensibilisierung. 121 a. a. O. 122 VAN DER KOLK, Bessel, A.: http://traumatherapie.de/kolk.htm. 123 a. a. O. 123 Seite 44 Posttraumatic Stressdisorder (PTSD) Es ist daher nicht verwunderlich, dass bei Patienten mit PTSD viele Abnormalitäten der Stress-Hormonregulation beobachtet worden sind . So war bei Kriegsveteranen im 24Stunden-Mittel eine erhöhte Ausschüttung von Noradrenalin und Adrenalin oder ein erhöhter Cortisolspiegel im Urin zu beobachten.124 4.7.2 Betäubtsein Gegenwärtig orientiert sich die Forschung an drei Hypothesen, um die biologischen Grundlagen, für die bei PTSD beobachtete Betäubung der psychischen Reaktivität, zu erklären: 125 A. Dämpfung des noradrenergen Systems und der HHN-Achse: Nach einer exzessiven, noradrenergen Stimulation zeigen Menschen eine verminderte adrenerge Rezeptoraktivität. B. Opioid vermittelte, stressinduzierte Analgesie126 (SIA) ist bei Stress ausgesetzten Tieren und bei Menschen mit PTSD beschrieben worden. C. Das Serotonin-System: Es gibt ziemlich sichere Hinweise auf eine reduzierte Serotoninaktivität bei PTSD, die das Funktionieren des Hippokampus stört und die auch Ursache dafür sein könnte, dass ankommende Sinneseindrücke als bedrohliche und nicht als neutrale Stimuli interpretiert werden. Das stört die Aufmerksamkeit auf ankommende Eindrücke. Diese werden nicht als Anforderungen erkannt, denen es gerecht zu werden gilt, sondern statt dessen als traumatische Stimuli interpretiert, die zu vermeiden sind. 4.7.3 Psychosoziale Folgen Bedrängende Erinnerungen an das Trauma, Schuld- und Schamgefühle wegen einer (vermeintlichen) persönlichen Schuld an dem Geschehenen beeinträchtigen die sozialen Beziehungen. Wut über Verlassenwordensein, sowie die veränderte, biologische Stressreaktion beeinträchtigen die Gestaltung familiärer und beruflicher Beziehungen. Die Mehrheit traumatisierter Menschen leidet: 127 1. an dem anhaltenden Gefühl von Niedergeschlagenheit und Hilflosigkeit, 2. an einer niedrigen Affekttoleranz, Impulsivität und einem primär somatischen Erleben von Emotionen, 3. an der zwanghaften Neigung, sich immer wieder in gefährliche Situationen zu begeben, 124 a. a. O. 125 a. a. O. 126 Analgesie: Aufhebung der Schmerzempfindung. Quelle: PSCHYREMBEL, Willibald [Begr.]; Zink, Christoph [Bearb]; Dornblüth, Otto [Begr.]: Klinisches Wörterbuch, 255. Aufl. Berlin, New York: de Gruyter, 1986. S. 71. 127 VAN DER KOLK, Bessel, A.: http://traumatherapie.de/kolk.htm. Seite 45 Posttraumatic Stressdisorder (PTSD) 4. an Hilflosigkeit und dem Verlust persönlicher Initiative mit der Folge, dass sich die Abhängigkeit von der Gesellschaft und/oder der Familie verstärkt; 5. außerdem kann der Mangel an Affekttoleranz dazu führen, dass sich traumatisierte Menschen von komplexen und differenzierten interpersonalen Beziehungen abwenden und statt dessen in exzessive Arbeit stürzen. Der Mangel an emotionaler Anteilnahme an konkreten Beziehungen lässt das Leben nach dem Trauma sinnlos werden und setzt die zentrale Rolle des Traumas im Leben der Betroffenen fort. Sie können in einen Zustand generalisierter Hoffnungslosigkeit versinken oder einfach Schwierigkeiten haben, gerechtfertigte Forderungen von nicht gerechtfertigten zu unterscheiden. Unfähig, die eigene Rolle und die Rolle anderer in zwischenmenschlichen Konflikten richtig einzuschätzen, sehen sie sich häufig in vielen sozialen Kontakten wieder zum Opfer gemacht. Da Traumatisierte dazu neigen, spätere Stresssituationen primär als Körperempfindungen zu erfahren und nicht als genau umrissene Probleme, die spezielle Lösungen erfordern, sind sie häufig unfähig, wirksam zu handeln. Sie begreifen nicht die Ursache der Intensität ihrer Reaktionen, die in keinem Verhältnis zu der Schwere aktueller Stressoren steht und sie sind daher nicht in der Lage, rational zu überlegen, was zu tun ist.128 Für viele traumatisierte Menschen bleibt die Beschäftigung mit dem Trauma auf Kosten anderer Erfahrungen ein zentraler Bestandteil ihres Lebens. Dies kann auch zu einer Änderung der Lebensvollzüge führen, wie z. B. Beistand für andere Opfer anbieten — eine gesellschaftlich akzeptierte Form der Bewältigung. Hingegen andere Traumaopfer finden eine eher weniger akzeptierte Lösung: sie reproduzieren das Trauma in irgendeiner Weise für sich oder andere. Es gibt Kriegsveteranen, die sich als Söldner anwerben lassen, auch Inzestopfer, die später zu Prostituierte werden. Kinder, die im zarten Kindesalter misshandelt wurden, können dazu neigen, sich als Heranwachsende selbst verstümmeln.129 128 VAN DER KOLK, Bessel, A.: http://traumatherapie.de/kolk.htm. 129 VAN DER KOLK, Bessel, A.: http://traumatherapie.de/kolk.htm. Seite 46 Posttraumatic Stressdisorder (PTSD) 5 Situationen, in denen PTSD entstehen kann Es sind nicht alle Lebenssituationen, in denen sich ein Mensch befinden kann, potentiell geeignet ein PTSD auszulösen. Es gibt aber einige Situationen, die von manchen Menschen als sehr belastend erlebt werden und in der Folge ein PTSD erzeugen. Die nachfolgende Tabelle listet zunächst die typischen Situationen, mit hoher Tendenz zum PTSD, auf. Es sind längst nicht alle denkbaren Ereignisse, bzw. Situationen angeführt, sondern stellen nur einen Ausschnitt dar. Es ist zugleich ein Versuch, die Ereignisse zu ordnen. Einmalig / plötzlich menschengemacht Unfälle Atomunfall Autounfall Brandverletzung Fährenunglück Flugzeugabsturz Zugunglück Arbeitsunfälle Verbrechen / Vergehen Amoklauf Einbruch Geiselnahme Gewalt i.d. Familie Körperverletzung Mordanschlag Raubüberfall Vergewaltigung nicht menschengemacht Krankheit Naturkatastrophen Plötzlicher Kindestod Erdbeben Flut Hochwasser Tornado Brand Lawinen Fortdauernd / wiederholend nicht menschengemacht Krankheit menschengemacht Verbrechen / Vergehen Folter Sekten Sexueller Missbrauch Körperliche und seelische Misshandlung Kriege / Terrorismus 1. Weltkrieg 2. Weltkrieg Holocaust Vietnam AIDS Krebs Israelische Kriege Golfkrieg Quelle: http://www.trauma-informations-zentrum.de/listen/ltraumat.htm 5.1 Gefährdete Personen Es gibt in unserer Gesellschaft unterschiedliche Personengruppen mit einer verschiedenen Prävalenz an einem PTSD zu erkranken. Es hängt sehr stark von der Intensität und auch von der Häufigkeit von belastenden Ereignissen ab, ob jemand ein PTSD entwickelt. Außerdem wird zwischen ‘Betroffenen’ (‘primär Traumatisierte’) und ‘Helfern’ (‘sekundär Seite 47 Posttraumatic Stressdisorder (PTSD) Traumatisierte’) unterschieden. Nachfolgende Tabelle stellt eine Übersicht der Personengruppen mit besonderer Gefährdung zu einem PTSD dar. Betroffene Personen Primär Traumatisierte Altersgruppe Kinder Jugendliche Erwachsene Senioren Gemeinsames Ereignis Hinterbliebene Suizidale Personen Strafgefangene Helfer Sekundär Traumatisierte Feuerwehr Polizei Rettungsdienst / Notärzte Laienhelfer Psychotherapeuten Quelle: http://www.trauma-informations-zentrum.de/listen/ltraumat.htm 5.2 Der Krieg, die Quelle posttraumatischer Belastungsstörungen für die gesamte Bevölkerung 5.2.1 Vorbemerkung Der Krieg ist ein soziales Ereignis, das die meisten ethischen Werte, wie z. B. das Tötungsverbot, auflöst. Viele Menschen werden sogar per Gesetz von der Allgemeinheit dazu gezwungen, andere Menschen zu töten, auszurauben und deren Hab und Gut zu zerstören. Durch die außerordentliche Destruktivität des Krieges sind extrem traumatisierende Ereignisse an der Tagesordnung und durch die moderne Kriegsführung ist die Zivilbevölkerung wesentlich stärker betroffen als Soldaten (Siehe Grafik Seite 53). Die besonders häufige Traumatisierung der Bevölkerung im Krieg wurde erst in den letzten Jahren entdeckt und beobachtet. Nachstehende Grafik (Seite 50) zeigt, dass fast alle Bewohner eines Krieg führenden Landstriches mit psychischen Problemen belastet sind. Die Folgen des Krieges auf die Zivilbevölkerung sieht man jetzt wesentlich anders. Es wird auch erkannt, dass die Folgen des Krieges für die Zivilbevölkerung wesentlich schlimmer sind, als früher angenommen wurde. Dies kann zum einen auch deshalb sein, weil die ‘beobachtende Zivilisation’ jetzt eher weniger durch eigene Kriege belastet ist. Noch vor 50 Jahren konnten Europa und die USA eher nicht aus der notwendigen Distanz die psychischen Folgen des Krieges beurteilen. Viele Völker mussten zunächst materielle Probleme meistern — für die Beobachtung und Bewertung der psychischen Schäden des Krieges waren weder Ressourcen noch ausreichende Grundlagen der Traumaforschung vorhanden. Zum anderen gibt es viele Menschen, die aus ihrer sicheren Umgebung der Zivilisation aussteigen und in ein Krieg führendes, zerstörtes Land reisten. Von einem Tag auf den anderen werden die Helfer mit der Zerstörung und dem Leid der Bevölkerung konfrontiert. Erst mit dem Hintergrund der sicheren, zurückgelassenen Heimat kann das wahre Ausmaß der Traumatisierung durch Krieg erfasst werden. Seite 48 Der Krieg, die Quelle posttraumatischer Belastungsstörungen für die gesamte Bevölkerung Ein weiterer Punkt ist die ethische Verpflichtung, den notleidenden Menschen in anderen Ländern zu helfen. Hierzu braucht es besonders bei psychischen Problemen ein fundiertes Rüstzeug. Vieles davon wurde erst in den letzten Jahren geschaffen. 5.2.2 Auswirkungen des Krieges auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung Nachfolgendes Kapitel stellt im Wesentlichen die Arbeit von Richard F. MOLLICA dar, die im Spektrum der Wissenschaften, 9.2000, veröfftentlicht wurde. Der Autor ist Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School in Cambridge (Massachussetts). 1981 gehörte er zu den Gründern des Harvard-Programms zur Behandlung von Flüchtlingstraumata, einem der ersten klinischen Zentren in den USA für die Überlebenden von Massengewalt und Folter. „Die Roten Khmer hatten ihre ganze Familie ermordet, sie selbst bewusstlos geschlagen und inmitten der Leichname ihrer Liebsten zurückgelassen. Als meine erste kambodschanische Patientin mir ihre Leidensgeschichte erzählte, war meine erste Reaktion, dass das einfach nicht wahr sein könne. Alles erschien so irreal - wie eine Szene aus einem Horrorfilm. Mein Instinkt sagte mir: Das darfst du nicht glauben.“130 Schilderungen wie diese machen es Politikern, Mitarbeitern von Hilfsorganisationen und sogar Psychiatern schwer, die Tiefen von kriegsbedingten Traumata richtig einzuschätzen. Es gibt auch eine Einstellung, die eine realistische Wahrnehmung der Kriegsfolgen verzerrt. Richard F. Mollica beschreibt sie folgendermaßen:131 „Krieg ist zwar die Hölle, aber die Betroffenen werden schon wieder in den Alltag zurückfinden, wenn der Konflikt erst einmal beigelegt ist. Körperliche Verletzungen bestehen zwar fort, aber Beklemmung und Angst, Begleiter aller lebensbedrohlichen Ereignisse, werden verschwinden, sobald die unmittelbare Gefahr vorüber ist.“ Die breite Öffentlichkeit sieht das im Großen und Ganzen einheitlich und „unterm Strich lautet Parole an die Kriegsopfer: ‘Seid hart! Das steht ihr schon durch!’“132 Langsam wird zu den Kriegsopfern eine andere Sichtweise eingenommen. In den letzten zwanzig Jahren haben Wissenschaftler damit begonnen, die sozialen und emotionalen Folgen von Krieg für die Zivilbevölkerung in ihrer Gesamtheit zu erforschen. Bis vor kurzem hatten die internationalen Behörden, die für Schutz und die Versorgung des Lagers zuständig waren, keine auch noch so einfache Vorkehrung für die psychische Versorgung der Opfer getroffen. Solche Versäumnisse kennzeichnen die meisten anderen Flüchtlingshilfe-Projekte weltweit. Richard F. MOLLICA kann die Gründe erkennen und meint, dass die seelischen Verletzungen ganzer Gesellschaftsteile unsichtbar sind. Es ist leichter Leichen und verlorene Extremitäten zu zählen als verwundete Seelen. Physisch Verwundete suchen aus 130 MOLLICA, Richard, F.: „Unsichtbare Wunden“. Spektrum der Wissenschaft. 2000/9. S. 42. 131 a. a. O. 132 a. a. O. Seite 49 Der Krieg, die Quelle posttraumatischer Belastungsstörungen für die gesamte Bevölkerung eigenem Antrieb einen Arzt auf, aber seelische Defekte sind so stark tabuisiert, dass die Betroffenen es meist um jeden Preis verhindern wollen, einen Psychiater aufzusuchen. Als internationale Organisationen in den letzten Jahren begannen, sich mit der psychischen Gesundheit von Kriegsopfern auseinander zu setzen, suchten sie zunächst nach einfachen Maßnahmen. Aber die seelische Gesundheit zu versorgen, ist weitaus schwerer als Straßen wieder aufzubauen oder Malaria zu behandeln. 5.2.3 Psychische Krankheiten, die durch Kriegshandlungen entstehen und ihre Häufigkeit in einem Kriegsgebiet Nahezu jedes Mitglied einer von Kriegswirren heimgesuchten Gesellschaft ist zu einem gewissen Grad traumatisiert, angefangen von schweren psychischen Störungen (wie etwa Psychose) bis hin zu klinischer Depression und posttraumatischen Belastungsstörungen (PTSD). Den Statistiken aus jüngeren Bürgerkriegen zufolge sind die meisten Zivilisten erschöpft, verzweifelt und misstrauisch — was das Sozialgefüge für eine ganze Generation oder noch länger zugrunde richtet.133 Nachstehende Grafik (Seite 50) stellt die Häufigkeit der einzelnen psychischen Belastungen in der Bevölkerung dar. Psychische Belastung der Bevölkerung in Krieg führenden Gebieten Quelle: Spektrum der Wissenschaften, 9/2000. S. 42 5.2.4 Todeszahlen in den einzelnen Kriegen Das Leid der Menschen lässt sich nicht quantifizieren. Es lassen sich jedoch Statistiken über die Kriegsopfer aufstellen. Zumindest wird dadurch deutlich, wie viele Menschen den Krieg in seiner Unmenschlichkeit erleben mussten. Außerdem wird ein Vergleich der relativen Härte der schwersten internationalen Konflikte der letzten zwei Jahrhunderte anhand der Zahl der Opfer schätzbar. Die nachstehende Grafik (Seite 53) stellt die Ergebnisse grafisch dar. Seite 50 Der Krieg, die Quelle posttraumatischer Belastungsstörungen für die gesamte Bevölkerung Die beiden Weltkriege sind mit Abstand die verheerendsten militärischen Konflikte der Menschheitsgeschichte — sowohl hinsichtlich der Gefallenen im engeren Sinne (Soldaten, die im Kampf getötet wurden) und auch der Gesamtanzahl der Todesfälle. Allerdings bedürfen die Daten einer Interpretation. Erstens beruhen die Todeszahlangaben nur auf groben Schätzungen. Zweitens spiegeln sie die Folgen eines Krieges für ein Land oder eine Region nicht so treffend wider wie die Todesfallrate pro Einwohner — und über die Auswirkungen auf Angehörige und Freunde sagen sie fast gar nichts aus. Es wird aber sichtbar, dass sehr viele Menschen, auch in Europa, durch die vergangenen Kriege schreckliche Situationen erlebt haben und höchstwahrscheinlich psychische Traumata erleiden mussten — lange bevor die Kategorie ‘PTSD’ in den diagnostischen Manualen aufgenommen wurde. Die Grafik verdeutlicht auch, dass im Laufe der Zeit die Zivilbevölkerung immer öfter durch Kriegsereignisse geschädigt wurde und damit PTSD immer häufiger in der Bevölkerung auftritt. Es besteht durch diesen massiven Ansturm von traumatisierenden Erlebnissen durchaus die Möglichkeit, dass die Gestaltung unseres gesamten sozialen Systems von dieser außerordenlichen Häufung betroffen ist. Früher bekriegten sich hauptsächlich Soldaten im Feld (nicht die Zivilbevölkerung). Während des Zeitraums vom Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 bis zur Französischen Revolution 1789 bekämpften sich die europäischen Fürsten mit relativ kleinen Söldnerheeren. Später bekam dann immer mehr die Zivilbevölkerung den Krieg zu spüren und wurde vertrieben, gefoltert und ermordet. Die industrielle Revolution machte dann Städte und Fabriken zu wichtigen Kriegszielen. In den Konflikten des 20. Jahrhunderts übertraf schließlich die Anzahl der zivilen Opfer zumeist die der Soldaten. Manche Staaten verloren in einem einzigen Krieg mehr als 10 % ihrer Bevölkerung — so etwa die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Nach 1945 verlagerten sich die Kriegsschauplätze nach Asien, Afrika und in den Mittleren Osten. Viele der internationalen Konflikte — wie etwa in Korea, Vietnam und Afghanistan — entstanden aus Bürgerkriegen. Deshalb stieg der Anteil ziviler Opfer stark an. In Angola und Mosambik waren mehr als 75 % der Opfer Zivilisten. Auch Kinder trifft es immer häufiger: Zwischen 1985 und 1995 starben rund zwei Millionen Minderjährige in Folge von Kriegshandlungen; weitere 10 bis 15 Millionen wurden verstümmelt oder traumatisiert. Die jüngsten Konflikte, wie etwa in Jugoslawien, wurden zunehmend von irregulären Einheiten ausgetragen, die aus Loyalität, Beutegier oder Rachedurst zur Waffe griffen. Unterdessen verbuchten reguläre Streitkräfte weniger Kampf-, aber mehr Friedenseinsätze. Im Golfkrieg 1991 und im Kosovokrieg 1999 verstanden es die Alliierten, eigene Verluste zu minimieren.134 133 MOLLICA, Richard, F.: „Unsichtbare Wunden“. Spektrum der Wissenschaft. 2000/9. S. 42. 134 WALTER C. Clemens jr; SINGER, J. David: „Millionenfache Tragödien“. Spektrum der Wissenschaft. 2000/9. S. 44. Seite 51 Der Krieg, die Quelle posttraumatischer Belastungsstörungen für die gesamte Bevölkerung 5.2.5 Neue Betrachtungen zu den psychischen Folgen von Kriegshandlungen Sechs grundsätzliche Erfahrungen konnte Richard F. MOLLICA135 erleben. Er meint, sie wären für zukünftiges Handeln von Helfern und internationalen Hilfsorganisationen wegbereitend. 5.2.5.1 Häufigkeit von psychischen Störungen unter Überlebenden von Kriegen Mittels Stichproben aus repräsentativen Gruppen, Einsatz von Laienbefragungen und der Entwicklung von standardisierte Diagnosekriterien — auch kulturübergreifend — wurden zuverlässige Daten gewonnen. Eine Studie über kambodschanische Flüchtlinge offenbarte akute klinische Depression in verschiedenen Graden bei 68 % und PTSD bei 37 % aller Untersuchungen. Ähnliche Werte wurden bei Flüchtlingen aus Bhuta, Nepal, Bosnien und Kroatien gefunden. Zum Vergleich: in nichttraumatisierten Gruppen würde schon eine Rate von 10 % bei Depressiven und 8 % PTSD (jeweils über die gesamte Lebenszeit gemessen) als sehr hoch eingestuft. — Dies lässt den Schluss zu, dass Kriegsereignisse die Überlebenden massiv in ihrer seelischen Verfassung schädigen. 135 MOLLICA, Richard, F.: „Unsichtbare Wunden“. Spektrum der Wissenschaft. 2000/9. S. 43ff. Seite 52 Der Krieg, die Quelle posttraumatischer Belastungsstörungen für die gesamte Bevölkerung Quelle: CLEMENS, C., Walter & SINGER, J., David: „Millionenfache Tragödien“, Spektrum der Wissenschaften, 2000/9. S. 44 Seite 53 Der Krieg, die Quelle posttraumatischer Belastungsstörungen für die gesamte Bevölkerung 5.2.5.2 Die Art der Traumata sind schwer zu erfassen Zunächst dachten Psychiater, dass das Herantasten an die traumatische Erfahrung eine zu große seelische Belastung der Patienten wäre. Daneben befürchteten sie, die Patienten könnten unrichtige Informationen liefern — bestenfalls Übertreibungen, schlimmstenfalls krasse Unwahrheiten. Anfang der 80er - Jahre wurde diese Sichtweise durch Gruppen, wie Amnestiy International korrigiert. Experten für Menschenrechte entwickelten ein systematisches Verfahren, die Richtigkeit der Angaben zu überprüfen — inklusive einer Erhebung der klinischen Befunde. Seit den 50ern gibt es die Hopkins Sypmtom Checklist, ein einfacher Raster, mit dem verschiedenen Posttraumatische Stresssymptome rasch abgefragt werden können. Dieses Instrument wurde weiterentwickelt und liegt jetzt als ‘Harvard-Traumata-Fragebogen’ vor. Er zielt speziell auf traumatische Ereignisse und Symptome ab. Es gibt ihn mittlerweile in 25 Sprachen, angepasst an kulturelle Kontexte und empirisch getestet. 5.2.5.3 Nicht-westliche Konzeptionen psychischer Störungen wurden kodifiziert In vielen Ländern mit Kriegen sind traditionelle Heiler oder Stammesälteste die wichtigsten medizinischen Therapeuten und verantwortlich für die seelsorgerische und psychologische Versorgung der Menschen. Es gibt aber eine große Diskrepanz in der Beschreibung von Krankheiten zwischen ortsansässigen Helfern und den Fachärzten westlichen Verständnisses. Daher fallen viele Patienten durch die Systemlücken: Traditionelle Heiler können ihnen nicht helfen und die Fachärzte vermögen es nicht, ihre vagen somatischen Beschwerden als Symptome einer unterschwelligen, psychischen Krankheit zu erkennen. Mit extensiver Feldarbeit in Kambodscha, Uganda und Simbabwe gelang es nun, das breite Spektrum von Volkskrankheiten, die mit seelischem Leiden einhergehen, systematisch zu erfassen. 5.2.5.4 Bestimmte traumatische Erlebnisse führen eher zu Depressionen und zu PTSD als andere Bei Flüchtlingen in Kambodscha, Lager Zwei, zählten Schläge gegen den Kopf, andere Folterungen, Kerkerhaft und das Mit-Ansehen-Müssen des Mordes oder des Hungertodes eines Kindes zu den schlimmsten Erfahrungen und lösten Depression und PTSD aus. Hingegen hatten fehlendes Obdach und das Beobachten von Gewalt gegen andere Erwachsene keine derart gravierenden Auswirkungen. 5.2.5.5 Einige extreme Erfahrungen verursachen dauerhafte Veränderungen im Gehirn Anfang der 60-er Jahre entdeckte der norwegische Forscher Leo EITINGER Kollegen bei Überlebenden von NS-Konzentrationslagern eine 136 und seine Verbindung von Kopfverletzungen und psychiatrischen Symptomen. Jüngeren Studien zufolge führten Schläge, die amerikanische Kriegsgefangene im Zeiten Weltkrieg, sowie im Korea- und 136 nicht näher benannt, zit. MOLLICA, Richard, F.: „Unsichtbare Wunden“. Spektrum der Wissenschaft. 2000/9. S. 45. Seite 54 Der Krieg, die Quelle posttraumatischer Belastungsstörungen für die gesamte Bevölkerung Vietnamkrieg erlitten, in vielen Fällen zu bleibenden Gehirnschäden. Ole RASMUSSEN137, ein dänischer Forscher, fand bei 64 % von 200 überlebenden Folteropfern neurologische Defekte. Bei diesen Befunden ist dies durchaus verständlich, weil ja eine direkte mechanische Einwirkung im Kopfbereich stattfand. Aber auch ohne direkte physische Ursachen können seelische Störungen zu Gehirnveränderungen führen. In den wenigen, verfügbaren Untersuchungen stellte sich heraus, dass bei Patienten mit PTSD Teile des Gehirns, beispielweise der Hippocampus, infolge von Traumata geschrumpft sind. 5.2.5.6 Beziehung zwischen psychischer Störung und sozialer Dysfunktion Es konnten bei bosnischen Flüchtlingen in Kroatien Schäden beobachtet werden; schwere soziale Beeinträchtigungen gingen mit psychiatrischen Störungen einher: 25 % der Personen waren nicht mehr in der Lage einer geregelten Arbeit nachzugehen, ihre Familie zu versorgen oder andere sozial produktive Tätigkeiten auszuüben. Es ist aber auch anzunehmen, dass es dauerhafte Auswirkungen gibt. Sie sind nur im Ansatz und nur aus einigen wenigen Langzeitstudien zu erkennen. Eine neue Untersuchung mit einer niederländischen Gruppe138 zeigt, dass Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung noch nach 50 Jahren eine deutlich erhöhte PTSD-Rate aufwiesen. Es gibt sogar generationenübergreifende Auswirkungen: Noch bei Kindern von Holocaust-Opfern wurden höhere PTSD-Raten gefunden als in einer jüdischen Vergleichsgruppe. 5.2.5.7 Konklusion Richard F. MOLLICA kommt zu folgender Konklusion: „Obwohl nur ein geringer Prozentsatz der Überlebenden von Massengewalt (wie Krieg) ernste psychische Erkrankungen aufweist, die einer sofortige Behandlung erfordern, erfährt die große Mehrheit weniger intensive, dafür aber lang anhaltende seelische Probleme. (Siehe Grafik auf Seite 50) Damit eine Gesellschaft gesunden kann, darf diese Mehrheit keinesfalls übersehen werden.“ 139 Es wird versucht, diese neuere Sichtweise von psychischen Schäden durch Kriegsereignisse, in verschiedenen Anpassungen der Hilfeeinsätze umzusetzen. In Kambodscha und Ost-Timor haben internationale Hilfsorganisationen psychiatrische Kliniken eingerichtet. In Südafrika und Bosnien machten ortsansässige Ärzte im Fernsehen auf die einschlägigen Probleme und Hilfsmöglichkeiten aufmerksam. Die Harvard Medical School (Cambridge, Massachussets) richtet im Rahmen eines eigenen Programms kleine, betriebliche Projekte ein, um Menschen mit Depressionen ins Arbeitsleben zurückzuführen. Solche Anstrengungen sind sehr wichtig, um den Teufelskreis von Lethargie und Rachegefühlen bei den Opfern zu durchbrechen. 137 RASUMSSEN, O.: Quelle nicht näher benannt, zitiert nach MOLLICA, Richard, F.: „Unsichtbare Wunden“, Spektrum der Wissenschaft. 2000/9. S. 45. 138 nicht näher benannt, zit. MOLLICA, Richard, F.: „Unsichtbare Wunden“. Spektrum der Wissenschaft, 2000/9. S. 45. 139 MOLLICA, Richard, F.: „Unsichtbare Wunden“. Spektrum der Wissenschaft, 2000/9. S. 45. Seite 55 Epidemologie des PTSD 6 Epidemiologie des PTSD (‘Epidemiologie’= Lehre von der Entstehung, Verbreitung u. Bekämpfung von Krankheiten140) 6.1 Bevölkerung Übersicht über die unterschiedlichen PTSD - Erkrankungen, für einige verschiedene traumatisierende Lebensereignisse Trauma erlebt PTSD ausgebildet 100 % KZ-Haft 50 - 65 % 100 % Vergewaltigung, sexueller Missbrauch 50 - 55 % 100 % Verkehrsunfälle 3 - 11 % 100 % Brand/ Feuer/ Naturereignisse 100 % Zeuge-Sein von Unfällen/ Gewalt 5% 2-7% Quelle: LUEGER-SCHUSTER, Brigitte: „Psychotraumatologie“. Psychologie in Österreich, 20. Jhrg. 12/2000. S. 277 Brigitte LUEGER-SCHUSTER, vom Institut für Psychologie der Universität Wien, meint zum Auftreten eines PTSD innerhalb des Lebens (=Lebenszeitprävalenz): „Die Lebenszeitprävalenz für beide Geschlechter liegt bei 7,8 % bis 12,3 % , wobei ca. doppelt so viele Frauen wie Männer betroffen sind (vgl. Kessler, 1995141)“142 Nach KESSLER143 entwickeln (je nach Art des Traumas) Männer von 22,3 % bis 38,8 % und Frauen von 21,3 % bis 48,5 % ein PTSD. Es gibt auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber Vergewaltigung ist bei Frauen als auch bei Männern das am meisten belastende Trauma. Bei Frauen sind es weiterhin sexuelle Belästigung, körperlicher Angriff, Bedrohung durch eine Waffe und körperlicher Missbrauch in der Kindheit. Bei Männern sind es Beteiligung an Kampfgeschehen, Vernachlässigung und körperlicher Missbrauch in der Kindheit. 140 DUDEN: Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke, hrsg. u. bearb. von d. Red. Naturwiss. u. Medizin d. Bibliograph.; 3., vollst, überarb. u. erg. Aufl.; Mannheim, Wien, Zürich: Bibliographisches Institut; Stuttgart: Thieme, 1979. S. 242 141 KESSLER, R.C., SONNEGA, A.; BROMET, E.; HUGHES, M.; NELSON, C. B.: „Posttraumatic stress disorder in the National Comorbitdity Survey“. Archives of General Psychiatry; 52, (1995). S. 1048-1060, zit. in LUEGER-SCHUSTER, 2000 142 LUEGER-SCHUSTER, Brigitte: „Psychotraumatologie“, Psychologie in Österreich, 20. Jhrg. 2000/12. S. 277 143 KESSLER, R.C., SONNEGA, A.; BROMET, E.; HUGHES, M.; NELSON, C. B.: „Posttraumatic stress disorder in the National Comorbitdity Survey“, Archives of General Psychiatry; 52, (1995). S. 1048-1060, zit. in LUEGER-SCHUSTER, 2000 Seite 56 Epidemiologie des PTSD Werden die Wahrscheinlichkeiten, nach einer traumatischen Belastung ein PTSD zu entwickeln, zwischen den Geschlechtern verglichen, so zeigt sich bei Frauen eine etwa doppelt so große Häufigkeit (20,4 % ) wie bei Männern (8,2 % ).144 6.2 Die Helfer Es liegt auch eine Studie aus dem Bereich der Helfer vor. Stefanie RÖSCH verfasste an der Universität Konstanz eine Diplomarbeit. Sie untersuchte die Häufigkeit des PTSD unter Feuerwehrleute in Baden-Württemberg.145 „Die 119 Feuerwehrleute, die an dieser Befragung teilnahmen, haben routinemäßig mit Einsätzen zu tun, in denen sie mit Schwerverletzten und Toten umgehen müssen. (...) In der vorliegenden Arbeit wurden mit vergleichbaren Kriterien folgende Prävalenzen gefunden: 8,25 % der Feuerwehrleute qualifizieren für eine chronische PTBS, Fälle von akuter PTBS gibt es nicht, weitere 21,09 % haben eine subsyndromale chronische PTBS und 0,92 % eine subsyndromale akute PTBS.“146 Dies deckt sich ungefähr mit anderen Forschungen in diesem Gebiet. 9 % der deutschen Berufsfeuerwehrleuten haben eine PTBS.147 Bei australischen Buschfeuern stieg das PTSD unter den Feuerwehrleuten stark an. 36 % der Feuerwehrleute entwickelten nach einem Buschfeuer in Australien ein PTSD. 148 144 KESSLER, R.C., SONNEGA, A.; BROMET, E.; HUGHES, M.; NELSON, C. B.: „Posttraumatic stress disorder in the National Comorbitdity Survey“, Archives of General Psychiatry; 52, (1995). S. 1048-1060, zit. in LUEGER-SCHUSTER, 2000 145 RÖSCH, Stefanie; ‘Wie traumtisch ist die Feuerwehrarbeit? Welche Folgen ergeben sich daraus für die Gesundheit von Feuerwehrleuten’, Diplomarbeit der Universität Konstanz, 1998. 146 a. a. O. S. 51 147 TEEGEN, F., DOMNICK, A., & HEERDEGEN, M.: „Hochbelastende Erfahrungen im Berufsalltag von Polizei und Feuerwehr: Traumaexposition, Belastungsstörungen, Bewältigungsstrategien“, Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 29(4) (1997)., 583-599. zit. http://www.trauma-informationszentrum.de/listen/betroff/feuer.htm#epidemiologie 148 MCFARLANE, A. C. & PAPAY, P.: „Multiple diagnoses in posttraumatic stress disorder in the victims of a natural disaster“, Journal of Nervous and Mental Disease, 180(8), 498504. 1992, zit. http://www.trauma-informationszentrum.de/listen/betroff/feuer.htm#epidemiologie Seite 57 Präventivmaßnahmen gegen das PTSD 7 Prävention des PTSD Critical Incident Stress Management (CISM) Maßnahmen zur akuten Krisenintervention und zur Prävention posttraumatischer Belastungsstörungen. 7.1 Grundsätzliches Von Soldaten, Angehörigen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten und vergleichbaren Personengruppen wird allgemein erwartet, dass sie mit außergewöhnlichen Situationen besser umgehen und diese besser bewältigen können als Menschen, die nicht Mitglieder einer dieser Gruppen sind. In der Regel ist dieser Personenkreis aufgrund seiner besonderen Persönlichkeitsstruktur, seiner Ausbildung und Erfahrung in der Lage, dieser Erwartungshaltung gerecht zu werden.149 Aus dem gewohnten Einsatzspektrum herausragende Ereignisse (Critical Incidents), wie zum Beispiel Ereignisse mit vielen Toten oder Schwerstverletzten, Tod oder schwere Verletzung von Kindern oder Kollegen, Schusswaffengebrauch mit Verletzungs- oder Todesfolge, Bedrohung von Leib und Leben oder die Erfahrung von Geiselnahme oder Gefangenschaft, bieten selbst für diesen Personenkreis ein erhebliches traumatisierendes Potential. Massive posttraumatische Stressreaktionen bis hin zur Entwicklung eines PostTraumatischen-Stress-Disorder (PTSD; gem. DSM IV u. ICD 10) können die Folgen solcher Ereignisse oder Einsätze sein.150 Dieser Entwicklung kann mit einer rechtzeitigen Intervention durch ein entsprechend psychologisch entsprechend geschultes Personal entgegengewirkt werden. Die Betroffenen werden möglichst schnell wieder ihrer eigentlichen Aufgabenerfüllung zugeführt. Genau dies ist das Ziel der verschiedenen, abgestuften Maßnahmen des CISM - Modells von MITCHELL. 151 WILLKOMM führt einige Kriterien, die ein erhebliches traumatisierendes Potenzial in sich bergen, an: „das Gefühl der Hilflosigkeit / Machtlosigkeit der Situation und den eigenen Reaktionen gegenüber berechtigte oder irrationale Schuldgefühle außergewöhnliche Dimension und/oder Intensität von Ereignissen hoher Grad der Identifikation und/oder persönlichen Betroffenheit 149 WILLKOMM, Bernd: „Critical Incident Stress Management (CISM) nach Mitchell“, Psychologie in Österreich, 20. Jhrg., 2000/5. S. 251. 150 a. a. O. 151 a. a. O. Seite 58 Präventivmaßnahmen gegen das PTSD Bedrohung von Leib und Leben (des eigenen und dessen anderer)“ 152 WILLKOMM meint, dass eine präzise Vorhersage der persönlichen Reaktionen auf eine oder mehrere dieser Ereignisse sehr schwierig ist: „Hinzu kommt, daß insbesondere die genannten Personengruppen aufgrund eines in solchen Situationen unangemessenen beruflichen Selbstverständnisses mehr oder weniger erfolgreich alles versuchen, ihre natürlichen Reaktionen zu unterdrücken, zu verbergen oder abzuleugnen. Daher reichen die unterschiedlichen Reaktionsverläufe von sofortigen und heftigen affektiv - emotionalen Reaktionen über verzögerte Reaktionen mit unterschiedlicher Intensität und Vielfalt bis hin zu überhaupt keinen berichteten oder beobachtbaren Reaktionen. Die Erfahrung und eine Vielzahl von Berichten belegen jedoch, daß ohne rechtzeitige Krisenintervention unabhängig vom vorherigen Reaktionsverlauf bei durchschnittlich etwa einem Drittel (zwischen 15 % und 65 % ) der Betroffenen nach Wochen, Monaten oder gar Jahren, psychische und / oder psychosomatische / somatoforme Spätfolgen aus dem Symptomkreis der posttraumatischen Belastungsstörung auftreten können.“153 Das Critical Incident Stress Management (MITCHELL154) kann dieser unerwünschten Entwicklung entgegenwirken. Es ist eine mehrstufige und integrative Methode. Dabei handelt es sich mit Ausnahme der vorbeugenden Unterrichts- und Trainingsmaßnahmen durchwegs um Maßnahmen der Sekundärprävention. Durch nachsorgende Betreuung, nach besonders belastenden Ereignissen, in strukturierten Einzel- oder Gruppengesprächen wird gleichzeitig der Entwicklung möglicher Spätfolgen vorgebeugt. Es handelt sich bei keiner der Techniken um therapeutische Maßnahmen.155 Im Einzelnen umfasst das CISM - Modell folgende Maßnahmen: (nach WILLKOM156) 1. Vorbeugende Unterrichts- und Trainingsmaßnahmen - je nach Zielgruppe unterschiedlich umfangreiche Module - je nach Umfang und Zielgruppe Durchführung durch entsprechend geschulte Angehörige von Einsatzkräften (‘peers’) oder Psychologen / Ärzte mit CISMAusbildung. 2. Individuelle Krisenintervention - psychologische Selbst- und Kameradenhilfe vor Ort oder unmittelbar nach Einsatzende für einzelne Traumatisierte durch entsprechend geschultes Personal (‘peers’) oder später durch Psychologen / Ärzte mit CISM-Ausbildung 3. Critical Incident Stress Defusing - strukturiertes Gruppengespräch mit kleinen Gruppen (ca. 5 - 8 Teilnehmer) - Durchführung möglichst innerhalb von 12 bis 24 Stunden nach Ende des Ein152 WILLKOMM, Bernd: „Critical Incident Stress Management (CISM) nach Mitchell“, Psychologie in Österreich, 20. Jhrg., 2000/5. S. 251. 153 a. a. O. 154 Prof. MITCHELL ist Professor für Emergency Health Services an der Universität in Maryland 155 WILLKOMM, Bernd: „Critical Incident Stress Management (CISM) nach Mitchell“, Psychologie in Österreich, 20. Jhrg., 2000/5. S. 251. 156 WILLKOMM, Bernd: „Critical Incident Stress Management (CISM) nach Mitchell“, Psychologie in Österreich, 20. Jhrg., 2000/5. S. 252 Seite 59 Präventivmaßnahmen gegen das PTSD satzes/ Ereignisses - Dauer ca. 30 - 60 Minuten - Durchführung durch ‘peers’ oder, falls verfügbar, Psychologen / Ärzte mit entsprechender Ausbildung 4. Critical Incident Stress Debriefing (CISD ) - strukturiertes Gruppengespräch mit in der Regel ca. 4-20 Teilnehmern - Durchführung frühestens 72 Stunden und spätestens ca. 4 Wochen nach Ende des Einsatzes / Ereignisses - Dauer ca. 3 Stunden - Durchführung ausschließlich unter Leitung eines ClSM-geschulten Psychologen oder Arztes unter obligatorischer Mitwirkung von ‘peers’ 5. Demobilisierung / (Groß-)Gruppen-lnformation - Großgruppen - Briefing unmittelbar nach Ende eines Einsatzes / Ereignisses zur Information über mögliche Reaktionen und Folgen sowie über Möglichkeiten / Angebote für weitere Unterstützung - psychologisches Briefing eines erweiterten Personenkreises (z. B. ganzer Organisationen / Einheiten) vor der Durchführung von Critical Incident Stress Debriefings mit den potentiell Traumatisierten - Durchführung durch CISM - geschulte ‘peers’, Psychologen oder Ärzte 6. Familien- / Organisations - Unterstützung - Unterstützung, Beratung und Schulung der Familien von besonders gefährdeten Personengruppen oder Betroffenen - Unterstützung, Beratung und Schulung von besonders gefährdeten Organisationen / Einheiten - Durchführung durch CISM - geschultes Personal oder Psychologen / Arzt Nachsorge / Überweisung (Follow-up) - falls erforderlich weitere Kontakte bzw. Angebot, Vermittlung und Durchführung weiterführender Maßnahmen (z. B. Therapie) - bei Fortbestehen deutlicher Symptome nach Durchführung einzelner oder mehrerer der o.g. Maßnahmen - Durchführung durch Fachärzte und / oder klinische Psychologen 7.2 Gemeinsame Ziele aller CISM - Maßnahmen zitiert nach B. WILLKOMM157 „schnelle Reduktion Reaktionen der sich aufschaukelnden, heftigen affektiv-emotionalen allen Betroffenen das häufig empfundene Gefühl der ‘Einzigartigkeit’ ihrer Situation zu nehmen 157 WILLKOMM, Bernd: „Critical Incident Stress Management (CISM) nach Mitchell“, Psychologie in Österreich, 20. Jhrg., 2000/5. S. 253 Seite 60 Präventivmaßnahmen gegen das PTSD ‘Normalisierung’ der als außergewöhnlich (‘nicht normal’) empfundenen Erfahrung, Empfindungen und Reaktionen Herstellung des gleichen, möglichst vollständigen Informations- und Wissensstandes bei allen Beteiligten Reaktivierung durch das Ereignis beeinträchtigter kognitiver Funktionen und Prozesse Informationsvermittlung über Maßnahmen zur Streßbewältigung möglicherweise noch zu erwartende Reaktionen und Symptome und über Einschätzung der Notwendigkeit weiterer Unterstützung / Maßnahmen Herstellung persönlicher Kontakte zu geschultem Personal und der Bereitschaft zur Inanspruchnahme weiterer Unterstützung schnellstmögliche Wiederherstellung der Einsatz- und Funktionsfähigkeit“ Bei der Durchführung von Stress Debriefing und Stress Defusing gelten wichtige Grundregeln: „Generell gilt für die Durchführung aller Maßnahmen (mit Ausnahme der individuellen Krisenintervention vor Ort), daß als Leiter einer Maßnahme oder ‘peer’ nur eingesetzt werden kann, wer nicht selbst zu den ‘unmittelbar’ Betroffenen gehört.“158 Bei der Durchführung des Critical Incident Stress Debriefings sind folgende Rahmenbedingungen einzuhalten:159 „Der richtige Zeitpunkt (z. B. wegen einer möglichen Retraumatisierung frühestens 2-3 Tage nach einer Trauerfeier bzw. Beerdigung) Überprüfung, ob die Kriterien für eine potentielle Traumatisierung bei allen Teilnehmern erfüllt sind Leitung eines Debriefings ausschließlich durch einen entsprechend ausgebildeten Psychologen oder Arzt unter obligatorischer Mitwirkung von ‘peers’ (optimales Verhältnis Teammitglieder : Betroffene = 1:3, mindestens aber 1:5) Gruppengröße in der Regel zwischen 4 und maximal 20 Betroffenen Gruppenzusammensetzung möglichst homogen (unterschiedliche Kriterien) Durchführung ohne Unterbrechung und niemals unter Zeitdruck (Zeitansatz für ein Debriefing mit Vor- und Nachbereitung ca. 5 Std.) Im Anschluss an ein Debriefing unbedingt Möglichkeit zu informellen Gesprächen anbieten (z. B. bei Imbiss und Getränken). Allen Betroffenen Telefonnummern bzw. Kontaktadressen für Fragen oder weitere Hilfe aushändigen.“ 158 WILLKOMM, Bernd: „Critical Incident Stress Management (CISM) nach Mitchell“, Psychologie in Österreich, 20. Jhrg., 2000/5. S. 253 159 WILLKOMM, Bernd: Seminarunterlagen zum Seminar ‘Aufbaulehrgang Posttraumatische Stressbewältigung’, unveröffentliches Manuskript, 2000. Seite 61 Präventivmaßnahmen gegen das PTSD 7.3 Übersicht über die einzelnen Interventionen des CSIM Defusing Demobilisierung Debriefing Zeitpunkt Innerhalb 8 h nach dem kritischen Ereignis Gleich nach dem kritischen Ereignis Ziele Auswirkungen vermindern wiederherstellen der Einsatzbereitschaft emotionale Belastungen verringern Anliegen der Gruppe erfassen die Notwendigkeit eines Debriefings ausloten Debriefing unterstützen, falls eines gebraucht wird 20-45 min Innerhalb 24 (12) - 72 h nach dem kritischem Ereignis Stressreaktionen mildern und verstehen die eigenen Verarbeitungsfähigkei ten aktivieren Erholung beschleunigen Selbstsicherheit für den nächsten Einsatz geben Dauer Inhalte Teilnehmer Gruppengröße Räumlich Anforderung Einführung Exploration Information CISM - trainiertes, psychologisches Personal Einsatzkräfte eines begrenzten Einsatzabschnittes max. 8 Personen abgeschlossen, in sicherer Entfernung des Einsatzortes Den mit dem kritischen Ereignis zusammenhängenden Stress verringern Erholung des Personals unterstützen keine Psychotherapie 10 min Vortrag 20 min Essen / Ausruhen Stressinformation Entspannung Nahrung 2 - 3 Stunden 7 Phasen: Einführung Fakten Gedanken Reaktionen (Emotionen) Symptome Unterweisung, Informationen Wiedereingliederung CISM - trainiertes, CISM - trainiertes, psychologisches psychologisches Personal Personal Einsatzkräfte eines Einsatzkräfte eines begrenzten begrenzten Einsatzabschnittes Einsatzabschnittes bis zur Großgruppe von 4-28 Personen mehreren Hundert leicht zugänglich, nahe abgeschlossen, keine Störungen, in weitaus am Ort des größerer Entfernung des Geschehens Einsatzortes. Quelle: APPEL-SCHUHMACHER, T. „Stressmanagement nach traumatischen Ereignissen“. Psychologie in Notfallmedizin und Rettungsdienst. Hrsg.: BENGEL, Jürgen; Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 1997. S. 254. Seite 62 Therapie des PTSD 8 Die Therapie des PTSD 8.1 Implikationen für die Behandlung von PTSD Auch wenn Menschen ein schreckliches Trauma erlitten haben, müssen sie irgendwie diesen Schicksalsschlag in ihr Leben integrieren. Traumatisierte Menschen sind hin- und hergerissen zwischen der exzessiven Beschäftigung mit der Vergangenheit und einem Gefühl emotionaler Betäubung gegenüber ihrer gegenwärtigen Umgebung.160 Der Versuch, das Trauma einfach zu vergessen, ist wohl selten eine hilfreiche psychologische Strategie, um es langfristig zu bewältigen. Die Fähigkeit nach einem akuten Trauma das Erlebte in vielen Details zu verbalisieren, verhindert sehr wirksam die Entstehung von PTSD. In einem späteren Stadium neigen diese Menschen allerdings zu einem Gefühl von Betäubung und Langeweile, wenn sie nicht in Aktivitäten verwickelt sind, die mit dem Trauma zusammenhängen. Das Entscheidende an der Traumatisierung liegt in einem Verlust von Sicherheit und in einer Festigung von psychischen und physiologischen Gefahrenreaktionen. Eine vorrangige Aufgabe von Interventionen ist es daher, dem Leben des Patienten Sicherheit und Vorhersehbarkeit zu geben. Es ist also besonders wichtig, dass der Helfer dem Opfer in physischer, sozialer und emotionaler Hinsicht beisteht; der Tendenz ‘dem Opfer die Schuld zu geben’ darf der Helfer nicht nachgeben. Eine geeignete psychopharmakologische Unterstützung kann die autonome Übererregbarkeit, die emotionale Betäubung und die extrem intensive Wiedererinnerung drastisch vermindern.161 Angesichts schrecklicher Tragödien ist die Reaktion von Helfern tendenziell problematisch. Helfer können die Wirkung des Traumas auf das Opfer lindern, aber können das Trauma auch verstärken. Sie können dem Opfer die Schuld geben oder umgekehrt das Opfer entwürdigen, indem sie es infantilisieren oder fälschlich romantisieren. 162 Nachdem ein Trauma einen Menschen vollkommen mit seiner existentiellen Hilflosigkeit und Verwundbarkeit konfrontiert hat, kann das Leben nie mehr genau das gleiche wie zuvor werden: Das traumatische Erlebnis wird in jedem Fall zum Bestandteil des Daseins einer Person. Sich genau darüber klar zu werden, was geschehen ist und die eigenen Reaktionen mit denen anderer Opfer zu teilen und zu vergleichen, hat sich als ungemein hilfreich erwiesen. Die mit dem Trauma verbundenen Gefühle und Ereignisse in Worte zu fassen, ist entscheidend für die Behandlung posttraumatischer Reaktionen. Der Patient strengt sich sehr an, ein Wiedererleben des Traumas zu verhindern. Deshalb darf der Therapeut nicht erwarten, dass die Widerstände gegen das Erinnern so einfach zusammenschmelzen. Aber eine sichere Beziehung zum Therapeuten kann helfen das Trauma durchzuarbeiten. Dies unterstützt die Psyche zusammenzuhalten, wenn die 160 VAN DER KOLK, Bessel, A.: http://traumatherapie.de/kolk.htm. 161 a. a. O. 162 a. a. O. Seite 63 Therapie des PTSD physischee Desintegration wieder droht.163 (Siehe auch ‘Psychotherapeutische Grundhaltung’, Seite 70) Das Vermeiden der Bearbeitung des Traumaerlebnisses kann Probleme bringen: Es führt ganz allmählich zu einer Intensivierung der mit dem Trauma verbundenen unangenehmen Gefühle und körperlichen Zustände. Dies kann ein verstärktes somatisches, visuelles oder verhaltensmäßiges Wiedererleben des Traumas zur Folge haben. Sind die traumatischen Erlebnisse einmal räumlich und zeitlich lokalisiert, kann eine Person anfangen, zwischen gegenwärtigen Stresssituationen und dem zurückliegenden Trauma zu differenzieren und so die Bedeutung des Traumas für das aktuelle Erleben zu vermindern. 164 Es reicht jedoch nicht, nur über das Trauma zu sprechen! Die Überlebenden von Traumata brauchen Handlungen, die den Triumph über Hilflosigkeit und Verzweiflung symbolisieren. Die Holocaustgedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem und das Vietnam Memorial in Washington D.C. sind gute Beispiele für Symbole für Opfer, welche die Toten betrauern und traumatischen Ereignissen eine historische und kulturelle Bedeutung geben. Vor allem können sie den Überlebenden vor Augen führen, welche Hilfe das gemeinsame Erinnern sein kann. Das gilt ebenso für andere Überlebende, auch wenn sie vielleicht nicht ebenso sichtbare Denkmäler und gemeinsame Symbole errichten können, um sich um diese zu versammeln, um zu trauern und um ihre Scham über ihre eigene Wehrlosigkeit auszudrücken. Das kann in vielen Formen geschehen: z. B. im Schreiben eines Buches, in politischer Aktion oder in der Hilfe für andere Opfer. 165 Das PTSD ist eine psychische Störung, die einer therapeutischen Behandlung bedarf. Im Grunde bieten sich dazu an: Medikamentöse Behandlung mit Psychopharmaka und die Psychotherapie. 8.2 Pharmakologische Behandlung 8.2.1 Vorbemerkungen Gerd LAUX meint zu Psychopharmaka166: „Seit ihrer (Psychopharmaka, Anm. der. Verfasserin) Entdeckung vor über 30 Jahren haben Psychopharmaka entscheidend dazu beigetragen, daß viele seelische Krankheiten - auch durch Nicht-Nervenärzte (Allgemeinärzte) — behandelt werden können. In der Therapie psychischer Erkrankungen sind deshalb heute Psychopharmaka unentbehrlich. Die Weltgesundheits-Organsation hat 6 Substanzen aus dieser Gruppe in die Liste der unentbehrlichen Medikamente aufgenommen.“ Gleichzeit warnt der Autor auch über möglichen Substanzmissbrauch und dass die Therapie mit Psychopharmaka alleine, nicht ausschließlich zum Erfolg führt. Er meint: 167 163 a. a. O. 164 a. a. O. 165 a. a. O. 166 LAUX, Gerd: Pharmakopsychiatrie. Unter Mitarb. von O. DIETMAIER und W. KÖNIG; Stuttgart, New York: G. Fischer, 1992. S. 3. Seite 64 Therapie des PTSD „Mit Entdeckung der modernen Psychopharmaka setzte eine gewisse Psychopharmaka Euphorie ein, und es kam zu unkritischer und unkontrollierter Verwendung dieser Medikamente. So wurden z. B. Neuroleptika ohne begleitende psycho- und soziotherapeutische Maßnahmen eingesetzt oder Tranquilizer als medikamentöse Konfliktlöser angesehen.“ Psychopharmaka werden auch sehr häufig unrichtig eingesetzt, Gerd LAUX führt dies an:168 „30—50 % der Verordnungen von Psychopharmaka erfolgen bei Patienten ohne psychiatrische, nur mit rein somatischer Diagnose. Dies laßt zum einen Mangel in der psychopathologisch - psychiatrischen Diagnostik vermuten (z. B. Nichterkennen somatisierter Depressionen oder Angsterkrankungen).“169 Daraus ergibt sich für Gerd LAUX folgende Forderung: „Will man Psychopharmaka einsetzen, so ist stets eine kritische, sorgfältige Auswahl und ein richtiger Umgang (...) mit ihnen erforderlich.“ Üblicherweise werden die Psychopharmaka in folgende Gruppen eingeteilt:170 1. Tranquilizer 2. Hypnotika 3. Antidepressiva 4. Lithium 5. Neuroleptika Es gibt dann noch andere Substanzen mit psychischer Wirkung. „Jeweils eine eigene Gruppe stellen außerdem Psychostimulantien, Nootropika, Parkinsonmittel, Betablocker und Antiepileptika dar. Letztere haben wie Analgetika zwar wichtige psychische Wirkungen, gehören aber nicht mehr in den engeren Rahmen der Psychopharmaka.“171 Psychopharmaka sind nicht voll in der Wirkungsweise zu unterscheiden. Es gibt große Ähnlichkeiten: „Untersuchungen zur Überprüfung der Wirkeigenschaften sowie die Entwicklung neuerer Substanzen weisen darauf hin, daß die Übergänge zwischen Neuroleptika, Antidepressiva und Tranquilizern fließend sein können und zum Teil dosisabhängig sind.“172 8.2.2 Psychopharmaka und Nebenwirkungen Psychopharmaka haben nicht nur die beabsichtigte Wirkung gegen die psychische Krankheit, sondern auch zum Teil sehr unangenehme Nebenwirkungen. Gerd LAUX warnt davor: 173 167 a. a. O. S. 4. 168 a. a. O. S. 4. 169 a. a. O. S. 4. 170 a. a. O. S. 4. 171 a. a. O., S. 27. 172 a. a. O. S. 27. 173 a. a. O., S. 102. Seite 65 Therapie des PTSD „Psychopharmaka zeigen neben den gewünschten Wirkungen (...) auch eine Reihe unerwünschter Begleitwirkungen wie z. B. Beeinträchtigung von Reaktionsvermögen, Aufmerksamkeit und Konzentration. Derartige Nebenwirkungen können den Patienten in seinen gewohnten Alltagstätigkeiten beeinträchtigen“. Außerdem gibt es in Kombination mit vielen anderen Genussmitteln unkontrollierbare Wirkungsveränderungen. Deshalb sollte beachtet werden: „Auf den Konsum der Genußmittel Nikotin und Alkohol sollte wahrend einer Behandlung mit Psychopharmaka vollständig verzichtet, der Konsum von Tee, Kaffee und koffeinhaltigen Getränken in der Regel eingeschränkt werden. (...) Bei Neuroleptika und Antidepressiva sind besonders Wirkungen auf die Kreislaufregulation zu beachten.“174 Weiters nimmt LAUX zu anderen Psychopharmaka Bezug: „Tranquilizer und Hypnotika können durch übermäßige Sedierung175 Tagesrestwirkung176 Konzentration und Aufmerksamkeit beeinträchtigen.“177 bzw. Psychopharmaka haben auch gefährliche Nebenwirkungen auf das ungeborene Kind während der Schwangerschaft. Gerd LAUX führt einige wichtige Argumente an und zieht folgendes Resumé: „Zusammenfassend kann gesagt werden, daß ein eindeutiger Nachweis teratogener Wirkungen178 bislang nur für Lithium, nicht für Neuroleptika, Antidepressiva, Benzodiazepine und Clomethiazol erbracht worden ist. Trotzdem sollten diese Psychopharmaka nur bei sehr strenger Indikation nach sorgfältiger Nutzen - Risiko Abwägung Schwangeren verordnet werden, im ersten Trimenon179 möglichst gar nicht.“180 8.2.3 Wirkung der Psychopharmaka auf das PTSD Anke EHLERS, Forschungsprofessorin am Department for Psychiatry der Universität Oxford, stellt eine Übersicht über den Einsatz von Psychopharmaka zur Behandlung des PTSD dar. Psychopharmaka haben keine vollkommen abgrenzbare Wirkung (Siehe Seite 174 a. a. O., S. 102. 175 ‘sedieren’: [lat. n-lat.] dämpfen, beruhigen. Quelle: DUDEN: Fremdwörterbuch. Bearb. v. Marion MÜLLER, 4. Auflage; Mannheim, Wien, Zürich: Bibligraphisches Institut 1982. S. 622. 176 ‘Tagesrestwirkung’ (auch ‘Hang-Over’) Nachwirkung von Psychopharmaka, die über die eigentlichen Wirkungszeitraum hinausgeht, z. B. bei Schlafmittel, die noch am nachfolgenden Tag leichte Wirkungen haben können. Quelle: LAUX, Gerd: Pharmakopsychiatrie. Unter Mitarb. von O. DIETMAIER und W. KÖNIG; Stuttgart, New York: G. Fischer, 1992. S. 104. 177 LAUX, Gerd: Pharmakopsychiatrie. Unter Mitarb. von O. DIETMAIER und W. KÖNIG. Stuttgart ; New York : G. Fischer, 1992. S. 103. 178 ‘teratogene Wirkungen’, „Teratogenität f: Eigenschaft best. ehem. Substanzen (z. B. Pharmaka), Mikroorganismen od. v. Strahlen, in d. Embryonalzeit Mißbildungen hervorzurufen.“ Quelle: PSCHYREMBEL, Willibald [Begr.]; Zink, Christoph [Bearb]; Dornblüth, Otto [Begr.]: Klinisches Wörterbuch, 255. Aufl. Berlin, New York: de Gruyter, 1986. S. 1647. 179 Trimenon: „Zeitrum von drei Monaten; v. a. auf Schwangerschaft u. Säuglingsalter bezogen.“ Quelle: PSCHYREMBEL, Willibald [Begr.]; Zink, Christoph [Bearb]; Dornblüth, Otto [Begr.]: Klinisches Wörterbuch, 255. Aufl. Berlin, New York: de Gruyter, 1986. 180 LAUX, Gerd: Pharmakopsychiatrie. Unter Mitarb. von O. DIETMAIER und W. KÖNIG; Stuttgart, New York: G. Fischer, 1992. S. 107. Seite 66 Therapie des PTSD 65), sondern die einzelnen Stoffgruppen zeigen sehr ähnliche Wirkungen und sind meist dosisabhängig. Im nachfolgenden Text werden die Wirkungen der verschiedenen Substanzen auf das PTSD beschrieben. Das PTSD ist ein Syndrom 181, bei dem viele einzelne Symptome gleichzeitig auftreten können. Depressionen, Ängste und Wahrnehmungsverzerrungen, ähnlich einer Halluzination, kommen in Begleitung des PTSD vor. Für die Depressionen, die sehr häufig in Begleitung des PTSD auftreten, können Antidepressiva hilfreich sein. Sie mildern die Beschwerden der Depression, wie die miserable Befindlichkeit, Schlafstörungen und auch Denkhemmungen. Antidepressiva können auch die psychotischen Wahnideen, die u. U. auch im PTSD enthalten sind, bekämpfen.182 PTSD enthält auch massive Ängste und Panikattacken. Gegen diese Symptome lassen sich im Akutstadium sehr gut Tranquilizer, aus der Benzodiazepin-Gruppe einsetzen. Obwohl es langfristig Probleme mit der Abhängigkeit geben kann, sind sie doch kurzfristig sehr gut gegen auftretende Ängste wirksam. LAUX beschreibt den Einsatzbereich der Tranquilizer folgendermaßen: „Als wichtigste Zielsymptome gelten Angstzustände. Pathologische Ängste, die ein adäquates Konfliktverhalten blockieren, können gemindert und der Weg zu einer Psychotherapie - falls erforderlich - geebnet werden. Tranquilizer bieten die Möglichkeit, psychovegetative Krisen, den «psychovegetativen Störkreis» zu durchbrechen (hierbei verstärkt Angst psychovegetative, somatische Störungen, die ihrerseits zu neuen Ängsten führen).“183 Gegen die Schlafstörungen, die im Zuge eines PTSD auftreten, eignen sich Benzodiazepine, mit einer besonders kurzen Wirkdauer, als Schlafmittel. Damit lassen sich Einschlaf- und Durchschlafstörungen behandeln. Länger anhaltende Formen des PTSD können auch von Substanzmissbrauch, wie Drogenkonsum, und/oder hohem Alkoholmissbrauch begleitet werden. Eine diagnostizierte Sucht wäre für Benzodiazepine ein Ausschließungsgrund: „Patienten mit einer Suchtanamnese sollten keine Benzodiazepin-Tranquilizer erhalten. Als medikamentöse Alternative bieten sich hier niedrigdosierte Neuroleptika, Antidepressiva oder Beta-Blocker an“.184 181 „Syndrom (gr. Dromos Lauf) n: Symptomenkomplex: Gruppe von gleichzeitig zusammen auftretenden Krankheitszeichen“, Quelle: PSCHYREMBEL, Willibald [Begr.]; Zink, Christoph [Bearb]; Dornblüth, Otto [Begr.]: Klinisches Wörterbuch, 255. Aufl. Berlin, New York: de Gruyter, 1986. S. 1629. 182 LAUX, Gerd: Pharmakopsychiatrie. Unter Mitarb. von O. DIETMAIER und W. KÖNIG. Stuttgart ; New York : G. Fischer, 1992. S. 203. 183 a. a. O. S. 139. 184 a. a. O. Seite 67 Therapie des PTSD 8.2.4 Antidepressiva 8.2.4.1 Selektive Serotonin - Wiederaufnahme-Hemmer (SSRIs) „Diese Medikamente (z. B. Sertralin, Fluvoxamin, Fluoxetin) sind wirksam in der Behandlung der PTB (DAVIDSON, 1997185). (...) Die SSRIs waren - über die verschiedenen Studien hinweg betrachtet - wirksamer als andere medikamentöse Therapien und können als pharmakologische Behandlung der Wahl gelten. Trotz der insgesamt guten Behandlungserfolge ist es möglich, dass SSRIs nicht bei allen Gruppen von PTB-Patienten gleich wirksam sind. (...) Die langfristige Wirksamkeit der SSRI ist nicht bekannt. Es ist nicht bekannt, ob eine Kombinationsbehandlung von psychologischer Behandlung und SSRIs erfolgreicher oder weniger erfolgreich ist als die psychologische Behandlung für sich allein.“186 VAN DER KOLK187 konnte jüngst in einer Studie darlegen, dass Fluoxetin188 (ein Antidepressivum), das die Wiederaufnahme (reuptake) von Serotonin an präsynaptischen Membranen blockiert, bei PTSD-Patienten eine besonders positive Wirkung auf die Fähigkeit zur Erregungsmodulation zeigt. Die klinischen Versuche mit Serotonin-ReuptakeBlockern deuten an, dass sie gegenwärtig die mit Abstand beste pharmakologische Behandlungsmöglichkeit für PTSD darstellen. 8.2.4.2 Monoamino-Oxidase-Hemmer (MAO-Hemmer) „Nach van ETTEN und TAYLORS189 (1998) Meta-Analyse sind MAO-Hemmer nicht wirksamer als Placebo oder Warten auf Therapie. (...) Es ist möglich, dass einige Studien die Wirkung der MAO-Hemmer unterschätzten, weil die Behandlung nicht über einen hinreichend langen Zeitraum stattfand. Trotzdem können sie nicht als pharmakologische Behandlung der Wahl angesehen werden (Davidson, 1997)“.190 8.2.4.3 Trizyklische Antidepressiva „Diese Medikamente scheinen, wenn überhaupt, nur bei weniger schweren Fällen der PTSD zu wirken (...). Effektstärken waren im Allgemeinen nicht bedeutend größer als für Placebo oder Warteliste (van Etten & Taylor, 1998; d = 0,54). DAVIDSON (1997)191 wies daraufhin, dass möglicherweise bei einigen Studien keine Wirksamkeit dieser Medikamente gefunden wurde, weil die Behandlungsdauer zu kurz war. Dennoch können 185 DAVIDSON, J. R. T.: „Biological therapies for posttraumatic stress disorder: an overview“, Journal of Clinical Psychiatry, 58 (suppl 9), 29-32, 1997. 186 EHLERS, Anke: Posttraumatische Belastungsstörung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, 1999. S. 76. 187 VAN DER KOLK, Bessel, A.: http://traumatherapie.de/kolk.htm. 188 „FLUOXETIN (Fluctin®) Chemisch neuartiger selektiver Hemmer der Wiederaufnahme von Serotonin ohne wesentliche Wirkung auf andere Neurotransmitter oder Rezeptoren. (...) Leicht aktivierende Wirkeigenschaften.“ Quelle: LAUX, Gerd: Pharmakopsychiatrie. Unter Mitarb. von O. DIETMAIER und W. KÖNIG; Stuttgart, New York: G. Fischer, 1992. S. 217. 189 VAN ETTEN, M. L. & TAYLOR, S.: „Comparative efficacy of treatments for posttraumatic stress disorder: A meta-analysis“. Clinical Psychology and Psychotherapy, 5. 126-144. 1998. 190 EHLERS, Anke: Posttraumatische Belastungsstörung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, 1999. S. 76. 191 DAVIDSON, J. R. T.: „Biological therapies vor posttraumatic stress disorder: an overview“. Journal of Clinical Psychitatry. 58 (suppl ), 29 - 32. zit. EHLERS, 1999, S. 76. Seite 68 Therapie des PTSD die trizyklischen Antidepressiva nicht als pharmakologische Behandlung der Wahl angesehen werden (DAVIDSON, 1997).“192 8.2.5 Antiepileptika „Antiepileptika sind eine chemisch sehr heterogene Gruppe von Substanzen, die in unterschiedlichem Maß das Auftreten bestimmter Formen epileptischer Anfälle verhindern können. Sie zählen (...) nicht zu den Psychopharmaka im engeren Sinn.“193 Aber einige Substanzen aus der Gruppe der Antiepileptika wurden auch in der psychiatrischen Therapie, zur Behandlung des PTSD, eingesetzt. Dies erscheint ungewöhnlich, weil epileptische Anfälle nicht im Syndrom des PTSD vorkommen. „Antiepileptika (Carbamazepin, Valproat) sind möglicherweise wirksam (d - 0,93, van Etten & Taylor, 1998), sind aber bisher noch nicht genügend untersucht worden (Friedman, 1998). Davidson (1997) schätzte, dass ca. 65 % der PTB-Patienten auf Antiepileptika ansprechen.“194 Aus all dem lässt sich schließen, dass Antiepileptika zu Behandlung des PTSD eher weniger eingesetzt werden. 8.2.6 Benzodiazepine In diese Gruppe fallen die meisten Tranquilizer, z. B. Lexotanil®, Librium®, Valium®, Temesta®, Mogadon®, sowie auch das Schlafmittel Halcion®195 „Benzodiazepine scheinen bei der Behandlung von PTSD nicht wirksam zu sein. Nach der Meta-Analyse von van Etten und Taylor (1998) waren sie nicht wirksamer als Placebo oder Warten auf Behandlung (...). Sie können nicht empfohlen werden, zumal es bei Absetzen von kurzzeitig wirkenden Benzodiazepinen, wie z. B. Alprazolam (Tafil®, Anm. d. Verfasserin), bei PTSD-Patienten zu einem Rebound-Syndrom196 mit erhöhter Ängstlichkeit, Schlafstörungen, Albträumen und Wutanfällen kommen kann (Davidson, 1997).“197 192 a. a. O., S. 76f. 193 LAUX, Gerd: Pharmakopsychiatrie. Unter Mitarb. von O. DIETMAIER und W. KÖNIG; Stuttgart, New York: G. Fischer, 1992. S. 283. 194 EHLERS, Anke: Posttraumatische Belastungsstörung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, 1999. S. 77. 195 a. a. O. S. 196 ‘Rebound-Syndrom’: „Beim Absetzen von Benzodiazepinen kommen vor allem vegetative Entzugssymptome als pathophysiologische Rebound-Phänomene vor. Letztere stellen ein (verstärktes) Wiederauftreten der ursprünglichen Symptome dar.“ Quelle: LAUX, Gerd: Pharmakopsychiatrie. Unter Mitarb. von O. DIETMAIER und W. KÖNIG; Stuttgart, New York: G. Fischer, 1992. S. 143. 197 EHLERS, Anke: Posttraumatische Belastungsstörung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, 1999. S. 77. Seite 69 Therapie des PTSD 8.3 Psychotherapie 8.3.1 Allgemeines Hans STROTZKA, Professor für Tiefenpsychologie der Universität Wien, definiert Psychotherapie folgendermaßen: „Psychotherapie ist eine Interaktion zwischen einem oder mehreren Patienten und einem oder mehreren Therapeuten (auf Grund einer standardisierten Ausbildung), zum Zwecke der Behandlung von Verhaltensstörungen oder Leidenszuständen (vorwiegend psychosozialer Verursachung) mit psychologischen Mitteln (oder vielleicht besser durch Kommunikation, vorwiegend verbal oder auch averbal), mit einer lehrbaren Technik, einem definierten Ziel und auf der Basis einer Theorie des normalen und abnormen Verhaltens.“ 198 Es lassen sich nach STROTZKA einige verschiedene Theorien als Orientierungshintergrund psychotherapeutischen Handelns erkennen:199 die Lerntheorien, (behaviorale, kognitive Ansätze) die tiefenpsychologischen Konzepte (alle Psychologien des Unbewussten, also vor allem die Psychoanalyse), die Systemtheorie (vorwiegend für die Familientherapie), eventuell sozialpsychologische Konzepte (für Gruppenpsychotherapien) und philosophische Anthropologien (etwa die Existenzphilosophie für die Daseinsanalyse oder FRANKLs Logotherapie oder eine humanistische Philosophie für die kognitive Psychotherapie). In diesem Rahmen wird auch ein wichtiges Element, die psychotherapeutische Grundhaltung, angeführt: „Man erwartet sich dabei eine Besserung von einem wertfreien Akzeptieren des Patienten, dem Bemühen um eine sympathisierende Einfühlung (Empathie), einem indirekten Beratungsstil und der Echtheit dieser Haltung (Kongruenz).“ 200 8.3.2 Psychotherapie des PTSD 8.3.2.1 Psychoanalytische Therapieformen Barbara Olasov ROTHBAUM und Edna B. FOA erkennen in den psychoanalytisch orientierten Therapieformen einige Probleme, sie zur Behandlung des PTBS einzusetzen. Sie berichten: „Verschiedene psychodynamisch orientierte Verfahren sind zur Behandlung von PTBSPatienten eingesetzt worden, und zwar als Einzel- oder Gruppentherapie und in unterschiedlichen, institutionellen Settings. Kein erkennbarer roter Faden verbindet die verschiedenen Interventionsformen miteinander, und es gibt kein in sich schlüssiges 198 STROTZKA, Hans: Tiefenpsychologie und Psychotherapie. Wien, New York: Springer, 1982. S. 1. 199 a. a. O. S. 2. 200 a. a. O. S. 2. Seite 70 Therapie des PTSD theoretisches Grundgerüst, das eine Beziehung zwischen gewähltem Vorgehen und der PTBS herstellen würde.“201 8.3.2.2 Wirksamkeit der psychoanalytischen Therapieformen Es wird über eine Therapie bei Vietnamveteranen berichtet: „Eine psychodynamische Therapie erwies sich als ineffektiv bei der Behandlung eines traumatisierten Vietnamveteranen (Grigsby, 1987 202). Nachdem es 19 Monate lang unter der psychodynamischen Psychotherapie zu keinen Fortschritten gekommen war, wurden [andere] (eingefügt v. Verfasserin) Techniken eingeführt.“203 Auf Grund dieses Berichtes kommen die Autoren zum Schluss, dass sich die rein gesprächs - orientierten Therapieformen nicht günstig für die Behandlung von PTSD bei Kriegsveteranen einsetzen lassen. „Dieser Bericht legt - vorbehaltlich der Beschränkungen einer Einzelfallstudie und des Fehlens systematischer Messungen - nahe, daß rein gesprächsorientierte Therapien nicht zu einer Linderung einer PTBS beitragen, während verhaltensorientierte Techniken anscheinend effektiv sind.“204 Verschiedene Gründe, wie das Fehlen einer Kontrollgruppe und genaue Beschreibung des Therapieherganges, machen es schwierig, die Ergebnisse über die psychodynamischen Therapien sinnvoll zu interpretieren. In einem Kommentar zu vielen Berichten über den Einsatz von psychodynamischen Therapien stellen ROTHBAUM & FOA fest: „Aus der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, daß Angaben über die Wirksamkeit traditioneller Interventionen bei Posttraumatischen Belastungsstörungen nur in relativ begrenztem Umfang vorliegen und offen für unterschiedliche Interpretationen sind.“205 8.3.2.3 Therapien auf der Grundlage von Lerntheorien und behaviorale Behandlungsmethoden Zwei unterschiedliche Gruppen verhaltenstherapeutischer oder behavioraler Verfahren werden im Allgemeinen zur Behandlung von Angststörungen angewandt: Expositionsverfahren und Angstbewältigungstechniken. 201 ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen, SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 103. 202 GRIGSBY, J. P.: „The use of imagery in the treatment of posttraumatic stress disorder“. The Journal of Nervous and Mental Disease, 175, 55-59. 1987. 203 ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl.; Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 104. 204 a. a. O. S. 104. 205 a. a. O. S. 107. Seite 71 Therapie des PTSD Expositionsverfahren Zu den Expositionsverfahren zählen eine Reihe von Techniken, deren Gemeinsamkeiten die Konfrontation mit den gefürchteten Situationen sind. Diese Techniken lassen sich nach zwei Gesichtspunkten gliedern: dem Expositionsmedium (in sensu oder imaginativ vs. in vivo), der Expositionsdauer (kurz vs. lang) und dem dabei entstehenden Erregungsniveau (niedrig vs. hoch) Barbara O. ROTHBAUM und Edna B. FOA206 fanden eine Planmäßigkeit der vielen unterschiedlichen Methoden der Verhaltenstherapien. Die verschiedenen Expositionsverfahren lassen sich an Hand der oben beschriebenen Dimensionen auf einem Kontinuum in eine Ordnung bringen: Der eine Extrempunkt wird von der systematischen Desensibilisierung (WOLPE, 1958207) gebildet, mit einer imaginativen, kurzen und minimal erregenden Exposition. Am anderen Ende befindet sich die Reizüberflutung in vivo208 (‘flooding’, MARKS, 1972209), bei der eine Konfrontation mit tatsächlichen Lebenssituationen stattfindet, die von längerer Dauer ist und darauf abzielt, Angst in hohem Ausmaß auszulösen. Die systematische Desensibilisierung besteht aus einer Konfrontation mit gefürchteten Situationen oder Objekten auf der Vorstellungsebene. Der Therapeut beschreibt kurze Szenarien, deren Fokus auf dem gefürchteten Stimulus liegt (z. B.: «Sie sind anderthalb Meter von der Schlange entfernt»). Die Patienten sollen sich die Szenarien für kurze Zeit so lebhaft wie möglich vorstellen. Zwar wird das Auftreten eines gewissen Ausmaßes an Furcht für notwendig erachtet, es wird jedoch versucht, die Furcht während der Vorstellung so gering wie möglich zu halten (im Allgemeinen durch Entspannung). Die am wenigsten gefürchtete Szene wird zuerst vorgegeben. Wenn der Patient zu verstehen gibt, dass er Angst hat, wird die Vorgabe der Szene unterbrochen, zur Entspannung zurückgekehrt und die Szene dann erneut beschrieben. Jede Szene wird so lange vorgegeben, bis sie keine Angst mehr auslöst. Im Anschluss daran wird eine nächst stärker ängstigende Szene vorgegeben. Varianten der systematischen Desensibilisierung sind abgestufte Konfrontationsverfahren in 210 vivo oder in sensu ohne Entspannung. Beginnt die Exposition mit stark gefürchteten 206 a. a. O. S. 108. 207 WOLPE, J.: Psychotherapy by reciprocal inhibition. Stanford: Stanford University Press, 1958. 208 In-vivo-Exposition (od. Konfrontation, exposure): Der Patient wird Reizen, die an das Trauma erinnern, aber bisher vermieden wurden (z. B. Ort des Geschehens, ähnliche Situationen, Aktivitäten, Gefühle) ausgesetzt. Es ist eine wirkungsvolle Methode, um zu erreichen, dass der Patient das traumatische Erlebnis als Teil der Vergangenheit akzeptiert. Quelle: EHLERS, Anke: Posttraumatische Belastungsstörung. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, 1999. S. 50. 209 MARKS, I. M.: „Flooding and allied treatments“. in W. AGRAS (Ed.), Behavior modification: Principles and clinical applications. Boston: Little Brown, 1972. 210 In-sensu-Exposition (od. Konfrontation, exposure): Der Patient wird mit dem angstmachenden oder traumatisierenden Ereignis in der Vorstellung konfrontiert. Seite 72 Therapie des PTSD Stimuli, ist sie langanhaltend und löst sie ein hohes Angstniveau aus, spricht man von Reizüberflutung (flooding)211. Auch das Flooding wird entweder in sensu oder in vivo angewendet und so lange fortgeführt, bis eine Angstreduktion einsetzt. Expositionstechniken (=Konfrontationstechniken) kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn ausgeprägtes Vermeidungsverhalten vorliegt. Die Behandlung zielt darauf ab, die Furchtstruktur zu aktivieren und zu modifizieren. ROTHBAUM & FOA berichten über Techniken, bei denen Patienten mit Material konfrontiert wurden, das in Zusammenhang mit dem ursprünglichen traumatischen Ereignis stand.212 In den meisten Fällen umfasste die Behandlung jedoch weitere Techniken wie Ärgerkontrolle oder Entspannungstraining, weshalb es unklar ist, welcher Anteil am gesamten Behandlungserfolg auf die Exposition zurückzuführen war. Die nachfolgenden Beispiele stellen die Behandlungen kurz dar. Mit der systematischen Desensibilisierung lassen sich Albträume reduzieren. Es wird von ROTHBAUM u. FOA über die Behandlung eines wiederkehrenden Albtraums eines 29jährigen männlichen Vietnamveteranen berichtet:213 Der Patient träumte von einem Vorfall, der sich tatsächlich ereignet hatte und bei dem ein Soldat durch eine Mine verletzt worden war. Etwa neun Jahre dauernd tauchte der Albtraum mindestens einmal im Monat auf. Dabei entwickelte sich bei dem Veteran eine chronische Furcht vor Schlafen und Träumen. Die Behandlung bestand aus fünf Sitzungen von dreißig Minuten Dauer. Die Expositionshierarchie richtete sich nach der zeitlichen Abfolge der Ereignisse im Traum. Zwei Wochen später gab der Patient an, keine Albträume mehr gehabt zu haben und weniger Angst in Zusammenhang mit Schlafen und Träumen zu haben. ROTHBAUM & FOA berichten des Weiteren über die erfolgreiche Behandlung von insgesamt 24 Vietnamveteranen. Die Expositionstherapien 214 werden auch zur Heilung von Traumata, die durch Vergewaltigungen ausgelöst wurden, eingesetzt. Über die erfolgreiche Therapie von Quelle: FLIEGEL et al.: Verhaltenstherapeutische Standardmethoden; München, Wien, Baltimore: Urban & Schwarzenberg, 1981. S. 214. 211 ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen, SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 108. 212 a. a. O. S. 108ff. 213 ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 108. 214 a. a. O. S. 110f. Seite 73 Therapie des PTSD Vergewaltigungsopfern berichten ROTHBAUM & FOA215: Eine 20-jährige Frau wurde im Alter von 13 Jahren vergewaltigt. Die Klientin hatte seit dem Ereignis keine Nacht allein verbringen können, da sie unter der Angst litt, der Täter könne zurückkehren. WOLFF (1977)216 setzte die systematische Desensibilisierung217 erfolgreich zur Behandlung dieser Ängste ein. Weitere therapeutische Interventionen sind Techniken zur Bewältigung von Ängsten. Diese Techniken werden im nachfolgenden Text beschrieben. Angstbewältigungstechniken Das Training von Angstbewältigungstechniken wird verwendet, wenn der gesamte Alltag des Patienten durch das Auftreten von Angst geprägt ist. In diesem Fall besteht weniger die Notwendigkeit, die Furcht zu aktivieren, als vielmehr, sie zu bewältigen. Zu den charakteristischen Merkmalen des PDST gehören sowohl spezifische Furchtreaktionen als auch eine chronisch erhöhte allgemeine Aktivierung (arousal). Daher sind sowohl Expositionsverfahren als auch Angstbewältigungstechniken zur Behandlung der Störung geeignet.218 Angstbewältigungstechniken zielen darauf ab, Ängste zu reduzieren, indem den Patienten Fertigkeiten zu ihrer Kontrolle vermittelt werden. ROTHBAUM & FOA219 teilen diese Techniken folgendermaßen ein: Entspannungstraining (z. B. BERNSTEIN & BORKOVEC, 1973; JACOBSON, 1983) Stressimpfungstraining (MEICHENBAUM, 1974), kognitive Umstrukturierung (BECK, 1972; ELLIS, 1977), Atmungstraining (CLARK, SALKOVSKIS & CHAUKLEY, 1985), Training sozialer Kompetenz (BECKER, HEIMBERG & BELLACK, 1987) Ablenkungstechniken (z. B. Gedankenstopp [WOLPE, 1973]). 215 a. a. O. S. 112. 216 WOLFF, R.: „Systematic desensitization and negative practice to alter the aftereffects of a rape attempt“. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 8, 423-425. 1977. zit. ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 112. 217 Systematische Desensibilisierung: Ein Verfahren zum schrittweisen Abbau von Ängsten. Quelle: DORSCH, Friedrich: Psychologisches Wörterbuch / Dorsch. Hrsg. von Friedrich Dorsch. Red.: Horst Ries. - 11., erg. Aufl. - Bern ; Stuttgart ; Toronto : Huber, 1987. S. 672. 218 ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“, Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen, SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. 114. 219 a. a. O. Seite 74 Therapie des PTSD Es gibt eine besonders wichtige, häufig angewandte Technik: „Die am häufigsten verwendete Technik ist das Muskelentspannungstraining, von WOLPE (1985) beschrieben als «Aktivität des Lösens tonischer Kontraktion der Muskelfasern» (...). Die Muskelentspannung wirkt sich auf das autonome Nervensystem aus und bewirkt, daß Reaktionen des Sympathikus220 abgeschwächt werden (d. h. sich der Herzschlag und die Atmung verlangsamen und der Blutdruck sinkt).“221 HICKLING, SISON und VANDERPLOEG (1986)222 untersuchten die Wirksamkeit dieser Angstbewältigungstechniken. Sechs Veteranen mit PTBS erhielten 7 bis 14 Behandlungssitzungen über einen Zeitraum von 8 bis 16 Wochen. Eingebaut in die genannten Techniken waren Elemente des Autogenen Trainings (z. B. die Suggestion von Wärme oder eines ruhigen, regelmäßigen Herzschlages [SCHULTZ & LUTHE, 1969223]) und stimuluskontrollierte Entspannung (cue-controlled relaxation). Es zeigten sich hinterher auf allen diagnostischen Skalen Verbesserungen. Zwar sind die Resultate vielversprechend, ihre Generalisierbarkeit ist jedoch begrenzt, da die überweisenden Ärzte nur solche Patienten geschickt hatten, die ihrer Meinung nach von dieser Form der Behandlung profitieren würden.224 220 Sympathikus: „(griech.), der (zuerst) entdeckte) Anteil des vegetativen Nervensystems, der vorwiegend leistungssteigernde (ergotrope) Impulse auf die Organe überträgt.“ Quelle: DER GROSSE KNAUR: Lexikon in 20 Bänden; München: Lexigraphisches Institut, 1983. S. 7823. Wirkungen des Sympathikus sind z. B. Anstieg des Gesamtstoffwechsels, Durchblutungsdrosselung der Haut und der Verdauungsorgane, u. U. Durchblutungssteigerung der arbeitenden Skelettmuskulatur, Steigerung der Herzdurchblutung, Entspeicherung der Blutdepots, Anstieg des Herzminutenvolumens, Forderung der Schlagfolge, Anregung der Adrenalinsekretion, Anregung der Hormonsekretion und Pupillenerweiterung. Quelle: BIBILOGRAPHISCHES INSTITUT AG, MANNHEIM: Wie funktioniert der Mensch?. Leitung: Karl-Heinz Ahlheim, 2. Aufl., Mannheim: Bibilographisches Institut, 1977. S. 352. 221 ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 114. 222 HICKLING, E. J., SISON, G. F. P. & VANDERPLOEG, R. D.: „Treatment of posttraumatic stress disorder with relaxation and biofeedback training“. Behavior Therapy, 16, 406-416. 1986. zit. ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitivbehaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 114. 223 SCHULTZ, F. H. & de LUTHE, W.: Autogenic therapy. New York: Grune and Stratton, 1969. zit. ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 114. 224 ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 108. Seite 75 Therapie des PTSD Auch bei Vergewaltigungsopfern wurden Angstbewältigungstechniken erfolgreich angewandt. FRANK, ANDERSON, STEWART, DANCU, HUGHES & WEST (1988)225 stellten eine Arbeit vor, in denen Daten von 84 Versuchspersonen verwendet wurden. Die Teilnehmerinnen wurden entweder mit kognitiver Verhaltenstherapie oder mit systematischer Desensibilisierung behandelt. Unabhängig von der Behandlungsmethode hatte ein Teil der Teilnehmerinnen die Therapie kurze Zeit nach der Vergewaltigung aufgenommen (im Durchschnitt nach 20 Tagen), während andere erst Monate (im Schnitt 129 Tage) nach der Tat behandelt wurden. Die Ergebnisse dieser Therapien werden von ROTHBAUM & FOA folgendermaßen interpretiert: „Obwohl die Teilnehmerinnen, die erst spät in Behandlung kamen, von Anfang an unter mehr Symptomen litten, zeigten die Ergebnisse der Messung nach Beendigung der Behandlung, daß beide Gruppen gleich gut sowohl auf die systematische Desensibilisierung als auch auf die kognitive Verhaltenstherapie ansprachen.“226 ROTHBAUM, O. B. & FOA227 zitieren HOLMES & St. LAWRENCE (1983). Sie stellen die Wichtigkeit von alternativen Angstreaktionen heraus: „daß «die am meisten versprechenden Behandlungsstrategien anscheinend darin bestehen, die Opfer mit spezifischen Bewältigungsmechanismen und alternativen Reaktionen auf Angst auszustatten».“228 225 FRANK, E.; ANDERSON, V. P., STEWART, B. D.; DANCU; D., HUGHES, C., & WEST, D.: „Efficiacy of cognitive behavior therapy and systematic desensitiziation in the treatment of rape trauma". Behavior Therapy, 19. 403-420.zit. ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 116. 226 ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Gottingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 116. 227 a. a. O. 228 HOLMES, M. R. & St. LAWRENCE, J. S.: Treatment of rape-induced trauma. Proposed behavioral conceptualization and review of the literature. Cinical Psychology Review, 3, 417-433. 1983. zit. ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 116. Seite 76 Therapie des PTSD Stressimpfungstraining Das Stressimpfungstraining (SIT) wurde zur Behandlung von Opfern entwickelt, die drei Monate nachdem sie vergewaltigt worden waren, immer noch unter starken Ängsten litten (KILPATRICK, VERONEN & RESICK, 1982)229. Das Programm hatte einen Umfang von 20 Therapiestunden, plus Hausaufgaben, und bestand aus zwei Phasen: einer edukativen Phase und einer, in der Copingfertigkeiten 230 eingeübt wurden. Die zweistündige, edukative Phase, mit der die Behandlung begonnen wurde, diente dazu, das Vorgehen und das theoretische Konzept, das der Behandlung zugrunde lag, zu erklären. In der zweiten Phase des Stressimpfungstrainings stand die Vermittlung und Anwendung von Copingfertigkeiten Muskelentspannungstraining im Vordergrund. und dem Begonnen kontrollierten wurde mit Atmen. dem Das Muskelentspannungstraining beruhte auf der Methode des An- und Entspannens einzelner Muskelgruppen nach JACOBSON (1938)231. Die Entspannungssitzungen wurden auf Band aufgezeichnet und den Teilnehmerinnen mitgegeben, sodass sie zu Hause üben konnten. Die Sitzungen wurden so lange durchgeführt, bis alle Patientinnen in der Lage waren, sich selbst in kurzer Zeit und in einer Vielfalt von Situationen in einen entspannten Zustand zu versetzen. Bei den Atemübungen wurde, ähnlich wie bei Yoga oder Lamaze- Geburtsvorbereitungskursen, vor allem auf langsame Zwerchfellatmung geachtet. Im Anschluss daran wurden durch Rollenspiele Kommunikationsfertigkeiten trainiert. Auch verdecktes Modelllernen wurde eingesetzt. Diese Technik ähnelt dem Rollenspiel. Statt Invivo-Übungen werden jedoch Szenen in der Vorstellung durchgespielt. Um Kontrolle über die störenden Auswirkungen aufdringlicher Gedanken zu bekommen, wurden die 229 KILPATRICK, D. G; VERONEN, L. J. & RESICK, P. A.: „Psychological sequelae to rape: Assessment and treatment strategies“. in D. M. DOLEYS & R. L. MEREDITH (Eds.), Behavioral medicine: Assessment and treatment strategies. New York: Plenum Publishing, 1982. zit. in ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth. 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 117. 230 „’coping’: [engl. cope handeln, kampfen mit], Auseinandersetzung, Bewältigung. Bez. für vorwiegend kognitive Strategien der Auseinandersetzung mit Stressoren und belastenden Situationen.“ Quelle: SCHMIDT, L.: in Psychologisches Wörterbuch / Dorsch; Hrsg. von Friedrich DORSCH, Red.: Horst RIES, 11., erg. Aufl.; Bern, Stuttgart, Toronto: Huber, 1987. S. 121. 231 JACOBSON, E.: Progressive relaxation. Chicago University of Chicago Press. 1938. zit. in ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 117 . Seite 77 Therapie des PTSD Teilnehmerinnen auch mit den Instruktionen zum Gedankenstopp (WOLPE, 1958)232 vertraut gemacht. Die letzte Technik, der gelenkte Selbstdialog, war in den Augen von KILPATRICK et al. (1982)233 die wichtigste. Die Therapeutin leitete alle Teilnehmerinnen an, sich auf ihren inneren Dialog zu Selbstverbalisationen konzentrieren zu und identifizieren. irrationale, Gemäß fehlerhafte und negative (1974) 234 MEICHENBAUMS Stressimpfungstraining und der Vorgehensweise zur kognitiven Umstrukturierung wurden rationale und positive Aussagen generiert und an die Stelle der negativen gesetzt. ROTHBAUM & FOA beschreiben die Grundprinzipien und den Ablauf der Stressimpfungstechniken im folgenden Text. Es ist auch zugleich ein konkretes Beispiel, wie die Vergewaltigungsopfer durch diese Technik lernen, mit ihrem Trauma fertig zu werden. Diese Technik lässt sich auch für alle anderen Opfer von Gewalttaten erfolgreich anwenden. „Alle Sitzungen, bei denen es um die Vermittlung von Copingfertigkeiten geht, laufen nach dem gleichen Grundschema ab. Am Anfang steht jeweils ein Rückblick auf die Inhalte der vergangenen Sitzung und eine Besprechung der zurückliegenden Versuche der Patientin, die gelernten Fertigkeiten in ihrer natürlichen Umgebung anzuwenden, sowie der Hausaufgaben. Es folgen im weiteren eine Darstellung des allgemeinen Vorgehens bei der Vermittlung einer Copingfertigkeit sowie detaillierte Anleitungen für die einzelnen Fertigkeiten. 1. Definition der Fertigkeit. Die Fertigkeit wird definiert. Für welchen Kanal (z. B. den kognitiven oder den autonomen) ist diese Copingfertigkeit geeignet? Warum ist sie wichtig für die Patientin? 2. Grundprinzip und Mechanismus. Den Patientinnen wird erklärt, welche Verhaltensweisen, Reaktionen oder Symptome durch die neue Copingfertigkeit abgeschwächt oder gestärkt werden. Es wird auf Parallelen und Unterschiede zwischen dieser Fertigkeit und anderen hingewiesen. 3. Demonstration. Der Patientin wird die Fertigkeit demonstriert oder ihr wird eine verbale Erklärung über die praktische Umsetzung gegeben. 232 WOLPE, J.: Psychotherapy by reciprocal inhibition. Stanford: Stanford University Press. 1958. zit. in ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 117. 233 KILPATRICK, D. G, VERONEN, L. J. & RESICK, P. A.: „Psychological sequelae to rape: Assessment and treatment strategies“. In D. M. DOLEYS & R. L. MEREDITH (Eds.), Behavioral medicine: Assessment and treatment strategies; New York: Plenum Publishing, 1982. zit. in ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 117. 234 MEICHENBAUM, D.: Cognitive behavior modification. Morristown. NJ: General Learning Press. 1974. zit. in ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 118. Seite 78 Therapie des PTSD 4. Anwendung 1. Die Patientin übt die Fertigkeit zuerst an einem Problem, das in keinem Zusammenhang zur Vergewaltigung steht (z. B. berufliche Schwierigkeiten). 5. Nachbesprechung. Es wird überprüft, ob die Patientin erklären kann, was sie getan und wie es funktioniert hat. 6. Anwendung 2. Die Patientin übt an einem ihrer vergewaltigungsbezogenen Probleme.“235 Die einzelnen Elemente der Copingfertigkeiten sind: Atemtechniken, Muskelentspannung, Gedankenstopp, kognitive Umstrukturierung, gelenkter Selbstdialog und verdecktes Modelllernen (Rollenspiel). Sie werden im Einzelnen wie folgt beschrieben. Beispielhaft werden auch Ausschnitte aus einer tatsächlich stattgefundenen Therapie mit Vergewaltigungsopfern angeführt, deshalb wird der Begriff ‘Patientin’ für die Bezeichnung der betroffenen Opfer benützt. A) Atemtechnik Zur Vermittlung des Grundgedankens wird die folgende Erklärung den Patientinnen mitgeteilt: „Den meisten Menschen ist klar, daß sich unsere Atmung darauf auswirkt, wie wir uns fühlen. Wenn wir beispielsweise in Aufregung geraten, fordert man uns manchmal auf, ‘erst mal tief durchzuatmen und uns zu beruhigen’. Nun ist es allerdings gar nicht das tiefe Atmen, sondern das normale, und vor allem das langsame Ausatmen, das in solchen Situationen hilfreich ist. (...) Sie sollen sich gleich ganz auf das Ausatmen konzentrieren und es bewußt in die Länge ziehen. Und beim Ausatmen sagen Sie bitte das Wort RUHIG leise zu sich selbst, während ich es laut aussprechen werde. RUHIG eignet sich hier gut, weil es in unserer Kultur schon mit angenehmen Dingen assoziiert -verbunden - ist. (...) Außer, daß Sie sich darauf konzentrieren, langsam auszuatmen und dabei RUHIG zu sich selbst sagen, möchten wir, daß Sie Ihre Atmung insgesamt verlangsamen. Sehr oft passiert es, daß Leute, wenn sie Angst bekommen oder sich aufregen, das Gefühl haben, mehr Luft zu brauchen und sie dann oft anfangen, zu hyperventilieren. In Wirklichkeit ist es genau andersherum. Wenn wir uns nicht gerade angesichts einer realen Gefahr auf eine Kampf-, Erstarrungs- oder Fluchtreaktion vorbereiten, brauchen wir oft weniger Luft als wir aufnehmen. Wenn wir hyperventilieren236 und mehr Luft in unsere Lungen lassen, ist das für unserem Körper das Signal, sich für eine der genannten Reaktionen vorzubereiten und dafür genügend Sauerstoff zur Verfügung zu stellen. (...)In den meisten Fällen, in denen wir hyperventilieren, täuschen wir damit unseren Körper. Viel besser wäre es, 235 ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 121. 236 „Hyperventilation: (lat. ventilare: lüften) für übermäßige Steigerung der Atmung.“ Quelle: PSCHYREMBEL, Willibald [Begr.]; Zink, Christoph [Bearb]; Dornblüth, Otto [Begr.]: Klinisches Wörterbuch, 255. Aufl. Berlin, New York: de Gruyter, 1986. S. 749. Seite 79 Therapie des PTSD unsere Atmung zu verlangsamen und weniger Luft aufzunehmen. Das können wir tun, indem wir zwischen den Atemzügen eine kleine Pause machen und so die Abstände zwischen ihnen vergrößern. Nachdem Sie langsam ausgeatmet haben, halten Sie bitte buchstäblich die Luft an und zählen bis vier [ggf. andere Zahl einsetzen], bevor Sie das nächste Mal einatmen.“237 Die Patientinnen werden anschließend angewiesen, einen normalen Atemzug zu machen, sehr, sehr langsam auszuatmen und dabei das Wort ‘RUHIG’ zu sich selbst zu sagen. Dann sollen sie die Atmung kurz anhalten und erst bis vier zählen, ehe sie erneut einatmen. Diese Atmungstechnik wird in der ersten Sitzung etwa 10 - 15 mal wiederholt. Als Hausaufgabe soll diese Übung etwa zweimal am Tag ausgeführt werden. B) Muskelentspannung Das Training nach JACOBSON (1938)238, das auf dem Wechsel zwischen An- und Entspannung beruht, wird ab der dritten Sitzung eingesetzt, um die Muskelentspannung zu lernen. Zum Relaxationstraining gehört die völlige Entspannung aller wichtigen Muskelgruppen. Die Klientinnen bekommen die Aufgabe, die Methode zwischen den Sitzungen zweimal täglich zu üben. In der vierten Sitzung wird das Entspannungstraining in Verbindung mit dem oben beschriebenen kontrollierten Atmen eingesetzt. Auch diese Fertigkeit wird sowohl in der Therapie als auch zu Hause geübt. C) Gedankenstopp Die Technik des Gedankenstopps wird vermittelt, indem die Klientin ersucht wird, sich bewusst auf ihre lästigen Gedanken zu besinnen. Nachdem sie dies 35 bis 45 Sekunden lang getan hat, ruft der Therapeut im Befehlston: ‘STOPP!’ und klatscht dabei in die Hände oder schlägt auf den Tisch. Dann fragt er die Klientin, was passiert ist. Die meisten Patienten geben dann an, dass der Gedanke verschwunden sei. Die Übung wird einige Male wiederholt. Im nächsten Schritt soll die Klientin ihre Gedanken selbst stoppen, indem sie sich leise das Wort ‘STOPP’ sagt. Dann erhält sie die Anweisung, die Technik zuerst bei mäßig schwierigen Gedanken und dann bei den stärker belastenden anzuwenden. Falls notwendig, kann die Patientin ein Gummiband am Handgelenk tragen, dieses gegen die Haut schnappen lassen und ‘STOPP!’ sagen, wenn sich ein aufdringlicher Gedanke einstellt. D) Kognitive Umstrukturierung 237 ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 122. 238 JACOBSON, E.: Progressive relaxation; Chicago University of Chicago Press, 1938. zit. in ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 123. Seite 80 Therapie des PTSD Der Therapeut stellt der Klientin zuerst das ABC-Paradigma für automatische, irrationale Gedanken (BECK, RUSH, SHAW & EMERY, 1979239) vor, wobei er vor allem darauf eingeht, wie subjektive Gedanken das Gefühl und das Verhalten beeinflussen. A = antecedent, vorausgehende Situation, B = belief, persönliche Überzeugung, C = consequences, Folgen Beispielhaft wird gezeigt, wie dasselbe Ereignis (z. B. ein lautes Geräusch aus dem Nachbarzimmer zu hören) zu völlig unterschiedlichen Reaktionen führen kann (z. B. sich sehr zu fürchten und umgehend das Haus zu verlassen versus sich ein wenig zu ärgern und das Zimmer zu betreten), je nachdem, wie die eigene Wahrnehmung interpretiert wird (z. B.: «Ein Einbrecher ist im Haus. Ich bin in Gefahr» versus «Was, zum Kuckuck, hat die dumme Katze denn jetzt schon wieder angestellt?»). Der Therapeut bittet die Klientin, eine nicht im Zusammenhang mit der Vergewaltigung stehende Situation zu schildern, in der sie aus der Fassung geraten ist (wie z. B. keine Gehaltserhöhung bekommen zu haben) und analysiert diese dann nach dem ABC-Raster. Zuerst geht sie auf das A (die auslösende Situation oder das Ereignis) und das C ein (die Folgen bzw. wie sich die Klientin gefühlt hat). Dann bittet er die Klientin, ihm dabei zu helfen, das B zu erschließen (die Überzeugungen/die Sätze, die sie zu sich selbst gesagt hat und die sie in Unruhe versetzt haben). ROTHBAUM & FOA beschreiben die Abfolge der kognitiven Umstrukturierung folgendermaßen: „Die kognitive Umstrukturierung erfolgt in den folgenden Schritten: 1. Benennen von A und C. 2. Benennen von B, Formulieren einer automatischen Annahme (z. B.: «Er hat mich zurückgewiesen. Ich brauche Liebe und Anerkennung, um mich wertvoll zu fühlen» oder «Er ist ein potentieller Vergewaltiger und geht gleich auf mich los»). 3. Überprüfen des Realitätsgehalts von B: Abwägen der Indizien, die für und gegen die Annahme sprechen, etwa so, wie es vor Gericht geschieht. 4. Sind die Belege unzureichend, kann die Patientin die Annahme entweder zurückweisen oder noch weitere Informationen einholen. 5. Wenn genügend Indizien vorliegen, rational und angemessen (zu) reagieren (z. B. «Mir wäre lieber, er würde mich nicht zurückweisen, aber es sagt nichts über meinen Wert als Person») oder versuchen, sich in Sicherheit zu bringen.“ 240 239 BECK, A. T.; RUSH, A. J.; SHAW, B. F. & EMERY, G.: Cognitive therapy of depression. New York: Guilford Press, 1979. zit. in ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitivbehaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 123. 240 ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 124. Seite 81 Therapie des PTSD Der Therapeut unterstützt dabei die Klientin, ihre Überzeugungen auf Rationalität hin einzuschätzen und sie durch rationalere Selbstverbalisationen zu ersetzen. Im Anschluss daran wird das Vorgehen auf eine Erfahrung übertragen, die in Zusammenhang mit der Vergewaltigung steht. Falls erforderlich, wird noch ein drittes Beispiel verwendet, bei dem die Klientin die beschriebene Methode möglichst selbständig anwendet. E) Gelenkter Selbstdialog Im gelenkten Selbstdialog lehrt der Therapeut die Klientin, ihre Aufmerksamkeit auf ihren inneren Dialog zu konzentrieren bzw. darauf, was sie zu sich selbst sagt. Irrationale, unrichtige oder negative Aussagen werden als solche identifiziert und durch rationale, förderliche oder aufgabenbezogene ersetzt. Die Klientin wird dann angewiesen, sich selbst eine Reihe von Fragen zu stellen und zu beantworten oder auf eine Reihe von Aussagen zu reagieren. Der gelenkte Selbstdialog lehnt sich an die Beispiele MEICHENBAUMS (1974)241 an. Der gelenkte Selbstdialog enthält Aussagen, die sich jeweils einer von vier Kategorien zuordnen lassen: Vorbereitung, Konfrontation und Umgang, Bewältigung von Versagensängsten und Verstärkung. Für jede der genannten Kategorien stellen Klientin und Therapeut eine Reihe von Fragen und Aussagen zusammen, die die Klientin dazu ermutigen, (a) die tatsächliche Wahrscheinlichkeit eines negativen Ereignisses einzuschätzen, (b) ihre Angst zu ‘managen’, (c) Selbstkritik und selbstabwertende Aussagen in Grenzen zu halten, (d) das gefürchtete Verhalten auszuführen und (e) sich selbst dafür zu verstärken sowie dafür, nach dem vereinbarten Schema vorgegangen zu sein. Grundsätzlich werden speziell auf die individuellen Probleme der Klientin zugeschnittene Aussagen formuliert. Die Selbstaussagen werden auf Karteikarten geschrieben, auf die die Patientin in den Übungen außerhalb der Behandlungssitzungen zurückgreifen kann. Die Klientin wird dazu ermutigt, sich dieser Copingfertigkeiten zu bedienen, um alltägliche Probleme 241 und Schwierigkeiten zu bewältigen. Üblicherweise drehen sich bei MEICHENBAUM, D.: Cognitive behavior modification. Morristown, NJ: General Learning Press. 1974. zit. in ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 125. Seite 82 Therapie des PTSD Vergewaltigungsopfern die meisten Selbstaussagen um die geringe Wahrscheinlichkeit, dass erneut etwas Traumatisches passiert. F) Verdecktes Modelllernen, Rollenspiel Verdecktes Modelllernen ist ein Rollenspiel auf der Vorstellungsebene. Zuerst beschreibt der Therapeut eine Szene, in der es eine für die Klientin schwierige Situation gibt. Der Therapeut setzt sich mit der Situation auseinander und bewältigt sie erfolgreich. Im Anschluss daran stellt sich die Klientin dieselbe Szene bildlich vor und malt sich aus, die Situation erfolgreich zu bestehen. Wie bei allen Fertigkeiten wird auch das verdeckte Modelllernen zuerst an einer Situation geübt, die nichts mit der Vergewaltigung zu tun hat. Dann erst an einer Szene, in der es eine große Ähnlichkeit zur Tat gibt. Für das verdeckte Modelllernen können dieselben Situationen verwendet werden, die später im Rollenspiel geübt werden.242 Im Rollenspieltraining setzen Klientin und Therapeut gemeinsam Situationen in Szene, in denen die Klientin Belastungen ausgesetzt ist. Der Therapeut erklärt, dass im Rollenspiel Verhaltensweisen durchgespielt werden und Text und Handlung geprobt werden, wobei so getan wird, als befände man sich in einer bestimmten Situation. Das Rollenspiel bietet die Möglichkeit neue Verhaltens- und Ausdrucksweisen zu erlernen. Statt sich wie gewöhnt zu verhalten, ist es eine Gelegenheit etwas zu üben, bevor die Situation tatsächlich eintritt. Ähnlich wie Proben am Theater, verringert wiederholtes Üben die Angst und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein neues Verhalten gezeigt werden kann.243 Der Therapeut dient zunächst als Verhaltensmodell, nimmt zuerst im Rollenspiel die Rolle der Klientin ein und demonstriert das angemessene soziale Verhalten. Anschließend werden die Rollen getauscht und die Klientin spielt sich selbst. Nach jedem Rollenspiel wird die Klientin aufgefordert, die positiven Aspekte ihres Verhaltens im Spiel, sowie Bereiche, die noch verbesserungsbedürftig sind, zu benennen. Der Therapeut tut dann das gleiche, wobei er stets die positiven Aspekte stärker hervorhebt als die negativen. Die Rollenspiele werden jeweils so oft wiederholt, bis die Patientin ein zufriedenstellendes Verhalten zeigt oder keine weiteren Fortschritte mehr macht (selten öfter als fünfmal). 244 G) Expositionsbehandlung Die Expositionsbehandlung besteht aus neun 90-minütigen Sitzungen, jeweils zwei in einer Woche. Die ersten beiden Sitzungen werden darauf verwendet, Informationen zu sammeln, das Behandlungskonzept zu erklären und die Behandlung zu planen. Es wird eine Hierarchie vermiedener Situationen für In-vivo-Expositionen erstellt. Die Hierarchie wird nach dem 242 ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 125. 243 a. a. O. S. 125. 244 a. a. O. S. 126. Seite 83 Therapie des PTSD Maß der Angstauslösung aufgebaut. Die In-vivo-Exposition beginnt bei Situationen, die ein relativ geringes Maß an Angst auslösen. Die nächste präsentierte Situation wird so gewählt, dass sie etwas mehr Angst erzeugt. Bei den weiteren Darbietungen wird das Angstpotential immer stärker bis hin zu den am meisten gefürchtetsten Situationen. In den nächsten sieben Sitzungen wird die Vergewaltigungsszene in der Vorstellung erneut durchlebt. Die Patientinnen werden aufgefordert, zu versuchen, sich die Situation der Vergewaltigung so lebhaft wie möglich vorzustellen und sie mit Worten so zu beschreiben, als würde sie sich gerade ereignen. In den ersten beiden Expositionssitzungen wird den Patientinnen gestattet, besonders schlimme, auch peinliche Details auszusparen. In den verbleibenden Sitzungen sollen sie die Vergewaltigung in allen Einzelheiten schildern, und zwar über 60 Minuten lang, in jeder Sitzung mehrere Male, so dass eine Habituation245 eintreten kann. Die Erzählungen werden auf Band aufgezeichnet und die Patientinnen werden aufgefordert, sich diese zu Hause mindestens einmal am Tag anzuhören.246 In der letzten Sitzung werden die Patientinnen daran erinnert, dass es zu einer Verschlimmerung der PTSD-Symptome kommen kann, wenn sie mit der Vergewaltigung in Zusammenhang stehende Gedanken vermeiden. Es wird ihnen nahegelegt, in ihrem Alltag weiterhin Expositionsübungen durchzuführen. Es geht um das Wiedererlangen des Gefühls der Selbstkontrolle in alltäglichen Situationen:247 „Die Behandlung konzentriert sich darauf, die Patientinnen bei der Lösung alltäglicher vergewaltigungsbedingter oder anderer - Probleme zu unterstützen, und zielt somit darauf ab, das Gefühl von Selbstkontrolle zu stärken.“248 8.3.2.4 Erfolge der Angstbewältigungstechniken Das Stressimpfungstraining zeigt gute Wirkung gegen das PTSD nach Vergewaltigungen und wirkt heilend. „In den Ergebnissen bei Untersuchungen hat sich das Stressimpfungstrainings und die Expositionsbehandlung gegenüber der Beratung und der Wartelistekontrollbedingung als überlegen erwiesen.“249 245 „Habituation: Gewöhnung, das Absinken einer Reaktion (motorisch oder sensonsch) bei wiederholter Einwirkung desselben Reizes in relativ kurzen Intervallen. Von der H. abzusetzen ist die Auslöschung (Extinktion). H. ist der selektiven Wahrnehmung insofern verwandt, als bedeutungslos gewordene (redundante) Reize ihre Wirkung verlieren.“ BECKER-CARUS, C.: in Psychologisches Wörterbuch / Dorsch. Hrsg. von Friedrich DORSCH, Red.: Horst RIES; 11., erg. Aufl.; Bern, Stuttgart, Toronto: Huber, 1987. S. 268. 246 ROTHBAUM, O. B. & FOA, Edna B.: „Kognitiv-behaviorale Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung“. Posttraumatische Belastungsstörung: Diagnose und Behandlung psychischer Störungen bei Opfern von Gewalttaten und Katastrophen. SAIGH, P.: (Hrsg). Aus dem Engl. übers. von Matthias Wengenroth, 1. Aufl., Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber 1995. S. 126. 247 a. a. O. S. 127. 248 a. a. O. 249 a. a. O. Seite 84 Falldarstellung 9 Fallgeschichte Folgende Fallgeschichte (von KUNTZE, M.; BULLINGER, A.; MÜLLER-SPAHN, F., 1997250) wurde aus der Zeitschrift ‘Verhaltenstherapie’ entnommen. Die Autoren der Publikation sind Mitarbeiter der Psychiatrischen Universitätsklinik Basel. Die Publikation wurde über die Agentur KARGER251, Freiburg, per Internet bezogen. Der Text entspricht im Großen und Ganzen der Originalarbeit, er wurde etwas gekürzt. Die übernommenen Texte wurden nur unwesentlich abgeändert. Insofern es sinnvoll war wurde die Formatierung des Textes weitestgehend belassen. Die Originalarbeit enthält einige spezifische Fachbegriffe aus Psychotherapie und Psychopharmakologie. Zur Erläuterung dieser Fachtermini wurden kurze Erklärungen in den Text eingefügt. 9.1 Zusammenfassung Der folgende Fall einer 33jährigen Krankenschwester, die für eine weltweit arbeitende Organisation tätig ist, stellt die Behandlung einer Posttraumatischen Belastungsstörung mit Hilfe eines Expositionsverfahrens dar. Die angewandte Methode basiert auf einem Manual von E. B. FOA et al. Dabei findet in insgesamt neun Sitzungen, die täglich erfolgen, eine prolongierte In-sensu-Exposition mit anschließender kognitiver Restrukturierung statt. Der günstige Therapieverlauf wird einmal deskriptiv, zum anderen auch mit Hilfe standardisierter Fragebögen veranschaulicht. 9.2 Einleitung Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) wird im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) unter den Angststörungen klassifiziert. Fünf diagnostische Kriterien werden dabei berücksichtigt: ein traumatisch erlebtes Ereignis, dessen sogenanntes «Wiedererleben», eine Vermeidung der traumaassoziierten Stimuli und eventueller anderer Alltagssituationen, emotionale Taubheit und eine vegetative Hypererregbarkeit. Die angewandte Methode (Cognitive Restructuring and Prolonged Exposure) zur Behandlung einer PTSD wurde von Prof. Dr. E. B. FOA entwickelt und wird in Philadelphia (USA) wissenschaftlich überprüft. Dieses vor allem bei Vergewaltigungsopfern erprobte Verfahren wurde im vorliegenden Fall zur Behandlung einer PTSD angewandt, die ihre Auslösung in gänzlich anderen Umständen hatte. In der Diskussion soll darauf näher eingegangen werden. 250 KUNTZE, M.; BULLINGER, A.; MÜLLER-SPAHN, F.: „Die Behandlung einer Posttraumatischen Belastungsstörunge (PTSD) durch die Insensu-Exposition und kognitive Restrukturierung: ein Fallbericht“, Verhaltenstherapie, 1997; 7; 161-167 251 http://www.karger.ch Seite 85 Falldarstellung 9.3 Kasuistik (=Beschreibung von Krankheitsfällen) 9.3.1 Aktuelle Symptomatik zu Therapiebeginn Die Patientin erschien zur ersten Exploration sehr verhärmt, wirkte angespannt und platzte sofort mit ihren Beschwerden heraus. Sie wisse ja, dass dies alles nur eine PTSD sei, aber sie sei am Rande ihrer physischen Kräfte. Im Vordergrund der Psychopathologie standen beängstigende Gedanken, Träume und Tagbilder aus den verschiedenen Kampfgebieten, die die Patientin in ihrer Karriere gesehen hatte. Sie könne nicht mehr schlafen, neben den Albträumen würde sie auch tagsüber von schrecklichen Bildern aus ihrem Diensteinsatz verfolgt. Diese kamen unkontrollierbar und die Patientin konnte sie auch nicht «zur Seite schieben». Die Gefühle von Trauer, Wut und Zorn, Schuldgefühle – wegen ihrer überstürzten Abreise aus Grosny – und Angst plagten die Patientin. Sie versuchte Gedanken, Gefühle und Gespräche über ihre Arbeit zu vermeiden. Zu Mitmenschen fühle sie sich emotional distanziert. 9.3.2 Biographische Vorgeschichte Die Patientin wurde 1963 geboren. Nach regulärem Schulbesuch schloss sie eine landwirtschaftliche Lehre an, die jedoch nach 2 Jahren von der Patientin wegen fehlender Zukunftsaussichten abgebrochen wurde. 1983 begann sie statt dessen eine Lehre als Krankenschwester, welche sie abschloss. Sie ging 1990 erstmals für eine internationale Organisation in den Südsudan. Sie war sich ihrer Berufswahl nicht sicher, weshalb sie wieder nach Hause zurückkehrte und zunächst für 2 Jahre als Pflegedienstleiterin arbeitete. Sie war dann für die internationale Organisation in Somalia, Sri Lanka und Ruanda tätig.1995 wurde die Patientin nach Afghanistan geschickt und wechselte ein Jahr später nach Tschetschenien. In einer ersten Liebesbeziehung wurde die Patientin 1980 schwanger und ließ die Schwangerschaft abbrechen. Sie hat aktuell eine Partnerschaft seit zirka Februar 1996, die für sie auch eine Zukunftsperspektive bietet. Das Paar verliebte sich in Afghanistan, und die Patientin wurde ein zweites Mal schwanger. Die Schwangerschaft wurde vor allem wegen der schwierigen beruflichen Situation (Auslandseinsätze) in gegenseitigem Einvernehmen Anfang August 1996 abgebrochen. 9.3.3 Krankheitsentwicklung Zu den relevanten Entstehungsbedingungen gehören vermutlich die vielen Einzelerlebnisse der Patientin über die vergangenen 4 Jahre in unterschiedlichen Krisengebieten. Ihr erster Einsatz im Sudan beinhaltete sofort die Triage252 von Verletzten nach Bombenangriffen in 252 „Triage (frz): Auslese, Selektion, Auswahl v. Fällen; i. e. S. Einteilen d. Verletzten im Katastrophenfall nach zunehmender Verletzungsschwere als (negatives) Behandlungskriterium“. Quelle: PSCHYREMBEL, Willibald [Begr.]; Zink, Christoph Seite 86 Falldarstellung einzelnen Dörfern – und dies eigenverantwortlich und allein. Eine regelmäßige Reflexion der Arbeit fand nicht statt. Sie entwickelte eine professionelle Grundhaltung, vor allem in Ambivalenzkonflikten: «Soll ich mich schützen und weglaufen oder soll ich den Opfern helfen? – Ich bin zum Helfen hier.» Zwei spezielle Einzelerlebnisse in Ruanda und Afghanistan gingen der akuten Störung unmittelbar voraus und werden von der Patientin damit in Verbindung gebracht. In Ruanda 1995 war sie zuständig für die Betreuung eines Gefängnisses und schildert wiederkehrende, albtraumhafte Erinnerungen von toten Menschenleibern, Folterwunden, Fäkalien und Unterernährung. In Afghanistan erlebte sie dann im November 1995 erstmals einen für sie wahrnehmbaren Kontrollverlust, als sie während einer Besprechung von einem Bombenabwurf überrascht wurde und im Sitzungssaal die Glasfront zerbarst. Sie dachte dabei: «Oh Gott, nicht bei einer sterbenslangweiligen Sitzung sterben.» Sie berichtet auch von psychovegetativen Reaktionen ihrerseits, die aber rasch abklangen. Im Juni 1996 wurde sie dann erstmals in ihrer Laufbahn zur Versorgung eines Kollegen gerufen, der von einer Patrouille mehrfach angeschossen worden war. Zu dieser Zeit hatte sie mit ihrem neuen Partner eine intime Beziehung aufgenommen und stellte ihre eigene Lebensplanung in Frage (bei der Organisation bleiben, weggehen, heiraten?). Der verletzte Kollege habe an einer unbehandelten PTSD gelitten und deshalb in einer heiklen Situation fehlreagiert, überlebte aber die Verletzungen. Bei ihr tauchten hier erstmals Ängste vor Verstümmelungen auf und der Gedanke: «Ja, das kann auch uns (Helfern) passieren.» Verstärkt wurde diese Erkenntnis durch eine zeitgleiche Meldung aus Burundi über drei getötete Mitarbeiter, von denen sie einen gut kannte. In der Folge dieses Ereignisses blieb die Patientin zunächst ruhig, distanziert und ging wie geplant in die Ferien. Zur Auslösung des PTSD-Syndroms kam es dann Anfang September 1996 in Grosny. Die Patientin wurde nach ihrem Urlaub in Tschetschenien eingesetzt. Bereits am Ankunftstag wurde sie zu einem Verletzten gerufen, der versehentlich beim Waffenreinigen angeschossen wurde. Während der Wundversorgung hatte die Patientin ein dissoziatives Erlebnis: Sie sah sich selbst (von außerhalb ihres Körpers) handeln und sah sich gleichzeitig in der Situation des Juni ’96 in Afghanistan. Die nachfolgenden Verrichtungen seien «wie in Kabul» gewesen. Ihr ging durch den Kopf: «Soll das mein Job sein?» Der Tod sei plötzlich sehr nahe gewesen, als ob sie ihn anziehen würde. Die Patientin fühlte sich stark verunsichert. Ein starker Sturm begann, Glasscheiben zerbrachen, alle Mitarbeiter sprangen auf (wie in Kabul während der oben erwähnten Sitzung: splitterndes Glas, erschreckte Menschen, Klang von Detonationen), und die Patientin konnte sich in der Folge nicht mehr beruhigen. Die Situation wurde für sie unkontrollierbar. Sie hatte Fluchtgedanken und beschloss sehr energisch und rational: «Ich will nicht sterben, ich gehe morgen sobald als möglich weg und ich schlafe heute Nacht nicht.» Auf einer visuellen Analogskala [von 0 (entspannt, funktionstüchtig) bis 10 (max. Anspannung, arbeitsunfähig)] schätzte sich die Patientin nachträglich für diese Situation in Grosny an diesem Abend bei >10 ein. [Bearb]; Dornblüth, Otto [Begr.]: Klinisches Wörterbuch, 255. Aufl. Berlin, New York: de Gruyter, 1986. S. 1701. Seite 87 Falldarstellung Sie kehrte nach Hause zurück. Besonders belastend in der Folge erlebte die Patientin dissoziative und paranoide Phänomene. Sie fühlte sich von Passanten bedroht, wollte ein Baby im Kinderwagen «vor Bomben retten». Sie wurde für einige Wochen unter der Diagnose einer PTSD stationär psychiatrisch behandelt. Mit einer Tagesdosis von 200 mg Melleril®253 (Thioridazin) versuchte man vor allem die Schlafstörungen zu lindern. Nach einer Selbsteinschätzung hat sich die allgemeine Anspannung im Laufe der Hospitalisation um etwa ein Drittel gesenkt. Die aufrechterhaltenden Bedingungen umfassen einerseits die konsequente Vermeidung aller Stimuli, die an Tod, Lärm und Szenen wie in Ruanda, Afghanistan und Tschetschenien erinnern könnten. Die Patientin zog sich andererseits von Mitmenschen zurück und litt unter den oben beschriebenen Symptomen einer PTSD. Zugleich (Übergeneralisierung, war sie in Katastrophisierung, dysfunktionalen All-Aussagen Denkstrukturen und gefangen Schwarzweißdenken). Besonders relevant scheinen die Schlafstörungen zu sein, die einerseits Teil des Syndroms sind, andererseits aber auch durch den inneren Entschluss «ich gehe nicht schlafen» aufrechterhalten werden, da schlafen von der Patientin assoziiert wird mit: bewegungslos, ausgeliefert, schutzlos; laufen hingegen stellte in der besagten Nacht in Grosny den Beweis der Lebendigkeit dar. 9.4 Behandlungsplan Die Patientin nahm an einer kognitiv-behavioralen Psychotherapie teil, die innerhalb von 2 Wochen mit 9 Terminen über 20 Therapiestunden durchgeführt wurde. Die Methode richtete sich nach dem Manual «Cognitive Restructuring and Prolonged Exposure» [FOA et al., 1994]254. Die Therapie diente zur Reduktion der affektiven und behavioralen Symptome der PTSD. Die Therapie gliederte sich in folgende Einzelteile: Exposition in sensu und kognitive Restrukturierung nach FOA (Therapierationale und Programmablauf erläutern, psychoedukative Ergänzungen zur PTSD, Anleitung zur Protokollierung dysfunktionaler Kognitionen, Tonbandaufnahmen der Exposition erklären und als Hausaufgaben mitgeben, sechs Expositionen in sensu zu je 50 Minuten, begleitende kognitive Restrukturierung), Erarbeitung einer Hierarchie aktuell vermiedener Tätigkeiten und Exposition in vivo (soweit vertretbar), Beratung zur Schlafhygiene, Beendigung der Medikation und schließlich Exploration weiterer Problemfelder. 9.4.1 Therapieverlauf Die Patientin war sehr kooperativ und wollte am liebsten sofort mit der Therapie beginnen. Sie war differenziert, bezüglich PTSD gut geschult, wie sie auch betonte. Sie schätzte es 253 Melleril®: Psychopharmaka aus der Gruppe der Neuroleptika, wirkt schwach antipsychotisch, gut wirksam gegen Angst- und Spannungszuständen. Quelle: LAUX, Gerd: Pharmakopsychiatrie. Unter Mitarb. von O. DIETMAIER und W. KÖNIG; Stuttgart, New York: G. Fischer, 1992. S. 267 254 FOA E. B., HEARST-IKEDA D. E., DANCU C. V., HEMBREE E., JAYCOX L. H.: Cognitive Restructuring and Prolonged Exposure (CR/PE) Manual. Medical College of Pennsylvania and Hahnemann University at Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute, revised November 1994. Seite 88 Falldarstellung sehr, in diskursive Wortkämpfe zu geraten. Sie habe Mühe, sich etwas sagen zu lassen. Dem Therapeuten fiel einerseits eine recht «bodenständige» Seite der Patientin auf, andererseits auch der große innere Leidensdruck. Das hervorstechendste Merkmal ihrer Persönlichkeit war eine starke Leistungsorientierung, der Wunsch, möglichst überall perfekt zu sein. Die Patientin reflektierte ihr Handeln und Denken häufig auf einer anspruchsvollen Metaebene, nannte es selbst «psychologisierend» und konnte trotzdem kritische Anregungen im Gespräch annehmen. Der erste Termin stand im Zeichen der gegenseitigen Information: von Seiten des Therapeuten bezüglich der angebotenen Therapiestrategie, von Seiten der Patientin zu ihren Erwartungen und Beschwerden. So konnte einerseits ein Therapievertrag geschlossen, andererseits die Diagnose kritisch evaluiert werden. Bereits jetzt wurde mit ihr die Schwierigkeit einer Expositionsbehandlung unter einer täglichen Einnahme von 200 mg Melleril besprochen, und sie war von sich aus bereit, ab sofort nur noch 100 mg zum Schlafen einzunehmen. Beim zweiten Termin 6 Tage später (dazwischen lag ein Wochenende) konnte mit der eigentlichen Exposition begonnen werden. Dabei war eindrücklich, dass die Patientin zu Beginn auf einer visuellen Analogskala ein vierfach höheres Angstniveau angab als während der Exposition und 45 Minuten danach. «Spitzen» (hot spots) gab es keine. Am folgenden Tag dauerte die Exposition 50 Minuten und erreichte gegen Ende den Wert von «knapp 100» (auf einer Skala von 0 bis 100). Dabei stand als Thema zunächst die «auslösende» Situation in Tschetschenien im Mittelpunkt. Als die Patientin sich jedoch an den konkreten Beginn der PTSD-Symptome erinnerte, kamen zusätzlich Bilder aus Kabul und Burundi (wo sie zur Zeit des oben erwähnten Angriffs nicht war). Diese Exposition soll beispielhaft näher geschildert werden: Nach einleitender Entspannung beginnt die Patientin vom Flughafen im Heimatort zu sprechen, schildert den «ungewohnten» Luxus eines Business-Class-Fluges via Moskau in eine Nachbarrepublik Tschetscheniens. Sie imaginiert Gespräche mit Kollegen am Vorabend ihrer Fahrt nach Grosny. Auf der Fahrt fällt ihr auf, dass diese Landschaft so ganz anders aussieht als Afghanistan, das Ausmaß der Zerstörung sei jedoch wie in Kabul. Die erste Nacht verläuft unruhig, die Patientin hört Schüsse, Hundegebell und wird dadurch auf unangenehme Weise erneut an Kabul erinnert. Der nächste Tag beginnt mit Einarbeitung. Am folgenden Tag wird die Patientin über Funk verständigt, sie solle einen Verletzten versorgen. «Aha, schon wieder», denkt sie. Sie schildert diese Situation und wie sie sich gleichzeitig nach Kabul zurückversetzt erlebt. An dieser Stelle geraten verschiedene Szenen «durcheinander», einmal Grosny, dann auch Kabul, zudem von dritter Seite gehörte Erzählungen aus Burundi und eine Beerdigungsszene einer Kollegin in der Heimat. Am Ende steht die Erinnerung an den Abend des gleichen Tages in Grosny, als ein starker Sturm Scherben bersten lässt, Schüsse in der Ferne erklingen und die Patientin sich nicht mehr beruhigen kann. Fluchtgedanken treten auf, die Lage wird von ihr unkontrollierbar erlebt, sie «beschließt», nicht sterben zu wollen. Schon am nächsten Tag klang die «Geschichte» aus Tschetschenien deutlich geordneter und löste eine maximale Angstspannung von 40 aus. Melleril konnte an diesem Tag gestoppt werden. In der nächsten Nacht trank die Patientin vermehrt Bier, um sicher einzuschlafen. Dieses Verhalten konnte gut in seinem funktionalen Zusammenhang Seite 89 Falldarstellung diskutiert werden und wiederholte sich nicht. Am Ende dieser Sitzung brach die Patientin von sich aus nach 40 Minuten ab, sie könne nicht mehr: «Es reicht mir heute», meinte sie. Sie war zu dieser Zeit auf einem Niveau von 50, nachdem die Sitzung bei 20 begonnen hatte. Sie beschrieb dabei auf die Frage, wann sie den größten Kontrollverlust erlebt habe, eine Sitzung in Kabul, während der als Folge eines Bombenangriffs große Scheiben zerbrachen. Am selben Abend sei dann auch eine Nachricht über getötete Mitarbeiter in Burundi eingetroffen, die eine tiefe Betroffenheit auslöste. Am nächsten Therapietag verweigerte sie die Exposition vollständig. Nach dem nächsten Wochenende hatte sich der Zustand jedoch weiter verbessert. Die Patientin berichtete von einer ersten gut durchgeschlafenen Nacht seit Grosny! Sie hatte auch eine Vernissage von Freunden besucht und fühlte allgemein ein wiedererwachendes Selbstvertrauen. Während der Exposition (Bilder aus Ruanda, Kabul und Tschetschenien) überschritt die innere Anspannung nie den subjektiven Wert von 15, sondern lag meist bei 0. In der letzten Sitzung kam keine innere Spannung mehr zustande, am Ende drängten sich Alltagsbilder in die Imagination. Die Patientin meinte, was bisher wie ein Film vor ihr abgelaufen sei, habe sich nun zu Diapositiven verändert, die einzeln vor ihr auftauchten, so als rutschten sie einzeln durch den Projektor. Am Ende der Therapie wurden mit der Patientin allgemeine Maßnahmen zur Angstbewältigung besprochen (vergleichbar denen bei der Therapie einer agoraphoben Störung). Die kognitive Therapie fokussierte auf «Alles-oder-Nichts-Denken» («Entweder ist man ein Einheimischer, dann besteht Lebensgefahr, oder man ist eine Helferin, dann geschieht einem schon nichts»), Übergeneralisierung («Alle dunkelhäutigen Menschen sind brutale Mörder!»), absolut formulierte Aussagen mit «nie, immer, müssen» («Ich hätte meine Aufgaben nie im Stich lassen dürfen!») und Katastrophisierungen («Ich werde nie wieder so gesund, wie ich einmal war»). Mit der Patientin wurden gedankliche Alternativen gesucht, die dysfunktionale Überzeugungen relativieren konnten. Sie wurde aufgefordert, im Sinn einer Realitätsprüfung, den Grad der Wahrscheinlichkeit der automatischen Befürchtungen einzuschätzen. Bedrohlich erlebte Alltagssituationen wurden gedanklich antizipiert, und verhaltensnahe Pläne zur Bewältigung wurden aufgestellt. Zu diesem Zweck wurden Tagesprotokolle zur Identifizierung dysfunktionaler Gedanken und zur Entwicklung rationaler Antworten hierauf geführt. Neben edukativen Erklärungen und dem sokratischen Dialog wurde die Patientin auch zu einer funktionalen Einschätzung der eigenen Bewältigungskompetenz angehalten. Zusammenfassungen am Schluss der Therapiesitzungen durch die Patientin selbst ermöglichten einerseits, weiterbestehende dysfunktionale Kognitionen zu erkennen, andererseits konnte die Patientin so in ihren eigenen Worten den «therapeutischen Inhalt» wiedergeben. 9.4.2 Katamnese (abschließender Krankheitsbericht) Im Gespräch nach 4 Wochen erklärte die Patientin, dass sich der Zustand weiter stabilisiert habe. Der Schlaf sei ungestört, sie fühle sich ausgeglichen und plane ihre weitere berufliche und private Zukunft optimistisch. Nach einer subjektiven Einschätzung hatten sich die PTSD-Symptome vollständig zurückgebildet. In einem Kontakt mit einem Vorgesetzten traten anlässlich eines Berichts ihrerseits über den Krankheitsverlauf erneut ängstlichSeite 90 Falldarstellung vermeidende Tendenzen auf. Diese konnten jedoch im Sinn der oben genannten Therapiestrategie von der Patientin gut bewältigt werden. Nach 6 und 12 Monaten war der Zustand weiterhin stabil. 9.5 Diskussion Einerseits überraschte bei der beschriebenen Therapie, dass ein so rascher und deutlicher Erfolg mit Hilfe des strukturierten Manuals auch bei einer PTSD gelang, die durch eine andere Form des Traumas als Vergewaltigung oder andere Formen sexueller Gewalt ausgelöst worden war. Andererseits ist «Exposition» als Therapiestrategie bisher auch z. B. bei Vietnam-Veteranen, die – wie die Patientin – traumatisierende Kriegserlebnisse hatten, erfolgreich erprobt worden. Hilfreich war, dass es sich bei der Patientin um eine sehr differenzierte und gut vorinformierte Frau gehandelt hat. Die gute Patientin-TherapeutBeziehung, die sich relativ schnell aufbauen ließ, trug dazu bei, dass sich die Patientin auf die Imaginationen einlassen konnte. Sie akzeptierte von Anfang an die Expertenrolle des Therapeuten und hatte – wenn auch skeptische – optimistische Erwartungen bezüglich eines Therapieeffekts. Zu Beginn war unklar, welche der multiplen «Horrorszenen», die die Patientin in den vier Jahren erlebt hatte, die entscheidende Auslösesituation darstellte. Eine kumulative Belastung mit aufeianderfolgenden Belastungsreaktionen (eventuell auch in Form einer ängstlich agitierten Depression) schien denkbar. Bei der Auswahl «der Bilder» diente der Hinweis von E. B. FOA als Wegleitung: Das, was die Patientin als traumatisierend erlebte, wird zunächst als relevante Information genutzt. Anders formuliert: Die gemiedenen diskriminativen Hinweisreize stellen die signifikanten – und damit zu exponierenden – Stimuli dar. Außerdem zeigte sich rasch, dass die Bedrohungssituation in Afghanistan von den vielen vergleichbaren zuvor doch deutlich unterschieden war. Erstmals wurde die Patientin mit einer konkreten Verletzung der körperlichen Integrität bei einem Berufskollegen konfrontiert, gleichzeitig erhielt sie die Nachricht, dass ein guter Bekannter in Burundi gewaltsam zu Tode gekommen war. Diese Erlebnisse fanden vor dem Hintergrund einer kritischen Lebensphase statt: Die Patientin hatte sich neu verliebt, dachte über Ehe und Kinder nach, reflektierte in diesem Zusammenhang ihren Beruf kritisch. Sie wurde schwanger und entschloss sich gemeinsam mit ihrem Partner zu einer – für sie zweiten – Schwangerschaftsunterbrechung. Somit kann von einer besonders vulnerablen affektiven Grundstimmung ausgegangen werden. In der kognitiven Restrukturierung wurden die dysfunktionalen Schemata bezüglich der Welt («Alles ist schlecht und gefährlich») und bezüglich des eigenen Selbst («Ich bin inkompetent») in ihren individuellen Ausgestaltungen modifiziert. Besonders auffällig in diesem Zusammenhang war die Gewohnheit der Patientin, auch emotional extrem belastende Ereignisse (Bombenangriffe, Todesfälle, Geiselnahme) mit «neutralen» Begriffen zu benennen (unangenehm, unpraktisch, ungeschickt). Die Patientin diskutierte aktiv Einwände von seiten des Therapeuten und war bald in der Lage, Veränderungen ihrer Haltung und ihrer automatischen Gedanken sich selbst zu attribuieren. Die dabei auftauchenden weiteren Problemkreise (Kinder bekommen, Beziehung zum aktuellen Seite 91 Falldarstellung Partner und zu den Eltern, Berufswahl) konnten problematisiert, strukturiert und beurteilt werden. Am Ende der PTSD-Therapie zeigte sich kein Bedarf bezüglich einer weitergehenden therapeutischen Bearbeitung dieser Problemfelder. Besonderen Raum in den Gesprächen nahmen immer wieder Reflexionen zum Therapieziel ein. Auch wenn primär eine Reduktion der Symptomatik angestrebt wurde, so stellte sich doch die Frage, inwieweit es ethisch vertretbar sei, die Patientin für Kriegsgebiete mit realer Lebensgefahr «fit zu machen». Eine Rückkehr zu den Einsatzgebieten war für die Patientin zunächst unvorstellbar; sie wollte vor allem wieder «normal» leben können. Erst mit zunehmender Besserung konnte sie sich entspannt und realistisch alternativen Berufsplänen widmen. In der Literatur werden einige Faktoren genannt, die prognostisch günstig für die Therapie sind [McFARLANE, 1988]255. In diesem Fallbeispiel war z. B. vorteilhaft, dass prämorbide256 psychopathologische Auffälligkeiten fehlten. Die Patientin litt an keinen komorbiden psychischen Störungen257, auch die Familienanamnese war bezüglich psychischer Erkrankungen unauffällig. Auch die Tatsache, dass das Intervall zwischen Beginn der PTSD und Anfang der Psychotherapie kurz war, erwies sich als vorteilhaft. Darüber hinaus handelte es sich um eine motivierte und verbal differenzierte Patientin mit einer bislang guten Lebensbewährung. Der Verlauf dieser kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlung entspricht einem durchschnittlichen Therapieerfolg, wie er bei durch Vergewaltigungen traumatisierten Frauen erreicht wird, die von E. B. FOA und ihren Mitarbeiterinnen nach dem von ihr veröffentlichten Manual [FOA et al., 1994]258 therapiert werden. Eine Symptomreduktion von etwa 60–70 % und eine weitere Stabilisierung im anschließenden Intervall bis zur Katamnese nach 3 bzw. 6 Monaten werden berichtet [ROTHBAUM und FOA, 1992]259. 255 MCFARLANE A. C.: „The longitudinal course of posttraumatic morbidity. The range of outcomes and their predictors“, J. Nerv. Ment. Dis. 1988,176; 30–39. 256 „Prämorbidiät [zu —> prä... u. —> Morbus] w; -: Gesamtheit der Krankheitserscheinungen, die sich bereits vor dem eigentlichen Ausbruch einer Krankheit manifestieren (bes. bei Psychopathien)“. Quelle: DUDEN: Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke. hrsg. u. bearb. von d. Red. Naturwiss. u. Medizin d. Bibliograph.; 3., vollst, überarb. u. erg. Aufl.; Mannheim, Wien, Zürich: Bibliographisches Institut; Stuttgart: Thieme, 1979. 257 Komorbide psychische Störungen: Sind Krankheiten, die in Begleitung einer anderen auftreten. „Das PTSD zeigt eine beträchtliche Komorbidität mit affektiven Störungen, anderen Angststörungen, Substanzmissbrauch und Somatisierungen.“ Es treten gehäuft auf: Ehe- u. Familienprobleme, gewalttätiges Verhalten, starkes Rauchen. Zitat und Quelle: EHLERS, Anke: Posttraumatische Belastungsstörung, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, 1999. S. 10 258 FOA E. B., HEARST-IKEDA D. E., DANCU C. V., HEMBREE E., JAYCOX L. H.: Cognitive Restructuring and Prolonged Exposure (CR/PE) Manual. Medical College of Penn-sylvania and Hahnemann University at Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute, revised November 1994. 259 ROTHBAUM B.O., FOA E.B.: „Exposure therapy for rape victims with post-traumatic stress disorder“, Behav. Therapist 1992,15; 219–222. Seite 92 Klassifikationssysteme 10 Zusammenfassung Stress Stress wird definiert als unspezifische Reaktion des Körpers auf jegliche Anforderung, der er ausgesetzt wird. ‘Stressor’ ist der Auslöser, der diese unspezifische Reaktion (nach SEYLE) herbeiführt. Innerhalb dieser Arbeit wird für ‘Stressor’ folgende Definition gewählt: Ein ‘Stressor’ ist eine Umweltbedingung, die eine Stressreaktion auslöst. Es wird zwischen ‘Eustress’ und ‘Distress’ unterschieden. Eustress bezeichnet im Großen und Ganzen erwünschte Auswirkungen eines Stressors. Dies wird auch als angenehm erlebt. Distress beschreibt im Wesentlichen unangenehme Erlebnisse und führt zu Leistungsminderung. Für das Erleben des Stress’ und seine Auswirkungen auf den Organismus ist auch die gedankliche Verarbeitung des Stressors sehr wesentlich. Es laufen zwei kognitive Bewertungsprozesse ab: Die Primärbewertung ergibt eine Beurteilung der Situation, ob eine Beeinträchtigung entstehen könnte. In der Sekundärbewertung wird abgeschätzt, ob die Bewältigungsressourcen ausreichen. Resultieren aus beiden Bewertungsprozesse ein negative Ergebnisse, bewirkt das Ereignis eine Stressreaktion. Stressablauf Das Stressgeschehen läuft nach einem Schema ab: Zuerst erfolgt die Alarmreaktion, in seiner heftigsten Form auch ‘Notfall-Reaktion’ genannt. In der weiteren Folge geht der Organismus in die Widerstand-Phase über. In diesem Bereich normalisiert sich der Organismus, bleibt aber in Alarmbereitschaft. Sollte der Stressor noch aufrecht bleiben, kommt es zur Phase der Erschöpfung. Posttraumatic Stress Disorder Menschen können besonders schwere Belastungen erleben, wie z. B. schwere Verletzungen, Bedrohung des eigenen Lebens, Vergewaltigung oder Naturkatastrophen, die Hab und Gut zerstören. Diese Ereignisse können zu den ‘normalen’ Stressreaktionen auch noch länger anhaltende, psychische Beeinträchtigungen nach sich ziehen. Noch nach Monaten bzw. Jahren können sich betroffene Personen lebhaft an das belastende Ereignis erinnern, werden von Albträumen geplagt und Gedächtnisstörungen erschweren das Alltagsleben. Diese psychische Beeinträchtigungen ‘Posttraumatische Belastungsstörung’ engl. werden mit dem Begriff ‘Posttraumatic Stress Disorder’ (PTSD) zusammengefasst. Entwicklung des Begriffes ‘PTSD’ Krankheitssymptome, die nach belastenden Ereignissen auftraten, wurden schon immer von Menschen erlebt. Sie wurden auch in der Literatur beschrieben, aber früher noch nicht als ‘PTSD’ klassifiziert. Man dachte damals, diese Krankheitssymptome würden irgendwie physisch durch das Ereignis ausgelöst, z. B. indem Bombensplitter in den Körper gelangten Seite 93 Klassifikationssysteme und so die Psyche irritierten. Erst spät, 1980, wurde das PTSD als psychische Störung in eine Klassifikation der psychischen Störungen aufgenommen. Es wurde damals erstmals in einer gesellschaftlich akzeptierten Form dokumentiert, dass die psychischen Symptome als direkte Folge der akuten schweren Belastung oder des kontinuierlichen Traumas eintreten. Im Anhang werden Kopien der derzeit gültigen Definitionen angeführt. Primäre u. sekundäre Traumatisierung Nicht nur jene Menschen, die das schrecklichen Ereignis selbst erleben mussten, d. h. selbst verletzt und beinahe getötet worden wären, können ein PTSD ausbilden, sondern auch die Helfer, wie Feuerwehrleute, Rot-Kreuz-Helfer, Sanitäter oder Krankenschwestern (sie sind nicht unmittelbar vom Ereignis betroffen). Deshalb wird zwischen einer ‘Primären’ und einer ‘Sekundären Traumatisierung’ unterschieden. Primär traumatisierte Menschen sind jene Personen, die selbst vom Ereignis getroffen wurden. Sekundär traumatisierte Menschen sind jene Personen, die irgendwie Zeuge des Ereignisses geworden sind. Dies sind meistens Helfer, die den in Not geratenen Menschen beistehen und sie retten bzw. heilen. Der Krieg, ein Ereignis mit besonders hoch traumatisierendem Potenzial für die gesamte Bevölkerung Der amerikanische Psychiater Richard F. MOLLICA erforschte neuerlich die psychischen Kriegsfolgen, revidierte die alte Anschauung ‘Krieg hätte eher weniger psychische Schäden an der Bevölkerung ausgelöst’ und kam zum Schluss, dass ein Krieg der gesamten Bevölkerung psychische Traumata in besonders hohem Maß zufügt und fast alle Bewohner des Kriegsgebietes mit psychischen Schäden belastet sind. Von diesem traumatisierenden Potenzial sind aber auch sehr stark die Helfer bedroht. Das Fallbeispiel stellt das Schicksal einer Krankenschwester des Roten Kreuzes im humanitären Hilfseinsatz in Tschetschenien dar, die wegen ihres PTSD aus dem Einsatz genommen wurde. Durch eine Psychotherapie konnte sie in der Heimat geheilt werden. Vorbeugende Maßnahmen gegen das PTSD Für die in zivilisierten Ländern lebenden Menschen gibt es zur Prävention gegen das PTSD eine Methode, das Critical Incident Stress Management. Es wurde von Jeffrey T. MITCHELL und George S. EVERLY, zwei US-Amerikanern, entwickelt. Es zielt vor allem auf die vorbeugende Abwehr des PTSD ab. Nach dem belastenden Ereignis werden mit den Helfern Einsatz-Nachbesprechungen in Gruppensitzungen durchgeführt. Therapie des PTSD Weil starke Angst das Wiedererleben des belastenden Ereignisses begleitet, werden sehr oft Tranquilizer angewendet. Diese Medikation hat aber eher ungünstige Effekte auf die Heilung des PTSD. Gute Heilungschancen liegen in den Antidepressiva. Hier sind vor allem die moderneren Formen, wie die selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRIs), wirksam. Seite 94 Klassifikationssysteme Psychotherapie Aus der Vielzahl von Therapieformen sticht mit besonderer Wirksamkeit die Verhaltenstherapie heraus. In Zusammenarbeit mit kognitiven Umstrukturierungen und Entspannungstechniken lässt sich das PTSD erfolgreich behandeln. Das Fallbeispiel im Anhang beschreibt eine gelungene Psychotherapie des PTSD. Klassifikation des PTSD Im Anhang wird die Klassifikation des PTSD dargestellt. Erst 1980 taucht das PTSD im DSM-III auf. Es wurde dann laufend angepasst und liegt nun in der Version IV vor. Parallel dazu ging die Entwicklung der Klassifikation des PTSD der World Health Organisation. Sie wird in der ICD-10 festgelegt. Seite 95 Klassifikationssysteme Anhang Seite 96 Klassifikationssysteme 11 Definition des PTSD nach internationalen Klassifikationssystemen 1889 wurde das erste einheitliche Klassifikationschema psychischer Störungen auf einem internationalen Kongress in Wien verabschiedet. Es war stark von KRAEPLINS Ansatz beeinflusst, jedoch kam es in der Praxis fast nie zum Einsatz. 1939 wurde die in der Medizin bereits gebräuchliche ‘International List of Causes of Death’ um eine Reihe psychiatrischer Krankheiten erweitert. 1948 wurde dann dieses Verzeichnis in seiner sechsten Auflage von der neugegründeten WHO zur International Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death erweitert (ICD-6), einschließlich einer Sektion V mit dem Titel Mental, Psychoneurotic and Personality Disorders. Diese Klassifikation fand, obwohl von der Konferenz einstimmig beschlossen, wenig Akzeptanz. Dies lag wohl vor allem daran, dass man sich an unterschiedlichen Modellen des ätiologischen Verständnisses psychischer Störungen orientierte. STENGEL (1959)260 schlug daher vor, operationale Definitionen zu entwickeln, die nicht auf einem bestimmten psychopathologischen Verständnis fußen. Des Weiteren ist der Versuch einer kategorialen Systematik nach klar voneinander abgrenzbaren Krankheitseinheiten zu Gunsten einer typologischen Systematik (Prototypenperspektive) aufgegeben worden (Mehrfachdiagnose möglich; nicht alle Diagnosekriterien müssen erfüllt sein; Kriterien sollen qualitativ gewichtet sein - weder in der ICD-10 noch im DSM-4; prototypische Merkmale sollen genannt werden).261 Das PTSD wird auch in den internationalen Klassifikationssystemen beschrieben. Es dient dazu, dass Fachleute aus verschiedenen Kulturkreisen ein und dasselbe Störungsbild auch einheitlich beschreiben. Dass dies trotz zweier, international anerkannter Manuale nicht so einfach ist, wird auf Seite 54 kurz dargestellt. Derzeit sind 2 Werke im Gebrauch: ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ der American Psychatric Association. ‘International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems’ (ICD10) der World Health Organisation. Beide Werke werden in den nachfolgenden Textteilen mit ihrer Klassifikation des PTSD kurz dargestellt. Obwohl schon Homer und Shakespeare in ihren Dichtungen um posttraumatischen Stress wussten, wurde dessen Existenz von der Psychiatrie erst seit 1980 allgemein anerkannt und als PTSD in das DSM III aufgenommen.262 260 keine näheren Angaben, zit. in http://www.uni-saarland.de/fak5/krause/kkol/dsmII5.htm. 261 Quelle: http://www.uni-saarland.de/fak5/krause/kkol/dsmII5.htm. 262 VAN DER KOLK, Bessel A.: http://traumatherapie.de/kolk.htm. Seite 97 Klassifikationssysteme 11.1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 11.2 Allgemeines zum DSM Name: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Abkürzung: DSM** Herausgeber: American Psychatric Association 11.2.1 Geschichte: 1. Auflage 1952 (der ‘Reaktionsbegriff’ von A. E. Meyer wird eingeführt) DSM-II und ICD-8 1968 (‘Neurosenbegriff’ wird eingeführt) DSM-III 1979 (‘Neurosenbegriff’ wird wieder aufgegeben) DSM-III-R und ICD-9 1986 (Annäherung von DSM und ICD) DSM-IV 1995 und ICD-10 1993 (ICD-Codes werden nun auch im DSM angegeben) 11.2.2 Merkmale Der DSM-IV ist ein diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen, es ist eine Diagnosenklassifikation der APA (American Psychiatric Association)263 Systematische Beschreibung (ohne Ätiologie) jeder Störung in folgenden Bereichen: Diagnostische Merkmale, Subtypen, und/oder Zusatzcodierungen, Codierungsregeln, zugehörige Merkmale Geschlechtsmerkmale, und Störungen, Prävalenz, besondere Verlauf, kulturelle, Familiäres Alters- und Verteilungsmuster, Differentialdiagnose. Das DSM zeigt eine multiaxiale Beurteilung in 5 Achsen: 1. Achse: alle psychischen Störungen (Ausnahmen: Persönlichkeitsstörungen, spezifische Entwicklungsstörungen) 2. Achse: Persönlichkeitsstörungen, spezifische Entwicklungsstörungen 3. Achse: alle körperlichen Störungen und Zustände 4. Achse: Schwere der psychosozialen und umweltbedingten Belastungsfaktoren 5. Achse: globale Beurteilung der sozialen und beruflichen Anpassung 263 http://www.uni-saarland.de/fak5/krause/kkol/dsmII4.htm. Seite 98 Klassifikationssysteme 11.3 Kriterien der Stress-Erscheinungen nach DMS III-R264 A) Die Person ist von einem Ereignis betroffen, das außerhalb der üblichen menschlichen Erfahrung liegt und das bei den meisten Menschen erhebliche Belastungssymptome hervorrufen würde, z. B. Bedrohung des eigenen Lebens, Miterleben von Situationen in denen die eigenen Kinder, der Ehepartner, Verwandte oder Freunde in Lebensgefahr sind, Zerstörung des Heims und/oder Miterleben wie ein anderer Mensch verletzt oder getötet wird. B) Das traumatische Ereignis wird ständig wiedererlebt auf mindestens eine der folgenden Weisen: Wiederkehrende eindringliche und belastende Erinnerungen an das Ereignis (bei Kindern auch spielerisches Wiederholen der traumatischen Situation). Wiederholte und belastende Träume von dem Ereignis. Plötzliches Handeln oder das Gefühl, als ob sich das traumatische Ereignis gerade wiederholt (schließt Illusionen, Halluzinationen und "flash backs" ein, auch solche, die beim Erwachen oder bei Intoxikation auftreten). Erhebliche psychische Belastungen, wenn die Person Ereignissen ausgesetzt ist, die die traumatische Situation symbolisieren oder ihr in bestimmten Aspekten gleichen, einschließlich Jahrestage des traumatischen Ereignisses. C) Ständiges Vermeiden von Stimuli, die in irgendeiner Weise mit dem Trauma zusammenhängen oder Einengung der Reagibilität und verminderte Beteiligung an der äußeren Welt (nicht vorhanden vor dem Trauma), was sich in mindestens drei der folgenden Symptome zeigt: Das Bemühen, mit dem Trauma zusammenhängende Gedanken und Gefühle zu vermeiden. Das Bemühen, Aktivitäten und Situationen zu vermeiden, die an das Trauma erinnern. Unfähigkeit, sich an bestimmte Aspekte des Traumas in Erinnerung zu rufen (psychogene Amnesie). Deutlich vermindertes Interesse an persönlich bedeutsamen Aktivitäten. Gefühl der Lösung oder Entfremdung von anderen. Eingeschränkter Affekt. 264 Quelle: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordes. Third Edition, Revised. Washington, D. C., American Psychiatric Association, 1987 (dt. Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störunge: DSM III R. Weinheim: Beltz, 1989. Seite 99 Klassifikationssysteme Gefühl einer verkürzten persönlichen Zukunft, z. B. eine berufliche Karriere, Heirat, langes Leben sind für den Betroffenen nicht vorstellbar. D) Anzeichen eines gesteigerten Arousal (vor dem Trauma nicht vorhanden), nachgewiesen durch mindestens zwei der folgenden Symptome: Einschlaf- und Durchschlafstörungen. gesteigerte Irritabilität oder Wutausbrüche. Konzentrationsstörungen. gesteigerte Wachsamkeit. gesteigerte Schreckreaktion. starke physiologische Reaktionen, wenn die Person Situationen ausgesetzt wird, die dem Ereignis gleichen oder es symbolisieren. (z. B. bekommt ein Betroffener Schweißausbrüche beim Betreten eines Fahrstuhls, wenn er vorher in einem Fahrstuhl überfallen wurde. E) Dauer der Störung (Symptome der Gruppen B,C,D ) für mindestens einen Monat. Ein verzögerter Typus der PTSD liegt dann vor, wenn die Symptome frühestens sechs Monate nach dem Trauma auftreten. 11.4 DMS-IV 11.4.1 Einfaches PTSD (DSM IV)265 A. 1. Lebensbedrohliches Erlebnis, gefolgt von 2. intensiver subjektiver Not. B. Wiedererleben des Traumas: 1. wiederkehrende eindringliche Erinnerungen oder Wiederholung im Spiel; 2. wiederkehrende Albträume; 3. plötzliches Verhalten oder Empfinden, als ob das traumatische Ereignis sich wiederholen würde; 4. intensive seelische Not, bedingt durch die wiederholte Konfrontation mit Ereignissen, die an das Trauma erinnern; 5. physiologische Reaktionen bei erneuter Konfrontation. 265 SCHUBBE. O.: Institut für Traumtherapie, EMDRIA Deutschland e.V. Am Siebrassenhof 70, D- 33605 Bielefeld. Zusammengestellt 5/95 und aktualisiert 10/96: Quelle: VAN DER KOLK Bessel A. van der Kolk, M.D, http://traumatherapie.de/pgkolk1.htm. Seite 100 Klassifikationssysteme C. Anhaltendes Vermeidungsverhalten oder Betäubtsein der allgemeinen Ansprechbarkeit: 1. angestrengtes Vermeiden von mit dem Trauma verbundenen Gedanken oder Gefühlen; 2. angestrengtes Vermeiden von Aktivitäten; 3. psychogene Amnesie; 4. vermindertes Interesse an vormals wichtigen Aktivitäten; 5. Gefühle von Distanziertheit und der Entfremdung; 6. Gefühl einer verstellten Zukunft. D. Anhaltende Symptome erhöhter Erregbarkeit: 1. Ein- und/oder Durchschlafstörungen; 2. Gereiztheit oder Wutausbrüche; 3. Konzentrationsschwierigkeiten; 4. Überwachsamkeit; 5. übermäßige Schreckhaftigkeit. 11.4.2 Kompliziertes PTSD Zur Erweiterung des Begriffes PTSD wird noch eine weitere, schwerere Form beschrieben. Dies wird aber nur als Vorschlag der PTSD-Gutachterkommission beschrieben. VAN DER KOLK meint dazu: „Angesichts der Tatsache, daß Traumata in frühem Alter tiefgreifende Auswirkungen auf die Affektregulation und Bewusstseinszustände haben und Einfluss darauf nehmen, wie Erfahrungen auf der somatischen Ebene organisiert werden und wie die Persönlichkeit sich an das chronische Erleben von Gefahr und Furcht anpaßt, hat die PTSDGutachterkommission im Rahmen der Vorbereitung von DSM IV eine erweiterte Definition von PTSD empfohlen. Bislang hat nur das ICD-10 (das internationale Diagnosenglossar der WHO), aber noch nicht die DSM-Klassifizierung die anhaltenden Folgen von Traumata auf alle Persönlichkeitsfunktionen eines Menschen anerkannt. Nachfolgende Aufstellung zeigt die einzelnen Elemente der für das DSM IV vorgeschlagenen Definition von ‘Schwerem PTSD’.“266 Die Definition des komplizierten PTSD267 1. Beeinträchtigte Regulation von Affekten und Impulsen: 266 VAN DER KOLK; Bessel, A.: http://traumatherapie.de/pgkolk2.htm. 267 Quelle: http://traumatherapie.de/pgkolk2.htm; Content & Design Schubbe 1994, letzte Änderung am 22.05.00. Seite 101 Klassifikationssysteme a. Affektregulation b. Modulation von Zorn c. Selbstzerstörung d. Suizidgedanken e. Schwierigkeit, sexuelle Aktivität zu modulieren f. exzessives Risikoverhalten 2. Aufmerksamkeitsstörungen oder Bewusstseinstrübungen: a. Amnesie b. vorübergehende dissoziative Episoden und Depersonalisation 3. Somatisierungen: a. Verdauungsstörungen b. chronische Schmerzen c. kardiopulmonäre Symptome d. Konversionssymptome e. gestörte Sexualität 4. Störungen der Selbstwahrnehmung: a. Hilflosigkeit b. permanenter Schaden c. Schuld und Verantwortlichkeit d. Scham e. Gefühl des Unverstandenseins f. Herabsetzung der eigenen Person 5. Gestörte Wahrnehmung des Angreifers: a. Übernahme verdrehter Ansichten b. Idealisierung des Angreifers c. exzessive Beschäftigung mit Rachephantasien 6. Gestörte Beziehungen zur Umwelt: a. Unfähigkeit zu vertrauen b. Wieder zum Opfer werden c. Andere zu Opfern machen 7. Gestörte Motivation und Orientierung: a. Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit b. Verlust früherer persönlichkeitsstabilisierender Überzeugungen Seite 102 Klassifikationssysteme Quelle: http://traumatherapie.de/pgkolk2.htm; Content & Design Schubbe 1994, letzte Änderung am 22.05.00 11.5 Das Klassifikationssystem ICD10 11.5.1 Internationale Klassifikation der Krankheiten 10. Revision Die Abkürzung ICD steht für "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems"; die Zahl 10 bezeichnet die 10. Revision. Diese Klassifikation wurde von der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation) erstellt und vom Deutschen Institut für übertragen. Medizinische 268 Dokumentation und Information (DIMDI) ins Deutsche Die nachfolgenden Texte sind eine Kopie der SYSTEMATIK ONLINE, SGB- V-Ausgabe V2.0, des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information, Waisenhausgasse 36 - 38 a, D-50676 Köln269 Kernklassifikation der ICD-10 ist der dreistellige Schlüssel, der für die internationalen Meldungen der Todesursachendaten an die WHO, sowie für allgemeine internationale Vergleiche, verbindlich ist. Die vierstelligen Subkategorien sind zwar für die Berichterstattung auf internationaler Ebene nicht verbindlich, werden jedoch für viele Anwendungszwecke empfohlen und sind ebenso wie die "Sonderverzeichnisse zur Tabellierung der Mortalität und Morbidität" ein integraler Bestandteil der ICD. 11.5.2 Die Beschreibung des Störungsbildes im ICD10 F43.- Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen: Die Zahl ‘F43’ ist innerhalb der ICD ein Index für die Kapitel-Nummerierung und ihre Untergliederung: ‘F’ wird das Kapitel V ‘Psychische und Verhaltensstörungen’ benannt. Die zweite Indexzahl läuft von 00 bis 99. Die hier vorliegende Indexzahl von 43 ordnet die Symptome in die Unterkapitel ‘Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen’ ein (F40 - F48). (Anmerkung der Verfasserin) Der nachfolgende Text ist eine Kopie des DIMDI. Die Störungen dieses Abschnittes unterscheiden sich von den übrigen nicht nur aufgrund der Symptomatologie und des Verlaufs, sondern auch durch die Angabe von ein oder zwei ursächlichen Faktoren: ein außergewöhnlich belastendes Lebensereignis, das eine akute Belastungsreaktion hervorruft, oder eine besondere Veränderung im Leben, die zu einer 268 Das DIMDI ist im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben für die Herausgabe deutschsprachiger Fassungen amtlicher Klassifikationen im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit zuständig. Dazu gehören die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD-9, ICD-10), der Operationenschlüssel nach Paragraph 301 Sozialgesetzbuch V (OPS-301) und die Nomenklatur für Medizinprodukte (UMDNS). Darüberhinaus erstellt DIMDI die deutsche Übersetzung des Thesaurus Medical Subject Headings (MeSH), der jährlich aktualisiert wird. Quelle: http://www.dimdi.de. 269 http://www.dimdi.de/germ/klassi/icd10/htmlsgbv20/fr-icd.htm. Seite 103 Klassifikationssysteme anhaltend unangenehmen Situation geführt hat und eine Anpassungsstörung hervorruft. Obwohl weniger schwere psychosoziale Belastungen ("life events") den Beginn und das Erscheinungsbild auch zahlreicher anderer Störungen dieses Kapitels auslösen und beeinflussen können, ist ihre ätiologische Bedeutung doch nicht immer ganz klar. In jedem Fall hängt sie zusammen mit der individuellen, häufig idiosynkratischen Vulnerabilität 270, das heißt, die Lebensereignisse sind weder notwendig noch ausreichend, um das Auftreten und die Art der Krankheit zu erklären. Im Gegensatz dazu entstehen die hier aufgeführten Störungen immer als direkte Folge der akuten schweren Belastung oder des kontinuierlichen Traumas. Das belastende Ereignis oder die andauernden, unangenehmen Umstände sind primäre und ausschlaggebende Kausalfaktoren, und die Störung wäre ohne ihre Einwirkung nicht entstanden. Die Störungen dieses Abschnittes können insofern als Anpassungsstörungen bei schwerer oder kontinuierlicher Belastung angesehen werden, als sie erfolgreiche Bewältigungsstrategien behindern und aus diesem Grunde zu Problemen der sozialen Funktionsfähigkeit führen. F43.0 Akute Belastungsreaktion: Eine vorübergehende Störung, die sich bei einem psychisch nicht manifest gestörten Menschen als Reaktion auf eine außergewöhnliche physische oder psychische Belastung entwickelt, und die im allgemeinen innerhalb von Stunden oder Tagen abklingt. Die individuelle Vulnerabilität und die zur Verfügung stehenden Bewältigungsmechanismen (Coping-Strategien) spielen bei Auftreten und Schweregrad der akuten Belastungsreaktionen eine Rolle. Die Symptomatik zeigt typischerweise ein gemischtes und wechselndes Bild, beginnend mit einer Art von "Betäubung", mit einer gewissen Bewusstseinseinengung und eingeschränkter Aufmerksamkeit, einer Unfähigkeit, Reize zu verarbeiten und Desorientiertheit. Diesem Zustand kann ein weiteres Sichzurückziehen aus der Umweltsituation folgen (bis hin zu dissoziativem Stupor, siehe F44.2) oder aber ein Unruhezustand und Überaktivität (wie Fluchtreaktion oder Fugue). Vegetative Zeichen panischer Angst wie Tachykardie, Schwitzen und Erröten treten zumeist auf. Die Symptome erscheinen im allgemeinen innerhalb von Minuten nach dem belastenden Ereignis und gehen innerhalb von zwei oder drei Tagen, oft innerhalb von Stunden zurück. Teilweise oder vollständige Amnesie (siehe F44.0) bezüglich dieser Episode kann vorkommen. Wenn die Symptome andauern, sollte eine Änderung der Diagnose in Erwägung gezogen werden. Akut: Belastungsreaktion Krisenreaktion Kriegsneurose Krisenzustand Psychischer Schock F43.1 Posttraumatische Belastungsstörung: 270 Vulnerabilität: Verwundbarkeit, Verletzbarkeit. Quelle: DUDEN: Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke. hrsg. u. bearb. von d. Red. Naturwiss. u. Medizin d. Bibliograph.; 3., vollst, überarb. u. erg. Aufl.; Mannheim, Wien, Zürich: Bibliographisches Institut; Stuttgart: Thieme, 1979. S. 737. Seite 104 Klassifikationssysteme Diese entsteht als eine verzögerte oder protrahierte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Prädisponierende Faktoren wie bestimmte, z. B. zwanghafte oder asthenische Persönlichkeitszüge oder neurotische Krankheiten in der Vorgeschichte können die Schwelle für die Entwicklung dieses Syndroms senken und seinen Verlauf erschweren, aber die letztgenannten Faktoren sind weder notwendig noch ausreichend, um das Auftreten der Störung zu erklären. Typische Merkmale sind das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen (Nachhallerinnerungen, Flashbacks), Träumen oder Albträumen, die vor dem Hintergrund eines andauernden Gefühls von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit auftreten. Ferner finden sich Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, Teilnahmslosigkeit der Umgebung gegenüber, Freudlosigkeit sowie Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten. Meist tritt ein Zustand von vegetativer Übererregtheit mit Vigilanzsteigerung, einer übermäßigen Schreckhaftigkeit und Schlafstörung auf. Angst und Depression sind häufig mit den genannten Symptomen und Merkmalen assoziiert und Suizidgedanken sind nicht selten. Der Beginn folgt dem Trauma mit einer Latenz, die wenige Wochen bis Monate dauern kann. Der Verlauf ist wechselhaft, in der Mehrzahl der Fälle kann jedoch eine Heilung erwartet werden. In wenigen Fällen nimmt die Störung über viele Jahre einen chronischen Verlauf und geht dann in eine andauernde Persönlichkeitsänderung (F62.0) über. In diese Kategorie wird die Traumatische Neurose eingeordnet. F43.2 Anpassungsstörungen: Hierbei handelt es sich um Zustände von subjektiver Bedrängnis und emotionaler Beeinträchtigung, die im allgemeinen soziale Funktionen und Leistungen behindern und während des Anpassungsprozesses nach einer entscheidenden Lebensveränderung oder nach belastenden Lebensereignissen auftreten. Die Belastung kann das soziale Netz des Betroffenen beschädigt haben (wie bei einem Trauerfall oder Trennungserlebnissen) oder das weitere Umfeld sozialer Unterstützung oder soziale Werte (wie bei Emigration oder nach Flucht). Sie kann auch in einem größeren Entwicklungsschritt oder einer Krise bestehen (wie Schulbesuch, Elternschaft, Misserfolg, Erreichen eines ersehnten Zieles und Ruhestand). Die individuelle Prädisposition271 oder Vulnerabilität spielt bei dem möglichen Auftreten und bei der Form der Anpassungsstörung eine bedeutsame Rolle; es ist aber dennoch davon auszugehen, dass das Krankheitsbild ohne die Belastung nicht entstanden wäre. Die Anzeichen sind unterschiedlich und umfassen depressive Stimmung, Angst oder Sorge (oder eine Mischung von diesen). Außerdem kann ein Gefühl bestehen, mit den alltäglichen Gegebenheiten nicht zurechtzukommen, diese nicht vorausplanen oder fortsetzen zu können. Störungen des Sozialverhaltens können insbesondere bei Jugendlichen ein zusätzliches Symptom sein. 271 Prädisposition: besonders ausgeprägte Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten. Quelle: DUDEN: Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke. hrsg. u. bearb. von d. Red. Naturwiss. u. Medizin d. Bibliograph.; 3., vollst, überarb. u. erg. Aufl.; Mannheim, Wien, Zürich: Bibliographisches Institut; Stuttgart: Thieme, 1979. S. 566. Seite 105 Klassifikationssysteme Hervorstechendes Merkmal kann eine kurze oder längere depressive Reaktion oder eine Störung anderer Gefühle und des Sozialverhaltens sein. In dieser Kategorie ist auch Hospitalismus272 bei Kindern, Kulturschock, Trauerreaktion anzusiedeln F43.8 Sonstige Reaktionen auf schwere Belastung F43.9 Reaktion auf schwere Belastung, nicht näher bezeichnet 272 Hospitalismus: „Sammelbez. für alle körperlichen und seelischen Veränderungen, die ein längerer Krankenhaus- oder Heimaufenthalt (bes. bei Kindern) mit sich bringt.“ Quelle: DUDEN: Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke. hrsg. u. bearb. von d. Red. Naturwiss. u. Medizin d. Bibliograph.; 3., vollst, überarb. u. erg. Aufl.; Mannheim, Wien, Zürich: Bibliographisches Institut; Stuttgart: Thieme, 1979. S. 331. Seite 106 Klassifikationssysteme Seite 107