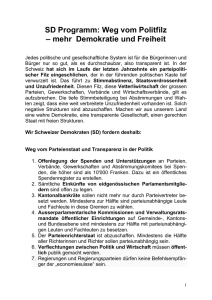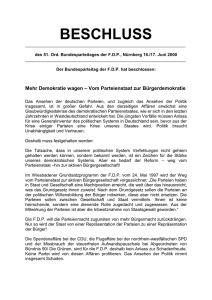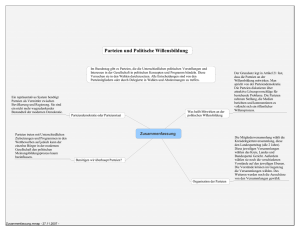Der Parteienstaat in Deutschland - Bundeszentrale für politische
Werbung

Everhard Holtmann Der Parteienstaat in Deutschland Erklärungen, Entwicklungen, Erscheinungsbilder Everhard Holtmann Der Parteienstaat in Deutschland Schriftenreihe Band 10100 Everhard Holtmann Der Parteienstaat in Deutschland Erklärungen, Entwicklungen, Erscheinungsbilder Professor Everhard Holtmann lehrte bis 2012 Systemanalyse und Vergleichende ­Politik an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Von 2007 bis 2012 war er Sprecher des DFG-Sonderforschungsbereiches 580 (Gesellschaftliche Entwicklungen nach dem Systemumbruch). Seit Oktober 2012 ist er Forschungsdirektor am Zentrum für Sozialforschung Halle e. V. (ZSH). Bonn 2017 2., überarbeitete und erweiterte Auflage ©Bundeszentrale für politische Bildung / bpb Adenauerallee 86, 53113 Bonn Redak­tion: Hildegard Bremer, bpb Lektorat: Eik Welker, Münster Diese Veröffent­lichung stellt keine Meinungs­äußerung der Bundeszentrale für politische Bildung dar. Für die inhalt­lichen Aussagen trägt der Autor die Verantwor­tung. Hinweis: Die Inhalte der im Text und Anhang zitierten Internet-Links unter­liegen der Verantwortung der jeweiligen Anbieter/-innen. Für eventuelle Schäden und Forderungen können die bpb und der Autor keine Haftung übernehmen. Umschlagfoto: © picture alliance / Robert B. Fishman Umschlaggestaltung, Satzherstellung und Layout: Naumilkat – Agentur für Kommunikation und Design, Düsseldorf Druck: Druck- und Verlagshaus Zarbock GmbH & Co. KG, Frankfurt / Main ISBN: 978-3-7425-0100-4 www.bpb.de Inhalt Einführung Ist der Parteienstaat ein Auslaufmodell? Krisenzeichen in Vergangenheit und Gegenwart 13 I.Erklärungen Parteien als Ausdruck sozialen Wandels und als Agenten ­gesellschaftlicher Konflikte 41 1 Ist alles schon einmal da gewesen? Historische Pfadabhängigkeiten41 2 Parteien und Gesellschaft: Eine besondere Beziehung 50 3 »Prinzipal« und »Agent«: Parteien als politische Handlungsbevollmächtigte51 4 Sozialer Wandel und Parteienentwicklung: Brüche und gleitende Übergänge 53 5 »Eingefrorene« Parteiensysteme: Die struktur­bildenden Wirkungen langlebiger gesellschaftlicher Konf liktlinien 55 6 Von der Bewegung zur Partei: Ein typisches Stufen­modell politischer Organisation 57 7 »Protest« als Ferment für Parteigründung 60 8 Nicht mehr selbstverständlich: Der parlamentarische Vertretungsvorrang der Parteipolitik 64 9 Parteien und Staat: Eine politische Vernunftehe 67 10 Deutungsmuster von Parteienfeindlichkeit 68 11 Der Demokratiemangel demokratischer Eliten­herrschaft 71 12 Handeln unter Bedingungen von Ungewissheit: Alte Probleme des heutigen Parteienstaates 74 5 Inhalt II.Entwicklungen Entwicklungsphasen und Typologien des d ­ eutschen Parteiensystems von den Anfängen bis heute 77 1 Typologische Unterscheidung von Parteien Sinn und Zweck der Typenbildung Klassische Typenbildungen – Honoratiorenpartei, Massenintegra­t ionspartei, Allerweltspartei Neuestes Produkt der Typenbildung – die Kartellpartei Die Vertrauenskrise der etablierten Parteiensysteme in Europa und der Aufstieg alternativer Parteitypen Die »runderneuerte« Volkspartei – eine zukunftsfähige Perspektive? 2 Fünf-Phasen-Folge der Parteienentwicklung in Deutschland 77 77 79 81 83 86 87 3 Entfaltung des Parteiwesens im Zeichen der Parlamen­tarisierung: Die erste Entwicklungsphase bis 1918 90 4 Polarisiertes Parteiensystem mit systemfeindlichen Flügelparteien: Die zweite Entwicklungsphase bis 1933 91 5 Demokratische Neugründung vor Traditionshorizonten und die Vorherrschaft der Volksparteien: Die dritte Entwicklungsphase von 1945 bis 1970 Die Union als Pionierin der Volkspartei Die vorübergehende Bedeutung kleiner Interessenparteien Die CSU als bayerische Hegemonialpartei Der Weg zur sozialdemokratischen Volkspartei Konzentrationsprozesse im deutschen Parteiensystem 94 97 98 101 102 104 6 Wertewandel und Neue Soziale Bewegungen: Die vierte Entwicklungsphase der 1980er-Jahre 113 7 Die Zäsur der deutschen Einigung: Die fünfte Entwicklungsphase seit 1990 118 Auf bruch aus dem SED-Einparteienregime in ein demokratisches Parteiensystem – Bürgerbewegung, Blockparteien, neue Parteien 119 Die Sonderrolle der PDS in der formativen Phase des ostdeutschen Parteiensystems 125 6 Inhalt Ostdeutsche Prägungen des gesamtdeutschen Parteiensystems Annäherung und Eigenheit – Ostdeutschland im gegenwärtigen ­Parteienstaat der Bundesrepublik Gesellschaftliche Konf liktlinien im Ost-West-Feld des Parteien­ systems Der Abstieg der Volksparteien – ein unheilbares Krisensymptom des Parteienstaates? Strukturmuster der Gegenwart – ein »f luides« Sechsparteiensystem 8 Piratenpartei und Alternative für Deutschland (Af D): Zwei gegensätzliche Erscheinungsformen des Typus Protestpartei »Äpfel und Birnen« in einem Korb? – eine klärende Vorbemerkung Was ist eine Protestpartei? – Versuch einer schlanken Definition Protest als gesellschaftliche Grundstimmung Rational oder rechtspopulistisch? – die soziale und ideologische Spreizung politischer Proteststimmungen Die Piraten – eine rationale Protestpartei Die Alternative für Deutschland (Af D) – eine rechtspopulistische Protestpartei Piraten und Alternative für Deutschland – doppelter Test für die Integrationsfähigkeit des deutschen Parteiensystems 127 130 136 143 149 152 152 152 154 156 160 164 169 III.Erscheinungsbilder Die Mühen der Tiefebene: Parteiarbeit zwischen Aufgabenerfüllung und populärer Kritik 173 1 Parteienverdruss: Ein chronisches Krankheitsbild deutscher politischer Kultur 173 173 173 175 178 Politikverdrossenheit – Beschreibung einer Gefühlslage Vertrauen als ein Grundwert politischer Kultur Schlusslicht beim Institutionenvertrauen – die Parteien Parteienferne – ein versachlichtes Erbe deutscher Tradition Parteienferne und »unpolitische« Kommunalpolitik – eine h ­ istorische Liaison 181 7 Inhalt Starker Staat und Sehnsucht nach Gemeinschaft – alte deutsche ­A nfälligkeiten Das Janusgesicht der deutschen politischen Kultur 2 Vom Fremdkörper zum Sprachrohr des Volkswillens: Der Parteienstaat in der Theorie Wegweisend, aber eine Fehlkonstruktion – ­ die Parteienstaats­theorie von Gerhard Leibholz Neuerer Erklärungsansatz mittlerer Reichweite – die Kartellpartei-These 184 189 192 192 196 3 Überdehntes Verfassungsprivileg? Die Rechtsstellung politischer Parteien197 Ermöglichende und beschränkende Vorgaben von Parteienrecht 197 Festigung, Eingrenzung, partielle Entmachtung – drei ­Entwicklungs­phasen des Parteienrechts Parteienverbot in der wehrhaften Demokratie Kodex des Parteienprivilegs – das Parteiengesetz Kommunale Institutionenreformen – Neues Steuerungsmodell, ­d irekte Demokratie und die Aushöhlung des repräsentativen Prinzips 4 Parteienfinanzierung: Kosten der Demokratie Der gespaltene Prinzipal – Spender und Steuerzahler Kein demokratischer Parteienstaat zum Nulltarif Tauziehen zwischen Gesetzgeber und Verfassungsgericht Weggabelungen auf dem Pfad der Parteienfinanzierung Die Einnahmen der Bundestagsparteien 5 Ohnmacht der Basis, abgehobene Führung? Schein und Wirklichkeit der »politischen Klasse« 198 200 202 204 207 207 209 210 211 214 217 217 Die »politische Klasse« im Sprachgebrauch Eliten in den Augen der Bevölkerung – bedeutsam, aber für 218 viele entbehrlich Ein »ehernes Gesetz der Oligarchie«? 221 Politiker als »verschwisterte Rivalen« – Befunde der empirischen Elitenforschung 222 8 Inhalt Den Wählern und dem Land verpf lichtet – das Repräsentations­verständnis der politischen Elite Von Mitgliedern und Parteiführung bevorzugt – eine effiziente ­Parteiorganisation Geringer Vertrauensbonus der Bevölkerung, stabile Vertrauensachsen in den Parteien Abgekoppelte untere Schichten – das Risiko einer neuen ­ inner­parteilichen Ungleichheit 6 Bei Anruf Job? Ämterpatronage 227 229 232 233 Der politische Charakter von Verwaltung 236 236 239 240 243 Das Spannungsverhältnis zwischen der Politisierung und den hergebrachten Grundsätzen des Berufs­beamtentums 244 Der politische Beamte – eine Anomalie im Rechtsstaat? Zum R ­ ollenkonf likt von Korrektheit und Loyalität 245 Parteibonus nicht ohne fachliche Eignung – Reichweite und Grenzen von Amtspatronage 247 Motivlagen – Machtkontrolle und Belohnung Protektion ist schwer zu fassen – die Tarnkappe des Patrons Austausch von Spitzenpositionen nach Regierungswechseln 7 Konkurrenz und Koexistenz: Parteien und parteifreie Wählergemeinschaften im kommunalen Feld Vorteile und Mühen der dezentralen Ebene 251 251 Parteien in der Kommunalpolitik – eine nicht standesgemäße ­Verbindung? 253 Kennzeichnend für Kommunalwahlen – Doppelherrschaft von ­Ortsparteien und kommunalen Wählergemeinschaften (KWG) 254 Gründungsmotiv für Wählergemeinschaften – »Sachpolitik, nicht Parteipolitik« 256 Organisation und soziales Profil kommunaler Wählergemeinschaften Einstellungen parteifreier Mandatsträger zur Kommunalpolitik 259 260 Auf dem Weg zu Programmparteien – Themenschwerpunkte von KWGs 261 9 Inhalt Bewegung im lokalen Parteiensystem – Institutionenreform, ­gesellschaftliche Polarisierung und ein neuer Lokalismus 8 Navigatoren im Mehrebenensystem: Parteien und ­ Parteipolitiker als Schlüsselakteure des Regierens Wandel der Parteienfunktionen im Fortgang der politischen Theorie Partikularinteressen und Gemeinwohl – die soziale Ausgleichsfunktion von Parteien Steuerungsaufgaben im Feld des Regierens Wandel der Staatstätigkeit – Wandel von Parteifunktionen Dezentrale Problemlösungen und wechselnde Arenen – Parteien im deutschen Bundesstaat Blockierer oder Blockadebrecher – die Rolle der Parteien im »­verf lochtenen« Föderalismus 9 Verlieren die Parteien das Volk? Zum Verhältnis von Parteienstaat und Bürgergesellschaft Absetzbewegungen in Parteivolk und Volk Die Beziehung zwischen Prinzipal und Agent – nicht rettungslos ­zerrüttet Von bürgerschaftlichem Engagement zur Parteiarbeit – ein eher ­seltener Brückenschlag Soziales Kapital von Bürgern – Anreiz oder Bremse für politische Beteiligung? Zivilgesellschaftliche Vorlieben für direkte Demokratie Abgekoppelte Unterschicht – eine unerwünschte Nebenfolge der direkten Demokratie Risiken für das vorhandene Institutionensystem 263 269 269 271 272 273 275 278 281 281 283 284 286 288 290 293 Ausblick Auf dem Weg in den defekten Parteienstaat? 10 295 Inhalt Anmerkungen 305 Abbildungen und Tabellen 335 Literatur 337 11 Einführung Ist der Parteienstaat ein Auslaufmodell? Krisenzeichen in Vergangenheit und Gegenwart Der Parteienstaat steht unter Stress Der demokratische Parteienstaat der Bundesrepublik Deutschland ist in­­ zwischen bald 70 Jahre alt. Dabei ist der zeitliche Vorlauf des zentralstaats­ losen Interims zwischen 1945 und 1949, als nur Länder und Gemeinden als Gebietskörperschaften existierten, noch nicht eingerechnet, gleichwohl es in dieser Zeit auch politische Parteien gab. Obwohl er in der ­politischen Landschaft allgegenwärtig ist und obschon in der ­ A lltagssprache die Bezeichnung »Parteienstaat« mit großer Selbstverständlich­keit verwendet wird, ist es um das öffentliche Ansehen der Parteipolitik in der Gegenwart, wie häufig auch schon in der Vergangenheit, nicht zum Besten bestellt. Tatsächlich durchlebt der deutsche Parteienstaat in den letzten Jahren den wohl ernstesten öffentlichen Belastungstest seit Gründung der Bundesrepublik. An die stereotyp wiederkehrenden verbalen Ausfälle gegen das »Parteienkartell« und gegen die als eine Gemeinschaft professioneller Wiederholungstäter abgestempelte »politische Klasse« hatte man sich fast schon gewöhnt. Neu ist, dass im Namen einer Idee bürgerschaftlicher Beteiligung, nach der die direkte Aktion fordernder Protestbürger als die authentische Ausdrucksform partizipatorischer Demokratie verstanden wird, nicht mehr nur die Parteien abgekanzelt werden, sondern nun auch der Vorrang der Parlamente infrage gestellt wird. Im Konf likt um das Bahnprojekt »Stuttgart 21« etwa wurde vorgeführt, wie eine Landesregierung nebst ihrer parlamentarischen Mehrheit heutzutage in ein »Mediationsverfahren« genötigt werden kann, um eine rechtsstaatlich korrekt zustande gekommene Entscheidung im Nachhinein gegenüber einer Protestallianz zu rechtfertigen, deren Betroffenheit zwar legitim ist, deren Änderungsbegehren aber keinen einer Parlamentsbefugnis vergleichbar repräsentativen Rang beanspruchen kann. Dass selbst die Sprecher ausnahmslos aller Bundestagsparteien in den Chor derer mit einstimmten, die den Stuttgar13 Einführung ter Mediationsmarathon als »Prototyp« neuer demokra­t ischer Kultur feierten, wirft ein Schlaglicht auf die Vertrauenskrise, die die ­parteienstaatlich gesteuerte parlamentarische Demokratie derzeit durchmacht. Auch die Demonstrierenden, die sich hinter dem Banner von Pegida, einer seitens führender Personen der Af D sekundierten Protestbewegung empörter Bürger, seit Oktober 2014 in Dresden und andernorts versammeln, pf legen eine grundsätzliche Distanz zum ­repräsentativen System. Immerwährende Vorzüge der repräsentativen Demokratie Grundsätzlich ist und bleibt der demokratische Parteienstaat die angemessene Ausdrucks- und Vermittlungsform für zivilgesellschaftliche Mitsprache, sobald diese den Anspruch erhebt, allgemein verbindliche politische Entscheidungen herbeizuführen oder zu korrigieren. Parteipolitik und Parteienstaatlichkeit sind durch Formen von Versammlungsdemokratie nicht ersetzbar. Dies begründet sich aus den öffentlichen Aufgaben der Parteien im politischen System. Dem Verfassungsverständnis des Grundgesetzes zufolge bündeln Parteien vielfältige Interessen der Bürger in der Gesellschaft und vermitteln deren Erwartungen und Forderungen in die staatliche Sphäre hinein. Dabei besitzen Parteien kein Monopol auf politische Willensbildung. Neben ihnen haben andere, nicht parteiförmig verfasste Aktivitäten, Bürgerinitiativen etwa, und volksunmittelbare Entscheidungsverfahren wie Volksbegehren und Volksentscheide ihren rechtlich verbrieften Platz. Doch nur Parteien gewährleisten dank ihrer dauerhaften Organisation die Stetigkeit eines programmgeleiteten politischen Willens, die für jede vorausschauende Politik notwendig ist. Und nur Parteien sind aufgrund ihrer – häufig als Funktionärsbetrieb geschmähten – inneren Entscheidungsabläufe imstande, unterschiedliche Interessenlagen abzuwägen und dabei auch die Belange schwacher Mitglieder der Gesellschaft zu berücksichtigen. Mit dem Begriff »Parteienstaat« verbindet sich daher in des Wortes positiver Bedeutung die Vorstellung, dass politische Parteien in modernen Demokratien eine zentrale Rolle spielen. Bei der Organisation des Volkswillens und seiner Übertragung in die Sphäre des Staatswillens übernehmen sie eine Schlüsselfunktion. Ferner fällt ihnen als »Parteien im Parlament« die Aufgabe zu, die Umsetzung gesetzgebender Entscheidungen in Regierungs- und Verwaltungshandeln zu überwachen und selbst öffentliche Mitverantwortung für diese Entscheidungen zu übernehmen.1 Soweit den Parteien überantwortet, erfolgt solche Herrschaftskontrolle nicht volksunmittelbar, sondern wird an gewählte Vertreter übertragen, die 14 Einführung kraft allgemeiner Wahlen legitimiert sind. Der demokratische P ­ arteienstaat gründet folglich im Prinzip politischer Repräsentation, und er gibt diesem Prinzip in Gestalt des Fraktionenparlaments des Bundestages und der Landtage sein zeitgemäßes Gesicht. An diesem Repräsentationsmodell wird ersichtlich, weshalb ­Vertreter von sozialen Protestbewegungen oder von sogenannten Nichtregierungsorganisationen (NRO – im Englischen: Nongovernmental Organization, NGO) nicht die gleiche demokratische Legitimation besitzen wie gewählte Vertreter der parteienstaatlich formierten parlamentarischen Demokratie. Der Unterschied wird am Verfahren der politischen Beteiligung anschaulich: Bei allgemeinen Wahlen (und ebenso bei direktdemokratischen Abstimmungen) ist das Wahlvolk formal bestimmt als Gesamtheit aller Wahlberechtigten. Zugleich ist diese Gesamtheit sozial nicht weiter verlesen: Das Recht zu wählen ist jedermanns verbrieftes Bürgerrecht, ohne Ansehen von Herkunft, Geburt, Besitz und Bildung. In der Ausübung dieses Allgemeinrechts äußert sich das Prinzip der Volkssouveränität. Bei bürgerschaftlichen Massenprotesten hingegen, wie bei den Demonstrationen gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 oder bei den Dresdener Massenauf läufen der Empörungsbewegten von Pegida 2 , sind die Bedingungen des Dabeiseins nicht an einen Nachweis formaler Berechtigung gebunden. Der soziale Aktionsradius ist nicht allgemein durch das landesweit zu Wahlen aufgerufene Volk definiert. Stattdessen variiert je nach Streitthema und »Tatort«, wer sich angesprochenen fühlt und teilnimmt. Zustande kommt eine Zufallsauswahl, deren soziale Zusammensetzung unausgewogener ist als bei allgemeinen Wahlen. Bei Stuttgart 21 waren es »vor allem die Akademiker, die demonstrieren: Die Hälfte der Befragten hat einen UniAbschluss«.3 In ähnlicher Weise war der Hamburger Volksentscheid gegen die von der gewählten Bürgerschaft einhellig verabschiedete Schulreform im Jahr 2010 ein plebiszitäres Projekt vornehmlich der gut situierten Mittelschichten. Auch unter den Dresdener Pegida-Demonstrierenden waren Teilnehmer mit Fachhochschul- bzw. Hochschulreife überrepräsentiert.4 Ein Entscheidungsrecht, das demjenigen eines gewählten Parlaments ebenbürtig wäre, kann ein solcher kollektiver Protest wegen des fehlenden formalen Mandats und mangels breiter gesellschaftlicher Repräsentation folglich nicht beanspruchen. 15 Einführung Strukturfragen und Moralfragen des Parteienstaates lassen sich schwer trennen In der Literatur sind die Grundlagen, Grundfragen und Grundprobleme des deutschen Parteienstaates ausführlich und sachkundig beschrieben worden. Die Darstellung der historischen Ursprünge und Verzweigungen deutscher Parteien und ihrer ideologischen Familien, der Partei­finanzen, der Parteiorganisation, des inneren Parteilebens und der Mitglieder- und Wählerprofile, der regionalen Hochburgen und Diasporagebiete, der Parteitypen und der Einordnung der Parteien auf der Links-rechts-Skala des Parteiensystems sowie der öffentlichen Funktionen von Parteien gehört mittlerweile zur Standardausstattung wissenschaftlich fundierter Überblickswerke.5 Mit den Schattenseiten des Parteienstaates, das heißt mit Vorgängen, bei denen Parteien und Parteipolitiker vor ihrer Aufgabe inhaltlich und moralisch versagen und dabei die Fundamente des Ansehens der Politik fortlaufend selbst untergraben, beschäftigen sich hingegen vorzugsweise die Massenmedien und publizistische Streitschriften.6 Der Erkenntnis förderlich ist diese unabgesprochene Arbeitsteilung zwischen Wissenschaft und parteienkritischer Publizistik nicht. Manche solide Darstellung des Parteiensystems kommt ohne systematische Berücksichtigung seiner Strukturprobleme aus. Es genügt jedoch nicht, die Struktur der Parteien und ihre Bedeutung für die Demokratie, ihre Funk­t ionen, ihre Anhänger und ihr Personal in einzelnen Kapiteln nacheinander abzuhandeln, ohne die strukturbedingten Schwachstellen der Parteipolitik mit in den Blick zu nehmen. Erst recht nicht analytisch befriedigend ist eine Sichtweise, die sich auf eine ausschließliche Verurteilung von fragwürdigen Praktiken des Parteienstaates beschränkt. Geht es bloß um eine Fehlermeldung in moralisierender Absicht, die »Postenschacher«, Selbstbereicherung und Machttrieb anklagt und dieses Skandalon für die Standardausstattung der Parteipolitik ausgibt, wird das Bild der Wirklichkeit auf besondere Weise verzerrt. Tatsächlich sind im Parteienstaat, so wie in anderen komplexen Gebilden auch, Strukturfragen und Moralfragen eng aufeinander bezogen. Treten Strukturkonf likte auf, so werden diese häufig an moralischen Maßstäben gemessen. Beispielhaft anschaulich wurde dies gleichfalls bei der Konf liktlage von Stuttgart 21, wo Tausende Versammelte ihr Eintreten für den Parkschutz als eine Form zivilen Widerstands zum Erhalt der Schöpfung sittlich begründeten. Dasselbe Beispiel zeigt klar: Die Wechselbeziehung zwischen den Strukturen des Parteienstaates und dem öffentlichen Werturteil über denselben tritt dann besonders deutlich zutage, wenn im 16 Einführung Verhältnis von Struktur und Moral krisenhafte Störungen auftreten. Verliert die Parteipolitik beispielsweise aufgrund eines auch nur angenommen schlechten Erscheinungsbildes des politischen ­Führungspersonals an Glaubwürdigkeit, sind ein sinkendes Vertrauen in die Institutionen des Parteienstaates, eine steigende Neigung zur Wahlenthaltung und Umschichtungen in den Wähleranteilen der Parteien die wahrscheinliche Folge. Ein politisch-kultureller Klimawandel übt Druck auf die politischen Strukturen aus. Umgekehrt kann eine Verschiebung der parteipolitischen Kräfteverhältnisse, wie sie im Ergebnis von »Erdrutschwahlen« eintritt, dazu führen, dass im umgeschichteten Parteienspektrum Grundsätze der politischen und sozialen Moral gegenüber »dem System« lauter und aggressiver eingefordert werden. Populistische Parteien, die in Zeiten anhaltender Politik(er)verdrossenheit häufig Auftrieb erhalten, werfen den »alten« Parteien nämlich vorzugsweise vor, in elementaren Gerechtigkeitsfragen zu versagen. In jüngster Zeit schlägt vor allem die Af D diesen Ton auf der Klaviatur ihrer öffentlichen Äußerungen an. Somit steht der Parteienstaat unter einer dauernden inneren ­Spannung. Ständig werden an die politisch verantwortlichen Stellen Forderungen herangetragen, mit denen konkrete Leistungsansprüche einhergehen. Werden diese Erwartungen nicht oder nur unzureichend erfüllt, sind Enttäuschung, Verweigerung, Protest oder auch Vertrauensverluste die Folge. Wird der Vertrauensentzug zum Dauerzustand, kann dies nicht nur zu Un­­zufriedenheit mit bestimmten Politikern und Parteien, sondern zur ge­­ nerellen Abwendung von »der Politik« führen oder Antisystemparteien bzw. Anti-Parteien-Parteien Auftrieb verschaffen. Wenn moralische Bedenken erhoben werden, wird Politik zwangsläufig personalisiert. Vieles (freilich nicht alles), was Politikerinnen und Politikern in der öffentlichen Meinung als persönliches moralisches Fehlverhalten angekreidet wird, erzeugt der Parteienstaat aber aus seinen Strukturen und Abläufen objektiv selbst. So führt beispielsweise an der Notwendigkeit, dass Parteipolitiker Kompromisslösungen vertraulich aushandeln, um Politikblockaden zu umschiffen, in einem demokratischen Regierungssystem kein Weg vorbei. Gleichwohl steht diese Verfahrensweise in der Öffentlichkeit stets unter dem Generalverdacht sachlich unzureichender Lösungen und unschicklicher »Kungelei«.7 Was objektiv notwendig ist, erscheint subjektiv verschuldet. Man sieht: Es liegt zumindest teilweise in der inneren Wirkungsweise des »arbeitenden« Parteienstaates begründet, wenn Parteien und Parteipolitikern vonseiten der Bürgerinnen und Bürger oder auch anderer Funktionseliten, etwa in Wirtschaft und Medien, Vertrauen entzogen und Unterstützung verweigert wird. 17 Einführung Der Parteienstaat – gleichermaßen ein System und ein ­Handlungszusammenhang Geboten ist es deshalb, bei der Darstellung des Parteienstaates analytisch einen Weg zu beschreiten, der es zulässt, die strukturelle und die mora­ lische Seite des Gegenstandes als zwei Seiten einer Beziehung zu verstehen, sie dennoch gesondert zu betrachten und dadurch in ein angemessenes Verhältnis zu bringen. Dies erklärt, weshalb aus sozialwissenschaftlicher Sicht der Parteienstaat als ein System und zugleich als ein Handlungszusammenhang von Akteuren im Einzugsbereich von Institutionen begriffen wird. Die Systemdimension lässt sich knapp wie folgt umreißen: Wie andere komplexe Systeme auch ist der Parteienstaat aus interdependenten, das heißt miteinander verbundenen Untersystemen zusammengesetzt. Er ist arbeitsteilig nach Rollen bzw. Systemfunktionen (z. B. der Aufnahme und Bündelung von Interessen) angeordnet und auf übergeordnete integrationsfähige Systemziele wie Freiheit, Sicherheit, soziale Gerechtigkeit hin ausgerichtet.8 Solche Basisideen ziehen dem System kulturelle Leitplanken ein, mit deren Hilfe die oben erwähnten Moralfragen im Sinne des Gemeinwohls geklärt werden. Ebenso stellt der Parteienstaat einen Handlungszusammenhang dar: Gegebene formale Institutionen (Verfassung, Gesetze, Verfassungsorgane) eröffnen den Akteuren (Bürgern, Wählern, Parteieliten) Handlungsspielräume und begrenzen diese zugleich. Parteien übernehmen in ­d iesem Spielfeld eine Doppelrolle: Aufgrund ihrer Eigenschaft als dauerhafte Organisation zählen sie zu den Institutionen. Gleichzeitig sind sie aber auch als Akteur aufgestellt, und zwar sowohl kollektiv als Gesamtpartei als auch individuell in Person einzelner Parteipolitikerinnen und -politiker. In der Arena der Politik bilden Parteipolitiker und Wahlvolk eine Akteursverbindung besonderer Art. Gewählte und Wähler sind voneinander abhängig. Politiker erhalten ihr Amt und Mandat durch demokra­t ische Wahlen, wobei die Möglichkeit bzw. das Risiko des Widerrufs dieses Votums bei folgenden Wahlen inbegriffen ist. Bürgerinnen und Bürger sind ihrerseits darauf angewiesen, die Ausübung der politischen Geschäfte an Personen ihres Vertrauens auf Zeit zu delegieren. Ein jederzeit aktiviertes Rückholrecht dieses Vertretungsauftrags durch ein ­selbsterklärtes »Volk«, das sich in zufälliger Zusammensetzung versammelt, ist in der repräsentativen Demokratie nicht vorgesehen. 18 Einführung Der Verfassungsrang von Parteienstaatlichkeit Jede ganzheitliche »Anatomie« des Parteienstaates muss ferner in Rechnung stellen, dass Parteien nicht nur in der Gesellschaft tätig sind, sondern, wie schon der Begriff Parteienstaat aussagt, zwingend auch in der Sphäre des Staates operieren, heute mehr als jemals zuvor. Faktisch rücken Parteien damit in den Status von Institutionen auf, die dem Staat anverwandt sind. In Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben nehmen Parteien quasistaatliche Eigenschaften an, ohne allerdings im Rechtssinne »staatlich« zu werden. Der real existierende Parteienstaat eignet sich also nicht etwa unzulässig Macht an, wenn er an den Schnittstellen von Gesellschaft und Staat vermittelt. Er erfüllt damit vielmehr öffentliche Aufgaben, die ihm im demokratischen Verfassungsverständnis zugewiesen worden sind. Der Bezug des Parteiensystems auf die Handlungsebene des ­Nationalstaates hat sich im Übrigen auch in den heutigen Zeiten der globalisierten Problemlagen und überstaatlichen Problemlösungen keineswegs überlebt, sodass der nationalstaatlichen Politik und Verwaltung nach wie vor wichtige Aufgaben übertragen bleiben. Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist der Parteienstaat als ein Rechtsgut ausdrücklich verankert. In der Folge hat die Staatsrechtslehre die positiv-rechtliche Begründung der Parteienstaatlichkeit fortentwickelt. Politische Parteien sind nach herrschender Lehre ein unverzichtbares »Begleitphänomen des demokratischen Verfassungsstaates«9. In Artikel 21, dem sogenannten Parteienprivileg, schreibt das ­Grundgesetz den herausgehobenen Status der Parteien als eine Verfassungsnorm fest. Damit sind in der Bundesrepublik Deutschland die Parteien »vom Rand der Illegalität oder Duldung in das Zentrum des Verfassungsrechts gerückt«10. In einer frühen Entscheidung stellte das Bundesverfassungsgericht hierzu fest: »Heute ist jede Demokratie zwangsläufig ein Parteienstaat.«11 In der Fachsprache werden denn auch die Bezeichnungen »Parteienstaat« und »Parteiendemokratie« häufig identisch verwandt.12 Parteienstaatlichkeit bildet im Übrigen ein universelles Strukturprinzip moderner repräsentativer Demokratien ab, das sich nach 1945 in weiten Teilen der Welt durchgesetzt hat. »Die europäische und die lateinamerikanische Verfassungstheorie zeigen sich durchaus des Umstandes bewusst, dass der Staat des 20. Jahrhunderts ein Parteienstaat ist und dass an die Stelle der Souveränität des Volkes praktisch die Souveränität der Parteien getreten ist.«13 Die faktisch beherrschende, funktional unabweisbare und rechtlich beglaubigte Stellung des Parteienelements im heutigen Staat ist mithin kein Alleinstellungsmerkmal der deutschen Bundes19 Einführung republik. Allenfalls seine besondere verfassungsrechtliche Absicherung im Grundgesetz stellt eine nationale Besonderheit dar. Antiparteienaffekte in deutscher Vergangenheit und ­Gegenwart Des ungeachtet hat gerade in Deutschland der Parteienstaat seit jeher einen »negativen Beigeschmack«14. Auch die nachholende verfassungsrechtliche Adelung durch das sogenannte Parteienprivileg in Artikel 21 GG hat diesen kulturellen Vorbehalt nicht ausgeräumt. Im Gegenteil: In den letzten Jahren hat sich der dem Parteienstaat zäh anhaftende Leumund eines selbstsüchtigen und machthungrigen Monopolisten in der öffentlichen Wahrnehmung eher wieder erhärtet. Jedoch ist der Antiparteienaffekt trotz aller historischen Vorbelastungen keine deutsche Besonderheit. Die Politikwissenschaftler Oscar W. Gabriel und Katja Neller verweisen zu Recht auf den Befund der international vergleichenden Einstellungsforschung, »dass parteienkritische Einstellungen zum Erscheinungsbild aller Demokratien des 20. und 21. Jahrhunderts gehören«15. Fest steht allerdings: Das Parteiwesen fand in Deutschland historisch erst relativ spät seine verfassungsrechtliche Anerkennung, nämlich im Gefolge der zweiten Demokratiegründung nach 1945. Erst danach wurde dem Parteienstaat der Status als institutioneller Handlungsrahmen des Politischen nicht mehr grundsätzlich bestritten. Älter als der anerkannte Parteienstaat selbst ist hierzulande jedenfalls seine ständige Begleiterin, die Parteienschelte. Die Gründe dafür liegen zum einen in der lange Zeit meinungsbildenden Kraft der klassischen deutschen Geisteskultur. Diese pf legte im Schatten des Obrigkeitsstaates des 19. und noch des ersten Fünftels des 20. Jahrhunderts ihr Bekenntnis zum Unpolitischen und verweigerte sich so entschieden der politischen Moderne. Aus dieser Sicht erschienen »Ge­­ sellschaft« und eben auch Parteien nicht als kulturwürdige Dinge, sondern als Fehlschöpfungen einer als »undeutsch« abzulehnenden »Zivilisation«.16 Dem »artfremden Parteigeist« wurde die Denkfigur des vermeintlich ganzheitlichen Volkes entgegengestellt. Das Modell pluralistischer Interessenvertretung hat darin keinen Platz. Neuerdings wird diese im Kern antidemokratische Denkfigur in der rechten Randzone des öffentlichen Diskurses von der völkischen »identitären« Bewegung wiederbelebt. Zum anderen hat der deutsche Parteienstaat schon in seinem frühen unfertigen Zustand jene Handlungsmuster hervorgebracht, die die zeitlosen Vorbehalte gegen ihn nähren. Ähnlich wie heute wurde auch schon in der Vergangenheit die strukturbedingte Handlungslogik der Parteipolitik, die sich beispielsweise in dem unter Wettbewerbsbedingungen ausgetrage20 Einführung nen Ringen um Machterwerb und Machterhalt ausdrückt, als »schmutziges Geschäft« denunziert. Und natürlich gab es von Anfang an eine Endlosschleife sich wiederholender Fälle von Politikversagen, Parteienfilz und persönlichem Fehlverhalten. Unter den historischen Randbedingungen des deutschen Obrigkeitsstaa­ tes und einer verbreitet »unpolitischen« Geisteshaltung seines Bildungs­ bürgertums gediehen die Vorbehalte gegen Parteipolitik prächtig. Allenfalls die Tonlage des Antiparteienaffekts variierte je nach Schichtzugehörigkeit. In den Salons der Wilhelminischen und ebenso noch der Weimarer Eliten wurde die Missachtung kulturalistisch überhöht, im sozialen Untergeschoss des Kleinbürgertums nistete sich antiparteiliches Denken als robustes Ressentiment ein. Tief sitzende Abneigung gegen Parteien ist folglich ein auch historisch gewachsener Teil der Wirklichkeit des deutschen Parteienstaates. Weil die objektiven Risiken des Politikversagens und die subjektive Versuchung zum moralischen Fehlverhalten in den Parteienstaat mit eingebaut sind und zudem in der Gegenwart über die modernen Medien ungleich schneller und detailgenauer vermittelt werden, überrascht es nicht wirklich, dass Antiparteienaffekte in der öffentlichen Meinung bis heute lebendig geblieben sind. Wahr ist auch: Viele Repräsentanten des Parteienstaates weben an dem Grauschleier des Vorurteils, der über ihnen liegt, eifrig mit. Fälle von Selbstbedienung und Kumpanei, von Filz, Korruption und Machtverliebtheit treten im Umfeld der politischen Elite der Republik mit unschöner Regelmäßigkeit auf (allerdings nicht nur hierzulande, wie etwa die im Mai 2009 im britischen Unterhaus massenhaft aufgedeckten Spesenskandale oder die Korruptionsaffären spanischer Provinzgranden zeigen). Wenn Parteipolitiker beispielsweise mit wichtiger Miene von der Bedeutung »unserer Gremien« reden, bedienen sie jedes Mal das populäre Klischee des verknöcherten Parteifunktionärs. Auch melden Vertreter der Parteien in staatlichen und staatsnahen Einrichtungen immer wieder einen überzogenen parteipolitischen Machtanspruch an (Parteipatronage nennt sich diese viel kritisierte Praxis). Dass mutwillige Selbstbeschädigungen des Parteienstaates ­gemeinsam mit Verfahrensweisen auftreten, die funktional begründet sind, aber gleichfalls kritisch bewertet werden, bleibt naturgemäß nicht ohne a­ bträgliche psychologische Folgen. Wird in repräsentativen Umfragen nach dem Vertrauen in öffentliche Institutionen gefragt, bilden Parteien regelmäßig das Schlusslicht. Im Korruptionsbarometer 2013 von Transparency International geben die Deutschen ihren Parteien die Note 3,8 (die 5 steht für »äußerst korrupt«) und damit den schlechtesten Wert aller befragten Ins21 Einführung titutionen.17 Dass Parteien nur auf die Stimmen der Wähler aus seien und nach Beendigung des Wahlkampfes schnell den Kontakt zum Volk wieder verlören – diese für Parteien wenig schmeichelhafte Einschätzung teilt spontan stets eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung.18 Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat die Parteienschelte in Deutschland einen neuen Wellenkamm erreicht. Die parteienkritischen akademischen Diskurse sind vielstimmiger geworden, und sie finden in wachsenden Teilen der Eliten des Landes, die jahrzehntelang loyal zum Parteienstaat gestanden haben, ein beifälliges Echo. Die Wahlbeteiligung ist im vergan­ genen Jahrzehnt auf allen drei Ebenen des deutschen Bundesstaates gesunken und erst ab 2013 wieder gestiegen. Im gleichen Zeitraum sind die Mitgliederzahlen der Parteien, zumal der Volksparteien, geschrumpft. Bevölkerungsumfragen registrieren eine schwindende Zuversicht in die Problemlösungskompetenz, die Parteien zugetraut wird, und wachsende Unzufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie. Das Vertrauen in Parteien und in Parteipolitiker verharrte bis zum Ausbruch der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise im Herbst 2008 auf demoskopischen Tiefständen, erholte sich jedoch danach moderat.19 Aus intellektuellen Kreisen heraus wird der landläufigen Parteienverdrossenheit gelegentlich mit bemerkenswerter Schärfe sekundiert.20 Am öffentlichen Abkanzeln des »ausufernden« Parteienstaates sind Wissenschaftler, auch Politikwissenschaftler, prominent beteiligt. Manche rhetorischen Ausfälle wecken ungute Erinnerungen an ein politisches Kampfvokabular, das sich zu Zeiten der Weimarer Republik für den demokratischen Parlamentarismus zerstörerisch ausgewirkt hat. Auch die Medien öffnen sich dieser verschärft parteienkritischen Grundstimmung. Hier fällt auf, dass grellen publizistischen Fanfarenstößen gegen »Wucherungen« des Parteienstaates als Refrain häufig Sirenenklänge folgen, die das hohe Lied der direkten Demokratie intonieren. Hört man genauer hin, so entpuppt sich das Werben für Plebiszite und das E ­ infordern eines unmittelbaren Entscheidungsrechts für »das Volk« allerdings häufig als ein nur anders verpacktes Misstrauensvotum gegen den ungeliebten politischen Vorrang von Parteien. Gefühltes Politikversagen und Vertrauensverlust in die ­Institution der Parteien Die gesteigerte Abneigung gegen Parteien lässt sich weder ausschließlich mit Nachwirkungen einer parteienfernen deutschen Tradition noch allein mit einer aktuell besonders dichten Häufung von Affären und Skanda22 Einführung len hinreichend erklären. Zur Begründung des Antiparteienaffekts reicht auch die Einschätzung nicht aus, dass parteipolitische Handlungsmuster als ­solche immer schwer vermittelbar sind. Als eine weitere, international ­verbreitete Ursache kommt gegenwärtig die extern, durch den Kollaps der ­weltweiten Finanzmärkte und den Staatsbankrott einzelner EU-Mitgliedsländer bedingte Schwäche der Performanz, das heißt der Leistungsbilanzen der politischen Systeme und der Regierungen hinzu. Waren schon vor den Ende 2008 aufziehenden Turbulenzen auf den Finanzmärkten die nationalstaatlichen Handlungsspielräume im Zuge der wirtschaftlichen Globalisierung generell verengt worden, so sind seit der jüngsten Weltwirtschaftskrise viele Staatshaushalte völlig aus den Fugen geraten. Mögen die astronomisch hohen Quoten der Staatsverschuldung auch für die meisten Bürger ein abstraktes Zahlenwerk bleiben – das Empfinden, dass die Lasten der Bankensanierung sozial höchst ungleich verteilt wurden, ist allgemein verbreitet und bleibt als ein gefühlter Beweis für Politikversagen im öffentlichen Gedächtnis haften. Wenn Politik überwiegend mit Leistungsversagen und Gerechtigkeitslücken gleichgesetzt wird, rührt ein solches negatives Meinungsklima am Nerv des Parteienstaates. In der oben eingeführten Begriff lichkeit ausgedrückt, heißt dies: Moralkrisen können sich zu Strukturkrisen der Parteiendemokratie ausweiten. Generalisiertes, also situations- und leistungsunabhängiges Vertrauen in Parteipolitik ist eine notwendige Bedingung für eine stabile Demokratie. Wenn die Gesellschaft ihren Politikern das Vertrauen auf kündigt, wird ein Risikofaktor aktiviert, der in die Mechanismen des Parteienstaates immer schon mit eingebaut ist. Unsere Annahme, dass sowohl Strukturmuster als auch Kulturmuster tragende Teile des Parteienstaates darstellen, die sich gegenseitig in guten Zeiten stützen und in Krisenzeiten destabilisieren können, lässt sich wie folgt veranschaulichen: Fehlende Handlungsfähigkeit des Parteienregimes führt zu sinkenden Vertrauenswerten. Geht in der Bevölkerung viel Vertrauen verloren, bauen sich umgekehrt höhere psychologische Hürden für die parteipolitischen Akteure auf, mit der Folge, dass deren politische Wirkungsmacht noch mehr eingeschränkt wird. Steigt oder fällt das Maß an Wertschätzung, das Parteien allgemein entgegengebracht wird, wächst oder schwindet auch die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich an Wahlen und zumal am Parteileben aktiv zu beteiligen. Um fortbestehen zu können, müssen demokratische Parteien jedoch neue Mitglieder und Anhänger rekrutieren. Ob die Chancen dafür kleiner oder größer werden, hängt wesentlich von einer parteienfreundlichen Grundstimmung in der Gesellschaft ab. Wie motiviert die bekennenden Anhänger welcher Partei 23 Einführung sind und wie sich die Wählergunst am Wahltag verteilt, e­ ntscheidet kurzfristig über Machtanteile im Parteiensystem. Wenn gefühlsmäßige Parteibindungen generell schwinden und das Lager der Nichtwähler stetig Zu­­ lauf erhält, hat dies langfristig einschneidende Folgen für Konstanz und Wandel des Parteiensystems. An einem solchen kritischen Punkt seiner Entwicklung scheint der deutsche Parteienstaat vielen Beobachtern zufolge inzwischen angelangt. Die Parteienforschung kommt nicht umhin, dem verbreiteten Stimmungsbild, das landläufig mit »Parteienverdrossenheit« umschrieben wird, Beachtung zu schenken. Sich mit diffusen antiparteilichen Stimmungsbildern wissenschaftlich auseinanderzusetzen, bedeutet aber gerade nicht, vorschnell eine Krise des Parteienstaates auszurufen. Im System des Parteienstaates ist Verdruss über Parteien und Politiker zunächst nur ein Oberf lächensignal. Es zeigt Reaktionen auf kritisierte politische Zustände und Vorgänge an, die zum Teil auf ein tadelnswertes Verhalten von Politikern hindeuten, aber ebenso in der Konstruktion und Funktionslogik des Parteienregimes als solchem begründet liegen können. Der historisch »verspätete« Parteienstaat als Teil des »deutschen Sonderweges« Der deutsche Parteienstaat hat, wie schon angedeutet, eine eigene Geschichte, in deren Verlauf sich das für jedes Parteiensystem kennzeichnende Spannungsverhältnis zwischen Strukturmustern und Kulturmustern in besonderer Weise ausgeformt und gewandelt hat. Der Entwicklungs­ pfad reicht hierzulande zurück bis zu den frühen Parteigründungen im 19. Jahrhundert. Der »verspätete« Parteienstaat war insofern Teil des historischen »deutschen Sonderweges«, als sich die demokratische Verfassungsordnung erst relativ spät durchgesetzt hat. Im Reichstag erhielten die Parteien zwar 1871 ihre parlamentarische Bühne. Sie übernahmen aber noch keine unmittelbare Regierungsverantwortung. Auch deshalb verharrten sie lange in einer Haltung doktrinärer Starre. Dieser doppelte Demokratierückstand im deutschen Parteiensystem ist erst nach 1945 aufgeholt worden. Erst ab 1949 wurde der Parteienstaat zu einer Verfassungsnorm und zugleich ein mit großer Selbstverständlichkeit praktiziertes Handlungsmuster der parlamentarischen Demokratie. Auch in der Gegenwart wird die historisch geformte Sonderentwicklung des deutschen Parteienstaates noch erkennbar, nun aber in einer bemerkenswert anderen Gestalt: Die Bundesrepublik ist einer der wenigen Mitgliedsstaaten der EU, in dem bis zu den Europawahlen von 2014 keine euro­ 24 Einführung skeptische Partei bei Wahlen nennenswerte Erfolge erzielt und in dem seit 1953 keine rechtsextreme oder rechtspopulistische Partei den Sprung in das nationale Parlament geschafft hat. Dies verweist auf eine historische Konstanz des Parteiensystems, die in mehr als sieben Jahrzehnten Nachkriegszeit erwachsen ist. Diese lange währende Beständigkeit des deutschen Parteien­systems endete allerdings im Mai 2014, als die Af D mit 7,1 Prozent der Stimmen ins Europäische Parlament gewählt wurde. Und bei den Bundestagswahlen 2017 dürfte mit der Af D erstmals eine rechtspopulistische Protestpartei in den Deutschen Bundestag einziehen. Strukturen und Kulturmuster, Institutionen und Akteure, ­P fadabhängigkeit und »Kontingenzen« Im Hinblick auf das Drehbuch, das für die nachfolgende Darstellung des deutschen Parteienstaates zu schreiben war, sind somit zentrale t­ heore­tische Annahmen eingeführt: Es gibt feste Strukturen im Parteiensystem, wie sie etwa in der politischen Repräsentation bestimmter sozialer Gruppen der Bevölkerung durch bestimmte Parteien ansichtig werden. Solche Strukturen sind nicht allein aus sich heraus wirksam, sondern sie werden getragen – oder infrage gestellt – durch auf sie bezogene Kulturmuster, die sich insbesondere in generalisiertem Vertrauen ausdrücken und aus elementaren Moralregeln (»wichtig ist, dass es hierzulande gerecht zugeht«) speisen. Zu dieser Systemdimension hinzu tritt, so haben wir gesagt, die Handlungsdimension. Diese erschließt sich aus dem Verhältnis von Institutionen und Akteuren des Parteienstaates. So ist in Artikel 21 GG das sogenannte Parteienprivileg zu einer Institution geworden, die den Politikern Handlungsspielräume rechtlich garantiert und diese zugleich begrenzt. Unter bestimmten Bedingungen können die Vorzeichen vertauscht werden, was dann eintritt, wenn Akteure die Institutionen umbilden. Dies ist etwa dann der Fall, wenn das Parlament das Parteiengesetz novelliert oder mit Zweidrittelmehrheit die Verfassung ändert. Das Wechselspiel zwischen Strukturen und Kulturmustern des Parteien­ staates sowie die Interaktion von Akteuren und Institutionen vollzieht sich auch in der Zeit. Über längere Zeiträume hinweg betrachtet, erscheint parteipolitisches Handeln hierzulande erkennbar »pfadabhängig«. Es bewegt sich in weitgehend festen Bahnen und hat eigene Routinen entwickelt. Es bedarf schon massiver äußerer Anstöße, etwa einer tief gehenden allgemeinen politischen Vertrauenskrise, um die Pfadabhängigkeit aufzubrechen. Die dem deutschen Parteienstaat innewohnende Handlungslogik, die zunächst wie ein aus der Zeit fallender Mechanismus der Macht anmu25 Einführung tet, muss folglich um seine Historik erweitert werden, das heißt um eine Perspektive, die die geschichtlichen Verlaufslinien des Parteienstaates aufnimmt. Dabei soll deutlich werden, dass die Entwicklung des Parteienstaates in Deutschland seit dem historischen Gründungsakt von 1949 in ­besonderer Weise pfadabhängig verläuft. Unbeschadet aller Zufälle, Unberechenbarkeiten und äußeren Einwirkungen (in der Wissenschaftssprache heißen diese »Kontingenzen«), bewegt sich die parteienstaatliche Karawane auf einem Entwicklungspfad voran, der mit der zweiten Demokratiegründung nach 1945 seinen Ausgang nahm und im Zuge der deutschen Einigung im Jahr 1990 nach Ostdeutschland hinein erweitert worden ist. Eine solche Darstellung des Parteienstaates, die die System- und Handlungsdimension mit der entwicklungsgeschichtlichen ­ Dimension zu­­ sammenführt, ist nicht wenig anspruchsvoll. Das Vorhaben wird enorm dadurch erleichtert, dass zu allen behandelten Teilaspekten eine Fülle von Erkenntnissen und Befunden vorliegt, zu denen unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen beigetragen haben. Wichtige Einsichten in Strukturprobleme der Parteiendemokratie verdanken wir neben der politischen Soziologie, zu der insbesondere die Wahl-, Parteien-, Einstellungs- und Elitenforschung zählen, etwa auch dem modernen Staatsrecht. Die strenge Formenlehre der Jurisprudenz eignet sich nämlich dazu, strukturbedingte Fehlentwicklungen von Parteipolitik, die häufig als Fehlverhalten von Personen gedeutet werden, tatsächlich aber in der Struktur des Parteienbetriebs begründet liegen, in entpersönlichter Form darzustellen. Diese nüchtern-distanzierte, in der Sache gleichwohl kritische Sichtweise auf den Parteienstaat nimmt beispielsweise der Parteienrechtler M ­ artin Morlok ein, wenn er schreibt: »Wichtige Probleme werden über die Parteien nicht hinlänglich in den politischen Entscheidungsprozess eingespeist. Die Durchlässigkeit der Parteien für Interessen und Auffassungen ist begrenzt. Die politische Diskussion wird von eher randständigen Themen beherrscht, drängende Zukunftsprobleme wagt man im Hinblick auf die Wahlaussichten nicht anzusprechen.«21 Von Systemmängeln des Parteienstaates und der Verantwortung der Politiker Den Funktionsmängeln, die Morlok hier anspricht, ist gemein, dass sie ursächlich nicht auf persönliches Versagen von Politikern zurückgehen. Andererseits setzt die Vorzugsstellung, die den Parteien in Deutschland institutionell eingeräumt wird, zweifellos eine Dynamik frei, die fortwäh26 Einführung renden Grenzüberschreitungen vonseiten der parteipolitischen Akteure Vorschub leistet. Exemplarisch deutlich wird dies an dem Dauerthema der Kontrolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Anstalten sind nach ihrer Rechtsnatur staatsfrei, dürfen aber nicht ausschließlicher Selbstkon­ trolle überlassen bleiben. Der ehemalige Verfassungsrichter Dieter Grimm spitzt die Beschreibung des Problems folgendermaßen zu: »Der Ausweg ist die Kontrolle durch die relevanten gesellschaftlichen Kräfte. Dazu gehören die Parteien zweifellos. Im Unterschied zu den anderen gesellschaftlichen Kräften ragen sie aber zugleich in den Staat hinein: Sie sitzen im Parlament und in der Regierung. Aus dieser Doppelrolle resultiert das Problem.«22 Es ist, so ließen sich Grimms Ausführungen ergänzen, die doppelte ex­­klusive Vertretungsmacht, nämlich zugleich Repräsentant gesellschaft­­ licher Kräfte und Mitglied staatlicher Organe zu sein, die es Parteipolitikern erleichtert, in Rundfunkräten meritokratische Praktiken a­ nzuwenden, das heißt leitende Positionen nach Maßgabe politischer Verdienste und Loyalitäten zu besetzen. Auf diesen Fluren findet so etwas wie eine ­strukturelle Verführung der Parteipolitik statt: Machtmissbrauch wird gefördert durch Fehlanreize, die im Gefüge des Parteienstaates selbst institutiona­l isiert sind. Ein mögliches Missverständnis sei an dieser Stelle ausgeräumt: Wer auf geöffnete strukturelle Gelegenheitsfenster und objektiv gegebene Be­­ schränkungen des Handelns verweist, die sich für politische Akteure ergeben, stellt den Parteipolitikern keinen Blankoscheck aus, für nichts selbst verantwortlich zu sein. Die Institution Parteienstaat räumt den Akteuren genügend Spielraum ein, subjektiv so zu handeln, wie es das allgemeine Sittengesetz guter Politik verlangt. Trotz aller systemischen Zwänge gibt es mithin eine Freiheit des Politikers, zwischen Alternativen wählen und auf Kritik reagieren zu können. So ist, um für die Fähigkeit der Politik zur Selbstkorrektur ein Beispiel zu nennen, der Staatsvertrag für das ZDF Anfang 2016 dahingehend geändert worden, dass dem – ­verkleinerten – Fernsehrat keine Vertreter politischer Parteien mehr angehören und im – gleichfalls verkleinerten – Verwaltungsrat des Senders nur vier (statt vormals fünf ) Vertreter der Länder sitzen. Mit der Novellierung des ZDF-­ Gesetzes zog die Politik die Konsequenz aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom März 2014, das die übergroße Partei- und Staatsnähe der Gremien beanstandet hatte. Aus der persönlichen Verantwortung für das eigene Tun wird den Parteipolitiker folglich auch der Parteienforscher, der objektiv gegebene Anpassungszwänge und Pfadabhängigkeiten in Rechnung stellt, nicht gänzlich entlassen mögen und entlassen müssen. Wo die Grenze zwischen sogenannten Sachzwängen, die im System an­­ gelegt sind, und persönlich zurechenbarem Fehlverhalten genau verläuft, 27 Einführung ist im Einzelfall oftmals schwer zu markieren. Auch die ­w issenschaftliche Literatur ist in gewisser Weise befangen, wenn sie solche politischen Vorgänge in ihre eigenen Sprachschöpfungen kleidet. Problematische Struktureffekte des Parteienregimes beschreibt sie nämlich vorzugsweise mit wertbezogenen Begriffen. Mit der sprachlichen Formulierung wird dann nahegelegt, dass der gemeinte Sachverhalt ursächlich auf angreif bare Beweggründe handelnder Personen zurückgeführt werden kann. Zu dieser wertenden Terminologie gehören in der Parteienforschung etwa häufig gebrauchte Begriffe wie Patronage, Oligarchie, politische Klasse und Parteienkartell oder Kartellpartei. Die Krise der Parteiendemokratie – ein Dauermotiv der Parteien­forschung Für die Analyse des Parteienstaates sind die genannten Begriffe dennoch unverzichtbar, weil sie typische strukturelle Fehlentwicklungen, die unbestreitbar demokratieschädliche Wirkungen zeitigen, in griffige sprachliche Formeln kleiden. Die Gefahr, selber der Voreingenommenheit zu erliegen, ist bei ihrer Verwendung nicht gänzlich auszuschließen. Das Risiko ist jedoch beherrschbar: Man muss sich darüber im Klaren sein, dass hinter den Wertungen, die in diesen Begriffen transportiert werden, immer nur auf vorhandenes Wissen gegründete Annahmen über strukturbedingte Schwächen und professionelle Deformationen des Parteienstaates stecken, die es empirisch jedes Mal neu zu überprüfen gilt. Die Erkenntnis, dass manche Auffälligkeiten und Anfälligkeiten von Parteipolitik aus ihren Strukturen erklärbar sind, hat sich in der interna­ tionalen Parteienforschung längst durchgesetzt. In vergleichender Sicht sind die Erscheinungsformen und Ursachen eines krisenhaften Wandels von Parteiensystemen ein Dauerthema. Das Krisenmotiv der Party-ChangeLiteratur fand zyklisch auch in die deutsche Parteienforschung Eingang.23 In den 1970er-Jahren wähnte man das Land »auf dem Weg zum Einparteienstaat«. In den folgenden 1980er-Jahren lautete die Zeitdiagnose, allgemein seien die »Parteien in der Krise«. Es schloss sich danach die Frage an, ob Volksparteien »ratlose Riesen« seien. Unter dem Titel »Krise oder Wandel der Parteiendemokratie?« ist wiederum 2010 ein Sammelband erschienen.24 Hier findet sich der Hinweis, dass der Parteienforscher Ulrich von Alemann von 1949 bis zum Ende des Jahrtausends »allein 10 Parteikrisen in Deutschland ausgemacht« habe.25 In einem weiteren, 2013 publizierten Sammelband werden zahlreiche Faktoren zusammengetragen, die sich zu dem Bild einer »Parteiendemokratie im Niedergang« fügen. Die Heraus28 Einführung geber konstatieren ein »verfestigtes Störungsbild« im Verhältnis zwischen Bevölkerung und Parteien und zitieren als Kronzeugen den Politikwissenschaftler Frank Decker, der von einer »Vertrauens-, Repräsentations- und Legitimationskrise des Parteiensystems« spricht.26 Derzeit wird vermehrt darüber nachgedacht, ob Formen direkter oder auch »deliberativer«, das heißt auf beratende Aussprache angelegter Demokratie Alternativen zum vorgeblich verschlissenen Parteienmodell sein könnten. Parallel dazu überlegen die Parteien selbst ­intensiv, i­nwieweit ihre inneren Organisationsstrukturen noch zeitgemäß und zukunftsfest sind. Dass die Debatten um »neue, alltagstaugliche Mitmach-Formate«, um verschiedene Mitgliedschaftsmodelle oder die Ablösung des Mitgliederprinzips durch das Delegiertenprinzip und ähnliche Reformschritte zum Teil von Parteien, die nach wie vor konkurrieren, gemeinsam geführt werden, zeigt, wie hoch der Problemdruck geworden ist.27 Ausgemacht scheint gegenwärtig jedenfalls, dass dem deutschen Parteienstaat die eigentlich »schwierigen Jahre«, so die Formulierung des Parteienforschers Helmut Wiesenthal, einmal mehr erst noch bevorstehen. Auf dem Weg zu dauerhaften Umschichtungen der Parteien­landschaft? Als während der zweiten Hälfte des Jahres 2016 die Neuauf lage dieses Buches entstand, schien diese Vorhersage Wirklichkeit geworden zu sein. Die Parteienlandschaft der Bundesrepublik hat sich seit dem e­ rstmaligen Erscheinen des Buches binnen fünf Jahren einschneidend verändert. Folgt man der Sicht eines publizistischen Leitmediums, so »bahnt sich eine dauer­ hafte Neuordnung der deutschen Parteienlandschaft an«28. Tatsächlich sind Wandlungen im Wählerverhalten erkennbar, deren Ausschläge über die Schwankungen der Stimmenverteilung bei »Normalwahlen«, also solchen Wahlgängen, die von langfristig stabilen Parteibindungen geprägt werden, hinausweisen. Zwar sind im Ergebnis der letzten Bundestagswahlen 2013 nur vier Fraktionen (mit insgesamt fünf Parteien) im Bundestag vertreten. Aber die vergleichsweise geringe Fragmentierung des nationalen Parlaments verdeckt lediglich, wie Helmuth Schulze-­Fielitz anmerkt, eine breitere »Aufsplitterung des deutschen Parteiensystems«, die zum Beispiel in der großen Zahl »verlorener« Stimmen sichtbar wird: »Noch nie waren, wie nach den jüngsten Bundestagswahlen, so viele Teilnehmer an den Wahlen nicht im Bundestag durch die von ihnen gewählten Parteien vertreten, denn 15,8 % aller Wähler haben Parteien gewählt, die an der 5-Prozent-Hürde gescheitert sind.«29 29 Einführung Bei den darauffolgenden Wahlen trat die Auffächerung des Parteienspektrums in der Verteilung der Stimmen und Parlamentssitze deutlicher zutage. Die bei den Wahlen zum Bundesparlament ein Jahr zuvor noch knapp gescheiterte Alternative für Deutschland (Af D) zog bei den Europawahlen im Mai 2014 mit 7,1 Prozent in Fraktionsstärke in das Europä­ ische Parlament ein und blieb auch bei den folgenden Landtagswahlen von März und September 2016 ausnahmslos erfolgreich. Sie erzielte durchwegs zweistellige Prozentwerte und rückte in Sachsen-Anhalt mit 24,3 sowie in Mecklenburg-Vorpommern mit 20,8 Prozent der Stimmen auf Anhieb zur zweistärksten Fraktion auf. Infolge der veränderten parlamentarischen Kräfteverhältnisse erlebten vormals unbekannte Koalitionsformate ihre Premiere: Grün-Schwarz in Baden-Württemberg und »Kenia« (SchwarzRot-Grün) in Sachsen-Anhalt. Auch die schon verblasste »Ampel« (RotGelb-Grün) wurde (in Rheinland-Pfalz) neuerlich eingeschaltet. Im Oktober 2016 kam die Af D in bundesweiten Umfragen auf 14 Prozent. Dabei erreicht sie in Ostdeutschland (Prozentwerte für September) mit 21 Prozent deutlich mehr als im Westen (12 Prozent).30 In der Vorausschau ist zu erwarten, dass die Af D ebenso bei der kommenden Bundestagswahl im September 2017 die Fünf-Prozent-Sperrklausel überwindet. Zwar ist keineswegs ausgemacht, dass sich die Af D nachhaltig als politische Kraft behaupten wird. Doch schon jetzt signalisieren ihr f lächendeckender und von breitem Wählerzuspruch getragener parlamentarischer Aufstieg, dass das Protestparteienelement im deutschen Parteiensystem eine bisher nicht gekannte wählerwirksame Größenordnung erreicht hat. Dies hat zur Folge, dass alte Lagergrenzen (z. B. zwischen CDU und Grünen) durchlässig werden und die jahrzehntelang geltende Regel, dass politische Machtwechsel in Bund oder Ländern zwei große Volksparteien unter sich ausmachen, hinfällig geworden ist. Die Frage stellt sich, wie die Tragweite der jüngsten Veränderungen in der deutschen Parteienlandschaft einzuschätzen ist. Bahnt sich hier möglicherweise ein Systemwandel an? Ist der Aufstieg von populistischen Protestparteien gar »ein entscheidendes Indiz für eine Krise der politischen Repräsentation«?31 – Vor solchen Kassandrarufen ist zu warnen. Unübersehbar ist hingegen, dass die zentrifugalen Fliehkräfte im Parteiensystem erstarkt sind – allerdings nicht gleichgewichtig rechts und links, sondern mit einer deutlichen »Rechtsschiefe«. Ob das bereits auf einen Typenwandel von einem gemäßigt pluralistischen zu einem polarisierten Parteiensystem (im Sinne der Typologie Giovanni Sartoris) hinweist, ist einstweilen noch offen. Denn mit Ausnahme der Rechtsextremen und Rechtspopulisten haben sich alle Parteien stärker zur Mitte hin bewegt, nimmt man die 30 Einführung übliche Links-rechts-Skala als Anhaltspunkt. Außerdem sind Proteststimmungen bekanntlich ein f lüchtiges politisches Gut. Für die Kampagnen der Af D liefert das Reizthema Asyl/Flüchtlinge/Zuwanderung gegenwärtig einen wichtigen Resonanzboden. Sollten die etablierten Parteien und die von ihnen gestellten Regierungen in Bund und Ländern die Deutungshoheit über dieses Thema zurückgewinnen, dürfte auch die Anziehungskraft populistischer Parolen wieder nachlassen. Ursachen für die gegenwärtige Konjunktur des Rechts­populismus Der Rechtspopulismus profitiert jedoch nicht allein von der Sogwirkung von Angst und Vorurteil, die in den Echoräumen emotional aufgeheizter Debatten auf blühen. Vielmehr spiegeln die Verwirbelungen im deutschen Parteiengefüge, wie wir sie gegenwärtig beobachten, einen fortgeschrittenen Stand diffuser politischer Unzufriedenheit und gesellschaftlicher Desintegration wider. Die heutige Konjunktur des Populismus ist folglich nicht ausschließlich durch Aufgeregtheit, die durch das aktuelle Angstthema Flüchtlinge angefacht wird, bedingt, sondern sie wird bef lügelt von Spaltungserscheinungen in der Gesellschaft und daraus entstandenen Legitimationseinbußen des politischen Systems. Die Legitimationsdefizite lenken den Blick auf tiefer liegende Konf liktlinien, die in der politischen Kultur und der Sozialstruktur der deutschen Gesellschaft in den letzten Jahren aufgebrochen sind. Die Chiffren hierfür lauten: Abstiegsängste, befürchteter Status- und Besitzstandsverlust, Wahrnehmung ungleicher oder gar trostloser Lebenschancen, das Vermissen »guter Arbeit«, fehlende Verteilungsgerechtigkeit. Es sind ursächlich solche subjektiv als prekär, das heißt als unsicher, riskant, ungerecht oder zukunftslos empfundenen Lebenslagen, die sich auf der Ebene der politischen Einstellungen als tief greifende Entfremdung von der etablierten Politik und ihren Repräsentanten auswirken. Dies ist nicht nur die Wahrnehmung des sogenannten unteren Drittels der Gesellschaft. Vielmehr reicht der Vertrauensverlust der Politik weit in die soziale Großformation der berufsaktiven Altersgruppen zwischen etwa 25 und 60 Jahren hinein. Ein Indikator für die veränderte politische Grundstimmung ist die langfristig gesunkene Wahlbeteiligung und ebenso ihr plötzlicher Wiederanstieg. Unter Nichtwählern sind, wie neue Studien belegen, die unteren sozialen Schichten der Bevölkerung generell überproportional ­vertreten. Bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt im März 2016 erhielt die Af D – auch dank deutlich gestiegener Wahlbeteiligung – von Arbeitern (35 Prozent) und Arbeitslosen (36) die meisten Stimmen. Dieselbe Partei 31 Einführung wurde von annähernd zwei Dritteln ihrer Wähler (64 Prozent) »aus Enttäuschung« gewählt.32 Auch bei den zeitgleichen Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz war die Af D bei Arbeitern und Arbeitslosen überdurchschnittlich erfolgreich. Und auch hier war ein ausgeprägter Antiparteienaffekt ein wesentliches Motiv der Wahlentscheidung: 100 Prozent (!) der rheinland-pfälzischen Af D-Wähler bejahten die Einschätzung, die etablierten Parteien nähmen die Sorgen der Bürger nicht ernst.33 Die Daten veranschaulichen beispielhaft den Zusammenhang, der zwischen einem Auseinanderdriften der Gesellschaft, sozialer Deprivation, sich verhärtender Abwendung von »alter« Politik und unvermutet auftretenden Radikalisierungsschüben des Wahlverhaltens besteht. Der Gleichklang von sich auf lösendem gesellschaftlichem Zusammenhalt und schwindendem politischem Grundkonsens rührt an die Fundamente des demokratischen Parteienstaates. Es trifft zu, dass der grassierende Verlust an Vertrauen in das Leistungsvermögen der etablierten politischen Ordnung und in die Glaubwürdigkeit der Regierenden kein speziell deutsches Problem ist, sondern ein gesamteuropäisches und ebenso transatlantisches Phänomen beschreibt.34 Hiervon sind die sogenannten konsolidierten westlichen Demokratien einschließlich der USA und die jungen Demokratien der postkommunistischen Transformationsländer Mittel- und Osteuropas gleichermaßen betroffen. Die Erfolgsspur links- und vor allem rechtspopulistischer Parteien ist europaweit erkennbar.35 Sie pf lügt inzwischen breite Schneisen durch die Gefilde der meisten nationalen Parteiensysteme. Nicht nur treten vergleichbare Anzeichen eines abrupten Umbaus ge­­ wachsener demokratischer Parteiensysteme in ganz Europa auf. Auch die ökonomischen, sozialen und psychologischen Bedingungen, die die krisen­ haften Umwälzungen in den Arenen der Parteipolitik ­kennzeichnen bzw. verursachen, zeigen einen transnationalen Zuschnitt. Wie sich das dabei erkennbare Wechselspiel zwischen strukturellen und kulturellen Faktoren hierzulande auswirkt, wurde oben schon angedeutet. Hinzu kommen das Trägheitsmoment politischer Institutionen und für ­Außenstehende undurchsichtige Eigenheiten der Abläufe politischer Steuerung und Koordinierung, die stärker als zuvor in der öffentlichen Wahrnehmung ein nachteiliges Bild von Politik, Politikern und Parteien vermitteln. Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, sei in diesem Zusammenhang auf vier ursächliche Faktoren verwiesen: (1) die gestiegene Komplexität von Problemen; (2) die deshalb noch schwerer mögliche Durchschaubarkeit und Verstehbarkeit politischer Entscheidungsprozesse; (3) nachteilige Folgen der Globalisierung, die als Aushöhlung nationaler Handlungsvoll32 Einführung machten und als Steigerung persönlicher Lebensrisiken empfunden werden; schließlich (4) der damit einhergehende Machtverlust nationalstaat­ licher Parlamente.36 Komplizierte Problemlagen und undurchschaubare Entscheidungsprozesse Diese vier Punkte seien hier kurz erläutert: Politische Problemlagen erweisen sich mittlerweile als derart vielschichtig und miteinander verwoben, dass steuernde Aktivitäten und Lösungsvorschläge der Politik sich nicht mehr eindeutig parteipolitischen Alternativen zuordnen lassen.37 Die Flüchtlingspolitik oder etwa auch zentrale Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik sind dafür Beispiele. Zwar mag der von Fall zu Fall in der Sache gefundene Konsens der politischen Entscheider wohlbegründet sein. Das Wahlvolk erlebt nichtsdestoweniger einen wie in Watte gepackten Parteienwettbewerb. Das wirkt demobilisierend und nährt den Verdacht, die »Altparteien« bildeten ein abgekapseltes Elitenkartell. Die gesteigerte Komplexität der Problemlagen nehmen Bürger, zumal politisch ungeübte, als Bestätigung für die Intransparenz des Politikbetriebs wahr. Was »hinter dem Vorhang« in oft komplizierten Verhandlungsrunden geschieht, bleibt den von Entscheidungen Betroffenen naturgemäß zumeist verborgen. Das lässt Misstrauen wachsen, und in der Folge verbreitert sich der unsichtbare Graben zwischen Bevölkerung und Politik. Einer Umfrage von Mitte März 2016 zufolge stimmen 57 Prozent der Bundesbürger der Aussage zu, dass »die da oben in der Politik« sowieso machen, was sie wollen, »meine Meinung zählt da nicht«.38 Der oben erwähnte Wirkungszusammenhang zwischen schwacher Ausstattung mit sozialen Ressourcen (geringe Bildung, bescheidenes Einkommen, unterentwickeltes Selbstvertrauen) und politischer Entfremdung, in der gleichwohl ein Protestpotenzial »schläft«, das durch populistische Angebote aktiviert werden kann, tritt im Wahlverhalten gegenwärtig zutage. Wie eine regionale Studie zu sozialen Hintergründen und Motivlagen des Nichtwählens exemplarisch aufzeigt, sind unter eingef leischten Nichtwählern Arbeiter überrepräsentiert, und ebenso Menschen, die sich »ungerecht behandelt« fühlen. Gering ausgeprägt ist dabei das Vertrauen in Politiker sowie das Gefühl, selbst politisch etwas bewirken zu können.39 Dieselbe Gruppe Wahlberechtigter neigt dazu, bef lügelt durch populis­ tische Ansprache von der Nichtwahl zur Protestwahl zu wechseln: Bei der Landtagswahl im März 2016 in Sachsen-Anhalt konnte die Af D die relativ meisten Wähler aus dem Reservoir vormaliger ­Nichtwähler gewinnen.40 33 Einführung Neuer Nationalismus als parteipolitische Alternative? Der 2007/08 eingetretene weltweite Kollaps der global agierenden Finanzmärkte und die als Folge davon in vielen Ländern ausgelöste Krise der Realwirtschaft wird von Betroffenen weithin als ein Kontrollverlust nationaler Politik wahrgenommen, der individuelle Lebensrisiken steigert. Gegenüber einer solchen externen Bedrohung suchen viele Menschen Schutz in ökonomischer und kultureller Abschottung nach außen. Befürwortet wird ein die Krise vermeintlich heilender nationaler Zusammenschluss nach innen. Durch den zeitweise massenhaften und unkontrollierten Zustrom von Flüchtlingen und Asylbewerbern, wie er 2015 in einigen (nicht allen) Staaten der EU registriert wurde, erhielt diese Wagenburgmentalität europaweit zusätzlich Auftrieb. Das mehrheitliche Votum der Briten für den EU-Austritt am 23. Juni 2016 sowie hierzulande der rasante Aufstieg der Af D seit der Jahreswende 2015/16 bestätigen es: Rechtspopulisten profitieren in Zeiten der Unsicherheit von der Angst vor Fremden und können mit betont nationalen Losungen punkten. Allerdings darf zumindest in Deutschland die auch hier ­weitverbreitete Globalisierungskritik nicht unbesehen mit Europhobie gleichgesetzt werden. So hatte die Af D unter dem Vorsitz Bernd Luckes mit ihrer Anti-EuroKampagne trotz des Einzugs ins Europaparlament nur begrenzten Erfolg. Zwar meinen auch die Deutschen mehrheitlich, die EU mische sich zu viel in nationale Angelegenheiten ein. Doch sind rund drei Viertel der Bundesbürger überzeugt, die EU-Mitgliedschaft sorge dafür, »dass es uns wirtschaftlich gut geht« und dass wir in Europa »sicherer leben«.41 Die Europäisierung hat jedoch, darauf weist der Staatsrechtler H ­ elmuth Schulze-Fielitz hin, eine Verlagerung der Entscheidungsmacht von den gewählten Volksvertretungen zu Regierungen und Verwaltungen im Ge­­ folge. Ein solcher »Megatrend« lasse sich für alle westlichen Demokratien feststellen.42 Die Anforderungen an das Krisenmanagement zur Steuerung der Folgen der Finanzkrise (und, so ist hinzuzufügen, neuestens auch der Flüchtlingskrise) lassen sich in der Tat nicht mehr in nationalen Alleingängen bewältigen, auch nicht seitens der Exekutiven in den Hauptstädten der Mitgliedsstaaten. Es bedarf hierfür vielmehr des Eingreifens supranationaler Institutionen wie der EZB oder des IWF, deren Machtzuwachs offenkundig, wenngleich umstritten ist. Unter den beschriebenen Umständen ist Krisenbewältigung vorrangig die »Stunde der Exekutive«. Den nationalen Parlamenten bleibt nur übrig, nachträglich zuzustimmen, was sie de facto »in eine Ratifikationslage drängt«.43 Verlagerungen von Kompetenzen auf die europäische Ebene 34 Einführung sind daher, so Schulze-Fielitz, »weithin Synonym für den Verlust an politisch-parlamentarischer Kontrolle und politischer Verantwortung nationaler parteipolitisch geprägter Institutionen«.44 Wenn Parlamente nur noch zu Notaren des Exekutivwillens werden, schwächt dies ihre Responsivität, das heißt die für eine Demokratie notwendige Verbindung zwischen den Wählern und den Gewählten. Dass diese politisch letztverantwortlich sind, wird nur noch schwer oder gar nicht mehr erkennbar. Stattdessen verstärkt sich das Gefühl, dass Politik undurchsichtig, abgehoben und noch weiter »nach oben« abgewandert ist. Solche Stimmungslagen sind Wasser auf die Mühlen der Populisten. Auch das erklärt die in letzter Zeit größer gewordenen Legitimationsprobleme des d­ emokratischen Parteienstaates. Nachlassende Integrationskraft »alter« politischer Parteien und der Aufstieg der AfD Binnen vergleichsweise weniger Jahre haben sich mithin die Handlungsbedingungen für den Parteienstaat in Deutschland nachteilig verändert. Das bedeutet nun nicht, dass die in diesem Buch gezogenen ­langfristigen Entwicklungslinien abgebrochen wären und historisch g­ewachsenen Erscheinungsbilder des deutschen Parteienstaates nicht mehr gültig. In Gegenteil, sie behalten ihre Erklärungskraft und finden daher auch in der Neuauf lage gebührend Platz. Aus der Perspektive einer gewandelten Gegenwart stellt sich gleichwohl die Frage, »ob vor dem Hintergrund tief gehender und vor allem gesellschaftlicher Veränderungen das herkömmliche Bild von der Integrationskraft politischer Parteien noch aufrecht zu erhalten ist«.45 Um einführend einen Fingerzeig zu geben, wie der g­ esellschaftliche Wandel sich auf den Parteienstaat auswirkt und wie er in demselben politisch verarbeitet wird, ziehen wir nochmals das oben eingeführte Begriffspaar Kulturmuster und Strukturmuster heran. Beide Muster folgen eigenständigen Entwicklungslinien und stehen zugleich in einer engen Wechselbeziehung. Beide schreiben stabile Pfadabhängigkeiten fort, ohne jedoch darin zu erstarren. Beide sind keineswegs homogen; während sich einesteils kulturell die Einstellungen von Eliten und Bevölkerung, aber auch sozialer Gruppen unterscheiden, begegnen uns andererseits auch »Strukturen« in verschiedener Gestalt, nämlich als Sozialstruktur oder als staatliche Institutionen oder als Parteiorganisationen. Innerhalb dieser »musterhaften« Anordnung von Kultur und Struktur entwickelt sich die spezifische Dynamik des Parteiensystems. Auf einige Erscheinungsformen 35 Einführung dieser Dynamik, die im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts entweder neu auftreten oder sich aktuell zugespitzt haben, sei hier zunächst stichwortartig verwiesen: Die Erosion der Mitgliederparteien infolge anhaltender Mitgliederverluste schreitet weiter fort, trotz intensivierter Strategien der Parteiführungen, diesem Abwärtstrend entgegenzusteuern. Die personelle Auszehrung vornehmlich der großen Mitgliederparteien geht einher mit der Abneigung eines anhaltend hohen Anteils der Bevölkerung, sich affektiv an eine Partei zu binden. Seit der Jahrtausendwende geben in Westdeutschland zwischen 30 und 40 Prozent sowie in Ostdeutschland zwischen 40 und 47 Prozent kontinuierlich an, keine Parteiidentifikation zu haben.46 Im politischen Diskurs ist eine wachsende Distanz zum Verfassungskern der repräsentativen Demokratie zu beobachten. Diese Distanz äußert sich nicht mehr nur in – zweifelsfrei demokratisch legitimierten – verbreiteten Sympathien für die Aufwertung von Instrumenten der direkten Demokratie, sondern neuerdings auch im Wiederauf leben antidemokratischer intellektueller Gegenentwürfe, die sich aus völkischer »identitärer« Ideologie speisen. Kennzeichnend für diesen Ansatz ist die gedankliche Kon­ struktion einer ihrer Natur nach gleichartigen Volksgemeinschaft, die gegen die Vielfalt der Kulturen, der sozialen Gruppen und den Pluralismus der Interessen und politischen Parteien ausgespielt wird. Die Destabilisierung der klassischen Vorrangstellung der traditionellen Volksparteien, insonderheit der SPD, schreitet im Ergebnis der Wahlen beschleunigt fort. Der kumulierte Stimmenanteil für Unionsparteien und SPD bei Wahlen unterschritt bei den Landtagswahlen von 2016 mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz die 60-Prozent-Linie. Die Kehrseite dieses Abschmelzens von vormals größeren Wählerblöcken ist die Diffusion des Parteiensystems auf nationaler und regionaler Ebene. Hervorstechendes Merkmal dieser Diffusion ist der Aufstieg einer rechts­ populistischen Protestpartei in Gestalt der Af D. Das Mobilisierungs­ver­mögen dieser Partei, ihre zum Teil spektakulären Wahlerfolge und ihre rasche Ausbreitung über fast sämtliche Etagen des politischen Mehrebenen­ systems deuten auf ein dealignment im Parteiensystem hin, das heißt auf eine Verschiebung der Kräfteverteilung, die aus massenhaft verbreiteter Lockerung von Parteibindun­gen resultiert. Ob sich für die Af D in ihrem Verhältnis zu Pegida das typische Erfolgsmodell einer neu gegründeten Partei, deren Ausbreitung von einer sozialen Bewegung f lankiert wird, wiederholt, bedarf indes genaueren Hin­sehens. Offen ist einstweilen nicht zuletzt die Frage, ob es der Af D gelingt, ein sie dauerhaft tragendes »Cleavage« zu besetzen, also eine soziale Konf liktlage politisch zu vertreten, die 36 Einführung in der Interessenstruktur der Gesellschaft und von dieser präferierten Themen verankert ist. Chancen für die Af D, ihre gesellschaftliche Verankerung zu festigen, zeichnen sich in drei Richtungen ab. Zum einen hat die mit der programmatischen Modernisierung der CDU einhergegangene Preisgabe klassischer konservativer Positionen in der Gesellschafts-, Bildungs- und Verteidigungspolitik rechts der Mitte des politischen Spektrums ein Vertretungsvakuum geöffnet. »Die CDU, so scheint es, hat am konservativen Rand eine Wählergruppe endgültig verloren und aufgegeben, die vor zehn Jahren noch fest an sie gebunden war. Und anders als früher kann die CSU dies nicht kompensieren.«47 Diese von Meinungsforschern bestätigte »Repräsentationslücke« wird gegenwärtig von der Af D erfolgreich besetzt. Darüber hinaus findet die Partei Zuspruch in jenen Teilen der Bevölkerung, die sich von der Politik innerlich schon abgewendet hatten, weil sie sich von dieser Seite für ihre eigenen als unbefriedigend oder ausweglos empfundenen Lebenslagen keine Lösung mehr erwarten. Diese Menschen sehen in der Af D nun eine »Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen«.48 Zum dritten bedient die Af D die Verlustängste jener, die befürchten, dass sie zugunsten von Flüchtlingen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt und bei Sozialleistungen Nachteile zu gewärtigen haben. Ob sich diese psychologische Gemengelage aus Existenzsorgen und Unzufriedenheit mit der eigenen Lebenslage, aus Politikverdrossenheit und Besitzstandsdenken zu einer »neuen sozialen Frage« verdichtet, die der Af D eine stabile Wählerbasis verschafft, ist ungewiss. Es dürfte der Partei schwerfallen, jene Klientel, die soziale Ungleichheit erfährt bzw. beklagt, die sich von den herrschenden Umständen ungerecht behandelt und von den »Altparteien« nicht mehr vertreten fühlt, mit politisch heimatlos gewordenen Nationalkonservativen und rechtslastigen Befürwortern einer die Demokratie transzendierenden Systemveränderung zu einer homogenen sozialen Koalition zusammenzuführen. Dagegen sprechen sowohl die soziale Streuung der mobilisierten Modernisierungsverlierer als auch die Vielgestalt der Motive und Interessenlagen unter den Sympathisanten der Partei. Vorerst dient das Protestmotiv – wahlweise die Ablehnung des Euro, der Zuwanderung und des Islam sowie »Widerstand« gegen »das System« – als vereinende Klammer. Dennoch kommt es bei der eingetretenen Auffächerung des Parteiensystems auch wieder zu »Begradigungen«, wie der Niedergang der Piratenpartei veranschaulicht. Deren Parteimodell einer rationalen Protestpartei ist nicht nur organisationspraktisch an den selbst gesetzten Ansprüchen einer 37 Einführung ungebremst basisdemokratischen »liquid democracy« gescheitert, sondern auch daran, dass sich aus der Kombination von Netzpolitik, Technikaffi­ ni­ t ät, lose gekoppelter Organisation und auf »Transparenz« fokussiertem Verständnis von Bürgerrechten keine dauerhafte soziale Konf liktlinie herausbildete, die erfahrungsgemäß notwendig ist, um die Gründung einer neuen Partei gesellschaftlich abzustützen. Stattdessen haben sich die etablier­ten Parteien das Thema Netzpolitik zu eigen gemacht. Der Parteienstaat – auch künftig kein politisches Auslauf­modell Insgesamt betrachtet läuten die im deutschen Parteiensystem aufgetretenen Bewegungen nicht das Ende der Parteien ein. Zwar ist der Parteienforschung die Annahme eines für die Funktionsfähigkeit von Parteiensystemen vorteilhaften Gleichgewichtszustandes (»stable equilibrium point«) nicht fremd.49 In der Realität stellt sich eine solche Balance jedoch bestenfalls vorübergehend ein, nämlich so lange, wie auf dem Wählermarkt Angebot (der Politik) und Nachfrage (der Wähler) hinreichend übereinstimmen.50 Obschon in der Bundesrepublik die etablierten Parteien in der Vergangenheit wiederholt eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit nachgewiesen haben, überträgt sich gesellschaftlicher Wandel in gleitende oder eben auch abrupte Veränderungen im Parteiensystem, die sich als Niedergang alter und als Aufstieg neuer Parteien darstellen können. Wenn gesellschaft­l icher Wandel eine neue Parteiengestalt annimmt, rückt er in seiner s­ozialen Reichweite und politischen Signalwirkung automatisch stärker ins öffent­ liche Bewusstsein. Zugleich entsteht im ­Parteiensystem eine neue politische Wettbewerbssituation, und mit dieser verändern sich die Handlungsbedingungen im Parteienstaat. Diesen Prozess in seinen Erscheinungsformen und Folgen nachzuzeichnen, ist für die S­ elbstauf klärung eines demokratischen Gemeinwesens wichtig. Die klassischen Funktionen politischer Parteien haben sich dabei jedoch keineswegs erübrigt. Nach wie vor werden Parteien aus guten Gründen gebraucht: um gesellschaftlichen Interessen Ausdruck zu geben, sie nach Dringlichkeit zu ordnen und in die staatliche Willensbildung einzuleiten; um das Personal für Parlament und Regierung zu rekrutieren; um egoistische Interessenlagen und »introvertierte« Loyalitäten, die sich in ­einzelnen Politikfeldern eingerichtet haben, zu zügeln und in Lösungspaketen, die gemeinwohlverträglich sind, zusammenzuführen; um politische Entscheidungen, die »oben« gefällt werden, den Bürgerinnen und Bürgern »unten« zu vermitteln und damit der Politik die notwendige Legitimation zu verschaffen. Diese Liste mit unverzichtbaren öffentlichen Aufgaben der Par38 Einführung teien ist nicht vollständig. Aber sie unterstreicht die eingangs zitierte Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, dass die moderne Demokratie zwingend eine Parteiendemokratie ist. Mithin ist der Parteienstaat kein Auslaufmodell. Für die praktische Um­­ setzung der Demokratie in den Flächenstaaten moderner Gesellschaften gibt es zu ihm trotz aller selbsterzeugten Mängel und Schwächen keine ernst zu nehmende Alternative. Diese Erkenntnis leitet auch die hier vorgelegte Studie. Es geht im Folgenden, wie bereits gesagt, nicht darum, gut bekannte Strukturelemente des bundesdeutschen Parteiensystems und Parteienstaates ein weiteres Mal neben- und nacheinander abzuhandeln. Wenn Teilaspekte ohne Orientierung an theoriegeleiteten Blickachsen lediglich »additiv« zusammengestellt werden, geht der Blick für das, was die Welt der Parteipolitik im Innern eigentlich zusammenhält, zwangsläufig verloren. Solche analytischen Streuverluste will die folgende Darstellung dadurch auffangen, dass sie prozessbezogene und den Gegenstand der Betrachtung systematisch erschließende Sichtweisen integriert. Es geht folglich um die Strukturformationen und die kulturellen Deutungsmuster, die Handlungslogik und die historischen Vorprägungen des heutigen Parteienstaates in ihren Ausformungen, Abläufen und Ursachen. Im Kapitel »Erklärungen« werden Parteien als Ausdruck sozialen Wandels und als Agenten gesellschaftlicher Konf likte vorgestellt. Das daran anschließende zweite Kapitel »Entwicklungen« zeigt die Formveränderungen im Fortgang der Zeiten auf. Das dritte Kapitel, betitelt »Erscheinungsbilder«, beschreibt die Mühen der Tiefebene, wo praktische Parteiarbeit stattfindet. Hier findet der Leser auch Argumente gegen den weitverbreiteten Generalverdacht, Parteipolitik sei ihrer Natur nach eine pathologische Abweichung vom Pfad politischer Tugend.51 39