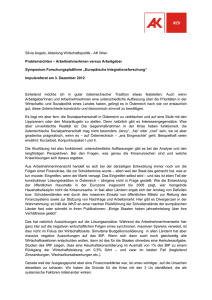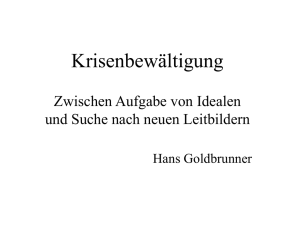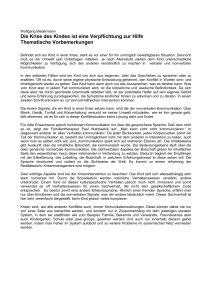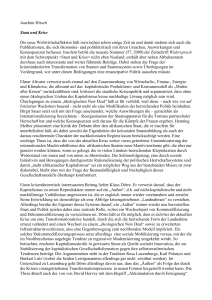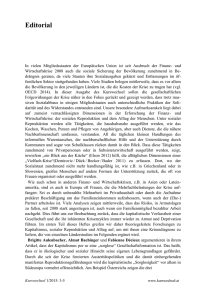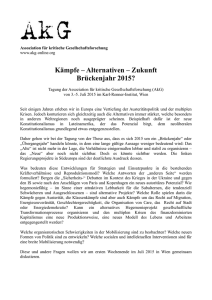Der freie Fall ist vorbei … aber die Krise geht weiter
Werbung

I N T E R N AT I O N A L E P R E S S E K O R R E S P O N D E N Z Der freie Fall ist vorbei … EU: Die weltweite Krise und die Wirtschaftspolitik: Kann die Politik den Kapitalismus vor sich selbst retten? ▶ Die Asienkrise: Krise eines exportgestützten Wachstums oder der Verdrängung von Arbeit? ▶ Die Auswirkungen der Krise auf Lateinamerika ▶ ... aber die Krise geht weiter Außerdem: Italien, Ökologie, Haiti Nr. 460/461 März/April 2010 € 4,– IMPRESSUM Inprekorr ist das Organ der IV. Internationale in deutscher Sprache. Inprekorr wird herausgegeben von der deutschen Sektion der IV. Internationale, von RSB und isl. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit GenossInnen aus Österreich und der Schweiz und unter der politischen Verantwortung des Exekutivbüros der IV. Internationale. Italien Der Aufstand der Arbeitsimmigranten in Rosarno, Charles-André Udry..............................3 Ökologie Gestaltet die kränkelnde Autoindustrie um! Lars Henriksson...............................................4 Inprekorr erscheint zweimonatlich (6 Doppelhefte im Jahr). Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung des herausgebenden Gremiums wieder. Ökonomie EU: Die weltweite Krise und die Wirtschaftspolitik: Kann die Politik den Kapitalismus vor sich selbst retten?, Özlem Onaran................................................................................7 Der freie Fall ist vorbei, aber die Krise geht weiter, Joel Geier..........................................19 Die Asienkrise: Krise eines exportgestützten Wachstums oder der Verdrängung von Arbeit? Jean Sanuk...........................................................................................................23 Die Auswirkungen Krise auf Lateinamerika, Claudio Katz.................................................33 Nicht aller Marxismus ist Dogmatismus – eine Erwiderung an Michel Husson Chris Harman...................................................................................................................39 Lange Wellen – die letzte? Thadeus Pato............................................................................46 Konto: Neuer Kurs GmbH, Postbank Frankfurt/M. (BLZ: 500 100 60), KtNr.: 365 84-604 Theorie Die Krise jenseits der Krise, Interview mit Daniel Bensaïd.................................................49 Abonnements: Einzelpreis: € 4,– Jahresabo (6 Doppelhefte): € 20,– Doppelabo (Je 2 Hefte): € 30,– Solidarabo: ab € 30,– Sozialabo: € 12,– Probeabo (3 Doppelhefte): € 10,– Auslandsabo: € 40,– Nachruf Bis zum letzten Atemzug ein revolutionärer Kämpfer: Daniel Bensaïd (1946–2010) Gilbert Achcar..................................................................................................................48 Website: http://inprekorr.de Redaktion: Michael Weis (verantw.), Birgit Al­ thaler, Daniel Berger, Wilfried Dubois, Thies Gleiss, Jochen Herzog, Paul Kleiser, Oskar Kuhn, Björn Mertens Register 2009 Register nach Ländern..........................................................................................................54 Register nach Themen..........................................................................................................54 die Internationale..................................................................................................................55 Haiti Solidaritätsappel, Batay Ouvriye..........................................................................................56 E-Mail: [email protected] Satz: Grafikkollektiv Sputnik Verlag, Verwaltung & Vertrieb: Inprekorr, Hirtenstaller Weg 34, 25761 Büsum, E-Mail: [email protected] Kontaktadressen: RSB, Revolutionär Sozialistischer Bund Postfach 10 26 10, 68026 Mannheim isl, internationale sozialistische linke Regentenstr. 75–59, D-51063 Köln SOAL, Sozialistische Alternative [email protected] Sozialistische Alternative Postfach 4070, 4002 Basel Eigentumsvorbehalt: Die Zeitung bleibt Eigentum des Verlags Neuer Kurs GmbH, bis sie dem/der Gefangenen persönlich ausgehändigt ist. „Zur-Habe-Nahme“ ist keine persönliche Aushändigung im Sinne des Eigentumsvorbehalts. Wird die Zeitschrift dem/der Gefangenen nicht persönlich ausgehändigt, ist sie dem Absender unter Angabe der Gründe der Nichtaushändigung umgehend zurückzusenden. 2 Liebe Leserinnen, liebe Leser, der Ausgang der Krise, in der sich das kapitalistische System als Gan­ zes befindet, ist noch nicht entschieden. Ihre Auswirkungen auf drei große Regionen der Welt – Asien, Lateinamerika und Europa – werden in der vorliegenden Ausgabe analysiert. Aber auch ohne „gelbe Seiten“ soll die Theorie nicht auf der Strecke bleiben: Methoden zur Ermittlung der Profit­ raten (Kontroverse zw. M.Husson und Chr. Harmann) oder die Bestim­ mung der – vielleicht letzten? – langen Welle (Th. Pato) fordern zur Dis­ kussion heraus. Eine anregende Lektüre wünscht euch Eure Redaktion Eure großzügigen Spenden erbitten wir wie immer auf das folgende Konto: Thies Gleiss Sonderkonto; Kto.Nr. 478 106-507 Postbank Köln (BLZ 370 100 50) inprekorr 460/461 Italien Der Aufstand der Arbeitsimmigranten in Rosarno Charles-André Udry In der kalabresischen Gemeinde Ro­ sarno brach am 7. Januar ein Aufstand der Arbeitsimmigranten, die überwie­ gend aus Afrika stammen, aus. Die Im­ migranten besetzten zu ihrer Verteidi­ gung die Straße, um zu zeigen, dass sie nicht gewillt sind, länger unsicht­ bare menschliche Wesen und rechtlose Handlanger zu sein, die zwar die duf­ tenden Clementinen sorgfältig ernten sollen, im Übrigen aber unter den Rat­ ten und wie die Ratten leben müssen. Die Jagd auf die Schwarzen Bereits im Dezember 2008 waren die Arbeitsimmigranten aus Ghana und Burkina Faso in Rosarno auf die Straße gegangen: Zwei von ihnen waren aus einem Auto heraus mit Maschinenpis­ tolen beschossen und schwer verletzt worden – einer dieser zahlreichen „Un­ fälle“, die typisch sind für die „Jagd auf die Schwarzen“. Dahinter steht die un­ menschliche Ausbeutung, die sich glei­ chermaßen auf Mafianetze und die Po­ litik der Regierung Berlusconi in Ge­ stalt des Ministers Roberto Maroni von der Lega Nord stützt. Und dort in Ka­ labrien nehmen es die Handlanger der Mafia nicht hin, dass die Immigranten aufmucken oder sich wehren. Dies wä­ re nämlich ein Angriff auf die „pax ma­ fiosa“, die die „billige“ Ernte der Zit­ rusfrüchte erst ermöglicht. Die Vertreterin des UN-Flücht­ lingskommissariats erklärte dazu, dass sie sehr besorgt sei, dass es in Rosar­ no zu einer „Immigrantenjagd“ kom­ men könne. Zumal Maroni am Vortag vehement behauptet hatte, dass die Si­ tuation durch „zuviel Toleranz gegen­ über der heimlichen Immigration“ zu­ stande komme. waren, den Tod ihrer Schicksalsgenos­ sen mit anzusehen: in der Wüste, auf dem Meer oder in den „Rückhaltela­ gern“, die von der EU und Schweiz fi­ nanziert werden. Sie haben ihre Länder verlassen, die von Kriegen gepeinigt sind, hinter denen die Minen- und Öl­ konzerne stecken, und durch neokolo­ niale Ausbeutung mithilfe der korrup­ ten und kollaborierenden „Eliten“ zer­ stört werden. Sie kamen zu Tausenden in eine Gegend, in der nur ihre Arme zum Zit­ ronenpflücken ab November gebraucht werden und die sie nach der Orangen­ ernte im März wieder verlassen, um – je nach Erntezeit – von einer Regi­ on in Italien zur anderen zu ziehen. Ohne feste Behausung, Wasser, Strom und Sanitäranlagen, mitunter abge­ schieden in leerstehenden Fabrikge­ bäuden. Um mit ihren Worten zu spre­ chen: „Wir leben zwischen den Ratten und der Angst.“ Oder wie sich ein an­ derer gegenüber La Repubblica äußer­ te: „Ich lebe in der Angst, dass meine Familie mitkriegen könnte, wie ich in Europa lebe.“ Ende des Jahres kommen in der Re­ gion von Rosarno jeden Morgen die „Vorarbeiter“ mit Kleinlastern vorge­ fahren, um diese Arbeitsimmigranten zu engagieren, die buchstäblich nichts als ihre Hände haben – junge Männer, die täglich 12 bis 14 Stunden arbeiten und 20 Euro dafür bekommen, wobei 5 noch für den „Transport“ draufgehen. Die Mitarbeiter von „Ärzte oh­ ne Grenzen“, die durchaus Erfahrun­ gen in Ländern mit „schwierigen“ Be­ dingungen gesammelt haben, sind fas­ sungslos über das, was sie hier vor­ finden. Die Kälteeinbrüche und der Rauch von den Feuern, die in den Ba­ racken zum Kochen und Heizen ent­ zündet werden, verursachen schwer­ wiegende Schädigungen der Atem­ wege. Dazu kommen diverse Infekti­ onen und Hauterkrankungen. Die Pro­ jektleiterin der „Ärzte ohne Grenzen“ meint: „Viele von ihnen leiden unter Depressionen. Denn sie erleben diese Entwürdigung ihrer Lebensbedingun­ gen als ein Trauma, von dem sie sich nie wieder erholen werden. Und wenn sie mit Zuhause telefonieren, sagen Die Überlebenden sind zu einer Odyssee Verdammt Die Immigranten, die in dieser Regi­ on ankommen, sind die Überlebenden einer Odyssee, auf der sie gezwungen inprekorr 460/461 3 ÖKOLOGIE sie, dass alles gut sei, und diese Lü­ gen, die sie sich selbst vormachen, de­ primieren sie noch weiter.“ Ein Kampf für sich zwar, aber einer mit Vergangenheit Diese Arbeitsimmigranten stehen am Ende einer Kette. Die Großerzeuger ha­ ben mithilfe der Mafia verhindert, dass sich die Kleinbauern zu Kooperativen zusammenschließen. Die Preise für die Clementinen und Orangen sind stark gefallen: Die Supermärkte und die Ex­ porteure diktieren die Preise. In Süditalien gibt es demnach eine Wanderarmee ohne Einwanderungspa­ piere. Die allermeisten von ihnen wer­ den keine Aufenthaltserlaubnis erhal­ ten, da sie eine Ausweisungsverfügung mit Rückkehrverbot erhalten haben. Daher pilgert eine regelrechte „Reser­ vearmee“ von „Illegalen“ je nach Sai­ son durch das Land, um Tomaten in Foggia zu ernten, Clementinen und an­ schließend Orangen in Rosarno, da­ nach Oliven in Alcamo und Kartoffeln in Cassibile – durch ein Süditalien al­ so, dessen Landwirtschaft mitten in der Krise steckt. Die Ausbeutungsmechanismen, die sie vorfinden, erinnern – mutatis mutandis – an jene der Tagelöhner in Süditalien, die nach dem 2. Weltkrieg harte Kämpfe ausfechten mussten und Landbesetzungen durchgeführt haben. Damals galten diese Tagelöhner offi­ ziell auch als Kriminelle. Und in die­ se Tradition der Kämpfe reiht sich der Aufstand der afrikanischen Arbeitsim­ migranten, die in Rosarno auf die Stra­ ße gegangen sind, weil sie es satt hat­ ten, als Schießscheibe zu dienen (zwei Jugendliche wurden mit Luftgewehren attackiert), und „wie Tiere behandelt zu werden“, um eine ihrer gängigen For­ mulierungen zu gebrauchen. Sie ha­ ben sich als Menschen gewehrt, deren Zorn ihr Leiden mildert – mit ein paar kaputten Autos und Fensterscheiben – und wurden dabei von der Polizei wie „Tiere“ niedergeknüppelt. Charles-André Udry ist Wirtschaftswissen­ schaftler und Mitglied des Beirats von Attac Schweiz Quelle: Gekürzt aus à l’encontre Übersetzung: MiWe 4 Gestaltet die kränkelnde Autoindustrie um! Infolge der ökonomischen Rezession und der Umweltkrise sind alternative Entwürfe für eine sozial nützliche, nachhaltige Produktion aktuell wie nie zuvor. Als letztes Jahr die Finanzkrise mit voller Wucht aufkam, wurde die Überproduktion in der Autoindustrie unübersehbar. Lars Henriksson Vor allem die schwedische Autoindus­ trie war überproportional betroffen. Die Krise traf dort zwei der kleinsten Mas­ senproduzenten der Welt, die kriseln­ den US-Firmen gehören und große, ver­ brauchsintensive Autos der luxuriöseren Kategorie produzieren. In einem Land, in dem 9 Millionen Menschen leben, ist dies so, als ob in London zwei Au­ tohersteller mitsamt ihren Zulieferern bankrott gingen und zwei LKW-Produ­ zenten krisengeschädigt wären. Die Autokrise wurde natürlich zum Politikum, und ist es noch immer. Wie im Rest der Welt wurde die offizielle Diskussion von zwei Argumentations­ linien darüber beherrscht, wie mit der Krise umzugehen sei. Die Einen halten die Entwicklung für eine „kreative Zerstörung“ in dem Sinn, dass der Markt sein „Urteil“ ab­ gegeben habe und einige Firmen eben zum Tode verurteilt worden seien. Und Eingriffe in das Marktgeschehen wür­ den die Lage nur noch verschlimmern. Die „grüne“ Variante dieser Position lautete, „dass Autos ohnehin dem Kli­ ma schaden. Wir brauchen sie oder die Herstellerfirmen nicht. Es ist gut, wenn die Autoindustrie verschwindet.“ Die Gegenposition in der öffent­ lichen Debatte reklamiert Unterstüt­ zung für die Autoindustrie. Die Regie­ rung müsse die Firmen subventionieren und ihnen über diese schlechten Zeiten hinweg helfen, damit die Autoindus­ trie anschließend wieder wachsen kön­ ne, wenn sich die Lage wieder norma­ lisiert hat. Dafür würden Kredite, Ver­ schrottungsprämien, vorübergehende Steuererleichterungen u. ä. benötigt. In Schweden war dies die Position der So­ zialdemokratie, der betroffenen Indus­ trie, vieler Analysten und der Gewerk­ schaften. Die Führer meiner Gewerk­ schaft leisteten ihren „Beitrag“, indem sie einen Vertrag unterschrieben, wo­ nach für ihre Mitglieder vorübergehend eine Reduzierung von Löhnen und Ar­ beitszeit gilt. Beide Herangehensweisen an die Krise sind desaströs. Die Position „Un­ terstützt die Industrie“ geht von einer grundlegend falschen Annahme aus. Es wird kein „Zurück zur Normalität“ mehr geben, oder zumindest nicht ei­ ne endlos wachsende Produktion von Autos. Der Straßenverkehr ist verantwort­ lich für circa 20 % der Emissionen an Treibhausgasen in der EU, wo­ bei in diesem Sektor die Emissionen am schnellsten zunehmen. Auch oh­ ne die Notwendigkeit, den Klimawan­ del zu stoppen, läuft die Zeit des Au­ tos ab. Die Ölförderung wird schon in naher Zukunft ihren Höhepunkt über­ schritten haben und als billige Energie nicht länger zur Verfügung stehen. Ein Verkehrssystem, das auf massenhaftem Autoverkehr beruht, stellt überhaupt keine Option dar. Und die Position der Industrie dazu – das grüne Auto, ver­ brauchsarm und betrieben mit erneuer­ baren Energien – ist eine Illusion. Es stimmt zwar, dass sich die durchschnittlichen CO2- Emissionen pro Kilometer bei neuen Autos verrin­ gert haben, aber während zwar in der Zeit 1995–2002 der durchschnittliche Treibstoffverbrauch für neue Autos in den EU-Ländern um 13% abgenom­ men hat, ist der Verbrauch insgesamt aufgrund der Verkehrszunahme um 7% gestiegen.1 1 Achieving Sustainable Mobility: Everyday and Leisure-time Travel in the EU. S. 170 Erling Holden. Ashgate Publishing Ltd 2007 inprekorr 460/461 ÖKOLOGIE Biosprit ist keine Lösung. Im waldreichen Schweden beispielswei­ se wird die Herstellung von synthe­ tischem Dieseltreibstoff (DME) aus Holz als die neue Zukunft angeprie­ sen. Aber wollte man nur den Benzin­ verbrauch der aktuell zugelassenen Au­ tos durch DME ersetzen, müssten allein dafür jährlich 6 Milliarden Hektar abge­ holzt werden. Andere Arten von Biot­ reibstoffen, die als Alternative zum Öl propagiert werden, wie Äthanol, benö­ tigen zuviel Ackerland und Wasser. Au­ ßerdem kollidiert die Herstellung von Äthanol aus Korn oder von Diesel aus Soja unmittelbar mit der Produktion von Nahrungsmitteln für die ärmsten Völker dieser Welt. Sind Elektroauto oder wasserstoffbe­ triebene Motoren eine Alternative? We­ der Wasserstoff noch Elektrizität sind Energiequellen, sondern sie sind Ener­ gieträger, die auf irgendeine Art Ener­ giezufuhr benötigen. Heutzutage wer­ den zwei Drittel des elektrischen Stroms auf der ganzen Welt in Kohlekraftwer­ ken produziert. Daraus folgt, dass der Umfang des Verkehrs an sich und des Straßenverkehrs im Besonderen an ein umweltverträgliches Maß langfristig angepasst werden muss. Und das würde das Ende der gegenwärtigen Autoindus­ trie bedeuten. Schlussendlich wird die Wirt­ schaftskrise, die noch lange nicht vor­ bei ist, die Autoindustrie komplett um­ gestalten. Das Argument, dass das Aus für nicht wettbewerbsfähige Autoherstel­ ler hingenommen werden sollte, ist momentan aus sozialer, praktischer und politischer Sicht das schlechteste. In Schweden kamen und gingen die In­ dustrien. In den 60ern verschwand die Textilindustrie, in den 70ern und 80ern die Werft und andere Sektoren wuch­ sen: die Autoindustrie und vor allen Dingen der öffentlichen Dienst. Dieser „strukturelle Wandel“ entsprach der of­ fiziellen politischen Linie der Gewerk­ schaften und der Sozialdemokratischen Partei. Heutzutage gibt es jedoch keine an­ deren Wachstumsindustrien und der öf­ fentliche Sektor erlebt Einschnitte. In einer vom Automobil abhängigen Wirt­ schaft wie der schwedischen bedeutet dies ein Desaster. Zweitens besteht eine Industrie wie die Autoindustrie nicht einfach aus einem Haufen Maschinen und Gebäu­ inprekorr 460/461 Die Wirtschaftskrise wird die Autoindustrie komplett umgestalten. den. Sie besteht vielmehr aus den Men­ schen, die in dieser Industrie arbeiten. Denn im Moment steht die Mensch­ heit vor ihrer schwersten Herausfor­ derung überhaupt: eine Wirtschaft und Produktion umzugestalten, die schon seit 250 Jahren auf fossiler Energie be­ ruht. Und dafür brauchen wir alle ver­ fügbaren Ressourcen, um dies zu bewäl­ tigen. Es wäre eine komplett unverant­ wortliche Verschwendung, wenn wir ei­ nen Industriekomplex vernichten wür­ den, der fast über ein ganzes Jahrhun­ dert hinweg aufgebaut und entwickelt worden ist. Die Automobilindustrie verfügt über fachliches Wissen in Logistik, Pro­ duktentwicklung, Produktdesign und Qualitätskontrolle, das an Produktionen jeglicher Art angepasst werden kann. Ei­ ne effiziente Massenproduktion ist ge­ nau das, was wir brauchen, wenn wir die Nutzung fossiler Energien ersetzen wol­ len. Dies würde komplizierte technische Geräte billiger machen und könnte bei der Produktion von Windturbinen und anderer Ausrüstung zur Erzeugung er­ neuerbarer Energie genutzt werden, wie z. B. für Bahnnetze, Züge und andere Fahrzeuge eines nachhaltigen Verkehrs­ systems. Für die ArbeiterInnen der Auto­ industrie sind Wandel und Konversi­ on durchaus nichts Neues. In den ver­ gangenen Jahrzehnten wurden immer neue Modelle in einem absurden Tem­ po auf den Markt gebracht, mit dem Resultat, dass Umrüstungen, Um­ bauten und Umschulungen Gang und Gäbe wurden. Es gibt historische Präzedenzfälle für industrielle Konversion. In den Mo­ naten nach dem Überfall der Japaner auf Pearl Harbor 1941 verbot die amerika­ nische Regierung die Produktion von Privatautos und befahl der Autoindus­ trie, zur Kriegsproduktion zu wechseln. Ford und andere Hersteller kamen dem nach (und verdienten gut daran), in­ dem sie ihre Kenntnisse in der Massen­ produktion auf Bomber und Panzer an­ wandten. Das Gleiche geschah in Groß­ britannien. Um es zusammenfassend zu sagen: Die Autoindustrie ist ein fantastischer und vielseitig einsetzbarer Betrieb, der nicht daran gebunden ist, Autos zu pro­ duzieren. Sie kann eine wichtige Rolle dabei spielen, unsere Gesellschaften in nachhaltige und Kohlendioxid-neutrale Gesellschaften zu verwandeln. Aber letztendlich geht es in der Kli­ mafrage nicht um Technologie. Es geht um Politik, d. h. um Klassenkampf. Und das ist der Punkt, wo die ArbeiterInnen der bedrohten Industrie ins Spiel kom­ men. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo wir, die ArbeiterInnen der bedrohten Autoindustrie ins Spiel kommen. Wir müssen zusammenstehen und für un­ sere Jobs kämpfen, jedoch ist es ein sehr harter Kampf und es ist fast un­ möglich, ihn zu gewinnen. Aus diesem Grund müssen wir uns an die breite Öf­ fentlichkeit wenden, um Unterstützung 5 ÖKOLOGIE Der Straßenverkehr ist verantwortlich für circa 20 % der Emissionen an Treibhausgasen und aktive Teilnahme zu erreichen. Wir müssen so argumentieren, dass die Manager, die den Staat nun um Hil­ fe angehen, ihr Recht auf die Führung der Autoindustrie verwirkt haben. Der Staat darf ihre Macht und anhaltend de­ struktive Produktionsweise nicht noch alimentieren, sondern muss stattdessen die ganze Industrie verstaatlichen und konvertieren, um sichere Jobs und eine Produktion zu schaffen, die uns helfen kann, von der fossilen Wirtschaft weg­ zukommen. Dies wäre eine Plattform für ein breites gesellschaftliches Bünd­ nis, um die Jobs, zugleich aber auch den Planeten zu retten. Ist es möglich, ein solches Bünd­ nis zu bilden, das sich für den Wechsel zu einer alternativen Produktion stark macht und das vom einfachen Arbeiter bis nach oben reicht? Wenn ja, wie? Der erste Schritt wird sein, das Selbstbewusstsein der ArbeiterInnen zu stärken, indem sie lernen, gemeinsam für alles zu kämpfen. Wenn wir jedoch nur über den großen Entwurf reden, oh­ ne uns im alltäglichen Kampf aktiv zu engagieren, werden wir als windige Er­ bauer von Luftschlössern abgestempelt werden. Der zweite Schritt wäre, konkrete Pläne zu entwickeln, wie man die ver­ schiedenen Sektoren konvertieren könnte. 1980 gab es ein Referendum über Atomenergie in Schweden, und eine der wichtigsten Initiativen die Umwelt­ bewegung bestand darin, einen alter­ 6 nativen Energieplan zu entwickeln, der bis ins letzte Detail aufzeigte, wie man Atomenergie abschaffen und durch er­ neuerbare Energie ersetzen kann. Di­ es war ein sehr wichtiger Schritt in der Kampagne, der zur Schulung von Akti­ vistInnen beitrug und den Menschen in­ nerhalb der Bewegung Selbstvertrauen gab. Im Mai diesen Jahres trafen sich UmweltaktivistInnen, Bürgerinitiati­ ven, WissenschaftlerInnen und Gewerk­ schaftsvertreterInnen aus verschiedenen europäischen Ländern (inklusive Bob Crow von der RMT aus Großbritannien) in Köln, um ein umweltfreundliches Ver­ kehrssystem zu diskutieren. Die Konfe­ renz verabschiedete die Kölner Erklä­ rung gegen die Bahnprivatisierung und für ein umweltfreundliches Verkehrs­ system. Ein konkreter Plan, RailEuro­ pe2025, wurde erstellt, wie man das eu­ ropäische Verkehrswesen innerhalb der nächsten 15 Jahre so umgestalten kann, dass die CO2-Emissionen um 75% zu­ rückgehen und somit auch die gesamt­ en Emissionen auf die Hälfte reduziert werden. Dieser Plan gibt den Gewerk­ schaften sowie anderen Bewegungen die Handhabe, politischen Druck aufzu­ bauen. Der dritte wichtige Schritt wäre, solche alternativen Pläne mit den kon­ kreten Arbeitsplätzen zu verbinden, mit der Produktion vor Ort, so wie dies zum Beispiel in den 70ern in Großbri­ tannien bei Lucas Aerospace versucht wurde. Obwohl dieser Kampf verloren ging, hatte er doch weltweit reichende Auswirkungen, die immer noch anhal­ ten. In den späten 70ern gab es in Schwe­ den eine Krise in der Werft- und Stahlin­ dustrie und den Überbleibseln der Texti­ lindustrie. Für eine ganze Zeit lang wur­ de „alternative Produktion“ zu einem weitverbreiteten Schlagwort und Hoff­ nungsträger. Aber so gut wie alle Ver­ suche unter diesem Motto scheiterten daran, dass fast Alle unter „alternati­ ver Produktion“ „andere profitable Pro­ dukte“ verstanden. Wenn wir diese Idee der „alterna­ tiven Produktion“ nutzen wollen, müs­ sen wir aufzeigen, dass wir unsere Fä­ higkeiten nutzen wollen, um ein gesell­ schaftlich nützliches und notwendiges Produkt herzustellen, egal ob es im ka­ pitalistischen Sinne profitabel ist oder nicht. Dies war die Stärke des Plans bei Lucas Aerospace. Ein anderer attraktiver Aspekt der Erfahrung bei Lucas war, dass sich zeigte, was passieren kann, wenn Arbei­ terInnen aus der Tretmühle ihres Alltags ausbrechen. Gegen Ende des 18. Jahr­ hunderts fasste dies Thomas Paine fol­ gendermaßen zusammen: „Revolutionen erzeugen Genie und Talent; aber durch diese Ereignisse tre­ ten diese nur ans Tageslicht. In jedem von uns schlummern massenhaft Fä­ higkeiten, die wir mit ins Grab nehmen, es sei denn, etwas bringt sie zum Erwa­ chen.“ 2 Die dieses Jahr auf der Gewerk­ schaftskonferenz ins Leben gerufene Kampagne gegen den Klimawandel be­ schloss, ein Komitee zu bilden, um mit der Erstellung eines Konversionsplans entlang lokaler Gegebenheiten zu be­ ginnen. Das ist ein Schritt in die rich­ tige Richtung. Lars Henriksson arbeitet in einer schwedischen Autofabrik. Er ist Mitglied der Sozialistischen Partei (SP), der schwedischen Sektion der IV. Internationale. Dieser Artikel ist ein Auszug aus einer Re­ de auf der Konferenz über Klima und Kapita­ lismus, die von Green Left und Socialist Resi­ stance in London am 12 September 2009 orga­ nisiert wurde. Übersetzung: Ana 2 Rights of Man, II, 1792 inprekorr 460/461 Ökonomie Vom 2. bis 4. Oktober 2009 hat im Internationalen Institut für Forschung und Bildung (IRRE) in Amsterdam ein Ökonomie-Seminar stattgefunden. Die in diesem Heft veröffentlichten Artikel von Chris Harman, Claudio Katz, Jean Sanuk, Özlem Onaran, Thadeus Pato wurden für dieses Seminar geschrieben und dort diskutiert. Weitere Beiträge von Esther Vivas, François Chesnais und Michel Husson sind in einer Sonderausgabe der französischen Inprecor veröffentlicht worden.1 An dem Seminar nahmen 32 ÖkonomInnen und politisch Aktive aus 15 Ländern teil. Es hatte die Ziele, die Wirtschaftskrise, die 2008 begonnen hat, in eine historische Perspektive zu stellen und zu analysieren, welche unterschiedlichen Ausprägungen sie auf verschiedenen Kontinenten hat; die marxistische Krisentheorie zu aktualisieren und zu berücksichtigen, welche Änderungen die Globalisierung und die „Finanzialisierung“ mit sich gebracht haben; die Verbindungen von Wirtschaftskrise, Nahrungsmittelkrise, Energiekrise und Klimakrise zu beleuchten. Bei einer Reihe von unterschiedlichen Akzenten und Meinungsverschiedenheiten waren alle, die gesprochen haben, sich darin einig, dass es sich um weit mehr handelt als eine Bankenkrise oder 1 Siehe http://orta.dynalias.org/inprecor/inprecor?numero=556-557. Der Beitrag von Esther Vivas über die internationale Nahrungsmittelpro­ duktion ist auf Englisch zu finden unter: http://www.internationalview­ point.org/spip.php?article1774. eine etwas schwerere Rezession als die der letzten Jahrzehnte (Mexiko 1994, Ostasien 1997/98, Russland und Türkei 1999, Argentinien 2001, geplatzte Blase der „new economy“ in den USA 2001). Die Krise erstreckt sich auf die Mechanismen, die mit der neoliberalen Offensive durchgesetzt worden sind; es handelt sich um eine Strukturkrise des internationalen Kapitalismus; wir haben erst den Anfang dieser Krise erlebt, auch bei einer konjunkturellen Erholung wird es weiter ein hohes Niveau von Arbeitslosigkeit und Armut geben. Im letzten Teil des Seminars wurden Referate über die Nahrungsmittelkrise und über die Energie-, Umwelt- und Klimakrise sowie über fortschrittliche Wege aus der Krise im Süden und im Norden vorgetragen. Bei dem letzten Thema wurde das Ziel benannt, ein Programm von Maßnahmen zu formulieren, die den unmittelbaren Anliegen der abhängig Beschäftigten und Ausgegrenzten entsprechen und zugleich eine Brücke hin zu einer „ökosozialistischen Gesellschaft“ schlagen. Dabei geht es darum, über die Weigerung, für die Krise zu zahlen, und auch über eine radikale Umverteilung des vorhandenen Reichtums hinauszugehen, sondern die Fragen aufzuwerfen und anzugehen, was unter Reichtum zu verstehen ist, und wie Reichtum produziert wird, Fragen der Zivilisation, Fragen der Kontrolle und Entscheidung. Fr. D. EU: Die weltweite Krise und die Wirtschaftspolitik: Kann die Politik den Kapitalismus vor sich selbst retten? Özlem Onaran Die neoliberale Politik und der sinkende Anteil der Arbeitslöhne haben ein frucht­ bares Terrain für die Entstehung einer weltweiten Krise geschaffen, die mit zu­ nehmender Verschuldung und einer Aus­ weitung der Risikomärkte im Kredit-, Wohnungs- und Versicherungswesen ein­ hergeht. Daher stecken wir in einer Kri­ se, die in steigenden Ausbeutungsraten und extremer Ungleichheit in der Einkom­ mensverteilung ihren Ausdruck findet. Die Wirtschaftspolitik beteiligt sich noch an diesen Verteilungskämpfen, statt die Kri­ inprekorr 460/461 se zu bekämpfen. Dies erklärt auch, wa­ rum die internationalen und nationalen In­ stitutionen erst auf die Anhäufung der Ri­ siken reagiert haben, als diese sich in ei­ ne veritable Krise verwandelt hatten. Die Eliten an der Macht, die aus den Schalt­ zentralen des Kapitals stammen, reagie­ ren darauf mit einer Politik, die die Profi­ te durch massive staatliche Interventionen hoch halten soll, um dann zum business as usual des Neoliberalismus zurückzukeh­ ren. Wie zu erwarten gelten die Bestre­ bungen dem Ziel, den Kapitalismus vor sich selbst zu retten, und nicht der Umver­ teilung der Einkommen und Reichtümer, solange kein Druck durch Massenmobi­ lisierungen ausgeübt wird. Gleichwohl übersehen die herrschenden Eliten in ih­ rem frommen Wunsch, die Geschäfte wie gehabt weiterlaufen zu lassen, die vielfäl­ tigen Dimensionen der Krise. An erster Stelle steht die wirtschaft­ liche Dimension. Der Kapitalismus steckt in einer erheblichen Krise der Kapitalverwertung. Der Neoliberalis­ mus hat versucht, die vorangegangene 7 Ökonomie Krise zu lösen, indem er den keynesi­ anischen Konsens des goldenen Zeital­ ters des Kapitalismus aufkündigte und auf offene Konfrontation zu den Lohn­ abhängigen ging. Dadurch konnten im Laufe der 90er Jahre in den wichtigsten kapitalistischen Ländern die Profitraten wieder hergestellt werden. Auf der an­ deren Seite wurde auf diesem Wege ei­ ne potentielle Krise der Kapitalverwer­ tung angebahnt als Folge niedriger Löh­ ne und zurückgehender Investitionen. Letztlich führte dies nur zu einer Verla­ gerung der Probleme: Statt der Überak­ kumulation und der sinkenden Profitrate der 70er Jahre kam es nun zu einer Ver­ wertungskrise. Die möglichen nega­ tiven Auswirkungen, die die Finanzia­ lisierung und die dramatische Einkom­ mensverschlechterung unter den Lohn­ abhängigen während der letzten 20 Jah­ re auf Konsum und Investitionen geha­ bt haben, wurden kompensiert, indem die USA ihren Konsum durch welt­ weite Verschuldung finanzierten. Seit dem Sommer 2007 ist auch dieser Aus­ weg versperrt, und die kapitalistische Wirtschaft befindet sich in einer ausge­ wachsenen Systemkrise, deren Ausmaß mit der Großen Depression vergleich­ bar ist. Lediglich durch eine nie da ge­ wesene politische Intervention wird ih­ re tatsächliche Dimension verschleiert. Nachdem nun die Finanzmechanismen, die die Schuldenanhäufung ermögli­ cht haben, kollabiert sind, bleibt unklar, wie die Verwertungskrise des Kapitals mit dieser Strategie überwunden wer­ den soll. Die zweite Dimension betrifft die Ökologie. Alle Bemühungen um wirt­ schaftliche Erholung zielen darauf, Wachstum und Beschäftigung durch er­ höhten Konsum aufrecht zu erhalten, und leben von der Hoffnung, dass durch wundersame Neuerungen in der Ener­ gieeffizienz der Verbrauch beibehalten werden kann. Im Unterschied jedoch zur letzten Systemkrise in den 70er Jah­ ren sind die ökologischen Grenzen des Wachstums inzwischen wissenschaft­ lich fest untermauert und es gibt kei­ ne ernsthaften Zweifel daran, dass Wie­ deraufschwung nicht die Rückkehr zum business as usual bedeuten darf, so­ wohl in ökologischer als auch in öko­ nomischer Hinsicht. Wenn die Nutzung der Umweltressourcen auf „Nachhal­ tigkeit“ abzielen soll, wird das langfri­ stige Wachstum bei Null oder darunter liegen müssen, d. h. es muss gleich der 8 Wachstumsrate der „Umweltproduktivi­ tät“ sein. Um jedoch auch sozial erstre­ benswert zu sein, muss ein solches Sy­ stem Arbeitsplätze auf hohem Niveau und eine gleiche Verteilung der Reich­ tümer bieten. Und genau dieser Punkt ist mit dem Kapitalismus unvereinbar, zumindest solange es keine grundle­ gende technologische Revolution gibt. Eine weitere Dimension betrifft die politische Legitimität. Das Ausmaß der aktuellen Krise hat die Hegemonie des Neoliberalismus ins Wanken gebracht und eine Reform des Wirtschaftssy­ stems weithin zum Thema gemacht. Durch zunehmende Arbeitslosigkeit und Ungleichheit in Westeuropa sowie die Wiederkehr der nach 20 Jahren Ka­ pitalismus für überwunden geglaubten düsteren Zeiten in Osteuropa, als der Zerfall des Ostblocks zunächst zu einer Krise führte, wird eine tiefe politische Unzufriedenheit entstehen. Dies schafft Raum für eine Radikalisierung, aber erst muss die Linke die ideologische Hege­ monie des Kapitalismus offen heraus­ fordern. Angesichts dieser Vielfältigkeit der Krise bleibt offen, woher der Auf­ schwung kommen soll, selbst wenn die Rezession ihre Talsohle erreicht hat. Da business as usual nicht langfristig trag­ bar ist, stellt sich die Frage, ob der Ka­ pitalismus neue institutionelle Struk­ turen und einen neuen Wirtschaftssek­ tor als Wachstumsmotor hervorbringen, die Grenzen, die ihm durch ökologische Nachhaltigkeit und politische Legitima­ tion gesetzt werden, überwinden und aus dieser Krise heraus in einen neu­ en Aufstiegszyklus eintreten kann. Wie einfallsreich der Kapitalismus in sei­ ner Destruktivkraft ist, bleibt unbestrit­ ten. Die dadurch entstehenden Verwer­ fungen eröffnen jedoch Spielräume für einen radikalen Systemwechsel. Die Krise der neoliberalen Ära des Kapitalismus Die neoliberale Wirtschaftspolitik ent­ stand als Reaktion der Kapitalisten auf die Krise der 70er Jahre. Seit den 80ern wurde von der Weltwirtschaft auf nati­ onaler und internationaler Ebene eine Deregulierung der Arbeit, des Waren­ verkehrs und der Finanzmärkte durch­ gesetzt. Mit dem Zerfall der Sowjetuni­ on und der Comeconstaaten entstanden nach den 90er Jahren neue Absatzmär­ kte und eine Reservearmee billiger Ar­ beitskräfte, wodurch die Sozialstaaten des Westens der Notwendigkeit entho­ ben wurden, den Lohnabhängigen ei­ nen bestimmten Lebensstandard zu ge­ währen. Infolgedessen erlitt die Arbei­ terbewegung seit Anfang der 80er ei­ nen dramatischen Abstieg ihrer Durch­ setzungsfähigkeit und der Lohnquote in den wichtigsten kapitalistischen Län­ dern (Grafik 1). Dieser historische Ver­ fall der Lohnquote griff in der Folge von den Metropolen auf die wichtigsten Schwellenländer in Lateinamerika und Asien sowie auf Osteuropa über. Über­ all dort wurden dieselben neoliberalen Direktiven angewandt. Hinter dieser an sich schon recht bemerkenswerten welt­ weiten Entwicklung verbirgt sich noch ein weiterer wesentlicher Faktor: die en­ ormen Gehälter der Unternehmensvor­ stände und anderer Topverdiener unter den leitenden Angestellten werden in diese Arbeitseinkommen reingerechnet und der Anteil dieser Spitzenverdiener hat im Lauf der letzten 20 Jahre erheb­ lich zulasten der übrigen Lohnabhängi­ gen zugenommen.1 In den USA und den meisten EU-Ländern hat die verschärf­ te Ausbeutungsrate dazu geführt, dass die Profitrate Ende der 90er/Anfang des Jahrtausends wieder das Niveau der frü­ hen 70er Jahre erreicht haben (Grafik 2). Der Wiederanstieg der Profitrate voll­ zog sich nicht nur in der Gesamtwirt­ schaft sondern auch im produzierenden und gewerblichen Sektor, dort aber we­ gen der hohen kapitalistischen Konkur­ renz in einem geringeren Umfang. Die­ se Wiederherstellung der Profitrate war einerseits die Folge der fallenden Lohn­ quote und damit der verschärften Aus­ beutung, andererseits auch der geringen Investitionen der Gewinne in die Kern­ aktivitäten der Unternehmen, sowohl in den EU-Ländern als auch in den USA. Für die USA ermöglichen genauere Zahlen, die Verteilung innerhalb der ka­ pitalistischen Klasse zu differenzieren. Der Anteil der Dividenden und Zinsge­ winne an den Profiten ist in den letzten 20 Jahren grundlegend gestiegen. Das Verhältnis von Investitionen zu Dividen­ den und Zinsgewinnen ist auch in den USA rückläufig. In der neoliberalen Ära des Kapita­ lismus gibt es zwei grundlegende lang­ fristige Widersprüche. Erstens wurden 1 World of Work: Income Inequalities in the Age of Financial Globalization, ILO, Genf 2008. inprekorr 460/461 Ökonomie Grafik 1: Entwicklung der Lohnquote (Großbritannien, EU -15, USA, Deutschland) in dieser Zeit höhere Profite für die mul­ tinationalen Konzerne besonders im Fi­ nanzsektor generiert. Diese gestiegenen Finanzrenditen haben jedoch die Ge­ winne aus der Realwirtschaft in zahl­ reichen Fällen ersetzt. Mit der wachsen­ den Ausdehnung der Finanzwirtschaft geriet das Investitionsverhalten der Un­ ternehmen zunehmend in den Schatten der steigenden Aktienwerte. Lazonick und O’Sullivan2 belegen, dass ein Para­ 2 Lazonick W. et O’Sullivan M., « Maximizing digmenwechsel unter den Unternehmern stattgefunden hat: Statt zu „bewahren und zu investieren“ wird „geschrumpft und verteilt“. Die Gehaltsvorstellungen der Manager, die sich an den auf kurz­ fristige Gewinne fixierten Finanzmärk­ ten orientieren, haben die Maxime des shareholder-value weiter verfestigt. Die Deregulierung der Finanzmärkte und der Druck der dortigen Investoren ha­ shareholder value : a new ideology for corpo­ rate governance », Economy and Society n° 29, pp. 13-35. ben die Neigung befördert, Vermögens­ werte lieber zu kaufen statt zu schaf­ fen. Zugleich haben die maßgeblichen Wirtschaftspolitiker hartnäckig Vertrau­ en in die volatilen Finanzmärkte einge­ worben. Das vorrangige Ziel der De­ regulierungen lag darin, die Interessen der Coupon-Schneider zu bedienen, und auch in Krisenzeiten gab es für sie Inve­ stitionsbeihilfen, Steuererleichterungen und Stützungsaktionen. Die Kehrseite dieser Entwicklung war die Deckelung der Lohnabhängigen. In gewisser Weise wurde durch die Absenkung der Lohn­ quote das Abschmelzen der Profite in der Realwirtschaft infolge der Zinsbela­ stung aufgefangen. Im Ergebnis hat sich das Verhält­ nis zwischen Renditen und Investiti­ onen verschoben: höhere Gewinne füh­ ren nicht mehr automatisch zu höheren Investitionen. Da der Anteil der Divi­ denden und Zinszahlungen an den Ge­ winnen während der vergangenen 20 Jahre erheblich zugenommen hat, ist der für Investitionen zurückgegangen. Trotz höherer Profitraten lagen die wirt­ schaftlichen Wachstumsraten nicht nur in den USA sondern auch in den ande­ ren führenden kapitalistischen Ländern (Deutschland, Frankreich und Großbri­ tannien) wie auch in manchen Schwel­ lenländern (bspw. Lateinamerika oder Grafik 2: Profitraten inprekorr 460/461 9 Ökonomie Türkei) weit unter ihrem historischen Trend. In den Augen des Kapitals wäre es widersinnig gewesen, inmitten einer deregulierten Finanzwirtschaft auf kurz­ fristige Gewinnoptionen zu verzichten, um langfristig gebundene Investitionen in Sachwerte mit ungewissem Ausgang zu tätigen. Notabene galt für das Kapital nach 1980 nicht die Profitrate als Aus­ gangspunkt, die Anfang der 60er Jah­ re im Produktionssektor erzielt worden war und über den heutigen Werten gele­ gen haben mochte, sondern die kurzfri­ stige Rendite der Finanzwerte. Insofern ist es wenig stichhaltig, diese Krise als das Ergebnis des tendenziellen Falls der Profitrate infolge der unvermeidbaren Zunahme der organischen Zusammen­ setzung des Kapitals zu sehen, wie dies Choonara, Harmann und Klimann3 tun, oder als Folge der gestiegenen internati­ onalen Konkurrenz, wie Brenner argu­ mentiert.4 Zweitens war die sinkende Lohn­ quote für das System mithin ursäch­ lich für die Verwertungskrise. Denn Ge­ winne können nur realisiert werden, wenn eine hinreichend zahlungsfähige Nachfrage für die Waren und Dienst­ leistungen existiert. Die schwindende Kaufkraft der Arbeitenden schlägt sich negativ auf den Verbrauch nieder, weil der vergleichsweise marginale Verzehr der Profiteure den abnehmenden Ver­ zehr der Lohnempfänger nicht aufwie­ gen kann. Dies dämpft zusätzlich die In­ vestitionen, die bereits unter der Aus­ richtung auf den shareholder value lei­ den. Und genau an diesem Punkt schie­ nen die finanztechnischen Neuerungen eine kurzfristige Lösung für die Krise des Neoliberalismus in den 90er Jahren parat zu haben: Wachstum durch Kon­ sum auf Pump. Notabene wäre ohne die ungleiche Einkommensverteilung ein auf Schulden beruhendes Wachstum 3 Cf. Choonara J., « Marxist accounts of the cur­ rent crisis », International Socialism n° 83, http://www.isj.org.uk/?id=557 ; Harmann Chris, « The Slump of the 1930s and the Crisis Today », International Socialism n° 121, www. isj.org.uk/?id=506; siehe auch den Artikel in der vorliegenden Ausgabe; Kliman Andrew, « “The Destruction of Capital” and the Cur­ rent Economic Crisis », http://akliman.square­ space.com/crisis-intervention/ 4 Brenner Robert, « What is good for Goldman Sachs is good for America – The origins of the current crisis », Prologue to the Spanish trans­ lation of Economics of Global Turbulence, Akal; s. auch “Die Wirtschaft in einer krisen­ geschüttelten Welt”, Interview mit R. Brenner, Inprekorr 452/453 10 niemals notwendig oder möglich gewe­ sen. Besonders in den USA, aber auch in England, Irland und sogar manchen kontinentaleuropäischen Ländern wie Holland oder Dänemark hat die Ver­ schuldung der Haushalte während der letzten zehn Jahre dramatisch zugenom­ men. Der Anstieg der Hypothekenkre­ dite und der Immobilienpreise haben sich dabei gegenseitig hochgeschaukelt, wobei der im Zuge der Immobilienbla­ se steigende Wert der Immobilien neue Kredite ermöglichte und so den Kon­ sum anheizte. Obwohl das Wachstum unter dem der 60er Jahre lag, muss di­ ese Phase als eine neue lange expansive Welle gelten, mit der Besonderheit, dass die Gewinne nicht zu Investitionen ge­ führt und das Wachstum keine Arbeits­ plätze geschaffen haben und der Finanz­ markt zunehmend instabiler geworden ist. Die Finanzialisierung hat zu einem Schulden induzierten Wachstum durch kurzfristige Stützung des Konsums ge­ führt, aber die Schulden müssen in der Zukunft bezahlt werden. Wegen der ho­ hen Verschuldung nimmt auch die An­ fälligkeit der Wirtschaft für Schwan­ kungen auf dem Kreditsektor zu. Durch die Deregulierung der Fi­ nanzmärkte und die darauf folgenden Innovationen wie besicherte Anleihen (MBS), forderungsbesicherte Wert­ papiere (CDO) und Kreditderivaten (CDS) wurde das Schulden gestützte Wachstumsmodell noch gefördert. Di­ ese Innovationen und die „originate to distribute“-Strategie (Verkauf von For­ derungen) der Banken haben die Kredit­ summen, die die Banken am Eigenkapi­ tal gemessen vergeben konnten, verviel­ facht. Die Prämien für die Banker, die Bankprovisionen, die hohen Vorstands­ bezüge dank der hohen Gewinne und die Provisionen für die Rating-Agen­ turen haben die Investitionsmechanis­ men in ein Kurz-Frist-Denken perver­ tiert, das blind gegenüber den Risiken dieses Modells ist. Selbst wenn das Aus­ fallrisiko bekannt war, spielte dies in dem auf Kurzfristigkeit angelegten Seg­ ment der Subprime-Kredite keine grö­ ßere Rolle. Erstens waren die meisten dieser Kredite bereits an andere Inve­ storen in Form hochrentabler besicher­ ter Anleihen verkauft. Zweitens konnten im Falle der Zahlungsunfähigkeit die verpfändeten Immobilien verkauft wer­ den, was für den Gläubiger höchst profi­ tabel war, solange die Immobilienpreise immer weiter stiegen. Allerdings führte dies Bankenmodell zu einem sehr risi­ koreichen Wirtschaftsmodell und zu ei­ ner Zeitbombe, die irgendwann hochge­ hen musste. Die schlechten Nachrichten vom Subprime-Markt lösten schließ­ lich die Explosion aus, die zunächst die CDO’s betraf, dann den Interbanken­ markt und schließlich brach der gesamte Kreditmarkt weltweit zusammen. Interessant dabei ist, warum es so lange gedauert hat, bis die Zeitbombe explodierte. Die Antwort liegt in der Ei­ gendynamik der Erwartungshaltung. Da das Schulden gestützte Wachstumsmo­ dell kurzfristig hohes Wachstum und Profite erzeugte, wurde der Optimis­ mus auf dem Weg der self-fulfilling pro­ phecy angeheizt und die Risiken wur­ den immer geringer geschätzt, selbst von den anfänglich Konservativen. In einer Welt des Konkurrenzzwangs müs­ sen auch diejenigen, die die Risiken er­ kennen, sich zu den Risiken hinreißen lassen, wenn sie ihre Position als Mak­ ler, Banker oder Vorstand behalten wol­ len. Denn das Platzen der Blase ist eine Frage der Zeit und die kann länger dau­ ern als die kurzfristige Gewinnerwar­ tung der Aktionäre, die deswegen auch nicht nach sichereren Anlagen streben. Nur wenige Wochen vor dem Crash im Juli 2007 hatte der ehemalige Vor­ standsvorsitzende der Citibank Chuck Prince noch gesagt: „Wenn die Musik – im Sinne von Liquidität – aufhört, wird die Lage kompliziert. Aber so lange die Musik noch spielt, muss man aufstehen und tanzen.“5 Michael Mayo ist ein Bei­ spiel für einen Bank-Analysten, der sei­ ne Stelle wegen „Konservatismus“ ver­ loren hat. „Er riet 1999 zum Verkauf von Bankaktien und blieb auch dabei, als es ihn seinen Job bei der Credit Suisse und Freunde bei der Wall Street kostete. Dieses Jahr meinte er, dass die Banken viel zu sehr auf forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) vertrauten und dass wir beim Fall der Immobilienpreise eine Kettenreaktion abnehmender Immobili­ enpreise und abnehmender Kreditsiche­ rung erleben würden, ganz zu schwei­ gen von den politischen Weiterungen (Fortune, 2008). Unter dem Druck des Wettbewerbs greifen sowohl die Ban­ ken als auch die Schuldner vermehrt auf Fremdkapital zurück. Dadurch wuchs die Anfälligkeit der Wirtschaft und es entstand ein systematisches Risiko. Als 5 Zitiert durch Elliot L., « After the orgy, let’s clean up », Guardian Weekly, 3. August 2007. inprekorr 460/461 Ökonomie dann der Crash kam, waren Kreditklem­ me und der Kollaps des Schulden ge­ stützten Wachstumsmodells unvermeid­ lich. Ein wesentlicherer Ansatz zur Er­ klärung der Krise ist die Einkommens­ verteilung, die diesem Risiko behaf­ teten Modell zugrunde liegt. Eine Kri­ senprävention erfordert die Lösung der Probleme auf der Verteilungsebene, die hinter dem Schulden gestützten Wachs­ tumsmodell stehen, d. h. eine Umvertei­ lung der Einkommen und Reichtümer. Aber die Mächtigen der Welt, die über ihre jeweiligen Staatsregierungen die Weltpolitik beeinflussen, wären mit ei­ ner solchen Lösung nicht einverstanden. Daher hoffen die politischen Instituti­ onen auf eine „weiche Landung“, die es ermöglicht, die wirtschaftlichen „Ex­ zesse“ zu korrigieren, ohne die Kon­ flikte auf der Verteilungsebene ins Spiel zu bringen. Dieses Konsummodel auf Pump hat in den USA zu einer negativen Zah­ lungsbilanz von über 6% des BIP ge­ führt. Dies Defizit wurde durch die Überschüsse anderer Industrielän­ der wie Japan und Deutschland, durch Schwellenländer wie China und Süd­ korea und die Erdölländer des Na­ hen Ostens finanziert. In Deutschland und Japan kamen die Überschüsse in der Zahlungsbilanz und der Kapital­ fluss in die USA durch Zurückhaltung bei den Löhnen zustande, die zu gerin­ gerer Binnennachfrage und steigenden Exporten führte. Auch dies ist wiede­ rum eine Konsequenz der ungleichen Verteilung. Was die Schwellenländer wie China und Südkorea angeht, ha­ ben die Erfahrungen aus den Krisen in Asien und Lateinamerika dazu ge­ führt, dass Währungsreserven gebildet wurden, um sich gegen Abflüsse von Spekulationskapital zu wappnen. Hier spielt die internationale Dimension der Ungleichheit eine große Rolle: unter Tab 1 Wirtschaftsaussichten der OECD-Staaten, Juni 2009, Hochrechnungen 2008 2009 2010 2009* BIP, jährliches Wachstum in % 1,1 Arbeitslosenquote 5,8 -2,8 0,9 -2,8 9,3 10,1 Jährlicher Reallohnanstieg in % -0,6 3,5 0,7 Haushaltsdefizit/BIP USA -5,9 -10,1 -11,2 Kurzfristige Zinsen 3,2 1,0 0,5 Inflation 3,8 -0,6 1,0 -0,7 -6,8 -0,7 4,0 5,2 5,7 Jährlicher Reallohnanstieg in % -1,4 -0,7 0,7 Haushaltsdefizit/BIP Die Krise in den EU-Ländern West- und Osteuropas Japan BIP, jährliches Wachstum in % Arbeitslosenquote -2,7 -7,8 -8,7 Kurzfristige Zinsen 0,7 0,6 0,3 Inflation 1,4 -1,4 -1,4 -5,6 Euro-Zone (12 OECD-Mitglieder) BIP, jährliches Wachstum in % Arbeitslosenquote -0,5 -4,8 0,0 7,5 10,0 12,0 Jährlicher Reallohnanstieg in % -0,8 0,6 0,6 Haushaltsdefizit/BIP -1,9 -5,6 -7,0 Kurzfristige Zinsen 4,7 1,2 0,5 Inflation 3,3 0,5 0,7 BIP, jährliches Wachstum in % 0,7 -4,3 0,0 Arbeitslosenquote 5,7 8,2 9,7 -3,9 Großbritannien Jährlicher Reallohnanstieg in % -1,6 -1,3 -0,1 Haushaltsdefizit/BIP -5,5 -12,8 -14,0 Kurzfristige Zinsen 5,5 1,4 0,6 Inflation 3,6 1,9 1,2 * bereinigte Zahlen vom September 2009 inprekorr 460/461 der Bedrohung durch die frei zirkulie­ renden und kurzfristig volatilen inter­ nationalen Finanzkapitalflüsse haben sie ihre Überschüsse in der Zahlungs­ bilanz in US-Regierungsanleihen inve­ stiert anstatt die Entwicklung der eige­ nen Länder zu fördern. Auf europäischer Ebene beför­ derte die starke Lohnzurückhaltung in Deutschland die Ungleichgewichte in­ nerhalb Westeuropas und auch zwi­ schen West und Ost. Im Westen führte das Ausbleiben einer systematischen In­ dustrieförderung und öffentlicher Inve­ stitionen in Ländern wie Spanien, Grie­ chenland, Portugal, Italien und Irland zu einem Anstieg der Produktionsko­ sten (Lohnstückkosten). Auf diesem Weg gingen die hohen Überschüsse in der Zahlungsbilanz der neomerkantili­ stischen Länder der EU – Deutschland gemeinsam mit Österreich, Holland und Finnland – mit einer Zunahme der Han­ delsdefizite in den anderen EU-Ländern einher. Auch das niedrige Lohnniveau in Osteuropa hat diese Länder nicht vor ei­ ner defizitären Handelsbilanz bewahrt, da die dort ansässigen multinationalen Konzerne aus Europa umfangreiche Im­ porte über ihre internationalen Zuliefe­ rer ausführten als auch wegen der hohen Profite, die sie erzielten und teils in die Heimatländer transferierten, teils re-in­ vestierten. -4,7 Die Krise offenbart die Divergenzen und Bruchstellen zwischen den Ländern Westeuropas und denen der Peripherie. 1. Westeuropa Obwohl die Krise von den USA ausging, sind die Auswirkungen in Europa größer, was mithin auf die umfassenden staat­ lichen Konjunkturprogramme und die prompte Reaktion in den USA zurück­ zuführen ist. Die aktualisierten Konjunk­ turprognosen des OECD-Wirtschaftsaus­ blick vom September 2009 gehen davon aus, dass das BIP 2009 in den USA um 2,8% schrumpfen wird, während für die 12 Länder der Euro-Zone ein Rückgang von 3,9% und für England von 4,7% er­ wartet wird (Tabelle 1). Dass in Eng­ land die Rezession stärker ausfällt, liegt an der größeren Abhängigkeit vom Fi­ nanzmarkt, dem Schuldenabbau der Ban­ ken, dem Platzen der Immobilienblase und der Verschuldung der Haushalte. In­ 11 Ökonomie nerhalb der Eurozone klaffen die Progno­ sen weit auseinander: für Deutschland und Italien werden -4,8% rsp. -5,2% erwartet, in Frankreich hingegen nur -2,1%. Auch die jeweiligen Gründe für die wirtschaft­ liche Anfälligkeit in den EU-Ländern sind unterschiedlich. Deutschland leidet auf­ grund schrumpfender Exportmärkte be­ sonders unter seiner fatalen neo-merkan­ tilistischen Ausrichtung, d. h. seinem auf Lohndumping beruhenden exportbezo­ genen Wachstum, das die Binnennachfra­ ge seit Jahrzehnten stagnieren lässt. Die in­ zwischen chronisch defizitären Leistungs­ bilanzen Italiens, Spaniens, Griechenlands und Portugals resultieren aus dem histo­ rischen Versagen, die EU und die gemein­ same Währung geschaffen zu haben, oh­ ne sich dabei politisch näher gekommen zu sein. Dies erweist sich jetzt als deletär: die Finanzinvestoren verlangen seit 2007 viel höhere Zinsen für die Staatsanleihen dieser defizitären EU-Länder als bspw. für Deutschland. Die Fähigkeit der einzelnen Länder, auf den Crash zu reagieren, wird auch durch das jeweilige Steueraufkom­ men limitiert. Auch Österreich reiht sich ein unter die Hochzinsländer infolge des ausgeprägten Engagements seiner Banken in Osteuropa. In Irland wird die Rezession aufgrund des aufgeblähten Bankensektors und der geplatzten Immobilienblase nicht nur 2009 sehr viel stärker (-9,8% nach den Vorläufigen Prognosen der OECD vom Ju­ ni 2009) ausfallen, sondern auch in 2010 anhalten. Auch in Spanien dürfte die Re­ zession infolge der geplatzten Immobili­ enblase und des Rückgangs der Bautätig­ keit noch 2010 anhalten. Für die anderen westeuropäischen Länder außer Spanien und Irland rech­ net die OECD mit einer schnelleren Er­ holung als ursprünglich angenommen, „wobei sich der Konjunkturaufschwung vorerst in kleineren Schritten vollziehen dürfte“.6 Dabei muss man die Progno­ sen der OECD noch als obere Marge an­ sehen. Die Reallöhne dürften sowohl in Deutschland als auch in England (um 1,2% bzw. 1,3% nach eigenen Berech­ nungen anhand der Vorhersagen für No­ minallöhne und Inflationsrate) in 2009, aber auch in 2010 sinken, wobei be­ reits 2008 ein Rückgang von 0,9% bzw. 1,6% verzeichnet wurde. Auch in Bel­ gien und Irland dürften die Reallöh­ ne 2009 zurückgehen, in Irland voraus­ sichtlich sogar auch 2010. Dies ist umso bemerkenswerter, da die OECD ja von 6 OECD, Interim Economic Assessment Sep­ tember 2009. 12 einem – zwar schwachen, aber positiven – Wirtschaftswachstum für 2010 aus­ geht. Reallohnverluste gab es 2008 be­ reits auch in Frankreich, Italien, Öster­ reich, Belgien, Luxemburg und Schwe­ den. Durch die deutliche und dauerhafte Zunahme der Arbeitslosigkeit steigt die Wahrscheinlichkeit weiteren Real­ lohnabbaus für 2010. Wenn sich die po­ litischen und organisatorischen Bedin­ gungen nicht ändern, werden die Lohn­ abhängigen noch drastischer an Durch­ setzungsvermögen verlieren. Das Beispiel Japans zeigt, dass zu Beginn einer Deflation oder lang dau­ ernden Rezession die Löhne stagnie­ ren oder mitunter sogar leicht steigen. Mit Fortdauer der Deflation oder Re­ zession sinken sogar die Nominallöh­ ne: zwischen 1992 und 2007 um 8,9%.7 Der Rückgang der Löhne in Osteuropa unter der Last der globalen Krise wird die Löhne in Westeuropa noch zusätz­ lich unter Konkurrenzdruck setzen. Ab­ sehbar ist außerdem eine weitere Zu­ nahme des Gefälles entlang der Quali­ fikation und der Zerstückelung von Ar­ beitsplätzen. Schon jetzt verlieren Zeit­ arbeiter als erste ihre Stelle, während die qualifizierteren Arbeiter gehalten wer­ den. Andererseits waren in bestimmten Bereichen in der Automobil- und Me­ tallindustrie sowie den Finanzdienstlei­ stungen auch qualifizierte Arbeitskräf­ te als erste betroffen. Dazu kommt, dass die anstehenden Kürzungen der staat­ lichen Sozialausgaben besonders die Lohnabhängigen treffen werden. Die Arbeitslosigkeit wird in England und der Euro-Zone wohl um 2,5% stei­ gen und 2010 weiter zunehmen. Beson­ ders hart werden Irland mit 6,2% und Spanien mit 6,8% betroffen sein. Insgesamt konnte durch den entspre­ chenden Einsatz von Haushaltsmitteln in vielen westeuropäischen Ländern der Crash abgefedert werden. Diese Politik war übrigens seinerzeit den Schwellen­ ländern in der Peripherie während der Krisen in den Jahren 1990 und 2000 verwehrt worden. Insofern erscheint der Crash anfänglich weniger ernst als der Umfang der Probleme erwarten lässt. Nichtsdestotrotz ist ein Verlauf der Kri­ se in Form eines „L“ (Rezession mit fol­ gender Stagnation) mit langer rezessiver Phase sehr wahrscheinlich. Die wirt­ 7 Onaran Ö., « Wage share, globalization, and crisis: The case of manufacturing industry in Korea, Mexico, and Turkey », International Review of Applied Economics n° 23(2). schaftliche Talsohle mag erreicht sein, aber ein Entkommen scheint auf lange Zeit nicht möglich zu sein und weitere Einbrüche können nicht ausgeschlossen werden. Trotz der Auffangeffekte der politischen Gegenmaßnahmen kann die Krise in Anbetracht ihrer globalen Di­ mension noch sehr viel tiefer reichen als die lange Rezession in Japan in den 90er Jahren. 2. Die mittel- und osteuropäischen EU-Länder Während der Weltwirtschaftskrise wur­ den die osteuropäischen Schwellenlän­ der durch den Zusammenbruch der Kre­ ditmärkte und die Kapitalflucht hart ge­ troffen. Zu der Bankenkrise kommen möglicherweise Währungskrisen hin­ zu. Nach dem Schock des Zusammen­ bruchs ihrer Gesellschaftssysteme und einem Jahrzehnt voller Umstrukturie­ rungen werden diese Länder erneut von den Kosten der Integration in einen de­ regulierten Weltmarkt betroffen. Der anfängliche Optimismus, dass Ost- und Westwirtschaft nicht notwendigerwei­ se zusammenhängen, hat sich als obso­ let erwiesen. Seit dem Herbst 2008 sind die Hoffnungen auf eine Bauchlandung von der Wirklichkeit des crash eingeholt worden. Die Stimmung an den Märkten ist pessimistisch geworden und die Ein­ bettung in die EU scheint nur begrenzt zu helfen. Das Hauptproblem dieser Region lag in der außerordentlichen Abhängig­ keit von den ausländischen Kapitalflüs­ sen. Die Umkehr dieser Flüsse muss­ te zwangsläufig dazu führen, dass der Boom platzte – eine typische Folge die­ ser Abhängigkeit. Auf dies jetzt Reali­ tät gewordene Risiko ist von vielen Au­ toren – darunter der Autorin – hinge­ wiesen worden.8 Auch ohne die welt­ weite Krise hätte dies auf unspektaku­ lärere Weise passieren können, wenn sich nämlich das Vertrauen in die über­ 8 Onaran Ö. « International financial markets and fragility in the Eastern Europe : “can it happen” here ? » in Dollarization, Euroization and Financial Instability, Becker J. et Weissen­ bacher R. (eds), Metropolis-Verlag, Marburg 2007, pp. 129-148 ; Becker J., « Dollarisation in Latin America and Euroisation in Eastern Europe : Parallels and Differences » in Dol­ larization, Euroization and Financial Instabil­ ity, Becker J. et Weissenbacher R. (eds), Me­ tropolis-Verlag, Marburg 2007, pp. 129-148 ; Goldstein M., « What might the next emerg­ ing-market financial crisis look like ? », Insti­ tute for International Economics, Working Pa­ per Series n° 0 5-7. inprekorr 460/461 Ökonomie bewerteten Währungen bei hoch defi­ zitärer Leistungsbilanz erschöpft hätte. Die Wirtschaftspolitik vor Ort blende­ te beharrlich die Möglichkeit einer mas­ siven Kapitalflucht aus. Dies ist, als ob ein Hausbewohner ausströmendes Gas ignoriert in der Hoffnung, dass sich das Problem von selbst erledigt. Letztlich können die Märkte ein systemisches Ri­ siko nicht verhindern, sondern es nur vertagen und dabei verschlimmern. Im Unterschied zu den früheren Kri­ senzyklen in den peripheren Ländern handelte es sich diesmal um eine glo­ bale und nicht bloß regionale Krise. Zwar hat sie in den Metropolen begon­ nen, aber ihre Auswirkungen auf die Pe­ ripherie werden schwerwiegender sein. Da sich die Kreditklemme weltweit be­ merkbar macht, ist eine Rückkehr der Kapitaleinströme nach dem Crash und der Abwertung der Währungen unwahr­ scheinlich. Eine weitere Folge der glo­ balen Ausbreitung der Krise liegt in der starken Schrumpfung der Exportmär­ kte. Eine Abwertung der Währungen, die üblicherweise auf einen Crash folgt, würde nur die Zahlungsbilanz negativ beeinflussen, ohne dass die Nachfrage angekurbelt würde. Weiteres Wachstum durch Konsum auf Pump und damit ei­ ne zunehmende Verschuldung der Haus­ halte erhöht – v. a. gegenüber dem Aus­ land – die Risiken noch viel stärker als in früheren Krisen und führt zu den ent­ sprechenden sozialen Folgen einer wei­ teren Abwertung. Die stagnierende weltweite Nachfra­ ge, der Rückgang der ausländischen Di­ rektinvestitionen, der Abfluss von Port­ folioinvestitionen, die abnehmenden Überweisungen von EmigrantInnen und die Kreditbeschränkungen betreffen al­ le Schwellenländer. Das Ausmaß ist je­ doch unterschiedlich zwischen den ein­ zelnen Ländern, je nach Umfang der angehäuften Bilanzdefizite einschließ­ lich der Zahlungsbilanz, der Stärke der Währungen, des Ausmaßes der Immo­ bilienblase und des Umfangs der Aus­ landsverschuldung der Privathaushalte. Die baltischen Länder, Ungarn, Rumä­ nien und Bulgarien sind sicher stärker betroffen als Polen, Tschechien, Slowe­ nien und die Slowakei. Aber auch diese Länder haben unter der nachlassenden Nachfrage und dem Rückgang der Di­ rektinvestitionen zu leiden. Auch die zu­ rückgehenden Überweisungen durch die EmigrantInnen werden künftig ins Ge­ wicht fallen. Die enorme Abhängigkeit inprekorr 460/461 von den Exportmärkten und die einsei­ tige Ausrichtung auf die Automobilin­ dustrie, was besonders für die Slowakei, aber auch für Tschechien und Slowe­ nien gilt, bergen weitere hohe Risiken. Insofern ist es nicht überraschend, dass Polen aufgrund seiner stärker gestreuten Märkte, einer starken Binnenwirtschaft und einem Außenhandelsvolumen, das unterhalb des BIP liegt, voraussicht­ lich am wenigsten unter der Rezession zu leiden haben wird. Außerdem gab es in Polen erst ab 2006 ein beschleunigtes Wachstum, so dass der Boom noch nicht seine brüchige Phase erreicht hatte.9 Die Slowakei und Slowenien sind durch die Einführung des Euro den Turbulenzen des Währungsmarktes entkommen; ihr Problem wird jedoch darin liegen, dass sie permanent an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber ihren internationalen Kon­ kurrenten verlieren werden, da diese zur Abwertung greifen können. Der Glaube, dass diese Länder dank der ausländischen Direktinvestitionen keinen Engpass in der Leistungsbilanz erleben würden, hat sich ebenfalls als Mythos erwiesen. Zwar sind diese Di­ rektinvestitionen noch immer sicherer als die anderen Kapitalströme, aber im ersten Quartal 2009 sind sie um 20%80% zurückgegangen und haben damit das Niveau von 2001-2002 wieder er­ reicht.10 Obwohl auch die defizitäre Lei­ stungsbilanz abnimmt, weil die Impor­ te rezessionsbedingt zurückgehen, glei­ chen die ausländischen Direktinvestiti­ onen diese Defizite zunehmend weni­ ger aus. Zudem tragen sie nicht nur zum Ausgleich sondern auch zur Unterhal­ tung des Defizits bei: durchschnittlich 70% der Profite in der Region wurden repatriiert und in Ungarn, Slowakei und Tschechien entsprechen die Direktinve­ stitionen aus dem Ausland dem Umfang der repatriierten Gewinne oder liegen sogar darunter.11 Im Unterschied zu den früheren Kri­ sen in den Schwellenländern fallen dies­ mal Umfang und Rhythmus der Abwer­ tung in den mittel- und osteuropäischen 9 Gligorov V., Pöschl J., Richter S. et al., « Where have all the shooting stars gone ? », The Vien­ na Institute for International Economic Stud­ ies, Current Analyses and Forecasts 4. 10 Hunya Gabor, « FDI in the CEECs under the Impact of the Global Crisis : Sharp Declines », The Vienna Institute for International Econom­ ic Studies Database on Foreign Direct Invest­ ment in Central, East and Southeast Europe, 2009. 11 ibidem. Ländern moderater aus. Die Länder mit flexiblen Wechselkursen – und sogar Polen – sind zwar in gewissem Umfang davon betroffen, aber bisher zumin­ dest gab es noch keinen Totalkollaps; in Ungarn, Polen und Rumänien ha­ ben die Wechselkurse um lediglich 1030% nachgegeben und im Baltikum und Bulgarien sind die Fixkurse noch stabil. Der Hauptunterschied zu Ostasien und Lateinamerika liegt in der Abhängigkeit von den Mutterbanken aus den Ländern mit gesättigten Märkten, die eine län­ gerfristige Strategie in der Region ver­ folgen als das vagabundierende Finanz­ kapital. Angesichts der globalen Krise und der Kreditklemme im Interbankenmarkt können die Mutterbanken eine weitere Kreditaufblähung nicht mehr durchhal­ ten. Auch ohne weitere Kapitalabflüsse wird daher die Rezession in dieser Re­ gion stärker als im Westen ausfallen, da die Kapitalzuflüsse von früher ausblei­ ben. Durch die expansive Haushaltspo­ litik der westlichen Länder erwachsen zusätzlich konkurrierende Investitions­ möglichkeiten für die internationalen Finanzfonds. Die Abwertung der Wäh­ rungen und die Rezession werden zu ei­ ner Zunahme der notleidenden Kredite führen und das Verhältnis der Mutter­ banken zu ihren osteuropäischen Able­ gern beeinträchtigen. Es ist nicht völlig auszuschließen, dass es zu einer Währungskrise kommt, indem die Fixkurse im Baltikum und in Bulgarien aufgrund weiterer Kapitalab­ flüsse und einer neuen Abwertungswel­ le in den Ländern mit flexiblen Wech­ selkursen aufgegeben werden. Jede Ab­ wertung kann in dieser Region eine Ket­ tenreaktion auslösen. Die Aufrechter­ haltung der festen Wechselkurse erfor­ dert umfangreichere internationale Stüt­ zungsmaßnahmen als das gesamte dor­ tige Wirtschaftsaufkommen ausmacht, was angesichts der finanziellen Pro­ bleme in den Kernländern der EU selbst und damit des Rückgangs der Finanz­ mittel kaum zu bewältigen sein dürfte. Und ob die verfügbaren Mittel des IWF ausreichen, ist fraglich. Die dort täti­ gen westeuropäischen Banken – z. B. schwedische im Baltikum und österrei­ chische in Bulgarien – und deren Regie­ rungen drängen darauf, Abwertungen zu vermeiden, weil ihnen sonst hohe Kredi­ tausfälle und entsprechende Profiteinbu­ ßen drohen. Auch die Regierungen vor Ort verteidigen das feste Wechselkurs­ 13 Ökonomie system. Aber die Beibehaltung dieser überbewerteten Wechselkurse bedeu­ tet unter den gegebenen politischen Ver­ hältnissen eine tiefe Rezession und De­ flation, um die umlaufende Geldmenge zu senken, was nur auf dem Wege mas­ siver Lohnkürzungen wie in Litauen möglich ist. Umgekehrt hätte auch eine unkon­ trollierte Abwertung infolge einer durch den Markt ausgelösten Währungskrise schwerste Auswirkungen auf die Ver­ teilungsebene zur Folge, da eine hohe Abwertung die Inflation anheizt, wie die Krisen in Asien und Lateinameri­ ka gezeigt haben. In den importabhän­ gigen Schwellenländern wirkt sich eine Abwertung zwangsläufig auf die Bin­ nenmarktpreise aus, da die Kosten für Importwaren steigen. Hingegen kön­ nen die Lohnabhängigen während ei­ ner Rezession und entsprechend hoher Arbeitslosigkeit ihre Reallöhne kaum verteidigen.12 Zwar verlief die Abwer­ tung bislang moderat und auch die In­ flation wurde durch den Einfluss der 12 Onaran Ö., « From the crisis of distribution to the distribution of the costs of the crisis : What can we learn from the previous crises about the effects of the financial crisis on labor ? », Polit­ ical Economy Research Institute, University of Massachusetts Working Paper 195. weltweit eher deflationären Tendenz und den Rückgang der Rohstoffpreise gebremst, aber in Zukunft könnte sich beides verschärfen. Auch wenn im gegenwärtigen Sta­ dium Prognosen schwer fallen, lässt sich doch anhand der Schätzungen der EU-Kommission vom April 2009 ab­ sehen, dass alle zehn neuen EU-Län­ der 2009 eine Rezession erleben wer­ den (Tabelle 2). Arbeitsplätze wer­ den abgebaut und die Arbeitslosig­ keit wird erheblich ansteigen, was besonders die baltischen Staaten be­ trifft. Die Erfahrung aus vorangegan­ genen Krisen in den Schwellenlän­ Tab 2 Jährliches Durchschnittswachstum von BIP, Beschäftigung, Produktivität und Reallöhnen in den mittel- und osteuropäischen EU-Ländern BIP Tschechien Ungarn Polen Slowenien Slowakei Estland Lettland Litauen Bulgarien Rumänien -2,3 -3,2 -1,6 -2,3 -2,4 -1,6 -11,2 -11,5 -5,7 -4,6 BIP Tschechien Ungarn Polen Slowenien Slowakei Estland Lettland Litauen Bulgarien Rumänien 3,2 0,5 4,8 3,5 6,4 -3,6 -4,6 3,0 6,0 7,1 1989*–1994 BeProdukschäftivität tigung -2,0 -4,2 -3,6 -4,6 -4,3 -5,1 -2,0 -5,8 -1,8 3,7 2,0 3,8 12,6 2,7 19,0 0,0 8,5 1,6 2008 BeProdukschäftivität tigung 1,2 2,0 -1,2 1,5 4,0 0,4 2,9 0,3 2,9 4,1 0,2 -5,2 0,7 -5,8 -0,5 0,9 3,3 2,3 0,3 5,4 Reallohn BIP -3,0 2,2 -1,9 -3,5 -6,0 -5,6 -17,3 8,2 -19,8 -13,4 -6,7 3,6 5,7 4,3 3,8 5,8 4,3 4,5 -0,2 0,1 Reallohn BIP 0,8 2,1 3,7 2,0 4,2 4,1 0,9 4,3 7,4 12,0 -2,7 -6,3 -1,4 -3,4 -2,6 -10,3 -13,1 -11,0 -1,6 -4,0 1994–2000 BeProdukschäftivität tigung -0,8 3,2 0,5 -0,2 -0,3 -0,6 -2,7 -2,3 -1,2 0,0 -2,4 2,3 5,0 4,7 4,8 8,7 2,7 8,3 0,0 5,0 2009 Be Produkschäf tivität tigung -1,7 -0,5 -3,0 -3,6 -2,3 1,3 -4,7 1,1 -1,7 -1,8 -7,0 -3,6 -8,9 -4,5 -7,7 -3,9 -2,2 1,6 -2,2 -0,8 Real lohn BIP 3,2 4,5 -1,9 4,8 2,9 5,3 8,0 3,4 6,9 -4,4 6,5 3,8 4,0 4,4 6,2 8,0 9,0 8,0 5,6 6,1 Real lohn BIP 2,1 -3,2 0,8 1,6 2,5 0,0 -10,8 -12,9 3,4 2,2 1,63 1,25 2,83 2,22 2,83 4,56 0,83 0,51 0,59 1,07 2000–2007 BeProdukschäftivität tigung 0,8 3,8 0,3 0,6 0,9 1,0 1,7 2,4 1,3 2,0 -0,8 3,1 2,5 3,3 5,9 6,3 5,8 5,5 3,2 5,5 1989*–2009 BeProdukschäftivität tigung 0,03 3,16 -0,48 2,38 0,21 2,95 0,14 3,57 0,31 5,30 -0,29 5,55 0,25 4,78 -0,26 5,30 0,67 3,36 -0,86 4,17 Reallohn 4,8 4,4 0,9 2,9 3,4 9,0 10,0 9,0 4,0 10,1 Reallohn 2,25 0,39 1,06 0,49 1,62 1,83 5,42 -0,98 -3,02 4,29 * Das Anfangsdatum variiert je nach der Verfügbarkeit der Daten: bspw. ist das BIP von Lettland erst ab 1993 verfügbar usw. Das BIP ist in Preisen der Landeswährung von 2000 angegeben. Beschäftigung bezieht sich auf die Gesamtindustrie. Die Produktivität ist nach dem realen BIP pro Beschäftigtem berechnet. Die Reallöhne entsprechen dem inflationsbereinigten Arbeitsentgelt auf der Basis von 2000 = 100. Die periodischen Mittelwerte sind geometrische Mittel. Den Daten von 2009 liegen die Schätzungen der Europäischen Kommission vom April 2009 zugrunde. Quelle: Berechnungen der Autorin auf Grundlage der Daten der Europäischen Kommission (AMECO); im Falle fehlender Daten für die Jahre 1989 – 1991 wurden die Wachstumsraten aus dem statistischen Handbuch der Wirtschaftsuniversität Wien entnommen 14 inprekorr 460/461 Ökonomie dern zeigt, dass auch lange nach En­ de der Rezession die Arbeitslosigkeit nicht auf das Niveau vor der Krise zu­ rückgeht.13 Reallohnsenkungen wer­ den für Ungarn, Litauen und Lettland erwartet, stagnierende Löhne für Est­ land und Polen. Die Austeritätspoli­ tik in Ungarn, Rumänien und Lettland wird die Krisenlasten obendrein wei­ ter verschärfen. In den Industriestaaten kommt es während einer Krise oft zu einer Zunahme der Lohnquote, in den Schwellenländern hingegen haben die dramatischen Auswirkungen der Wäh­ rungskrise bislang immer die Reallöh­ ne viel weiter zurückgehen lassen als die Produktivität und insofern zu ei­ ner starken Abnahme der Lohnquote geführt.14 Die Zahlen für 2009 in den mittel- und osteuropäischen Ländern liegen noch nicht vor. Für Lettland, Li­ tauen und Slowenien wird allgemein ein Rückgang erwartet, im Einzelnen aber wird dies weitgehend vom Aus­ maß der jeweiligen Währungsabwer­ tung abhängen. Außerdem lässt nicht ausschließen, dass die Rezession lan­ ge anhalten wird, was sicherlich nega­ tiv für die Reallöhne und Lohnquote zu Buche schlägt. Selbst wenn wir die eher zu opti­ mistischen Annahmen der EU-Kom­ mission zugrunde legen und daraus das durchschnittliche Wachstum von BIP, Beschäftigung und Löhnen wäh­ rend der vergangenen 20 Jahre seit dem Übergang der zehn mittel- und osteuropäischen Länder in die Markt­ wirtschaft errechnen, ist das Ergebnis niederschmetternd (Tab. 2). Mit einer Rezession wurde der Übergang begon­ nen und am vorläufigen Ende steht die weltweite Krise, daher sind die Fort­ schritte in puncto Wachstum und Löh­ ne alles andere als berauschend. Die Beschäftigung hat allenfalls stagniert und ist in Rumänien, Estland, Litau­ en und Ungarn sogar zurückgegangen. Die Reallöhne sind in Ungarn und Slo­ wenien gleich geblieben und in Litau­ en und Bulgarien gesunken. Der Real­ lohnanstieg ist allgemein hinter dem Produktivitätszuwachs zurückgeblie­ ben. Der einzig nennenswerte Anstieg war in Rumänien aber auch da ent­ spricht er exakt dem Produktivitätszu­ wachs. Insofern lässt sich kaum von ei­ 13 Onaran Ö., « Wage share, globalization, and crisis… », op. cit. 14 ibidem inprekorr 460/461 ner politisch und sozial lebensfähigen Bilanz des steinigen Übergangs zum Kapitalismus während der letzten 20 Jahre sprechen.15 Die Wirtschaftspolitik in Europa in Anbetracht der Krise 1. Westeuropa Alle Industrieländer haben auf die Kri­ se mit nie da gewesenen Konjunktur­ maßnahmen reagiert, um die weltwei­ te Wirtschaftsrezession zu überste­ hen16: in der Geldpolitik wurden die Zügel gelockert und die Leitzinsen un­ vorhergesehen gesenkt und die Banken seitens der Zentralbanken unkompli­ ziert und großzügig mit liquiden Mit­ teln versehen – auch wenn die EZB langsamer als die Fed oder die Bank von England reagiert hat. Zudem wur­ den weitere Hilfspakete für die Fi­ nanzwirtschaft geschnürt: Staatsga­ rantien zur Einlagensicherung, Staats­ beteiligungen an Banken durch Kapi­ talspritzen oder gar Verstaatlichungen, und Aufkauf „toxischer Wertpapiere“. Auch steuerliche Hilfsmaßnahmen wurden – zeitverzögert – auf den Weg gebracht: öffentliche Ausgaben, Kon­ sumanreize durch Steuernachlässe und –abwälzungen, Steuernachlässe für Unternehmen und Subventionen für Wirtschaftsbranchen. Das größte Konjunkturpaket kam in den USA zustande, während die Maßnahmen auf europäischer Ebene am BIP gemessen schwächer waren. Ein kürzlich von Sameer Khatiwada für die IAO erstellter Bericht17 kommt zu dem Ergebnis, dass die staatlichen Maßnahmen relativ bescheiden waren und in 32 Ländern – darunter die G20 – nur 1,8% des BIP ausgemacht haben, was unterhalb der vom IWF empfoh­ lenen 2% liegt. Diese Konjunkturpläne gingen von relativ optimistischen Pro­ gnosen aus. Die Maßnahmen für die Finanzwirtschaft lagen durchschnitt­ lich zehnfach höher als die Konjunk­ 15 Für weitere Details s. Onaran Ö., « From tran­ sition crisis to the global crisis : Labor in East­ ern Europe, 20 Years after transition », Hert­ fordshire 9-10 octobre 2009, http://www. wu.ac.at/arbeitsmarkt/staff/onaran/research 16 ILO, The financial and economic crisis : A De­ cent Work response, ILO, Geneva 2009. 17 Khatiwada S, « Stimulus packages to coun­ ter global economic crisis : a review », Inter­ national Institute for Labour Studies, Geneva 2009. turpakete.18 Auch wenn dieser Ver­ gleich nicht ganz stimmig ist, da die in die Finanzhilfen eingerechneten Garantien nicht notwendigerweise in Anspruch genommen werden, zeigt er doch, wie grotesk die Relationen sind. 2008 betrugen die Finanzhilfen in England 28,6% des BIP und in Ir­ land sogar aberwitzige 235,7%.19 Ir­ land hat zusätzlich noch einen Spar­ haushalt verabschiedet. Auch wenn die Banken auf dem europäischen Festland für sich eine konservativere Anlagen- und Kredit­ politik beanspruchen, sind auch sie große Risiken eingegangen, indem sie – wie Deutschland – forderungsbesi­ cherte Wertpapiere in den USA ge­ kauft haben oder ihre Kredite an Ost­ europa ungeachtet des Risikos, dass der Boom platzen könnte, enorm aus­ geweitet haben, wie dies die öster­ reichischen, schwedischen und teils auch griechischen Banken getan ha­ ben. Aus dieser Gruppe hat Österrei­ ch wegen des hohen Risikos von Kre­ ditausfällen in Osteuropa Finanzhilfen in Höhe von 36,9% des BIP gewährt und Schweden in Höhe von 50,5%. Obendrein verknappen diese Banken ihre Kredite, weil die Regierung ihnen so gut wie keine Bedingungen für ih­ re Beihilfen auferlegt hat, was die prä­ ventive Anhäufung liquider Mittel an­ geht. Auch die Zusammensetzung der Konjunkturpakete ist unangemessen: in den Industrieländern werden nur 3% der Gesamtausgaben für Arbeits­ plätze ausgegeben, 10,8% für soziale Transferleistungen an einkommens­ schwache Haushalte und knapp 15% für die Infrastruktur.20 Wie üblich ver­ weist die OECD darauf, dass die au­ tomatischen Ausgleichsmechanismen wie die Arbeitslosengelder besonders in Nordeuropa fast dreimal so hoch wie die Konjunkturpakete seien und insofern die Gesamthöhe der Budget­ maßnahmen angemessen sei.21 Die Zahlen in diesem Bericht zeigen je­ doch, dass in den USA die Summe der Konjunkturmaßnahmen einschließlich der automatisch oder im Ermessensfall greifenden über 10% des BIP beträgt, 18 ibidem 19 OECD Economic Outlook June 2009, (OCDE Perspectives économiques, juin 2009). 20 Khatiwada S., op. cit. 21 OCDE, Juni 2009, op. cit. 15 Ökonomie während Deutschland nur bei 6% liegt. Nur vier EU-Länder liegen in puncto Konjunkturankurbelung vor den USA: Schweden, Luxemburg, Spanien und Dänemark. Abgesehen vom Umfang dieser Maßnahmen krankt die EU an der feh­ lenden politischen Koordination ihrer Gegenmaßnahmen, die über die blo­ ße Entscheidung der EU-Kommissi­ on hinausginge, von den Mitgliedslän­ dern Konjunkturanreize in Höhe von 2% des BIP zu fordern. Dabei wer­ den von politischer Seite die Diver­ genzen innerhalb der EU und sogar in­ nerhalb Westeuropas nicht berücksich­ tigt. Bisher waren eher vage und unge­ richtete Erklärungen in der Presse zu lesen, wie die des deutschen Finanzmi­ nisters, wonach die EU kein Mitglieds­ land mit seinem Schuldenproblem al­ lein lasse, wenn die Finanzinvestoren die Regierung dieser defizitären Län­ der unter Druck setzten, die Zinsen für Staatsanleihen bis an den Rand des Ruins zu erhöhen. Offen bleibt auch, wann die neo­ liberalen Ökonomen anfangen wer­ den, Haushaltsdisziplin einzufordern und den Inflationsdruck an die Wand zu malen. Bisher hält die OECD an der Erfordernis von Konjunkturmaß­ nahmen fest, warnt aber bereits, dass es „jetzt erforderlich sei, den Ausstieg aus den außerordentlichen und durch die aktuelle Währungs- und Haushalts­ politik ermöglichten Stützungsmaß­ nahmen, glaubwürdige Ausstiegsstra­ tegien und Konsolidierungspläne für die Haushalte vorzubereiten“.22 Trotz der umfangreichen Konjunkturmaß­ nahmen zielt die gegenwärtige Politik an den Ursachen vorbei. Mit viel Nach­ druck wird auf die niedrigen US-Zin­ sen als Ursache der Krise verwiesen und kaum ein Wort auf die Liberalisie­ rung der Finanzmärkte verwandt. Die neue EU-Regelung, wonach die Ban­ ken jetzt 5% ihrer Kredite in die Bi­ lanzsumme aufnehmen müssen, klingt angesichts der Krise des bisherigen Bankenmodells eher lachhaft. Auch auf dem G20-Treffen wurde lediglich eine Regulierung der „systemwich­ tigen Finanzinstitute“ verabredet und die hedge fonds werden nur gehalten, sich registrieren zu lassen und Transpa­ renz zu wahren, statt bestimmte Eigen­ 22 OECD Interim Economic Assessment Septem­ ber 2009. 16 kapitalquoten einzuhalten.23 Obwohl die Kosten der Rettungspakete be­ kannt sind, gehen keinerlei politische Überlegungen dahin, die Verantwort­ lichen und Reichen über eine Steuer­ reform dafür heranzuziehen. Ange­ sichts der bestehenden Kräfteverhält­ nisse ist auch seitens der herrschenden Eliten keinerlei politisches Umdenken zu erwarten, das auf die Wurzeln der Krise zielen würde – nämlich die dra­ matische Umverteilung der Einkom­ men zugunsten des Kapitals. Noch nicht einmal kleinere Steuerreformen werden ins Auge gefasst. Hinsichtlich der weltweiten Ungleichgewichte wird verwiesen auf den zu hohen Konsum in den USA oder die zu niedrigen Löh­ ne und die Unterbewertung der Wäh­ rung in China statt auf das Lohndum­ ping und den stagnierenden Binnen­ konsum in Deutschland. Derlei Politik ist auch schwerlich als neo-keynesianistisch zu bezeich­ nen. Obwohl es auch Keynes’ Anlie­ gen war, den Kapitalismus vor sich selbst zu retten, wäre es Anliegen ei­ ner solchen Politik, die Investitionen durch öffentliche Ausgaben und An­ reize für den Privatsektor zu stimulie­ ren, das Finanzsystem wieder zu re­ gulieren und auf internationaler Ebe­ ne eine Kontrolle der Kapitalflüsse und feste Wechselkurse einzuführen. Im Rahmen der bestehenden Kräfte­ verhältnisse wird die herrschende Elite einen keynesianistischen Politikansatz nicht freiwillig akzeptieren. Eine sol­ che Rückkehr zum goldenen Zeitalter des geregelten Kapitalismus würde so­ mit größere organisatorische Anstren­ gungen der Arbeiter und eine radika­ le Änderung der Kräfteverhältnisse er­ fordern. 2. Mittel- und Osteuropa Die gegenwärtige weltweite Krise hat keinerlei politisches Umdenken be­ züglich der EU-Erweiterung und dem Zusammenwachsen der Gesellschaften erbracht. Die Belange der EU in den mittel- und osteuropäischen Ländern werden durch die Interessen der mul­ tinationalen Konzerne und besonders der westlichen Banken bestimmt und beschränken sich darauf, die Wäh­ rungen stabil zu halten und weniger die Arbeitsplätze und Einkommen. In der EU gab es gar nicht den politischen Willen, die Institutionen und Instru­ mente für eine gemeinsame antizy­ klische Konjunkturpolitik zu schaffen. Vielmehr überließ man die Zukunft dieser Länder den westeuropäischen Multis und dem IWF, abgesehen von bestimmten Finanzbeihilfen mit dem Ziel, den Zusammenbruch der westeu­ ropäischen Großkonzerne in der Regi­ on zu verhindern. Die nach der Asienkrise angeschla­ gene Glaubwürdigkeit des IWF wur­ de auf dem G20-Treffen durch eine Aufstockung der verfügbaren Finanz­ mittel wieder hergestellt, aber an der praktischen Politik hat sich nichts ge­ ändert, trotz aller frommen Worte. Un­ ter dem Druck der Kapitalflucht haben sich Ungarn, Lettland und Rumänien an den IWF gewandt. Aufgrund der Verzahnung mit der EU waren die In­ teressen der Multis und besonders der westeuropäischen Banken eher aus­ schlaggebend für die Höhe der bereit­ gestellten Gelder als die tatsächlichen Bedürfnisse vor Ort. Wie bereits bei den früheren Krisen der Schwellenlän­ der in den Jahren 1990 und 2000 wa­ ren die politischen Auflagen des IWF wieder einmal sehr viel restriktiver als vergleichsweise gegenüber den west­ europäischen Ländern wie Deutsch­ land. Die einzige Ausnahme von die­ sem Strickmuster des IWF war die Ge­ währung eines Kreditrahmens an Po­ len ohne weiter gehende Auflagen. Ungarn, Rumänien und Lettland betreiben eine ausgesprochen prozy­ klische Haushaltspolitik, in der Haus­ haltsdisziplin noch immer oberster Maßstab ist und Kürzungen der Löh­ ne im öffentlichen Dienst und der Ren­ ten Teil des Instrumentariums sind. In Lettland wurden die Löhne im öffent­ lichen Sektor um 35% und die Renten um 10% gekürzt, während die Mehr­ wertsteuer von 18 auf 21% angehoben wurde. Diese Bedingungen musste die lettische Regierung akzeptieren, um vom IWF die zweite Tranche der Kre­ ditlinie zu erhalten24. In Estland und Litauen wurden ebenfalls Kürzungen der Löhne im öffentlichen Dienst und der Sozialleistungen um minde­ stens 20% beschlossen.25 Der einzige Unterschied ist, dass der IWF inzwi­ schen versucht, die Banken zu reka­ 23 Stockhammer E., « Wirtschaftspolitik ange­ sichts der Krise in den USA und Europa », Kurswechsel 2/2009. 24 Gligorov et al., op. cit. 25 ibidem inprekorr 460/461 Ökonomie pitalisieren und darauf zu verpflich­ ten, den Kreditumfang in den Ländern beizubehalten, die in das Stabilitäts­ programm des IWF einbezogen sind. Trotzdem wird sich erst weisen, ob die umfangreichen Hilfsgelder tatsächlich in den Ländern verbleiben oder nicht dazu dienen die internationalen Inve­ storen wieder flüssig zu machen, wie dies in Ostasien und Lateinamerika der Fall war. Kapitalkontrollen, die eine Flucht von Spekulationsgeldern oder eine manipulierte Abwertung verhin­ dern könnten, sind noch nicht einmal Thema bei IWF oder EU. Es gibt eine Alternative! Die Art und Weise, wie die Regie­ rungen und namentlich sozialdemo­ kratische auf die Krise reagiert haben – mit der Sozialisierung der Kosten – hat in der Bevölkerung zu starker Un­ zufriedenheit geführt. Paradoxerwei­ se wurden dadurch auch politische Al­ ternativen diskreditiert, die „kollek­ tive“ Herrschaftsformen oder Verstaat­ lichungen beinhalten. Dennoch lässt sich erstmals nach dem Fall der Mauer wieder öffentlich diskutieren, wie in­ stabil und unerträglich der Kapitalis­ mus in wirtschaftlicher, ökologischer und politischer Hinsicht ist. Allerdings wird es aufgrund der ideologischen Barrieren der vergangenen Jahrzehnte ein mühsames Unterfangen sein, diese Unzufriedenheit in Akzeptanz für ein alternatives Wirtschaftsmodell umzu­ münzen, das sozialistisch, nachhaltig, egalitär und demokratisch ist und auf Planung von unten beruht. Wir haben aber auch Pluspunkte: Es ist inzwi­ schen klar, dass höhere Profite nicht zu mehr Investitionen und Arbeitsplät­ zen führen, dass Wachstum nicht Ab­ nahme der Ungleichheit bedeutet und dass die kapitalistische Marktwirt­ schaft zu Systemkrisen neigt. Um po­ litische Auswege aus der Krise auf­ zuzeigen, müssen auch deren Ursa­ chen hervorgehoben werden: diese lie­ gen nicht nur in den unzureichend re­ gulierten Märkten sondern auch in der ungleichen Verteilung. Und die Frage muss laut aufgeworfen werden, warum die ArbeiterInnen für die Krise bezah­ len sollen. Programme zum wirtschaft­ lichen Wiederaufschwung dürfen kei­ nesfalls in ökonomischer wie ökolo­ gischer Hinsicht die Rückkehr zum status quo ante bedeuten. Eine große inprekorr 460/461 Krise schreit nach einer gleich großen politischen Umstrukturierung und auf dem Weg zu einer solchen Alternative bezieht sich unser Ausgangspunkt auf die dringendsten Probleme: Arbeits­ plätze, Umverteilung und ökologische Nachhaltigkeit. Deren Lösung bedingt in vielen Punkten Änderungen, die mit der kapitalistischen Wirtschaft und ih­ rem Streben nach privatem Profit nicht vereinbar sind: Im Mittelpunkt der Haushaltspoli­ tik müssen ein öffentliches Beschäf­ tigungsprogramm und eine Umvertei­ lungspolitik stehen, die die negativen Auswirkungen der Krise kontert. Öf­ fentliche Ausgaben in arbeitsintensiven Dienstleistungen wie Erziehung, Kin­ dergärten, Pflegeheimen, Gesundheits­ wesen, Gemeindeaufgaben und sozi­ alen Diensten sowie in öffentlichen In­ frastrukturen und Umweltschutzinve­ stitionen sollten hierbei im Mittelpunkt stehen. In diesen Bereichen ist es auch möglich, die Wirtschaft in die Rich­ tung einer solidarischen und nachhal­ tigen Entwicklung zu lenken. Der Be­ darf an sozialen Dienstleistungen ist unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht erfüllt und wo es sie gibt, wer­ den sie schlecht bezahlt (um die Ren­ tabilität zu gewährleisten) oder sind es Luxusleistungen für die Oberen oder werden als unsichtbare und unbezahlte Hausfrauenarbeit im Rahmen der ge­ schlechtsspezifischen Arbeitsteilung verrichtet. Um dies Handicap zu ver­ meiden kann entweder der Staat oder ein gemeinnütziger Träger dafür sor­ gen. Öffentliche Beschäftigungspro­ gramme müssen auch die Geschlech­ terfrage berücksichtigen, um eine Be­ nachteiligung von Frauen zu vermei­ den, aber auch um deren Anteil an den Erwerbstätigen zu erhöhen. Um ökologische Nachhaltigkeit zu erzielen bedarf es einer Änderung der Nachfragestruktur hin zu langfristigen umweltgerechten Investitionen. Da­ für bedarf es unbedingt einer gezielten Strategie in den öffentlichen Investiti­ onen. Bei den Arbeitsplätzen im Privat­ sektor geht es darum, die „Sozialisie­ rung der Kosten“ zu vermeiden, d. h. zu verhindern, dass die Erwerbstätigen und Arbeitslosen die Lasten des verant­ wortungslosen Verhaltens des weltwei­ ten Kapitals tragen müssen. Besonders könnten einzelne Unternehmen die Krise nutzen, um ihren langfristig ge­ planten Abbau von Arbeitsplätzen um­ zusetzen. In vielen europäischen Län­ dern werden Bestimmungen zur Kurz­ arbeit genutzt, um die Arbeitslosigkeit zu dämpfen. Letztlich wird hierbei zur Behebung des Problems die Solida­ rität der Lohnabhängigen ausgenutzt durch staatlichen Teilausgleich der Einkommensverluste der Kurzarbeite­ rInnen. Die Alternative wäre, die Un­ ternehmer die Kosten tragen zu lassen durch ein gesetzliches Verbot von Ent­ lassungen und gesetzliche Mindestlöh­ ne. Für Unternehmen, die Dividenden ausschütten und hohe Managergehäl­ ter bezahlen können, wäre das Verbot von Entlassungen nur logisch. Wenn bestimmte Firmen durch das Verbot von Entlassungen in Konkurs geraten, können sie mit Unterstützung öffent­ licher Kredite unter Arbeiterkontrol­ le gestellt und saniert werden. Zahl­ reiche Beispiele dafür hat es in Argen­ tinien nach der Krise gegeben, wo di­ es eine Überlebensstrategie für die Ar­ beiterInnen war nach einem Konkurs ihrer Unternehmen, der oft mit Lohn­ rückständen einherging und Sozialplä­ ne ein Fremdwort waren. Noch 2007 waren 10.000 Menschen in den selbst­ verwalteten Unternehmen in Argenti­ nien beschäftigt. In Bereichen, in de­ nen Massenentlassungen drohen, wie der Automobilindustrie sollten Verge­ sellschaftungen und mittelfristig Um­ strukturierungen dieser dann öffent­ lichen Unternehmen angestrebt wer­ den. Die Autoindustrie beispielsweise könnte auf diese Weise in die Herstel­ lung öffentlicher Transportmittel kon­ vertiert werden und die Beschäftigten sukzessive in neue innovative Bereiche überführt. Die Finanzierung dieser Förder­ maßnahmen für Wirtschaft und Ar­ beitsplätze sollte erfolgen durch ent­ sprechende Einkommenssteuerpro­ gression, Vermögens- und Erbschafts­ steuer, Erhöhung der Körperschafts­ steuer und die Besteuerung von Fi­ nanztransaktionen, da nur somit die Kosten der Krise denen aufgebürdet werden können, die dafür verantwort­ lich sind. Zugleich ist dies das einzige Mittel, Haushaltskürzungen bei Sozi­ alausgaben, Bildungs- und Gesund­ heitswesen sowie Kinder- und Alten­ betreuung zu verhindern. Steuerermäßigungen und Beihil­ fen für einkommensschwache Schich­ ten oder Ausweitung der Arbeitslo­ 17 Ökonomie sengelder auf nicht bezugsberechtigte Lohnabhängige sind gängige kurz­ fristige Lösungen. Dies ersetzt frei­ lich nicht die erforderlichen Maßnah­ men, die der generellen Einkommens­ verschlechterung der Lohnabhängigen entgegen wirken können. Hier geht es nicht nur um den Gleichheitsgrundsatz sondern auch um eine volkswirtschaft­ liche Notwendigkeit. Die Lohnzurück­ haltung, die von europäischen Wirt­ schaftspolitikern üblicherweise pro­ pagiert wird, verschärft nur noch das Problem der fehlenden Binnennachfra­ ge. Das Risiko liegt darin, dass in man­ chen Ländern wie Deutschland weiter­ hin Niedriglohnpolitik betrieben wird. Für eine grundlegende Lösung der Pro­ bleme dieser Krise muss sich die Wirt­ schaftspolitik zuerst mit der Vertei­ lungskrise befassen. Erforderlich ist eine substantielle Verkürzung der Ar­ beitszeit, die einhergeht mit dem An­ stieg der Produktivität, und zugleich ei­ ne Angleichung der Löhne nach oben. Die hohen Profite in der Vergangenheit sind verantwortlich für die Krise, al­ so müssen sie jetzt die Kosten tragen. Darin liegt nicht nur der Schlüssel zur Lösung des Arbeitslosenproblems in­ folge der Krise sondern auch zur Lö­ sung der Umweltkrise. Denn nachhal­ tige Entwicklung setzt ein Null- oder schwaches Wachstum in den entwi­ ckelten Ländern voraus, was bedeutet, dass Vollbeschäftigung nur durch eine Verkürzung der Arbeitszeit erzielt wer­ den kann und nicht durch ungerichtetes Wachstum. Die Einkommensverluste der Lohnabhängigen können durch substantielle Umverteilung vermieden werden. Außerdem, wenn wir zu einer demokratischen Entscheidungsfindung gelangen wollen, setzt dies Zeit für ei­ ne aktive Beteiligung voraus und somit eine Verkürzung der Arbeitszeit. Die Umgestaltung des Finanzsek­ tors ist ein Gebot der Stunde, das auch breit thematisiert wird in der Diskussi­ on über Alternativen. Eine Regulierung ist zwar wichtig, allerdings nicht aus­ reichend, denn die Finanzinstitutionen verfügen über eine erstaunliche Phan­ tasie, die Regulierungen durch weitere Innovationen zu umgehen. Insofern ist das Finanzwesen ein Schlüsselsektor, der nicht länger dem kurzfristigen Pro­ fitstreben überlassen werden darf. De facto war der Sektor bereits verstaat­ licht, groteskerweise jedoch ohne öf­ fentliche Verfügungsgewalt, und die 18 Staatsanteile werden so bald als mög­ lich wieder privatisiert werden. Die Krise hat offenbart, dass die großen Privatbanken das dictum „Too big to fail“ zu ihrem Vorteil ausnutzen. Hingegen stehen wir vor der He­ rausforderung, umfangreiche Investi­ tionen in sozial nützlichen Bereichen finanzieren zu müssen, z. B. im En­ ergiesektor. Dafür brauchen wir ei­ nen öffentlichen Finanzsektor, der je­ doch nicht bloß auf staatlichem Eigen­ tum beruht sondern auf kollektivem Ei­ gentum unter Beteiligung der Beschäf­ tigten und Betroffenen. Dieser öffent­ liche Finanzsektor muss selbstverständ­ lich die Konten offenlegen. Nur auf ei­ ner derartigen strukturellen Grundla­ ge werden die folgenden Finanzregu­ lierungen die sozial erwünschten Re­ sultate liefern: effektive Regulierung und Überwachung aller Finanzinstitu­ tionen, volle Rechenschaftspflicht al­ ler Entscheidungsträger, antizyklische Verwendung des Kapitals, Beseitigung der außerbilanziellen Transaktionen, wie bspw. ATTAC sie empfiehlt.26 Die notwendige Vergesellschaftung des Finanzsektors wirft auch ein Licht auf die anderen gesellschaftlich proble­ matischen Sektoren, die nicht der pri­ vaten Verfügungsgewalt und dem Pro­ fitstreben unterworfen sein dürfen. Die Wirtschaftskrise hat unübersehbar ge­ macht, dass Finanz- und Immobilien­ sektor reif für eine Vergesellschaftung sind. Die Energiekrise wiederum zeigt, dass auch dieser Sektor und die Inve­ stitionen in alternative Energien in die öffentliche Hand gehören. Die Pro­ bleme, die durch private Pensionsfonds und durch die Privatisierungen im Bil­ dungs- und Gesundheitswesen sowie in der Infrastruktur verursacht werden, offenbaren, dass soziale Dienste eben­ falls zu sensibel sind, um privatem Pro­ fitdenken unterworfen zu sein. In wel­ chen sonstigen Sektoren die öffent­ liche Hand für gerechtere und sozial wirksamere Resultate stehen könnte, sollte einer öffentlichen Diskussion unterworfen werden, die Anregungen schafft und unter breiter Beteiligung stattfindet. Es geht hier nicht darum, die öffent­ liche Hand über den grünen Klee zu lo­ ben, sondern diejenigen zur aktiven 26 « Das Casino endlich schließen! », Gemein­ same Erklärung von 14 europäischen ATTAC Organisationen zur Finanzkrise und demokra­ tischen Alternativen, 15. Okt. 2008 Teilnahme und Aufmerksamkeit auf­ zurufen, die als Beschäftigte, Konsu­ menten, Vertreter der Bevölkerung etc. von den Entscheidungsprozessen be­ troffen sind. Das geltende Wirtschafts­ modell soll somit öffentlich und trans­ parent sein und die neuen Wege der Entscheidungsfindung werden zugleich die Koordination der Gesamtwirtschaft im Sinne einer nachhaltigen, geplanten und auf Solidarität gegründeten Ent­ wicklung erleichtern. Dieser umfas­ sende Wandel erfordert auch einen an­ deren institutionellen Rahmen als den gegenwärtigen, der an eine kaum ge­ steuerte und profitorientierte Wirt­ schaft angepasst ist, in der die Lohnab­ hängigen und Bürger nur wenig zu sa­ gen haben. Auf internationaler Ebene innerhalb der EU hängt die politische Glaubwür­ digkeit der Union davon ab, ob und wie der Westen dem Osten bei der Über­ windung der globalen Krise hilft und dadurch echte Kooperation signalisiert. Tatsächliche Hilfe muss über bloße fi­ nanzielle Unterstützung zur Stützung der Währung hinaus gehen und öffent­ liche Investitionsprogramme anschie­ ben, die auf die regionale Entwicklung abzielen. Dabei sollten öffentliche eu­ ropäische Investitionen wirksam wer­ den, die durch EU-weit erhobene pro­ gressive Steuern finanziert werden. Ein weiteres durch die Krise offen­ bar gewordenes Manko ist, dass die of­ fenen Kapitalflüsse besonders in den Schwellenländern zu Turbulenzen und strukturellen Problemen führen. Die von einer (realen und nominalen) Ab­ wertung der lokalen Währungen ausge­ henden verheerenden Wirkungen kön­ nen nur durch eine Kontrolle der Ka­ pitalflüsse und eine gesteuerte Abwer­ tung mit Kontrolle der Preise überwun­ den werden. Wien, September 2009 Özlem Onaran, Wirtschaftswissenschaftle­ rin, lehrt Wirtschaft an der Universität Middle­ sex in Großbritannien. Veröffentlichungen: u. a. Türkiye Emek Piyasasinin Yapisi ve Issizlik (Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung in der Türkei, mit Hacer Ansal, Suat Kucukciftci und Benan Zeki Orbay), Istanbul 2000. Sie ist regelmäßige Mitarbeiterin von Yeniyol (Neuer Kurs), der Zeitung der türkischen Sektion der IV. Internationale. Übersetzung MiWe inprekorr 460/461 Ökonomie Der freie Fall ist vorbei, aber die Krise geht weiter Joel Geier Eine neue Phase der langfristigen Sy­ stemkrise des internationalen Kapitalis­ mus entfaltet sich vor unseren Augen. Die Rezession, die im Dezember 2007 begonnen hatte, ist die längste, tiefste und weitestreichende globale Krise seit den 1930er Jahren. Ihre schlimmste Phase folgte auf die Entscheidung von Henry Paulson, Ben Bernanke und Tim Geithner im September 2008, Lehman Brothers zu erlauben, in Konkurs zu ge­ hen. Der Weltkapitalismus kam sechs Monate lang ins Trudeln. Das virtuelle Bankensystem brach zusammen und die Geschäftsbanken verloren Hunder­ te Milliarden Dollar. Das Finanzsystem war tatsächlich bankrott und die Kapi­ talmärkte mussten schließen – eine Si­ tuation, die von den Regierungen in al­ ler Welt eine massive Intervention ver­ langte. Das weltweite Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank um 4–6 %, die industrielle Produktion in den entwickelten Ökono­ mien fiel um 15–25 %, Exporte brachen zusammen, und der Welthandel ging um über 20 % zurück. Solche Zahlen gab es nicht mehr seit der Großen Depression. Im April endete der freie Fall. Der Nie­ dergang geht weiter, aber in weitaus ge­ ringerem Tempo. Einige wirtschaftliche Indikatoren weisen auf das Ende der Talfahrt, aber nicht auf das der Krise. Alle Rezessionen erreichen schließlich einen Grund, wo sich die Wirtschaft auf einem neuen niedrigen Stand stabilisiert oder der der Ausgangspunkt einer Erho­ lung ist. Aber hier handelt es sich nicht um eine normale Rezession, und die Er­ holung, wenn sie denn kommt, wird kei­ ne normale Erholung sein. Die Erholung der Börse in den letz­ ten Monaten gründet auf Projektionen, wonach das Wachstum bald wieder­ hergestellt sein werde. Aber die erwar­ tete Erholung ist abnormal schwach – es wird ein Wachstum von 0,5 bis 1 % in den vergangenen sechs Monaten und von 1–2 % für 2010 vorhergesagt. Auf einen heftigen Rückgang folgt norma­ inprekorr 460/461 lerweise ein starkes Wachstum (das Wachstum von 1933 bis 1936 nach dem sehr tiefen Fall von 1929 bis 1932 betrug 8,5 % im Jahr, und selbst dies bedeutete nicht das Ende der Krise). Das Ende des freien Falls ist nicht der Selbstkorrek­ tur des freien Marktes geschuldet, son­ dern der massivsten steuerlichen und fi­ nanziellen Intervention des Staates, die es jemals in der Weltwirtschaft gegeben hat. Das Kernstück von Barack Obamas Wirtschaftsprogramm war die Rettung des Finanzkapitals. Die Regierung be­ zahlte für die Banken Beihilfen, Darle­ hen, Kredite und Bürgschaften im Wert von insgesamt 13 Billionen Dollar. Di­ ese Intervention zur Rettung von Inha­ bern von Bankobligationen wird auf Jahre hinaus mit einem geringeren Le­ bensstandard der amerikanischen Werk­ tätigen bezahlt werden. Nicht die Bankenkrise, jedoch die Furcht, dass die Banken zusammenbre­ chen werden, ist vorüber. Darüber hi­ naus ist die Obama-Administration in der Lage gewesen, die Forderung nach Verstaatlichung der Banken zurück­ zudrängen. Diese Forderung war so­ gar von Alan Greenspan erhoben wor­ den. Der jüngste „Stresstest“, das letz­ te Stück des Wirtschaftsrettungsplans der Regierung, zielte darauf ab, das Ver­ trauen wiederherzustellen, indem garan­ tiert wurde, dass keiner der 19 größten Banken erlaubt werde, bankrott zu ge­ hen. Der Zustrom von Regierungsgel­ dern in die Banken löste die Blockade der Geldmärkte und der Kredite. Die Darlehensvergabe unter den Banken, die zum Stillstand gekommen war, lief wieder an. Die Risikoprämien wurden verstärkt und die Aktienmärkte wieder­ belebt. Das Kreditsystem ist jetzt funk­ tional, obwohl viele Individuen und Un­ ternehmen noch Probleme bei der Kre­ ditvergabe haben. Die zweite Grundlage für die Er­ holung sind die finanziellen Anreiz­ programme der USA und Chinas. Der US-Anreiz ist in diesem Jahr durch ein Haushaltsdefizit von 1,84 Billionen Dollar (13 % des BIP) finanziert wor­ den. Diese Summe wurde nur während der beiden Weltkriege übertroffen und reicht aus, einer sonst im Koma befind­ lichen Wirtschaft wieder etwas Leben einzuhauchen. Kleine Steuererleichte­ rungen, geringere Hypothekenraten und niedrigere Benzinpreise stützten die sin­ kenden Konsumentenausgaben. Die In­ frastrukturausgaben sollten in den näch­ sten Monaten private Investitionen als Motor des für das Jahresende vorge­ sehenen maßvollen Wachstums erset­ zen. Chinas 585-Milliarden-Dollar-Pro­ gramm zum Aufbau der Infrastruktur soll den Boom bei Öl und industriellen Rohstoffen wieder ankurbeln und damit die Warenproduzenten unterstützen. Doch eine schwache Erholung und die Unfähigkeit, Schlüsselsektoren der Wirtschaft zu stabilisieren, wirft die Möglichkeit einer langdauernden Sta­ gnation oder eines verkürzten Wirt­ schaftszyklus ohne eine Periode starken Wirtschaftswachstums auf. Der Woh­ nungssektor steckt immer noch in der Krise. Die Preise sind um 32 % gefal­ len und 27 Millionen Menschen – ge­ genüber 16 Millionen vor einigen Mo­ naten – haben eine Hypothekenlast, die den Wert ihres Hauses übersteigt. Das sind 29 % aller Hausbesitzer, von denen viele ihre Häuser möglicherweise auf­ geben müssen. Es gibt auch eine neue Welle von Zwangsvollstreckungen, die diejenigen betrifft, die ihre Jobs ver­ loren haben und ihre Zahlungen nicht mehr leisten können. Über 5 Millionen Menschen haben ihre Hypotheken länger als drei Monate nicht mehr bezahlt oder stehen vor der Zwangsvollstreckung. Die meisten von ihnen sind von Obamas Programm der Hypothekenmodifizierung ausgeschlos­ sen, da dieses Häuser, deren Hypothe­ ken höher sind als 105 % vom Wert des Hauses, ausschließt. Dieses Programm wurde als Rettung für Millionen vor der Zwangsvollstreckung angepriesen, da­ 19 Ökonomie mit sollte jedoch nur die Rettung der Banken versüßt werden. Es ist drastisch gescheitert, da es nur 10 000–50 000 Ei­ genheime betrifft. Die kranke Logik der kapitalistischen Pleite geht weiter: Mehr und mehr Menschen verlieren ihre Jobs und werden zwangsvollstreckt; die Prei­ se sinken wieder und löschen so die Er­ sparnisse, wodurch die Anzahl der po­ tenziellen Nutznießer der Entlastung re­ duziert wird und die geplante Erholung erstickt. Trotz der Kosten des Banken­ programms von Bush und Obama wird die Krise weitergehen und werden die Verluste der Banken in den beiden kom­ menden Jahren zunehmen. Zwei Millio­ nen Eigenheime werden 2010 zwangs­ vollstreckt werden, was einen durch­ schnittlichen Verlust von 50 000 Dollar je Eigenheim bedeutet – ein Verlust von 100 Milliarden Dollar für die Banken. Der kommerzielle Immobilienmarkt tritt jetzt in eine Krise ein, die der äh­ nelt, die den Wohnungssektor betrof­ fen hat. Die kommerziellen Immobili­ enpreise sind um 30–40 % gefallen. Die zunehmende Anzahl leerstehender Im­ mobilien und die sinkenden Mietpreise führen zu einer Welle von Pleiten im Immobiliensektor. Das Wall Street Journal schreibt: „Im letzten Jahrzehnt ent­ fesselte die Wall Street eine Welle von wertpapiermäßig unterlegten Schulden bei kommerziellen Immobilien, wie sie es bei den Wohnungshypotheken getan hatte. Hypotheken auf kommerzielle Immobilien im Wert von etwa 700 Mil­ liarden Dollar wurden in Wertpapiere aufgeteilt und an ein breites Spektrum von Investoren verkauft. Das bedeutet, dass diesmal der Schmerz von einer grö­ ßeren Anzahl von Spielern gespürt wer­ den wird, über Banken und Sparkassen hinaus.“ Die Banken haben diese Darlehen zu ihrem nominellen Wert verbucht, wäh­ rend die Federal Deposit Insurance Cor­ poration (FDIC) sie sogar für 59 Cent pro Dollar veräußert hat. Der Zusam­ menbruch des kommerziellen Immobi­ lienmarkts wird die Banken über 200 Milliarden Dollar kosten. Vier- bis fünf­ hundert zumeist regionale Banken wer­ den dabei wahrscheinlich bankrott ge­ hen. Die Qualität der an Unternehmen gegebenen Darlehen geht auch zurück. In den Jahren der Finanzblase nahmen die Unternehmen große Anleihen zu bil­ ligen Kreditraten. Als die Profite nach unten gingen, ergaben sich Schwierig­ 20 keiten, die Zinszahlungen zu leisten. In den letzten drei Monaten hat Standard & Poor den Kredit von über 500 Un­ ternehmen reduziert. Sie werden somit nicht in der Lage sein, ihre Darlehen zu niedrigen Raten zu refinanzieren und es wird erwartet, dass 14 % der Unterneh­ mensobligationen 2010 nicht bezahlt werden. Der Stresstest der 19 größten Banken ergibt die Schlussfolgerung, dass diese Banken in den nächsten zwei Jahren 599 Milliarden Dollar verlieren werden, wobei ein Verlust von 424 Mil­ liarden Dollar in den vier größten Ban­ ken – Chase, Bank of America, Citicorp, Wells Fargo – konzentriert sein wird. Die europäischen Banken sind in ei­ ner noch schlimmeren Lage. Es werden Verluste von 1 Billion Dollar erwartet, und noch mehr, wenn die osteuropäische Bankenkrise außer Kontrolle gerät. Wel­ che Auswirkung dies auf das US-Banken­ system haben wird, ist in den Nebel des Bankgeheimnisses gehüllt. Der Internati­ onale Währungsfonds (IWF) schätzt, dass das internationale Bankensystem 4 Billi­ onen Dollar verlieren wird: 2,2 Billionen in den USA, 1 Billion in Europa und 800 Milliarden im Rest der Welt. Nouriel Rou­ bini schätzt, dass die Verluste der US-Ban­ ken allein 3,6 Billionen Dollar erreichen werden. Angesichts der Tatsache, dass sie das Recht hatten, das Zehnfache ihres Ka­ pitals in Kreditoperationen zu stecken, werden mindestens 40 Billionen Dollar aus dem Kreditsystem im Rahmen einer Verschuldung verschwinden, die noch gar nicht richtig begonnen hat. Dies erklärt wesentlich, warum diese Krise so lang­ dauernd sein wird und die Erholung so kraftlos. Überproduktionskrise Die Krise unterstreicht den gewal­ tigen Grad der Überproduktion in der Welt und den untragbaren Charakter des Welthandelssystems, das auf einem jährlichen Defizit der US-Zahlungsbi­ lanz von 700–800 Milliarden Dollar beruhte. Eine Rückkehr zu diesem Re­ gime der Zeit vor der Krise ist unmög­ lich. Die USA können gewaltige Zah­ lungsbilanzdefizite nicht mehr durch Auslandsanleihen finanzieren. Folglich muss das gesamte System des Welthan­ dels umstrukturiert werden. Das chi­ nesische Modell der Überausbeutung, bei dem nur 35 % dessen, was produ­ ziert wird, für den einheimischen Kon­ sum, der Rest aber für den Export und Neuinvestitionen verwendet wird, wird auf ein Weltsystem stoßen, das nicht be­ reit ist, Chinas exportorientierte Wachs­ tumsstrategie zu tolerieren. Die Tiefe der Überproduktionskrise ist die Quelle für den Zusammenbruch der industriellen Produktion – 15 % in den USA, 20 % in der Euro-Zone, 34 % in Japan. Als Ergebnis fielen die Kapi­ talinvestitionen in den USA um 40 % im ersten Quartal 2009. Da die Industrie nur zu 69 % ihrer Kapazitäten funktio­ niert, der geringste Wert seit den 1930er Jahren, gibt es in den kommenden Jah­ ren ohne eine Umstrukturierung keine Basis für Investitionen in neue Fabriken. Die Streichungen bei General Motors und Chrysler sind ein Aspekt einer welt­ weiten Autoüberproduktion von schät­ zungsweise 20–30 Millionen Autos. Eine große Zahl von Jobs wird bei dieser Umstrukturierung verschwinden, wahrscheinlich mindestens ein Drit­ tel der verbleibenden Jobs in den beste­ henden Automobilunternehmen. Dies wiederum führt zu Entlassungen, Kür­ zungen, Umstrukturierungen und Plei­ ten in allen Bereichen, die von der Au­ toindustrie abhängig sind: Zulieferer, Verkäufer, Verkehr, Marketing, kommu­ nale Steuern und Dienstleistungen usw. Das Automobil ist ein Muster für die Zukunft. Andere Industrien, die Kandi­ daten für eine Umstrukturierung infol­ ge von Überkapazität sind, sind Flug­ gesellschaften, Zeitungen, Shopping Malls und Restaurants. Eine jahrelan­ ge Umstrukturierung mit Entlassungen, Kürzungen bei Löhnen und Soziallei­ stungen wird auch in der Erholung wei­ tergehen. Eine neue Studie ergibt, dass 16 % der Unternehmen die Löhne ge­ kürzt haben, während 20 % die Anzahl der vergüteten Arbeitsstunden reduziert haben. Die Anzahl der Arbeitsstunden ist im ersten Viertel 2009 um 9 % redu­ ziert worden. Eine starke durch die Kon­ sumenten bewirkte Erholung ist deshalb reine Fantasie. Die Verschuldungsblase im Herzen der Krise besteht weiter. Mit dem Schei­ tern des freien Markts, des privaten Ka­ pitals, wurde der Staat die einzige Insti­ tution, die die Liquidität, den Kredit und die Konsumentennachfrage garantieren kann. Der Staat hat die Schulden der Banken und der Unternehmen auf sei­ ne Bilanz transferiert und so die Furcht vor der Monetarisierung dieser Schul­ den und der Entstehung einer scharfen Inflation in der Zukunft hervorgerufen. inprekorr 460/461 Ökonomie Die Tiefe der Krise hat die Finanzie­ rung durch Staatsverschuldung auf ein ganz neues Ausmaß gebracht. Das öf­ fentliche Defizit beträgt 2009 1,84 Billi­ onen Dollar, 1,26 Billionen Dollar 2010 und etwa 1 Billion Dollar im Jahr 2011. Dieses neue Ausmaß an Defiziten und akkumulierten Staatsschulden bedroht den Kreditstatus der USA – die Stellung des Dollars als internationale Reserve­ währung – und den Status der U.S. Fe­ deral Reserve als die zentrale Bank der Welt. In den letzten Monaten haben die Regierungen von Irland und Spanien ih­ re Höchstbewertung der Kreditwürdig­ keit verloren. Jüngst hat Standard & Poor die Schulden der britischen Regie­ rung unter Beobachtung gestellt, mit der Aussicht, die Höchstbewertung der Kre­ ditwürdigkeit aufzuheben, da die Staats­ verschuldung so schnell steigt. Großbri­ tannien war seit 1693 mit seinen Schul­ den nicht mehr im Rückstand – eine un­ schlagbare Kreditgeschichte. Die An­ kündigung von Standard & Poor hat ei­ nen massiven Ausverkauf auf dem USMarkt an Obligationen hervorgeru­ fen, weil die US-Regierung denselben Weg zu einem geringfügig langsameren Tempo verfolgt. Dies ließ die langfri­ stigen Zinsraten steigen, einschließlich der auf Hypotheken und Unternehmen­ sobligationen, was die Möglichkeit für eine Erholung weiter einschränkt. Das Defizit stellt die Position der USA als eines sicheren Hafens des Ka­ pitals in Zeiten der Krise in Frage. Das Congressional Budget Office schätzt, dass die Zinsen auf die Staatsschulden von 172 Milliarden Dollar 2009 auf über 800 Milliarden Dollar pro Jahr im Verlauf des kommenden Jahrzehnts stei­ gen werden. Die Zinszahlungen allein wären größer als jedes Defizit vor dem Jahr 2009. Dies wird eine Schuldenfal­ le schaffen, wo die Regierung allein für die Zinszahlungen Anleihen aufnehmen muss, was die Staatsverschuldung wei­ ter vergrößert. Mittlerweile beginnen die Regie­ rungen Chinas und anderer Länder aus Furcht vor einem scharfen Sturz des Dollars infolge der steigenden Staats­ verschuldung, von langfristigen US-An­ leihen zu kurzfristigen US-Schatzwech­ seln und anderen Alternativen überzu­ gehen. Dies könnte zu einem steilen An­ stieg der Zinsraten führen, um den Dol­ lar und die Staatsschuld zu schützen, was einen weiteren tiefen wirtschaft­ lichen Abschwung auslösen würde. inprekorr 460/461 Die Lohnabhängigen zahlen die Rechnung Erholung oder nicht, das Elend der US-Arbeiterklasse wird sich verschär­ fen. Die Arbeitslosigkeit wird auch bei schwacher Erholung weiter wachsen. Die Schaffung von Arbeitsplätzen wird noch Jahre brauchen. Kürzungen bei Löhnen, Sozialleistungen, Renten und Gesundheit werden beschleunigt zuneh­ men. Bei stagnierenden Reallöhnen in den letzten vierzig Jahren und sinkenden Fa­ milieneinkommen im letzten Jahrzehnt wurde der Konsum der Arbeiterklasse durch das Wachstum von Hypotheken und anderen Schulden finanziert. Die­ se Option ist jetzt beendet. Es wird kei­ nen Kredit für US-Lohnabhängige ge­ ben, deren Einkommen sinkt, deren Ei­ genheime im Wert sinken und deren Er­ sparnisse dezimiert worden sind. Vor der Krise machten die Konsumenten­ ausgaben 70 % des BIP aus. Es ist bür­ gerlicher Konsens, dass der Konsum ge­ kürzt werden muss, um die US-Ökono­ mie auf gesunderer Basis wiederaufzu­ bauen, d. h. auf der Grundlage von Er­ sparnissen statt auf Schulden und Aus­ landskapital. Die Kapitalistenklasse und ihre intellektuellen Handlanger sagen uns, dass die Arbeiter und nicht die Bos­ se über ihre Verhältnisse gelebt haben – trotz der Tatsache, dass die Löhne in den letzten dreißig Jahren weitgehend sta­ gnierten oder zurückgegangen sind. Solange die Verschuldung dazu diente, den amerikanischen Kapitalis­ mus zu retten, insbesondere das Ban­ kensystem, wurde sie vom Kapital ver­ teidigt, vor allem da sie von der Arbei­ terklasse bezahlt wurde und nicht durch die Besteuerung der Reichen. Da die Verschuldung nun eine Bedrohung für die Kreditwürdigkeit des US-Kapita­ lismus ist, wird das Kapital sich poli­ tisch gegen weitere Finanzierung durch Staatsverschuldung wenden. Um die Staatsverschuldung zu reduzieren, wird die herrschende Klasse Kürzungen bei den Regierungsausgaben vorschlagen, besonders bei den Ausgaben für Sozial­ leistungen und Gesundheit. Ohne die Reichen zu besteuern, werden die Bundesstaaten ihre zuneh­ menden Haushaltskrisen – Kalifornien hat bspw. ein Haushaltsdefizit von über 20 Milliarden Dollar – durch die stär­ kere Besteuerung des Konsums zu lösen suchen, was hauptsächlich die Arbei­ terklasse betrifft. Diese Steuern werden mit gewaltigen Kürzungen bei Sozial­ leistungen, von denen die Arbeiterklasse abhängt, wie Bildung, Schulmahlzeiten, Krankenversicherung und andere Sozi­ alprogramme, kombiniert werden. Bush und Obama haben 170 Milli­ arden Dollar aufgebracht, um die Schul­ den der Finanz- und Versicherungsge­ sellschaft AIG bei Banken und HedgeFonds-Spekulanten zu begleichen. Jeder Dollar, der an die Banken geht, wird dem Lebensstandard der Werktätigen entzo­ gen. Und die Krise wird die Ausflucht für weitere Angriffe bilden. Obamas Bildungsminister, Arne Duncan, benutzt die Krise in Kalifornien als Gelegenheit, um zu Vertragsschulen und „leistungs­ bezogener“ Bezahlung überzugehen. Die Republikaner und die Rechte wol­ len die Lehrergewerkschaften zerstö­ ren, während die Demokraten die Krise ausnutzen, um die Errungenschaften der Gewerkschaftsbewegung im Bildungs­ sektor zurückzudrängen. Lösungen Von einer Lösung dieser Krise sind wir noch sehr weit entfernt. Im vergangenen Jahr begann in den USA eine ideolo­ gische Krise des Neoliberalismus, des Scheiterns des freien Markts, seiner Un­ fähigkeit zur Selbstkorrektur ohne die Perspektive eines totalen Zusammen­ bruchs. Das staatliche Eingreifen ver­ hinderte ein Bankenzusammenbruch wie in den 30er Jahren. Aber es hat die Krise nicht gelöst. Sowohl ökonomisch als auch ideolo­ gisch können die USA auf die Grenzen dessen stoßen, was der bürgerliche Staat zu erwägen bereit ist, d. h. auf die Gren­ zen des Keynesianismus. Der Keynesia­ nismus schlägt bei Rezessionen als Lö­ sung billiges Geld und Kredit zu nied­ rigen Zinsraten, ein Haushaltsdefizit zum Ausgleich mangelnder Kapitalinve­ stitionen und die Schaffung einer effek­ tiven Konsumentennachfrage vor. Die Regierung hat die kurzfristigen Zinsra­ ten fast auf Null gesenkt und ihr Haus­ haltsdefizit übertrifft das der 30er Jahre. Doch die Auswirkungen auf die Nach­ frage sind dürftig aufgrund der Rettung der Banken, und der Anstieg der Ver­ schuldung bedeutet, dass die Nachfra­ ge wahrscheinlich nicht nennenswert steigt. Keine der Varianten bürgerlicher Wirtschaftspolitik – der Neoliberalis­ mus des freien Markts oder der staats­ 21 Ökonomie kapitalistische Keynesianismus – kann die Krise lösen. Tatsächlich bedeuten die ersten Anzeichen einer Erholung nicht, dass wir aus der Krise rauskommen. Ei­ ne schwache Erholung kann stecken­ bleiben und zu einer neuen Rezession werden oder ein Jahrzehnt der Stagna­ tion einleiten. Die Wirtschaft bricht nicht mehr zusammen, aber das be­ deutet keinesfalls, dass die Krise vor­ bei ist. Eine große Zahl von Menschen hat den Glauben an den freien Markt ver­ loren. Eine wachsende Anzahl hat kei­ nerlei Vertrauen mehr in Kompetenz, Intelligenz, Ehrlichkeit, Integrität und Fairness des kapitalistischen Systems. Der Vorstellung, dass die Reichen das Geld, das sie gewinnen, verdienen und dass Ungleichheit der notwendige Preis für eine funktionale und blü­ hende Gesellschaft ist, wurde ein hef­ tiger Schlag versetzt. Stattdessen gibt es eine massive Unterstützung dafür, dass der Staat die Krise zu lösen ver­ sucht und insbesondere eine Politik durchsetzt, die der „Main Street“ (den einfachen Leuten) und nicht der Wall Street zugute kommt. Die Unterstützung für Obama und die Illusionen in ihn werden weiter­ gehen, wenn die Regierung die Wirt­ schaft stabilisiert. Aber wenn die La­ ge sich nicht dramatisch verbessert, wenn sie sich für die Werktätigen wei­ ter verschlechtert, wird es eine weitere Radikalisierung geben. Die Radikali­ sierung wird dann über die Abneigung gegen den freien Markt, die Banker und die Autobosse hinaus gehen und dazu führen, dass sich die Leute fra­ gen, wem diese Regierung gehört und warum sie sich um die Reichen küm­ mert, die uns in den Schlamassel ge­ bracht haben, und nicht um uns. Dies kann eine Radikalisierung nach links fördern. Aber es kann auch ein Wachs­ tum der extremen Rechten fördern, die bereit ist, die Karte des rassistischen Populismus zu spielen. Deshalb wird die Rolle von Sozialisten und anderen Radikalen, die eine kämpferische Ar­ beiterbewegung aufbauen wollen, ent­ scheidend sein. Die Arbeiterbewegung wurde durch den Triumph des Neoliberalismus in 22 den letzten Jahrzehnten zerschlagen und marginalisiert. Die Wiederbele­ bung einer Klassenpolitik, von Klassen­ organisationen und des Klassenkampfs wird deshalb langwierig sein, ein Pro­ zess von sich häufig wiederholendem Auf und Ab. Wie die Krise und die Er­ holung wird sie viele Stadien durch­ laufen. Eine wachsende Anzahl von Lohnabhängigen, deren Lebensum­ stände sich weiter verschlechtern wer­ den, wird die Illusionen in den Staats­ liberalismus als Alternative zum Neoli­ beralismus verlieren. Die von der Kri­ se geschaffene ideologische Öffnung wird mit der Zeit die Bedingungen für die Wiedergeburt praktischer Kämpfe gewöhnlicher Werktätiger als Antwort auf die Krise schaffen. Obama war gewählt worden, weil Millionen nach den reaktionären BushJahren einen Wandel wollten. Die Lohn­ abhängigen müssen noch viele Erfah­ rungen machen, um zu begreifen, dass der Wandel nicht von oben, vom bürger­ lichen Staat kommt, sondern von unten, gegen die Kapitalisten und ihren Staat. Joel Geier ist Mitglied der International Socia­ list Organization (ISO) in den USA und Redak­ teur der Zweimonatszeitschrift International Socialist Review (ISR). Der Beitrag erschien zu­ erst in ISR, Nr. 66, Juli/August 2009. Übersetzung: HGM IV. Internationale im Internet englisch: www.internationalviewpoint.org/ französisch: http://orta.dynalias.org/inprecor/home spanisch: http://puntodevistainternacional.org deutsch: www.inprekorr.de/ inprekorr 460/461 Ökonomie Die Asienkrise: Krise eines exportgestützten Wachstums oder der Verdrängung von Arbeit? Jean Sanuk Nachdem das Wachstum in den asiati­ schen Entwicklungsländern 2007 auf 9,5 Prozent geklettert war, brach es 2008 um ein Drittel auf 6,5 Prozent ein. Am härtesten brachen Ost- und Südost­ asien ein, während Südasien weniger betroffen ist und die Pazifikregion so­ gar weiter wuchs. Die letzte Krise in der Region im Jahr 2001 ging auf das Plat­ zen der „Internet-Blase“ in den Verei­ nigten Staaten zurück. Das Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) der Re­ gion sank zwischen 2000 und 2001 von 7,1 auf 4,8 Prozent, also um ein Drittel. Die „Asienkrise“ von 1997/98 war we­ sentlich schwer wiegender. Zuerst ver­ langsamte sich das Wachstum in den Entwicklungsländern Asiens zwischen 1996 und 1997 von 7,5 auf 6,0 % und brach dann 1998 sogar auf 1,6 % ein, d. h. gegenüber 1996 auf ein Viertel. Ein genauer Blick auf die Quartals­ zahlen zeigt, dass die meisten Länder Asiens (außer Singapur und Taipeh) im ersten Quartal 2009 die Talsohle er­ reicht und einzelne die Krise besser ge­ meistert haben als 1997/98 (siehe Ta­ belle 1).1 1 Tabelle 1 vergleicht die Quartale eines Jahres inprekorr 460/461 Sieht man sich die Ergebnisse des ersten und zweiten Quartals 2009 an, lässt sich eine erneute Wachstums­ tendenz beobachten (siehe Tab. 2). Wie wir noch sehen werden, ist die­ ser Wiederaufschwung hauptsächlich China zu verdanken, dessen Wachs­ tum im zweiten Quartal 2009 7,5 % erreicht. Indien und Indonesien, zwei andere „Schwergewichte“ in der Re­ gion, weisen ebenfalls ein positives Wachstum aus, und Japan, eine an­ dere wichtige regionale Wirtschafts­ macht, scheint aus der Rezession hi­ naus zu sein. Vergleicht man die Quartale mit den Vorjahrsergebnissen, ist der Wie­ deraufschwung noch deutlicher. Zwi­ schen dem ersten und dem zweiten Quartal 2009 wuchs das BIP in China um 15 %, in Südkorea um 10 %, in Sin­ gapur um 21 %, in Indonesien um 5 % (siehe Tab. 2). Der „Wachstumspol Asien“ ist so­ gar die einzige Region der Welt, in der die Industrieproduktion wieder den mit den entsprechenden Quartalen des Vorjahrs, um Saisonschwankungen zu vermeiden und Entwicklungstendenzen besser zu erfassen. Stand von vor der Krise erreicht (sie­ he Grafik 1). Grund genug für den für seine Se­ riosität bekannten britischen „Econo­ mist“, auf dem Titelblatt vom „sensati­ onellen Aufschwung in Asien“ zu spre­ chen.2 Obwohl dieser Aufschwung tat­ sächlich eindrücklich ist, hängt er stark vom Aufschwung Chinas ab, und die vielfältigen Probleme, mit denen die Länder Asiens konfrontiert sind, dürfen nicht unterschätzt werden. Verschiede­ ne Faktoren deuten darauf hin, dass der Wiederaufschwung in Asien von kur­ zer Dauer sein wird. 1. Auswirkungen je nach Land Die Folgen der Krise in den asiatischen Ländern weichen stark voneinander ab, je nachdem, ob man den Finanz- oder den Produktionsbereich betrachtet. Folgen im Finanzsektor Asien war von der „Subprime“-Kri­ se im eigentlichen Sinn, die die gegen­ wärtige Krise ausgelöst hat, nur be­ grenzt betroffen. Die Verluste werden 2 The Economist vom 15.–21. August 2009. 23 Ökonomie daher als sehr gering eingestuft. Die Verluste für ganz Asien einschließlich Japan werden auf 19,5 Mrd. Dollar ge­ schätzt. Das entspricht 1,95 % des Ban­ kenkapitals und nur 0,09 % der gesam­ ten Bankaktiva, gegenüber 10,03 % bzw. 1,02 % für die USA: Im Mai 2008 betrugen die globalen Verluste durch Wertminderung von Aktivposten und uneinbringliche Kredite der 100 größ­ ten Banken und Investitionsfonds welt­ weit 379 Mrd. Dollar. Asien (ohne Ja­ pan) trägt daran einen Anteil von 10,8 Mrd. Dollar, also weniger als 3 % der Gesamtverluste. Zudem sind asiatische Banken indirekt nur geringfügig von Konkursen und den riesigen Verlusten amerikanischer und europäischer Ban­ ken betroffen. So etwa blieben die Fol­ gen der Insolvenz der Lehman Brothers sehr begrenzt. Die Bangkok Bank bei­ spielsweise verzeichnet einen Verlust von 101 Millionen Dollar, was zwar er­ heblich ist, aber die Bank nicht gefähr­ dete. Doch selbst wenn die direkten und indirekten Auswirkungen der Subpri­ me-Krise minimal waren, hatte die Fi­ nanzmarktkrise für Asien trotz allem erhebliche Folgen. Sie drückte sich durch eine massive Kapitalflucht in zahlreichen Ländern aus (siehe Gra­ fik 2). Diese Kapitalflucht erklärt sich in erster Linie durch massive Verkäufe von Aktien und Obligationen auf den asiatischen Finanzmärkten und die Konvertierung der erhaltenen Beträge in Dollar, die dann ins Herkunftsland 24 zurücktransferiert wurden. Dieses Phä­ nomen ist sehr ausgeprägt in Südko­ rea und Neuseeland mit ihren riesigen, für ausländisches Kapital gleichzei­ tig sehr offenen Aktienmärkten und in Malaysia mit seinem hoch entwickel­ ten Markt für staatliche Schuldtitel und einer ebenfalls starken Präsenz auslän­ discher Investoren (BIS 2009). Die Ka­ pitalflucht erklärt sich darüber hinaus durch die Nichterneuerung von kurz­ fristigen Bankkrediten in Dollar, die ausländische Banken den asiatischen Banken gewährt hatten. Der Einbruch bei Bankkrediten war in den Finanz­ zentren Singapur und Hongkong sehr ausgeprägt. Die Banken dieser Länder mussten die Darlehen, die sie bei aus­ ländischen Banken aufgenommen hat­ ten, in Dollar zurückzahlen. Hongkong und Singapur, aber auch Japan, konnten diesen enormen Kapitalabfluss verkraf­ ten, da sie in ihrer Leistungsbilanz er­ hebliche Überschüsse auswiesen, aber auch, weil die Repatriierung von Kapi­ tal in diese Länder den Abgang mehr als aufwog. Im Fall Japans führte die Repatriierung von Kapital zur Aufwer­ tung des Yen, wodurch sich die bereits bestehenden Absatzprobleme der Ex­ portwirtschaft weiter verschärften. In anderen Ländern, insbesonde­ re in Südkorea, waren die Folgen we­ sentlich einschneidender. Der Kapital­ abfluss war in diesen Ländern ab dem dritten Quartal 2007 spürbar und ver­ schärfte sich, als die Krise im Jahr 2008 offen ausbrach. Im Herbst 2008 hatte der koreanische Won bereits 40 % sei­ nes Werts verloren – die bislang stärks­ te Abwertung einer asiatischen Wäh­ rung überhaupt im Verlauf der aktuel­ len Krise. 60 Mrd. Dollar an internati­ onalen Reserven lösten sich in einigen Monaten in nichts auf. Die Risikoprä­ mien auf koreanische Staatsobligatio­ nen, die das Misstrauen ausländischer Investoren gegenüber der koreanischen Wirtschaft zum Ausdruck bringen und vor der Krise bei 30 Basispunkten la­ gen, schnellten auf 700 Punkte.3 Die stärkere Vulnerabilität der koreani­ schen Wirtschaft erklärt sich durch ei­ ne Reihe von Faktoren, die zur hohen Finanzinstabilität beitrugen: die fast vollständige Freiheit der Kapitalbewe­ gungen, das Vorliegen von sehr entwi­ ckelten und liquiden Kapitalmärkten, die Entwicklung eines bedeutenden Markts für Derivate und schließlich der flexible Wechselkurs. Auslöser der Kri­ se war dann die massive Verschlech­ terung der Zahlungsbilanz seit 2005. Die Finanzierung dieses Defizits stützt sich immer mehr auf von koreanischen Banken gezeichnete kurzfristige Dar­ lehen statt auf stabilere, langfristige­ re Mittel wie langfristige Darlehen und ausländische Direktinvestitionen. Die Bevorzugung von kurzfristigen Kre­ diten durch die koreanischen Banken erklärt sich durch die massive Zunah­ 3 Die Risikoprämie bemisst sich aus der Differenz zwischen dem Zinssatz, der von der USamerikanischen Staatskasse an Inhaber amerikanischer Schatzscheine ausgezahlt werden, und den Zinsen, die die Staatskassen anderer Länder zahlen müssen. inprekorr 460/461 Ökonomie me an Darlehen, die sie nationalen Un­ ternehmen und Haushalten ausgestellt hatten, während die Einlagen nur lang­ samer stiegen. Diese Entwicklung ver­ läuft genau umgekehrt zu jener in den anderen asiatischen Ländern. Die kore­ anischen Banken mussten ihre Schul­ den refinanzieren und aufgrund einer ungenügenden heimischen Sparkraft kurzfristige, in Dollar ausgestellte Kre­ dite bei ausländischen Banken aufneh­ men. Damit wiederholt sich gewisser­ maßen die Krise von 1997/98. Die Aus­ landsverschuldung verdoppelte sich damit für die Periode 2005–2008. Als im Herbst 2005 die internationale Kri­ se offen ausbrach, bekamen die Inves­ toren angesichts der hohen Abhängig­ keit Koreas von kurzfristigen ausländi­ schen Darlehen kalte Füße und began­ nen, ihr Kapital abzuziehen. „Das Aus­ maß des Nettokapitalabflusses erreich­ te allein im Oktober 2008 25,5 Mrd. Dollar (mehr als 3 % des BIP), also we­ sentlich mehr als die 6,4 Milliarden, die im Dezember 1997 auf dem Höhepunkt der ‚Asienkrise‘ von 1997/98 abgeflos­ sen waren.“ (Cho, Dongchul 2009) Im Dezember 2008 wurden durch auslän­ dische Anleger über 70 Mrd. Dollar (7,7 % des BIP) an Börsenwerten abge­ zogen. Die von der koreanischen Zen­ tralbank gewährten Kreditgarantien er­ wiesen sich als weniger effizient zur Wiederherstellung des Vertrauens als in den westlichen Ländern und Korea musste ausgiebig aus seinen Währungs­ reserven schöpfen, um den Zusammen­ bruch seiner Währung zu verhindern und die heimischen Banken und Exporteure mit Dollars und anderen Devisen auszu­ statten. Die Unterstützung der ausländi­ schen Zentralbanken erwies sich als ent­ scheidend, um das Vertrauen wiederher­ zustellen. Die Zentralbanken der Verei­ nigten Staaten, Japans und Chinas lie­ hen Korea Dollars, damit es ständig genügend liquid ist. Dank Abwertung des koreanischen Won konnte die Leis­ tungsbilanz schlagartig wiederherge­ stellt werden und war zur Hälfte dar­ an beteiligt, die Zahlungsbilanz in den ersten acht Monaten des Jahres 2009 wiederherzustellen, während die zwei­ te Hälfte auf ausländisches Kapital zu­ rückgeht. Ländern vor allem durch den Welt­ handel und in zweiter Linie durch die internationalen Finanzmärkte verbrei­ tet. Der Nachfrageeinbruch für asiati­ sche Produkte im Westen führte zum plötzlichen Schrumpfen des Export­ wachstums von rund 30 % für Ostund Südostasien und von rund 10 % für Südasien. Generell gesprochen war die rezessive Wirkung in Län­ dern mit einem größeren Öffnungs­ grad gegenüber dem Welthandel, de­ ren Exporte am stärksten auf den in­ dustriellen Bereich konzentriert sind und in den USA einen bedeutenden Abnehmer haben, am stärksten (sie­ he Grafik 3). In Singapur, das sich auf Import/ Export spezialisiert hat, machen die In­ dustrieexporte 140 % des BIP aus, in Malaysia 70 %, in Kambodscha und Thailand über 40 % und in China, Ko­ rea, auf den Philippinen und in Vietnam über 30 %. Dagegen entsprechen die Industrieexporte in Indien und Pakistan weniger als 10 % des BIP und in Indo­ nesien nur 11 % des BIP. Diese Kenn­ zeichen erklären, warum Länder wie In­ donesien und die Philippinen weniger gelitten haben als beispielsweise Sin­ gapur und Malaysia. Die beiden Aus­ nahmen von der Regel sind China und Vietnam, deren unmittelbare Gesund­ heit vom Ausmaß des Ankurbelungs­ plans abhängt (siehe weiter unten). Der Einbruch der internationalen Nachfra­ ge hatte auch einen Niedergang der In­ vestitionen in den neuen Industrielän­ dern (NIC) der ersten Generation (Sin­ gapur, Hongkong, Taiwan, Südkorea) sowie in den Kernländern der ASEANStaaten (Philippinen, Indonesien, Thai­ land und Malaysia) zur Folge. Die NIC waren insbesondere von den rückläufi­ gen Investitionen (–15,3 %) während des ersten Quartals 2009 betroffen, während die vier ASEAN-Länder we­ niger darunter litten (–5,3 %). Die Bin­ nennachfrage schrumpfte in den NIC ebenfalls um –2,3 %, während sie in den vier ASEAN-Ländern mit +2,6 % im Plus, wenn auch niedriger als im dritten Quartal 2008 (+5,5 %) ausfiel. (ADB 2009a) Die „kleinen“ ASEAN-Länder (Vi­ etnam, Kambodscha, Laos) hielten bis­ lang besser stand als die vier „großen“, da sie weniger exportabhängig sind. Der Wachstumsrhythmus in Vietnam verlangsamte sich im ersten Quartal 2009 bis auf 3,1 %, was der schwächs­ te Wert seit zehn Jahren ist. Im zwei­ ten Quartal stieg das Wachstum aller­ dings wieder auf 4,4 %. Der Wieder­ aufschwung dürfte vermutlich nicht anhalten, da er stark einem Konjunk­ turprogramm zu verdanken ist, dessen Kernelement ein niedriger, subventi­ onierter Zinssatz ist, der den Staat ei­ ne Milliarde Dollar jährlich kostet. Das wird das Budgetdefizit von 4,1 % des BIP im Jahr 2008 für 2009 auf 10,3 % treiben, und angesichts des Risikos, das die öffentliche Verschuldung der aufstrebenden Märkte für ausländische Investoren birgt, wird es kaum abge­ baut werden können. In Kambodscha lag das Wachstum 2008 bei 6,5 % ge­ genüber 10,2 % im Jahr 2007, was für diese fragile Wirtschaft eine erhebli­ che Verlangsamung bedeutet. In La­ os konnte das Wachstum dank der Ex­ pansion der Bergbauwirtschaft und der hydroelektrischen Produktion 2008 auf 7,2 % gehalten werden. Vor dem Hintergrund der allgemei­ nen Krise in fast ganz Asien bildet Chi­ na die einzige beachtliche Ausnahme, Die Auswirkungen auf den Produktionsbereich Die Rezession in Nordamerika und Europa hat sich in den asiatischen inprekorr 460/461 25 Ökonomie denn dort konnte im ersten Quartal 2009 das Wachstum auf 6,1 % gehal­ ten werden. In geringerem Ausmaß gilt dieselbe Feststellung für die beiden an­ deren großen Entwicklungsländer Asi­ ens, also Indien und Indonesien, die mitten in der Krise ein Pluswachstum verzeichneten. Der Größenvorteil, ver­ bunden mit der geringen Abhängigkeit von Exporten, spielt in Zeiten interna­ tionaler Krisen eine wichtige Rolle. In China verlangsamte sich das Wachstum nach einer Spitze von 14 % im zweiten Quartal 2007, nachdem die Regierung beschlossen hatte, die durch die Immo­ bilienblase überhitzte Wirtschaft zu be­ ruhigen. Die chinesische Zentralbank erhöhte den Zinssatz und verknapp­ te die Kredite. Als die allgemeine Kri­ se offen ausbrach, vollzog die Regie­ rung einen völligen Kurswechsel in ih­ rer Wirtschaftspolitik. Ein umfassendes Konjunkturprogramm (siehe im Detail weiter unten) führte zu einer massiven Erhöhung öffentlicher Investitionen (+38,7 %), wodurch der Einbruch bei den Exporten, die im Mai 2009 einen Tiefststand erreichten (–22 %, siehe Grafik 4), mehr als ausgeglichen wer­ den konnte. Der Plan zur Wiederankurbelung der Wirtschaft ist also beachtlich, was sich dadurch erklären lässt, dass der chinesische Kapitalismus noch eng vom Staat und den staatlichen Unter­ nehmen gesteuert wird. Das Wachs­ tum beschleunigte sich und erreich­ te im zweiten Quartal 2009 7,9 % und im dritten 8,9 %. Doch gleichzeitig steht dieses Wachstum auf unsicheren Beinen. Langfristig ist kaum vorstell­ bar, dass die chinesische Wirtschaft den Exportrückgang durch ein anhal­ tendes Investitionswachstum unbe­ schränkt ausgleichen kann. Die Inves­ titionen in fixes Kapital müssen frü­ her oder später in die Herstellung von Gütern und Dienstleistungen münden, die im Wesentlichen von chinesischen KonsumentInnen gekauft werden müs­ sen, da es an ausländischer Nachfrage fehlt. Das Problem ist, dass die Nach­ frage der chinesischen Haushalte auf eine harte Probe gestellt ist. Der An­ teil der Arbeitseinkommen am chine­ sischen BIP hat in den letzten Jahren stark abgenommen und die aktuelle Krise hat das Einkommen noch einmal deutlich reduziert. Diese Feststellung trifft in gewisser Weise auf die meisten Länder Asiens zu. Wie sollen die asi­ atischen KonsumentInnen unter diesen Bedingungen die asiatische Wirtschaft stützen? Ausführlicher dazu etwas spä­ ter, doch zuerst zu den sozialen Folgen der Krise für die Bevölkerung. Die sozialen Folgen der Krise Die Beschäftigten im Finanzdienstleis­ tungssektor der reichen Ländern wie Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur und Japan bekamen die in­ ternationale Krise angesichts der en­ gen Verflechtung ihrer Bankensyste­ me und Börsenmärkte mit den Verei­ nigten Staaten als Erstes zu spüren. In den asiatischen Entwicklungsländern waren als Erstes die ArbeiterInnen der Exportindustrie betroffen. Es gab unmittelbar zahlreiche Entlassungen in diesem Sektor, die dann auf ande­ re Sparten übergriffen. Wie in den rei­ chen Ländern, drückt sich die Krise im Rückgang der gearbeiteten Stunden4, im Lohndruck und in massivem Stel­ lenabbau aus. In den Entwicklungslän­ dern Asiens bedeutet die Krise auch ei­ nen Rückgang der von MigrantInnen überwiesenen Mittel, die Rückkehr von ArbeitsmigrantInnen, die ihre Stel­ le verloren haben, die Zunahme von prekären Arbeitsverhältnissen und den Wechsel in die informelle Wirtschaft, steigende Armut in Ländern, wo die­ se gerade erst abgenommen hatte und/ oder teilweise weiter auf einem hohen Stand ist. Diese Phänomene werden da­ durch verschärft, dass die soziale Absi­ cherung in Asien im Schnitt schwächer ist als in anderen Kontinenten. • Rückläufige Überweisungen: Für viele arme Haushalte stellen die Geld­ überweisungen von ArbeitsmigrantIn­ nen einen entscheidenden Anteil am Einkommen dar. Auf den Tonga-Inseln entsprechen sie einem Drittel des BIP, auf den Philippinen 11 %, in Bangla­ desh, Sri Lanka, Vietnam und der Mon­ golei zwischen 5 % und 10 % (Kim, Kee Beom, Huynh Phu, Sziraczki Gy­ orgy und Kapsos Steven 2009). • Lohndruck: Zwischen 2001 und 2007, der Periode mit dem stärksten Wachstum in den asiatischen Entwick­ lungsländern, sind die Jahreslöhne im Schnitt um 1,8 % gestiegen und da­ mit deutlich hinter den Produktivitäts­ gewinnen derselben Periode zurückge­ blieben (ILO 2008a). Angesichts der Tatsache, dass in den meisten Ländern weniger als 15 % der Löhne durch Kol­ lektivverträge geregelt sind, besteht ei­ ne hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Krise zu einer Stagnation oder zu sin­ kenden Reallöhnen führen wird. • Stellenabbau: In Asien wie in den westlichen Ländern stehen insbeson­ dere in der verarbeitenden Industrie Massenentlassungen bevor. Sie kon­ zentrieren sich auf die Exportindust­ rie. Die meisten Beschäftigten arbeiten in kleinen und mittleren Zulieferbetrie­ ben für Großunternehmen, die in nati­ onale, regionale oder globale Produkti­ onsketten eingebunden sind. Betroffen sind in erster Linie Frauen, die einen hohen Anteil an vulnerablen Beschäf­ tigungsverhältnissen stellen. Sie sind von den Massenentlassungen am meis­ ten betroffen, weil die Exportindust­ 4 Bei den Löhnen in Asien spielen Überstunden eine wichtige Rolle, da die Grundgehälter niedrig sind. 26 inprekorr 460/461 Ökonomie rie vor allem Frauen beschäftigt. Bei­ spielsweise arbeiten auf den Philippi­ nen, in Thailand und Vietnam doppelt bis viermal so viele Frauen wie Män­ ner in der Bekleidungs- und Textilin­ dustrie und fünfmal mehr in der Elek­ tronikindustrie. Allein in China hat die Regierung kürzlich angekündigt, dass rund 20 Millionen oder 15 % der ins­ gesamt 130 Millionen Arbeitsmigran­ tInnen im Land in den letzten Monaten ihre Stelle verloren haben. China sticht hier besonders hervor, aber dasselbe gilt auch für andere asiatische Länder. Dennoch ist es schwierig, die Folgen der Krise für die Beschäftigung umfas­ send zu beurteilen, da die Zunahme der Arbeitslosenzahlen nur sehr begrenzt Aussagekraft hat, da der Begriff Ar­ beitslosigkeit in den Entwicklungslän­ dern nicht viel bedeutet. Lohnarbeit ist in Asien eine Minderheitserscheinung5 und fehlende (oder geringe) Arbeitslo­ sengelder in den meisten Ländern sind nicht gerade ein Ansporn, sich „arbeits­ los“ zu melden, wenn man die Stel­ le verliert. Trotz dieser Einschränkung ist ein deutlicher Anstieg der Arbeits­ losigkeit zu verzeichnen, der in Japan bei +26 %, in Korea bei +18 %, in Sin­ gapur bei +73 % und in Thailand bei +28,7 % liegt. Bedeutender ist die Zunahme von informellen Jobs und die Rück­ kehr aufs Land. Ein ähnliches Phäno­ men wurde während der „Asienkrise“ 1997/98 beobachtet. Das fehlende Ein­ kommen und die Angst vor Armut ver­ anlassen diejenigen, die ihre Stelle ver­ loren haben, sich selbstständig zu ma­ chen, um sich ein Ersatzeinkommen zu erwirtschaften oder, wo dies noch möglich ist, auf den Hof der Familie zurückzukehren und im Austausch ge­ gen die Unterstützung durch die Fa­ milie dort gratis zu arbeiten. Die In­ ternationale Arbeitsorganisation ver­ sucht, dieses Phänomen „vulnerabler Beschäftigung“ als Summe der selbst­ ständigen oder unbezahlt im Familien­ betrieb oder auf dem familieneigenen Hof geleisteten Arbeit zu erfassen. In Thailand ist beispielsweise im dritten Quartal 2008 die Zahl der Arbeitskräf­ te um 98 600 gegenüber dem Vorjahr gesunken, während im gleichen Zeit­ raum 799 200 vulnerable Stellen ent­ standen sind (Quelle: Thailändisches Amt für Statistik). Diese vorüberge­ hende Rückkehr aufs Land wird den Druck auf die ländlichen Arbeitsmärk­ te mit ihrem begrenzten Stellenangebot erheblich erhöhen. Die Einkommen der ländlichen Haushalte reichen nicht aus, um vielköpfige Familien zu ernähren, so dass die Armut steigen wird. Insge­ samt befinden sich Familien, die dank neuer Beschäftigungsmöglichkeiten im formellen städtischen Bereich in den letzten zwanzig Jahren die Schwelle absoluter Armut überwunden haben, in einer sehr unsicheren Lage und könn­ ten aufgrund der Krise erneut in Ar­ mut stürzen. „Mehr als 52 Millionen ArbeiterInnen leben gegenwärtig auf einem Einkommensniveau von 10 % über der absoluten und 140 Millionen auf einem Niveau von 20 % über der absoluten Armutsgrenze von 1,25 Dol­ lar.“ (ILO 2009) In Kambodscha sinkt das Einkommen dieser Arbeiterkatego­ rien bereits. In Indien bekommen die ArbeiterInnen, die Abfall recyclieren, die Folgen der Krise bereits deutlich zu spüren, da sich die Preise für Recy­ clingmaterial in freiem Fall befinden. In Adhmedabad, einer Stadt im indi­ schen Staat Gujarat mit 5,2 Millionen Einwohnern, recyclieren 35 000 Men­ schen 12­ % bis 14 % der 300 Tonnen an täglichen Abfällen. Gemäß den Zahlen einer Vereinigung selbstständiger Frau­ en (Self-Employed Women‘s Associa­ tion, SEWA) sind deren „Einkommen in den letzten fünf Monaten um 50 % gesunken“. Auch Jugendliche sind von der Kri­ se hart betroffen. 2008 lag die Wahr­ scheinlichkeit, arbeitslos zu sein, bei Jugendlichen dreimal höher als bei Er­ wachsenen. Diese Zahl könnte abrupt steigen, da junge Beschäftigte im All­ gemeinen als Erste entlassen werden. „Auf den Philippinen ist die Zahl der Arbeitslosen im Januar 2009 gegen­ über dem Vorjahr beispielsweise um 5,9 % oder 1,4 Millionen Menschen gestiegen. Auch in Japan stieg die Zahl der Jugendlichen ohne Stelle im Feb­ ruar 2009 gegenüber dem Vorjahr um 19,5 %. In China wird erwartet, dass 2009 6,1 Millionen Hochschulabgän­ gerInnen auf den Arbeitsmarkt gelan­ gen, wo bereits 4 Millionen Abgänge­ rInnen der Vorjahre auf eine Stelle war­ ten“ (ILO 2009). Zusammenfassend geht die Interna­ tionale Arbeitsorganisation (ILO) da­ von aus, dass „in Asien und dem Pazi­ fikraum die Zahl der stellenlosen Ar­ beiterInnen 2008 um 4,4 Millionen auf 90,3 Millionen oder 4,8 % der aktiven Bevölkerung steigen wird (ILO 2009). Einer pessimistischen Annahme zufol­ ge könnte der entsprechende Wert für 2009 auf 5,9 % klettern, was für die Region einen beispiellosen Anstieg be­ deuten würde. Zudem geht die ILO da­ von aus, dass 1,09 Milliarden AsiatIn­ nen, also 60,7 % der Gesamtbeschäf­ tigten, 2008 in einer vulnerablen Stel­ le sind. Wenn sich die Wirtschaftslage weiter verschlechtert, könnte die Zahl auf 64 Millionen Menschen steigen. Der Schock der Krise würde sich da­ mit stärker im Bereich der Gesamtbe­ 5 Sie liegt für Südasien bei 21 %, für Südostasien und den Pazifikraum bei 39 %, für Nordostasien (Japan, China, Südkorea) bei 43 %. In den reichen Ländern liegt der Anteil der Lohnabhängigen an den Beschäftigten durchschnittlich bei 84 %. Quelle: ILO. 2008a. „Global Wage Report 2008/09. Minimum wages and collective bargaining: Towards policy coherence“ Global Wage Report: 120. International Labour Organisation: Genf. inprekorr 460/461 27 Ökonomie schäftigung ausdrücken als in der An­ zahl der verlorenen Stellen (Kim, Kee Beom, Huynh Phu, Sziraczki Gyorgy und Kapsos Steven 2009). Die sozialen Folgen der Krise wä­ ren umso härter spürbar, als in Asien das soziale Netz schlecht ausgebaut ist. Gemessen am BIP betragen die Sozial­ ausgaben nur 2,2 % in der Asien-Pazi­ fik-Region, was weit hinter Lateiname­ rika, der Karibik (4,5 %) und Nordaf­ rika (6,4 %) liegt, ganz zu schweigen von den reichen Ländern (14,2 %) (sie­ he Grafik 5). Eine soziale Abfederung der Krise gibt es in Asien nicht. 2. Ende des starken Wachstums und Wiederaufkommen der sozialen Frage Ein ausgeglichenes Wachstum errei­ chen – so lautet das neue Leitmotiv der offiziellen Institutionen in Asien. Die Feststellung, dass das implizite Arrangement, das vor der Krise zwi­ schen den asiatischen Ländern und den Vereinigten Staaten bestand, über­ holt ist, ist ein Gemeinplatz. Die akku­ mulierten Währungsreserven Asiens wurden zum Teil aufgewandt, um den Vereinigten Staaten die nötige Finan­ zierung zur Deckung ihres Leistungs­ bilanzdefizits zu ermöglichen. Die ex­ portorientierten Länder Asiens stütz­ ten mit anderen Worten den Kauf asia­ tischer Produkte durch amerikanische KonsumentInnen, die nicht mit stei­ genden Einnahmen, sondern mit stei­ genden Schulden zahlen. Dieses Sys­ tem ermöglichte den Ländern Ost- und Südostasiens eine hohe Wachstumsra­ te, die zur massiven Abwanderung von landwirtschaftlichen ArbeiterInnen in Industrie und Dienstleistungen führte. Das Phänomen an sich ist nicht neu, da es jeden Industrialisierungsprozess begleitet. Was in den Entwicklungslän­ dern Asiens beachtlich ist, ist die Ge­ schwindigkeit, mit der dies geschieht. Da sich die absolute Arbeit auf länd­ liche Gebiete konzentriert,6 erlaub­ 6 Die absolute Armut bedeutet Bedürftigkeit. Sie bemisst sich durch einen nationalen Armutsdurchschnitt, der von den Behörden im Verhältnis zum Einkommen festgelegt wird, das zur Befriedigung der Grundbedürfnisse (Nahrung, Kleidung, Wohnen ...) nötig ist, oder anhand eines internationalen Werts, der von der Weltbank gemüss denselben Kriterien errechnet wird und gegenwärtig bei 1,25 Dollar in Kaufkraftparität liegt. Die beiden Armutsgrenzen sind nicht identisch und führen zu oft sehr unterschiedlichen Angaben über den Anteil der 28 te dieser rasche strukturelle Wandel einen starken Rückgang der absolu­ ten Armut, begleitet von einer Stei­ gerung der relativen Armut, d. h. der Einkommensungleichheiten.7 Ausmaß und Geschwindigkeit dieser Entwick­ lung variieren je nach Land, treffen aber auf zahlreiche Länder der Region zu. Die rasche Industrialisierung führ­ te zur Entstehung einer zahlenmäßig starken, auf Industrieparks konzent­ rierten industriellen Arbeiterklasse, die im Allgemeinen schlecht bezahlte, undankbare und teilweise gefährliche Arbeiten verrichtet, die ihr aber trotz allem einen Lebensstandard erlauben, der über der auf dem Land verbreite­ ten absoluten Armutsgrenze liegt. Da­ neben ist ein bedeutender städtischer Mittelstand entstanden, der über eine bessere Ausbildung verfügt und von besseren Jobmöglichkeiten profitie­ ren kann. Aus diesem Grund ist die­ ser Mittelstand die beste Stütze der Bourgeoisie und der Staatsbürokratie. Ein gutes Beispiel dafür ist Thailand mit seiner Opposition, die gespalten ist in die im Wesentlichen aus Bauern/ Bäuerinnen, ArbeiterInnen und armer Stadtbevölkerung bestehenden „Rot­ hemden“ einerseits und die aus dem privilegierten Mittelstand, Angehöri­ gen des Staatsapparats und Teilen von Bangkoks Bourgeoisie zusammenge­ setzten „Gelbhemden“ andrerseits. Ei­ ne ähnliche Opposition gibt es, wenn auch in einem völlig anderen Zusam­ menhang, in China, wo sich die Kom­ munistische Partei auf den jungen, gut ausgebildeten Mittelstand stützt, der vom neuen Angebot an qualifizierten Stellen in Industrie und Dienstleistun­ gen profitieren konnte und einen ho­ hen Lebensstandard erreicht hat. Auf ihre Unterstützung zählt die Kom­ munistische Partei, um die Hebel der Macht weiter in der Hand zu halten. Mit dem anhaltenden Sinken der Nachfrage an Konsumgütern der ame­ rikanischen Haushalte und der Not­ wendigkeit der Vereinigten Staaten, ihr Leistungsbilanzdefizit zu reduzie­ ren, kann Asien nicht mehr darauf set­ Bevölkerung, der in absoluter Armut lebt. 7 Die Ungleichheiten können anhand der Einkommen oder anhand des Konsums gemessen werden. Das zweite Kriterium ist in Entwicklungsländern geeigneter, da die Geldeinkommen die Situation der Haushalte auf dem Land nur schlecht widerspiegeln. Je nach gewähltem Kriterium können die Armutsmessungen deutlich voneinander abweichen. zen, dass es ein wachsendes Volumen an immer differenzierteren Gütern ex­ portieren kann, um ein hohes Wachs­ tum aufrechtzuerhalten. Das stellt die Regierungen der Region vor ernsthafte politische und soziale Fragen. Das hohe Wachstum ist ein beque­ mes Mittel, sozialen Fragen und der Notwendigkeit zum Abbau von Un­ gleichheiten aus dem Weg zu gehen. Wie sollen in einer Phase, in der die meisten asiatischen Länder in ein ver­ längertes Wachstum eintreten, die poli­ tischen Spannungen bewältigt werden, die durch die allgemeine Unzufrieden­ heit unvermeidlich aufkommen wer­ den? Lässt sich das Wachstum auf den Binnenmarkt ausdehnen, um ausrei­ chend hoch zu bleiben? Wie kann die Binnennachfrage stimuliert werden, ohne die Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel zu setzen und an den hohen Pro­ fiten zu nagen, die die Unternehmen normalerweise einsacken? Alle macht­ habenden Eliten der Region müssen sich diesen Fragen stellen, doch wel­ che Antworten gefunden werden, spielt vor allem für China eine wichtige Rol­ le, da es der wichtigste Wirtschafts­ partner zahlreicher asiatischer Län­ dern geworden ist, angefangen bei Ja­ pan und Korea. Wird China, wenn es sein Wachstum zugunsten seines aus­ gedehnten Binnenmarktes ausgleichen kann, ein ausreichender Wachstums­ motors zur Belebung des gesamten asi­ atischen Raums werden? 3. China als Motor des Aufschwungs? Definitive Antworten auf all diese Fra­ gen sind nicht möglich, aber zumindest einige Hypothesen. Als Ausgangspunkt soll die allzu breitwillig übernommene These hinter­ fragt werden, ob die hohen systemati­ schen Handelsüberschüsse ein den asi­ atischen Wirtschaften eigenes Kennzei­ chen sind. Tatsächlich hat sich die Re­ gion insgesamt bis zur Krise 1997/98 durch Defizite ausgezeichnet. Bis An­ fang der 90er-Jahre war die Binnen­ nachfrage in so verschiedenen Län­ dern wie China, Indien, Südkorea, den Philippinen und Thailand der wich­ tigste Wachstumsfaktor. Handelsüber­ schüsse, die zum Wachstum beitragen, gibt es in allen asiatischen Ländern au­ ßer den Philippinen erst seit den 90erJahren (Felipe, Jesus and Lim Joseph inprekorr 460/461 Ökonomie 2005). Eine detailliertere Untersu­ chung der elf größten Länder mit vor­ liegenden Zahlen, die 95 % des regi­ onalen BIP erwirtschaften, stützt die Feststellung, dass es sich bei den Han­ delsüberschüssen um ein relativ junges Phänomen handelt (ADB 2009b). 1. Die Kategorie der Länder mit gerin­ gem Einkommen und Leistungsbi­ lanzüberschüssen: Hierzu zählt nur China. Bis 2003 waren die Über­ schüsse schwach und unregelmäßig; ab diesem Zeitpunkt wachsen sie und liegen derzeit bei rund 10 % des BIP. 2. Länder, die von der Asienkrise 1997/98 betroffen waren: Indone­ sien, Korea, Malaysia, Philippi­ nen, Thailand. In diesen Ländern schwankte die Leistungsbilanz vor der Krise von 1997/97 zwischen Überschüssen und Defiziten; die Überschüsse verringerten sich ten­ denziell in den letzten Jahren, außer in Malaysia. 3. Die übrigen neuen Industrieländer (NIC): Hongkong, Singapur, Tai­ wan. Die Bilanz weist während län­ gerer Zeiträume Überschüsse auf, die in den letzten Jahren tendenziell steigen. 4. Die übrigen einkommensschwachen Länder: Indien und Vietnam. Die Leistungsbilanzen sind im Schnitt defizitär. Zusammenfassend lassen sich die Über­ schüsse seit 2003 im Wesentlichen auf die erhöhten Überschüsse Chinas zu­ rückführen. Die von der Asienkrise be­ inprekorr 460/461 troffenen Ländern Asiens mit Ausnah­ me von Malaysia weisen eher beschei­ dene Überschüsse aus, die vor allem auf die schwachen Investitionen zu­ rückgehen, die nie mehr den Stand von vor der Krise erreicht haben. Diese Kategorie von Ländern ist früher in eine Phase verlangsamten Wachstums eingetreten, als zu erwar­ ten war, da es sich mit Ausnahme von Korea um Länder mittleren Einkom­ mens handelt. Die anderen drei NIC (Hongkong, Singapur, Taiwan) wei­ sen ebenfalls langfristig sinkende In­ vestitionsraten auf, wie sie in gesetz­ ten Ländern mit hohem Einkommen zu erwarten sind. Im Fall der beiden anderen einkommensschwachen Län­ der, Indien und Vietnam, spiegeln die Leistungsbilanzdefizite eine tendenzi­ elle Steigerung der Investitionen wi­ der, wie sie für Länder in vollem In­ dustrialisierungsprozess zu erwarten sind. Wie in China liegt der Investiti­ onsgrad bei rund 40 %. Doch China ist insofern einzigartig, als hier der hohe Investitionsgrad (über 40 %) mit einem Rekordüberschuss der Leistungsbilanz verbunden ist. Die meisten internationalen Insti­ tutionen lassen sich des Langen und Breiten darüber aus, ob die asiatischen Länder aus kulturellen oder soziologi­ schen Gründen zu viel sparen, ob sie zu wenig investieren, weil ihre natio­ nalen Märkte zu wenig „liberalisiert“ sind, ob sie „die letzten Hindernisse für den Freihandel“ in Industrie und Dienstleistungen nicht abgebaut hät­ ten, wodurch das Wachstumspotenzi­ al nicht realisiert werden kann, oder ob sie nicht genügend in die Bildung in­ vestiert haben, was eine Knappheit an qualifizierten Arbeitskräften zur Folge hat. Nur selten werden dagegen die ab­ solute und relative Armut, die Verschul­ dung der Haushalte, die geringen Löh­ ne, die hohen Wohnkosten, die hohen Bildungskosten und das Fehlen oder die Schwäche der sozialen Sicherung berücksichtigt. Die geringen Einkom­ men in Verbindung mit den genannten Alltagsschwierigkeiten erklären, war­ um die Mehrheit der asiatischen Bevöl­ kerung sparen muss, wann immer sie kann, und daher nur beschränkt konsu­ mieren kann. Eine Möglichkeit zur Erklärung der Leistungsbilanzüberschüsse der meis­ ten Länder bei geringen Investitionsra­ ten (mit Ausnahme Chinas) ist, die Ent­ wicklung des Anteils der Arbeitsein­ kommen am BIP zu betrachten. Wie in anderen Weltregionen ist der Anteil der Arbeitseinkommen auch in Asien rück­ läufig. Zwischen 1984 und 2002 sank er zugunsten der Profite (siehe Grafik 6). Der Rückgang entspricht jenem der reichen Länder in der Phase 1980 bis 2005, ist aber weniger ausgeprägt als in Lateinamerika, wo die Arbeitsein­ kommen in einem kürzeren Zeitraum (1993–2002) stärker gesunken sind (ILO 2008b). Die kontinentalen Durch­ schnittswerte verbergen erhebliche Un­ terschiede zwischen den Ländern. In China ist der Anteil der Arbeits­ einkommen am BIP zwischen 1997 und 2007 von 52 % auf 40 % gesunken, was einem Verlust von 12 % in zehn Jahren zugunsten des Anteils an Profiten ent­ 29 Ökonomie spricht, die von 20 % auf 30 % hochge­ schnellt sind (siehe Grafik 7). Es sind die Jahre des Wirtschafts­ booms in China, als das Wachstum über 10 % betrug und die Leistungsbi­ lanz hohe Überschüsse auswies. Daher verwundert es nicht, dass der private Konsum zwischen 1993 und 2007 von einem bereits schwachen Stand von 47 % des BIP auf den noch schwäche­ ren Stand von 37 % gesunken ist (sie­ he Grafik 8).Zum Vergleich: Der An­ teil des Privatkonsums am BIP in den OECD-Ländern lag 2007 bei 61 %, in den Vereinigten Staaten bei 72 %, al­ so rund doppelt so hoch wie in China (Quelle United Nations Statistical Di­ vision). Thailand ist ein typisches Bei­ spiel für ASEAN-Staaten (südostasia­ tische Länder), deren Investitionen nie mehr den Stand erreicht haben, den sie vor der Asienkrise 1997/98 hatten. Der Anteil der Arbeitseinkommen fiel zwi­ schen 1960 und 2007 von geschätzten 87 % auf 65 % (siehe Grafik 9). Man kann auch den Einfluss auf den Konsum der Haushalte messen, der im selben Zeitraum von 73 % auf 54 % sank. Das erklärt, warum die Privatun­ 30 ternehmen trotz hoher Profitrate nicht massiv investieren wollen (siehe Gra­ fik 10). Wie in anderen reichen Ländern ziehen es die Unternehmen vor, ihre Profite zu nutzen, um hohe Dividenden an Aktionäre und astronomische Ein­ kommen an die Unternehmensleitun­ gen zu zahlen sowie auf nationalen und ausländischen Finanzmärkten zu inves­ tieren. Die Zahlen zeigen deutlich, dass die meisten kapitalistischen Länder Asiens schon vor der aktuellen Krise bedeutende Ungleichgewichte aufwie­ sen. Entweder investieren sie viel zu viel wie in China oder nicht genug, um ein hohes Wachstum aufrechtzuerhal­ ten, wie im Fall der von der Asienkrise 1997/98 betroffenen Länder. Trotz die­ ser Unterschiede ist allen Ländern ge­ mein, dass die Realeinkommen schwä­ cher gestiegen sind als die Produkti­ vitätsgewinne, so dass die Arbeitsein­ kommen und mit ihnen der Binnen­ konsum sanken. Das bezeichnen wir als „Wachstumsregime durch Verdrän­ gung der Arbeit“. Unter diesen Bedin­ gungen kann es keinen Ausgleich der asiatischen Wirtschaften ohne erneute Aufbesserung der Arbeitseinkommen, verbunden mit einem Abbau der sozi­ alen Ungleichheiten und der Überwin­ dung der absoluten Armut, geben. Dafür müssen enorme politische Widerstände überwunden werden. Die meisten asiatischen Länder wurden und manche werden noch immer von skrupellosen Diktaturen regiert, die massiv auf den Einsatz der Staatsge­ walt setzen, um die Arbeiterbewegung zu unterdrücken und einen hohen Ausbeutungsgrad aufrecht zu erhal­ ten. Die asiatischen Ökonomien sind schon lange berüchtigt dafür, Welt­ meister in „exzessiven Arbeitszeiten“ zu sein (Lee, S., McCann D. und Mes­ senger J.C. 2007). Selbst in sogenannt demokratischen Ländern der Regi­ on wurden Gewerkschaften und linke Parteien so sehr geschwächt, dass es (mit Ausnahme von Südkorea und In­ dien) auf nationaler Ebene keinen or­ ganisierten Widerstand mehr gibt, der ein Gegengewicht zur Macht der Un­ ternehmenschefs und herrschenden Eliten bilden könnte. So wird verständlich, dass sich inprekorr 460/461 Ökonomie die meisten asiatischen Regierungen für sogenannte „keynesianische“ Pro­ gramme zur Belebung der Wirtschaft entschieden habe, die die Priorität auf riesige Investitionen in große Infra­ strukturprojekte und subventionierte Kredite für Privatunternehmen legen. Mit diesen teilweise hochdotierten Programmen (siehe Grafik 11) soll die Notwendigkeit umgangen werden, die Löhne zu erhöhen und die Ungleich­ heiten abzubauen. Der chinesische Plan ist ein gu­ tes Beispiel dafür. Er beträgt 12 % des BIP über zwei Jahre, was quantita­ tiv gesehen sehr viel ist. Über die ge­ nauen Summen, die ausgegeben wer­ den sollen, bestehen große Unsicher­ heiten, da ein Teil schon eingeplante Ausgaben betrifft und ein Großteil der Ausgaben von lokalen Behörden getä­ tigt werden sollen, die dazu nicht un­ bedingt immer willens und fähig sind. Doch das Hauptproblem ist der Inhalt des Plans an sich. Nicht nur, dass kei­ ne Erhöhung der Löhne vorgesehen inprekorr 460/461 ist, sondern trotz wiederholter Beteu­ erungen der Regierung, ein umfassen­ des soziales Sicherheitssystem aufzu­ bauen, das Erziehungssystem zu ver­ bessern und die Hilfe an Bauern zu er­ höhen, gibt es nur geringe Ausgaben im Sozialbereich (siehe Tabelle 3). Nur 10 % entfallen auf den Bau und die Renovierung von Sozialwoh­ nungen, 9 % auf Infrastrukturausga­ ben auf dem Land und die Stützung der bäuerlichen Einkommen, 4 % auf Sozialausgaben (Gesundheit, Bil­ dung, Kultur) und 5 % auf nachhalti­ ge Umweltinvestitionen, während für die Straßeninfrastruktur 38 % veran­ schlagt sind. Für die ersten acht Mo­ nate des Jahres 2009 hat sich bestä­ tigt, dass sich nur wenig geändert hat. 45 % der auf Wunsch der Regie­ rung neu gewährten Bankkredite wur­ den für Spekulationen an den Börsen­ märkten und Immobilieninvestitionen aufgewandt. In der verarbeitenden In­ dustrie, der Transportinfrastruktur und im Immobilienbereich stiegen die In­ vestitionen auf 33 %. Im sozialen Be­ reich stiegen sie nur um 1,1 % (siehe Tabelle 4). Gemäß Au Loong Yu erklären zu­ mindest zwei Faktoren, warum die chinesische Regierung beschlossen hat, Infrastruktur- und Industrieinves­ titionen erneut zu bevorzugen (LoongYu, Au 2009). Erstens hat sich die Staatsbürokratie im weiteren Sinn in eine Kapitalistenklasse gewandelt und besitzt inzwischen direkt oder indi­ rekt die Mehrheit der Industriebetrie­ be. Würde den Lohnerhöhungen und Sozialausgaben Priorität eingeräumt, würden die Profite, aus denen sie den Großteil ihres Einkommens erzielen, sinken. Wie die Kapitalisten aller Län­ der lehnen sie dies instinktiv entschie­ den ab. Zweitens sind die großen In­ vestitionsprogramme in Industrie, In­ frastruktur und Immobiliensektor die wichtigsten Kanäle der Korruption auf allen Ebenen des Staatsapparats. „Das erinnert uns an Folgendes: Das Eigen­ interesse der Bürokratie ist es, das den Inhalt der Maßnahmen und jeglicher Reformen bestimmt.“ (Loong-Yu, Au 2009) Dasselbe ließe sich von vielen anderen steuerlichen Ankurbelungs­ programmen in den anderen Ländern Asiens sagen, auch wenn deren politi­ sches und soziales System anders ist. In Japan war die Führung der Libera­ len Demokratischen Partei (LDP), die am 30. August 2009 die Parlaments­ wahlen verloren hat, berüchtigt für ih­ re Konjunkturpakete in den 90er-Jah­ ren, die in den Straßen- und Brücken­ bau flossen und von zweifelhaftem sozialem Nutzen waren, da sie wenig 31 Ökonomie bevölkerte Regionen erschlossen. Von diesen Infrastrukturausgaben profi­ tierten Großbetriebe und Lokalfürs­ ten, die sich durch Korruption berei­ cherten, Stellen anboten und Stimmen kaufen konnten. Die neue Regierung und Führung der Demokratischen Par­ tei Japans (DPJ) kündigte an, sie wol­ le mit dieser Politik brechen. Die öf­ fentlichen Gelder sollten hauptsäch­ lich in kleine und mittlere Betriebe und Sozialausgaben fließen. Die Zu­ kunft wird weisen, was aus den Ver­ sprechen wird. All diese Faktoren veranlassen uns zur Annahme, dass der „asiatische Aufschwung“ von kurzer Dauer sein wird, da er nicht nachhaltig ist. Vor­ erst werden die enormen Summen, die im Rahmen des chinesischen Kon­ junkturprogramms aufgebracht wer­ den, die chinesische Wirtschaft 2009 und 2010 beleben. Bereits jetzt ist ein Mitnahmeef­ fekt für die gesamte asiatische Wirt­ schaft spürbar. China ist nicht nur für viele asiatische Länder der wichtigste (darunter Japan und Korea) oder einer der wichtigsten Abnehmer (Thailand, Indien), sondern auch die Art des Han­ dels zwischen China und Asien verän­ dert sich. Bekanntlich exportieren die asiatischen Länder Rohstoffe und Be­ standteile an China, die dort zu Fertig­ waren zusammengesetzt und danach in die USA und nach Europa expor­ tiert werden. Doch oft wird vergessen, dass ein großer Teil dieser Produkte auch nach Asien exportiert wird. Un­ terdessen gibt es überall in Asien Pro­ dukte „Made in China“. Im Lauf der letzten Jahre haben die Länder der Re­ gion in größerem Umfang untereinan­ der Handel betrieben als mit Ländern außerhalb der Region. Insgesamt ist der Anteil des interre­ gionalen Handels zwischen 1990 und 2008 von 31,7 % auf 42 % gestiegen. Je nach Land hat dieser interregiona­ le Handel einen anderen Stellenwert, doch er ist überall außer in China stei­ 32 gend, was zeigt, dass China die Mehr­ heit der Fertigprodukte in die restli­ che Welt exportiert. Dennoch hat sich parallel zum Handel mit Teilen und Komponenten (dem sogenannten Ver­ edlungshandel) zwischen China und dem Rest Asiens ein Handel mit Fer­ tigwaren entwickelt. „Der Anteil der Teile und Komponenten an den chine­ sischen Importen aus Ost- und Südost­ asien ist zwischen 1996 und 2008 von 43,6 % auf 38,8 % erheblich gesun­ ken, der Anteil an Fertigwaren im sel­ ben Zeitraum von 43,6 % auf 54,7 % deutlich gestiegen (ADB 2009c). Diese Veränderungen können als Schwächung der Rolle Chinas als Pro­ duzent in der Region und damit ein­ hergehend als Stärkung der Rolle des Landes als Konsument betrachtet wer­ den. Dieser Wandel stützt die Vermu­ tung, die regionale Integration Asien reduziere teilweise die Abhängigkeit gegenüber Exporten von Fertigwaren nach Westeuropa, insbesondere Euro­ pa und USA. Wenn dieser Trend an­ hält, könnte er Asien einen größeren Handlungsspielraum gegenüber dem Rest der Welt verschaffen. Doch wir befinden uns erst am Anfang eines langfristigen Prozesses. Selbst wenn der Aufschwung Chinas im Jahr 2009 in Asien eine bedeutende neue Nach­ frage geschaffen hat, reicht er nicht aus, um die gesamte Region aus der Krise zu führen. China ist noch kein autonomer Nachfragefaktor für Ostund Südostasien und kann es auch nicht werden, solange die Arbeitsein­ kommen nicht steigen, um eine deutli­ che Steigerung des Konsums der chi­ nesischen Haushalte zu erlauben. Aus diesem Grund ist zu erwarten, dass nach 2010 bei Ausbleiben eines anhaltenden Wiederaufschwungs der Weltwirtschaft alle Bedingungen für ein neuerliches Abflauen des Wachs­ tums in Asien gegeben sind. Jean Sanuk, Ökonom, Inprecor-Korrespon­ dent für Asien. Literatur ADB 2009a. “Asia Economic Monitor July 2009”, Asia Economic Monitor 101, Asian Development Bank, Manilla. ADB 2009b. “Asian Development Outlook 2009”, Asian Development Outlook, Asian Development Bank, Manilla. ADB 2009c. “Asian Development Outlook 2009 Update”, Asian Development Outlook, Asian Development Bank: Manilla. BIS. 2009. “The international financial cri­ sis: timeline, impact and policy responses in Asia and the Pacific”, The International Fi­ nancial Crisis and Policy Challenges in Asia and the Pacific, BIS, Shanghai. Cho, Dongchul, 2009, “The Republic of Korea’s Economy in the Swirl of Global Crisis”, ADBI Working Paper Series 25, Asian Development Bank Institute, Tokio. Felipe, Jesus und Lim Joseph, 2005, “Ex­ port or Domestic-led Growth in Asia?”, ERD Working Paper 51, Asian Development Bank, Manila. ILO 2008a. “Global Wage Report 2008/09, Minimum wages and collective bargaining: Towards policy coherence”, Global Wage Report 120, International Labour Organisa­ tion, Genf. ILO 2008b. “World of Work Report: Income Inequalities in the Age of Financial Globalization” 178, International Labour Organi­ sation, Genf. ILO 2009. « Global employment Trends Up­ date », Global Employment Report Interna­ tional Labour Organisation, Geneva. Kim, Kee Beom, Huynh Phu, Sziraczki Gy­ orgy und Kapsos Steven. 2009. “The Global Economic CrisisLabour Market Impacts and policies for recovery in Asia”, ILO Asia-Pacific Working Paper Series 39, ILO Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok. Lee, S., McCann D. und Messenger J.C. (Hg.), 200. Working Time Around the World: Trends in Working Hours, Laws, and Policies in a Global Comparative Perspective. London und Genf, Routledge and ILO. Loong-Yu, Au, 2009. “China: Nationalistische Antwort auf die Herausforderung der Glo­ balisierung”, Inprekorr Nr. 458/59, Januar/ Februar 2010. Aus dem Französischen: Tigrib inprekorr 460/461 Ökonomie Die Auswirkungen Krise auf Lateinamerika Der folgenden Beitrag ist eine überarbeitete Version eines Vortrags, den Claudio Katz im Juli 2009 auf der „Conference at the Socialism 2009“ gehalten hat. Organisiert wurde diese Konferenz vom “Center for Economicand Social Change” in Chicago. Claudio Katz Danke für die Einladung und Glück­ wünsche zu dieser Konferenz. Aus mei­ ner Sicht werfen die Auswirkungen der weltweiten Krise auf Lateinamerika verschiedene Fragen auf. Diese betref­ fen die unmittelbaren ökonomischen Effekte, die politischen Auswirkungen und die sozialen Maßnahmen, die be­ nötigt werden, um dem Finanzkollaps zu begegnen. Die Krise hat in Lateinamerika zu einem generalisierten Kollaps der Ak­ tienmärkte geführt und zu einer Kapi­ talflucht, die den Kreditrahmen ein­ schränkte. Der allgemeine Wertverlust führt zu Rezession, die Arbeitslosig­ keit steigt und der Zyklus ungleichen Wachstums, der die letzten fünf Jahre bestimmt hat, ist beendet. Darüber hi­ naus reduzierten sich die Erwartungen einer Abkoppelung von der allgemei­ nen Entwicklung. Und der Schutz durch die drei ökonomischen Barrieren – sub­ stantielle Reserven, niedrige Schulden oder fiskalischer Überschuss – in ei­ nigen Ländern reicht nicht aus. Einige Ökonomen gehen davon aus, dass die fiskalische Situation in Lateinamerika besser aussieht als in Osteuropa. Außer­ dem nehmen sie an, dass das Schrump­ fen der Exporte besser zu verkraften ist als in Afrika. Aber das Hauptproblem bei diesen Einschätzungen ist ihr ephe­ merer Charakter. Sie tauchen in journa­ listischen Artikeln auf und verschwin­ den wieder in erstaunlicher Geschwin­ digkeit. An dem einen Tag bleibt La­ teinamerika von dem Sturm verschont, den nächsten Tag ist es in der Mitte des Sturms. Nach meiner Meinung hat die globa­ le Krise drei Auswirkungen auf Lateina­ merika. Erstens handelt es sich um eine globale Krise durch Überakkumulati­ on, die durch die Konzentration von fik­ tivem Kapital in der Finanzsphäre her­ vorgerufen wurde. Angesichts des nied­ rigen Volumens von privaten Schulden in der Region wirkt sich dies nicht un­ mittelbar für die Banken, die faule Kre­ dite erhalten, aus. Aber der Krach hat dazu geführt, dass die wichtigen Ökono­ mien mehr Liquidität brauchen, und das führt zu verstärktem Abzug von Einla­ gen. Insbesondere ziehen ausländische Banken Ressourcen aus Lateinamerika zu Gunsten ihrer Zentralen ab. Claudio Katz inprekorr 460/461 Zweitens unterstützt Latein­amerika die Überproduktion von Gütern, was ein weiteres Charakteristikum der derzei­ tigen Krise ist. Dieser Überschuss wur­ de von dem auf dem Neoliberalismus basierenden, mit Lohnkürzungen ver­ bundenen Modell des globalen Wettbe­ werbs hervorgerufen. Dieses Ungleich­ gewicht zeigt sich besonders in den am meisten globalisierten Branchen der re­ gionalen Industrie. Der Automobilsek­ tor zum Beispiel leidet unter derselben Überproduktion, die die Ökonomien der Metropolen getroffen hat. Aber die größte Bedrohung der Re­ gion geht von dem Preisverfall bei den Rohmaterialien aus. Dieser Preisver­ fall stoppt das Wachstum der letzten fünf Jahre, das durch eine signifikante Verbesserung der terms of trade gene­ riert wurde. In den letzten zwei Mona­ ten konnten wir eine Verbesserung der ökonomischen Situation in Lateiname­ rika betreffend die Finanzsituation be­ obachten. Auch die Situation des Han­ dels hat sich durch die Erholung der Preise, insbesondere bei den Nahrungs­ mitteln, verbessert. Aber aus diesen zy­ klischen Bewegungen lassen sich der­ zeit keine belastbaren Schlüsse ziehen. Im Folgenden zitiere ich eine Rede, die ich in Chicago im Juli 2009 gehal­ ten habe: Soziale Auswirkungen Das zentrale Problem sind die verhee­ renden sozialen Auswirkungen der Kri­ se. Die Weltbank sagt voraus, dass die Stagnation der Wirtschaft zur Verar­ mung weiterer 6 Millionen Menschen in Lateinamerika führen wird, insbe­ sondere im Bereich des informellen Sektors und der Mittelklasse. Am dra­ matischsten ist die Situation in Mexiko, dem lateinamerikanischen Land, das am stärksten von der Krise betroffen ist. Mexiko steht vor der Situation, dass der Markt, der 90 % seiner Exporte auf­ nimmt, kollabiert ist, und dass es eine Lawine von zurückkehrenden Migran­ tInnen gibt, gekoppelt mit sozialen Tra­ 33 Ökonomie gödien und organisierter Kriminalität. Zusätzlich war es von der Schweine­ grippe und dem daraus folgenden Zu­ sammenbruch des Tourismus betrof­ fen. Die alte Romanze mit der NAFTA (nordamerikanische Freihandelszone; Anm.d. Ü.) ist zum Albtraum gewor­ den. Sehr ernst ist auch die Situation in den kleinen zentralamerikanischen Ländern, die auf die Überweisungen von Emigranten angewiesen sind. Viele Ökonomen argumentie­ ren, dass Lateinamerika den Hurrikan überstehen kann, wenn es die richtige keynesianische Politik anwendet. Da­ mit wird bereits, insbesondere in den drei größten Ökonomien der Region, begonnen, um die Liquidität zu ver­ bessern, den öffentlichen Kredit aus­ zuweiten und die Industrie zu subven­ tionieren. Aber die wahre Absicht die­ ser Maßnahmen ist es, das lokale Ka­ pital mithilfe der Ressourcen zu retten, die eigentlich von der hilflosen Bevöl­ kerung benötigt würden. Diese Marschrichtung beruht auf ei­ ner positiven Einschätzung der Macht­ haber. Sie gehen davon aus, dass die Regierungsgelder die Kapitalisten da­ zu bringen, ihre Aktivitäten aufrecht zu erhalten. Aber sie vergessen, dass dies davon abhängt, dass die Profitabilität weiterhin stimmt. Die Regierungspläne versuchen auch, den Konsum zu stimu­ lieren, aber ohne jegliche Maßnahmen zur Umverteilung der Einkommen. Momentan ist die öffentliche Dis­ kussion von der Frage der Angemes­ senheit und der Effektivität dieser Maß­ nahmen bestimmt. Aber tatsächlich hängt die Wirksamkeit dieser Maßnah­ men mehr von der Größe der Krise ab als als von der Qualität der Heilmittel. Monetäre und fiskalische antizyklische Politik wirkt nur innerhalb bestimmter Grenzen. Nachfragestimulierung kann in einer Rezession den Rückgang der Produktion auffangen oder aufhalten, aber in einer großen Depression hat sie wenig Einfluss. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Lateinamerika und den Öko­ nomien der Metropolen. Die Vereini­ gten Staaten, Westeuropa und Japan ha­ ben die Ressourcen, um einen Versuch zu starten, die Krise zu begrenzen. Sie können Belebungsmaßnahmen mit der Unterstützung der Zentralbanken aus­ probieren und Dollars, Euros und Yens drucken. Aber Lateinamerika hat solche Ressourcen nicht. Unsere Währungen 34 sind im internationalen Vergleich schwach. Es gibt noch ein anderes Bei­ spiel für diese Unterschiede. In der Kri­ se vergrößern die zentralen Ökonomien ihr fiskalisches Defizit, während unsere Region weiterhin auf fiskalische Über­ schüsse verpflichtet bleibt. Zusammen­ fassend gesagt verstärkt die Krise alle traditionellen Probleme der lateiname­ rikanischen Ökonomien. Politische Effekte Es gibt in allen lateinamerikanischen Ländern eine große Übereinstimmung betreffs der negativen Konsequenzen der ökonomischen Krise. Aber einige Analysten glauben, dass die derzeitigen Schwierigkeiten positive Effekte zeiti­ gen können, wenn sich das wiederholt, was in den dreißiger Jahren geschah. Sie weisen darauf hin, dass das Desa­ ster zwischen den Kriegen die hervor­ ragenden Bedingungen für den nach­ folgenden Prozess der Industrialisie­ rung generierte. Aber sie vergessen dabei, dass der primäre Effekt der großen Depression eine schmerzhafte Entwertung der pro­ duzierten Waren war. Die Substitution von Importen kam erst später als Resul­ tat von Protektionismus und Weltkrieg. Und sie wurde in einer Region durchge­ führt, der es möglich war, sich aus dem Flächenbrand des Krieges herauszuhal­ ten. Heute kollidiert jeder Versuch der Wiederholung der Nachkriegsgeschich­ te einerseits mit der Abwesenheit einer solchen Zwischenkriegskonfrontation und ebenso mit der zunehmenden In­ ternationalisierung der Ökonomie. Hervorzuheben ist dabei, dass ein ökonomischer Zusammenbruch im Zentrum des Kapitalismus nicht not­ wendigerweise den Handlungsspiel­ raum in der Peripherie erweitert. Die Krise der siebziger Jahre zeigte, dass das Gegenteil eintreten kann. Zu Be­ ginn fiel dieser Schock zusammen mit günstigen Rahmenbedingungen für die so genannte Dritte Welt. Aber dieser Weg wurde mit der neoliberalen Offen­ sive der Achtzigerjahre abrupt beendet. Die kurzzeitige Abschwächung der in­ ternationalen Ungleichheit wurde ab­ gelöst von einer neuen Phase globaler Polarisierung, die bis zum Ende des 20. Jahrhunderts andauerte. Dies illustriert, wie begrenzt und zerbrechlich eine Pe­ riode der Autonomie in der Peripherie sein kann. Ein zentraler Punkt für die Zukunft Lateinamerikas ist die Krise der USDominanz. Die Gründe für diese Kri­ se liegen in militärischen Fehlentschei­ dungen außerhalb der Region, nämlich in Nahost, und in den antiimperialis­ tischen Aufständen in der Region. Die Dominanz der USA wurde zusätzlich durch das Fehlschlagen beziehungs­ weise das Stocken der Freihandelsab­ kommen auf der ökonomischen Ebene betroffen. Darüberhinaus haben viele der süd­ amerikanischen Regierungen von ih­ rer alten Unterordnung unter den Nor­ den als Ergebnis größerer politischer und sozialer Bewegungen Abstand ge­ nommen. Im letzten Jahr beispiels­ weise wurden die Vereinigten Staaten bei den Verhandlungen über Kolum­ biens Militärintervention in Ecuador und betreffend den Rechtsputsch in Bolivien umgangen. Außerdem mus­ sten sie die Ausweisung der beiden Botschafter in Bolivien und Venezue­ la hinnehmen. Meiner Meinung nach kann die Po­ litik von Obama bezüglich Lateiname­ rikas als Folge zweier Prozesse erklärt werden: zum einen die Krisis des ex­ tremen Neoliberalismus, der während der achtziger und neunziger Jahre vor­ herrschte, und zum amderen der Volks­ widerstand zwischen 2000 und 2005. Aus diesen Gründen können wir heu­ te eine Änderung im Verhalten und eine Veränderung in der Rhetorik von Oba­ ma im Vergleich zu Bush beobachten. Der deutlichste Beweis für diesen neuen Kontext ist die Entscheidung der Organisation amerikanischer Staaten, die Restriktionen fallen zu lassen, die Kuba daran gehindert haben, Mitglied dieser Organisation zu sein. Diese Ent­ scheidung bedeutet einen politischen Sieg für Kuba. Die politischen Führer dieses Landes haben sehr richtig argu­ mentiert, dass sie nicht in eine Orga­ nisation wieder eintreten wollen, die ständig die Interessen des Imperialis­ mus bedient. Nichtsdestoweniger illus­ triert dieses Ereignis das Ende der poli­ tischen Isolation, in der die kubanische Revolution sich während der 90er Jah­ re befand. Einige Analysten meinen, dass der allgemeine Kontext die Vereinigten Staaten dazu bringen wird, ihre Kon­ trolle über Lateinamerika zu lockern. Aber in Wahrheit hat Obama keine Plä­ ne, wesentliche Änderungen betreffend inprekorr 460/461 Ökonomie Lateinamerika durchzuführen. Er wird die Gefangenen von Guantánamo ab­ ziehen, aber die Enklave nicht an Ku­ ba zurückgeben. Er wird Reiseerleich­ terungen für die Insel einführen, aber ohne das Embargo aufzuheben. Er wird auf der Ebene der Diplomatie Annä­ herungen an Kuba versuchen, aber er wird es strikt vermeiden, eine Nieder­ lage einzugestehen. Und es ist immer noch nicht klar, ob er fortfahren wird, den Staatsterrorismus in Kolumbien und die politische Einflussnahme in Bolivien und Venezuela zu decken. Mit Sicherheit wird Obama eine Kombina­ tion von Zuckerbrot und Peitsche wäh­ len, allerdings mehr mit den Mitteln der Diplomatie als mit offener Brutalität. Aber letztendlich wird er die imperiale Politik, die auf der Monroedoktrin ba­ siert, beibehalten. Und wir können di­ ese Kontinuität der amerikanischen Po­ litik an der Wiederbelebung der vierten Flotte unter dem Vorwand des Kampfes gegen Drogenhandel und Terrorismus sehen, an der immensen militärischen Stärke des Südkommandos in Miami, den Militärbasen in Kolumbien und Pe­ ru und den Planspielen betreffend eine militärische Intervention in Mexiko. Für manche Analysten sind alle di­ ese Dinge lediglich ein bedauerliches Erbe der Vergangenheit. Sie glauben, dass Lateinamerika von dem struktu­ rellen und unvermeidlichen Abstieg des US-Imperialismus profitieren wird. Ich teile diese Meinung nicht. Das US-Mi­ litär hat immer noch keine Konkurrenz und seine Mitbewerber akzeptieren das. Diese Tatsache, dass nämlich weder von europäischer noch von asiatischer Seite ein Ersatz existiert, ist besonders entscheidend. Die amerikanische Vor­ herrschaft ist in einer Krise, deren En­ de nicht absehbar ist. Es gibt keinerlei Klarheit, ob sie mit dem Aufstieg eines Opponenten oder mit einer Wiederher­ stellung der alten Führungsstärke en­ den wird. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es unmöglich, abzuschätzen, ob die USA sich in einem begrenzten oder in einem dauerhaften Abstieg befinden. Es ist wahr, dass in Lateinamerika die Macht der USA an ökonomischem Gewicht in der letzten Dekade verg­ lichen mit den europäischen Konkur­ renten verloren hat. Aber die europä­ ische Gemeinschaft beabsichtigt nicht, ihren Rivalen zu ersetzen, und be­ schränkt sich darauf, ihre Freihandels­ abkommen auszuprobieren, die nach inprekorr 460/461 dem Modell der FTAA angelegt sind. Es ist ebenfalls wahr, dass die USA die erste chinesische Handelsoffensive tolerieren mussten, aber dies bedroht mehr Europa als die traditionelle ame­ rikanische Vorherrschaft. Zusammen­ fassend kann man sagen, dass im Mo­ ment keine Daten existieren, die die These eines Rückganges der US-Vor­ herrschaft in Lateinamerika stützen würden. Die Rechte und Mitte-Links Für die unmittelbare Zukunft ist die politische Strategie der lateinamerika­ nischen Rechten entscheidender. Ich denke, dass die konservativen und Ne­ oliberalen eine Gegenoffensive in allen Ländern vorbereiten. Sie versuchen die Finanzkrise zu benutzen, um wieder in die Offensive zu kommen. Mit der Aus­ rede, ausländische Investitionen anzie­ hen zu wollen, schlagen sie fiskalische Anpassungsmaßnahmen vor. Und sie behaupten auch, dass in dieser schwie­ rigen Situation es noch nötiger denn je ist, Opfer zu bringen zugunsten des Ka­ pitals. Wir können viele Zeichen die­ ser rechten Gegenoffensive beobach­ ten, insbesondere in den Medien, die zu konservativen Antworten seitens der Mittelklasse ermutigen. Beispiele für diese Kampagne sind die Versuche der kolumbianischen Regierung, unbe­ grenzt an der Macht zu bleiben, die Er­ holung der Rechten bei den Wahlen in Chile oder Mexiko, der politische Sieg der Agrarindustrie in Argentinien und der Druck auf den neuen Präsidenten von Paraguay, zurückzutreten. Aber einige Analysten übertreiben diese Tendenz. Sie behaupten, dass der gesamte politische Kontext sich ins Ne­ gative gewendet habe. Allerdings hat die Rechte bis heute mehrere große Kämp­ fe in Südamerika verloren. Der Putsch in Bolivien schlug fehl, die militärische Attacke Kolumbiens auf Ecuador war ein Misserfolg und der Versuch, regio­ nalen Separatismus in Gang zu bringen, schlug ebenfalls fehl. Ich denke, dass es schwierig sein wird, die Einmütigkeit und direkte Herrschaft der Rechten wiederherzu­ stellen, wie wir sie aus den neunziger Jahren kennen. Diese Kampagne der 35 Ökonomie Lula in Brasilien ist das bedeutendste Beispiel für die konservative Wende von Mitte-Link Rechten hat nur zweifelhafte Aussicht auf Erfolg, weil in einer Reihe von Län­ dern die Bevölkerung sich an die ver­ heerenden Konsequenzen der neolibe­ ralen Politik der Neunziger erinnert. Der Ausgang der jüngsten Wahlen zeigt eine widersprüchliche Situation. Die neue Regierung in Panama wurde von der Rechten wieder errungen, aber in El Salvador war es die F. M. L. N., die einen deutlichen Wahlsieg einfuhr. So­ gar Honduras, ein Land das traditionell an der Seite der USA steht, schlägt der­ zeit einen sehr unabhängigen außenpo­ litischen Kurs ein. Eine ebenfalls wichtige politische Tatsache ist die konservative Wendung der Mitte-Links-Kräfte. Das deutlichste Beispiel dieser konservativen Wende ist Lula in Brasilien, der nach einem lan­ gen Prozess der Organisierung der Ar­ beiterschaft um die Arbeiterpartei seit den achtziger Jahren an die Regierung kam. Lulas Regierung hat die Bevöl­ kerung demobilisiert und entpolitisiert, alle sozialen Kämpfe abgeblockt und die kapitalistische Politik der früheren Regierungen beibehalten, ohne wesent­ liche Änderungen durchzuführen. Lu­ la hat speziell die Agrarindustrie ge­ fördert. Er ließ die Vertreibung klei­ ner Bauern zu, um die Exporteure und Großgrundbesitzer zu fördern. Das hat zu einer großen Enttäuschung und Kri­ tik von Seiten der Bewegung der Land­ losen geführt. Trotzdem schlagen einige Analy­ sten auf der Linken vor, Mitte-LinksKräfte zu unterstützen, in der Hoffnung, 36 dass sie in der Zukunft einige Verbesse­ rungen für die Bevölkerung erreichen und zu einer wachsenden Macht der Bevölkerung beitragen. Aber die Erfah­ rung zeigt, dass sie falsch liegen. MitteLinks-Regierungen vertreten ganz klar die Interessen der herrschenden Klasse und reproduzieren den Kapitalismus. Einige von diesen Analysten sagen, dass diese Art von Regierungen multi­ polare Szenarien begünstigen. Sie glau­ ben, dass Lateinamerika aus diesem Wandel im geopolitischen Kontext ei­ nen Vorteil ziehen könne, dergestalt, dass eine autonomere Politik möglich sei. Ich denke, dass tatsächlich eine Möglichkeit besteht, dass wir vor einer Periode größerer Diversifizierung der kapitalistischen Kräfte stehen. Aber es ist entscheidend, zu betonen, dass die­ ser Prozess aus sich selbst der Mehrheit der Bevölkerung keinen Vorteil bringt. Er wird eher die lokalen Herrscher schlicht stärken, die mit den Machtha­ bern verbunden sind. Die Aufnahme neuer Partner in ein multipolares Sze­ nario würde die Unterdrückung erneu­ ern und die Emanzipation der Bevölke­ rung behindern. In Südamerika stellt Brasilien den ersten Kandidaten dar, der diese unter­ drückerische Multipolarität anführen könnte, weil die brasilianischen trans­ nationalen Unternehmen trotz ihres ge­ ringen Wachstums in den vergangenen Jahren sich in der Region deutlich kon­ solidiert haben. Das Hauptprojekt die­ ser Unternehmen – unterhalten durch Regierungsgelder – ist ein Netz von ge­ planten Autobahnen und Wasserstra­ ßen. Sie setzen dabei aggressive For­ men der Geschäftsdiplomatie ein, und diese Politik hat zu zahlreichen Kon­ flikten mit Bolivien, Ecuador und Para­ guay geführt. Es ist außerdem wichtig, daran zu erinnern, dass Brasilien die Besatzungs­ kräfte anführt, die die amerikanischen Marines in Haïti ersetzt haben. Das be­ weist, dass eine neoliberale Politik exi­ stiert, die mit ihren Polizeimethoden die Tragödie aus Hunger, Armut und Emi­ gration verstärkt. Diese Aktivitäten ha­ ben den Zugang für brasilianische Un­ ternehmen zum karibischen Raum er­ leichtert. Lula wiederholte die Politik, die von Spanien in den neunziger Jah­ ren entwickelt wurde, um es spanischen Unternehmen zu erleichtern, Zugang zu Lateinamerika zu bekommen. Brasilien ordnet sogar die Kontinuität des MER­ COSUR (südamerikanischer gemein­ samer Markt; Anm.d. Ü.) seinen Füh­ rungsansprüchen unter. Bei vielen internationalen Verhand­ lungen betreffend den globalen Han­ del düpierte Brasilien seine Alliierten zu Gunsten von Kompromissen mit den entwickelten Ländern. Um der Führer des südamerikanischen Blocks zu sein, muss Brasilien Venezuela politisch neu­ tralisieren und den Handelskonflikt mit Argentinien lösen. Mit dieser Strategie der herrschenden Klasse versucht Bra­ silien die Lücke zu füllen, die durch die Krisis der US-Herrschaft entstanden ist, aber ohne dabei mit der Führungsmacht auf Konfrontationskurs zu gehen. Meiner Meinung nach spielt Bra­ silien in seiner neuen Rolle die eines Subimperialismus. Der Begriff Subim­ perialismus ist hilfreich, um den sim­ plifizierenden Begriffskomplex „Zen­ trum-Peripherie“ zu überwinden, und er beschreibt die Vielfältigkeit der Be­ ziehungen auf dem Weltmarkt. Er be­ schreibt auch die Existenz von Zwi­ schenformationen, die einige Theoreti­ ker mit dem Begriff „Semi-Peripherie“ belegt haben. Lula in Brasilien ist das bedeu­ tendste Beispiel für die konservative Wende von Mitte-Links. Aber wir kön­ nen die gleiche Entwicklung bei ande­ ren südamerikanischen Regierungen sehen, wie bei Michel Bachelet in Chile oder Cristina Kirchner in Argentinien. Sie alle haben bei der Vorbereitung des letzten Treffens der G 20 in London mit den USA zusammengearbeitet. inprekorr 460/461 Ökonomie Sie folgten weiter der ökono­ mischen Agenda, die von den Vereini­ gten Staaten installiert wurde, nämlich am Dollar festzuhalten und die Res­ sourcen des Restes der Welt zu benut­ zen, um die US-amerikanischen Ban­ ken aus der Krise zu holen. Ihre Poli­ tik blockiert die Möglichkeiten für eine Debatte über eine kollektive Antwort auf die Krise, die in der UNO entwi­ ckelt werden müsste. Aber an erster Stelle halten die Mit­ te-Links-Regierungen am internationa­ len Währungsfonds als der Institution fest, die für die fiskalische Reorganisie­ rung der Welt verantwortlich sein soll. Sie tun das unter der illusionären Vor­ stellung, dass diese Agentur reformier­ bar sei, während die einzige progres­ sive Politik darin bestünde, den Wäh­ rungsfonds zu schließen und eine an­ dere Institution von Grund auf aufzu­ bauen. Ich denke, dass es eine soziale Ver­ änderung in der herrschenden Klasse gibt, die diese politische Regression er­ klärt, insbesondere in Brasilien und Ar­ gentinien. Dieser Wandel basiert auf ei­ ner Transformation der alten nationalen Bourgeoisie – die den lokalen Markt beherrschte – zu einer lokalen Bour­ geoisie, die den Export und die Part­ nerschaft mit transnationalen Gesell­ schaften priorisiert. Dieser Schwenk der herrschenden Klasse hin zu einer multinationalen Ausrichtung hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten konsoli­ diert. Es ist ein Fehler, Südamerika als eine neokoloniale Region zu betrach­ ten, ähnlich wie verschiedene Regionen in Afrika. Und es ist auch nicht korrekt, die wesentlichen lokalen Herrschafts­ schichten als Marionetten des Empires zu betrachten. Sie agieren als Gruppen mit eigenen Interessen und Strategien, in einem Rahmen, der sich substanti­ ell von dem alten halbkolonialen Status unterscheidet. Radikale nationalistische Regierungen Aber für die Linke ist es wichtig, ei­ nen anderen Wandel wahrzunehmen. Meiner Meinung nach ist der interes­ santeste politische Wechsel in Latein­ amerika die Konsolidierung radikaler nationalistischer Regierungen in Vene­ zuela, Bolivien und Ecuador, besonders auf der Wahlebene. Sie gewannen 15 Wahlen in Venezuela, drei in Bolivien inprekorr 460/461 (inzwischen vier; Anm.d. Ü.) und fünf in Ecuador. Diese Regierungen unterscheiden sich von den Mitte-Links-Administrati­ onen (Tabarè, Cristina, Lula, Bachelet) in drei Bereichen: Sie stützen sich auf Massenmobili­ sierung, treten in Konflikt mit dem Im­ perialismus und der herrschenden Klas­ se und suchen nach Maßnahmen zur Einkommensneuverteilung. In Ecuador, Bolivien und Venezuela gab es bedeu­ tende demokratische Fortschritte durch neue Verfassungen, die nach einer har­ ten Auseinandersetzung im Wahlkampf mit der Rechten durchgesetzt wurden. In Bolivien zum Beispiel wurde die Trennung von Kirche und Staat durch­ gesetzt und ausländische Militärba­ sen wurden verboten. Die Regierungen dieser drei Länder betreiben reformi­ stische ökonomische Politik, basierend auf öffentlichen Investitionen und einer Hebung der Kaufkraft. Ein Schlüsselaspekt dieser Maß­ nahmen sind die Nationalisierungen in Venezuela, durch die wegen der Abwe­ senheit einer nationalen (industriellen) Bourgeoisie die Wirtschaft industriali­ siert werden soll. Es ist wichtig, dass Chávez zur Mobilisierung der Arbeite­ rInnen aufruft, um die Arbeiterkontrol­ le in den nationalisierten Unternehmen zu praktizieren. Aber die radikal nati­ onalistischen Regierungen stehen vor einem größeren Dilemma. Sie haben weiterhin die Unterstützung des Volkes, aber einige Konzessionen an das Kapi­ tal drohen diese zu schwächen. In Bo­ livien beispielsweise ist die Geschwin­ digkeit der sozialen Transformation im Bereich der Landwirtschaft sehr lang­ sam. Man beschloss, einige Forde­ rungen der Oligarchie betreffend die neue Verfassung (insbesondere, dass es keine rückwirkende Gültigkeit der Be­ grenzung des Landeigentums gibt) zu übernehmen. In Venezuela hält die so­ ziale Ungleichheit an und auch die Kor­ ruption wächst wieder. In Ecuador gibt es Spannungen zwischen der Regie­ rung und der Bewegung der indigenen Bevölkerung. Aber ich glaube, dass die globale Krise eine Gelegenheit eröffnet, diesen Stillstand durch neue Impulse zu be­ enden, eine regionale politische Ach­ se mit Kuba zu bilden und die Boliva­ rianische Alternative für den amerika­ nischen Kontinent (ALBA) wiederzu­ beleben. Dieser Zusammenschluss in­ stallierte frühzeitig solidarischen Aus­ tausch, bekräftigte die antiimperialis­ tische Aktion und setzte soziale Re­ formen auf die Tagesordnung. Es ist Zeit, diese Schwierigkeiten dadurch zu überwinden, dass die natio­ nalen Prozesse radikalisiert werden. Die Priorität ist ganz klar, die Rechte zu neu­ tralisieren und die Rückkehr der Kon­ servativen zu verhindern. Aber eben­ so essenziell ist es, einen Stillstand der sozialen Transformation zu vermeiden, da das die Schicht der Unterdrücker, die sich innerhalb der Volksbewegung he­ rausbildet, stabilisiert. Wir müssen un­ bedingt die Umkehr der politischen Ba­ sisprozesse vermeiden, wie sie z. B. in Mexiko nach der Revolution stattgefun­ den hat. Ich denke, dass die sich radika­ lisierenden nationalen Prozesse die fort­ schrittlichste Perspektive für diese Län­ der bieten, aber das wird ein sehr unter­ schiedlicher und widersprüchlicher Pro­ zess werden. Wir müssen diese Kom­ plexität verstehen und eine Sektiererhal­ tung vermeiden. Letztere Haltung igno­ riert die Unterschiede zwischen Lula und Chávez, leugnet die Fortschritte der radikalen nationalen Bewegung, wei­ gert sich, an Wahlen teilzunehmen, und benennt vor allem keinen gangbaren Weg zum Aufbau des Sozialismus. Ich glaube, dass der beste Weg für die Ent­ wicklung der Linken die Konvergenz der sozialistischen Kräfte mit dem revo­ lutionären Nationalismus ist, der schon in der kubanischen Revolution trium­ phierte. Es gibt eine starke Tradition des lateinamerikanischen Marxismus, der die theoretische Grundlage für die­ se Konvergenz liefert, auf der Basis des Lebens und der Erfahrung von Denkern und Aktivisten wie dem Kubaner Mella, dem Peruaner Mariátegui und dem Ar­ gentinier Che Guevara. Soziale Kämpfe Und schließlich ist es sehr wichtig, die Bedeutung der sozialen Kämpfe zu un­ terstreichen. Die Zukunft unserer Re­ gion hängt von diesen Kämpfen ab. In jedem möglichen kommenden Szena­ rio wird die Bevölkerung harte Schläge einstecken müssen, wenn sie ihren Wi­ derstand gegen das Kapital nicht ver­ stärkt. Diese Schlussfolgerung ist die Hauptlektion aus dem finanziellen Kol­ laps, den die Region in den letzten zehn Jahren erlitten hat. Dieses Desaster führte zu Revolten, die es erlaubten, ei­ 37 Globalisierung nige bedeutende politische und soziale Erfahrungen zu machen. Aufstände durchbrachen in Boli­ vien einen lange dauernden Zyklus der Herrschaft der Rechten, demontierten verschiedene neoliberale Präsidenten in Ecuador, führten zu einer zunehmenden Polarisierung in Venezuela und waren die Basis für den historischen Aufstand von 2001 in Argentinien. Sie verallge­ meinerten den Kampf gegen Privati­ sierung, für Rationalisierung der natür­ lichen Ressourcen und für die Demo­ kratisierung des politischen Lebens. Die Unterdrückten in Lateinameri­ ka nehmen die dramatische Rettungs­ aktion der Kapitalisten wahr, und sie müssen sich darauf vorbereiten, gegen den Angriff vorzugehen, der die neu­ erliche Rettungsaktion für die Banker begleitet. Verglichen mit der Hochzeit des Volkswiderstandes zwischen 2002 und 2005 zeigt die politische Konjunk­ tur eine geringere Intensität. Aber es gab in der Karibik einen signifikanten Aufschwung in Guadeloupe und Mar­ tinique und in der letzten Woche den Kampf der Indigenas in Peru. Aber der Volkswiderstand benötigt ein Programm sozialer Maßnahmen an­ gesichts des ökonomischen Kollapses. Es ist wichtig zu wissen, dass in den letzten Monaten einige soziale Bewe­ gungen, politische Organisationen und radikale Ökonomen bei verschiedenen Treffen in Caracas, Buenos Aires und Belem Alternativvorschläge diskutiert haben. Diese Programme weisen jeg­ liche Regulierungen und staatlich kon­ trollierte Maßnahmen zurück, die die Verluste der Kapitalisten sozialisieren. Sie rufen dazu auf, für eine öffentliche Kontrolle darüber zu mobilisieren, wie die öffentlichen Gelder genutzt werden. Die Vorschläge, die dort ausgearbeitet wurden, priorisieren die Aufrechter­ haltung der Beschäftigung, das Verbot von Entlassungen, die Umverteilung der Arbeitszeit ohne Lohnkürzung und die Nationalisierung von Fabriken, die schließen oder ArbeiterInnen feuern. Diese Maßnahmen sind notwendig angesichts der Komplizenschaft der Re­ gierungen mit den Unternehmern beim Abbau von Arbeitsplätzen. Staatlich ge­ führte Verhandlungen, die Löhne zu kürzen im Tausch für den Erhalt von Ar­ beitsplätzen, sind eine andere Facette der anwachsenden sozialen Gemeinheiten. Drei der diskutierten Maßnahmen sind 38 besonders dringlich. Erstens die Nati­ onalisierung des gesamten Finanzsy­ stems ohne jegliche Kompensation. Das Ziel dieser Maßnahme ist es, die Kon­ trolle über das Kreditsystem angesichts der derzeitigen explosiven Situation zu gewährleisten. Die Rettung der Banker sollte durch die Enteignung ihres Be­ sitzes ersetzt werden. Die Staaten müs­ sen die Kosten, um die Banken funkti­ onsfähig zu halten, dadurch refinanzie­ ren, dass sie das Eigentum der Anteil­ seigner und der Direktoren einziehen. Die neue Verfassung von Ecuador, die es dem Staat verbietet, private Schulden zu übernehmen, bietet eine Basis für ei­ ne solche Aktion. Der zweite wesentliche Schritt ist die Aussetzung, Revision oder Strei­ chung der externen und internen Schul­ den. Während in der Krise Verpflich­ tungen in Billionenhöhe in den zentra­ len Ökonomien bereinigt werden, muss Lateinamerika weiter bezahlen. Die Re­ geln der Risikovorsorge, wie sie in den USA üblich sind, dass nämlich die Hö­ he und der Zeitrahmen der Verpflich­ tungen neu kalkuliert werden, werden in der Region nicht angewandt. […] Die dritte Maßnahme, die durch die Krise notwendig wird, ist die Nationa­ lisierung von Öl, Gas und Bergbau. Di­ es würde die Ressourcen, die Lateina­ merika braucht, vor den globalen Er­ schütterungen schützen. Dieser Weg wurde bereits von Venezuela und Boli­ vien begonnen. Aber die Nationalisie­ rungen werden sehr zögerlich durchge­ führt, und es werden inakzeptable Aus­ gleichszahlungen vorgenommen. Mit­ ten in einer Periode fallender Rohstoff­ preise können solche Ausgaben fatale Folgen haben. Die Kompensationszah­ lungen an die Eigentümer der nationa­ lisierten Unternehmen waren beispiels­ weise bis heute sehr negativ, bis jetzt kosteten sie 15 Milliarden Dollar. Zusammenfassend denke ich, dass die globale Krise generell die Wahrneh­ mung dessen verändert hat, was „dra­ stische Maßnahmen“ sind. Mitten in einem Kollaps, der die neoliberale Ide­ ologie geknackt hat, hat keiner Angst davor, nach Nationalisierung zu rufen oder nach Streichung von Schulden. Es ist höchste Zeit, diesen Vorteil zu nut­ zen, um die Bevölkerung von Lateina­ merika zu schützen, indem unverblümte Entscheidungen getroffen werden. Sozialismus Aus all dem folgt: Lateinamerika hat ei­ ne führende Rolle im Widerstand gegen den Neoliberalismus gespielt, aber die derzeitige Krise stellt eine andere He­ rausforderung dar: eine führende Rol­ le im Kampf gegen den Kapitalismus zu spielen. Dieses System ist verant­ wortlich für das derzeitige Desaster, und sein Überleben würde zu weiteren Lei­ den für die Bevölkerung führen. Nur der Weg, die Ausbeutung, die Verschwen­ dung und die Ungleichheit zu beseiti­ gen, wird Armut und Arbeitslosigkeit verschwinden lassen. Dieser Weg er­ fordert die antiimperialistische und an­ tikapitalistische Aktion. Und die Ant­ wort wird wirksam sein, wenn sie den Übergang zum Sozialismus erleichtert, indem sie sich jedem Projekt, den Ka­ pitalismus zu regulieren, entgegenstellt. Der in Mode gekommene Dirigismus birgt die Gefahr, dass die Krise nach mühsamen Rettungsversuchen, die von der Bevölkerung bezahlt wurden, wie­ der auflebt. Nur eine sozialistische Perspekti­ ve kann eine Ökonomie schaffen, die an den Bedürfnissen der Bevölkerung ausgerichtet ist, die mit demokratischen Formen der Planung die traumatischen Umbrüche der kapitalistischen Zyklen abmildern (und schließlich beseitigen) kann. Der zukünftige Sozialismus wird keine Ähnlichkeit mit den fehlgeschla­ genen Erfahrungen der bürokratischen totalitären Regime des 20. Jahrhunderts haben. Er wird die kollektive Selbstver­ waltung einführen, die man braucht, um eine egalitäre Gesellschaft zu errichten. Zum Schluss möchte ich euch noch einmal zu dieser Konferenz gratulie­ ren. In dieser Art von Aktivität haben wir, die Völker aus Lateinamerika und Nordamerika, angefangen, unseren ge­ meinsamen Kampf für den Sozialismus zu führen. Übersetzung aus dem Englischen: Thadeus Pato Claudio Katz ist Ökonom und Forscher. Er ist Fellow des Internationalen Institutes für For­ schung und Bildung in Amsterdam und Hoch­ schullehrer an der Universität von Buenos Aires. Er ist Mitglied des argentinischen Netz­ werks „Economistas de Izquierda“ (Ökonomen der Linken)“ inprekorr 460/461 Ökonomie Die Kontroverse über die Profitrate Eine Reihe von Autoren vor allem aus dem angelsächsischen Bereich stellt die Idee in Frage, dass die Profitrate sich seit Mitte der 1980er Jahre vor allem in den USA beträchtlich erholt hat. Einige zeigen sogar, dass sie kontinuierlich gefallen ist. Nicht zuletzt die Antwort von Chris Harman auf mich, die er aus Anlass des Ökonomie-Seminars im IIRE vorlegte, hat zur Belebung dieser Kontroverse beigetragen.1 Ich möchte festhalten, wie sehr sein Tod mir nahe gegangen ist, weit darüber hinaus, dass damit einer gerade eben begonnenen Debatte auf tragische Weise ein Ende gesetzt worden ist. Diese Debatte ist sehr technisch, weil es dabei im Wesentlichen um die Modalitäten der Berech- nung der Profitrate und vor allem ihres Nenners, nämlich des Kapitals, geht. Diese Berechnung ist von Natur aus definitionsabhängig, die Ergebnisse unterscheiden sich je nach den festgelegten Konventionen ganz erheblich. Es versteht sich von selbst, dass keiner von denen, die sich an dieser Debatte beteiligen, die verwendeten Daten „erfindet“, sie stammen durchweg von dem US-amerikanischen Bureau of Economic Analysis. Also ist es nötig, an anderer Stelle die Gründe für die Meinungsverschiedenheiten im Einzelnen herauszuarbeiten, um die von mir getroffenen Entscheidungen zu rechtfertigen.2 1 Die Beiträge zu dieser Debatte sind unter folgender Adresse im Internet zu finden: http://hussonet.free.fr/cricoco.htm 2 Siehe Michel Husson, „La hausse tendancielle du taux de profit“, Januar 2010, http://hussonet.free.fr/tprof9.pdf Michel Husson Nicht aller Marxismus ist Dogmatismus – eine Antwort auf Michel Husson Chris Harman Michel Husson hat eine Reihe mar­ xistischer Ökonomen, darunter mich, scharf kritisiert.1 Er schreibt: „Die Krise der letzten Monaten war An­ lass für unzählige, von kontraproduktivem und entmutigendem Dogmatismus geprägte Beiträge … Was sie alle gemeinsam haben, ist ihr Bezug auf die orthodoxe Interpretati­ on des Gesetzes des tendenziellen Falls der Profitrate.“2 problematisch. Woher die europäische Union sie hat, wird nicht gesagt, und die Methodik, mit der aus diesen Zah­ len eine Profitrate abgeleitet wird, wird auch nicht näher erläutert. Es bleibt bei der dürren Aussage, dass sie „den Net­ toüberschuss aus der Ausbeutung ins Verhältnis zum Kapitalstock setzen“. Das Fehlen solcher Angaben macht es für diejenigen unter uns, die des „Dog­ matismus“ beschuldigt werden, un­ möglich, seine Argumente wissen­ schaftlich zu prüfen. (Abbildung 1) Ferner weichen seine Grafiken ganz erheblich von anderen Versuchen ab, die Entwicklung der Profitrate abzubil­ den. Das ist besonders deutlich im Fall der USA. Husson behauptet nicht nur, Diese Haltung, so Husson, lässt die ganz einfache Tatsache außer Acht, dass „die Profitraten der wichtigsten kapi­ talistischen Länder eine klare Tendenz nach oben aufweisen. Diese Entwick­ lung ist so eindeutig, dass sie auch nicht durch mehr oder minder angebrachte Korrekturen ernsthaft in Frage gestellt werden kann.“ Es folgt dann eine Grafik auf Grundlage von EU-Statistiken für die USA, Europa und die G 8, die seine These untermauern soll. Seine Zahlen sind allerdings sehr 1 Das vorliegende Papier ist ein Beitrag zu einer kürzlich in Amsterdam abgehaltenen und von der Vierten Internationale organisierten Konfe­ renz. 2 Husson, 2009 inprekorr 460/461 Abbildung 1: Hussons Zahlen für die US-amerikanische Profitrate 39 Ökonomie dass sich die Profitrate im Jahrzehnt 1998–2008 von ihrem vorangegan­ genen Fall um 25 Prozent in den Jah­ ren 1968–1982 erholte, sondern ein um 30 Prozent höheres Niveau als das in der Periode vor 1973 erreichte.3 Robert Brenner, Fred Moseley, Si­ mon Mohun, Alan Freeman und An­ drew Kliman liefern ganz andere Zah­ len, die zwar in gewissem Maße von­ einander abweichen, aber dennoch ein ganz anderes Muster aufweisen, als das von Michel Husson.4 Sie zeigen einen größeren Abschwung bis 1982 als Hus­ sons Zahlen, und für die Zeit danach eine viel schwächere Erholung, als er nahelegt, eine, die keinesfalls das Ni­ veau der späten 1960er Jahre erreicht oder dieses gar um 30 Prozent über­ trifft. Auch Moseleys Zahlen, die die größte Erholung der Profitraten in den vergangenen Jahren begründen, liefern ein Muster, das weit entfernt von dem Hussons liegt, während Brenner, Mo­ hun, Freeman und Klimans Zahlen eine Rentabilität weiter unter der der 1960er Jahre belegen. Ihre Zahlen beruhen alle auf nachprüfbaren Statistiken des US Bureau of Economic Affairs (NIPA-Ta­ bellen). Arnaud Sylvains Zahlen rei­ chen nur bis zum Jahr 2000, aber auch seine Grafik belegt keine massive Erhö­ hung über das Niveau der 1960er Jahre hinaus – vielmehr zeigt sie eine Spitze am Ende der 1990er Jahre, die gerade das Niveau von 1973 erreicht und so­ mit weit unter dem Mitte bis Ende der 1960er Jahre ereichten Niveau liegt.5 Gerard Duménil und Dominique Lévys Zahlen bis 1997 weichen ebenfalls er­ heblich von denen Hussons ab.6 Die Berechnung von Goldman Sachs be­ ginnt erst im Jahr 1980 und enthält so­ mit keine Hinweise auf den Rückgang der Profite ab Ende der 1960er Jahre. Mit einer Spitze in den Jahren 1997 und 2007, die nur etwa 10 Prozent hö­ her liegt als im Jahr 1988, belegen aber auch diese Zahlen ein Erholungsmuster der US-Profite, das ganz erheblich von Hussons abweicht.7 Dieselbe Unvereinbarkeit mit Hus­ sons Zahlen findet sich in Berech­ nungen für andere Länder. Brenner und Sylvain weisen einen langfristigen Fall der Profitraten in Japan nach, ebenfalls Arthur Alexander8 sowie Fu­ mio Hayashi and Edward C. Prescott.9 Mehmet Ufuk Tutan hat die Profitra­ ten Deutschlands einer sehr sorgfäl­ tigen Analyse unterzogen. Sie reicht nur bis zum Jahr 1987, weist aber ei­ ne wesentlich schwächere Erholung nach, als Hussons Grafik für die vier größten EU-Wirtschaften impliziert.10 Ich habe drei Untersuchungen über die Profitraten in China gefunden. Ei­ ne zeigt einen starken Rückgang um mehr als ein Drittel in den Jahren 1978 bis 2000.11 Die zweite zeigt ei­ nen noch tieferen Fall um 40 Prozent von 1978 bis 2003.12 Und die drit­ te zeigt einen Rückgang in der verar­ beitenden Industrie bis zum Jahr 1999 und einen beträchtlichen Aufschwung danach.13 (Abbildung 2) Die Entscheidung, wie Kapitalin­ vestitionen gemessen werden sollten, wirft grundsätzliche Probleme auf. Hin­ zu kommt die schwierige Suche nach geeigneten Zahlen. Unternehmen mes­ sen die Rentabilität ihrer Investitionen, indem sie der ursprünglichen Investi­ tionssumme für Betriebsanlagen und Ausrüstungen die jährlichen Ausga­ ben für Rohmaterialien, Komponenten und Löhne hinzu addieren und dann die Gesamtsumme ins Verhältnis zur Sum­ me der in dieser Zeit erzielten Nettoge­ 3 Ich beziehe mich hier auf seine Grafik, denn er liefert keine Zahlen hierzu. 4 Diese Grafiken und andere, auf die ich mich beziehe, werden weiter unten aufgeführt. 5 Sylvain, 2001. 6 Duménil und Lévy, 2002. 7 Siehe Choonara, 2009. 8 Alexander, 1988. 9 Hayashi und Prescott, 2001. 10 Tutan, 2008. 11 O’Hara, 2006. 12 Felipe, Lavina und Fan, 2008. 13 Yu und Feng, 2006. 40 Abbildung 2: Moseleys Zahlen für die US-amerikanische Profitrate. Quelle: Moseley, 2007. winne setzen. Mit anderen Worten, die über eine längere Zeit erzielten Profite werden durch die in derselben Zeit ge­ machten Ausgaben dividiert. Nach die­ ser „konventionellen Buchungsmethode … werden die Werte des Kapitalstocks und der Kapitalkonsumtion zu ihren his­ torischen Werten gemessen.“14 Aber das Aggregieren verschie­ dener, zu unterschiedlichen Zeitpunk­ ten getätigter Investitionen ist naturge­ mäß ein sehr komplexer Vorgang, so­ dass zur Messung der nationalen Pro­ fitraten meistens eine andere Methode verwendet wird, nämlich die der Bilan­ zierung zu aktuellen Preisen: Die Pro­ fite eines gegebenen Jahres werden be­ zogen auf den aktuellen Marktwert, also die Wiederbeschaffungskosten der ein­ gesetzten Anlagen und Ausrüstungen. Das bringt zwangsläufig eine Verzer­ rung der Zahlen mit sich, denn jeglicher Produktivitätszuwachs im Zeitintervall seit der ursprünglichen Investition be­ deutet, dass ihr gegenwärtiger Markt­ wert unter dem der ursprünglichen Aus­ gaben liegen muss, sodass die Profitrate höher erscheint. Je schneller die techno­ logische Innovationsrate, desto größer wird diese Diskrepanz ausfallen. Das fällt besonders in den letzten Jahren ins Gewicht wegen des rapiden, computer­ gestützten Produktivitätszuwachses.15 Es ist daher zu erwarten, dass auf die­ ser Berechnungsgrundlage kalkulierten Profitraten für die zurückliegende Zeit höher ausfallen als die der Vorperiode. (Abbildung 3) 14 Bank of England, Quarterly Bulletin, 1975. 15 Siehe beispielsweise Tevlin und Whelan, 2003. inprekorr 460/461 Ökonomie Die Bemessung der Profitrate auf Grundlage der historischen Kosten ist in Zeiten steigender Preise für in Un­ ternehmerhand befindliche Warenlager ebenfalls fehleranfällig: Die Profitrate erscheint durch ihren der Inflation ge­ schuldeten Wertzuwachs größer.16 Andrew Kliman hat historische Ko­ stenkalkulationen bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Inflationseffek­ ten herangezogen, um so beide Arten von Verzerrung möglichst auszuschal­ ten.17 Seine Grafiken ergeben ein Ge­ samtmuster, das mit dem von Bren­ ner, Mohun und Moseley weitgehend übereinstimmt – nur dass sie eine weit­ aus geringere Erholung der Rentabili­ tät von ihrem Tiefpunkt zu Beginn der 1980er Jahre belegen. (Abbildung 4) Eine dritte Quelle von Verzerrung der Rentabilitätsstatistiken können Ak­ tienblasen sein. Diese verleiten Firmen dazu, eine Werterhöhung vorzugeben, die in keiner Beziehung zu realen Pro­ duktionssteigerungen steht. Dieser Ef­ fekt tritt deutlich zutage in den Gesamt­ statistiken über Geldflüsse in den USA (US Flow of Funds Accounts). Bei Fi­ nanztransaktionen kann diese Werter­ höhung als Bestandteil einer Nettozu­ nahme der gesamtwirtschaftlichen Lei­ stung registriert werden. Da Profite ei­ ner Volkswirtschaft in der Regel durch Abziehen der Lohnkosten vom Netto­ sozialprodukt errechnet werden, kann eine solche Werterhöhung den An­ schein schneller steigender Profite er­ wecken. Der Schock des Finanzcrashs der letzten beiden Jahre hat manche Wirt­ schaftsweisen zu dem Geständnis be­ wegt, dass es Mitte dieses Jahrzehnts, wenn nicht sogar früher, „fiktive Profi­ te“ – und damit auch ein „fiktives Wirt­ schaftswachstum“ – gab. Bei den mei­ sten Rentabilitätsberechnungen soll das Problem umschifft werden, indem sie sich auf nicht im Finanzsektor tä­ tige Unternehmen oder manchmal den Wirtschaftssektor ohne das Finanzwe­ sen beschränken. Es ist allerdings frag­ lich, ob damit die Verzerrung vollkom­ men ausgeschaltet ist, wenn Produkti­ onsunternehmen wie General Electric (die größte Produktionsgesellschaft der USA), Ford oder General Motors von 16 Bank of England Quarterly Bulletin, 1975. 17 Dafür verwendet er gebräuchliche Inflations­ statistiken sowie seine eigene Methode auf Grundlage der monetären Äquivalenz für Ar­ beitszeit (MELT). inprekorr 460/461 Abbildung 3: Brenners Zahlen für die US-amerikanischen Profitraten im Nichtfinanzsektor. Quelle: BEA-Daten. inflationsbereinigt Arbeitsproduktivitätsrate (LaborROP), bereinigt um Lohnkostenveränderungen aus unbereinigten Geldwerten berechnete Profitrate (ROP) Abbildung 4: Klimans Zahlen für die US-amerikanische Profitrate. Quelle: Kliman, 2009. Abbildung 5: Mohuns Zahlen für die US-amerikanische Profitrate. Quelle: Mohun., 2006. Beginn der 1990er Jahre an zunehmend von Finanztransaktionen abhängig ge­ worden sind. (Abbildung 5) Die Financial Times berichtet, der Wirtschaftsanalyst Andrew Smithers habe „schon seit geraumer Zeit da­ rauf hingewiesen, dass aufgeplusterte Wertbemessungen ernsthafte Verzer­ rungseffekte mit sich bringen. Er rech­ net nach, dass allein die gestiegenen 41 Ökonomie Grundstückspreise im Jahr 2007 die Bilanzen der nicht im Finanzsektor tä­ tigen Unternehmen um schwindelerre­ gende 1000 Milliarden und mehr auf­ gebläht haben.“18 Smithers rechnet, dass Wertsteigerungen dieser Art im vergangenen Jahrzehnt „beachtliche 22 Prozent aller Gewinne von nicht im Finanzsektor tätigen Unternehmen ausmachten“.19 General Electric erhielt im August 2009 ein Bußgeld in Höhe von mehreren Millionen Dollar wegen Aufbauschens seiner Gewinne. Wir haben allen Grund zu der An­ nahme, dass Hussons Zahlen all die­ se Verzerrungen enthalten. Jedenfalls legt die europäische Website, auf die er sich bezieht, bei der Bemessung be­ trieblicher Investitionen die Ersatzund nicht die ursprünglichen Kos­ ten zugrunde. Es scheint auch, dass die Zahlen die Gesamtwirtschaft um­ fassen, einschließlich der aufgebläh­ ten Scheinprofite im Finanzsektor. Oh­ ne detaillierte Darlegung der Methodik und der Quellen lässt sich dazu nichts Genaueres sagen. Fehlerhaftes Theorieverständnis Aber nicht nur Hussons Zahlen sind fragwürdig, sein Versuch, sie nach mar­ 18 Jackson, Financial Times, 26. November 2008. 19 Jackson, Financial Times, 30 März 2009. xistischen Kriterien zu erläutern, ist es ebenfalls. Er schreibt über Marx’ „ten­ denziellen Fall der Profitrate“: „Es gibt a priori keinen Grund für die Annahme, dass diese Tendenz systematisch die Gegentendenz überwiegen muss. Die Ar­ beitsproduktivität kann steigende Reallöh­ ne und die Zunahme des physischen Kapi­ tals auf ganz symmetrische Weise kompen­ sieren.“ Die Akkumulation von Produkti­ onsmitteln muss keineswegs, so Hus­ son, eine Zunahme der organischen Zusammensetzung des Kapitals nach sich ziehen: „Die zunehmende Arbeitsproduktivi­ tät ermöglicht eine Reduzierung der Kosten für Maschinen. Diese Gegentendenz kann die zunehmende Anzahl von Maschinen aus­ gleichen, so dass die Entwicklung der or­ ganischen Zusammensetzung undefiniert bleibt.“ Unter solchen Bedingungen kann ei­ ne Steigerung der Ausbeutungsrate je­ des einzelnen Arbeiters zu einer Stei­ gerung der Profitrate führen. Und ge­ nau das ist es – das sollen Hussons Zah­ len belegen –, was wir im vergangenen Vierteljahrhundert erlebt haben: „Das Verhältnis zwischen Zähler und Nenner, das die Profitrate ergibt, kann konstant bleiben, und somit auch die Profitrate.“ Seine Argumentation ist aller­ dings an einer entscheidenden Stelle lückenhaft. Er lässt einen wichtigen Gesichtspunkt außer Acht, den ver­ Abbildung 6: Freemans Zahlen für die US-amerikanische Profitrate. Quelle: Freeman, 2009. 42 schiedene Marxisten in ihren Kontro­ versen über die Profitrate in den letz­ ten 40 Jahren hervorgehoben haben.20 Die Kontroverse wurde durch den Lehrsatz des japanischen Marxisten Okishio entfacht, wonach Kapitalisten nur dann neue Technologien einfüh­ ren würden, wenn dadurch die Pro­ fitrate erhöht wird, daher könnten stei­ gende Kapitalinvestitionen die Pro­ fitrate nicht senken. Vielmehr wür­ den sie die Produktivität erhöhen, da­ mit die Kosten für Neuinvestitionen senken und folglich eine allgemeine Steigerung der Profitrate herbeifüh­ ren. Das Einzige, was die Rentabilität senken könnte, wäre in diesem Fall ei­ ne sinkende Ausbeutungsrate (mit an­ deren Worten eine Zunahme des An­ teils am Ausstoß, der den Arbeitern zukommt). (Abbildung 6) Das von Robin Murray,21 Ben Fi­ ne und Lawrence Harris,22 Gugliel­ mo Carchedi,23 Alan Freeman, An­ drew Kliman24 und mir selbst25 unter­ schiedlich formulierte Gegenargument ist schlicht und beweiskräftig. Näm­ lich, dass die Wirkung von Produkti­ vitätszuwächsen zur Reduzierung zu­ künftiger Investitionskosten dem ein­ zelnen Kapitalisten nicht hilft, seinen Profit aus bereits vorhandenen Investi­ tionen zu ziehen. Wie das Sprichwort sagt: „Man kann die Häuser von heute nicht mit den Ziegelsteinen von morgen bauen.“ Die Tatsache, dass neue Maschinen im nächsten oder übernächsten Jahr bil­ liger sein werden, reduziert nicht auf wundersame Weise die Summe, die für die vorhandenen bereits verausgabt wurde. Ganz im Gegenteil: Je rasender die technologische Innovation und die Produktivitätszuwächse, desto schnel­ ler wird der Maschinenpark vom „mo­ ralischen Verschleiß“ betroffen sein und veralten. Als Ergebnis gerät die Rentabilität unter zunehmenden, nicht abnehmenden Druck. (Abbildung 7) 20 Im englischen Sprachraum begann diese Kon­ troverse im Bulletin of the Conference of Socialist Economists Anfang der 1970er Jahre, in dem Andrew Glyn, Robin Murray, Sue Him­ melweit, Bob Rowthorn, Philip Armstrong, Ben Fine and andere unterschiedliche Positio­ nen vertraten. 21 Murray, 1973. 22 Fine und Harris, 1979. 23 Carchedi, 1991. 24 Kliman, 2007. 25 Harman, 1984, S. 20-34 und 2009, S. 68-75. inprekorr 460/461 Ökonomie Es gibt nur einen Ausweg, um die­ sen Effekt zu neutralisieren: wenn die Kosten bestehender Investitionen aus den Büchern entfernt, also die Kapi­ talien entwertet werden können. Der einzelne Kapitalist kann aber veraus­ gabte Summen nicht achselzuckend abtun. Wenn er das versucht, wird sei­ ne Rentabilität so oder so sinken. In meinem neuesten Buch habe ich das wie folgt beschrieben: „Investitionen … werden zu einem be­ stimmten Zeitpunkt getätigt. Die Verbilli­ gung weiterer Investitionen infolge verbes­ serter Produktionstechniken geschieht zu einem späteren Zeitpunkt. Beide Vorgänge finden nicht gleichzeitig statt … Wenn Kapi­ talisten ihre Profitraten messen, vergleichen sie den aus dem Betreiben ihrer Fabrik und den Maschinen erzielten Mehrwert mit den in der Vergangenheit dafür getätigten Aus­ gaben, nicht mit den aktuellen Wiederbe­ schaffungskosten … [Die Profitrate] impli­ ziert immer den Vergleich des gegenwärtigen Mehrwerts mit den Investitionen, aus denen dieser fließt. Ohne das ergäbe die Vorstellung eines „sich selbst verwertenden Werts“ kei­ nen Sinn.“26 Das bedeutet, dass nur ein Weg of­ fen steht, damit die fallenden Kosten für Neuinvestitionen nicht zu sinkender Rentabilität führen: Manche Kapitalien müssen die Verluste aus der Entwer­ tung tragen und bankrottgehen, sodass andere deren Anlagen, Ausrüstungen und Rohmaterialien unter ihrem Wert aufkaufen können. Die Krise schafft eben diese Bedingungen, unter denen manche Kapitalien andere ausschlach­ ten können und folglich die sinkenden Kosten für Neuinvestitionen dem lang­ fristigen Druck auf die Profitraten ent­ gegenwirken können. Eine wichtige empirische Beo­ bachtung der Wirtschaftskrisen der letzten 40 Jahre zeigt jedoch, dass sie relativ wenige Firmenpleiten verur­ sacht haben. Wegen der Konzentra­ tion und Zentralisation des Kapitals werden die größten Unternehmen in die Lage versetzt, ihre weniger profi­ tablen Abteilungen vor der Pleite zu schützen – ein Umstand, auf den der russische Ökonom Preobraženski be­ reits 1931 hinwies.27 Die Angst an­ 26 Harman, 2009, S. 74–75. Die erste Spielart dieses Arguments, der ich begegnet bin, war die Robert Murrays im Bulletin of the Confe­ rence of Socialist Economists, in dem er das Kornmodell heranzog (Murray, 1973). 27 Preobaženski, 1985, S. 137. inprekorr 460/461 Abbildung 7: Sylvains Zahlen für die Profitraten ausgewählter Länder. Quelle: Sylvain, 2001. derer Kapitalisten vor den Folgen für sie selbst im Falle eines Zusam­ menbruchs wirklich großer Unter­ nehmen hat in jeder Krise der letz­ ten Jahrzehnte dazu geführt, dass die Staaten interveniert haben, um ei­ ne solche Entwicklung abzuwenden – was die Wirtschaftswissenschaftler des Mainstreams als Phänomen des „zu groß, um unterzugehen“ bezeich­ nen. Eine Untersuchung über Pleiten in den USA kommt zu dem Ergeb­ nis, dass sie bis in die 1990er Jahre eine Seltenheit blieben. In der kurz­ lebigen Krise von 2000 bis 2002 gab es bereits mehr Pleiten – Enron und WorldCom waren die berühmtesten – aber der Rückgriff auf staatliche Rettungspakete seit dem Zusam­ menbruch von Lehman Brothers, die massive Einmischung verschiedener Staaten, um beispielsweise den dro­ henden Kollaps von General Motors und Chrysler abzuwenden, zeigen die Grenzen einer Kapitalentwertung durch Krisen. (Abbildung 8) Dieser Umstand erklärt das Dilem­ ma, mit dem sich neoliberale Öko­ nomen in der gegenwärtigen Kri­ se konfrontiert sehen. Eine reine Hayek‘sche oder neoklassische Lö­ sung hieße, viele der Firmengiganten gegen die Wand fahren zu lassen, um den übrigen eine Lebenschance zu er­ öffnen. In Wirklichkeit hat aber die Konzentration und Zentralisation von Kapital einen Grad erreicht, wo die verschiedenen Bestandteile des Sy­ stems dermaßen eng miteinander ver­ quickt sind, dass ein Bankrott ihrer unprofitablen Teile den übrigen mehr schaden als helfen kann. Abbildung 8: Duménil und Lévys Zahlen für die Profitraten US-amerikanischer Unternehmen. Quelle: Duménil und Lévy, 2002. 43 Ökonomie Die wirklichen Wurzeln der Krise Diese Beweisführung lässt uns erken­ nen, dass die Wurzeln der Krise tat­ sächlich im Druck auf die Profitraten seit Ende der 1960er Jahre liegen. Die Versuche, damit zu Rande zu kommen, umfassten alle von Husson erwähnten Mittel: Angriffe auf die Löhne, auf So­ zialleistungen, auf Arbeitsbedingungen usw., mit anderen Worten: Steigerung der Ausbeutungsrate. Eine Reihe von Quellen belegen den wachsenden An­ teil der Kapitaleinkünfte im Vergleich zu den Lohneinkünften in allen wich­ tigen kapitalistischen Ländern. Aber in Ermangelung großer Firmenpleiten reichte das nicht aus, um der Rentabili­ tät zu ihrem alten Niveau zu verhelfen. Das Ergebnis war eine langwierige Ver­ langsamung der weltweiten Akkumu­ lationsrate – sogar unter Berücksichti­ gung der beschleunigten Akkumulation in China. Nebenbei sollte erwähnt werden, dass dieser Abwärtstrend der Akku­ mulationsrate einen Nebeneffekt zei­ tigt: Das reduzierte Akkumulationstem­ po kann zumindest zeitweise den Auf­ USA wärtsdruck auf die organische Zusam­ mensetzung des Kapitals reduzieren.28 Aber die verminderte Akkumulati­ on in einer Zeit steigender Ausbeutung bewirkt in aller erster Linie eine wei­ tere Öffnung der Schere zwischen dem Potenzial des Systems, Güter zu produ­ zieren, und der Aufnahmefähigkeit des Markts dafür. Diese „Überproduktion“ ist aber nicht Folge von „Unterkonsum­ tion“ an sich, sondern des Ausbleibens einer ausreichenden Akkumulationsra­ te, um die verlorene Konsumnachfrage durch eine erhöhte Nachfrage nach In­ vestitionsgütern auszugleichen. Die Ausdehnung des Finanzsektors fand vor diesem Hintergrund statt. Es war der Versuch von Kapitalisten, ei­ ne höhere Profitrate zu erzielen, als pro­ duktive Investitionen hergeben. Damit können einzelne Kapitalisten Erfolg ha­ ben, das kann aber nicht für das System als Ganzes funktionieren, da der Mehr­ wert seinen letztlichen Ursprung in pro­ duktiven Investitionen hat. Sie war zu­ 28 Zahlen für das Verhältnis zwischen Kapital und Ausstoß einerseits und Kapital und Beschäfti­ gung andererseits legen nahe, dass dieser Fall seit Mitte der 1970er Jahre mehrmals eingetre­ ten ist. EU 5 (D, GB, F, I, E) Abbildung 9: Goldman Sachs‘ Zahlen für Gewinne aus physischen Kapitalanlagen. Quelle: Daly, Kevin und Ben Broadbent, 2009. 44 gleich verbunden mit der Vergabe von Konsumkrediten an Arbeiter und An­ gehörige der Mittelschichten, womit ei­ ne Nachfrage für Güter erzeugt wurde, die sonst unverkäuflich geblieben wä­ ren. Dieser „privatisierte Keynesianis­ mus“ wurde vom Chef der US-ameri­ kanischen Zentralbank, Alan Green­ span, nach der Dotcom-Blase und dem Zusammenbruch der Telekomgesell­ schaften Ende der 1990er Jahre und der allgemeinen Panik nach dem 9. Sep­ tember förmlich angeschoben. Aber auch dieser Ausweg konnte nicht ewig währen, weil Arbeiter die Zinszah­ lungen, aus denen sich die hohen Pro­ fite des Finanzsektors speisten, nur hät­ ten zahlen können, wenn ihre Löhne ge­ stiegen wären, was wiederum die Pro­ fitrate gesenkt hätte. Sogar bürgerliche Wirtschaftskommentatoren wie Martin Wolf stellten fest, dass die Kredite ei­ nen beträchtlichen Teil der US-ameri­ kanischen Bevölkerung in die Lage ver­ setzten, die Rolle des „letzten Konsu­ menten“ für das übrige Weltsystem zu spielen, vor allem für Deutschland, Chi­ na, Japan (über den Umweg seiner ge­ stiegenen Exporte nach China), die an­ deren fernöstlichen Länder und Lateina­ merika. (Abbildung 9) Die Krise kann daher sehr wohl als Folge des „Gesetzes des tendenziellen Falls der Profitrate und seiner Gegenten­ denzen“ verstanden werden – vorausge­ setzt, die Begrenztheit der Gegenten­ denzen wird richtig verstanden: Sie ho­ ben zwar die Profitraten von ihrem ex­ trem niedrigen Niveau zu Beginn der 1980er Jahre an, aber nicht in dem Aus­ maß, die Investitionstätigkeit so weit an­ zuspornen, dass sie die gesamte Produk­ tion des Systems hätte absorbieren kön­ nen. Das löst ein Rätsel, das Hussons Entwurf birgt: Warum führten die an­ geblich so hohen Profitraten (höher als während des langen Booms der „glor­ reichen 30 Jahre“) nicht zu einem Ni­ veau produktiver Investitionen, das aus­ gereicht hätte, das ganze System auf Wachstumskurs zu bringen? Stattdessen erleben wir seit 30 Jahren mehrjährige Investitionsperioden in bestimmten Tei­ len des Weltsystems (manchmal sogar sehr ausgeprägte, wie während Ende der 1970er Jahre in Brasilien, während der letzten zehn Jahre in China oder in den USA Mitte der 1990er Jahre), aber kei­ nen nachhaltigen globalen Aufschwung. Seine Erklärung dafür scheint zu sein, inprekorr 460/461 Ökonomie Abbildung 10: Tutans Berechnung der deutschen Profitraten (ohne Bausektor). Quelle: Tutan 2008. dass es politische Kräfte gibt, die das System davon abhalten, die erforder­ lichen keynesianischen Maßnahmen zu ergreifen, und stattdessen das akkumu­ lierte Geldkapital weg von produktiven Investitionen in Finanzen umleiten. Es ergibt aber mehr Sinn, den Kapitalab­ fluss zum Finanzsektor als Antwort auf die in ihren Augen unbefriedigenden Profitraten in der Produktionssphäre zu sehen – ein Umstand, den alle Berech­ nungen der Profitraten bestätigen, außer denen Hussons. Hussons eigene Zahlen lassen noch eine weitere Frage unbeantwortet: Was passiert mit dem Geldkapital, das in den Finanzsektor fließt? Denn nur ein Teil dieses Geldkapitals kann dort blei­ ben, da der Hauptzweck des Finanzsek­ tors definitionsgemäß nicht die Rück­ wandlung von Geldkapital in Konsum­ güter ist. Ein Teil fließt in den Bau von Bankentürmen und Bankgehältern, der Großteil fließt aber zurück ins System. Das Finanzsystem ist ein Leitungsnetz, das die verschiedenen Teile des Sy­ stems miteinander verbindet, die ihrer­ seits sehr wohl Geldkapital in Konsum­ güter umwandeln. Wie ein Becken kann es nur eine bestimmte Menge Geldka­ pital aufnehmen, ohne überzulaufen. Der Bauboom wird einen Teil des Geld­ kapitals wohl in Konsumgüter verwan­ delt haben, aber nicht in dem Maße, wie man annehmen könnte, denn ein Groß­ teil speiste die steigenden Häuserpreise, nicht die Ausweitung der Bauindu­ strie (das war besonders in Großbritan­ nien offensichtlich, wo sich die Häuser­ preise innerhalb von zwölf Jahren ver­ vierfachten, während der Hausbau auf einem historischen Tief stagnierte). Die Zahlen für die USA legen nahe, dass Fi­ nanzen erst Mitte es vergangenen Jahr­ inprekorr 460/461 zehnts wieder in produktive Investiti­ onen zurückflossen. Von Mitte bis En­ de der 1990er Jahre gab es seitens der Industrie­unternehmen Nettokreditauf­ nahmen. Das Problem war, dass sogar in dieser Phase das Kapital weltweit nicht genügend Vertrauen in die Rentabilität hatte, um Investitionen in einem Aus­ maß zu tätigen, das einen tragfähigen Aufschwung hervorgebracht hätte. Übersetzung: David Paenson Literatur Alexander, Arthur, 1998, „Japan in the context of Asia“, SAIS policy forum series John Hop­ kins University. Carchedi, Guglielmo, 1979, „Frontiers of Politi­ cal Economy“ (Verso). Choonara, Joseph, 2009, „A Note on Gold­ man Sachs and the Rate of Profit“, International Socialism 124 (Herbst 2009), www.isj.org. uk/?id=588 Daly, Kevin, and Ben Broadbent, 2009, „The Savings Glut, the Return on Capital and the Rise in Risk Aversion“, Global Economics Paper No 185, Goldman Sachs Global Econo­ mics, Commodities and Strategy Research. Duménil, Gérard, and Dominique Lévy, 2002, „The Profit Rate: Where and How Much Did it Fall? Did It Recover?“, Review of Radical Political Economy 34, www.jourdan.ens.fr/le­ vy/dle2002f.pdf Felipe, Jesus, Edith Lavina, and Emma Xiaoqin Fan, 2008, „Diverging Patterns of Profitabili­ ty, Investment and Growth in China and India during 1980-2003“, World Development, Bd. 36, Ausgabe 5. Fine, Ben, and Lawrence Harris, 1979, „Rerea­ ding Capital“ (Macmillan). Freeman, Alan, 2009, „What Makes the US Rate of Profit Fall“, unpublished paper, http:// mpra.ub.uni-muenchen.de/14147/1/MPRA_ paper_14147.pdf Harman, Chris, 1984, „Explaining the Crisis“ (Bookmarks). Harman, Chris, 2009, „Zombie Capitalism“ (Bookmarks). Hayashi, Fumio and Edward C Prescott, 2001, „The 1990s in Japan: A Lost Decade“, www. esri.go.jp/jp/prj21/forum04/pdf/summary4.pdf Husson, Michel, 2009, „Le Dogmatisme n’est Pas Marxism“, NPA website, http://bit.ly/husson-dogmatism Jackson, Tony, 2008, „Recession Flames Fan­ ned by Debt-Capex Combination“, Financial Times, 26 November 2008. Jackson, Tony, 2009, „Maybe Equities Rally, but My Money Stays Under the Mattress“, Financial Times, 30 March 2009. Kliman, Andrew, 2007, „Reclaiming Marx’s Capital“ (Lexington Books). Kliman, Andrew, 2009, „The Persistent Fall in Profitability Underlying the Current Cri­ sis: New Temporalist Evidence“ (zweiter Ent­ wurf), http://akliman.squarespace.com/persistent-fall O’Hara, Phillip Anthony, 2006, „A Chinese So­ cial Structure of Accumulation for Capita­ list Long-Wave Upswing?“, Review of Radical Political Economics, volume 38, number 3, http://hussonet.free.fr/rrpe397.pdf Mohun, Simon, 2006, „Distributive Shares in the US Economy, 1964-2001“, Cambridge Journal of Economics, volume 30, number 3. Moseley, Fred, 2007, „Is the US Economy Hea­ ding for a Hard Landing?“, www.mtholyoke.edu/courses/fmoseley/hardlanding.doc Murray, Robin, 1973, „Productivity, Organic Composition, and the Falling Rate of Profit“, Bulletin of the Conference of Socialist Economists, Frühjahr 1973. Preobrazhensky, Evgeny, 1985 (1931), „The Decline of Capitalism“ (ME Sharpe). Sylvain, Arnaud, 2001, „Rentabilité et Profitabi­ lité du Capital: le Cas de Six Pays Industriali­ sés“, Économie et Statistique, no 341-2, www. insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES341G.pdf Tevlin, Stacey, and Karl Whelan, 2003, „Ex­ plaining the Investment Boom of the 1990s“, Journal of Money, Credit and Banking, volu­ me 35, number 1, www.federalreserve.gov/pu­ bs/feds/2000/200011/200011pap.pdf Tutan, Mehmet Ufuk, 2008, „The Falling Rate of Profits in West Germany“ (VDM Verlag Dr Mueller eK). Yu, Zhang, and Zhao Feng, 2006, „The Rate of Surplus Value, the Composition of Capital, and the Rate of Profit in the Chinese Manuf­ acturing Industry: 1978-2005“. Beitrag für die Second Annual Conference of the Internatio­ nal Forum on the Comparative Political Economy of Globalization, 1-3 September 2006, Renmin University of China, Beijing, China. 45 Ökonomie Lange Wellen – die letzte? Thadeus Pato 1. Die Debatte über die Frage, ob die so­ genannten langen Wellen der Konjunktur, die von Kondratieff und anderen postu­ liert wurden, tatsächlich existieren, dauert jetzt bereits fast hundert Jahre an. Wäh­ rend dieser Zeit kamen verschiedene mar­ xistische Ökonomen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Der ostdeutsche Wissenschaftler Jürgen Kuczinsky stell­ te beispielsweise in den dreißiger Jahren eine Untersuchung an und kam zu dem Schluss, dass es keine Evidenz für ihre Existenz gäbe. Sein Sohn Thomas wiede­ rum präsentierte in den achtziger Jahren eine eigene Erklärung der langen Wellen, die sich von der Ernest Mandels nicht we­ sentlich unterschied. Wenn wir uns die Zeitrahmen anse­ hen, die bisher benutzt wurden, um die langen Wellen abzubilden, so scheint es, als ob die Theorie der langen Wellen durch die aktuelle ökonomische Krise wi­ derlegt wäre. Wenn wir Mandel und anderen Öko­ nomen zustimmen, zum Beispiel dem Russen Menschikoff, aber auch dem er­ wähnten ostdeutschen Mathematiker Tho­ mas Kuczinsky, dass die letzte lange Wel­ le mit expansivem Grundton nach dem Zweiten Weltkrieg begann und bis Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre andauerte, dann sollte eigentlich das En­ de der depressiven Phase spätestens Mit­ te der neunziger Jahre erreicht gewesen sein und wir befänden uns jetzt mitten in einem neuen weltweiten Wirtschaftsauf­ schwung. Dass das nicht der Fall ist, ist evident, und dass wir im Gegenteil in der tiefsten 46 Krise des kapitalistischen Systems seit 80 Jahren stecken, scheint die Diskussion über die langen Wellen zu guter Letzt als intellektuelle Spielerei zu entlarven. Andererseits hat Mandel ebenso wie Trotzki immer darauf hingewiesen, dass im Gegensatz zu den kurzen industriel­ len Zyklen wie die Juglar- oder KitchinZyklen die langen Wellen von einer solch großen Zahl unterschiedlicher, nicht nur ökonomischer, Faktoren beeinflusst wer­ den, dass ein regelmäßiger, kontinuier­ licher und periodischer Zyklus mit einem definierten Zeitplan gar nicht zu erwarten sei. 2. Es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die im Zusammenhang mit der aktuellen ökonomischen (und ökologischen) Krise sind zu beantworten sind: • Welche Faktoren könnten den unge­ wöhnlichen Verlauf der letzten depres­ siven Welle über inzwischen fast 40 Jahre erklären? • Spielt dabei das Finanzkapital eine Rolle? • Hat die tiefgreifende ökologische Krise einen Einfluss auf den ökono­ mischen Zyklus, und wenn ja, in wel­ che Richtung? Im Folgenden möchte ich einige Thesen präsentieren, die eine Antwort auf die so­ eben gestellten Fragen zu geben versu­ chen. Ich gehe dabei von der grundsätz­ lichen Annahme aus, dass die langen Wel­ len tatsächlich existieren und dass sie in erster Linie auf der langfristigen Entwick­ lung der Profitraten beruhen. Ich möchte hier nicht die gesamte Debatte pro und contra die Existenz der langen Wellen wiederholen, lediglich dazu eine kurze Anmerkung: In Bezug auf die genannte Annahme können wir feststellen, dass wir, begin­ nend mit der Wirtschaftskrise Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre eine lange Phase schrumpfender Wachstums­ raten in einer relevanten Anzahl industria­ lisierter Länder zu verzeichnen hatten und einen dazu korrespondierenden Rückgang der Profitraten. Der Versuch, die Profitrate anzuheben, führte zu der Politik der acht­ ziger Jahre mit der sogenannten neolibe­ ralen Wende, mit Lohnsenkungen, Dere­ gulierung, Privatisierung etc. Die logische Konsequenz dieser Politik, der Rückgang der Nachfrage, hätte ungefähr 1990 in ei­ ne tiefe Überproduktionskrise münden müssen. Insoweit korrespondieren die entsprechenden statistischen Daten mit der Theorie der langen Wellen. 3. These 1: Die derzeitige Krise „hätte eigentlich“ schon vor 15–20 Jahren eintreten müs­ sen, aber sie wurde durch ein oder meh­ rere Faktoren hinausgezögert. Der erste identifizierbare (und Haupt-) Faktor ist das enorme Wachstum der öf­ fentlichen und privaten Verschuldung. Di­ ese fand in fast allen großen Industrie­ staaten statt. Aber sie hatte in unterschied­ lichen Ländern unterschiedliche Gründe. Nur ein Beispiel: In Deutschland lag zum Zeitpunkt des Falls der Berliner Mauer die Kapazitätsauslastung der west­ inprekorr 460/461 Ökonomie deutschen Industrie bei ca. 60 %, kurz da­ nach stieg sie auf bis zu 90 % in manchen Branchen. Das war eine Folge der Nach­ frage, die durch die Öffnung der Grenze zu Ostdeutschland generiert wurde, und de facto eine riesige Subvention für die westdeutsche Industrie. Aber das führte gleichzeitig zur Zerstörung der ostdeut­ schen Industrie, generierte Arbeitslosig­ keit, und die Rechnung wurde komplett durch öffentliche Schuldenaufnahme be­ zahlt. In den USA gab es eine vergleichbare Entwicklung, und bei der privaten Ver­ schuldung war sie sehr ähnlich der der öf­ fentlichen Verschuldung in Deutschland. Aber auch die Gesamtverschuldung folgte dieser Tendenz. Die Gründe waren offen­ sichtlich andere als in Deutschland, aber mit dem gleichen Effekt: Die notwen­ dige Nachfrage für die schon bestehen­ de Überproduktion wurde mehr oder we­ niger erfolgreich durch eine exorbitante Steigerung von öffentlicher und privater Verschuldung geschaffen. (Einschließlich der Kosten für die verschiedenen teuren Kriege der letzten zwanzig Jahre). Was die private Verschuldung betrifft, so hat, nebenbei gesagt, Mandel bereits in „Der Kapitalismus der dritten Periode“ darauf hingewiesen, dass die Verschul­ dung in dieser Periode ein bedeutender Faktor wird. Und ich denke, das ist die Verbindung zu dem zweiten Faktor, nämlich der Ent­ wicklung des sogenannten Finanzkapi­ tals, das seine Profite sowohl aus der öf­ fentlichen wie der privaten Verschuldung zog. Aber da das Problem der sinkenden Profitrate nicht gelöst wurde, entstand ei­ ne enorme Menge an Kapital, das „nach Realisierung suchte“. Das erzeugte, grob gesagt, die sogenannte Spekulationsbla­ se, die jetzt explodiert ist. (Michel Hus­ son schrieb 2002: „Das Wachstum der Fi­ nanzsphäre erklärt sich durch das Wachs­ tum des nicht akkumulierten Surplus.“) inprekorr 460/461 Der dritte Faktor ist die Reintegrati­ on des früheren Ostblocks und Chinas in das kapitalistische System. Insbesonde­ re in China wirkten die Wachstums- und Profitraten dieser Periode als kompensa­ torische Faktoren, und ein großer Teil der US-amerikanischen öffentlichen Schuld­ titel der letzten 15 Jahre wird von China gehalten. 4. These 2: Die globale Umweltkrise und die Ernäh­ rungskrise werden die externen Kosten und Risiken wesentlich erhöhen und da­ mit die Erholung der Profitraten limitie­ ren. Die Umweltkrise, insbesondere der Klimawandel, werden enorme unpro­ duktive Kosten auf verschiedenen Ebe­ nen generieren. Die Schätzungen bezüg­ lich der sogenannten Anpassungskosten in den Ländern der Peripherie wuchsen in den letzten Jahren kontinuierlich. Und angesichts der sich jedes Jahr verschlech­ ternden Szenarien bezüglich der Folgen des Klimawandels sind die derzeitigen Zahlen mit Sicherheit nicht realistisch. Hinzukommt, dass wir gleichzeitig ein riesiges Flüchtlingsproblem haben werden. Einige hundert Millionen Men­ schen werden ihre Heimat verlassen müs­ sen. Den Beginn dieser Entwicklung kön­ nen wir täglich an den Grenzen der Eu­ ropäischen Union ebenso beobachten wie in den Flüchtlingslagern Afrikas und Asi­ ens. Auf der anderen Seite stehen wir vor einer Zunahme bewaffneter Konflikte als Konsequenz des Klimawandels, worauf beispielsweise einige US-Generäle in einem Memorandum im April 2007 hin­ wiesen. Außerdem gibt es bereits Schätzungen über die Auswirkungen des Klimawan­ dels auf die Produktivität der Arbeitskräf­ te. Die Zahlen für Deutschland sind ein gutes Beispiel für diesen Effekt des Kli­ mawandels. 5. Schlussfolgerungen Wir befinden uns immer noch in der lan­ gen depressiven Welle, die vor 40 Jahren begann. Die derzeitige Krise wurde durch eine Reihe von Faktoren und Maßnah­ men hinausgezögert, in erster Linie durch das enorme Wachstum der öffentlichen und privaten Verschuldung. Das Problem, vor dem wir stehen, ist, dass die Maßnah­ men, die von der Bourgeoisie vorgeschla­ gen oder getroffen werden, um die öko­ nomische Krise zu überwinden und den Weg für einen neuen expansiven Zyklus zu öffnen, in ihrer großen Mehrheit in Be­ zug auf den Kampf gegen die ökologische Krise kontraproduktiv sind. Das macht die Forderung nach einem radikalen Wan­ del des existierenden sozialen und ökono­ mischen Systems, die Forderung nach ei­ ner gänzlich anderen Gesellschaft, zur unmittelbaren Notwendigkeit. Wir stehen an einem entscheidenden geschichtlichen Wendepunkt. Literatur Grossmann, H.: Das Akkumulations- und Zusam­ menbruchsgesetz des kapitalistischen Sy­ stems; Verlag Neue Kritik Frankfurt 1967 Husson, M.: Surfen auf der langen Welle, in: Um­ bau der Märkte; VSA, Hamburg 2002 Kriedel,N.: Lange Wellen der wirtschaftlichen Ent­ wicklung; LIT Verlag Münster 2005 Kuczinsky, J.: Das Problem der langen Wellen; Philografischer Verlag Basel 1934 Kuczinsky, T.: Das Problem der langen Wellen, in: Wirtschaftsgeschichte und Mathematik; Aka­ demieverlag Berlin 1985 Mandel, E.: Spätkapitalismus; Suhrkamp Verlag Frankfurt 1972 Mandel, E.: Die langen Wellen im Kapitalismus; isp, Frankfurt 1983 Menschikow, S.: Lange Wellen in der Wirtschaft; IMSF, Frankfurt 1989 47 NAchruf Bis zum letzten Atemzug ein revolutionärer Kämpfer: Daniel Bensaïd (1946–2010) Gilbert Achcar Seit Juni vergangenen Jahres ist das ge­ genwärtige marxistische Denken bedeu­ tend ärmer geworden. Mit dem frühzei­ tigen Tod von Denkern wie Peter Go­ wan, Giovanni Arrighi, Chris Harman und jetzt Daniel Bensaïd ist uns leider genommen worden, was jeder einzel­ ne von diesen Freunden und Genossen noch hätte beitragen können; ihr Leben hat zu einer Zeit geendet, da ihre intel­ lektuelle Produktion in vollem Schwung war. Am 12. Januar ist Daniel Bensaïd in Paris gestorben, nachdem er am Ende von nahezu 15 Jahren Leben mit AIDS mehrere Monate lang einen schmerz­ vollen Kampf gegen Krebs geführt hat­ te. Das beeindruckende internationale Gedenken – die meisten französischen Medien und mehrere Zeitungen über­ all auf der Welt widmeten ihm ausführ­ liche Nachrufe – zeugt davon, dass er zu Recht als ein prominenter Intellektueller und eine politische Führungsfigur Fran­ kreichs sowie als eine zentrale intellek­ tuelle Persönlichkeit von globaler Statur betrachtet worden ist. Daniel galt als der Haupttheoreti­ ker der im vergangenen Jahr gegründe­ ten Neuen Antikapitalistischen Partei (NPA) und war vorher jahrzehntelang eine zentrale Figur der Ligue Commu­ niste Révolutionnaire (LCR) gewesen. Engels hat einmal bemerkt, dass Frankreich das Land ist, in dem der Daniel Bensaïd 48 Klassenkampf immer die schärfsten Formen angenommen hat – eine Fest­ stellung, die von der Zeit nach ihm nicht widerlegt worden ist. Auf viele Weise verkörperte Daniel Bensaïd diese fran­ zösische revolutionäre Tradition. Ge­ wiss hatte er durch seinen Vater jüdischalgerische Wurzeln, und diese Dimen­ sion war eine Grundlage für sein inten­ sives Interesse für das Schicksal sowohl der Juden und Jüdinnen als auch der Pa­ lästinenser und Palästinenserinnen, als führender Kämpfer sowohl gegen An­ tisemitismus als auch gegen israelische Unterdrückung. Er war jedoch vor allem anderen ein französischer Revolutionär. Nicht in ir­ gendeinem engen, provinziellen Sinn – im Gegenteil, er war durch und durch ein Internationalist, in Theorie und Pra­ xis. Dank seiner Beherrschung des Spa­ nischen und Portugiesischen und auf­ grund seiner Zugehörigkeit zur zentra­ len Leitung der IV. Internationale war er an Entwicklungen innerhalb der radi­ kalen Linken in Lateinamerika, von Me­ xiko bis Brasilien, sowie, näher an der Heimat, auf der iberischen Halbinsel in­ tensiv beteiligt. Die französische revolutionäre Tra­ dition, die Daniel hochhielt, war selbst eine sehr internationalistische, wie er in dem Buch betonte, das er zum 200. Jah­ restag der Revolution von 1789 veröf­ fentlichte. Es trägt den bezeichnenden Titel Moi la Revolution (Ich, die Revo­ lution): Daniel entschied sich dafür, es in der ersten Person zu schreiben, als wäre die Revolution die Erzählerin. Er identifizierte sich mit der jakobi­ nischen Bewegung von 1793 und noch mehr mit ihrem radikalen Flügel – mit dem revolutionären Erbe, das von Grac­ chus Babeuf repräsentiert wird und im 19. Jahrhundert von Louis Augu­ ste Blanqui fortgeführt wurde, einem Erbe, das ein wesentlicher Bestandteil des Spektrums von Strömungen wer­ den sollte, die in der Pariser Kommu­ ne von 1871 repräsentiert waren. Mit der „Commune“ war er auf eine Wei­ se „physisch“ verbunden, wie er gerne und stolz betonte: Sein Großvater müt­ terlicherseits war ein Kommunarde ge­ wesen. Er verlängerte seine Verteidi­ gung der Bewegung von 1793 gegen die antijakobinische Wut, die aus An­ lass des 200. Jahrestags von 1789 aus­ brach, mit einer Verteidigung des rus­ sischen Bolschewismus, indem er ge­ gen die oberflächlichen kritischen Um­ wertungen im Gefolge des Zusammen­ bruchs der Sowjetunion an Lenins Ver­ mächtnis festhielt. Dabei spielte er der Tendenz nach die problematischen Di­ mensionen beider Revolutionen herun­ ter, nicht weil er die Probleme nicht ge­ sehen hätte, sondern weil er das Tempe­ rament eines Kämpfers hatte – eines po­ litischen Boxers, könnte man sagen, im Gedenken an seinen Vater, der tatsäch­ lich ein Boxer war. Nichts bringt diesen Aspekt seiner Persönlichkeit besser zum Ausdruck als der Titel eines seiner Bü­ cher: Eloge de la résistance à l’air du temps (Lob des Widerstands gegen den Geist der Zeit, 1999). Bensaïd hat dennoch nie eine „The­ ologie“ der Revolution betrieben. Hie­ rin setzte er wiederum die radikale Tra­ dition in Frankreich fort – als leiden­ schaftlicher Repräsentant eines ihrer wesentlichen Merkmale, eines gründ­ lichen Säkularismus (wenn nicht Anti­ klerikalismus). Diese Haltung zieht sich durch sein Denken nicht nur zur Reli­ gion, sondern auch zu allen Formen sä­ kularer Theologie (wie Identitätspoli­ tik) sowie zu Einsprengseln von reli­ giösen Bezügen bei linken Autoren (in der Kritik an Denkern wie Alain Badiou und Antonio Negri). Hier ist wiederum der Titel seines letzten größeren Buchs bezeichnend: Eloge de la politique profane (Lob der profanen Politik, 2008). Sein erstes Buch, das er zusammen mit Henri Weber (der später Mitglied der Sozialistischen Partei und Senator wurde) verfasst hat, erschien 1968. Sein Titel, Mai 68, une répétition générale (Mai 68, eine Generalprobe), spricht Bände über die damalige Stimmungsla­ ge. Die folgenden Schriften waren zu­ inprekorr 460/461 THEORIE meist Interventionen in die französische Politik. Nach seinem Buch zum 200. Jahrestag der Französischen Revoluti­ on veröffentlichte er jedoch eines über Walter Benjamin und ein weiteres über die Figur Jean d’Arc. Diese neuen Themenbereiche spie­ gelten die Melancholie wieder, die durch die internationale politische Ver­ schiebung nach 1989 mit den ideolo­ gischen Attacken auf den Marxismus und dem Triumphalismus des globalen neoliberalen Ansturms entstanden war. So trug denn auch eines der späteren Bücher von Bensaïd den Titel Le Pari mélancolique (Die melancholische Wet­ te, 1997). Sein wichtigstes theoretisches Werk, Marx l’intempestif (Der unzeitige Marx) erschien 1995 auf Französisch und 2002 auf Englisch unter dem Titel A Marx for Our Times: Adventures and Misadventures of a Critique. Es bietet eine unkon­ ventionelle Lektüre von Marx und wen­ det sich gegen die von der Zweiten In­ ternationale sowie dem Stalinismus po­ pularisierte positivistische Interpretati­ on. Es kam im selben Jahr heraus wie ein weiteres großes Werk von Daniel, zu einer Zeit, als er sich bereits Aids zuge­ zogen hatte. In diesen Werken zeigt sich erneut seine Statur als öffentlich wirk­ samer Intellektueller. Weil er wusste, dass seine Tage ge­ zählt waren, hat er sich seit seiner Er­ krankung daran begeben, mit einer er­ staunlichen Geschwindigkeit zu schrei­ ben und zu veröffentlichen: in 15 Jahren, von seinem Marx-Buch 1995 bis zu sei­ nem Tod, an die 20 Bücher unterschied­ lichen Umfangs und zu unterschied­ lichen Themen. Zugleich stellte er sich dem Tod sehr tapfer entgegen – ein Re­ volutionär, der bis zu seinem allerletzten Atemzug standhaft gekämpft hat. Gilbert Achcar stammt aus dem Libanon und lehrt an der School of Oriental and African Stu­ dies in London Politische Wissenschaft. Zu­ letzt veröffentlichte er Les arabes et la Shoah – La guerre israélo-arabe des récits (Arles u. Pa­ ris 2009). Auf Deutsch erschien von ihm zuletzt Der 33-Tage-Krieg – Israels Krieg gegen die Hisbollah im Libanon und seine Folgen (Ham­ burg 2007). Dieser Text erschien in der Februarausgabe der Monatszeitschrift der britischen SWP Socialist Review. Eine kürzere erste Fassung erschien in Socialist Worker, der Wochenzeitung der USamerikanischen ISO. Übersetzung: Wilfried Dubois inprekorr 460/461 Die Krise jenseits der Krise Interview mit Daniel Bensaïd Dieses Gespräch wurde im Sommer 2009 von Jacques Pelletier und François Cyr für die in Montréal, Québec, erscheinende Zeitschrift Nouveaux Cahiers du socialisme (Neue Hefte des Sozialismus) geführt und ist in der zweiten Ausgabe vom Herbst 2009, die dem Thema „Ihre Krise“ gewidmet ist, veröffentlicht worden1. Nouveaux Cahiers du socialisme: Wir sollten uns bemühen, ganz knapp den Charakter dieser Krise zu bestimmen, um darauf vorauszuschauen, welches Ausmaß sie einnehmen und welche Tragweite sie bekommen wird, vor allem aber, um den schmerzhaften Krisenlösungen entgegenzutreten, an die der Kapitalismus uns gewöhnt hat. Es geht nicht um Haarspaltereien, sondern um ein Verstehen im Blick auf das Handeln. Eine adäquate Analyse dieser Krise ist unerlässlich, meinen wir, um einen strategischen Rahmen oder ein Sofortprogramm auszuarbeiten, wie es beispielsweise die Neue Antikapitalistische Partei (NPA) vorschlägt. Um mit der Diskussion zu beginnen, wollen wir uns an eine Typologie wagen. Zunächst einmal lässt sich ein Lager der Leugnung ausmachen, von dem das Problem auf eine Frage der Kaufkraft reduziert wird, was mit der Überschuldung der Mittelklassen vor allem in den Vereinigten Staaten verbunden sei. Da sie nicht in der Lage sind, mehr zu konsumieren und die Plastikkreditkarten heiß laufen zu lassen, werden sie für das, was passiert, verantwortlich gemacht, und ihr fehlendes Vertrauen in die Zukunft wird getadelt. Fehlendes Vertrauen, das ist für diese Analyse das Schlüsselwort der Krise. Andere versuchen die Krise durch Fahrlässigkeit bzw. die Unehrlichkeit bestimmter hochgestellter Personen im Finanzsektor zu erklären, die jeglichen Kontakt mit der Wirklichkeit verloren hätten. In diesem Zusammenhang heißt aus der Krise herauskommen dann ein Großreinemachen, wenn auch sehr partiell und ausgewählt, im Verbund mit einer adäquaten Regulierung, mit der man die wildesten Aspekte der Spekulation im Rahmen halten bzw. die Kontrolle der öffentlichen Hand verstärken 1 http://www.cahiersdusocialisme.org/ will. „We are all socialist now“, hat Newsweek im Februar 2009 getitelt. Und dann gibt es im Lager der globalisierungskritischen Linken offensichtlich Bemühungen, die Krise mit einer vertieften Analyse zu begreifen. Diese Krise ist nicht die erste und, leider, auch nicht die letzte: Sie haftet dem Kapitalismus an. Im Gegensatz zu den klassischen Überproduktionskrisen ist die hier aber aus einem Abgrund, dessen Boden nicht zu erblicken ist, zwischen der Realökonomie, in der die Güter und Dienstleistungen produziert werden, einerseits und der spekulativen Betätigung andererseits heraufgestiegen, die vierzigmal mehr Geld produziert, ohne dass ein Fitzelchen realer Wert produziert würde: Der wäre ja das Resultat von Arbeit. Das ist die These von der Kasinowirtschaft und ihrer neuen Herren, der Spekulanten, die eine Art von Banditentum im großen Maßstab praktizieren. „Croony capitalism“ hat Samir Amin gesagt. Was ist von all dem zu halten? Daniel Bensaïd: Man sucht oft die gegenwärtige Krise mit der groß­ en Krise zu vergleichen, die als Refe­ renz dient, der von 1929. Die Unter­ schiede sind ebenso wichtig wie das, was sich ähnelt. Wahrscheinlich ist die gegenwärtige Krise viel schwerer. Sie ist grundlegend eine Krise des Wertge­ setzes, also eine Krise der Maßlosig­ keit oder des Fehlmaßes einer Welt, ei­ ner kapitalistischen Welt, in der Reich­ tum und soziale Beziehungen einzig und allen mit dem Wertmaßstab der ab­ strakten Arbeitszeit gemessen werden. Doch ist dieses Maß, wie Marx es in den Manuskripten von 1857/582 ange­ kündigt hat, immer „miserabler“ und ir­ rational geworden, im Zuge einer immer weiter vorangetriebenen Sozialisierung 2 Bekannter als „Grundrisse der Kritik der poli­ tischen Ökonomie“; siehe Marx Engels Werke, Bd. 42, S. 601. 49 THEORIE (einer Kooperation) der Arbeit und ei­ ner immer stärkeren Integration von gei­ stiger Arbeit und Handarbeit. Das bele­ gen unter anderem die sinnlosen Krite­ rien, die zur Quantifizierung des Nicht­ quantifizierbaren in den Bereichen Bil­ dung und Gesundheit ausgearbeitet wor­ den sind. Mit ihrer doppelten Dimension, der sozialen und der ökologischen, hat die­ se Krise also im Zentrum des Systems selber ihre Quelle. Dass das Wertgesetz „miserabel“ ist, tritt dabei in der Tat durch das Anschwellen von neuen For­ men der Armut und sozialen Ausgren­ zung zu Tage: Warum bringen die er­ staunlichen Produktivitätsgewinne im­ mer mehr Arbeitslosigkeit und Preka­ rität hervor, anstatt dass sie in mehr „Freizeit“ umgesetzt werden? In wie­ weit lassen sich die Schäden, die den natürlichen Bedingungen der Repro­ duktion der menschlichen Gattung (Abholzung, Verschmutzung der Oze­ ane, Lagerung der atomaren Abfälle, Klimaänderungen) zugefügt werden, in „Realzeit“ (Börsenkurse!) und in Geld­ beträgen bewerten? Die Krise ist von Anfang an welt­ weit oder global, in dem Maße wie das kapitalistische System die Reserven für eine Expansion nach außen, über die sich Rosa Luxemburg in der Akkumulation des Kapitals geäußert hat, prak­ tisch erschöpft hat und es seine Schran­ ken weiter hinaus geschoben hat, in­ dem es geographische Zonen oder Pro­ duktionsformen, die ihm noch nicht zur Verfügung gestanden hatten, in die Wa­ renproduktion integriert hat. Während der Krise der dreißiger Jahre mach­ ten die ländliche Bevölkerung und die landwirtschaftliche Produktion in den wichtigsten kapitalistischen Ländern noch über 30 % aus, so dass die Fa­ milien- und die Dorfsolidarität soziale Puffer darstellen konnten. Jetzt stellen die Lohnabhängigen etwa 90 % der er­ werbstätigen Bevölkerung, so dass die Krise, mit den Entlassungen und Be­ triebsverlagerungen, einen Schnee­ balleffekt hat. In Frankreich ist es so­ weit, dass die Regierung die Rolle lobt, die die „automatischen Stabilisatoren“, wie sie es inzwischen verschämt nennt, (noch!) spielen, also im Klartext jenes Systems sozialer Sicherung, dass sie so eifrig beseitigen wollte. Und schließlich ist diese Krise, so könnte man sagen, auch eine Krise der Krisenlösungen. Man spricht in den 50 Gazetten viel von New Deal oder einer Neuauflage des Keynesianismus. Dabei vergisst man ein bisschen arg schnell, dass Roosevelts New Deal 1934 ei­ nen kurzen Aufschwung möglich ge­ macht hat (unter dem Druck der groß­ en Arbeiterkämpfe), bevor es 1937/38 wieder einen heftigen Abschwung gab; die Krise ist erst mit der massiven Aus­ weitung der Rüstungsindustrie und der Kriegswirtschaft wirklich überwunden worden. Vor allem aber vergisst man dabei, dass die keynesianische Poli­ tik in der Nachkriegszeit nicht nur in einem „circulus virtuosus“ (einer Auf­ wärtsspirale) von Produktivität, Löh­ nen und Massenkonsum bestanden hat, sondern ein ganzes institutionelles Ge­ füge (Arbeitsrecht, öffentliche Dien­ ste, Währungspolitik) zur Vorausset­ zung hat, das innerhalb von nationalen Rahmen errichtet worden ist, die in­ zwischen durch die Globalisierung und die Deregulierung eingerissen worden sind. Um eine Neuauflage des Keynesi­ anismus auf europäischer Ebene anzu­ gehen, wie es die sozialdemokratischen Parteien in ihren Wahlreden gelegent­ lich ankündigen, wäre eine Kehrtwen­ de bei der europäischen Einigung um 180 Grad notwendig gegenüber dem, was sie seit einem Vierteljahrhundert mitgetragen haben: Es müsste wie­ der eine politische Kontrolle über die Geldpolitik geben (die jetzt der Zen­ tralbank überlassen worden ist), einen Umbau der öffentlichen Dienste und der Systeme zur sozialen Sicherung, die 20 Jahre lang von rechten und lin­ ken Regierungen systematisch zerstört worden sind, die europäischen Verträ­ ge, die für freien Kapitalfluss sorgen, müssten aufgekündigt werden usf. Wenn man den Charakter und das Ausmaß der Krise so einschätzt, so er­ misst man, wie dürftig die Erklärungen und die Lösungen sind, die im allge­ meinen angeboten werden, ob es sich um die so genannte „Unterkonsumti­ onsthese“ handelt oder um die These, bei der man sich auf die Unmoral der Banker bezieht. Die erste greift mehr oder minder die Theorie von Jean-Bap­ tiste Say über das angenommene spon­ tane Gleichgewicht von Produktion und Konsum auf, die in einer Tausch­ wirtschaft gelten kann, nicht aber in ei­ ner kapitalistischen Wirtschaft, in der Produktion und Konsum zeitlich und räumlich voneinander abgetrennt sind. Es ist inzwischen festgestellt wor­ den, dass infolge der neoliberalen Kon­ terreformen 10 % der Wertschöpfung aus den Taschen der abhängig Beschäf­ tigten in die der Kapitalisten (der Akti­ onäre usw.) geflossen sind, so dass die „Kaufkraft“ nicht mit dem Zugewinn an Produktivität Schritt gehalten hat. Der Konsum ist also mit massiver Zu­ hilfenahme von Krediten und der Ver­ schuldung gestützt worden, und das hat es möglich gemacht, eine latente Über­ produktionskrise hinauszuschieben. Nachdem sie durch das Platzen der Spekulationsblase angekündigt worden ist, tritt sie jetzt in den Schlüsselbran­ chen Bauwirtschaft und Automobilin­ dustrie in Erscheinung. Diese neoliberale Phase ist auch durch eine spürbare Zunahme der Un­ gleichheiten gekennzeichnet, die si­ cherlich moralisch schockierend (die goldenen Fallschirme, außerordent­ lich hohe Bonuszahlungen, wunder­ same Erträge in Höhe von 15 % bei einem durchschnittlichen Wachstum unter 5 %!), aber nichtsdestoweniger funktional ist: Diese deutliche Zunah­ me hat es ermöglicht, das Schrumpfen des Konsums des größten Teils der Be­ völkerung zum Teil durch eine Auswei­ tung des Luxuskonsumsektors zu kom­ pensieren. Wenn jetzt die Unternehmer der Raffgier beschuldigt werden, dient das der Ablenkung. Damit wird insbe­ sondere die politische Verantwortung der rechten und linken Regierungen verschleiert. Die Deregulierung ist kein ökonomisches Phänomen, das so schicksalhaft ist wie die so genannten Naturkatastrophen (bei denen das, ne­ benbei bemerkt, auch nicht immer der Fall ist): Es waren über 20 Jahre hin­ weg gesetzliche Maßnahmen notwen­ dig, um die Börsen zu deregulieren, die Kapitalflüsse zu liberalisieren, die öf­ fentlichen Dienste zu privatisieren, die Patentierung des Wissens und von Le­ bendigem voranzutreiben usf. Der Ausdruck „Kasinowirtschaft“ bezeichnet also nur ein Phänomen, das Marx bereits in den Theorien über den Mehrwert und im Kapital beschrieben hat, nämlich das des Geldfetischismus, des „fiktiven Kapitals“, das Wunder vom Geld, das angeblich durch Selbst­ vermehrung Geld machen würde, oh­ ne ein Zutun von Produktion und Zir­ kulation. Die Erträge der Investitionen in Höhe von 15 % bei einem Wachs­ tum von 4 oder 5 % waren noch wun­ derbarer als das biblische Wunder von inprekorr 460/461 THEORIE der Vermehrung der Brote. Das konn­ te nicht ewig so weitergehen; es war zwar nicht möglich, das Datum und den Auslöser der Krise vorauszusehen, aber man musste kein Diplom von der London School of Economics haben, um zu verstehen, dass sie unausweich­ lich war. Was die Fabel von der Bekehrung des Kapitalismus zur Moral angeht, so liegt auf der Hand, wie nichtig sie ist. Dadurch dass er die Wegwerf-Be­ schäftigten als „Variablen der Anpas­ sung“ behandelt hat, hat der Kapitalis­ mus die Menschen stets als Mittel und nicht als Zweck behandelt. Die utilita­ ristische Philosophie gibt das offen zu, und Marx hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, als der auf den ersten Seiten des Kapitals geschrieben hat, dass an der Pforte der Hölle der Aus­ beutung geschrieben steht „No entry, except for business.“3 Kein Eintritt, geschäftliche Angelegenheiten ausge­ nommen. Anders ausgedrückt: Moral bitte am Eingang abgeben. Nun zu einer schwierigen, wenngleich alten Frage, die auf die Diskussion über Reform oder revolutionären Bruch verweist, doch in einem neuen Kontext, nämlich dem des triumphierenden Neoliberalismus und dessen, was wir Sozialismus des 21. Jahrhunderts nennen. Ist der Kapitalismus 400 Jahre nach seinem Entstehen am Ende seines Wegs, und ist er nur noch stark wegen der Schwäche und der Uneinigkeit derjenigen, die ihn in Frage stellen? Kann man sich einen Weg aus der Krise heraus vorstellen, der etwas anderes wäre als Krieg oder ein Faschismus in einer Version des 21. Jahrhunderts? Kann man sich eine Art von Neokeynesianismus vorstellen, der mit der Kraft der sozialen und ökologischen Kämpfe durchgesetzt wird und sich auf ein breites Bündnis stützen könnte, das aus allen Bereichen der Zivilgesellschaft hervorgeht? Diese Frage ist weder theoretisch noch spekulativ. Aus der Antwort, die man darauf gibt, leiten sich unterschiedliche programmatische und organisatorische Vorstellungen der verschiedenen Strömungen her, die sich auf den Sozialis3 Eigentlich: „No admittance except on busi­ ness.“ (Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, MEW, Bd. 23, S. 189, 4. Kapitel, Unterkapitel „3. Kauf und Verkauf der Arbeitskraft“.) inprekorr 460/461 mus berufen. Direkter formuliert: Soll man politisch dafür kämpfen, dass die Widerstandskräfte sich gegen die neoliberalen „Übertreibungen“ oder gegen den Kapitalismus zusammenschließen und in Bewegung setzen? Eine schwierige Frage … Ich möch­ te von Anfang an die Idee von einer Endkrise des Kapitalismus verwerfen, wie sie die Zusammenbruchtheoretiker wie Eugen Varga in der „dritten Perio­ de der Irrtümer der III. Internationale“ vertreten haben. Wahrscheinlich gibt es einen Ausweg, das Problem ist, zu welchem Preis und auf wessen Rücken. Der Preis für den Ausweg aus der Kri­ se von 1929 war für die Unterdrückten und Ausgebeuteten exorbitant hoch: Faschismus, ein Weltkrieg und die zeit­ weilige Konsolidierung eines schein­ bar siegreichen Stalinismus. Man muss sich aber davor hüten, die Geschichte in Form einer Wiederholung des glei­ chen zu denken, das führt zum Risiko, für das, was sie an noch nicht da Ge­ wesenem und Überraschendem bringt, blind zu bleiben. Niemand weiß, was heutzutage die Kombination der öko­ nomischen, sozialen und ökologischen Krisen ergeben kann. Wenn der Kapitalismus als vorherr­ schendes System – ihr habt ja daran er­ innert – erst vier oder fünf Jahrhun­ derte alt ist, so ist es hingegen gewiss, dass er nicht ewig ist. Was kann es jen­ seits von ihm geben? Das hängt, so hät­ te Heraklit gesagt, von der Notwendig­ keit und vom Kampf ab. Welches Über­ schreiten des Kapitalismus ist vorstell­ bar? Das ist keine Frage eines Mo­ dells oder eines utopischen Fernziels. Es geht darum, in den gegenwärtigen Kämpfen, in der „realen Bewegung“, die der Tendenz nach auf Beseitigung der bestehenden Ordnung aus ist, den Keim des Möglichen aufzuspüren. Für mich befindet sich dieser Keim in der Gegnerschaft einer solidarischen Logik (des Gemeinwohls, des öffentlichen Diensts, der gesellschaftlichen Aneig­ nung) zur Konkurrenzlogik des pri­ vaten Eigentums und des egoistischen Kalküls. Das habe ich unter anderem in [dem Buch] Les Dépossédés4 zusammenfassend dargestellt. Die Frage (und die Zweifel) beziehen sich in Wirklichkeit eher darauf, was mit den Kräften ist, die da- zu imstande wären, diese große soziale Transformation zu vollbringen. Anfang der sechziger Jahre hat Herbert Marcuse in Der eindimensionale Mensch die Frage aufgeworfen, ob es noch möglich ist, den Teufelskreis der Herr­ schaft zu durchbrechen. Er stellte sie in Bezug auf die Konsumgesellschaft, die Überfluss, Befriedigung der Bedürf­ nisse, restlose Integration der subver­ siven Fähigkeiten des Proletariats zu verheißen schien. Seine Suche nach so­ zialen Ersatz-Subjekten (die Studieren­ den) ist gescheitert. Vom Fetischismus zum Spektakel (Guy Debord, 1967), vom Spektakel zum Trugbild (Jean Baudrillard, 1981) ist der Teufelskreis, so scheint es, unaufhörlich perfekter und geschlossener geworden. Aller­ dings sind wir jetzt weit weg von den Mythen des Überflusses, der in Reich­ weite sei, und die sozialen Kämpfe, auch der Klassenkampf, nehmen wie­ der an Intensität zu. Die neue Frage ist, wie ich es sehe, die nach dem Aufbau eines neuen hegemonialen historischen Blocks ausgehend von der nicht zu be­ seitigende Pluralität der Widersprüche und Herrschaftsformen und der nicht zu beseitigenden Pluralität (und Un­ vereinbarkeit) der verfügbaren Zeit für verschiedene Lebensbereiche5. Die Weltsozialforen geben in die­ ser Hinsicht wertvolle Hinweise. Was bewirkt es, dass so unterschiedliche Bewegungen wie Industriegewerk­ schaften, feministische, ökologische, kulturelle Bewegungen etc. dort zu­ sammenkommen? Der große Vereini­ ger ist meiner Ansicht nach das Ka­ pital selber: Seine globalisierte syste­ mische Logik generiert das Bedürf­ nis nach anti-systemischen Antworten. All dies läuft aber auf eine andere Fra­ ge hinaus, die den Rahmen dieses Ge­ sprächs sprengt, die der Verknüpfung von sozialen und politischen Kämpfen, von sozialen Bewegungen und Parteien zwischen sozialen Protesten und insti­ tutioneller Repräsentation. Wenn es darum geht – denn das ist die Frage –, ob „für den post-liberalen Kapitalismus ein Leben möglich ist“, so wäre die Antwort: Wahrscheinlich ja, aber welches Leben? Vor der Pro­ klamation, dass eine andere Welt mög­ lich ist, wie wir es auf den Sozialfo­ ren getan haben, muss man sich zuerst 4 Daniel Bensaïd, Les dépossédés. Karl Marx, les voleurs de bois et le droit des pauvres, Pa­ ris: La fabrique, 2007. 5 Im Original heißt es temps sociaux, das ist u. A. die Zeit für. Schlaf, Arbeit, Haushalt, Er­ ziehung, Erholung usw. [Anm. d. Red.] 51 THEORIE dessen vergewissern, dass sie notwen­ dig ist. Es geht also darum, sie möglich zu machen. Und diese andere Welt darf sich nicht damit begnügen, die Über­ treibungen und Missbräuche des Ka­ pitalismus (die in sein Betriebssystem eingeschrieben sind) zu korrigieren. Sie macht es erforderlich, dass die tod­ bringende Logik des Kapitalismus zer­ brochen wird. Die Hypothese des notwendigen revolutionären Bruchs mit dem Kapitalismus bekommt sicherlich Kraft und Substanz durch die spektakuläre Unfähigkeit der herrschenden politischen Klassen, zufrieden stellende Erklärungen für und Antworten auf die Krise zu liefern. Im Wesentlichen sind es die gleichen, die sich nun als Feuerwehrleute aufführen, nachdem sie den Brand gelegt haben. Diese Unfähigkeit finden wir auf der Ebene der Ideen aber auch bei den Intellektuellen der Kreise, die in den letzten 30 Jahren die Welt in der Art von Friedman erklärt haben. Bei ihnen ist ebenfalls nichts als Leere. Es ist zu merken, dass sie nicht in der Lage sind, neue Vorstellungen zu formulieren, es sei denn einen grünen Kapitalismus mit vagen und ungenauen Umrissen. Ihre Antworten sind ansonsten oft unbedeutend und bestehen in Schuldzuweisungen… Die Kämpfe der Unterklassen sind hart und vorwiegend defensiv. Mit dem Rücken zur Wand versucht man, dem Verlust von Arbeitsplätzen, der Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, der Teuerung entgegenzutreten. Im wesentlichen geht es darum, die Schäden der Krise in den Griff zu bekommen und zu begrenzen. Wie ist diese Kluft zwischen der Härte der Konfrontationen und der Begrenztheit sowohl der Ziele wie der Ergebnisse zu erklären, die so eindeutig von den großen Kämpfen der keynesianischen Periode absticht? Wie ist die Inflexibilität der herrschenden politischen Klassen zu erklären, die nicht minder eindeutig von einer gewissen Plastizität des gestrigen Kapitalismus absticht? Die gebieterischen Vorgaben der globalisierten Konkurrenz erklären nicht alles; es gibt sicher noch andere Faktoren – welche sind das? Außerdem nährt die sehr reale Gefährdung, die die Beeinträchtigung unserer Umwelt für die Menschheit bedeutet, ein tief sitzendes Gefühl der Dringlichkeit, vor allem unter den Jugendlichen. Kön52 nen wir uns letzten Endes den Luxus einer Mäßigung noch leisten? Ist die radikale Perspektive nicht zu einer gebieterischen Notwendigkeit geworden, auf die sich unser Recht auf Revolte gründet? Dass die Kämpfe der Bevölkerung, die vielfach hart und lang geführt wer­ den, einen defensiven Charakter haben, ist nicht erstaunlich. Das 20. Jahrhun­ dert ist mit einer historischen Nieder­ lage der Hoffnungen auf Emanzipati­ on zu Ende gegangen. Es geht weder ausschließlich noch hauptsächlich, wie man manchmal zu glauben geneigt ist, um eine ideologische Niederlage; näm­ lich die Diskreditierung des kommu­ nistischen Projekts in Anbetracht des Scheiterns des real nicht existierenden Sozialismus, wie er von dem bürokra­ tischen Despotismus verkörpert wor­ den ist. Es geht vor allem um eine so­ ziale Niederlage, die mit der Verdop­ pelung der Arbeitskräfte in weniger als 20 Jahren, die auf einem globalisierten und deregulierten Weltmarkt der Arbeit in Konkurrenz miteinander zur Ver­ fügung stehen, gut auf den Punkt ge­ bracht wird. Dieser Umstand wirkt sich heftig auf die gesellschaftlichen Kräf­ teverhältnisse auf internationaler Ebe­ ne aus, bis hin zu den Widerständen in China, in Osteuropa, in Russland, die sich erst langsam entwickeln und in neuer gewerkschaftlicher und poli­ tischer Organisierung zum Ausdruck kommen. Das wird schließlich gesche­ hen, aber es hat ein Wettlauf begonnen, und dabei können die Katastrophen des 21. Jahrhunderts, die sozialen und die ökologischen Katastrophen, leider vorn liegen. Zugleich löst die einschneidende Krise natürlich Reaktionen aus, die zwar defensiv sind (um klar zu ma­ chen, welch ein Weg rückwärts zurück­ gelegt worden ist, genügt es, daran zu erinnern, dass ein Kongress der fran­ zösischen Richtergewerkschaft [Syn­ dicat de la Magistrature] 1985 für die Beseitigung der Gefängnisse gestimmt hat!), doch radikal und gelegentlich ge­ waltförmig. Als sei eine Menge abhän­ gig Beschäftigter hin und her geris­ sen zwischen Angst (legitimer Angst vor der Arbeitslosigkeit) und Wut we­ gen so viel Ungerechtigkeit und Un­ gleichheit. Die Frage, wer oder was, die Angst oder die Wut, die Oberhand behalten wird, ist nicht entschieden. Wenn es die Angst ist, wird es ein all­ gemeines Rette-sich-wer-kann geben, den Krieg aller gegen alle und die Zu­ nahme von Rassismus und Fremden­ feindlichkeit, wofür bereits Vorzeichen zu erkennen sind. Selbstverständlich ist der Verlust des Vertrauens in alternative Lösungen oder „Modelle“ auch ein schweres Handicap. Das kommt in der Versu­ chung zum Ausdruck, sich auf einen falschen, minimalistischen Realis­ mus und auf eine Politik des kleineren Übels zurückzuziehen, aus der sich die großen Enttäuschungen und die großen Entmutigungen speisen. Es sind aber bereits Anzeichen für ein erneutes po­ litisches Engagement, sicherlich bei Minderheiten, doch auch bei den Jün­ geren. Nach dem, was ich das utopische Moment von Ende der neunziger Jah­ re und Anfang dieses Jahrzehnts nen­ nen möchte, das dadurch gekennzeich­ net war, dass man die „neuen sozialen Bewegungen“, die als von Natur aus einwandfrei betrachtet wurden, und die politischen Parteien, die als altbacken galten, einander entgegengestellt hat, belegt die Krise, dass die Selbstgenüg­ samkeit der sozialen Bewegungen ei­ ne Illusion ist und dass es notwendig ist, in Anbetracht der Unnachgiebigkeit der herrschenden Klassen wieder eine politische Perspektive herauszubilden. Denn, wie ihr sagt, sie sind in der Tat unnachgiebig. Wegen der Krise tun sie so, als ergriffen sie kosmetische Maßnahmen, um den Kapitalismus moralischer zu gestalten. Wie wenige konkrete Entscheidungen aber bei dem Gipfel der G 20 [im April 2009 in Lon­ don] herausgekommen sind, zeigt, dass die Grenzen der Absichtserklärungen rasch erreicht sind. Während der Krise geht die liberale Konterreform auf den Gebieten Bildung, Gesundheit, Arbeits­ recht usf. weiter. Warum diese Unnach­ giebigkeit? Vielleicht weil die Strate­ gen der herrschenden Klassen trotz der Diskurse von einer „Neubegründung des Kapitalismus“ oder einem „Green New Deal“ sehr gut wissen, dass ei­ ne Rückkehr zu keynesianischer Poli­ tik (unter der Voraussetzung, das ginge im Rahmen einer globalisierten Öko­ nomie) heißen würde, dass man wie­ der vor den Widersprüchen steht, die man mit der liberalen Konterreform angehen wollte. Auf ihre Weise stellen sie ein starkes Klassenbewusstsein un­ ter Beweis: Der Weg aus der Krise he­ raus bedeutet für sie, dass es notwendig inprekorr 460/461 THEORIE ist, den beherrschten Klassen eine noch schwerere historische Niederlage bei­ zubringen und mit dem, was von den sozialen Errungenschaften der vorher­ gehenden Periode noch geblieben ist, Schluss zu machen. In Anbetracht dieses „reinen Kapi­ talismus“ (wie Michel Husson es aus­ gedrückt hat6) ist ein reiner Antikapita­ lismus notwendig, um die drohende so­ ziale und ökologische Katastrophe ab­ zuwenden. Seit der großen Krisenperiode der Jahre 1910 bis 1950 ist es den Linken mehr oder minder gelungen, die Zuckungen des Kapitalismus richtig zu „lesen“. Es hat natürlich Ausnahmen gegeben, wie das Moment von Petrograd 1917 oder das vom Yenan 19407. Aber meistens hat die Unfähigkeit der Linken, die Krisen zu denken, zu schweren Fehlern geführt: sei es, dass sie zu schnell voran wollte und zu optimistisch war (Berlin 1923), sei es, und das war in den meisten Fällen so, dass sie sich nicht schnell und weit genug in Bewegung gesetzt hat. Man kann sich rechtfertigen, indem man sagt, die Geschichte ist nicht lesbar wie eine Kristallkugel, und der Marxismus ist nicht ein Kompass, der nicht falsch gehen kann, oder eine Software, aber reicht das aus? Auf der Linken gibt es ein dramatisches Pendeln zwischen einer abwartenden Haltung, die von Ökonomismus geprägt ist, einer Art von Fatalismus auf der einen und einem Ultravoluntarismus auf der anderen Seite, als sei alles möglich und das sofort. Diese beiden Haltungen haben übrigens eine gemeinsame Grundlage, einen fast religiösen Glauben an den „Fortschritt“, an das unvermeidliche Heraufziehen des Sozialismus … Du begreifst die Politik als einen Knoten, verflochten mit Weggabelungen und Möglichkeiten, leider auch mit Rückschlägen, was im Verhältnis zu der ökonomistischen Sicht der Geschichte einen Schritt nach vorn darstellt. Ist es möglich, noch ein wenig weiter zu gehen? Was wäre beispielsweise zu tun, um die Isolation ei6 Michel Husson, Un pur capitalisme, Lausan­ ne: Editions Page deux, 2008; dt. Ausg.: Kapitalismus pur. Deregulierung, Finanzkrise und weltweite Rezession. Eine marxistische Analy­ se, Köln: Neuer ISP Verlag, 2009. 7 Yen-an (Yan’an) ist eine Millionenstadt im Norden der Provinz Shaanxi (Nordwestchi­ na); von 1937 bis 1947 politisches und mili­ tärisches Zentrum der kommunistischen Partei unter Führung von Mao Zedong. inprekorr 460/461 ner Schicht von voluntaristischen, begeisterten, vor allem aus Jüngeren bestehenden Schicht von AktivistInnen zu vermeiden, in einer Welt, die weitgehend routinemäßig funktioniert und in einer Art von Schlafwandelei feststeckt, um den berühmten Ausdruck von Hermann Broch8 aufzugreifen? Die „Illusionen des Fortschritts“ sind seit langer Zeit ziemlich stark mitgenommen, mindestens seit einem Büchlein von Georges Sorel, das schon vor 1914 diesen Titel getragen hat. Dann hat es nach dem Ersten Weltkrieg Valéry mit seinen Blicken auf die ge­ genwärtige Welt, den Freud des Unbehagens an der Zivilisation, Benjamins Thesen zum Begriff der Geschich­ te gegeben. Heute wissen wir, unter Zutun der ökologischen Krise, besser denn je, dass die Zivilisationen sterb­ lich sind und dass wir selber eine of­ fene Geschichte ohne Jüngstes Gericht machen. „Was wäre zu tun, um die Isolati­ on einer Schicht von voluntaristischen AktivIstinnen zu vermeiden?“ fragt ihr. Wenn wir das wüssten! Das Eigentüm­ liche (und die Größe) einer profanen Politik, ohne göttliche und ohne wis­ senschaftliche Garantie, besteht eben in dem „Arbeiten für das Ungewisse“ (wie eine alte Formulierung des Kir­ chenvaters Augustinus lautet). Das re­ volutionäre Engagement hat unver­ meidlich die Form einer Wette, gewiss einer durchdachten Wette, so luzid wie möglich, es gibt aber keine exakte Wis­ senschaft der Revolutionen. Um die Welt zu verändern, was dringender ist denn je, sind wir zur Bastelei verurteilt, ohne Gewissheit des Gelingens, aber mit der Gewissheit, dass wir, wenn wir es nicht versuchen, dazu verurteilt sind, vor Scham zu sterben, noch bevor wir von einer eventuellen atomaren Kata­ strophe oder einem Klimadesaster ver­ nichtet werden. Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Friedrich Dorn. 8 Hermann Broch (1886–1951), österreichischer Textilfabrikant und ab 1928 Schriftsteller, ver­ öffentlichte zwischen 1930 und 1932 die Ro­ mantrilogie Die Schlafwandler, die den Verfall der bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland und ihrer Werte darstellt. ABOBESTELLUNG Ich bestelle ☐ Jahresabo (6 Doppelhefte) € 20 ☐ Solidarabo (ab € 30) € .... ☐ Sozialabo € 12 ☐ Probeabo (3 Doppelhefte) € 10 ☐ Auslandsabo € 40 Name, Vorname Straße, Hausnummer PLZ, Ort Datum, Unterschrift Überweisung an Neuer Kurs GmbH, Postbank Frankfurt/M. (BLZ 500 100 60), Kontonummerr.: 365 84 604 Zahlung per Bankeinzug Hiermit erteile ich bis auf Widerruf die Einzugsermächtigung für mein Bank-/Postgirokonto bei in Konto-Nr. BLZ Datum, Unterschrift Das Abonnement (außer Geschenkabo) verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn es nicht vier Wochen vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Bestellung an: Inprekorr, Hirtenstaller Weg 34, 25761 Büsum oder per E-Mail an: [email protected] 53 REGISTER 2009 Register nach Ländern Titel Antillen Ein historischer Sieg auf den Antillen AutorIn MoHeft Seite nat 450 Argentinien Kirchners Stern verblasst, neue Kräfte entstehen Guillermo Pacagnini 446 Brasilien Internationale Konferenz der antikapitalistischen Linken in Belém François Sabado 450 China Kann China das kapitalistische Jean Sanuk System retten? ArbeiterInnen als verfügbare Mas- Au Loong-yu se – Chinesische Beschäftigung im wirtschaftlichen Abschwung Europa Ein antikapitalistischer Pol entsteht Jan Malewski „Nicht die Völker und ArbeiterInnen Erklärung der sollen für die Krise bezahlen, Konferenz der sondern die Kapitalisten!“ europäischen antikapitalistischen Linken Der Neoliberalismus, flankiert von François Sader populistischen Rechten bado Frankreich Auf dem Weg zu einer Neuen Pierre Rousset Antikapitalistischen Partei Die Gründung der NPA Ursi Urech Resolution zu den Wahlen zum NPA Europaparlament 2009 Neue Antikapitalistische Partei – Guillaume ein vielversprechender Anfang Liégard Vierte Internationale: Beschluss zu Frankreich Frankreich: Die „Ligue“ und die Par- François Duval tei – eine alte Debatte Griechenland Ursachen und Dynamik der Revolte OKDE – Spartakos Erfolg für die revolutionäre Linke Tassos Anastassiadis Großbritannien Im Fegefeuer der Eitelkeiten Phil Hearse Honduras Die Bevölkerung leistet Widerstand Erklärung des gegen die Oligarchie und den Büros der IV. Imperialismus Internationale Indonesien Indonesien: Wahljahr Iran Krise des Regimes und Mobilisierungen der Bevölkerung Unser Platz ist an der Seite des iranischen Volkes! Israel Der Überfall Israels auf Gaza aus historischer Sicht Italien Eine „rückgratlose Linke“ vor den Europawahlen 54 33 34 4 5 1 5 Lateinamerika Argumente für den ZusammenEric Toussaint schluss der Länder Lateinamerikas und die (partielle) Abkopplung vom kapitalistischen Weltmarkt Malaysia Zwischen Wandel und politischer Danielle Sabaï Erstarrung Marokko Marokko: Resolution gegen die Repression Mexiko Erklärung der Revolutionären Ar- beiterpartei (PRT) zur Schweinegrippe-Epidemie in Mexiko 448 20 3 456 34 11 Pakistan Aufruf zur Hilfe im Kampf gegen die Tariq Ali, Farooq Taliban und die Operationen des Tariq pakistanischen Militärs 448 450 18 3 3 5 Palästina Eine vorbereitete Aggression Gilbert Achcar Israels selbstgerechte Wut und ihre Ilan Pappe Opfer in Gaza Die „Ausgewogenheit“ der israeli- Michael Warschen Schöngeister schawski Der Überfall Israels auf Gaza aus Julien Salingue historischer Sicht Die Wasserkrise in Gaza Alice Gray Resolution zur israelischen Offensi- Internationales ve gegen Gaza Komitee der IV. Internationale Kritik der Resolution des Interna- Gabriel Lévy tionalen Komitees der IV. Internationale zur israelischen Offensive gegen Gaza vom 23. Februar 2009 452 3 7 446 31 1 448 448 13 15 3 3 450 11 5 450 15 5 450 25 5 448 7 3 450 10 5 454 11 9 454 36 9 Danielle Sabaï 456 31 11 Babak Kia 454 14 9 Erklärung des Büros der IV. Internationale 454 15 9 Julien Salingue 448 3 3 Cinzia Arruzza 452 7 7 Portugal Durchbruch des Linksblocks Alda Sousa Sri Lanka Sri Lanka: Arbeiterorganisationen fordern Waffenstillstand Keine Zukunft ohne eine politische Danielle Sabaï Lösung Ein gnadenloser Krieg hat keine Büro der IV. politische Lösung gebracht Internationale USA Das doppelte Mandat des Barack Obama Solidarity 446 40 1 452 16 7 450 32 5 452 36 7 452 4 7 446 446 3 4 1 1 446 6 1 448 3 3 450 450 16 19 5 5 456 21 11 454 10 9 450 32 5 452 10 7 452 15 7 446 7 1 34 5 37 9 7 11 Heft Seite Monat Venezuela Was wird die dritte Periode der boli- Stalin Perez 450 varianischen Revolution bringen? Borges, Carlos Miranda Ein Jahr nach der Verstaatlichung: Fernando Este454 Sidor probt den Weg der Partiziban, Sébastien pation Brulez Der Umbau des venezolanischen Victor Alvarez R. 456 Produktionsmodells Register nach Themen (Auswahl) Titel AutorIn Buchbesprechung Helmut Dahmer: DIVERGENZEN, Holocaust – Psychoanalyse – Utopia 454 30 9 inprekorr 460/461 REGISTER 2009 Jan Willem Stutje, Rebell zwischen Phil Hearse Traum und Tat. Ernest Mandel (1923-1995) Debatte Die NPA, ein neuer Ansatz zum Aufbau einer antikapitalistischen Partei Leninismus im 21. Jahrhundert? In der Krise des Kapitalismus „Ballast abwerfen“? Frauen Erklärung zur globalen Finanzkrise – eine andere Welt ist nötig und möglich! IV. Internationale Rolle und Aufgaben der IV. Internationale Internationales sozialistisches Sommercamp in Griechenland IV. Internationale: Tagung des Internationalen Komitees Sismos, Sismos – Kommunismos! Revolutionär-Sozialistisches Sommercamp in Griechenland 454 30 9 François Sabado 456 47 11 Gabriel Lévy B. B. 456 22 456 26 11 11 7. internationales 446 48 Treffen des Weltfrauenmarsches 1 450 6 5 Karl Lindt 450 52 5 450 31 5 Karl Lindt 454 52 9 Krise und Linke Europa – die Krise und die antika- François Sabado 454 pitalistische Linke 3 9 454 454 40 47 9 9 Bill Onasch Jean-Michel Krivine Wilfried Dubois 446 452 43 50 1 7 454 49 9 Daniel Tanuro 448 448 39 46 3 3 Beatrice Whitaker Daniel Tanuro 448 50 3 452 19 7 Daniel Tanuro 454 19 9 Michael Löwy 456 3 11 446 446 9 14 1 1 448 27 3 448 29 3 448 52 3 450 37 5 450 45 5 452 43 7 456 38 11 Linke Wohin treibt die radikale Linke? Alex Callinicos Eine Antwort auf Alex Callinicos zu Alan Thornett Respect Nachruf Peter Camejo (1939 – 2008) Hoang Khoa Khoi (1917–2009) Leni Jungclas (1917–2009) Ökologie Bali schon vergessen? II. Internationales Manifest: Die ökosozialistische Erklärung von Belém Internationale ökosozialistische Koordination Bericht über den Klimawandel an das IK der Vierten Internationale Bericht über den Klimawandel an das IK der Vierten Internationale, Teil II Klimawandel: Ein Beitrag zur Debatte Ökonomie Die Folgen der Krise François Sabado Die schlimmste Krise des Kapitalis- Joel Geier mus seit den Dreißigerjahren „New Deal“ und Keynesianismus – Henri Wilno Den Kapitalismus retten Die Hintergründe der Nahrungsmit- Eric Toussaint telkrise Das Weltsozialforum: Wir zahlen Versammlung nicht für die Krise. Die Reichen der sozialen müssen zahlen! Bewegungen Automobilindustrie – ein Zyklus Jean-Claude geht zu Ende Vessillier Krise des Kapitalismus – Protektio- Jim Porter nistischer Sirenengesang Die Wirtschaft in einer krisengeJean-Robert schüttelten Welt Brenner Der Kapitalismus steuert auf eine Michel Husson chaotische Regulierung zu inprekorr 460/461 Theorie Programmatisches Manifest der Antikapitalistischen Linken (Schweiz) Was tun mit Lenins „Was tun?“ Politische Resolution der Delegiertenkonferenz des RSB Zeit, Beschleunigung, Krise und Klimawandel – Eine Annäherung 446 21 1 Michael Meier 446 450 26 21 1 5 Thadeus Pato 456 15 11 die Internationale MoTitel AutorIn Heft Seite nat Erklärung zur globalen Finanzkrise 7. internationales 446 48 1 – eine andere Welt ist nötig und Treffen des möglich! Weltfrauenmarsches Programmatisches Manifest der 446 21 1 Antikapitalistischen Linken (Schweiz) Was tun mit Lenins „Was tun?“ Michael Meier 446 26 1 Politische Resolution der Delegier- 450 21 5 tenkonferenz des RSB Frankreich: Die „Ligue“ und die François Duval 450 25 5 Partei – eine alte Debatte IV. Internationale: Tagung des 450 31 5 Internationalen Komitees Sri Lanka: Arbeiterorganisationen 450 32 5 fordern Waffenstillstand Marokko: Resolution gegen die 450 32 5 Repression Bericht über den Klimawandel an Daniel Tanuro 452 19 7 das IK der Vierten Internationale Bericht über den Klimawandel an Daniel Tanuro 454 19 9 das IK der Vierten Internationale, Teil II Helmut Dahmer: DIVERGENZEN, 454 30 9 Holocaust – Psychoanalyse – Utopia Jan Willem Stutje, Rebell zwischen Phil Hearse 454 30 9 Traum und Tat. Ernest Mandel (1923-1995) Kritik der Resolution des Interna- Gabriel Lévy 456 21 11 tionalen Komitees der IV. Internationale zur israelischen Offensive gegen Gaza vom 23. Februar 2009 Leninismus im 21. Jahrhundert? Gabriel Lévy 456 22 11 In der Krise des Kapitalismus B. B. 456 26 11 „Ballast abwerfen“? Indonesien: Wahljahr Danielle Sabaï 456 31 11 55 Haiti – Solidaritätsappell Das Erdbeben vom 12. Januar in Port-au-Prince hat in erster Linie die einfache Bevölkerung getroffen. Außer den öffentlichen Gebäuden, von denen zahlreiche ein­ gestürzt sind, waren es vorwiegend arme Wohnviertel, die zerstört wurden. Dies überrascht nicht, da hier die baufälligsten und billigsten Behausungen stehen, für die der Staat nie einen Finger gerührt oder sich ernst­ haft um ihren Zustand gekümmert hat. Wir waren im Gegenteil immer von Vertreibung und „Umsiedlung“ bedroht, so dass wir uns noch nicht einmal selbst um die Sanierung unserer eigenen vier Wände hätten küm­ mern können. Uns ArbeiterInnen und einfachen Leuten wurden durch das Beben nicht nur die Arme gebrochen. Während für uns die Situation eine einzige Katastrophe ist , sind etliche Kapitalisten schon wieder dabei, ihre Beschäf­ tigten zurück zur Arbeit in die einsturzgefährdeten Fa­ briken zu schicken; weigern sich die Besitzer der Super­ märkte, ihre Waren kostenlos zu verteilen und kassieren stattdessen überhöhte Preise; kann man überall auf der Welt sehen, wie sich der Staat davongestohlen hat und durch Unfähigkeit und Inkompetenz glänzt, auch wenn er ohnehin nichts als stehlen und betrügen kann und stets auf Seiten der Großgrundbesitzer, Bourgeois und multi­ nationalen Konzerne steht; unternimmt die Polizei, die angeblich „schützen und dienen“ soll, nichts gegen die katastrophalen Zustände oder gegen Gangs und Plünde­ rungen – sie ist nur dazu da, das Volk zu unterdrücken – und profitieren die imperialistischen Mächte noch von den Hilfsaktionen, indem sie sie in unverhüllter Dreistig­ keit zur weiteren Festigung ihrer Herrschaft nutzen und uns nur noch weiter entmündigen. Es gibt aber auch fortschrittliche Ansätze, die sich un­ ter Druck entwickelt haben und ein Minimum an Koor­ dination der betroffenen Regionen ermöglichen. Die da­ bei entstandenen Bevölkerungskomitees sind unentwegt um Hilfe bemüht, hingegen mangelt es hinten und vorn an Hilfsmitteln. Das Erdbeben hat uns nicht nur Zer­ störung gebracht, sondern wir dürfen uns nicht einmal selbst helfen und werden komplett überrollt. Auch wenn die meisten Kader und Mitglieder von BATAY OUVRI­ YE überlebt haben, so haben doch etliche ihre Familie zum Teil verloren, ihr Zuhause und das wenige, das sie hatten. Andere sind verletzt und verstümmelt und – als wäre es nicht schon schlimm genug, unsere Toten begra­ ben zu müssen –wird uns das eigene Überleben zuneh­ mend schwieriger. Wir versuchen so weit als möglich, die offiziellen Kanäle zu vermeiden, aber tatsächlich wird die Lage immer unerträglicher. Daher wenden wir uns mit die­ sem Solidaritätsappell an alle ArbeiterInnen und fort­ schrittlichen Kräfte in aller Welt und bitten darum, uns aus dieser schrecklichen Lage zu helfen. Für die nötigsten Dinge brauchen wir nach vorläufiger Bestandsaufnahme: • 50 000 $ zur Reparatur der Häuser • 20 000 $ für dringendste Wiederbeschaffungsmaß­ nahmen • 10 000 $ zur Versorgung der Verletzten und Verstüm­ melten • 30 000 $ für das Überleben in der nächsten Zeit • 10 000 $ für die Bestattung der Toten Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Inflation von 40 % benötigen wir also 170 000 $ an Spenden. Andere Kräfte, zu denen wir während der letzten großen Kampagne für einen Mindestlohn Kontakt geknüpft ha­ ben, sind in einer ähnlichen Lage und bedürfen gleich­ falls unserer Hilfe. Zudem müssen wir mit den Solidari­ tätsbewegungen, die in unseren Wohngegenden entstan­ den sind, eng zusammen arbeiten und für unsere Ideen dort werben. Gerade weil die herrschenden Klassen den Wiederaufbau entlang ihrer Erfordernisse planen, müs­ sen wir schleunigst unser Konzept dagegen setzen, wenn wir nicht der nächsten Katastrophe, die sie uns bereiten, ausgeliefert sein wollen. Zusammen genommen benötigen wir 300 000 $ zum Überleben und zum Aufbau einer breiten und starken politischen Alternative, die uns wappnet, der nächsten und bereits in extremer Form dräuenden Katastrophe entgegen zu treten: der Herrschaft des Imperialismus im Verband mit den herrschenden Klassen des Landes und dem reaktionären Staat. Wir bedanken uns im Voraus bei Allen, die uns hel­ fen wollen. Die desaströsen Umstände erfordern nicht nur eine starke Solidarität sondern ein bewusstes Eintre­ ten für den gemeinsamen internationalen Kampf. Wer uns unmittelbar mit Nahrungsmitteln, Wasser, Bekleidung, Medikamenten etc. helfen will, kann sich an unser Organisationsbüro in Port-au-Prince wenden: BATAY OUVRIYE, Delmas 16, # 13b. Geldspenden bitte auf das Sonderkonto von Inpre­ korr: Kto. 478 106-507, BLZ 370 100 50 (Postbank Köln), Stichwort: HAITI Selbstverständlich werden wir die Spenden öffent­ lich machen und über unsere Aktivitäten informieren. BATAY OUVRIYE Batay Ouvriye (kreolisch von frz. Bataille Ouvrière, dt. ArbeiterInnenkampf) ist eine basisdemokratische Gewerkschaftsorganisation in Haiti. Übersetzung: MiWe