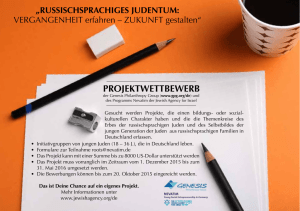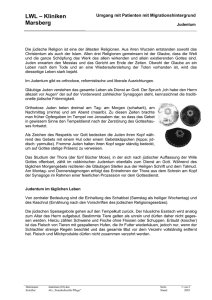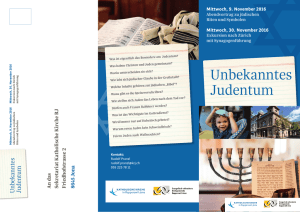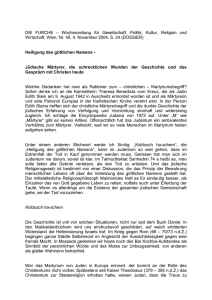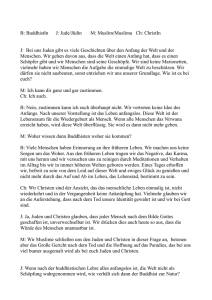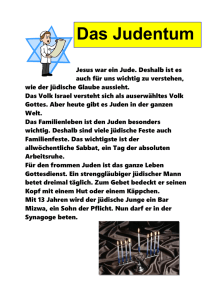Geschichte des Christentums
Werbung

Hans-Christoph Goßmann (Hrsg.) Die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit der Geschichte ist nicht nur interessant, sondern auch hilfreich, um Phänomene der Gegenwart verstehen und deuten zu können. Dies gilt auch für die Geschichte des Christentums. In diesem Buch sind die sechs Vorträge einer Vortragsreihe über die Geschichte des Christentums dokumentiert, die die VHS-Seniorenakademie Dithmarschen und die Jerusalem-Akademie in Hamburg gemeinsam durchgeführt haben. Dr. Hans-Christoph Goßmann, Prof. Dr. Holger Hammerich, Prof. Dr. Gabriele Borger, Bischof Dr. Hans Christian Knuth, Prof. Dr. Inge Mager und Henning Keine stellen je eine Epoche der Christentumsgeschichte dar. Ihre Beiträge geben somit einen Überblick über die Geschichte des Christentums von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Hans-Christoph Goßmann (Hrsg.) - Geschichte des Christentums 7 Geschichte des Christentums ISBN 978-3-88309-663-6 Verlag Traugott Bautz GmbH Geschichte des Christentums Jerusalemer Texte Schriften aus der Arbeit der Jerusalem-Akademie herausgegeben von Hans-Christoph Goßmann Band 7 Verlag Traugott Bautz Hans-Christoph Goßmann (Hrsg.) Geschichte des Christentums Verlag Traugott Bautz Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. Verlag Traugott Bautz GmbH 99734 Nordhausen 2011 ISBN 978-3-88309-663-6 Inhaltsverzeichnis Hans-Christoph Goßmann Vorwort 6 Hans-Christoph Goßmann Die jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens 8 Holger Hammerich Alte Kirche 19 Gabriele Borger Die Kirche im Mittelalter 35 Hans Christian Knuth Kirche in der Reformation. 12 Thesen zur Bedeutung Luthers für die Zukunft 49 Inge Mager Kirche in der Frühen Neuzeit 1555–1750. „Behüt uns allzusammen / Vor falscher Lehr / Und Feindes Heer, / Vor Pest und Feuersflammen“ 86 Henning Kiene Die EKD in Bewegung. Standortbestimmung der evangelischen Kirche in Zeiten des Wandels 106 Die Autorinnen und Autoren 122 55 5 Vorwort Hans-Christoph Goßmann Die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit der Geschichte ist nicht nur interessant, sondern auch hilfreich, um Phänomene der Gegenwart verstehen und deuten zu können. Dies gilt auch für die Geschichte des Christentums. Um für eine Beschäftigung und Auseinandersetzung mit der Geschichte des Christentums einen geeigneten Rahmen zu bieten, haben die VHSSeniorenakademie Dithmarschen und die Jerusalem-Akademie in Hamburg gemeinsam eine Vortragsreihe durchgeführt, in der die einzelnen Epochen der Christentumsgeschichte in je einem Vortrag dargestellt werden. Die sechs Vorträge dieser Reihe wurden in der Zeit vom September 2009 bis zum Januar 2011 im Sitzungssaal der Sparkasse Westholstein in Meldorf gehalten: Den Auftakt dieser Reihe bildete der Vortrag über die jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens von Dr. Hans-Christoph Goßmann am 8. September 2009, dann folgte am 17. November desselben Jahres der Vortrag von Professor Dr. Holger Hammerich über die Alte Kirche. Im Jahr 2010 wurden die nächsten drei Epochen der Christentumsgeschichte in je einem Vortrag dargestellt: Am 23. Februar hielt Professorin Dr. Gabriele Borger einen Vortrag über die Kirche im Mittelalter, am 19. Oktober setzte Bischof i.R. Dr. Hans Christian Knuth die Reihe mit einem Vortrag über die Kirche in der Reformation fort, in dem er die bleibende Aktualität Martin Luthers und seiner Theologie zur Sprache brachte, und am 23. November gab Professorin i.R. Dr. Inge Mager eine Einführung in die Geschichte der Kirche in der Frühen Neuzeit. Den Abschluss dieser Reihe bildete der Vortrag über die Kirche in der Moderne von Henning Kiene am 25. Januar 2011, in dem er die Nachkriegszeit bis zur Gegenwart thematisierte. In dem vorliegenden Band werden die Vorträge dokumentiert und damit einem größeren Publikum zugänglich gemacht. 6 Für die gute Zusammenarbeit bei der Konzeption und Durchführung dieser Vortragsreihe danke ich dem Leiter des Vereins Volkshochschulen in Dithmarschen, Herrn Martin Gietzelt, ganz herzlich. Darüber hinaus gilt mein Dank Frau Ulla Wieckhorst für das gründliche Korrekturlesen. 7 Die jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens Hans-Christoph Goßmann Wer waren die Mitglieder der Urgemeinde? Wer waren die ersten Christen? Mit diesen Fragen wollen wir versuchen, uns einem Thema zu nähern, das nicht nur von historischem Interesse ist. Die erste Antwort lautet: Sie waren zunächst einmal Juden. Die ersten Christen stellten eine der vielen Gruppen innerhalb des damaligen Judentums dar. Das damalige Judentum präsentierte sich genau so vielschichtig wie das heutige. Jeder, der schon einmal in Israel war, hat selbst gesehen, in welcher Vielfalt jüdisches Leben in Israel existiert: Juden aus über 70 Ländern sind seit der Staatsgründung im Jahr 1948 nach Israel eingewandert und prägen jetzt das dortige Leben. Das jüdische Leben zur Zeit der Urgemeinde werden wir uns sehr ähnlich vorzustellen haben. Seit dem babylonischen Exil im 6. vorchristlichen Jahrhundert lebten Juden nicht nur im Land Israel, sondern auch in der Diaspora. Das Leben in der Diaspora – im Exil – geschah nicht aus Not, sondern freiwillig. Schließlich hatte ja jeder Jude die Möglichkeit, ins Land Israel einzuwandern. Wenn viele dies nicht taten, sondern ein Leben in der Diaspora vorzogen, dann deshalb, weil sie dort in jeder Hinsicht – kulturell wie materiell – günstige Lebensbedingungen vorfanden. Dabei kam es zu einer gegenseitigen Beeinflussung: Juden wirkten einerseits auf ihre Umgebung prägend und wurden andererseits selbst von ihrer Umgebung beeinflusst. Diese Einflüsse wirkten auch auf Israel, das Heimatland der Juden, da ein reger Austausch zwischen den Juden in der Diaspora und denen im Land Israel bestand. Dieser Austausch war allein deshalb schon gewährleistet, weil unzählige Juden aus der Diaspora anlässlich der großen Wallfahrtsfeste nach Jerusalem kamen. Jerusalem bildete auch für die Juden in der Diaspora das Zentrum. Das Leben in dem vergleichsweise kleinen Land Israel war also durch eine Vielzahl von kulturellen Einflüssen geprägt – es war gleichsam ein Schmelztiegel unterschiedlichster Richtungen. So 8 wundert es nicht, dass es innerhalb des Judentums zur Zeit der Urgemeinde verschiedene jüdische Gruppierungen gab. Einige, wie z.B. die Pharisäer, sind uns aus dem Neuen Testament bekannt. Andere – wie z.B. die Essener – sind uns nicht aus dem Neuen Testament bekannt, sondern aus anderen Quellen. Eine dieser Gruppen innerhalb des Judentums bildete die Urgemeinde. Ich sage bewusst: innerhalb des Judentums. Das mag im ersten Blick zumindest sehr ungewöhnlich klingen. Schließlich sind wir ja heute gewöhnt, Judentum und Christentum als zwei unterschiedliche Religionen anzusehen. Diese Sichtweise wird dem Problem jedoch nicht gerecht, da Judesein nicht nur die Zugehörigkeit zu einer Religion, sondern auch zu einem Volk bedeutet. Anders ausgedrückt: Jüdische Existenz definiert sich nicht nur religiös, sondern auch ethnisch. Die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk haben die ersten Christen jedoch niemals aufgegeben. Für sie schlossen sich die Bezeichnungen ’Juden’ und ’Christen’ keineswegs aus. Sie waren ihrem Selbstverständnis nach Juden, die an den Messias – an Jesus Christus – glaubten. Auch in ihren religiösen Auffassungen unterschieden sie sich in vielerlei Hinsicht nicht von ihren nichtchristlichen Mitjuden. Dies möchte ich an zwei Beispielen verdeutlichen: Die Essener von Qumran lasen die alttestamentlichen Texte in dem Bewusstsein, die Erben der göttlichen Verheißung zu sein. Da die Endzeit angebrochen war, konnte nun der eigentliche Sinn der prophetischen Aussagen verstanden werden. Dieses Schriftverständnis wird in folgendem Text, der in der ersten Höhe von Qumran gefunden wurde, besonders deutlich: Und Gott sprach zu Habakuk, er solle aufschreiben, was kommen wird über das letzte Geschlecht. Aber die Vollendung der Zeit hat er ihm nicht kundgetan. Und wenn es heißt: Damit eilen kann, wer es liest, so bezieht sich seine Deutung auf den Lehrer der Gerechtigkeit, dem Gott kundgetan hat alle Geheimnisse der Worte seiner Knechte, der Propheten. (1 Q pHab VII, 1-5). 9 Dieses Schriftverständnis findet sich auch im Neuen Testament: Lasset uns auch nicht Unzucht treiben, wie etliche von ihnen Unzucht trieben und (deshalb) an einem Tage 23000 fielen. Lasset uns auch nicht Christus versuchen, wie etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murret auch nicht, wie etliche von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Dies aber widerfuhr jenen als Exempel; geschrieben wurde es zur Warnung für uns, denen das Ende der Welt nahe bevorsteht. (1. Kor. 10, 8-11). Paulus bezieht hier Ereignisse der Geschichte Israels auf die christliche Gemeinde. Vers 11 macht deutlich, dass er – wie die Essener von Qumran – glaubt, in der Endzeit zu leben. Auch die Bestimmungen, wie in der Gemeinde von Qumran Mitglieder zu behandeln sind, die gesündigt haben, sind den entsprechenden des Neuen Testamentes ähnlich: Man soll zurechtweisen, ein jeder seinen Nachbarn in Wahr(heit) und Demut und barmherziger Liebe untereinander. Keiner soll zum anderen sprechen in Zorn und Murren oder Halsstarrig(keit oder im Eifer) gottlosen Geistes. Und er soll ihn nicht hassen in seinem (unbeschnittenen) Herzen; sondern am selben Tag soll er ihn zurechtweisen, aber nicht soll er seinetwegen Schuld auf sich laden. Ferner soll niemand gegen seinen Nächsten eine Sache vor die vielen bringen, wenn es nicht vorher zur Zurechtweisung vor Zeugen gekommen ist. Diese Bestimmungen decken sich teilweise mit denen in Matthäus 18, 15-17: Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen! Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er dagegen nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit „jede 10 Sache auf Aussage von zwei oder drei Zeugen beruhe“. Wenn er jedoch nicht auf sie hört, so sage es der Gemeinde! Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hört, so sei er dir wie der Heide und Zöllner! Diese Beispiele machen deutlich, dass die Urgemeinde mit ihren religiösen Auffassungen nicht gleichsam im luftleeren Raum entstand, sondern in das damalige Judentum eingebettet war. Die Trennung zwischen der Urgemeinde von dem übrigen Judentum und ihre Gründe 1. Die Trennung christlicher Seite Bei dieser engen Einbettung der urchristlichen Gemeinde in das damalige Judentum stellt sich die Frage, wann und vor allem warum es zur Trennung zwischen der Urgemeinde und den anderen Juden kam. Zunächst zur Frage, wann die Trennung erfolgte. Offensichtlich schon relativ früh. Die Juden waren durch das Claudius-Edikt aus Rom vertrieben worden. Eine genaue Datierung dieses Edikts ist nicht möglich. Während es nach dem christlichen Historiker Paulus Orosius, der im 5. Jahrhundert lebte, im Jahr 49 erlassen wurde, gibt der römische Schriftsteller Dio Cassius das Jahr 41 an. Auf jeden Fall betraf die Christenverfolgung des Nero im Jahr 64 nicht mehr die Juden, sondern die Christen. Daraus ist zweierlei zu schließen: Erstens, dass es zu der Zeit bereits nichtjüdische Christen gegeben hat, mit anderen Worten: dass sich das Christentum bereits als eigenständige Größe neben dem Judentum konstituiert hat und zweitens, dass die heidnische Umgebung bereits klar zwischen den Christen und den verschiedenen jüdischen Gruppierungen zu differenzieren wusste. Die Frage, warum die Trennung erfolgte, beantwortet uns das Neue Testament, genauer gesagt Galater 2 und Apostelgeschichte 15. Diese beiden Texte berichten von dem so genannten Apostelkonzil. Auf diesem wurde beschlossen, dass es neben der Judenmission auch 11 die Heidenmission geben dürfe und solle. D.h. nun musste ein Heide, der Christ werden wollte, nicht erst Jude werden, sondern konnte direkt zum Christentum übertreten. Wie brisant dieses Problem zur Zeit des Neuen Testaments war, zeigt der Galaterbrief. Dieser Brief ist eine Kampfschrift, in der sich Paulus mit Vehemenz gegen die Auffassung wendet, ein Heide müsse zunächst Jude werden, um dann als Jude, der die Gebote hält, Christ werden zu können. In die galatischen Gemeinden waren Juden gekommen, die genau dieses förderten. Paulus, ebenfalls Jude, setzt sich aufs schärfste mit dieser Forderung auseinander und bezieht sich in Gal 2 auf die Regelung, die auf dem Apostelkonzil festgelegt wurde. Durch diese Regelung wurde aber die Gemeinschaft des jüdischen Volkes verlassen. Denn ein Heide, der nicht mehr Jude werden musste, um Christ werden zu können, gehörte natürlich nicht mehr der Gemeinschaft des jüdischen Volkes an. Ursprünglich war es also nicht so, dass Juden, die sich zu Jesus Christus bekannten, dadurch keine Juden mehr waren. Es war vielmehr so, dass die nichtjüdischen Christen zu keinem Zeitpunkt Juden gewesen waren. Seit dem Zeitpunkt, an dem die Christen nicht mehr nur unter Juden, sondern auch unter Heiden missionierten, muss zwischen den so genannten Judenchristen und den so genannten Heidenchristen unterschieden werden. Die heidenchristlichen Gemeinden waren z.T. aus den so genannten Gottesfürchtigen – Heiden, die sich von der jüdischen Ethik und dem jüdischen Monotheismus angesprochen fühlten und an den Synagogengottesdiensten teilnahmen, aber nicht zum Judentum übertreten wollten – hervorgegangen. Trotzdem fühlten sie sich im Laufe der Zeit dem Judentum immer weniger verbunden und distanzierten sich von ihm. Dies hatte u.a. die Konsequenz, dass in der frühen Kirche zunächst nicht klar war, ob das Alte Testament als Heilige Schrift der Kirche anerkannt werden sollte. Denn es war ja auch die Heilige Schrift der Juden. Und von denen wollten sich die Heidenchristen distanzieren. Markion, der als erster einen neutestamentlichen Kanon zusammengestellt hatte, verwarf 12