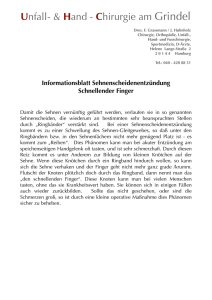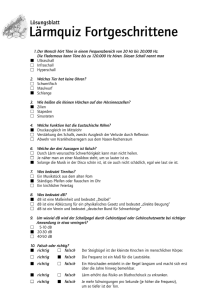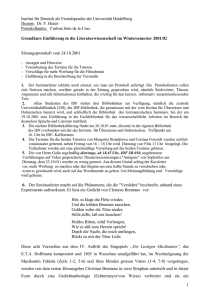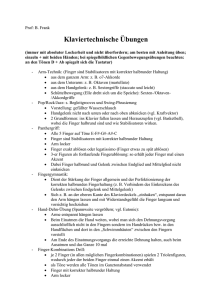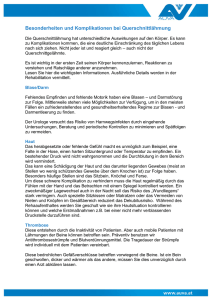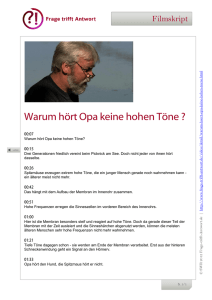13.Kapitel - Technik und Übung
Werbung
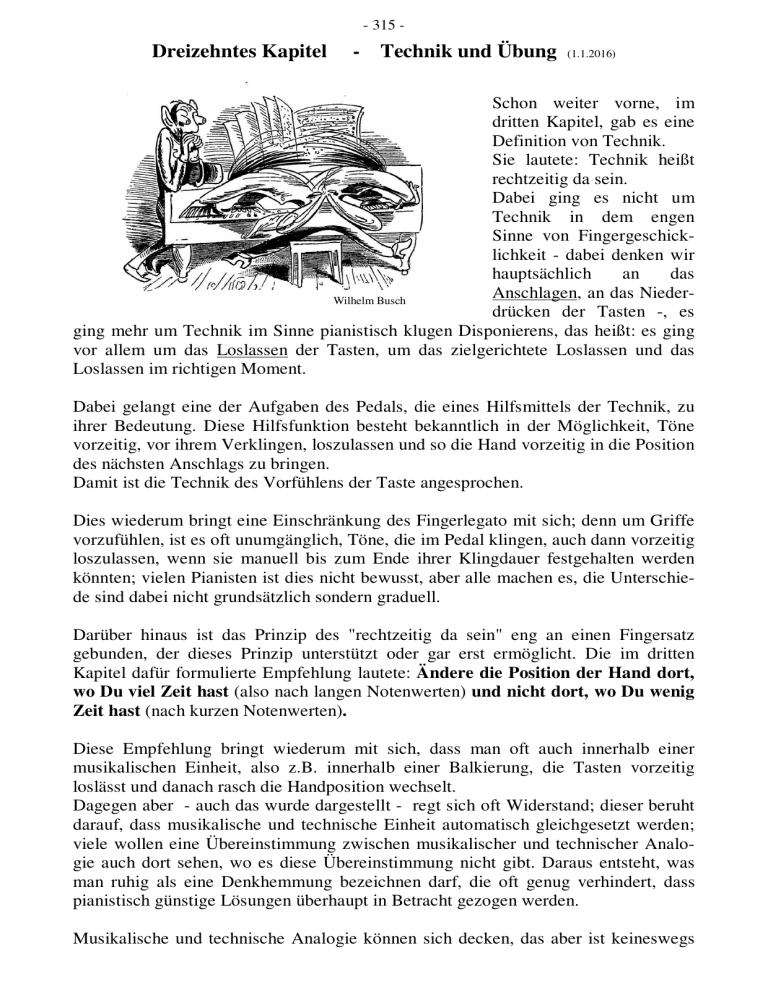
- 315 - Dreizehntes Kapitel - Technik und Übung (1.1.2016) Schon weiter vorne, im dritten Kapitel, gab es eine Definition von Technik. Sie lautete: Technik heißt rechtzeitig da sein. Dabei ging es nicht um Technik in dem engen Sinne von Fingergeschicklichkeit - dabei denken wir hauptsächlich an das Anschlagen, an das NiederWilhelm Busch drücken der Tasten -, es ging mehr um Technik im Sinne pianistisch klugen Disponierens, das heißt: es ging vor allem um das Loslassen der Tasten, um das zielgerichtete Loslassen und das Loslassen im richtigen Moment. Dabei gelangt eine der Aufgaben des Pedals, die eines Hilfsmittels der Technik, zu ihrer Bedeutung. Diese Hilfsfunktion besteht bekanntlich in der Möglichkeit, Töne vorzeitig, vor ihrem Verklingen, loszulassen und so die Hand vorzeitig in die Position des nächsten Anschlags zu bringen. Damit ist die Technik des Vorfühlens der Taste angesprochen. Dies wiederum bringt eine Einschränkung des Fingerlegato mit sich; denn um Griffe vorzufühlen, ist es oft unumgänglich, Töne, die im Pedal klingen, auch dann vorzeitig loszulassen, wenn sie manuell bis zum Ende ihrer Klingdauer festgehalten werden könnten; vielen Pianisten ist dies nicht bewusst, aber alle machen es, die Unterschiede sind dabei nicht grundsätzlich sondern graduell. Darüber hinaus ist das Prinzip des "rechtzeitig da sein" eng an einen Fingersatz gebunden, der dieses Prinzip unterstützt oder gar erst ermöglicht. Die im dritten Kapitel dafür formulierte Empfehlung lautete: Ändere die Position der Hand dort, wo Du viel Zeit hast (also nach langen Notenwerten) und nicht dort, wo Du wenig Zeit hast (nach kurzen Notenwerten). Diese Empfehlung bringt wiederum mit sich, dass man oft auch innerhalb einer musikalischen Einheit, also z.B. innerhalb einer Balkierung, die Tasten vorzeitig loslässt und danach rasch die Handposition wechselt. Dagegen aber - auch das wurde dargestellt - regt sich oft Widerstand; dieser beruht darauf, dass musikalische und technische Einheit automatisch gleichgesetzt werden; viele wollen eine Übereinstimmung zwischen musikalischer und technischer Analogie auch dort sehen, wo es diese Übereinstimmung nicht gibt. Daraus entsteht, was man ruhig als eine Denkhemmung bezeichnen darf, die oft genug verhindert, dass pianistisch günstige Lösungen überhaupt in Betracht gezogen werden. Musikalische und technische Analogie können sich decken, das aber ist keineswegs - 316 - immer der Fall. Die pianistisch günstigste Zusammenfassung von Tönen ist oft eine ganz andere als die Art und Weise, wie Töne im Text als musikalische Einheit zusammengefasst sind. So kann die Vereinigung mehrerer Töne unter einer Balkierung oder unter einem Bogen wie eine psychologische Barriere wirken insofern, als der Spieler, unbewusst, daraus ableitet, er dürfe innerhalb dieser musikalischen Einheit die Position der Hand nicht verändern. Exemplarisch dafür ist der Part der linken Hand in den Takten 134 - 136 im ersten Satz von Brahms' Sonate f-moll, op.5, wozu ich Sie bitten müsste, zu Beispiel 71 im dritten Kapitel zurückzublättern. Damit aber soll der Rückblick abgeschlossen sein. Alles, was auf dem Instrument geschieht, um Musik hervorzubringen, ist Technik. Dieses Kapitel will Technik in ihrer mechanischen Bedeutung betrachten, unter dem wohl am leichtesten objektivierbaren Begriff "Technisches Können", worunter die Fähigkeit verstanden wird, instrumentale Schwierigkeiten zu überwinden, oder, um es populärer auszudrücken, die Fähigkeit, in kurzer Zeit viele, auch unbequem liegende Töne sauber wiederzugeben. Der brillante Strafrechtler, der geschickte Chirurg, sie konnten im Alter von 20 Jahren ihr Studium ohne jegliche Vorkenntnisse ihres künftigen Metiers beginnen; wer mit 20 noch keine Klaviertaste angefasst hat, dem wird es kaum je gelingen, Chopins Etüde op.10, Nr.2, Liszts Feux follets oder Schuberts Wanderer-Fantasie zu meistern. Denn manuelle Fertigkeit am Klavier hat, unbestreitbar, auch eine zirzensische Seite, und zwar unabhängig davon, wie die Fertigkeit erworben wurde, ob durch isoliertes, von der Musik abgekoppeltes Training oder direkt durch ständiges Musizieren. Das heißt: Um technisches Können auf höchstem Niveau zu erlangen, muss man mit dem Klavierspiel in der Kindheit beginnen. Das sind die Gemeinsamkeiten mit der Eiskunstläuferin, dem Hochseilartisten, dem Meisterjongleur, der Trapezkünstlerin, der Olympia-Turnerin. In der Artistik und selbst im Sport - es sei denn, es handelt sich explizit um Kraftoder Ausdauersport - spielt die Ausbildung von Muskeln und Muskelgruppen keineswegs die wichtigste Rolle, und am Klavier ist die sportlich-gymnastische Bedeutung des Technikerwerbs beinahe vernachlässigbar. Viel entscheidender ist, dass die in zahllosen Wiederholungen geübten Griffe, Bewegungsformen etc. nach und nach als unauslöschliche Prägungen im Gehirn verbleiben. Eben dies ist der Grund, warum man mit dem Klavierspielen früh beginnen muss; denn die Fähigkeit des Gehirns, komplizierte Bewegungsmuster dauerhaft und stets abrufbar zu verankern, nimmt schon in der Jugend rasch ab. Herr Dr. Michael Mende vom Münchner Max-Plank-Institut teilte mir am 25.1.2016 nach einem vorausgegangenen Telephonat per E-Post mit, seit den Arbeiten der Nobelpreisträger Thorsten Wiebel und David Hubel sei es in der Hirnforschung weitgehend akzeptiert, dass es "kritische Perioden" und "Fenster" gibt, in welchen das Nervensystem für die Prägung komplizierter körperlicher Abläufe besonders aufnahmefähig ist, anerkannt sei ferner, dass diese kritischen Perioden in einem sehr jungen Lebensalter liegen. - 317 - An der Staatlichen Fachschule für Artistik, Berlin, zu Zeiten der DDR eine bekannte Olympia-Medaillen-Schmiede, beginnen die Kinder ihre Ausbildung im Alter von neun Jahren. Der Leiter dieser berühmten Schule, Herr Roland Wendorf, sagte mir am 12.Feb.2016 in einem Telephon-Interview, die Mehrheit der im Alter von 10 bis 12 Jahren in die Schule eintretenden Kinder bringe schon artistische Vorkenntnisse mit, und nach der Pubertät, so Herr Wendorf weiter, brauche man mit einer Artistenausbildung erst gar nicht mehr zu beginnen. Olympia-Turnerinnen werden noch weit vor dem 10.Lebensjahr Opfer ehrgeiziger Trainer und Eltern. Auch alle bekannten Pianistinnen und Pianisten, ob lebend oder verstorben, haben lange vor dem zehnten Lebensjahr mit dem Klavierspielen begonnen. Ausnahmen, wenn es sie gibt, dürften selten sein. Private Anmerkung : Als mein Sohn Valentino 10 Jahre alt war, ließ ich ihm das Einradfahren beibringen; ich war damals beinahe 50 Jahre alt und wollte es zusammen mit ihm ebenfalls erlernen (und, auf bescheidenem Niveau, auch das Jonglieren). Mein Sohn konnte es nach drei Tagen, ich brauchte viele Monate, bei täglicher kurzer Übung. Für meinen jüngeren Sohn Carl Emilio habe ich mich im Alter von deutlich über 60 Jahren noch einmal auf das Einrad gesetzt und ihn angelernt. Kurz darauf hatte er das Glück, einige UnterrichtsStunden bei dem damaligen Einrad-JugendWeltmeister Philipp Ploner aus Lajen/ Südtirol zu bekommen, wodurch er sehr rasch große Geschicklichkeit erlangte (Rückwärtsfahren, nur mit einem Fuß pedalieren, das Einrad nur mit den auf den Reifen gesetzten Füßen vorantreiben, von Stufen springen u.s.w.) Völlig losgelöst von Musik kann sich keine Klaviertechnik ausbilden, aber je nach Gewichtung lassen sich zwei Arten des Technik-Erwerbs unterscheiden: 1) Musik und Technik werden als zwei gesondert zu behandelnde Gebiete betrachtet. Diese Unterrichtsphilosophie war vor langer Zeit, im 19.Jahrhundert, in Deutschland und Frankreich vorherrschend, ja selbstverständlich, sie ist es noch in den asiatischen Ländern. Als beispielhaft nenne ich einen Unterrichtsaufbau, wie er heute noch in Japan üblich ist, und zwar landesweit. Grundlage des Anfangsunterrichts ist nach wie vor die 1851 entstandene "Vorschule im Klavierspiel" des deutschen Komponisten und Pianisten Ferdinand Beyer (1803 1863). Es folgt ein Unterrichtsteil, der technischen Übungen (Tonleitern, Arpeggien, Fesselungsübungen etc.) und Etüden (Hanon, Czerny, Clementi) vorbehalten ist; dann kommt etwas von Bach, und dann kommt, im letzten Unterrichtsteil, "ein Stück". - 318 - "Das Stück" ist der Unterrichtsteil, in dem die Schüler musikalischen Ausdruck erlernen und zeigen sollen; Bach zählt nicht als "Stück" sondern wird noch dem technischen Unterrichtsteil zugerechnet. Die Art des Unterrichts hat mit viel Übung, mit immerwährender Wiederholung derselben Bewegungen zu tun. Dem stehe ich bei weitem nicht so naserümpfend gegenüber, wie dies bei uns meist der Fall ist. Die begabten unter den asiatischen Kindern erlernen - tausendfach erwiesen - auf diese Weise eine gute Fingerfertigkeit, sei diese auch, meinetwegen, musikalisch nicht geerdet. Eine Beethoven-Sonate akkurat zu exekutieren, ist noch keine Musik, aber allein sie akkurat zu exekutieren, bedeutet schon sehr viel. Und warum, schließlich, sollte es nicht möglich sein, einem zunächst mechanisch abgespielten Stück Lebendigkeit zu verleihen, z.B. durch guten Unterricht? Die vielen Studentinnen, die aus Korea, China und Japan zu mir gekommen sind, brachten als künstlerische Voraussetzung meist ein gutes Handwerk mit. Das ist wohltuend! Es ist wohltuend, Schüler zu bekommen, die bei ihrer Ankunft saubere und gleichmäßige Sechzehntel im Gepäck haben, umso mehr, als solche Voraussetzungen bei deutschen Studienaspiranten keineswegs selbstverständlich sind. Der Grund hierfür ist: Außer im Sport spielt Übung bei uns, ganz anders als im asiatischen Kulturkreis, eine untergeordnete, ja oft verachtete Rolle. Übung ist lästige Pflicht auf dem Weg zu einem Ziel. Nur das Ziel zählt ("Ergebnisorientierung" wie es im Imponiergefasel des Managerjargons heißt). Übung gilt als "unkreativ", als öde Wiederholung immer desselben. Nur so aber entsteht Können. "Es gibt kein wertvolles Schaffen ohne ein erworbenes mechanisches Können" (Georg Kerschensteiner). Es gibt kein Können ohne Übung. Näheres dazu weiter hinten im Kapitel, ab S.334. 2) Die unerlässliche mechanische Fertigkeit aber kann auch auf anderem Weg, ganz im Einklang mit der Musik, erworben werden, augenscheinlich aber nur von begabten Menschen. Es gibt viele Pianistinnen und Pianisten, die meisten von Rang, die eine sehr gute, ja herausragende Technik besitzen und nie isoliertes technisches Fingertraining, Hanon, Czerny, Cortot und dergleichen absolviert haben. Aber natürlich haben sie von Kindheit an immer Klavier gespielt. Persönlich kenne ich fünf Pianisten dieser Kategorie, drei davon bekannt, einer berühmt, namentlich nenne ich hier nur den, der keine Karriere gemacht hat, den aus Argentinien stammenden Daniel Rivera. Mit ihm habe ich 1975/76 in Florenz während meines Studiums bei Maria Tipo für ein Jahr zusammengewohnt. Rivera war/ist eine klaviertechnische Ausnahmeerscheinung; eine derart sichere, beinahe tierisch-instinkthafte Naturtechnik ist mir bei keinem zweiten Pianisten begegnet. Dass ich später auch sehr virtuose Werke spielen konnte, verdanke ich ihm, während für ihn, möglicherweise, meine klanglichen Hinweise und die für den Pedalgebrauch hilfreich waren. Keiner der fünf Pianisten hat in seiner Kindheit isolierte Fingerübungen oder technische Studien gemacht. - 319 - Während meiner langen Zeit als Hochschullehrer hatte ich vielleicht 10 Studenten, sechs weibliche, vier männliche, denen zu Recht eine Hochbegabung zu attestieren war; hätten sie sich in ihrer Kindheit mit irgendwelchen technischen Studien abgegeben, hätte ich sicher davon erfahren. Im Internet können Sie, in französischer Sprache, ein Interview mit Martha Argerich sehen (https://www.youtube. com/watch?v=l_86HRWzuIQ ); darin sagt sie, sie halte nichts vom Technik Üben, habe dergleichen nie gemacht. Das sind viele Beispiele für eine nur direkt über die Musik erworbene Technik. Da aber alle Hände, so verschieden sie aussehen, dieselbe Anatomie haben, wäre allein ein verbürgtes Beispiel als Beweis dafür hinreichend, dass ein isoliertes technisches Fingertraining unnötig ist. Deshalb ist es viel attraktiver, über diese Art des Technikerwerbs zu reden, welcher über das Hören erfolgt, genauer ausgedrückt: Der Technikerwerb erfolgt über den Willen, den unbedingten Willen, etwas in einer bestimmten Weise und nicht anders zu hören. Eigentlich ist damit schon alles gesagt. Unter einem anderen Blickwinkel wurde darüber schon an einer früheren Stelle dieses Buches gesprochen, wobei der Hinweis auf "Die individuelle Klaviertechnik auf der Grundlage des schöpferischen Klangwillens" von Carl Adolf Martienssen nicht fehlte. Wenn ich dennoch zunächst über Punkt 1) spreche, dann geschieht dies wegen der vielen bemerkenswerten, ausgefallenen, ja, aus heutiger Sicht, amüsanten Einblicke, die eine vom musikalischen Ausdruck weitgehend losgelöste Technikausbildung zu bieten hat. Es ist ein zeit- und kulturgeschichtlicher Exkurs über Technik und Übung, nicht nur in der Musik. Sie mögen den Abschnitt, der keinen Anspruch auf chronologische Ordnung erhebt, ruhig überblättern. Sehr verbreitet in der Klavierpädagogik des 19.Jahrhunderts war die Ansicht, man könne die natürliche Ungleichheit der Finger überwinden. Grund dafür war wohl die mangelnde Kenntnis der Anatomie der Hand. Ungemein beliebt waren alle nur erdenklichen mechanischen Vorrichtungen, die den Zweck hatten, eine erwünschte Handhaltung zu erzwingen und die Kraft und Hebefähigkeit der Finger, besonders der schwächeren Außenfinger, zu erhöhen. Auch Friedrich Wieck, Clara Schumanns Vater, war ein großer Anhänger solcher Justierungs- und Hebeapparaturen. Nicht selten fungierten Klavierlehrer als Propagandisten und Händler solcher Apparate, auf Provisionsbasis oder durch direkte Beteiligung am Hersteller. - 320 - Das erste Drittel des 19.Jahrhunderts gehörte dem Komponisten, Virtuosen und Klavierpädagogen Friedrich Kalkbrenner (1785 - 1849). Bevor Franz Liszt berühmt wurde, war er der weltweit bekannteste Pianist und Pädagoge. Auch wirklich große Künstler, Liszt und Chopin z.B., haben ihn bewundert. Liszt sollte als Kind bei ihm Unterricht erhalten. Kalbrenner war zu teuer. Liszts Lehrer wurde Carl Czerny. Auch Kalkbrenner war überzeugt, Technik sei in erster Linie eine Frage der Ausbildung der Hand- und Fingermuskeln, ebenso meinte auch er, die natürliche Ungleichheit der Finger ließe sich durch Übung beseitigen. Die Gerätschaft, die ihm dazu als die geeignete erschien, war ein "Handleiter" (guide-mains), der eine korrekte Handhaltung erzwingen sollte, und unter der Bezeichnung Chiroplast von Johann Bernhard Logier produziert wurde. Mit ihm tat sich Kalkbrenner 1818 zur gemeinsamen Verwertung der Vorrichtung zusammen. Später wurde er auch Teilhaber der Firma des Pianoforte-Fabrikanten Ignaz Pleyel. Die theoretische Untermauerung seiner Fingerschulung und der Anwendung des Chiroplasten lieferte Kalkbrenner in seiner "Methode das Klavierspielen mit Hilfe des Handleiters zu erlernen" („Méthode pour apprendre le pianoforte à l'aide du guide-mains“). Kalkbrenner hat eine von der Musik abgekoppelte Technikausbildung auf die Spitze getrieben, bis ins Lächerliche. Einer seiner Ansprüche war, ein Pianist müsse in der Lage sein, beispielsweise mit der linken Hand anspruchsvolle Oktavenstudien auszuführen - Oktaven waren bei Kalbrenner stets aus dem Handgelenk heraus zu spielen - und dabei gleichzeitig eine mit der freien Hand gehaltene Zeitung zu lesen. Der verbreiteten Auffassung, Technik und Musik seien in der Ausbildung zu trennen, saßen auch große Künstler auf, deren eigene Technik nur aus dem Musizieren erwuchs. Akribisch und mit großem Aufwand - drei Bände! - verfasste Franz Liszt sein Opus "Technische Studien", nacktes technisches Material, das gar nicht erst versucht, sich als Vortragsstücke zu verkleiden. Die Studien wurden erst vor wenigen Jahren im Rahmen der neuen Liszt-Gesamtausgabe bei Editio Musica Budapest als Supplement-Bände veröffentlicht. Lange wusste niemand von diesen Studien, nicht zuletzt deshalb, weil Liszt selbst sie nie im Unterricht verwendet hat. Auch Exerzitien anderer Autoren fanden keinen Eingang in seine pädagogische Arbeit. Liszts Unterricht, in zahlreichen Quellen glaubwürdig dokumentiert, war nur musikalisch ausgerichtet. Wie ein sich langsam verlaufender Ölfleck sandte diese Art der Technikausbildung immer dünner werdende Rinnsale hinüber in das zwanzigste Jahrhundert. Erwähnt seien wenige Schlaglichter: Der Abteilung unfreiwillige Komik zuzurechnen sind Schriften wie das 1919 erschienene Werk "Wie werde ich Klaviervirtuose? - Ratschläge und Winke für Aufwärtsstrebende". Ich erwähne es, weil wir uns als Studenten beim Wein vergnügt daraus vorlasen, und der Autor, Herr Theodor Ritte, konnte sich nicht mehr wehren: "... Die Sorge um die Gesunderhaltung bedingt aber auch, daß werdende und gewordene Virtuosen alles vermeiden, was zu einer Zerrüttung ihrer Nervenkraft führen kann. Also Mäßigung in allen Genüssen des Lebens und der Liebe ... Bier macht den - 321 - feinnervigen Künstler träge und schlaff ... ein gutes Glas Wein erst nach beendetem Konzerttriumpfe ... viel Aufenthalt in freier Luft; dagegen kein anstrengender Sport, kein Rudern, kein Fußball ... abends kalte Abwaschungen als innere Maßnahmen der Nervenertüchtigung: Selbsterziehung seines Temperaments und seiner Leidenschaften. Keine Spielkarten! ... Das Rauchen spielt, wie bei den meisten geistigen Arbeitern, so auch beim Tastenkünstler eine große Rolle als Mittel zur vollen Konzentration ... Es ist dem daran Gewöhnten ebenso wie Kaffee oder Tee nahezu unentbehrlich. Das Pfeifenrauchen wird vom Pianisten als spießbürgerlich empfunden ... Die Zigarette ist für klavierübende "Kettenraucher" umständlich und zeitraubend, im Übermaß auch stark gesundheitsschädlich. Das beste Rauchmittel ist für den Virtuosen und solche, die es werden wollen, die solide Zigarre." Von Theodor Ritte gibt es auch Anleitungen zu fingergymnastischen Übungen, eine Brochure von 1920, gehalten im durchwegs erhabenen Stil; der Titel lautet: "Mein Fingersportsystem Energetos auf autosuggestiv-gymnastischer Grundlage nach Klavierhandschulungs-Methode 'Energetos'-Ritte Wichtig für jeden Musiker, der ohne Mehrübung seine Fingerfertigkeit bis zur Virtuosität zu steigern wünscht." Daraus zu zitieren, wäre womöglich noch amüsanter gewesen. Abbildung aus: "Mein Fingersportsystem Energetos ..." von Theodor Ritte Viel bekannter, ernst zu nehmen und doch an der Wirklichkeit vorbei sind die "Grundbegriffe der Klaviertechnik", die "Rational Principles of Pianoforte Technique" aus dem Jahr 1928 von Alfred Cortot, denen er auch gymnastische Übungen beigestellt hat. Mit hinzuzunehmen sind Cortots aufwendige Nebenstudien in seiner Ausgabe der Chopin'schen Etüden: Die Übungen sind zeitraubende Umwege, eine Klaviergymnastik, die in ihrer Praxisferne bisweilen den Vergleich nahelegt, man wollte jemandem das Fahrradfahren dadurch beibringen, dass man ihn dazu auffordert, den Lenker mit überkreuzten Armen zu halten. Probieren Sie es nicht aus! Sie fallen sofort um. Cortot, sagte Claudio Arrau, habe immer sehr viel geübt. Es existiert eine aufregende, leidenschaftliche, sehr suggestive, aber in ihrer ausufernden Subjektivität indiskrete Aufnahme der Préludes von Chopin. Andere Schallplatten Cortots habe ich weggeworfen, weil mir die große Menge falscher Noten zu viel wurde. Die übliche Erklärung dafür, er sei ständig bekokst gewesen, stimmt mich nicht milder. Einen Ausläufer isolierter Technikschulung habe ich selbst noch während meines Studiums mitbekommen, in Person der Pianistin Maria Hindemith-Landes (1901 1987), die von 1946 bis 1974 als Dozentin an der Münchner Musikhochschule wirkte; 1963 wurde ihr der Titel Honorarprofessor, Professorin honoris causa, zuerkannt. Auch von Frau Hindemith-Landes gibt es ein "Kompendium der Klaviertechnik", erneut nacktes, von Musik losgelöstes Fingertraining. - 322 - Ihre Studenten mussten oft bei ihr zuhause üben, wo kleine Übekammern bereit standen. Als Adlatus und Antreiber fungierte ihr Ehemann, der Cellist Hans Lofer, alias Rudolf Hindemith, Bruder des Komponisten Paul Hindemith. Lofer gab selbst den Schülern seiner Frau zusätzlichen Unterricht und überwachte die Einhaltung der Übepläne, die sie mit minuziöser Genauigkeit (10 Min. diese Fingerübung, 15 Minuten diese ...) für ihre Schüler ausgearbeitet hatte. Noch Maria Hindemith-Landes glaubte - eine für das dritte Drittel des 20.Jahrhunderts seltene und seltsame Einstellung -, die natürliche Ungleichheit der Finger sei durch Fingertraining zu überwinden. Die Idee aller Technikschulen ist: Die Finger sollen alle nur erdenklichen spieltechnischen Aufgaben, die sich am Klavier ergeben können, schematisch und systematisch durcharbeiten (Tonleiterstudien, Fesselungen, Akkordbrechungen, Doppelgriffe, Oktaven etc.). Sind alle Bewegungsformen in allen Varianten erfasst und einstudiert, dann, so die Überzeugung, seien die mit einem so großen technischen Fundus versehenen Hände jederzeit in der Lage, jede Hürde der Literatur zu meistern. - Wer solche Technik-Studien eifrig betreibt, kann auf diese Weise, natürlich, große Geschicklichkeit erlangen. Die Aufgaben der Literatur aber zeigen sich nur sehr selten in den schematischen Mustern, in denen sie in Technik-Schulen dargestellt sind. Tonleiterstudien haben noch einen relativ hohen Wirklichkeitsbezug, aber selbst bei Mozart, dessen Klaviermusik zu 80 % aus Tonleiterfigurationen besteht (so Andor Foldes in "Wege zum Klavier"), treten Tonleitern fast nie in der modellhaften Form auf, wie sie in den Technik-Studien geübt werden. - Hinzu kommt: Die zuvor emotionslos absolvierten Bewegungen sollen nun, unversehens, mit Empfindung, Ausdruck und Klangschönheit wiedergegeben werden, ein Umstand, der die Finger ganz anders reagieren lässt, als sie es von den Übungen gewohnt sind. Der Trugschluss: "Hauptsache die Finger laufen, die Musik kommt dann schon!", wurde schon an einer früheren Stelle des Buches erwähnt. - Ein entscheidender Einwand ist, dass technische Studien sehr viel Zeit kosten, Zeit, die dann für das Literaturstudium fehlt. Der Anspruch der Technikschulen, an spieltechnischen Aufgaben alles zu erfassen, was nur vorkommen könnte, bringt mit sich, dass auch vieles geübt wird, was man nie braucht. Nach der Salatschleuder suche ich in der Küche, nicht im ganzen Haus. Allein der Varianten-Fülle an Fesselungsübungen, die nie fehlen dürfen, ist keine Grenze gesetzt. Dabei wird - siehe z.B. Cortot (Bsp.299) - abwechselnd immer ein anderer Finger gefesselt, während ihn die anderen Finger in wechselnden Tonfolgen umspielen; dann folgt die Fesselung zweier Finger, nach und nach in allen möglichen Paarungen jedes Fingers mit jedem, wobei wiederum das jeweils gefesselte Fingerpaar umspielt wird, dann drei gefesselte Finger ... die Umspielungen wiederum erfassen alle möglichen Wendungen und Richtungsänderungen, werden einmal als Triolen, einmal als Sechzehntel absolviert ... - 323 Bsp.299 (aus A.Cortot: "Rational Principles of Pianoforte Technique") Technische Übungen sind dann sinnvoll, wenn sie einen unmittelbaren Bezug zur Literatur haben. An meiner ersten Hochschulstelle in Freiburg habe ich im WS 1986/87 ein Verzeichnis "Was wofür?" angelegt, worin, angelehnt an Orchesterstudien, für die gängigen Anforderungen geeignete Literaturstellen genannt waren, z.B.: - als Kompendium typischer Bewegungsformen der Wiener Klassik: Mozart: Variationen über "Ah, vous dirai-je, Maman" KV 265 oder die DuportVariationen KV 573 , überhaupt Mozart-Variationen - 324 - - für chromatische Tonleitern: Beethoven: 4.Klavierkonzert, 1.Satz; Liszt: Etude chasse neige (!) - für Doppelgriffe: Brahms: die ersten beiden Variationen der Paganini-Variationen op.35 - Oktaven: Chopin: Prélude g-moll aus op.28, Liszt: "Orage" (aus "Années de pèlerinage" I, Suisse) und, natürlich, die bekannte Strettastelle der h-moll-Sonate - geschüttelte Oktaven: a) rechte Hand: Beethoven: Variation VI aus den "Schneider-Kakadu-Variationen" op.121a (Klaviertrio), b) linke Hand: Prokofiew: Etüde op.2 Nr.4, - Verzierungen, Triller: Mozart: "Andante F-Dur für eine Walze in eine kleine Orgel", KV 616 - generell Schüttelbewegungen: Clementi: Etüde Nr.18 aus "Gradus ad Parnassum" (siehe Bsp.300) Schubert: Wanderer-Fantasie, Übergang vom 2. zum 3.Satz, Takte 231 - 234 (!!) usw. Bsp.300 Das Verzeichnis blieb unvollständig, ich habe nicht versucht, es zu komplettieren. "Orchesterstudien" für Klavier funktionieren bei kurzen Stücken, dagegen ist es etwas unrealistisch, zu verlangen, zum gesonderten Technikstudium eine Stelle aus dem Zusammenhang eines großen Werkes herauszunehmen. Es entsteht dann immer der Wunsch, das ganze Werk zu lernen. Eine Zeit lang habe ich allen Schülern aufgegeben (und das Anfangs auch noch kontrolliert), sich vor dem eigentlichen Üben mit den Variationen I und II der Paganini-Variationen von Brahms einzuspielen; zudem mussten alle Schüler chromatische kleine Terzen üben, in Triolen und Vierergruppen mit sich steigerndem Tempo und mit dem Fingersatz, bei dem der zweite Finger von schwarz auf weiß rutscht, wo auf - 325 - eine schwarze Taste zwei weiße folgen (so dass der Fingersatz einwärts anders ist als in der Auswärtsbewegung). Das habe ich ein bis zwei Jahre mit einiger Konsequenz beibehalten, technische Übungen jedenfalls nicht mehr pauschal vergeben. Schwierige Literaturstellen soll man mit dem Schüler im Unterricht am Klavier übend durcharbeiten, wobei Nebenübungen nützlich sein können. Üblich und wahrscheinlich hilfreich sind z.B. Betonungsverschiebungen oder das Verfahren, schwierige Tonfolgen in Fünfergruppen abzugehen, in Überlappung von Ton zu Ton schreitend, also so, dass die erste Fünfergruppe vom ersten bis zum fünften Ton, die zweite Gruppe vom zweiten bis zum sechsten Ton, die dritte Gruppe vom dritten bis zum siebenten Ton reicht usw., bis die ganze Passage erfasst ist. Jede Fünfergruppe wird viele Male vor- und rückwärts gespielt, in stark akzentuierter Dreierbetonung, wodurch, bei Fünfergruppen, der Betonungsimpuls immer auf einen anderen Ton fällt. Diese Übung unterstützt die Bildung der notwendigen Reflexe. Die Hauptaufgabe bei schweren Passagen ist ihre Analyse. Dies geschieht, indem man die Schwierigkeit in ihre Bestandteile aufgliedert. Danach ist meist der Punkt gefunden, an dem die Bewältigung der Stelle scheitert. Oft ist ein ungeschickter Fingersatz der Grund. Deshalb gehört zur Analyse, schlüssig darzulegen - nicht nur in Worten sondern an den Tasten - warum dieser Fingersatz günstig ist, der andere nicht. Nicht selten aber wurde ich von meinen Studenten belehrt, indem sie saubere Ausführungen mit Fingersätzen geboten haben, die nach meinen noch sehr von Ludwig Hoffmann beeinflussten Fingersatz-Leitlinien gar nicht funktionieren durften. Schließlich, bei den sehr begabten Studentinnen und Studenten, habe ich nur noch aufgezeigt, dass und wo und warum etwas ungenau, undeutlich klang, habe auf Nebenübungen verzichtet. Die Schüler wussten sich selbst zu helfen, erfinden, wo nötig, selbst Übungen. Es hat etwas gedauert, bis ich begriffen hatte, dass sich Technikerwerb aus anderen Quellen speist. Grundsätzlich gilt: Technische Hinweise müssen konkret sein. Der Lehrer muss zeigen, wie es geht. Wolkig allgemeine Hinweise ("Bleib' locker!", Denk' an einen Sonnenaufgang!" usw.) sind ärgerlich und lassen den Schüler, was die Bewältigung technischer Probleme betrifft, ratlos zurück. Sind die technischen Hürden überwunden, können poetische Metaphern das Verständnis eines Werkes unterstützen. Ludwig Hoffmanns Fingersatzregeln Über Fingersätze, vor allem: über die korrespondierende Abhängigkeit zwischen Fingersatz und Pedalisierung, wurde in den Kapiteln 2, 3 und 4 gesprochen, und im Anhang über Ludwig Hoffmann am Ende des fünften Kapitels ("Weite Griffe") war schon kurz von dessen Fingersatzregeln die Rede gewesen, in eher distanziertem Ton. Dennoch sollte man diese Regeln zu kennen. Sie sind durchdacht, berücksichtigen die Anatomie der Hand und stellen eine Grundlage, einen Fixpunkt dar, worauf die vielen Ausnahmen Bezug nehmen. Hoffmann selbst hat seine Regeln nicht schriftlich formuliert, das besorgte sein - 326 - Schüler Roland Keller. Dessen Formulierungen enthalten viele eigene Überlegungen und sind weit mehr als nur eine Niederschrift der Worte Ludwig Hoffmanns. Ich zitiere die Regeln aus Prof. Kellers Essay "Über das Üben", erschienen im Dezember 2001 in der Zeitschrift "Üben und Musizieren" (Schott-Verlag). 1) Tu' alles, was dir hilft! 2) Reduziere Sprünge, Spannungen, unbequeme Lagen, Über- und Untersätze sowie Kreuzungen der Hände auf das absolut notwendige Mindestmaß! 3) Triff die Tasten immer "ins Herz", das heißt die schwarzen ganz vorne, die weißen in der Mitte des Bereichs, der vor den schwarzen liegt. Spiele so selten wie möglich zwischen den schwarzen Tasten und vermeide 1 und 5 auf schwarzen Tasten. 4) Greife gleiche Positionen mit gleichen Fingern, verschiedene mit verschiedenen. 5) Suche bei musikalisch analogen Tonfolgen analoge Fingersätze, jedoch nur, sofern sie nicht gegen die dritte und vierte Regel verstoßen. 6) Vermeide stumme Fingerwechsel! 7) Vermeide Fingerwechsel bei Tonwiederholungen, wenn diese nicht sehr schnell gespielt werden müssen, und benütze sie dann nur in der Reihenfolge von außen nach innen ( 4 - 3 - 2 - 1 ), nie umgekehrt. 8) Vermeide die Folge 3 - 4 bzw. 4 - 3, benütze stattdessen 2 - 4, 4 - 2, 3 - 5, 5 - 3 und oder benütze Unter- oder Übersätze! 9) Verwende den Daumen auf verschiedenen Tasten nacheinander nur, wenn mindestens zwei andere Finger dazwischen gespielt haben. 10) Setze den Daumen unter den 4.Finger nur nach schwarzen Tasten und den 4.Finger über den Daumen nur auf schwarze Tasten! 11) Verwende immer beide Hände und verteile auf sie alle Schwierigkeiten gleichmäßig und unabhängig von der Verteilung im Notentext, aber unter gewissenhafter Berücksichtigung der klanglichen Intention des Komponisten. 12) Spiele nie mit beiden Händen auf der gleichen Taste. 13) Gruppiere parallel oder spiegelbildlich angeordnete Passagen für beide Hände gleich und achte darauf, dass die Daumen zusammentreffen! 14) Greife beim Kreuzen der Hände immer nur über, nie unter, und triff beim Übergreifen als erste eine schwarze Taste! 15) Schreibe den Fingersatz sparsam aber unmissverständlich in die Noten, ebenso wie jede nachträgliche Fingersatzänderung. Aus Regel 1) geht hervor, dass Hoffmann kein Dogmatiker war; der Wortlaut "Tu' alles, was dir hilft!" ist schon das Zugeständnis an Ausnahmen. Der Zusatz zu Regel Nr.11 "... aber unter gewissenhafter Berücksichtigung der klanglichen Intention des Komponisten." ist die einzige unbestimmte, ja etwas verlegen klingende Formulierung; sie hat, da beliebig auslegbar, kaum Aussagewert. Zu Regel 5 könnte man anmerken, dass es angesichts der vielen einschränkenden Regeln für analoge Fingersätze zu analogen Tonfolgen kaum noch Spielraum gibt. Regel 7 lohnt eine nähere Betrachtung: Tonrepetitionen, auch langsame, grundsätzlich nur mit wechselnden Fingern zu spielen, ist ein seltsames, praxisfernes Stereotyp und ist doch für die meisten Fingersatzverfasser unumstößliches Gesetz. Roland - 327 - Kellers Argumentation dagegen ist einleuchtend: "Fingerwechsel (Regeln 6 und 7) sind zusätzliche Gedächtnisbelastungen und erschweren darüber hinaus das genaue Dosieren der Anschlagsstärke, da jeder Finger sein eigenes Erinnerungsvermögen besitzt, mit dem aufeinander folgende Anschläge miteinander verglichen werden." So sollten die Bass-Repetitionen im ersten Satz von Beethovens Appassionata (Bsp.301), trotz des recht raschen Tempos, nur mit einem Finger gespielt werden. Wer klagt, beim Repetieren mit nur einem Finger werde die Hand steif, dem ist entgegenzuhalten, dass er dann noch nicht so weit ist, das Werk zu spielen. Bsp.301 ? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ... sempre ? 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 Kommentar zu Bsp.301: Die große Herausforderung dieser Passage besteht darin, die Repetitionen in dieser tiefen, stark risuonierenden Bass-Lage im pp hinzubekommen. - Deshalb muss, damit sich der Klang nicht zu sehr aufbläht, das Pedal oft gelüftet werden, z.B. bei langen Notenwerten der rechten Hand, wo das Pedal als Legatohilfe nicht benötigt wird. - Die zweite wichtige Voraussetzung für das Zustandekommen eines gleichmäßig pochenden pp ist, dass die Repetitionen in der Taste, vom Auslösepunkt aus gespielt werden. Und dies gelingt am besten mit nur einem Finger, hier dem dritten. Ein Finger richtet sich schnell in dem Anschlagspunkt in der Taste ein, wechselnde Finger müssen den tief liegenden Anschlagspunkt jedes Mal neu aufsuchen: Die Tonkontrolle ist deutlich erschwert. Repetitionen mit einem Finger haben etwas Insistierendes. Das kann, zugegeben, einem womöglich erwünschten Leggiero-Charakter entgegenstehen, andererseits birgt der bei schnellen Tonrepetitionen übliche Fingersatz 4-3-2-1 das Risiko wegbleibender Töne. Ein sehr rasches Tempo setzt Repetitionen mit nur einem Finger eine Grenze. In Beispiel 301 aus der Appassionata mit den vielen Repetitionen hintereinander ist das Tempo so, dass Repetitionen mit nur einem Finger noch möglich sind. Eine Alternative zu Repetitionen mit einem Finger besteht darin, mit zwei Fingern zu repetieren, mit 2-1-2-1- oder mit 3-1-3-1An der in Bsp.302 abgebildeten Stelle des 4.Satzes in Schuberts Klavier-Trio Es-Dur, op.100 hat sich mein kursiv angezeigter Fingersatz stets als zuverlässig (= keine wegbleibenden Töne) erwiesen. Einem Hochschul-Kollegen erschien der Fingersatz beinahe wie ein unsittliches Ansinnen: "Der Geist der Stelle" (?) verlange zwingend ein Durchwechseln der Finger auf jeder Vierergruppe. - 328 Bsp.302 5 5 5 5 2 1 21 2 1 21 (3 3 3 3) 21 21 2121 3333 2121 2121 2121 3 3 3 3 2121 3 3 33 2121 2121 T.321 Die größte Herausforderung der Klavierliteratur zum Thema Repetitionen darf nicht fehlen: Der Anfang von Ravels Scarbo aus "Gaspard de la nuit" (Bsp.303). Hier ist kaum noch von Repetitionen zu reden, die Idee ist die eines Tremolo auf einem Ton. Für eine Ausführung mit nur einem Finger ist die Stelle eindeutig zu schnell: Arturo B. Michelangeli spielte sie mit nur einem Finger, dem zweiten, wobei der Daumen die Beuge der beiden unteren Fingerglieder des zweiten Fingers leicht stützte. Das Ergebnis war ein vibrierender Ton-Strich, der, wie es sein soll, völlig ausdruckslos weder abnahm noch anschwoll. Bsp.303 ein durchgehendes Pedal würde den Klang zu sehr aufblähen, verbietet sich daher. Zeugen sind Kollegen, die Michelangelis Hände, während er Scarbo spielte, genau sehen konnten; die zuverlässigste Bestätigung aber kommt von Ludwig Hoffmann. Der nahm 1955 als junger Mann an einem Meisterkurs Michelangelis teil, bei dem der Meisterpianist den perplexen Kursteilnehmern die Stelle vorgeführt hat. Michelangeli, so Ludwig Hoffmann, sagte dazu selbstbewusst, nur er sei in der Lage, diese Stelle mit einem Finger zu spielen. Das lag am außergewöhnlichen Können des - 329 - großen Künstlers, eine hilfreiche Rolle aber kam auch seinem Flügel zu, dessen Mechanik er sich so hatte regulieren lassen, dass der Auslösepunkt der Taste noch ein wenig tiefer lag als üblich. Dadurch konnte er noch tiefer in der Taste spielen, das heißt: rasche Tonfolgen, etwa Triller, noch leiser und, wegen des noch mehr verkürzten Tastenweges, Repetitionen noch schneller und leichter ausführen. Diese besondere Einrichtung der Mechanik war der Grund, warum Michelangeli zu Konzerten immer mit dem eigenen Flügel reiste (was ihn stets einen guten Teil seines Honorars kostete). Üblicherweise werden die Repetitionen des Scarbo-Anfangs mit zwei Fingern, mit 2 - 1 - 2 - 1 gespielt oder, z.B. von Wolfgang Manz, mit 3 - 1 - 3 - 1 Der Vollständigkeit halber sei noch eine Lösung genannt, die durchaus Anwendung findet: Die meisten können mit der rechten Hand besser repetieren. Man kann demnach den Akkord links nehmen und die Repetitionen mit der hineingreifenden rechten Hand spielen, in welchem Fall die Finger die Taste von der Seite, von der rechten Tastenkante aus anschlagen. Anmerkung: Ein Hinweis, der den Auslösepunkt der Taste betrifft: Von diesem Punkt aus gespielte Ton- oder Akkordwiederholungen können Sie ohne Pedal in einem ununterbrochenen Klang-Band ausführen. Probieren Sie es - langsam - aus: Drücken Sie die Taste bis zur Hälfte des Tastenweges hinunter und schlagen dann den Ton an, lassen Sie dann die Taste den halben Tastenweg wieder herauf kommen. Der Ton bricht dabei nicht ab, denn wenn die Taste wieder nach oben geht, nähert sich zwar der Dämpfer wieder der Saite, setzt aber noch nicht auf sie auf. Sie können so in den noch klingenden Ton / Akkord hinein wieder anschlagen, können also ohne Pedaleinsatz ein Legato zwischen gleichen Tönen hervorbringen. Zu Ravel fällt mir noch diese Stelle (Bsp.304) aus dem dritten Satz des G-DurKonzerts ein, wo die Repetitionen mit dem zweiten Finger noch zuverlässiger, prägnanter, motorischer kommen als mit der üblichen und weicheren Folge 3 - 2 - 1 Bsp.304 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 Bsp.304: Bei Repetitionen mit dem zweiten Finger stützt der Daumen die Beuge der unteren beiden Fingerglieder des zweiten Fingers. Um die Stellungnahme zu Ludwig Hoffmanns bzw. Roland Kellers Fingersatzregel Nr.7 abzuschließen: Die Fanfarenstöße am Ende der Introduzione von Liszts Funérailles (Bsp.305) werden, natürlich, mit dem gleichen Finger gespielt. - 330 Bsp.305 Bsp.305: Eine vorteilhafte Ausführung der Repetitionen ist die mit 3 und 1 oder, von der Seite angeschlagen, mit 3 und 2 Die Regel Nr.8 ("Vermeide die Folge 3 - 4 bzw. 4 - 3") hat viele Kontroversen hervorgerufen. Hoffmann argumentierte, richtig, mit den Gegebenheiten der Anatomie der Hand: Im Handrücken sind zwischen dem dritten und vierten Finger quere Sehnenbänder (connexus intertendinei); diese bewirken, dass die Finger 3 und 4 in nur sehr eingeschränktem Maße unabhängig voneinander agieren können. Tatsächlich ist eine saubere Fingerablösung zwischen 3 - 4 bzw. 4 - 3 schwierig, besonders dann, wenn der dritte Finger auf weiß und der vierte, darüber erhöht, auf schwarz zu spielen kommt. Hoffmann brachte dafür gerne das Beispiel mit der auf Tonband aufgenommenen Tonleiter. Werde das Band anschließend mit einer höheren Geschwindigkeit abgespielt, sei an den Stellen, an denen die Folge 3 - 4 bzw. 4 - 3 gespielt wurde, nur eine Verwischung zu hören. Das hat mich seinerzeit beeindruckt, heute ist meine Antwort: Na und!? Mehr als alle anderen steht diese Regel, die Regel Nr.8, musikalisch analogen Fingersätzen im Wege. Um der ihr Genüge zu tun, ist man oft zu umständlichen Umwegen gezwungen: Innerhalb einer allgemeinen Fließrichtung, einer Sequenz etwa, kann es dann unumgänglich werden, in der Bewegung ständig zurückzusetzen, viele zusätzliche Unter- und Übersätze, sprich: Richtungsänderungen zu machen, die ohne die Regel nicht nötig wären. . Am nachhaltigsten haben mich Schüler belehrt, die mir, unbekümmert von der 3 - 4 - Regel, eine gute und gleichmäßige Geläufigkeit vorgeführt haben. Die Regel darf aber nicht achtlos beiseite gelegt werden; denn die sehr eingeschränkte Unabhängigkeit des Mittel- und Ringfingers voneinander ist eine Tatsache. Wenn Schüler auf die Idee kamen, mit 3 - 4 zu trillern, habe ich das unterbunden; mich damit durchzusetzen, war leicht, weil sie schnell begriffen haben, dass jede angebotene Triller-Alternative besser gelingt. Bei einer, rechts, abwärts gespielten D-Dur-Tonleiter, bereitet mir der Fingersatz 5 4 - 3 - 2 - 1 bei den Anfangstönen D - Cis - H - A - G ein geradezu körperliches Unbehagen. Zwischen 4 (Cis) und 3 (H) ergibt sich eine unangenehme Beengung, weil der 4.Finger, hoch, auf schwarz (Cis) und der 3.Finger darunter auf weiß (H) zu spielen kommt. Ich nehme deshalb 5 - 3 - 2 - 1, habe damit, am Start, ein besseres Gefühl der Kontrolle, und es verlagert sich dadurch zwei Töne weiter, bei G - Fis, die Folge 4 - 3 von der ungünstigsten Variante (= 4 auf schwarz, 3 auf weiß) in die günstigere (= 4 auf weiß, 3 auf schwarz). Und der Übersatz 1 - 4 vorverlagert sich - 331 - von G - Fis auf A - G. Damit allerdings verletze ich Regel Nr.10 ("Setze den Daumen unter den 4.Finger nur nach schwarzen Tasten und den 4.Finger über den Daumen nur auf schwarze Tasten! "). Will ich aber der Regel Nr.8 und der Regel Nr.10 genügen, geht dies meist nur auf Kosten von Regel Nr.9 ("Verwende den Daumen auf verschiedenen Tasten nacheinander nur, wenn mindestens zwei andere Finger dazwischen gespielt haben.") ... Dies zeigt: Wer Regeln aufstellt, sieht sich schnell von ihnen in die Zange genommen. Jede der Regeln ist gut begründbar, aber nie können gleichzeitig alle befolgt werden. Es gilt zu entscheiden, jedes Mal. Dem Erfahrenen erschließt sich aus der Aufgabe, die Beachtung welcher Regel gerade den meisten Nutzen bringt. Was die Regel Nr.8, die 3-4, 4-3- Regel, betrifft, ist es viel besser, sie durch eine übergeordnete Empfehlung zu ersetzen. Diese Empfehlung, die die 3-4, 4-3-Regel weitgehend mit einschließt, könnte lauten: Lasse die Finger 3, 4 und 5 nicht allein!, genauer: Lasse die Finger 3, 4 und 5 nicht zu lange alleine spielen! "Nicht zu lange" ist natürlich unpräzise formuliert, gemeint ist, man solle die drei Finger immer gut mit dem zweiten und dem Daumen "durchmischen". Literaturbeispiele erübrigen sich, als Nachweis genügt eine einfache Tonfolge, sagen wir, links, die Folge C - D - E; diese soll oft und schnell 'rauf- und herunter gespielt werden. Bei allen Klavier spielenden Menschen geht dies mit 3 - 2 - 1 - 2 - 3 -... am besten, und bei allen ist es mit 5 - 4 - 3 - 4 - 5 - ... am schwierigsten. Und dazwischen ist es mit allen Kombinationen, an denen 2 und/oder 1 beteiligt sind, leichter als mit 5 - 4 - 3 gleichmäßige und unverklebte Abfolgen hervorzubringen. Zu Regel Nr.11 (Verteilung aller Schwierigkeiten auf beide Hände) ist, ergänzend zum dem, was darüber im Anhang zu Kapitel 5 gesagt wurde, anzumerken: Viele in den vorherigen Kapiteln besprochenen Literaturstellen haben gezeigt, dass Verteilungen keineswegs nur der technischen Erleichterung dienen, sondern auch klanglich unverzichtbar sind, z.B. in den nicht seltenen Fällen, in denen ein Bass lange manuell festgehalten werden muss, damit er einen auf ihn folgenden Pedalwechsel überlebt. Ein gutes Beispiel für eine sehr sinnvolle Verteilung im Dienste einer technisch besseren Ausführung ist eine Passage aus dem 4.Satz von Beethovens Sonate A-Dur, op.2 Nr.2 (Bsp.306). Ein Zurückweichen im Tempo klingt nach Verlegenheit, sehr wirkungsvoll dagegen ist, wenn der Aufgang im Grundtempo weiterläuft. Damit die Tonleiter in dem sehr schnellen Tempo nicht nur als Glissando hörbar wird, sondern so, dass jede Note noch gut distinguierbar bleibt, ist eine Verteilung unerlässlich. Die handschriftlich eingetragene ist sehr geeignet und bewährt; sie reduziert Untersätze, da selbst der flinkste Daumenuntersatz gegenüber anderen Fingerfolgen immer eine gewisse Bewegungshemmung darstellt (siehe Regel Nr.9). Hinter Beethovens Textverteilung soll man nicht immer einen tieferen Sinn suchen: Hier in Bsp.306 ist sie jedenfalls für die Ausführung ohne jede Verbindlichkeit. Wie an anderen Stellen seiner Werke, wechselt Beethoven dort ins andere Notensystem, wo er sich am besten Hilfslinien ersparen kann. - 332 - Bsp.306 Der Lauf muss völlig akzentfrei ausgeführt werden, die Akzente ( ) dienen der rhythmischen Orientierung. Verteilungen bedeuten vermehrte Gedächtnisarbeit, da wegen der Übernahme von Tönen mit der anderen Hand das motorische Gedächtnis ausgeschaltet wird, das sich im Fortschreiten der Hand von Ton zu Ton durch das Fühlen der Intervallspannungen bildet. Erschwert ist die Memorisierung besonders in den Fällen, in denen eine Hand ihre Position während einer Tonfolge kurz verlässt, um aus dem Part der anderen Hand zu deren technischer Erleichterung ein paar Töne herauszufischen. Dieses Verlassen und Wiederaufsuchen einer Position führt oft zu Gedächtnis-Unfällen. Auch sehr gut erdachte, vernünftige Verteilungen können mit dem musikalischen Empfinden kollidieren, dort, wo die Bewegung der Töne in einer engen Verbindung zu einer körperlichen Bewegung steht. In meiner Diplomarbeit von 1974 "Über Fingersätze und Arrangements" (die ich heute niemandem mehr zeigen würde) habe ich für den dramatischen Absturz am Ende von Chopins d-moll-Prélude (Bsp.307) die hier gezeigte Verteilung vorgestellt, die den Abgang technisch tatsächlich sehr leicht (aber nicht risikolos!) macht. Nicht erst seit heute erscheint mir dieses Arrangement als geradezu lächerlich. Der Wunsch, das Herabstürzen im Arm mitzufühlen, ist ein urmusikalischer Wunsch, der aus der Verbindung zwischen musikalischer und körperlicher Spannung erwächst. Bsp.307 321 5 321 5321 1235 3+2 3+2 1235 ? 1235 Wie sehr jemand diesen Zusammenhang zwischen Musik und Körper spürt, hat Einfluss darauf, ob, wie und wo er einen Notentext verteilt. Die Art zu verteilen gibt Auskunft über die interpretatorische Haltung. Im Zusammenhang mit Verteilungen in der Durchführung des ersten Satzes von Brahms' f-moll-Sonate hieß es dazu im fünften Kapitel, dass oft gerade die Pianisten einen glättenden Fingersatz wählen, die auch interpretatorisch zur Glätte neigen. Für viele ist Musik in erster Linie spirituell, körperlos, von abstrakter, geistiger - 333 - Gestalt (was ja objektiv richtig ist); ein sf ist dann nur ein akustisches Signal und nicht das, was ein sf auch sein muss: der (schon erwähnte) Ruck durch den Körper. Musiker, die Musik eher als nur akustisches Ereignis wahrnehmen und auch überwiegend über das Ohr auswendig lernen, solche Musiker können Texte viel unbedenklicher umverteilen als die, die Musik stark körperlich miterleben und bei denen für die Memorisierung auch die motorische Prägung eine große Rolle spielt. Ein eindrucksvolles Beispiel für das körperliche Miterleben und Erfühlen des musikalischen Gehalts finden wir in Liszts zweiter Legende, der Legende des heiligen Franziskus von Paola, der die Meerenge von Messina auf seinem ausgebreiteten Mantel überquert. Das tönende Auf- und Ab der Meereswellen findet seine unmittelbare körperliche Entsprechung in diesem schönen Solo für die linke Hand (Bsp.308). Dieses Solo nicht umzuverteilen, ist notwendiger Teil der Interpretation. Bei ausdrucksstarken Künstlern spielt es meist keine große Rolle, ob sie verteilen oder nicht, z.B. einen Intervallsprung tatsächlich ausführen oder sich - oft sinnvoll den Sprung durch Handaufteilung ersparen: Sie können die dem Sprung innewohnende Spannung auch mit einer Verteilung fühlen. Bei diesem Solo für die linke Hand in der Franziskus-Legende allerdings oder auch im Falle des Schluss-Abgangs im d-moll-Prélude (Bsp.307) hätte ich als Lehrer bei keinem Studenten eine Handaufteilung zugelassen. Bsp.308 Das Solo der linken Hand repräsentiert eine Einheit zwischen musikalischer und körperlicher Bewegung. Nicht aufzuteilen ist hier Teil der Interpretation. - 334 - Die Geringschätzung von Technik und Übung Claudio Arrau kam 1913 im Alter von zehn Jahren als Stipendiat der chilenischen Regierung nach Berlin und blieb dort bis 1940. Er ist ein verlässlicher Chronist des kulturellen Lebens dieser Zeit. Arrau lernte bei Martin Krause, der Schüler Franz Liszts gewesen war. Zu Krauses Schülern am Stern'schen Konservatorium zählte auch Edwin Fischer, der sein Studium gerade beendete, als Arrau seine Lehrzeit bei Krause antrat. Von 1925 bis zu seiner Emigration aus Deutschland 1940/41 war Arrau selbst Professor am Stern'schen Konservatorium. Seine Beobachtungen sind niedergelegt in den Gesprächen mit dem amerikanischen Musikschriftsteller Joseph Horowitz, zusammengefasst in dem Band "Leben mit der Musik". Was Claudio Arrau offen ausspricht: Viele der damaligen pianistischen Größen Deutschlands besaßen nicht nur keine besondere Technik, sie hatten auch gar kein Interesse daran. Bekannte Künstler: Eugen d'Albert, Edwin Fischer, Eduard Erdmann, Elly Ney sowieso, hielten es, so Arrau, für oberflächlich, ja betrachteten es als unter ihrer Würde, sich gründlich mit Spieltechnik auseinanderzusetzen. "Wilhelm Kempff", so Arrau im Interview, "war auch dieser Meinung. Ich glaube nicht, dass er jemals geübt hat." Er berichtet von Eugen d'Albert, der sehr suggestiv und sehr falsch gespielt habe, und von dem Pianisten Conrad Ansorge; der habe manchmal nur falsch gespielt und hatte eine große Verehrer-Gemeinde. Mit seiner Akkuratesse ist Arrau, inmitten einer Kultur des Al-fresco-Spiels und der Ungenauigkeit, wie ein erratischer Block. Er habe, sagt er, jeden Tag, vor dem eigentlichen Repertoire-Studium, einige der schwierigen Chopin-Préludes und die Fuge aus Beethovens Hammerklavier-Sonate durchgespielt. Dies zeugt von einer imponierenden professionellen Einstellung. Sie erinnert an Hugo von Hofmannsthal, der täglich ein Sonett schrieb - nicht zur Veröffentlichung, sondern nur, um in Übung zu bleiben. Angesichts einer weiten Übereinkunft, nach der falsche Töne - offenbar mehr als die richtigen - wie selbstverständlich zur Klavierkunst gehörten, kann sich selbst ein so ernster und vornehmer Mann wie Arrau nicht ganz des Spotts enthalten. Auf die Frage von Joseph Horowitz, ob sich das Berliner Publikum nicht an den vielen falschen Noten gestört habe, antwortet er: "Nein, das galt als genial!" Horowitz bohrt nach: "Sie meinen, die Zuhörer fanden es sogar gut, wenn ein Pianist falsch spielt?", darauf Arrau: "Ja. Das war das gute Recht des Genies." Die Einstellung zu Technik und Üben, über die Claudio Arrau berichtet, galt nicht nur für die Berliner Pianistenszene der Jahre 1920 bis 1940, sie galt allgemein und hatte lange Ausläufer in die Vergangenheit und bis zu uns in die Gegenwart. Längst besteht allgemeine Konvenienz, dass ein Interpret eine gute Technik besitzen sollte, dennoch: Wer ein Werk sauber oder gar perfekt darbietet, macht sich damit auch heute noch bei Vielen zunächst einmal verdächtig. Es gibt eine eigenartige Philosophie, für die Technik nicht als das gilt, was sie selbstverständlich sein sollte: Voraussetzung und Dienerin der Kunst, sondern als etwas, das zu ihr, der Kunst, geradezu in Widerspruch steht. - 335 - Das Unvollkommene, das mit Fehlern Behaftete, so der Gedanke, verleiht dem Vortrag den versöhnlichen Tupfer von Wärme und Menschlichkeit; denn Menschen machen Fehler, sauberes Spiel aber, schlimmer noch: Perfektion steht für maschinelle Kälte. Man begegnet häufig Kommentaren, Kritiken etc., die diesen konstruierten Widerspruch von Technik und Kunst zum Ausdruck bringen (wobei das griechische Wort ἡ τέχνη - technä die Kunst bedeutet). Manchmal heißt es dann nicht nur, der Pianist habe es trotz, Nein!, er habe es wegen seiner sehr guten Technik an Tiefe des Ausdrucks mangeln lassen. Mein lieber Freiburger Kollege, der Pianist Robert Alexander Bohnke, schwärmte für Alfred Cortot, einschließlich seiner falschen Töne; diese seien ihm lieber als die richtigen Töne vieler anderer Pianisten. In der Fernsehübertragung einer Orchesterprobe für Smetanas "Die Moldau" hörte ich vor vielen Jahren den Dirigenten Ferenc Fricsay sagen: "Spielen Sie falsche Töne, aber spielen Sie atmosphärische Töne!", eine Bemerkung, die, obgleich zum Orchester gesprochen, wohl mehr für den Fernsehzuschauer bestimmt war. Orchestermusiker dürften eine Ermunterung zu falschen Tönen kaum ernst nehmen. Bemerkungen, die fehlerhaftem Spiel Charme und eine musikalische Aura verleihen wollen, machen Eindruck, besonders auf Laien, und sind doch unsinnige Bemerkungen. Falsche Töne besitzen keine Atmosphäre, sie stören die Atmosphäre, sind immer ein Makel, falsche Töne haben keinen musikalischen Ausdruckswert. Den haben nur die richtigen Töne, schon weil es die vom Komponisten niedergelegten Töne sind und damit fast immer auch die besten. Der bedeutende Klavierkünstler Edwin Fischer habe, heißt es, sehr fehlerhaft gespielt und hat doch die Menschen mit seinem Spiel tief berührt. Andere Pianisten spielen perfekt und lassen den Hörer kalt. Natürlich gibt es das oft. Unzulässig und zutiefst unprofessionell aber ist es, nun, im Umkehrschluss, technische Unzulänglichkeit gleichsam als Voraussetzung beseelten Musizierens anzusehen. Einen grundsätzlichen, gleichsam wesenhaften Widerspruch zwischen einer sehr guten Technik und musikalischer Tiefe an- bzw. hinzunehmen, ist nichts anderes als ein Qualitätsverzicht a priori. Denn selbstverständlich gibt es diese Einheit von Beseeltheit und Perfektion. Sie ist, natürlich, sehr selten, so wie alles sehr Gute sehr selten ist - und eben gerade deshalb erstrebenswert. Ich denke an Friedrich Guldas Beethoven-Abende: technisch perfekt und spannend, jede Note unter Strom. Irgendwann in den späten 1980-er-Jahren - das Datum konnte ich nicht mehr herausfinden - hörte ich Murray Perahia (vor seiner jahrelangen Verletzungspause) im Münchner Herkules-Saal mit Schuberts vier Impromptus op.142, der Wanderer-Fantasie und den Variations sérieuses von Mendelssohn. Der Klavierabend war die vollkommenste Einheit von Technik und Musik, die sich denken lässt, war makellose Schönheit. Über die Gleichgültigkeit vieler Kollegen gegenüber fehlerhaftem Spiel habe ich mich oft gewundert, eine Haltung, die sich bisweilen geradezu in Wohlwollen verwandelt, wenn der Leistungsstand des Prüflings dem des Prüfers noch nicht gefährlich nahe kommt. Als unvergesslich eingeprägt hat sich mir die Bemerkung eines Kollegen der Freibur- - 336 - ger Hochschule: "Mich stören falsche Noten überhaupt nicht, denn ich weiß ja, wie es richtig klingen muss." Die Bemerkung fiel in einer Prüfungsbesprechung, nachdem ich gesagt hatte, das mit falschen Noten und Aussetzern durchsetzte Spiel der soeben gehörten Kandidatin könne bei der Bewertung nicht unberücksichtigt bleiben. Die Bemerkung verstand ich erst, nachdem ich den Kollegen wenig später, im Oktober 1990, in einem Klavierabend mit Werken Robert Schumanns gehört hatte: Im Publikum stilles Aufstöhnen, quälende Peinlichkeit. Über Fehler und Schludrigkeit sehen die hinweg, die nie am Konzertleben, und sei es wenigstens für kurze Zeit, teilhatten und das Podium auch nie als Beitrag zum Lebensunterhalt ansehen mussten. Als nicht erstrebenswert hinzustellen, was ich nicht kann bzw. nicht erreicht habe, ist eine sehr häufige Schutzhaltung; es ist der Wunsch, den Schmerz über die eigene Unzulänglichkeit zu lindern. Ich hasse Fehler, sie sind wie hässliche Flecken. Leider sind mir in meinen Konzerten immer wieder Fehler unterlaufen. Nie aber wäre es mir eingefallen, diese in einen Vorzug umzudeuten. Auswirkungen auf Schule und Allgemeinbildung Die Geringschätzung von Technik und Präzision hat nicht nur persönliche Gründe, sondern auch solche, in denen eine allgemeine Geistesströmung zum Ausdruck kommt. Übung, Technik, handwerkliches Können, Sauberkeit, Perfektion wurden lange misstrauisch beäugt, ja waren verdächtig, nicht nur in der Musik, mehr noch in der bildenden Kunst. Denn Makellosigkeit verlangt Übung in vielen Wiederholungen. Das aber wird mit geistlosem Drill gleichgesetzt. Die Erklärung für die verachtete Stellung, die die Übung in den westlichen Ländern einnimmt, gibt uns der Philosoph und Pädagoge Otto Friedrich Bollnow (1903 1991). Die folgenden Sätze sind seinem Buch "Vom Geist des Übens" entnommen. "Die Abneigung gegen die Übung findet ihre theoretische Rechtfertigung in der modernen, um die Jahrhundertwende einsetzenden Reformpädagogik. Im 'Zeitalter des Kindes', das man damals enthusiastisch verkündete, ging es um die Entfaltung der schöpferischen Kräfte im Kinde ... Man schätzte den unmittelbar aus dem Innern quellenden Ausdruck, besonders auf künstlerischem Gebiet. Übung erscheint dabei als lästiger Zwang, der die Unmittelbarkeit des schöpferischen Vorgangs zerstört. Denn Übung ist wesensmäßig unproduktiv, weil sie sich als Wiederholung dem Alten, schon Fertigem zuwendet. Die Frische des ursprünglichen Lebens scheint in der festen Gewohnheit zu erstarren." Nicht in fester Gewohnheit erstarren! Deshalb das Gebot: im Stoff rasch fortschreiten, immer Neues bieten. Gespeist von der Auffassung, alles müsse Spaß machen und der Unterricht solle vor allem unterhalten, wird, in ständiger Anbiederung, alles vermieden, was die "kids" langweilen und "abtörnen" könnte; Übung aber ist langweilig, "weil sie lange beim schon Bekannten verweilt und dies bis zur Geläufigkeit wiederholt."(Bollnow). Nur Übung und die damit verknüpften vielen Wiederholungen aber bewirken, dass sich die wichtigen Grundlagen bilden und einprägen, dass sie - 337 - "sitzen", dass sich Wissen festigt und in angewandtes Können verwandelt. Ohne Wiederholung wird gar nichts gefestigt. Die neue Lernkultur gesteht den Schülern diese unerlässlichen Phasen der Festigung von Wissen nicht mehr zu, sie gelten als zeitraubender Hemmschuh beim schnellen und oberflächlichen Voranschreiten im Stoffe. Grundschullehrerinnen berichten übereinstimmend, dass sich Kinder heute das Einmaleins, eine lebenslang nützliche Kulturtechnik, nicht mehr sicher einprägen, der Lehrplan sehe die dafür nötige Zeit nicht vor. Mit der Begründung, das Auswendiglernen von Jahreszahlen (Dieter Schwanitz: "Leuchtbojen der Geschichte") sei sture Paukerei, hat man im Fach Geschichte die chronologische Ordnung aufgegeben. Mit der neuen Lernkultur haben die dafür verantwortlichen Kulturpolitiker und Kulturbürokraten bewiesen, dass sie den Verstand verloren haben. Ich erlaube mir den Hinweis auf ein Buch des Philosophen Christoph Türcke: "Lehrerdämmerung. Was die neue Lernkultur in Schulen anrichtet." (2016) Dieter Schwanitz, Bestsellerautor ("Campus") und bis 1997 Professor für Anglistik an der Universität Hamburg, schreibt, er habe in einer systematischen Datenerhebung über 10 Jahre hinweg die Anfänger des Studienfaches Anglistik befragt, wer Oliver Cromwell war und wann er ungefähr gelebt hatte. Diese Frage konnten nur sechs von 100 Befragten beantworten, und die Lebensdaten Shakespeares seien gerecht auf alle Epochen zwischen dem 12. und 19.Jahrhundert verteilt worden. Der Leitspruch "Übung macht den Meister" wurde ersetzt durch Kreativität, dieses unsägliche Wort, das sich ausgebreitet hat wie Schimmelpilz in einem feuchten Keller. Kreativität bedeutet alles und nichts, das Wort steht für Beliebigkeit, für Ungenauigkeit, das Ungefähre, Ungeformte, für Schludrigkeit. Und viele sind bereit, das Unfertige, Verwaschene als kreativ schöpferisch anzusehen und - zu loben. Otto Friedrich Bollnow: "Wo man nur auf den schöpferischen Ausdruck bedacht ist, entsteht sehr bald die Gefahr der Nachlässigkeit. Das Ergebnis bleibt im Ungenauen und Ungefähren, solange der strenge Maßstab einer genauen Formung vernachlässigt wird. Der Ausdruck bleibt ungeformt und die anfänglich kindliche Produktivität zerflattert in einem undisziplinierten Dilettantismus." Anmerkung: 1973 gelangte aus der deutschen Kultusministerkonferenz ein Witz an die Öffentlichkeit, der diesen Dilettantismus auf den Punkt brachte. Der Witz zeigte, anhand einer Mathematikaufgabe, den Unterschied auf zwischen der fortschrittlichen hessischen Gesamtschule und dem rückständigen und veralteten bayerischen Schulsystem: Ein Kilo Kartoffeln kostet eine Mark und zwanzig. Der Preis der Kartoffel steigt um 10 %. Die Aufgabestellung an der bayerischen Schule lautet: Wie viel kostet das Kilo Kartoffel nach der Preiserhöhung? Die Aufgabenstellung an der hessischen Gesamtschule lautet: Unterstreiche das Wort Kartoffel und diskutiere über den Preis! Erst im Üben formt sich der Mensch, in der Übung selbst liegt der Sinn, sie ist Charakterformung, z.B. auf dem oft langen Weg der Einstudierung eines großen Werkes. Otto Friedrich Bollnow: "Übung ist nicht nur als Vorbereitung zu betrachten, die ihren Sinn erfüllt hat, sobald das einzuübende Können erreicht ist, sie bedeutet in sich selbst schon eine nicht zu überbietende Entfaltung und Erfüllung des Lebens. In diesem Sinne bleibt der Mensch lebenslang ein Übender. Er verliert seine Lebendigkeit und fällt der Erstarrung anheim, sobald er aufhört zu üben." - 338 - Im asiatischen Kulturkreis ist diese Erkenntnis selbstverständlicher Teil des Lebens. Etliche Jahre lang hatte ich mir die Listen der Kandidaten aufgehoben, die an der Musikhochschule Würzburg zur Aufnahmeprüfung im Hauptfach Klavier angetreten waren. Der Anteil ausländischer Studienbewerber lag bei 70 %. Das ist eine recht zuverlässige, über die Jahre ermittelte Zahl. Prof. Wolfgang Manz von der Musikhochschule Nürnberg meint, der Prozentsatz dürfte eher noch höher sein. Fast alle dieser ausländischen Studienbewerber kommen aus Asien, davon wiederum stammte früher der größte Teil aus Japan, heute sind es in der Mehrheit junge Damen aus Korea, die an einer deutschen Musikhochschule Klavier studieren wollen. Erst seit etwa 15 Jahren kommen auch viele aus der VR China, aus Taiwan kamen schon ab den 1960-er-Jahren Studenten zum Studium nach Deutschland. Aus unseren europäischen Nachbarländern Italien, Frankreich, England dagegen bewirbt sich bei uns kaum jemand um einen Studienplatz für das Hauptfach Klavier. Selbst ein prominenter Lehrstuhlinhaber bekommt heute mit deutschen Studenten seine Klasse nicht mehr voll. Neben den asiatischen auch ein paar tüchtige deutsche Studenten in der Klasse zu haben, ist für einen Professor inzwischen fast zu einer Prestige-Sache geworden. Tatsache, unausgesprochene, ist: Ohne die Studenten aus Asien wären die meisten Klavier-Lehrstühle überflüssig. Anmerkung: Ich zitiere ein paar Sätze aus einem Artikel, den Christian Nürnberger im Juli 2007 für das Magazin der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat. Die Sätze zeigen auf, dass eine Lernkultur des Oberflächlichen nicht nur kulturelle sondern, irgendwann, auch wirtschaftliche Auswirkungen haben wird: "Warum schneiden deutsche Autos bei den jährlichen Pannentests des ADAC regelmäßig um so viel schlechter ab als japanische Autos? Hängt es vielleicht damit zusammen, dass in der japanischen Erziehung gedrillt und gezwiebelt wird, während hierzulande viel Wert auf die kreative Entfaltung, aber wenig Wert auf Genauigkeit gelegt wird? Vielleicht hat es auch etwas mit der Abschaffung des Faches Schönschreiben zu tun und der allenthalben vorhandenen Bereitschaft, Halbgares, Unfertiges und schlampig Hingerotztes zu akzeptieren. Das wäre noch hinnehmbar, wenn dann wenigstens die Patent-Statistik der »kreativen Deutschen« haushoch über der Statistik der »gedrillten Japaner« stünde. Tut sie aber nicht." Technik und die bildende Kunst Einer Anschauung von Technik als etwas maschinell Kaltem, Seelenlosem, das dem künstlerischen Ausdruck im Wege steht, waren in der Interpretationskunst immer Grenzen gesetzt; denn selbst wenn der Pianist Conrad Ansorge, wie Claudio Arrau siehe oben - berichtet hat, manchmal nur falsche Noten spielte, musste doch erkennbar bleiben, welches Werk er gerade vorzutragen beabsichtigte. In der bildenden Kunst gibt es diese Begrenzungen nicht mehr. Die Möglichkeiten, Kunst zu machen und Künstler zu sein, haben sich explosiv ausgeweitet. Wird handwerkliches und durch Übung erworbenes Können nicht mehr als Voraussetzung für Kunst angesehen, ja als etwas, das zu ihr im Gegensatz steht, bedeutet das nichts weniger als die Aufhebung des Begriffs der Professionalität. - 339 - Siegfried Kracauer hat diese Wandlung des Kunstbegriffs mit dem Satz kommentiert: "An das Nichtmalenkönnen werden, seit es eine eigene Kunstform geworden ist, immer höhere Anforderungen gestellt." "Der wahre Künstler macht das, was das Volk nicht kann" (Markus Lüpertz, SZMagazin, 14.9.2007), er hebt sich, eben auf seinem Gebiet, durch sein Können von der Masse ab. Das gilt schon lange nicht mehr. Jeder Dilettant kann Künstler sein; denn jeder Mensch ist kreativ - irgendwo, somit ist jeder auch ein Künstler irgendwie. Es genügt, sich als Künstler zu definieren. Theoretische Untermauerungen einer von Technik befreiten Kunstdeutung gibt es seit den Dadaisten, ich hörte sie, bewusst, zum ersten Mal 1983 in Paris, wo ich an der cité des arts für sechs Monate Stipendiat des Bayerischen Kultusministeriums war. Ich hörte sie von anderen Stipendiaten, den Malern und Bildhauern. Technik, hieß es da etwa, unterbinde den kreativen Strom künstlerischer Intuition aus dem Unbewussten. Keine Technik in der Kunst also, von hoher Kunst aber ist die Technik der sprachlichen Verschleierung des einzig wahren und tiefen Beweggrundes: keine Lust zu Übung und Arbeit. Fragen Sie einen Kunststudenten, welche Voraussetzungen nötig seien, um Künstler zu werden. Talent werden sie als Antwort nicht bekommen, Sie werden hören, man müsse kreativ sein. Aber! Die Begriffe Talent und Kreativität werden immer durcheinandergebracht: "Der Drang sich kreativ, sich künstlerisch zu betätigen und die dazugehörige Begabung sind Eigenschaften, die keineswegs automatisch zusammengehören. Sie können zusammentreffen, selten und zufällig, so etwa, wie ein Gärtner einen Buckel haben kann.“ (Alexander Roda Roda) Wollen Sie Lächerliches sehen, wirklich Lächerliches, die ständige Verwechslung von Kunst mit Gags - oder mit Sozialarbeit, dann besuchen Sie die Jahresausstellung einer staatlichen Kunstakademie; in München findet sie jeweils im Juli statt. Kein Klischee über zeitgenössische Kunst ist so abgenutzt, als dass es sich dort nicht bestätigte. Auch ausgelutschte Weißwursthäute (Johanna Doll, Klasse Prof. Nikolaus Gerhart) brauchen Sie als Ausstellungsobjekte nicht missen. Der Staat hält sich mit den Kunstakademien eine von allen Normen freie Spielwiese. In der Abteilung "Freie Kunst" gibt es keine Studienpläne, keinerlei Verpflichtung, in seinem Fachgebiet auch nur elementarste Grundlagen zu erwerben, entsprechende Kurse zu besuchen, so etwa wie ein Klavierstudent auch Fächer wie Akustik, Gehörbildung, Harmonielehre etc. besuchen muss. Anmerkung: Gerechterweise muss eine gute Einrichtung der Kunstakademie erwähnt werden: die Werkstattmeister. Das sind angestellte Handwerksmeister: Steinmetze, Metallbauer, Photographen, Schreiner sowie Spezialisten für Tiefdruck, Keramik, Tipographie, Kunststoff usw. Sie bringen den Studenten, die sich dafür interessieren, die nötigen Kenntnisse ihrer Fachgebiete bei. Verantwortungsvolle Professoren fordern ihre Studenten auf, zu den Werkstattmeistern zu gehen, bei ihnen zu lernen und zu üben. Andere Professoren sind nie da, sind gegenüber den ihnen anvertrauten Studenten gleichgültig, nehmen ihren Lehrauftrag nicht oder nur schludrig wahr, lassen sich nur gelegentlich sehen, um ein paar huldvolle Worte zu sprechen ... Mein Sohn Valentino hat an der Münchner Kunstakademie studiert. Kurz nach Beginn seines - 340 Studiums sagte er mir, "die Einzigen, von denen man an der Akademie etwas lernt, sind die Werkstattmeister" (welche Ansicht er später revidiert hat, nachdem er zu einem fähigen Professor gekommen war, der sich seiner Studenten annahm). Die Kunstakademie ist in drei Abteilungen gegliedert: Freie Kunst, Kunstpädagogik, Innenarchitektur. Kunstpädagogik ist der Ausbildungsgang für Kunsterzieher an Gymnasien. Studenten der Kunstpädagogik und Innenarchitektur müssen beim Diplom die Belegung von Pflichtfächern nachweisen. Solche Pflichtfächer sind: Zeichnen, Kunstgeschichte, ästhetische Theorie, Werkanalyse, Produktgestaltung, Bautechnik. Die Fächer aber heißen nicht mehr Fächer sondern, seit 2010, Module. In der Fakultät Freie Kunst sind zusammengefasst: Malerei, Bildhauerei, Photographie, Bühnenbild & Kostüm, Medienkunst, Keramik & Glas, Schmuck & Gerät. In diesen Fachrichtungen gibt es keine Verpflichtung zum Besuch von Grundkursen, Vorlesungen, Seminaren, Übungen. Handwerklich technische Fähigkeiten braucht ein Künstler, um als solcher zu gelten, seit langem nicht mehr zu besitzen, er muss nicht einmal in der Lage sein, ein Strichmännchen zu zeichnen, ganz zu schweigen von so unkreativen Vorkenntnissen wie einen Rahmen verkeilen, die Leinwand aufziehen, spannen, grundieren. Aber er sollte einen bestimmten Jargon beherrschen, aria fritta - frittierte Luft, wie es die Italiener nennen; gemeint ist der Phrasenmüll, der mit der Kunstszene in Weseneinheit verschmolzen ist: Schonungslose Reduktion, Erstarrung in formalem Kausalitätsdenken, Antagonismen, Raumgreifende Installation, Verkrusteter Formenkanon, Kristallines Formenprinzip, Prozesshaft strukturiert, Soziokommunikative Variable, Konstellation ungerichteter Energien, Chiffriert-biomorphe Archetypen, u.s.w. heißen die Bausteine dieses Imponiergefasels, das nur den einen Zweck hat, jeder Albernheit, jeder Inhaltslosigkeit einen Inhalt zu verleihen. Nichts ist so biegsam wie die Sprache. Sie kann jedem Ressentiment, jeder Ideologie dienstbar gemacht werden - und jedem Blödsinn. Und je mehr erklärender Text, desto weniger spricht das Kunstwerk selbst. An diese Faustregel kann man sich halten. Wie in allen Berufen, in denen man mit seinen Händen zeigen muss, was man kann, ist dem Interpreten die Flucht in Geschwätz verschlossen. Deshalb ist die Interpretationskunst die ehrlichste Kunst. Unter den bekannten Interpreten gibt es niemanden, der sein Metier nicht verstünde, ohne hinreichend manuelles Geschick kann niemand als Interpret Anerkennung finden. Handwerkliches Können ist noch nicht Kunst, aber bewahrt zuverlässig vor Scharlatanerie. Interpretationskunst und Scharlatanerie schließen sich aus. Das Gesagte trifft auch auf viele zeitgenössische Komponisten zu. Lange ist die Liste der Scherze, die den Nachweis erbrachten, dass die bei den Donaueschinger Musiktagen aufgeführten Komponisten oft nicht die geringste adäquate Klangvorstellung dessen besaßen, was sie zu Papier gebracht hatten. Oft bestehen die Partituren ohnehin nicht aus Noten sondern in Graphiken, interpretierbar in grenzenloser Beliebigkeit. Mein Hochschul-Kollege, der Komponist Heinz Winbeck, war dabei, als Karlheinz Stockhausen, irgendwann um 1970, im großen Saal der Musikhochschule München mit den Fingernägeln über eine Hartschaumplatte kratzte. - 341 - Natürlich kann Herr Stockhausen mit den Fingernägeln an einer Hartschaumplatte kratzen, und warum sollen dabei auf der Bühne nicht 20 Staubsauger laufen? Warum soll einer im musikalischen Vortrag nicht mit einem Gabelzinken über einen Teller schrappen ("Aufschrei der gequälten Kreatur!")? Das ist nicht die Frage. Das Frage ist: Warum gibt es Leute, die das auch nur eine Sekunde lang ernst nehmen? Zu allen Zeiten gab es eine größere Anzahl sehr guter Künstler und eine kleine Zahl von Genies. Das ist heute nicht anders: Es gibt großartige Maler, Malergenies - man braucht nur die atemberaubenden Bilder des Gerhard Richter anzusehen - und unter den Komponisten der letzten 50 Jahre sind mit Sicherheit welche, deren Werke man noch in 100 Jahren spielen wird. Auch von der Stufe unterhalb von Ruhm und Anerkennung wäre zu reden: Sehr viel schöne Musik ist drei Jahrzehnte lang allein aus der Kompositionsklasse meines hoch verehrten Kollegen Heinz Winbeck gekommen, der selbst ein bedeutender Komponist ist: phantasievolle und, vor allem, sinnliche Musik, die Note für Note aus einer Klangvorstellung niedergeschrieben wurde, Musik, die unmittelbar anspricht, ohne weitschweifiger Erläuterungen zu bedürfen. An künstlerischer Güte mangelt es nicht, der Unterschied zu früher ist: Seit Übung, Ausbildung und Technik als Voraussetzung für Kunst wegdefiniert wurden, sind für Scharlatanerie und Bluff wunderbare Zeiten angebrochen. Der wissensdurstige Kunstliebhaber sitzt in einem Konzert zeitgenössischer Musik und hört eingespielte Motorengeräusche von Kampfhubschraubern; er steht in einem Museum vor Installationen vor, sagen wir, miteinander verschraubten Fahrradfelgen, vor einem Haufen Bauschutt ("Vergänglichkeit") oder vor Wollfetzen, die in vier Reihen übereinander an Holzstangen gehängt sind ("Untitled") u.s.w. Der Besucher denkt: Das ist ein bekannter Konzertsaal, ein bekanntes Symphonieorchester, die Künstler sind bekannt, die Objekte befinden sich in einem bekannten Museum, QualitätsZeitungen berichten darüber in ihren Feuilletons ... also muss doch etwas dahinter stecken!? Seien Sie versichert: Es steckt nichts dahinter, gar nichts. 1994 waren im dänischen Kunstmuseum in Esbjerg sieben Schweinekadaver des Künstlers Christian Lemmerz in Vitrinen ausgestellt worden. Nach der Ausstellung bot das Museum die verwesenden Schweine zum Verkauf an, für 18.000 Mark pro Kadaver. Schließlich handele es sich bei den toten Schweinen um Kunst, sagte Museumsdirektor Peter Meyer. Was aus den Objekten geworden ist? - 342 - Rundfunk- und Plattenaufnahmen Mit der sich schnell entwickelnden Aufnahmetechnik setzte sich durch, dass zu einer guten Interpretation auch eine saubere Ausführung gehört. Eine CD-Einspielung will makellos sein, sie ist ein Dokument und das Dokument wird zur Vorlage. Viele der berühmten Künstler, über die Claudio Arrau aus seiner Zeit in Berlin berichtet hat, wären an dem Anspruch gescheitert, ein makelloses Ton-Dokument abzuliefern. In dem weiter vorne erwähnten Gespräch zwischen Joseph Horowitz und Claudio Arrau richtet Horowitz an Arrau die als Frage zu verstehenden Worte: "Edwin Fischer wäre nicht akzeptabel. Die Vorstellung einer von Fischer eingespielten modernen Plattenaufnahme ist ein Widerspruch in sich selbst. Der Produzent würde ihm sagen: 'Spielen Sie die Exposition noch einmal, damit wir die falschen Töne korrigieren können.' Und er wäre nicht dazu in der Lage." Arraus Antwort: "Das ist richtig." Auch Wilhelm Kempff (1895 - 1991) gehörte zu den Künstlern, die es, wie Claudio Arrau sagt, unter ihrer Würde fanden zu üben. Kempff lebte 30 Jahre länger als Edwin Fischer, und ihm, dem großen Klavierpoeten, machte die Plattenindustrie noch Zugeständnisse. Vor Jahren hörte ich Wilhelm Kempffs Einspielung der WandererFantasie. Bei der sehr schnellen und schweren Passage am Ende des dritten Satzes (die Takte 580 - 586) nimmt er das Tempo um beinahe die Hälfte zurück. Bei Aufnahmen stehen dem Vorteil der Fehlerkorrektur andere Anforderungen gegenüber. Betrachten Sie bitte den Schluss der Wanderer-Fantasie (Bsp.309). Bsp.309 5 3 1 2 1 0 1 1 T.711 01 5 1 01 4 1 01 1 1 5 15 1 1 2 3 5 32 1 5 1 T.715 1 5 1 1 5 Zwischen den Takten 711 und 715 ist eine große Fülle schneller Noten zu absolvieren, aber es sind immer nur die drei Töne C, E und G. Es gibt phänomenale Blattspieler, die spielen die Stelle so vom Blatt, dass es fast wie eine gute Ausführung klingt, aber die Stelle wirklich ganz sauber zu spielen, also so, - 343 - dass stets nur die Tasten C, E und G getroffen werden und keine anderen, das ist sehr schwer. Auch mit einer geschickten Verteilung ist die Gefahr groß, im Gewühl da und dort eine Nebentaste zu streifen. In einem Konzert spielt das keine Rolle, denn auch bei einigen gestreiften Nebentasten bleibt im Publikum doch der Eindruck einer sauberen Ausführung zurück, da die Nebentöne vom der Masse des mächtigen C-Dur-Gesamtklang aufgesogen und wegen des zwischendurch immer wieder gelüfteten Pedals auch gleich wieder gelöscht werden. Bei einer Rundfunk- oder CD-Einspielung aber sollen, als einem Dokument, nur die Töne C, E und G und keine anderen zu hören sein. Haben Sie sich nicht sorgfältig darauf vorbereitet, immer nur die Tasten C, E und G zu treffen und eben keine anderen, dann können die zahlreichen Korrekturen zur Beseitigung kleiner Unsauberkeiten sehr strapaziös werden. Der Tonmeister fordert Sie auf, wegen eines kleinen Wischers hier, dann wegen eines kleinen Wischers dort eine Passage ein ums andere Mal zu wiederholen. Irgendwo zwischen der zehnten und zwanzigsten Korrektur sind Sie nervlich und körperlich am Ende, und jeder weitere Versuch ist mit mehr Fehlern behaftet. Ich erlaube mir einen ganz persönlichen Rat: Bei der Vorbereitung auf eine Rundfunk- oder CD-Einspielung sollten man heikle Stellen immer wieder auch ganz "kalt" und, ausnahmsweise, losgelöst vom künstlerischen Ausdruck ausschließlich daraufhin trainieren, die richtigen Tasten zu treffen, um bei der Aufnahme notwendige Korrekturen souverän zu bewältigen. Dabei ist nicht zu vergessen, dass für eine Produktion nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht. Für meine Aufnahme der gewaltigen Brahms f-moll-Sonate im Jahr 1999 hat mir der Bayerische Rundfunk vier Stunden eingeräumt. Das ist die übliche Zeit für die Produktion eines großen Werkes, wobei Vorbereitungen wie Aufbau, Positionierung der Mikrophone, Balance-Test etc. darin eingerechnet sind. Stillschweigend wird erwartet, dass man die Zeit nicht voll ausschöpft. Der Usus, schwere Stellen vorweg aufzunehmen und später in die Gesamtaufnahme zu montieren, war mir lange unbekannt. Ich hatte zwei Mal Gelegenheit, die Wanderer-Fantasie aufzunehmen. Der zweiten Einspielung vom 22.Dezember 1986 beim (damaligen) SWF Baden-Baden ging am 4.November 1983 eine Aufnahme bei Radio Bremen voraus. Dabei überraschte mich der Tonmeister, Herr Jobst Philipp, mit dem Vorschlag, zuerst nur die bekannten schweren Stellen, z.B. den Schluss (Bsp.309), zu machen. Am Anfang seien die Kräfte noch frisch. Ich habe das abgelehnt, hätte ein solches Verfahren als Verstoß gegen mein Berufsethos empfunden, Herr Philipp aber berichtete mir sofort, er habe die WandererFantasie erst unlängst mit Herrn ... aufgenommen, einem Pianisten, der nie als besonders virtuoser Pianist aufgefallen war, aber gerade wegen seiner SchubertInterpretationen international große Anerkennung erlangt hatte. Und dieser sehr prominente Pianist habe, sagte Herr Philipp, dezidiert gewünscht, vorab die schweren Stellen aufzunehmen. Etwas später konnte ich es selbst miterleben. Zu Liedaufnahmen ins Studio gekommen, begrüßte ein selbstbewusster Tenor das Aufnahme-Team mit den Worten: "Erst einmal machen wir jetzt die hohen Töne!" - 344 - Technische Sauberkeit - der günstige Einfluss der Japaner In den 1960-er Jahren setzte der Zustrom japanischer Klavierstudenten ein. In der Mehrheit waren es junge Damen, und deren durchschnittliches spieltechnisches Niveau lag deutlich über dem ihrer deutschen Kommilitonen. Insbesondere brachten die Japanerinnen eine saubere, gleichmäßige Geläufigkeit mit. Das machte viele kopfscheu, wirkte verstörend, es gab Schmähungen, vor allem von Seiten der Pfuscher. Die Gleichung: Saubere Technik = Ausdruckskälte wurde aus der Requisitenkammer geholt, der Terminus "Japanische Klaviermaschinen" wurde zum geflügelten Wort. Technik ist nicht so wichtig, wir haben dafür das Entscheidende: die interpretatorische Tiefe - den deutschen Tiefsinn. So etwa ließe sich die Ausweichhaltung beschreiben, die angesichts der vielen japanischen Studentinnen mit gut ausgebildeten Händen nicht länger aufrecht zu erhalten war. Das viel kritisierte japanische Techniktraining hat, trotz der Widerstände, ohne jeden Zweifel einen sehr guten Einfluss auf unsere Einstellung zur Technik gehabt und hat dazu geführt, dass unsere Ansprüche an technische Genauigkeit gestiegen sind: Ansprüche, die wir an die Pianisten stellen und die Pianisten an sich selbst. Nach der Ankunft der Japaner hat man in Deutschland begonnen, sauberer zu spielen. Das ist unbestreitbar. Allerdings ist richtig: Das Klavierspiel von Japanern wirkt/wirkte tatsächlich oft mechanisch. Für das "seelenlose Klavierspiel" machen viele den Unterrichts-Drill in Japan verantwortlich. Die Gründe sind andere: 1) die Mentalität, 2) die Sprache. 1) Mentalität: Ein Klavier-Abend ist ein öffentliches Aufzeigen von Gefühlen, ist ein espressives Aus-sich-Heraustreten, ist Ausdruck höchster Individualität, ist ein Herausstellen des Ichs: Man steht im Mittelpunkt, ist Individuum, nicht mehr nur Teil eines Kollektivs. Diese Merkmale eines sich öffentlichen Produzierens widersprechen der japanischen Mentalität. Die japanische Kultur ist ganz auf das Zurücknehmen des eigenen Ichs ausgerichtet. Das Individuum tritt hinter das Kollektiv zurück. Ein Verhalten außerhalb von Regeln und Konvention, laut und espressiv nach außen Gekehrtes gelten als anstößig. Die japanische Sprache kennt keine Flüche, die Gestik ist gemessen. Eine exzessive Äußerung auf Japanisch ist etwa so, als wenn ich auf Deutsch sagte "Potz-Blitz!" Ein Japaner wird Ihnen - es ist zum wahnsinnig werden! - nie mit einem direkten Nein antworten, auch wenn er zu der Party, zu der Sie ihn gerade eingeladen haben, unmöglich kommen kann. In den Zeitungen gibt es auch für ein schlechtes Konzert keinen Verriss, ja es gibt grundsätzlich keine Kritiken. Da alles stets höflich und freundlich kommentiert wird, sitzen viele ausländische Künstler dem Irrtum auf, sehr gefallen zu haben. Europäer werden in japanischen Theaterstücken durch ein für Japaner untypisches, ausladendes Gestikulieren kenntlich gemacht. Das Wichtigste für Japaner ist die Einhaltung von Regeln und Konvention. Ein Notentext ist auch ein Regelwerk; so kann der Trugschluss entstehen, mit der genauen Erfüllung des Textes sei es getan. Der Spott, sie wirkten am Klavier wie Buchhalter beim Stempeln von Formularen, ist - 345 - den Japanern nicht entgangen. Deshalb ist in Japan schon bei Kindern das Einüben effektvoller Gesten (Emporwerfen der Arme, herrische Kopfbewegungen etc.) Bestandteil des Klavierunterrichts geworden. Allerdings teilt sich untrüglich mit, ob Bewegungen am Klavier im Einklang mit der Musik sind oder nur aufgesetzt. Bewegungen und Gesten am Klavier betreffend, können Sie zu den Beispielen 33 bis 35 im ersten Kapitel zurückblättern. Unter dem Einfluss globaler Jugendkultur und der Pop-und Rockmusik sind in Japan die Gesten der Jugend ausladender, wilder, "espressiver" geworden, auch die Sprache zeigt höhere, schrille, jähere Ausschläge - so lange die Leute jung sind. Ab 30 sind alle wieder richtige Japaner: gemessene Gesten, keine großen Ausschläge in Sprache und nach außen gezeigten Emotionen. 2) Sprache: Musik ist eine Sprache, hat wie diese Hebungen und Senkungen, Berge und Täler. Diese sind im Japanischen weniger ausgeprägt als im Deutschen. Japanisch bewegt sich mehr auf einer Tonhöhe, und das wichtige Wort bekommt einen Akzent. Der Korridor der Ausschläge nach oben und unten ist relativ eng. Dieser enge Korridor an Unterschieden sprachlicher Tonhöhen kann eine plausible Erklärung für ein Klavierspiel sein, das gerade in der Melodiegestaltung oft wenig Bewegung zeigt. Aber es geht nicht nur um die Sprachmelodie sondern auch um den Sprachrhythmus. Sprechen wir das Wort wunderbar mit wirklichem Erstaunen aus, dann erfährt die erste Silbe wu nicht nur eine weiche Betonung sondern auch eine Dehnung derart, dass wunderbar als punktierter Rhythmus gehört wird: Eine punktierte Viertel (wuun - ), ein Achtel ( - der) und wieder ein Viertel (- bar). Faszinierend aber ist die Möglichkeit der Sinnverschiebung je nach Betonung und Rhythmus: "Deine Mutter hat mir dieses Buch geschenkt." Den Sinn dieses Satzes können wir durch Wortumstellungen ändern, aber das ist, auf Deutsch, gar nicht nötig: Je nachdem ob wir die Wörter Deine, Mutter, mir, dieses, Buch oder geschenkt betonen, ändert sich der Sinngehalt - und der Rhythmus! Betone ich "geschenkt" (um klar zu machen, dass das Buch nicht nur geliehen ist), acceleriert der Satz rasch, um in das Wort geschenkt gleichsam hineinzufallen. Will ich "Deine" hervorheben, dann wird der Satzteil "Deine Mutter" langsam, der folgende Satzteil schnell gesprochen. Hebe ich "mir" oder "dieses" hervor, spricht man die Vokale dieser Wörter viel länger, als wenn die Wörter nicht hervorgehoben würden - mit entsprechenden Auswirkungen auf das Tempo der übrigen Wörter. Auch auf Japanisch kann man natürlich die Sinngewichte des Beispielsatzes ändern, dazu aber sind jeweils Änderungen in der Konstruktion nötig. Will ein Japaner "Deine Mutter" betonen, würde er etwa sagen "Es war Deine Mutter, die mir ..."; will er hervorheben, dass ihm das Buch geschenkt wurde, würde er nur sagen "Das Buch ist ein Geschenk" und alles Übrige weglassen, denn der Satzteil "Deine Mutter hat mir ..." könnte als unhöflicher Vorwurf aufgefasst werden, die Tochter bzw. der Sohn der Mutter wolle ihm das Buch streitig machen. - 346 Anmerkung: Meine Kenntnisse über Japan verdanke ich, neben meinen japanischen Studentinnen, vor allem Herrn Dr. Christoph Neumann, Software-Entwickler (Steuerung von Maschinen mit gesprochener Sprache) und Schriftsteller. Dr. Neumann, seit langem in Tokyo lebend, ist Autor des Bestsellers "Darum nerven Japaner - der ungeschminkte Wahnsinn des japanischen Alltags". Er ist mit einer Chinesin verheiratet. Die Kinder der Familie Neumann wachsen viersprachig auf: Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Englisch. Die japanische Sprache kennt keine Beugung, weder von Verben noch von Nomen und Adjektiven, es gibt keine Artikel, keine Präpositionen, auch keinen Singular und Plural. Die Sprache gilt dennoch als die schwerste der Welt - wegen der komplizierten Höflichkeitsregeln, deren Wahrung oft überaus verschachtelte Satzkonstruktionen erfordert. Vom Du zum Sie gibt es sehr viele Zwischenstufen, je nachdem ob man mit einer höherrangigen oder rangniederen Person, ob man mit einer Frau oder einem Mann spricht. Die Studentin im ersten Semester redet mit der Studentin im höheren Semester in einem respektvolleren "Du" als mit der Kommilitonin des gleichen Semesters. Wegen der unendlichen Möglichkeiten, verschieden zu intonieren, ist die gesprochene Sprache grundsätzlich der geschriebenen an Nuancenreichtum überlegen. Ein Nein kann, je nachdem, wie es gefärbt wird, die vielfältigsten Bedeutungen annehmen, von einem entschiedenen Nein über viele Zwischenstufen von "vielleicht" über "Nein, es sein denn ..." bis zu einer versteckten Aufforderung und einem kaum verhohlenen Ja. In diesem Zusammenhang soll ein erstaunliches Phänomen nur erwähnt werden, erklären mag es, wer will: Es besteht, auch international, eine weitgehende Übereinkunft darüber, wer, mit deutlichem Abstand zu allen anderen, die größten Komponisten sind, die je gelebt haben: Es sind Bach, Mozart, Beethoven, Schubert und, mit etwas Abstand, Brahms, Schumann, Liszt, vielleicht noch Wagner. Zumindest über den Rang der vier Erstgenannten herrscht weitgehende Einigkeit. Und diese Größten der Großen haben alle Deutsch gesprochen, hatten Deutsch als Muttersprache. Anmerkung: Allein das Beispiel der Schreibschrift ist hinreichend, um ins Bewusstsein zu rücken, wie unterschiedlich die schulische Ausbildung in Japan und Deutschland ist. Alte handgeschriebene Briefe sind oft ein ästhetisch beeindruckender Anblick. Zum Beispiel die Briefe der Bäckermeistersgattin, Frau Margarete Buchner (1894 - 1986), meiner Großmutter. Sie war eine einfache Frau, aber ihre Briefe offenbaren Sorgfalt, Genauigkeit, Deutlichkeit, Achtung vor dem Leser, Disziplin, Akkuratesse und ein Gespür für Form und Ebenmaß: Absatz Einrücken - Abstände - Ränder. In den energischen Linien zeigen sich ein starker Charakter und unverwechselbare Individualität. Die Handschrift meiner Großmutter war nicht kreativ, sie war sauber, ordentlich, schön. Das Fach Schönschreiben, früher eigens benotet, ist längst abgeschafft, auch auf die gebundene Handschrift wird in der Grundschule kaum noch Wert gelegt, und den meisten Eltern ist, wie Grundschullehrerinnen berichten, die Handschrift ihrer Kinder ebenfalls egal. Japanische Schüler erlernen bis zur 9.Klasse 2000 und bis 12.Klasse 4000 (!) Schriftzeichen, wobei Wert auf eine kalligraphisch gute Ausführung gelegt wird. Das kann man, nach Belieben, als sinnlosen Drill betrachten oder als Charakterformung im Sinne der oben genannten Tugenden. Die Erziehung zu einer schönen, ausdrucksvollen Handschrift fördert die Entwicklung der genannten Tugenden. Disziplin, Ordnung, Genauigkeit etc. sind zwar Sekundärtugenden, aber für das Ziel, künstlerisch und technisch - auf allen Gebieten! - ein hohes Niveau zu erreichen, sind es mit Sicherheit sehr wichtige Tugenden. Der immense Zeitaufwand zum Erlernen der vielen Schriftzeichen müsste dazu führen, dass japanische Schüler in anderen Fächern, z.B. wissenschaftlichen, gegenüber deutschen Schülern im Rückstand sind. Dies ist keineswegs der Fall. - 347 - Eigenwahrnehmung - Fremdwahrnehmung Weiter vorne war die Rede gewesen von den Pianisten, meist sehr bekannten, die ihre beeindruckende Virtuosität nicht mit Fingerübungen, Etüden etc. erworben haben sondern nur über das Hören, genauer: über den Hörwillen. Jetzt, gegen Ende des Buches, komme ich auf diese Art des Technik-Erwerbs zurück. Das Hauptinteresse galt über das ganze Buch hinweg der Frage, wie wir uns beim Spielen selbst hören, und wie uns das Publikum hört, und dass es keineswegs selbstverständlich ist, dass diese beiden Höreindrücke, der des Spielers und des Hörers, sich decken. Das Spiel eines Pianisten, hieß es in der Einleitung, komme beim Publikum keineswegs immer so an, wie der Pianist, denkt, dass es ankommt, und Meisterschaft wurde definiert als Übereinstimmung der inneren Vorstellung des Spielers mit der Wahrnehmung des Publikums. Der Schauspieler Robert Joseph Bartl drückte es 2015 in einem Interview so aus: "Selbsteinschätzung mit Fremdwahrnehmung in Einklang bringen." Entscheidende Voraussetzung für eine gute Technik ist die Bereitschaft und die Fähigkeit, aus der Eigenwahrnehmung herauszutreten, sich, trotz der emotionalen Anspannung des eigenen Vortrags, so zu hören, als säße man unter den Zuhörern. Eines der auffälligsten Anzeichen einer Begabung ist die Fähigkeit, sich beim Spielen zuzuhören. Dies ist viel schwerer, als man glauben möchte, aus zwei Gründen. Der erste wurde schon in der Einleitung genannt: - Zuhören und Aktion schließen sich ihrem Wesen nach aus. Wollen wir etwas genau hören, halten wir für gewöhnlich in der Aktion inne. Der zweite Grund wiegt mehr: - Das Gehirn hat die Eigenart, Gehörtes unseren Wünschen, Vorurteilen, Erwartungen, Vorstellungen anzupassen, zu ergänzen, umzudeuten, ja zu verbiegen. Wir hören auch das, was wir hören wollen. Das gilt allerdings nicht nur für den, der spielt, sondern auch für Prüfer und Juroren. Dieses Phänomen wurde im 12.Kapitel unter den Begriffen Perzeption und Apperzeption behandelt. Perzeption ist, was auf unsere Sinne einwirkt, Apperzeption ist die Interpretation dieser Eindrücke im Gehirn. Dies gilt natürlich nicht nur für Musik sondern auch für andere Sinneswahrnehmungen: optische Eindrücke, Gerüche, Berührungen. Unzählige Experimente belegen, wie sehr sich die Sinne lenken lassen. Im Falle des spielenden Pianisten aber kann es zu einer Selbsttäuschung führen, denn er produziert selbst die Töne, deren Wirkung er - meist zu seinen Gunsten - umdeutet. Die Vorstellung prägt den Höreindruck der Selbstwahrnehmung und kann die Realität beiseite drücken. In der Einleitung und im zweiten Kapitel hatte es dazu geheißen: Die Vorstellung eines strahlenden reinen Klanges kann so stark sein, dass sie die Realität überdeckt, z.B. einen verschmierten Klang. Wie klangliche Fehler: Ungenauigkeiten, Verschmierungen etc. zu beheben sind, - 348 - wurde im zweiten Kapitel ("Hörkontrolle") besprochen. Im Fortgang des Spielens lässt sich die Güte von Klängen schwer überprüfen, weil sie rasch vorüberziehen; deshalb besteht die empfohlene Methode darin, den Klang in einer Fermate genau dort anzuhalten, wo seine Sauberkeit kontrolliert werden soll, und dem Klang, den man soeben produziert hat, kritisch zu lauschen ("Hör-Kontroll-Fermate"). Während dieser langen Kontroll-Fermate - auch das sei im Rückblick noch einmal erwähnt - müssen die Hände von den Tasten gehoben sein; bleiben sie in den Tasten liegen, kann man sich selbst betrügen, indem man mit dem Pedal nachkorrigiert. Die dafür einschlägigen Beispiele im zweiten Kapitel sind die Beispiele 36 bis 40. Nicht nur klangliche, auch andere Störungen werden von dem, der spielt, oft ganz anders wahrgenommen, als sie beim Publikum ankommen. Rhythmische Fehler spielen dabei die größte Rolle; darüber hinaus sind es im Wesentlichen: - nur flüchtig und passiv angetippte (im Grunde gar nicht gehörte) Bässe, - verklebte Tonfolgen - Unbeabsichtigte Akzente, die, unbewusst-mechanisch, nur deshalb mit-gemacht werden, weil in einer anderen Stimme ein Akzent gesetzt wurde. - falsche Töne - wegbleibende Töne - unpräzises Zusammen-Anschlagen von Griffen und von Bass und Sopran ("Hinterherklappern"). Eine Störung, ein Fehler, hieß es eben noch, werde vom Spieler oft anders wahrgenommen als vom Hörer. Aber das ist nicht alles! Nach beinahe 30 Jahren Tätigkeit an Musikhochschulen ist es für mich wie zu einer unumstößlichen Wahrheit geworden: Fehler, Störungen werden von dem, der sich am Flügel produziert, oft genug überhaupt nicht wahrgenommen, sie werden ausgeblendet, weggeschoben, verleugnet ... Ich greife zwei häufige Fehler heraus: Wegbleibende Töne und Griffe, die nicht zusammen angeschlagen werden. Im alla turca der Sonate KV 331 (Bsp.310) spricht das letzte Sechzehntel der Sechzehntel-Gruppen oft nicht richtig an oder bleibt ganz weg. Laien-Pianisten, bei denen das Stück sehr beliebt ist, passiert dies natürlich häufiger als professionellen Spielern. Bsp.310 Die umringelten Töne bleiben oft weg, ohne dass dies vom Spieler bemerkt würde. - 349 - Bsp.310 bestätigt die bekannte Erfahrung, dass das Gehirn Nicht-Vorhandenes ergänzt. Die Täuschung gelingt deshalb, weil der Körper, hier genauer: der Daumen, die entsprechende Anschlagsbewegung ja ausführt, nur führt er sie wegen der gleichzeitig übersetzenden Hand zu flüchtig aus, so dass die Taste nur gestreift und für eine deutliche Tongebung nicht hinreichend gegriffen wird. Eine Anschlagsbewegung aber, wenn auch eine unzureichende, macht der Daumen, und selbst wenn der Ton tatsächlich nicht zum Klingen kommt, kann doch eben eine Fingerbewegung, die einen Ton hätte hervorbringen sollen, diesen im Gehirn des Vortragenden als Illusion erklingen lassen. Es versteht sich von selbst, dass das beschriebene Phänomen nicht nur für Bsp.310 gilt. 1972, ein Jahr vor meinem Diplom, war ich bei einer Lehrprobe anwesend. Ein Student sollte klavierpädagogisch examiniert werden, ein anderer Student übernahm die Rolle des Schülers. Im Mittelteil des zweiten Satzes von Beethovens Sonate op.110 (Bsp.311) waren die Vierteleinwürfe des unteren Notensystems nie mit den Achteln des oberen Systems zusammen. Der Lehrer-Student wies seinen Kommilitonen darauf hin, aber trotz zahlreicher Versuche änderte sich nichts, bis der Unterrichtende schließlich ärgerlich und laut wurde: Zusammen! Und erst da ging dem Schüler-Studenten langsam auf, dass bei ihm links und rechts offenbar grundsätzlich auseinander klapperten. Der unterrichtende Student hieß den Schüler dann, richtig, die Stelle in Zeitlupe spielen, mit der einzigen Maßgabe aufzupassen, dass links und rechts zusammen waren. Bsp.311 2 1 2 4 2 3 2 3 3 4 2 1 3 5 1 3 1 2 Viele schlagen Griffe unpräzise an und lassen beim Zusammenspiel von links und rechts grundsätzlich die rechte Hand hinterher klappern, was ihnen, nachweislich, oft nicht bewusst ist. Die Aufgabe ist, den Schüler so weit zu bringen, dass er hört, was tatsächlich klingt: Sprechen alle Töne an?, platzen Töne grundlos heraus?, sind die Sechzehntel klar voneinander zu unterscheiden?, sind die Griffe zusammen?, sind die Töne schneller Unisono-Gänge zusammen?, schmiert der Bass in den nächsten Klang hinein? An anderer Stelle dieses Buches hatte es geheißen: Klavierunterrichten ist im Grunde nur Gehörübung bzw. Zuhör-Training. Und damit sollte man früh beginnen. - 350 - Ein selbst-kritisches Ohr führt auf direktestem Weg zu einer guten Technik. - Hält man ein Kind immer dazu an, dass die Sechzehntel gleichmäßig sind, keines herausplatzt, unterbelichtet ist oder wegbleibt, dann kann das Kind auf diesem Weg, über das Sich-kritisch-Zuhören, eine gute Geläufigkeit entwickeln. - Achtet man immer darauf, dass Akkorde und Doppelgriffe nicht klappern, sondern genau zusammen sind, dann kann das Kind so, über das Sich-kritisch-Zuhören, eine gute Doppelgrifftechnik bekommen. Viel mehr können Sie als Lehrer nicht ausrichten, denn der Schüler muss die gleichmäßigen Sechzehntel, die präzisen Doppelgriffe etc. auch wirklich selbst wollen. Und das ist keineswegs selbstverständlich. Anmerkung: Zum Thema präzises Zusammenspiel sei hier ein Auszug aus Übungen vorgestellt, die Roland Keller für sein Klavierseminar an der Wiener Musikhochschule entwickelt hat. Gedanklich einem einfachen Prinzip folgend, stellen sie in der Ausführung eine Herausforderung an Feinmotorik und Geschicklichkeit der Hand dar; das heißt: Es ist schwer, die Übungen gut auszuführen, wer sich aber darauf einlässt, ist dauerhaft für genaues Zusammenspiel sensibilisiert. Nachstehend ein Auszug: Bsp.312 Das Schema der Übungen ist: a) der Griff ändert sich, der Fingersatz bleibt gleich, b) der Griff bleibt gleich, der Fingersatz ändert sich. zu a) Tontrauben von zwei bis fünf Tönen wandern in einer Tonart mit immer dem gleichen Fingersatz (ergibt sich bei fünf Tönen von selbst) hinauf und hinunter. zu b) eine Tontraube (zwei bis vier Töne) wird mit wechselnden Fingerkombinationen angeschlagen. Um dies am Beispiel einer harmonischen c-moll-Tonleiter zu erläutern: Schreiten Sie die Tonleiter c - d - es - f - g - as - h - c in Tontrauben zu je drei Tönen ab. Der erste Griff besteht aus den Tönen c-d-es, der zweite aus d-es-f, der dritte aus es-f-g u.s.w. Nehmen Sie nun für jeden Griff, den Fingersatz 5 - 4 - 3 (auf die linke Hand bezogen). Der immer gleiche Fingersatz trifft jedes Mal auf eine andere Tastensituation, extrem unterschiedlich z.B. zwischen dem bequemen Griff c-d-es auf - 351 der ersten und dem etwas gespreizten Griff g-as-h auf der fünften Stufe. Und jedes Mal kommt es darauf an, dass die drei Töne exakt zusammen angeschlagen werden. Sie werden bemerken, dass das schwer ist, dass es Konzentration und oft viele Versuche erfordert. Nun können Sie die Griffe mit anderen Fingerkombinationen nacheinander abgehen, mit 4 - 3 - 2, 3 - 2 - 1, 5 - 3 - 2, 4 - 2 - 1 Der nächste Schritt ist, eine Tontraube so lange stationär zu lassen, bis sie mit allen möglichen Fingerkombinationen, stets perfekt zusammen, abgegriffen wurde. Präzision hat, zweifellos, einen eigenen Ausdruckswert. Über die Chancen jedoch, jemandem den Willen zu Genauigkeit einzuflößen, darf man sich keine zu großen Hoffnungen machen. Eine grundsätzliche Bereitschaft dazu muss, a priori, vorhanden sein. Somit wird der Wille zur Genauigkeit selbst zum wesenhaften Teil der Begabung. Dies schließt den Willen ein, nicht zu rasten, bis eine Aufgabe sauber gelöst ist. Viele, und oft gerade auch Begabte, sind schnell mit sich zufrieden, sind nicht bereit, sich viel über das hinaus anzustrengen, was ihnen zufliegt. Bei einigen sehr wenigen Hochbegabten trifft alles glücklich zusammen: Sie lernen sehr leicht und schnell, zwischen Üben und Spielen besteht kaum ein Unterschied, und am Ende steht doch ein sehr gutes Ergebnis; die meisten müssen auf dem Weg zu künstlerischer Vollkommenheit Zeit und Mühe aufwenden, und das Ergebnis ist dann womöglich nicht nur nicht schlechter sondern noch besser. Dazu hatte es am Ende des vierten Kapitels geheißen: Das Unbewusste, und wenn es das geniale Unbewusste ist, findet irgendwo seine Grenze, und das schnelle, geniale Erfassen des Ganzen kann nicht ohne Verluste für Einzelheiten gelingen. "Feile so lange, bis es wie eine gute Improvisation klingt!" sagte der Komponist Luigi Dallapiccola. Phlegma, mangelnde Ambition zur Genauigkeit sind große künstlerische Hindernisse. Was aber das Bemühen betrifft, Schüler dazu zu bringen, dass sie sich beim Spielen zuzuhören, gibt es noch größere Hindernisse, bisweilen unüberwindliche: Manche sind nur zur Selbstbetrachtung fähig, können oder wollen aus der Eigenwahrnehmung nicht heraustreten, sind nicht herauszuholen aus einer inneren Klangund Ideenwelt, die kaum noch etwas mit dem zu tun hat, was beim Publikum ankommt: Wirre Darbietungen mit völlig aus den Fugen geratenen Proportionen und bizarren rhythmischen Verbiegungen - aber hingebungsvoll und mit Leidenschaft vorgetragen. Hat man das angehört, folgt oft eine detaillierte Erklärung dessen, was als "meine Auffassung von dem Werk" bezeichnet wird, mit weitläufigen Bezügen zu Personen, Schicksalen, Lebensumständen, Naturphänomenen. In solchen Fällen habe ich meist gesagt, er / sie könne das Werk so spielen, nur sei dann unumgänglich, auf der Bühne während des Vortrags ein virtuelles Spruchband mit Erläuterungen mitlaufen zu lassen. Anmerkung: 2008 stellte sich ein Student vor, der in Liszts h-moll-Sonate das erhabene Grandioso (Bsp.291, 12.Kapitel) nur als wütendes Dreschen und Toben darbot. Darauf angesprochen sagte er, er wolle in seine Interpretation auch Clara Schumanns negatives Urteil über die Sonate einbringen. Einbringen! - ausgerechnet das Urteil Claras, die zeitlebens mit großer Musik, z.B. der ihres Mannes, nichts anzufangen wusste. - 352 Liszts h-moll-Sonate ist Robert Schumann gewidmet. Liszt sandte ihm das Werk im Mai 1854 nach Düsseldorf. Schumann aber war zwei Monate zuvor in die Nervenheilanstalt Endenich bei Bonn verbracht worden. So nahm Clara die Sendung in Empfang. Am 25.Mai 1854 notiert sie in ihr Tagebuch: "Die Sachen sind schaurig. Brahms spielte sie mir, ich aber wurde ganz elend. Das ist doch nur blinder Lärm - kein gesunder Gedanke mehr, alles verwirrt, eine klare Harmoniefolge ist da nicht mehr herauszufinden! Und für so etwas muß ich mich auch noch bedanken!" Klavierspieler der beschriebenen Art sind voller Phantasie und Ideen, lesen oft sensationell vom Blatt, erfassen einen Notentext unglaublich schnell und erreichen damit sofort ein sehr hohes Niveau eines Al-fresco-Klavierspiels. Ab da aber geht es nicht mehr viel weiter; sie hören dort auf, wo sich der Unterschied zwischen dem sehr guten Klavierspieler und einem Künstler zu erweisen beginnt. Beim öffentlichen Vortrag hinterlassen sie einen Eindruck, der mit "auswendig vom Blatt gespielt" zu beschreiben wäre. Bei Kommilitonen, besonders jüngeren, rufen sie wegen ihrer Geschicklichkeit und Schnelligkeit zunächst viel Bewunderung hervor, bald nimmt sie niemand mehr ernst. Misserfolge, die sich bei Prüfungen, Wettbewerben, Bewerbungen einstellen, bleiben ihnen unbegreiflich. Nach und nach werden sie zu tragischen Figuren, hochbegabte bis genialische Pfuscher, von denen es an jeder Hochschule ein paar gibt. Mehr noch als direkte musikalische Defizite sind es Verstiegenheit und Selbstüberschätzung, die die Grenzen pädagogischer Vermittelbarkeit aufzeigen. Verstiegenheit geht stets mit Realitätsverlust einher. Sie kann so definiert werden: Verstiegenheit heißt, den eigenen privaten Schlüssen, Assoziationen und Botschaften eine für alle gültige, gleichsam naturgesetzliche Wahrheit zuzuschreiben. Die für den Pädagogen entmutigende Folge ist ein Sich-Verschließen vor jeder berechtigten Kritik. Eindringliche Hinweise auf Schludrigkeiten nützen nichts, Nachweise, z.B. Tonmitschnitte, werden en passant registriert, aber nicht wirklich gehört. Die eigenen Schwächen nicht zu erkennen, nicht wahrhaben zu wollen, ist für einen Künstler eine Katastrophe. Nicht nur für einen Künstler. Anmerkung: Der grellste Fall von Verstiegenheit der gesamten Kunstgeschichte ist der des Komponisten Karlheinz Stockhausen, dessen ausschließliche Selbstbezogenheit zu messianischer Selbsterhöhung wurde. Stockhausen versäumte nie, seine Klänge zu allem Großen und Erhabenen in eine phantastische - für ihn kausale - Beziehung zu setzen: zu Universum, Sternen, Gottheit, Unendlichkeit: „Mein Werk ist dazu geschaffen worden, dass der Mensch sich zu einem überlegeneren, höheren Wesen entwickelt, zu einem kosmischen Wesen, das über diesen Planeten, über dieses Sonnensystem hinausreicht.“ Mit diesen Worten erhebt der Erfinder dieser Klänge sich selbst in diese Sphäre des Überirdischen und Göttlichen, ist so dem gewöhnlichen Menschsein enthoben: „Ich bin auf dem Stern Sirius ausgebildet worden und will dort auch wieder hin, obwohl ich derzeit noch in Kürten bei Köln wohne. Auf Sirius ist es sehr geistig. Zwischen Konzeption und Realisation vergeht fast keine Zeit. Was man hier als Publikum kennt, passive Beisitzer, gibt es dort gar nicht. Da ist jeder kreativ.“ Stockhausen ist berühmt. Kennen Sie einen Menschen, der sich abends mit einem Glas Rotwein in seinen Fauteuil setzte, um sich eine Stockhausen-CD anzuhören? - 353 - Sicheres Ohr, sichere Technik - Du hast nur einen Versuch! Musikalität lässt sich einteilen nach den unmittelbaren musikalischen Eigenschaften wie Klangsinn, gutes Gehör, Ausdrucksfähigkeit, und, andererseits, nach allgemeinen Charaktereigenschaften, die zwingend hinzutreten müssen: Genauigkeit, Phantasie, Willensstärke. Die rein musikalischen und die allgemeinen Eigenschaften durchdringen einander derart, dass eine Zweiteilung wenig sinnvoll erscheint. Ohne Phantasie kann jemand allenfalls ein tüchtiger Musiker werden, und ohne Genauigkeit und Willenskraft wird sich nie eine gute Technik entwickeln. Das Meer an Etüden und Fingerübungen beiseite lassend, ist der Erwerb einer guten Technik, zusammenfassend, nicht anders zu beschreiben als: Technik entsteht durch den unbedingten Willen, dass etwas so klingt, wie ich es hören will, und nicht anders; dies schließt, wie gesagt, mit ein, sich nicht zufrieden zu geben, bis dieses Ziel erreicht ist, und schließt ebenso mit ein die Bereitschaft und Fähigkeit, sich beim Spielen zuzuhören. Wir erreichen das Ziel mit dem stets gegenwärtigen Vorsatz: Jede Note, die ich spiele, will ich auch hören! Aber selbst wenn sich in einem glücklichen Zusammentreffen aller Voraussetzungen eine gute Technik herausgebildet hat, hängt ihr Funktionieren, von Künstler zu Künstler sehr unterschiedlich, von den Umständen ab, unter denen sie funktionieren soll. Damit ist angesprochen, was den Interpreten von fast allen anderen Berufen unterscheidet: Es kommt nicht nur auf die vorhandenen Fähigkeiten an, sondern darauf, inwieweit diese Fähigkeiten zu einem ganz bestimmten, oft noch in weiter Ferne liegenden Moment abrufbereit sind - und zwar in nur einem Versuch! "Zuhause lief alles gut" ist die mit Abstand häufigste Entschuldigung, die ein Lehrer zu hören bekommt. Für Viele macht es einen großen Unterschied, ob sie für sich spielen oder vor Leuten. Schon die zufällige Anwesenheit einer unbeteiligten Person kann irritieren. "Kaum geht die Frau Larch durchs Zimmer, schon verspiel' ich mich!", sagte mir eine Pianistin. Frau Larch war die Putzfrau. Wir sind beim Thema Bühnenangst, der negativen Nervosität, die die Leistung beeinträchtigt oder lähmt. Eine unüberschaubare Zahl von Kursen, Therapien, Ratgebern verspricht Abhilfe. Vermutlich sind die meisten dieser mentalen Übungen und Entspannungstechniken nützlich, sie übersehen durchwegs, dass das Gefühl der Sicherheit, vor vielen Menschen zu spielen, in hohem Maße auch von vorgegebenen Fähigkeiten abhängt, angeborenen oder früh erworbenen. Manche Musiker - es sind ausschließlich Absoluthörer - besitzen die glückliche Gabe einer unmittelbaren Verknüpfung vom Ohr zum Griffbrett bzw. zur Tastatur. Das heißt: Die Hand geht von selbst zu der Taste, die zu dem Melodieton gehört, und zwar in einer ungebremsten Bewegung, ohne hemmende Zweifel, ob die angesteuerte Taste auch die richtige ist, und genauso gruppieren sich zu jeder Harmonie die Finger von selbst zu dem entsprechenden Griff auf der Tastatur. Diese Direktverbindung funktioniert sowohl für Tonfolgen als auch für Klänge, auch komplizierte. Für solche Künstler ist das Auswendiglernen eines Werkes kein eigener Arbeitsschritt, und oft können sie nicht begreifen, dass es für andere ein eigener Arbeitsvorgang ist. Für gewöhnlich kennen solche Künstler keine Bühnenangst. - 354 - Wilhelm Kempff, heißt es, konnte - unfassbar! - jede Bachfuge sofort in jeder Tonart spielen. Natürlich betrat er stets völlig gelassen die Bühne: "Ich habe nie viel geübt und tue es heute überhaupt nicht mehr. Ich komme nie auf die Idee, ich könnte beim Spiel auf dem Podium einmal herauskommen – wie ich auch nie Angst vor dem Auftreten hatte." (aus: "Zeitschrift für Klaviere und Flügel", Jg.1, 1991, Heft 3, S.52) Anmerkung: In einer etwas angestaubten Anekdotensammlung von Hans-Peter Range über berühmte Pianisten heißt es, Wilhelm Kempff, der seine Programme stets aus dem Stegreif spielte, habe immer einen Merkzettel in einer Tasche des Fracks gehabt, um nachsehen zu können, welche Werke er vortragen musste. Einmal, als er diesen Zettel nicht dabei hatte, habe er vor dem Auftritt eine Person aus seiner Begleitung gebeten, ihm rasch ein Konzertprogramm zu besorgen, damit er wisse, was er spielen sollte. Wenn sich Künstler dieses Ranges verspielen, dann meist deshalb, weil sie, im Vertrauen auf die automatische Führung ihres Ohres, kaum oder gar nicht für ihre Auftritte üben. Anders sind z.B. die bisweilen unverfrorenen Schludereien des Genies Daniel Barenboim nicht zu erklären. Solche Künstler können sich auch verspielen, wenn sie die melodische Fortsetzung selbst vergessen haben; solange diese aber im Gedächtnis ist, geht die Hand auch stets von alleine zur richtigen Taste. Und tritt eine Gedächtnislücke auf, wissen sie sich zu helfen. Der unvergessliche Karl Richter (1926 - 1981) hat bei einer Aufführung der Goldbergvariationen im Münchner Cuvilliéstheater eine profunde Gedächtnislücke mit einer congenialen (und sehr langen) Cembalo-Improvisation souverän überbrückt. Angst auf der Bühne aber ist auch berühmten Künstlern nicht fremd. Martha Argerich und Arturo B.Michelangeli haben viele Konzerte abgesagt, weil sie fürchteten, ihren Ansprüchen nicht zu genügen. Claudio Arrau berichtet freimütig, er habe, wenn er sich bei einem lange nicht mehr gespielten Werk nicht sicher fühlte, manchmal abgesagt. An anderer Stelle (in "Leben mit der Musik") spricht er davon, in der Anfangszeit seiner Karriere habe er sich, wenn im Konzert etwas missglückt sei, aufgegeben und das Konzert nur noch zu Ende absolviert, er habe erst später begriffen, dass in dem "Sich-aus-der-Angstheraus-kämpfen" auch das Potential zu gesteigerter Eindringlichkeit liegen könne, Ausdruck also oft gerade auch aus dem Kampf gegen die Angst erwachse. Anmerkung 1): Menschen mit der seltenen Gabe einer unmittelbaren Beziehung zwischen Ohr und Griffbrett begegnet man auch unter Musiklaien; es sind z.B. die, die sich auf Partys ans Klavier setzen und jedes gewünschte Musikstück sofort und in jeder beliebigen Tonart spielen. Bis Anfang der 70-er-Jahre gelangte man in München-Schwabing, Biedersteinerstraße 6, über eine Außentreppe in das Kellerlokal "Peters Roßtränke". Als junger Mann ging ich gerne dorthin. Es spielte ein Barpianist. Nach und nach kam er an jeden Tisch: "Was wünschen Sie zu hören?" Der freundliche Herr konnte, ohne die geringste Andeutung eines Herumsuchens, sofort alles spielen, was immer man wünschte, in geschickten Figurationen und nicht nur mit einer simplen Harmonik. Als ich noch ein Kind war, gab es in meiner Nachbarschaft einen Bauern, der nie Notenlesen gelernt oder Musikunterricht gehabt hatte. Zu allen Wirtshausfesten war er hoch willkommen; er hat auf dem Akkordeon zum Tanz aufgespielt und jeden Schlager, jede bekannte Melodiefolge gespielt. Anmerkung 2): Aus seinen "Erinnerungen" berichtet Arthur Rubinstein: "Meine Fähigkeit, die gesamte Salome aus dem Gedächtnis zu spielen, erwies sich als äußerst ertragreich ... viele Laien, die mit den Verzwicktheiten dieses modernen Werkes besser vertraut werden wollten, ließen es sich von mir daheim vorspielen. Das war eine ganz neue und sehr angenehme Art, Geld zu verdienen. - 355 Ich verlangte für mein Vorspielen 500 Francs ... im allgemeinen lauschten meinem Vortrag vielleicht ein halbes Dutzend aufmerksam in ihre Partituren vertiefte Straussverehrer, mehr nicht." Und: "Von Kindheit auf habe ich Musik in mir so selbstverständlich gespürt wie das Schlagen meines Herzens und das Atmen ... Ich war und bin imstande, jede beliebige Komposition genauso zu spielen, wie ich sie hören möchte, seien es Opern, lange Sinfonien, Lieder, Kammermusik und, Gott sei Dank, alle Klaviermusik. Nicht nur bin ich mit Musik geboren wie mit einem sechsten Sinn, ich bin auch mit einem Erinnerungsvermögen beschenkt, das mich befähigt, jedes Klavierwerk auswendig zu spielen, wenn ich die Noten zwei- oder dreimal gelesen habe." Die glückliche Gabe, die die Hand automatisch zur richtigen Taste führt, erhöht auch die spieltechnische Sicherheit, da während des Spiels nie der Zweifel aufkommt, welche Taste als nächste kommt, und für solche Musiker macht es für gewöhnlich keinen großen Unterschied, ob sie vor Publikum spielen oder für sich allein. Sicherheit des Ohres bedeutet auch technische Sicherheit. Aber auch bei denen, deren Hand nicht von selbst zur richtigen Taste gelenkt wird, sollte man meinen, dass die Hände vor Publikum arbeiten, wie sie es zuvor zuhause hundert Mal geübt und richtig ausgeführt hatten. Was die Hände unsicher reagieren lässt, ist der Zweifel, der Selbstzweifel, der dann, und nur dann, unvermittelt auftreten kann, wenn man vor Leuten spielt: "Geht es denn so weiter, wie ich denke, dass es weitergeht?!", und oft sehen sich gerade besonders skrupulöse, sorgfältige, selbstkritische Musiker diesen Zweifeln ausgeliefert. Können muss also, vor dem Hintergrund nervlicher Belastung, viel strenger gefasst werden: Können ist nur, was auch unter Druck geht. Wer vor Publikum eine Passage unsicher darbietet, der kann sie eben nicht, und hätte er sie vorher zuhause noch so oft perfekt und mit Leichtigkeit ausgeführt. Professionalität heißt, nie, auch nicht wenn man sich schlecht fühlt oder von Sorgen absorbiert ist, unter ein bestimmtes Niveau zu sinken. Klavierspielen hat, zweifelsfrei, auch diese zirzensische Seite, und ich scheue nicht den, zugegeben, etwas übersteigerten Vergleich mit dem Artisten, dessen Wurfmesser nie seine Assistentin treffen darf, die sich ein paar Meter vor ihm auf die rotierenden Scheibe gestellt hat. Wie sicher das Ohr führt, erhellt ein Versuch: Nehmen Sie irgendeine in Figurationen verwobene Melodie. Spielen Sie die Melodie ohne die Umspielungen im Ein-FingerSystem nach, also völlig herausgelöst aus der motorischen Prägung. So finden Sie heraus, wie gut das Ohr Ihre Hand führt: ob Sie die Melodietöne sofort treffen, ob Sie vor den Anschlägen zögern, überlegen müssen ... Anmerkung: Beim Gehör ist, hier nicht im medizinischen sondern im musikalischen Sinne, zwischen innerem und äußerem Ohr zu unterscheiden, so wie das Hermann Scherchen in seinem "Lehrbuch des Dirigierens" getan hat. Die Unterscheidung entspricht, im Wesentlichen, der zwischen sekundären und primären Musiktugenden. - Die äußere Musikalität oder "das äußere Ohr" umfasst die Fähigkeit, Tonhöhen und Tonhöhenunterschiede zu benennen, sicher zu treffen und Tonfolgen leicht nachzuspielen. Im Idealfall zeigt sich diese Fähigkeit als absolutes Gehör, das es in verschiedenen Ausprägungen gibt, von partiell bis vollkommen. Ein gutes "äußeres Ohr" hat mit wahrer Musikalität nicht viel zu tun, ist aber für die Berufspraxis, also für das Agieren auf der Bühne, eine über die Maßen nützliche Fähigkeit. - Die innere Musikalität oder "das innere Ohr" ist das Gespür für die Güte des Tons und für die Spannung, die den Intervallen und den Klängen innewohnt. Carl Adolf Martienssen hat - 356 diese Intervallspannung, etwas melodramatisch, als den "Abgrund zwischen den Tönen" bezeichnet. Nur die, die mit einem guten inneren Ohr ausgestattet sind, können bedeutende Künstler werden; ist das "äußere Ohr" aber nicht gleichfalls gut entwickelt, tun sie sich in der Berufspraxis schwerer und müssen viel mehr üben. Nach langer Hochschultätigkeit kann ich mit Sicherheit sagen: Pianisten, deren Hände dem Ohr nicht automatisch folgen, sind in der musikalischen Gestaltung keineswegs schwächer, weniger eindringlich. Im fünften Kapitel hieß es in diesem Zusammenhang: In der "Blindheit des Ohres", also der Notwendigkeit, sich von Ton zu Ton zu hangeln, kann auch ein Ausdruckspotential liegen. Hinzukommt das bekannte Phänomen der Kompensation, demzufolge künstlerische Höchstleistungen nicht trotz, sondern wegen einer Schwäche entstehen, weil die Schwäche als Herausforderung an die schöpferischen Kräfte erlebt wird. Wessen Hand nicht automatisch vom Ohr zur richtigen Taste bzw. zum richtigen Akkord gelenkt wird, muss in der Vorbereitung gezielt auf diese Beschränkung reagieren und kann diese dadurch kompensieren. Dies geschieht auf zwei Arten: 1) Eine von motorischer Prägung unabhängige Memorisierung von Tonfolgen. 2) Beim Werkstudium ist gezielt auf das Problem einzugehen, welches das Merkmal nur des Interpretenberufes ist. Dieses Merkmal lautet: Du hast nur einen Versuch! 1) Tonfolgen bekommt man dadurch sicher ins Gedächtnis, dass man sie an die Tastatur koppelt. Dies geschieht durch Solfeggieren. Wenn Sie als Text statt "Alle Vöglein sind schon da ..." die entsprechenden Solmisationssilben singen "Do - Mi Sol - Do - La - Do - La - Sol ...", werden die mit dem Liedtext unbewusst gesungenen Intervalle zu bewussten und gewussten Intervallen, da beim Solmisieren die Tastatur vor das innere Auge tritt. Sie sehen die Intervalle gleichsam vor sich auf der Tastatur. Dabei spielt es keine Rolle, ob die solmisierten Töne ein Versetzungszeichen haben. Egal ob G oder Ges, F oder Fis, Sie singen für beide Tasten die Silben Sol bzw. Fa. Das innere Auge sieht die Taste, die gemeint ist, zuverlässig vor sich. Das Verfahren ist besonders wichtig bei Themen und Melodien, die nicht Legato gespielt werden können. Das kommt häufig vor, ist fast schon die Regel: Themen sind in Figurationen, Umspielungen, mit Nebenstimmen verwoben, oft derart, dass man die (als lange Notenwerte) notierten Melodietöne nach dem Anschlag sogleich loslassen muss, um zwischen zwei Melodietönen an anderer Stelle andere Aufgaben zu absolvieren. Ein Beispiel von unzählig möglichen ist das Prélude in c-moll, op.23 Nr.7 von Rachmaninoff (siehe Bsp.275, Kapitel 10). Solche schwebenden, nicht mit Fingerlegato ausführbaren Linien sollten Sie auswendig sicher solmisieren und dann nachspielen können; so verankern sie sich, unabhängig von motorischer Prägung, im Gedächtnis. Wenn Sie (oder Ihre Schüler) sich in der aktiven und passiven Bestimmung von Intervallen nicht sicher fühlen, sind Übungen mit den Solmisationssilben nützlich. Fixieren Sie von einem Bezugston aus verschiedene Töne und üben Sie, sie singend sicher zu treffen. Als Ausgangston können Sie immer den Kammerton A nehmen, - 357 - denn manche schwören darauf - ich glaube nicht daran - , man könne auch noch im fortgeschrittenen Alter das absolute Ohr erwerben, wenn man beim Intervalltraining stets das A als Bezugston nehme. Lassen Sie vor allem auch Intervalle abwärts üben; denn Tonschritte nach unten zu bilden und zu bestimmen, ist grundsätzlich schwieriger als Tonschritte aufwärts. Der Grund ist: 70 % aller Musikstücke beginnen mit einem Tonschritt nach oben (Quelle: "A Dicitonary of Musical Themes" von Harold Barlow und Sam Morgenstern). Auf eine Einschränkung ist hinzuweisen: Die sichere Verankerung der Tonfolgen durch die Solmisation, also dadurch, dass aus Intervallen bewusste und gewusste Intervalle werden, diese Sicherheit erstreckt sich auf die so eingeübten Tonfolgen, sie erweitert sich jedoch nicht - wenigstens ist dies sehr unwahrscheinlich - zu einer allgemeinen Sicherheit, derart dass Sie nun, als Ergebnis des Solmisation-Trainings, irgendwann zu der Fertigkeit gelangten, beliebige andere Tonfolgen sofort und ohne Zögern nachzuspielen. Ist die Fähigkeit, eine Melodie sofort nachzuspielen, nicht schon vorhanden, dann lässt sich, ab einem bestimmten Alter, diese Fähigkeit nicht mehr erlernen. Und die Altersgrenze ist niedrig. Damit sich eine direkte Verknüpfung vom Ohr zur Tastatur ausbilden kann, muss man bei einem Kind mit dem Bestimmen, Üben, Erkennen, Unterscheiden von Tonhöhen in einem Alter von deutlich unter 10 Jahren beginnen. Es gibt dafür ein großes Repertoire phantasiereicher Übungen und Gehörspiele. Schon Zweijährige lernen, verschiedene Tonhöhen mit verschiedenen Ereignissen oder Gegenständen zu verbinden. Im Vorteil sind, natürlich, Kinder, die in Musikerfamilien aufwachsen. Unter chinesischen Musikern sei, heißt es, der Prozentsatz an Absoluthörern besonders hoch, und Ursache seien die in der chinesischen Sprache sehr ausgeprägten Tonhöhenunterschiede, die für die Verständigung entscheidend sind. Zum Thema Solmisation und Erwerb des absoluten Gehörs, Gehörerziehung, Gehörspiele mit Kindern etc. finden Sie im Internet etliche gute Beiträge. Anmerkung: Die Solmisation ist in der deutschen Musikerziehung nicht üblich, und das ist mit Sicherheit die Ursache dafür, dass unter deutschen Kindern der Prozentsatz von Absoluthörern sehr niedrig ist, deutlich niedriger als z.B. in Frankreich, wo die Solmisation zum Musikunterricht gehört, und extrem viel niedriger als in Asien. Was mir Klavierkollegen bestätigt haben, habe auch ich festgestellt: Unter den vielen, meist weiblichen Klavierstudenten aus Asien fiel es eher auf, wenn eine der jungen Damen nicht absolut gehört hat 2) Die zu bewältigende Aufgabe muss beim ersten und einzigen Versuch gelingen. Eben dieser Druck, dass es beim ersten Versuch klappen muss, macht vielen zu schaffen und ist die Ursache, wenn vor Publikum nur mit Einbußen gelingt, was zuvor unzählige Male geübt und bewältigt wurde. Es gilt daher, sich in der Vorbereitung auf dieses "Du hast nur einen Versuch!" einzustellen und die psychische Befindlichkeit unter Druck zu üben, zu suggerieren, gleichsam nachzustellen, so realistisch das zuhause eben geht. Die meisten sind, wenn sie ein Werk neu lernen, zunächst darauf angewiesen, schwierige Stellen sehr oft zu wiederholen, bis Griffe und Fingersatz sitzen. Ab dann sind viele Wiederholungen hintereinander nicht mehr sehr sinnvoll. Der Kollege Arnulf von Arnim sagte mir: "Im Grunde dreht man sich beim Üben oft im - 358 - Kreis." Wiederholungen - eine alte pädagogische Erkenntnis - bringen umso mehr Nutzen, je besser sie über einen längeren Zeitraum verteilt werden. Ist eine schwere Passage ein paar Mal hintereinander sicher bewältigt, nützt es nicht mehr viel, sie noch hundert Mal zu wiederholen. Die Wiederholungen werden zum Leerlauf. Man sollte daher, sobald die Finger ohne Stocken laufen, schnell damit beginnen zu proben, worauf es auf der Bühne ankommt: das Gelingen beim ersten Mal. Annähernd realitätsnah, also so, dass man während des Spielens auch eine innere Anspannung und Aufgeregtheit verspürt, gelingt dies dann, und nur dann!, wenn Sie, je nach Stand der Vorbereitung, Werkteile oder das ganze Werk durchspielen, also bei Patzern nicht anhalten und nicht korrigieren, so wie Sie in einem Konzert auch nicht unterbrechen, korrigieren, zurückspringen können. Und dabei sollten Sie sich in die Situation unter Druck hineindenken: "Jetzt sitze ich vor 500 Menschen, muss spielen, darf nicht unterbrechen." Die Fehler werden nach dem Durchlauf abgearbeitet, einer nach dem anderen. Das Verfahren, das am effizientesten ist und am meisten Zeit spart, lautet also: Erst durchspielen, dann nacharbeiten. Jeder Übeabschnitt beginnt mit dem Durchspielen eines Programmteils, z.B. eines Sonatensatzes. Wenn der Konzerttermin näher kommt, empfiehlt es sich, eine gedachte oder tatsächlich ausgeführte Liste heikler Stellen des Programms anzulegen: Spieltechnisch schwere Passagen oder solche, bei denen es leicht zu Verwechslungen kommen kann. Immer wieder, zwischendurch, verteilt über die gesamte Übezeit, z.B. am Ende eines Übeabschnitts oder vor einer Pause, sollten Sie, testartig, in diese Stellen springen und sich so immer wieder der Situation aussetzen, dass Sie die Stellen ad hoc spielen, also das Üben zu vielen ersten Versuchen machen Am besten prägt sich ein, was Sie unmittelbar vor einer Pause gut bewältigen. Bühnenangst im Üben vorwegnehmen Drei Beispiele - die letzten dieses Buches - sollen veranschaulichen, wie sehr sich die Befindlichkeit unversehens ändern kann, wenn man Passagen vor Publikum vorträgt, die man zuvor beim Proben unzählige Male sorglos absolviert hat. Bsp.313 ist eine Stelle aus Schuberts Fantasie C-Dur für Klavier & Violine, D 934, op.159 posth., die für beide Instrumente, als das schwierigste Kammermusikwerk überhaupt angesehen werden darf. Den Klavierpart bezeichnete auch Gerhard Oppitz als "noch viel schwerer als die Wanderer-Fantasie". Zu Recht! Schon die pp-Triller im Bass, gleich in der Einleitung, sind ein schwerer pianistischer und künstlerischer Prüfstein. Vor den in Beispiel 313 abgebildeten Takten geht es virtuos und hochdramatisch zur Sache, die Beispieltakte aber sind nur ein einfacher Übergang, eine chromatische Tonleiter über drei Oktaven, die nur ausdruckslose Gleichmäßigkeit erfordert. Wer in chromatischen Tonleitern geübt ist, muss diese Stelle nicht wirklich üben, spielt sie in den Proben viele Male wie selbstverständlich, sorglos, einfach so. Eine leichte Stelle. Gerade eine vorgeblich so leichte Stelle aber kann ins Schwitzen bringen, dann nämlich, wenn erst im Konzert bewusst wird, was man sich schon beim Proben hätte bewusst machen sollen: Du bist jetzt auf der Bühne, nackt, nur mit dieser einfachen - 359 - chromatischen Tonleiter. Wie unüberhörbar und unendlich peinlich wäre es, wenn du dich jetzt verspieltest (während ein paar falsche Töne in dem dramatischen Gewühl davor kaum aufgefallen wären). Bsp.313 Die beschriebene Angst kann auf der Bühne gerade bei solch eher leichten Passagen auftreten, die man, eben weil sie leicht sind, nicht explizit geübt hat. Es ist ein häufiger und schwerer Fehler, in der Vorbereitung zwischen wichtigen und unwichtigen Stellen zu unterscheiden. In Bsp.314 sehen Bsp.314 Sie den Anfang eines wenig bekannten ChopinWalzers (Brown Index 46). Das Ritornell des Walzerthemas holt extrem weit aus, überwindet sofort drei Oktaven, geht im nächsten Takt drei Oktaven zuTakt 12 rück. Aber alles liegt bequem. In Takt 12 gibt es zwei große Sprünge hintereinander, nach oben und wieder zurück. Hier muss man aufpassen, aber grundsätzlich kann man den Text nach einigem Probieren fließend abspielen. Sollte man in Bsp.314 in den Takten 1 und 2 im Abgreifen der schnell aufeinander folgenden Oktavlagen einen Nebenton erwischen oder in Takt 12 das hohe Es nicht treffen, dann lösen solche Patzer keinen Schrecken aus - solange man mit sich allein ist! Vor Publikum aber kann die Musik von der angstvollen Erkenntnis beiseite gedrängt werden, wie peinlich es jetzt wäre, bei den vielen Lagenwechseln eine falsche Note zu treffen oder den Sprung in Takt 12 zu verfehlen. - 360 - Das "Training" dafür habe ich schon im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf Tonaufnahmen erwähnt: Manchmal ist es nützlich, nur das Treffen der richtigen Tasten zu "trainieren", so als hinge alles nur davon ab. Denken Sie sich in die Lage, Sie sitzen vor vielen Menschen am Flügel, und es käme jetzt ausschließlich darauf an, die erste Seite des Walzers Bsp.314 ohne eine falsche Note zu exekutieren. Dadurch werden die an sich bequem zu spielenden Takte unversehens zu einer schweren Aufgabe, weil alles nur auf die Parameter falsch oder richtig fokussiert ist, das Gelingen nur noch davon abhängt, ja keine falsche Taste zu treffen. Damit setzen Sie sich selbst, freiwillig, unter Druck. Und eben das ist der Sinn der Übung. Es ist wie bei dem Hochspringer, der mit einem Bleigürtel trainiert. Das letzte Beispiel 315 ist eine Passage aus dem Adagio molto der Sonate c-moll, op.10 Nr.1 von Beethoven. Die Stelle betrifft die bekannte Bedingung "Du hast nur einen Versuch!". Bsp.315 5 Takt 29 Die schnelle Koloratur, die in dem Adagio vier Mal auftritt, misslingt, obwohl bequem in der Hand liegend, häufig beim ersten Versuch. Es ist das plötzliche Umschalten zu großer Schnelligkeit, das nervös macht. Die Töne werde nicht richtig "angefasst", und in der zu hastig und flüchtig angesetzten Figur bleiben Töne weg. Kein Bläsersolist aber würde diese Figur mit einer plötzlichen Temporückung ansetzen, gleichsam mit einem sofortigen mathematisch exakten Vielfachen des langsamen Grundtempos, vielmehr ließe er die Koloratur anlaufen, nähme die ersten Töne ein wenig langsamer. Und genau darin besteht auch die Lösung für die sichere Ausführung auf dem Flügel. Bei Stellen wie Bsp.315 bin ich im Unterricht oft so verfahren, dass ich - mittendrin, überraschend, bei kurzen Unterbrechungen, nach Beendigung der Besprechung anderer Stellen anderer Stücke - immer wieder auf die schnelle Improvisationsfigur gezeigt und den Studenten aufgefordert habe, sie, mit einem Takt Vorlauf, aus dem Stegreif zu spielen, um so immer wieder das Gelingen auf den ersten Versuch zu üben, bis bei den vielen Ad-hoc-Tests kein Ton mehr nur flüchtig angetippt war, keiner mehr weggeblieben ist. Neben der musikalischen Arbeit, die, natürlich, an erster Stelle steht, waren für meinen Unterricht diese Ex-tempore-Tests heikler Stellen charakteristisch. Daneben: viele Testvorspiele, vergleichendes Üben von Parallelstellen, Trainieren der Fähigkeit, an jeder beliebigen Stelle eines Werkes einzusetzen usw. Es gibt viele gute Beiträge mit guten Ratschlägen für das richtige Üben. Aber um welche Ratschläge es sich auch handelt: Bei überragenden Talenten, wo die Grenzen zwischen Üben und Spielen zerfließen, werden sie überflüssig. - 361 - Persönliches Ich habe meine Studenten immer einem großen Leistungsdruck ausgesetzt, denn dieser Druck ist auf der Bühne eine Realität. Und ich habe mich nicht gescheut auszumalen, wie peinlich und quälend es z.B. wäre, für Spieler und Publikum, im öffentlichen Vortrag stecken zu bleiben. Aber niemand ist gezwungen, Pianist zu werden. Man kann die Laufbahn einer Sachbearbeiterin im Wasserwirtschaftsamt anstreben oder die eines Stadtarchivars. Mit einem Aufwand, der mir in der Rückschau als unfassbar erscheint, habe ich über 20 Jahre für meine Studenten an vielen Orten eine große Zahl von Konzerten besorgt, organisiert, betreut, geleitet, begleitet; an einigen Orten wurden die Konzerte zu beliebten Einrichtungen ("Meisterschüler spielen Meisterwerke"). Vorwürfe von Freunden blieben nicht aus, stärker waren die Selbstzweifel, die Sorge, möglicherweise meine eigenen Bühnenängste über die Studenten zu verarbeiten. Dem habe ich nicht widersprochen. Die eigene Biographie fließt, natürlich, mit in den Unterricht ein: Für wen Einkünfte aus Konzerttätigkeit, und sei es auch nur für eine kurze Zeit, ein bedeutsamer Beitrag zum Lebensunterhalt sind, der lernt schnell, wie wichtig es auf dem Podium ist, auch richtig zu spielen. Falsch spielen dürfen Sie, wenn Sie alt und sehr berühmt sind. Es heißt dann Altersreife. Die Ängste, in der Art wie bei den Beispielen 313 und 314 beschrieben, müssen nicht aufkommen, aber dass sie sehr häufig aufkommen, in eben der beschriebenen Art, das haben mir sowohl meine als auch Studenten von Kollegen unzählige Male so geschildert. So gut es geht, muss man sich dagegen wappnen, sich darauf schon im Üben einstellen, muss die Angst mit-üben, sie im Üben vorwegnehmen. Am Ende kamen fast immer die Bestätigungen meiner Studenten, sie seien, zum eigenen Erstaunen, auf der Bühne nicht sonderlich nervös gewesen. Ich hatte sie schon vorher "verrückt gemacht", die Bühnenangst mit ihnen abgearbeitet. Es gibt die seltenen Momente, in denen sich alles glücklich trifft. Der Klang breitet sich aus, wie er soll, und es überkommt einen im Spielen eine grenzenlose Kraft, die alle Zweifel und Unsicherheiten zu Staub werden lässt. Den Mitschnitt eines solchen Konzerts, eines Liszt-Recitals, das ich noch als Meisterschüler der Münchner Musikhochschule am 9.Juni 1975 gegeben habe, hörte ein bekannter Produzent. Ich erhielt einen Vertrag bei der damals weltweit renommiertesten Schallplattenfirma. Schnell folgten Konzertangebote. Bisweilen saß ich dann auf der Bühne und wartete darauf, dass sich die Beseeltheit von damals wieder einstellte, und musste lernen, dass sich dieses Gefühl, das beim Spielen vollkommene Zuversicht spendet, nicht herbeizitieren lässt, dass es manchmal auch nur darauf ankommt, anständig seine Arbeit zu machen. Irgendwann in den 80-er Jahren hatte ich eine längere Tour. Das Programm: Wanderer-Fantasie, Busoni: Carmen-Fantasie, Bartok: Sonate 1926, Beethovens Sonate op.110 und noch andere Stücke, an die ich mich nicht mehr erinnere, wahrscheinlich welche von Liszt. Gegen Ende der Tour bekam ich für einen Klavierabend in Bad - 362 - Homburg eine schlechte Kritik in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Tenor war: Perfekt aber kühl. Offenbar hatte ich Beethovens op.110 sehr lieblos absolviert. Dennoch war ich mit dieser Kritik sehr zufrieden: Ich, dessen Probleme beim Spielen oft eher der emotionale Überdruck, die zu geringe kühl kontrollierende Distanz gewesen waren, war nun auch einmal zu einem funktionierenden exécuteur geworden, zu einem, der auch in der Lage ist, etwas nur sauber abzuliefern. Mein Vater Alfons Betz, Gründer der Firma Betz-Chrom starb am Sonntag, 13.August 1961 im Alter von 47 Jahren; ich war 14, mein Erbteil ging rasch verloren, mit der Firma hatte ich nichts mehr zu tun. Dass ich Musiker geworden bin, ist wohl die richtige Entscheidung gewesen; denn der Wunsch dazu kam ganz aus mir, ohne Förderung von außen. Ich wuchs auf im Haushalt der Bäckerei meines Großvaters mütterlicherseits, und dort gab es keine musikalischen und kaum andere kulturellen Anregungen. Aber es gab Schellackplatten mit 78 Umdrehungen. Ich erinnere mich an vier modernere Platten, eine, 33 Umdrehungen/Minute, mit der Schlussszene aus Strauss' Salome, gesungen von Maria Cebotari, eine Single-Platte, 45 Umdrehungen, auf der Julian von Karolyi Liszts Liebestraum (A-Seite) und die Consolation Des-Dur (BSeite) eingespielt hatte, eine Platte mit Auszügen aus "Lucia di Lammermoor" und eine mit "Die schöne Müllerin", gesungen von dem Bariton Martial Singher. Diese Platte hörte ich unentwegt. Bei dem Lied "Ich schnitt' es gern in alle Rinden ein ..." kamen mir stets, wie auf Knopfdruck, die Tränen. Das Lied ist heute noch gefährlich. Im Alter hat man sich etwas besser unter Kontrolle. Selbstbewusstsein, Ichstärke besaß ich nicht; die waren mir früh genommen worden, ich darf sagen: mit System. Noch als ich an der Hochschule schon zu den besten Studenten gezählt wurde, schätzte ich mich selbst sehr niedrig ein. Hatte ich das Spiel eines Kommilitonen als nichtssagend empfunden, er selbst es aber als sehr gut gelungen bezeichnet, dann vertraute ich seinen Worten mehr als meiner Empfindung: Wenn er selbst sagt, es sei gut gewesen, musste es so gewesen sein. Können und Selbstbewusstsein gehen einher - aber nicht notwendigerweise. Spät habe ich begriffen, dass Viele auch bei einer sehr geringen Leistung sehr mit sich zufrieden sind, ja es gibt - allerdings nicht bei Interpreten - das tiefe Überzeugtsein von der eigenen Genialität ohne auch nur eine Spur von Können. Selbstbewusstsein wurde ausschließlich von außen, langsam, nach und nach, in mich hineingetragen. Wenn man immer wieder hört und liest, man sei offenbar in der Lage, die Klänge am Flügel in einer besonderen, womöglich einzigartigen Weise zu mischen, dann bleibt, irgendwann, etwas davon haften. Der Pianist Roland Keller ist in diesem Buch öfter erwähnt, schon im ersten Satz wird sein Name genannt. Er war aus Stuttgart, wo er bei Jürgen Uhde studiert hatte, nach München zu Ludwig Hoffmann gekommen. Zwei Jahre, 1971 bis 1973, waren wir Kommilitonen der Münchner Hochschule. Roland Keller und ich: Verschiedener, musikalisch und in der Wesensart, können zwei Menschen nicht sein; gerade dieser Gegensatz war für mich von großem Wert. Keller war viel weiter als ich und half mir aus pianistischer Orientierungslosigkeit. Der Student, der sich in der in Beispiel 311 geschilderten Lehrprobe als Schüler zur Verfügung gestellt hatte, der, dem nicht - 363 - aufgefallen war, dass seine linke und rechte Hand nie zusammen waren, dieser Student war ich gewesen. Mit Hilfe meines Mitstudenten Keller lernte ich, mir beim Spielen zuzuhören, oder, um es noch einmal mit den Worten des Schauspielers Robert Joseph Bartl zu sagen, "Selbsteinschätzung mit Fremdwahrnehmung in Einklang zu bringen." Danach wurde ich schnell von einem anonymen Studenten zu einem Pianisten, der Beachtung fand, zunächst an der Hochschule, dann in der Öffentlichkeit. Um 1980 sagten, schrieben, glaubten Viele, unter den jüngeren deutschen Pianisten sei ich wohl derjenige, der bald weit oben auf der Karriereleiter stehen müsse. In der Zeit etwa von 1979 bis 1995 kann ich meine Konzerttätigkeit, ich denke zu Recht, als umfangreich und auch als international bezeichnen. Als Zeichen der Anerkennung darf ich werten, dass ich regelmäßig von allen deutschen und auch ausländischen Sendern eingeladen wurde, große und bekannte Werke der Klavierliteratur einzuspielen, Werke, die schon in vielen Versionen von sehr prominenten Pianisten vorlagen. Als ich zum Wintersemester 1986/87 in Freiburg meine erste Hochschulstelle antrat, habe ich noch an die große Konzertlaufbahn geglaubt. Bei einem Spaziergang erzählte ich davon meinem Kollegen Wilhelm Behrens, Bruder der berühmten Sopranistin Hildegard Behrens. Ich bin kein spontaner Mensch, gehöre zu denen, denen ausnahmslos erst nach einem Disput einfällt, was die treffende Entgegnung gewesen wäre; auf Wilhelm Behrens' Einwand aber "Aber ich bitte Sie, das schaffen weltweit doch nur ganz ganz wenige!" kam meine Antwort sofort: "Und warum soll ich zu denen nicht dazugehören!?" Will man Pianist werden, ist es nicht unbedingt günstig, zu sehr in der Realität verhaftet zu sein. Zumindest eine Zeitlang muss man daran glauben, danach brennen, dass man ganz an die Spitze kommt. Erst dieses gewisse wahnhafte Umschleiert-Sein von Illusion verleiht die Kraft und zähe Ausdauer, später weit genug vorne zu landen. Wie sich Technik, Können, Kunst, Großes herausbilden, hat Goethe in einen Satz von unnachahmlicher Eindringlichkeit gefasst: Tief in uns liegt die schöpferische Kraft, die das zu schaffen vermag, was sein soll, und uns nicht ruhen und rasten lässt, bis wir es außer uns oder an uns, auf eine oder andere Weise dargestellt haben. (31.7.2017)