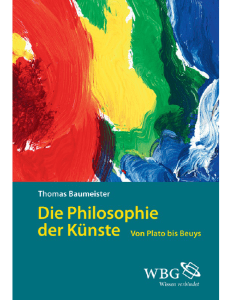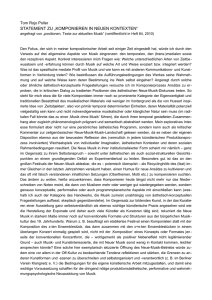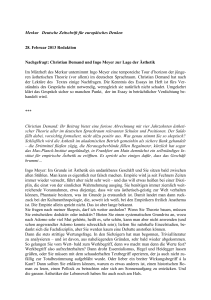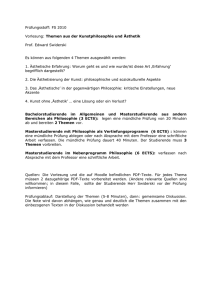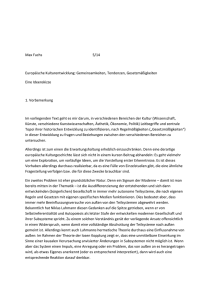In: Widerspruch Nr. 26 Ästhetik des Nationalen (1994), S.77
Werbung
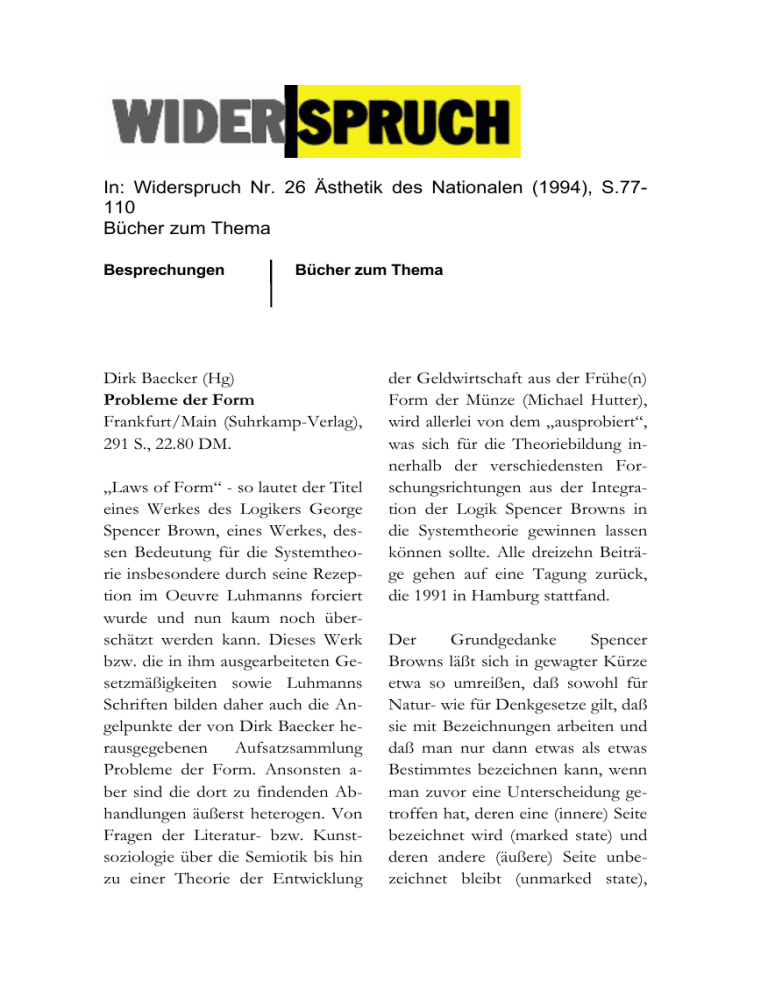
In: Widerspruch Nr. 26 Ästhetik des Nationalen (1994), S.77110 Bücher zum Thema Besprechungen Bücher zum Thema Dirk Baecker (Hg) Probleme der Form Frankfurt/Main (Suhrkamp-Verlag), 291 S., 22.80 DM. „Laws of Form“ - so lautet der Titel eines Werkes des Logikers George Spencer Brown, eines Werkes, dessen Bedeutung für die Systemtheorie insbesondere durch seine Rezeption im Oeuvre Luhmanns forciert wurde und nun kaum noch überschätzt werden kann. Dieses Werk bzw. die in ihm ausgearbeiteten Gesetzmäßigkeiten sowie Luhmanns Schriften bilden daher auch die Angelpunkte der von Dirk Baecker herausgegebenen Aufsatzsammlung Probleme der Form. Ansonsten aber sind die dort zu findenden Abhandlungen äußerst heterogen. Von Fragen der Literatur- bzw. Kunstsoziologie über die Semiotik bis hin zu einer Theorie der Entwicklung der Geldwirtschaft aus der Frühe(n) Form der Münze (Michael Hutter), wird allerlei von dem „ausprobiert“, was sich für die Theoriebildung innerhalb der verschiedensten Forschungsrichtungen aus der Integration der Logik Spencer Browns in die Systemtheorie gewinnen lassen können sollte. Alle dreizehn Beiträge gehen auf eine Tagung zurück, die 1991 in Hamburg stattfand. Der Grundgedanke Spencer Browns läßt sich in gewagter Kürze etwa so umreißen, daß sowohl für Natur- wie für Denkgesetze gilt, daß sie mit Bezeichnungen arbeiten und daß man nur dann etwas als etwas Bestimmtes bezeichnen kann, wenn man zuvor eine Unterscheidung getroffen hat, deren eine (innere) Seite bezeichnet wird (marked state) und deren andere (äußere) Seite unbezeichnet bleibt (unmarked state), wobei der „unmarked state“ der markierten Seite aber erst ihre Bestimmtheit verleiht. „Draw a distinction“ - eine Aufforderung und kein Axiom steht dabei am Anfang von Spencer Browns Logik und verleiht ihr einen operationalen Charakter, der auf Voraussetzungslosigkeit bewußt verzichtet, wie Elena Esposito in ihrem Aufsatz Zwei-Seiten-Formen in der Sprache ausführt. Mit „Form“ wird also eine Unterscheidung bezeichnet, sofern sie von dem durch sie Unterschiedenen unterschieden wird. „Form“ ist also paradox: sie muß Unterscheidungen etablieren (also schon gegeben sein); um sich von diesen Unterscheidungen unterscheiden zu können als das, was sie selbst ist: die Form jeder Unterscheidung. Mit „Form“ wird hier also kein Begriff bezeichnet, der noch durch die traditionelle Unterscheidung von Form und Inhalt (Materie) zu verstehen wäre: „Die Form ist so materiell wie die Materie formal bestimmt“, erklärt Dirk Baekker in der Einleitung. Und wenn immer nur die „innere“ Seite (der marked state) bezeichnet und also beobachtet werden kann, weil die „äußere“ Seite der Unterscheidung nur zur Bestimmung der inneren verhilft, selbst aber unbestimmt bleiben muß, dann bleibt diese äußere Seite einer Form immer ein blinder Fleck, wie David Roberts ausführt. Die unbezeichnete Seite jeder Form muß blind bleiben, denn würde sie bestimmt, so müßte man sich auf ihre andere Seite stelle, um sie beobachten zu können, womit dann umgekehrt nun diese unbezeichnet gehalten werden müßte, um der anderen ihre Bestimmtheit zu verleihen. Will man also beide Seiten einer Form zugleich beobachten, so muß man innerhalb der bezeichneten Seite eine weitere Unterscheidung einführen, womit die Form also nun in sich selbst wiedereintritt (Spencer Brown: „re-entry“) - und paradox wird. David Roberts gelingt es nicht nur, diese Paradoxie der Form in der Literatur des Deutschen Idealismus bei Fichte unter der Bezeichnung „Reflexion“ wiederzufinden: „Die Handlung der Freiheit, durch welche die Form der Form ihres Gehaltes wird und in sich selbst zurückkehrt, heißt Reflexion“ (Fichte). Vielmehr wendet er die Theorie der Form auch auf eine Theorie der Evolution der Literatur an, die den Weg von der (traditionellen) „Objektkunst“ zur (modernen) „Weltkunst“ (Luhmann) auf den geschichtlichen Prozeß der Transformation der Gesellschaft von einer Bücher zum Thema stratifizierten zu einer funktional differenzierten nachzuzeichnen weiß. Niklas Luhmann widmet seinen Beitrag dem Zeichen als Form. Historisch ansetzend zeichnet er den Weg von einer antiken Ontologie der Sprache über de Saussure, Peirce und Roland Barthes bis zu den Konsequenzen einer Anwendung der Laws of Form innerhalb der Semiotik nach. „Zeichen“ wird nun verstanden als die Differenz von Bezeichnetem und Bezeichnendem, so daß einerseits nicht mit Barthes davon ausgegangen werden kann, daß es referenzlose Zeichen gebe und man andererseits gezwungen wird, die Referenz nicht mehr als etwas zeichenexternes (einen äußeren Gegenstand, etwas Gedachtes oder ein „Meinen“) anzusehen, sondern als eine Seite der Differenz, die das Zeichen selbst ist. Wer hier dekonstruktivistische Anleihen wittert, liegt sicherlich nicht ganz falsch. Ausgehend von Kants Entdeckung, daß schon im Begriff der Form die Unterscheidung von Form und Materie steckt, entwickelt der Pädagoge Karl Eberhard Schorr in Zu Formenanalyse und Formgebrauch in der Logik eine Kritik der formalen Logik. Nach den so- genannten Gödel- und FregeKatastrophen, in denen sich die klassische Logik des „tertium non datur“ als eine Logik mit eingeschlossenem Ausgeschlossenen (d. h. mit eingeschlossenem Widerspruch) erwies, läßt sich laut Schorr auf die Frage: „Wie sind logische Formen bestimmt, wenn sie nicht zur widerspruchsfreien Kontrolle der Prozesse taugen?“, nur noch antworten: Sie sind zur Herstellung und Erkennung von Widersprüchen bestimmt. Dirk Baecker wiederum macht mithilfe des Formbegriffs in Das Spiel mit der Form die jedes Spiel begleitende und im Spiel selbst unsichtbare Paradoxie sichtbar, eine Paradoxie, die darin besteht, daß im Spiel Handlungen vollzogen werden müssen, die nicht bedeuten was sie bedeuten. Klaus P. Japp analysiert dagegen Die Form des Protests in den neuen sozialen Bewegungen. Die Protestbewegungen kennzeichnende Differenz ist seiner Meinung nach die von zugehörig/nichtzugehörig-zu-einer-Bewegung. Rudolf Stichweh analysiert Die Form der Universität, um die Ausdifferenzierung und die Stabilität des Universitätswesens soziologisch präziser fassen zu können. Helmut Willke nutzt dagegen seine Untersuchung Kontingenz und Notwendig- keit des Staates, um sein größeres Werk Ironie des Staates zusammenzufassen, und Giancarlo Corsi ergründet in Die dunkle Seite der Karriere die Unmöglichkeit, sich heute einer Karriere zu entziehen, denn selbst der „Verweigerer“ kann eine Karriere nur verweigern, wenn er sich biographisch an der Unterscheidung (=Form) Karriere/keine Karriere immer schon orientiert. Fritz B. Simon schließt den Band ab und möchte in seinem Beitrag Die andere Seite der Krankheit zeigen, daß die systemische Therapie die Psychotherapie ersetzen kann, indem sie therapeutisch nicht am System Psyche ansetzt, sondern das, was andere (etwa Freud) als psychische Störung behandeln, lediglich zu einer Störung des Kommunikationssystems erklärt. Die von ihm erörterten Formen sind verstehbar/nicht-verstehbar sowie gesund/krank. Immerhin stellt er sich dabei explizit auf die Seite der „verstehenden Wissenschaften“. Das Problem aber, ob nicht doch beispielsweise eine Phobie schon vor oder ohne Kommunikation eine Störung im und für das psychische System sein kann, so daß nur Psychotherapie helfen kann, wird in seiner ansonsten sehr aufschlußrei- chen Untersuchung leider nicht diskutiert. Dem soziologisch und systemtheoretisch interessierten Leser kann man den Sammelband wohl als eine interessante, weil richtungsweisende Neuerscheinung des letzten Jahres empfehlen. Harald Wasser Arthur C. Danto Die philosophische Entmündigung der Kunst (The philosophical disenfranchisement) übersetzt v. Karen Lauer, München 1993 (Fink-Verlag), 255 S., 48.- DM. Ist Danto ein Vertreter der Postmoderne? - Nein, er ist Intuitionist, Hermeneutiker, Antihermeneutiker, Materialist, Anti-Philosoph in einem. Doch scheint es gerade ein Merkmal von Postmoderne zu sein, daß verallgemeinernde (die „identifizierenden“) Fragen vermieden werden sollten, um die Würde des Einzeldings (was auch immer das sein mag: es reicht von Natur über Individuen bis - anscheinend - Nationen) nicht zu unterdrücken. Bücher zum Thema Doch der Reihe nach: Die vorliegende Aufsatzsammlung ist mit der Ehrenrettung der Kunst beschäftigt und dies aus zwei Gründen: 1) weil Philosophie die Kunst ins Ephemere abgedrängt habe (und dies offensichtlich nicht hingenommen werden dürfe); 2) wegen der in der modernen Kunsttheorie drängenden Frage, was eigentlich ein Kunstwerk konstituiere, wenn es nicht sein sinnlich Äußeres sei. Danto macht dies an Duchamps Ready-mades fest, d.h. Kunstobjekten, die Gebrauchsgüter wie Flaschentrockner oder Urinale nicht nur darstellen, sondern es tatsächlich sind. Seine dabei entworfene Interpretationstheorie wendet sich sowohl gegen die Institutionstheorie wie gegen idealistische Transparenztheorien, nach denen das Kunstwerk nur ein Medium für eine höhere Entität (Gott, Genie o.a.) sei. 1) Seit Platon, so Danto, sei Kunst von der Philosophie zur Wirkungslosigkeit verdammt worden. Platon habe Kunst als Erscheinung von Erscheinungen marginalisiert, Kant sie zu einem Zweck ohne Zweck gemacht. Gemeinsam sei allen, daß Kunst - gemessen am Maß der Vernünftigkeit (bei Platon die Ideen, bei Kant Vernunft im Allgemeinen und reiner Verstand im Besonderen) - auf einer Erkenntnisart niederer Stufe (bei Hegel am deutlichsten: als das noch Sinnenverhaftete) angesiedelt wurde. Mit Hegel und Marx habe die Philosophie sich gegen sich selbst gekehrt, da sie das Kriterium der Vernünftigkeit mit der Veränderbarkeit der Welt identifiziert habe. Dem „Verdikt“ der Wirkungslosigkeit, welches Philosophie seit ihren Anfängen über die Kunst verhängte, mußte Philosophie sich nun selbst beugen. Gegenüber der Wissenschaft, die Hegel und Marx zur Richterin der Wahrheit gemacht hätten, sei Philosophie als Erkenntnisweg unvollkommen geworden. Das kennen wir: Adorno, Negative Dialektik, 1.Kapitel, 1.Seite. Dantos Reaktion auf die Selbstisolierung der Philosophie ist jedoch von der der postmodernen Urväter grundverschieden: Wenn Philosophie sich selbst obsolet gemacht hat, so soll sie diese Rolle auch akzeptieren. Und damit knüpft er die Frage nach der Rolle der Philosophie an das zweite Problem: was konstituiert Kunstwerke? 2) „Meine Theorie folgt nicht dem Geist der Wissenschaft, sondern dem der Philosophie. Wenn Interpretationen das sind, was die Werke konstituiert, dann gibt es keine Werke ohne sie...“ (68) Doch was sind überhaupt Interpretationen? Interpretationen seien nicht „außerhalb des Kunstwerkes“, sondern entständen „gemeinsam im ästhetischen Bewußtsein“ (68). „Die Interpretation ist die Instanz, in der sich das, was ich Verklärung [wohl: enchantment] genannt habe, vollzieht“ (104). Diese „Verklärung“ aber läuft letztlich darauf hinaus, daß ein Ding nicht (nur) buchstäblich bedeute, - eine nicht sehr neue und in dieser Form sehr dürftige Theorie. Besser sind da die weiteren Ausführungen zum Interpretationsbegriff (in: Tiefeninterpretation). Danto unterscheidet zwischen Oberflächenund Tiefeninterpretationen. Erstere, die traditionelle Art, drehe sich um die Frage, was die Identität eines Kunstproduktes konstituiere, und besitze als Konvergenzpunkt die Intention des Künstlers. Demgegenüber weise die Tiefeninterpretation keinen derartig privilegierten Standpunkt auf, da sie nach dem suche, was verborgen sei, - für den Künstler wie für die Rezipienten. Beispiele solcher Interpretationen seien: Psychoanalyse, Strukturalismus, Marx' und Hegels Geschichtsphilosophie. Alle diese Tiefentheorien seien antimaterialistisch, insofern sie die Identitätsthese (nach der mentale Zustände mit neuronalen oder materiellen Zuständen identifiziert werden könnten) ablehnen würden, und dies in einer bestimmten Weise: im Gegensatz zum naturwissenschaftlichen Materialismus würden diese geisteswissenschaftlichen Tiefeninterpretationen erstens notwendig Ausnahmen zulassen und seien zweitens konstitutiv intensional. „Tiefeninterpretation“ bedeute also, daß das Interpretandum (das Kunstwerk) durch die Interpretantia überdeterminiert sei, indem es viele, gleichrangige Tiefeninterpretationen desselben Objektes gäbe, ohne daß dabei die Oberflächeninterpretation (die Intention des Künstlers) unbestimmt werde. Abgesehen von einem gründlichen Mißverständnis naturwissenschaftlicher Theoriebildung (Charakter von wissenschaftlichen Allaussagen, Extensionalität) - Danto macht nicht klar, was an intensionalen Beschrei- Bücher zum Thema bungen „tief“ oder „verborgen“ sein soll! Ebenso drückt sich Danto um eine Stellung zu dem Problem, wie verborgene Zustände - zu denen übrigens auch neuronale Zustände gehören! - ein Phänomen überdeterminieren können durch die bloße Tatsache, daß es deren viele gibt? Anders ausgedrückt: What the heck is Overdetermination if not simple pluralism? Die Vermutung liegt nahe, daß hier Geisteswissenschaft gegen Naturwissenschaft ohne Not ausgespielt wird, und die Wortwahl das postmoderne Unbestimmtheitspostulat kaschiert. Die Aufsätze Das Ende der Kunst und Kunst, Evolution und das Bewußtsein der Geschichte behandeln Dantos These: die Kunst sei an ihrem Ende angekommen, indem sie zu Philosophie geworden sei (für die Literatur: Die Philosophierung der Literatur). Danto verbindet dabei die postmoderne Entgrenzungsthese mit der Hegelschen Geschichtsphilosophie. Die Unterschiede zwischen Künstler und Kritiker, Werk und Rezeption lösten sich in dem Maße auf, in dem Kunst nicht mehr an bestimmte Personen und Objekte gebunden sei. Die (Post)moderne Kunst habe sich durch konsequenten Interpretationismus selbst zum Objekt gemacht und damit auch noch den Unterschied von Subjekt und Objekt aufgehoben. Nach Hegel falle aber das Ende von Geschichte mit der Aufhebung der Subjekt-ObjektDialektik (dem absoluten Wissen) zusammen. Kunst sei in ihrem posthistorischen Zeitalter zu sich selbst gekommen, indem sie zu Philosophie geworden sei. „Die weitere Geschichte (ist) ... jetzt Sache der Philosophie“ (243). Doch diese Entgrenzung gehe weiter: sie „bewirkt einen Wandel der gesamten Kultur“ (244). Der Pluralismus der Tiefeninterpretationen (=Philosophien) sei nunmehr auf der Höhe der Zeit, habe diese „auf den Begriff gebracht“. Mit (Hegels) Geschichtsphilosophie läutet Danto das Ende von (Kunst)Geschichte ein. Im Gegensatz zu seinen postmodernen Kollegen (wie etwa Lyotard) bedient sich Danto der Metaerzählungen, um das Paradies des ästhetischen Pluralismus zu verkünden, als dessen Propheten er sich selbst betrachtet (244). Das schöne Ideal von der Gleichberechtigung der Lebensformen wird „gestützt“ von der post- modernen Annahme: „Geschichte hat ein Ende, die Menschheit aber bleibt bestehen“ (142). Für Danto verbleibt die Geschichtsphilosophie als Surrogat von Tiefeninterpretationen, aus denen keine Konsequenzen gezogen werden dürfen außer derjenigen, daß es deren viele gibt. Diese autosuggestive Vorstellung von Kunst und Geschichte wird sich aber auch mit der selbstproklamierten These auszusetzen haben, sie sei ja auch nur eine Interpretation unter vielen. Es überrascht nicht, daß sie eben dies nicht tut. Wolfgang Melchior Terry Eagleton Ästhetik. Die Geschichte ihrer Ideologie Stuttgart-Weimar 1994 (MetzlerVerlag), engl. Br., 447 S., 78.- DM. Um eine Geschichte der Ästhetik handelt es sich bei diesem Werk nicht. Zu viele bedeutende Ästhetiker werden mit Stillschweigen übergangen, zu wenig werden die behandelten Autoren und Werke sys- tematisch entfaltet. Eagleton verfährt exemplarisch; von der englischen Aufklärung (Shaftesbury, Hume) bis zur französischen Postmoderne (Foucault, Derrida) stellt er einzelne Ästhetiker und ästhetische Konzepte vor: Kant und Schiller, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Freud, Heidegger, Benjamin, Adorno. Kenntlich gemacht wird dabei das Prinzip oder der Begriff des Ästhetischen, von dem aus die Phänomene des Schönen, des Häßlichen oder der Kunst dargestellt oder entschlüsselt werden. Zum einen will Eagleton die sozialen und moralischen Fragen transparent machen, die in den Begriffen des Ästhetischen enthalten sind und in denen sich der „Kampf der Mittelklasse um politische Hegemonie“ ausdrückt. Zum anderen versucht er, über die Widersprüchlichkeit und Ambiguität dieser Begriffe, den Zugang zu den zentralen Fragen der europäischen Moderne freizulegen. Dieser Zugang besteht für Eagleton insbesondere in zwei Tendenzen. Erstens versucht er den Nachweis zu führen, daß die moderne Philosophie selbst die Form und Struktur des Ästhetischen annimmt. Hegel Bücher zum Thema hatte die Kunst der Philosophie bzw. der Wissenschaft mit dem Argument untergeordnet, die prosaische Wirklichkeit könne im Medium der Sinnlichkeit nicht adäquat dargestellt und begriffen werden. Nun rächt sich die Kunst gewissermaßen, indem sie der Philosophie selbst den Stempel des Ästhetischen aufdrückt. Bei Marx wird die Kunstproduktion zum Modell der freien, selbstbestimmten Arbeit, während die Ware das Schandmal des „mißlungenen Kunstwerks“ auf der Stirn trägt (213 und 218). Bei Nietzsche erscheint der Wille zur Macht in der „inneren Form eines Kunstgebildes“; der Übermensch ist nach dem Vorbild des Künstlers geformt (258). Freud faßt den primärnarzistischen Zustand des Menschen, in dem Objekt- und Ichlibido noch miteinander verschmolzen sind, als einen ästhetischen Zustand (273). Heidegger ästhetisiert sowohl das menschliche Dasein, das im Vorlauf zum Tode seine Zufälligkeit überwinden und sich eine innere Notwendigkeit geben will, als auch (nach der Kehre) das Sein selbst (306 und 315). Was die Grundbegriffe der verschiedenen Philosophien mit dem Ästhetischen verbindet, ist die Ein- heit von Freiheit und Notwendigkeit, von Einzelnem und Allgemeinem, von Faktum und Wert, aber auch der Charakter des Selbstzweckhaften. Die ästhetisch gewordene Philosophie zeichnet sich dadurch aus, daß sie jene Themen und Inhalte aufbewahrt, die der verdinglichten Rationalität der Wissenschaft und des Positivismus fortlaufend zum Opfer fallen. Von Schelling führt der Weg über Nietzsche und Heidegger so geradewegs in die Postmoderne. Eine zweite Entwicklungstendenz der Philosophie sieht Eagleton in der zunehmenden Emanzipation des Sinnlichen, Körperlichen, Einzelnen aus seiner geistigen Beherrschung durch das Allgemeine. Entstanden ist die Ästhetik als „Diskurs über den Körper“. Sie hat sich (bei Baumgarten) als Herrschaft über das bisher Unbeherrschte etabliert, als Kolonialisierung der Sinnlichkeit und des Gefühls durch die Rationalität. Der klassischen Ästhetik gelingt es noch, beide Seiten zu vermitteln und Körper/Neigung und Geist/Pflicht als schöne Harmonie darzustellen. Mit dem Zerfall der klassischen Ästhetik zerfällt diese Einheit jedoch. Das sinnlich Einzelne befreit sich (etwa in Nietz- sches Begriff des Dionysischen oder des Lebens) aus seiner Kolonialisierung und Disziplinierung. Luk cs, der am Begriff der Totalität festhält (und die Zersplitterung als durch die Totalität produziert begreift), wird ausdrücklich abgelehnt. Benjamins und Adornos Konzept des Splitters, der „Konstellation“ dagegen, die das Einzelne gegen seine begriffliche Identifizierung verteidigt, als der „originellste Versuch“ (341) gewürdigt, im Zeitalter der Moderne mit der Totalität zu brechen. In Michael Bachtins Bild des Karnevals, der Geburt und Tod, Hohes und Niederes, Zerstörung und Erneuerung durcheinanderwirbelt, ist diese Logik zu Ende geführt. Der Begriff der Ideologie, den Eagletons Werk im Untertitel trägt, verweist darauf, daß die Ästhetik nicht als abgehobene Geistesgeschichte behandelt, sondern auf die wirkliche Geschichte bezogen wird. Über den klassischen Ideologiebegriff geht Eagleton dabei insofern hinaus, als er die Ästhetik weniger als Reflex von Klassenkämpfen, als „Diskurs über den Körper“ begreift. Die Ästhetik wird auf diese Weise zur Gegenbewegung, zum Hort des Widerstands gegen die reale Geschichte, die den Körper, die Sinnlichkeit, das Konkrete oder die „Lebenswelt“ zunehmend unter die Gewalt der verdinglichten Rationalität zwängt, d.h. in ihr System preßt. Übereinstimmung in diesem Ausgangspunkt besteht nicht nur mit Adorno und der Frankfurter Schule, sondern auch mit dem „intellektuellen Milieu des modernen Frankreich“, in dem sich Eagleton beheimatet weiß. Es sind vor allem die späten Schriften Paul de Mans und die darin durchgeführten Dekonstruktionen, zu denen eine unerwartete Verwandtschaft besteht. Die Moderne beginnt mit der Auflösung der Einheit von Wahrem, Schönem und Gutem. Mit ihr beginnt das Ästhetische zugleich seine „Guerillataktik geheimer Subversion“, durch die es sich störrisch gegen seine Vereinnahmung durch das Allgemeine verhält und gegen seine Überformung durch das System behauptet. In dieser „linksästhetischen“ Tradition, die die Postmoderne prägnant zu Ende führt, bekommt auch Marx seinen Platz zugewiesen. Bei ihm erscheint das schlechte (Mathematisch-) Erhabene in der schlechten Unendlichkeit der Warenbewegung und der Akkumulation. Das gute Erhabene hingegen, das Unaussprechli- Bücher zum Thema che, dessen Inhalt über alle Form hinausweist, erscheint in dem Programm der sozialistischen Revolution. Sie ist die „absolute Bewegung des Werdens“, die ihre Poesie nicht aus dem Bekannten, Vergangenen bezieht (wie z.B. die Französische Revolution, die sich in ein antikes Kostüm kleidete), sondern allein aus dem Unsagbaren der Zukunft schöpft. Im Gegensatz zu Adorno erscheint das Erhabene, Nichtidentische bei Eagleton aber nicht als das nur Negative, das sich dem Weltlauf spröde widersetzt und das „ganz Andere“ aufblitzen läßt. Es ist zugleich der positive Vorschein einer zukünftigen und wünschenswerteren Welt. Mit Marx und Habermas hält Eagleton daran fest, daß die Utopie im gegenwärtigen System „irgendwie vorhanden“ ist und sich daher „aus unserer gegenwärtigen Praxis“ (421) entwickeln lassen muß. Konrad Lotter Peter Glotz Die falsche Normalisierung. Die unmerkliche Verwandlung der Deutschen 1989 bis 1994. Essays Frankfurt/Main 1994 (SuhrkampVerlag), 272 S., 19.80 DM. Seit Deutschland nach der Wiedervereinigung 1990 seine volle Souveränität zurückerhalten hat, reißen die Diskussionen um seine veränderte Stellung in Europa und der Welt nicht ab. Meist enden diese Diskussionen, wie z.B. in dem kürzlich erschienenen Buch des Politologen Hans-Peter Schwarz „Die Zentralmacht Europas“, mit der naheliegenden These: Wenn Deutschland auf dem Weltmarkt schon eine ökonomische Kraft sei, die man nicht übergehen könne, dann müsse sich diese Stärke nach Wiedervereinigung und Erlangung voller Souveränität auch in einer dementsprechenden Außenpolitik niederschlagen. Alte Zurückhaltungen, geprägt von der Nachkriegssituation, seien aufzugeben. Deutschland müsse sich der 'Normalität' und den 'Üblichkeiten' der anderen europäischen Nationalstaaten, vor allem an England und Frankreich, angleichen: ständiger Sitz im Weltsicherheitsrat, weltweites militärisches Engagement, unbeschränkter Waffenexport und die Option auf Che- mie- und Atomwaffen. Daß Peter Glotz sich derartigen Meinungen nicht anschließt, geht schon aus dem Titel seines Buches hervor, das diverse in Tageszeitungen und Magazinen veröffentlichte Essays aus der Zeit zwischen 1990 bis 1994 versammelt. Interessant sind seine Begründungen. Glotz' Gedankengang beginnt mit einem für das Buch neu verfaßten Exkurs über der These vom sog. deutschen „Sonderweg“. Um Verwirrungen zu vermeiden, sei eine kurze Begriffsklärung eingeschoben. Die Sonderweg-These ist ursprünglich eine 'linke' These und bezieht sich auf die historische Sonderentwicklung Deutschlands im 18. und 19.Jahrhundert. Während die Entwicklung in Europa durch die Fortschritte der Ökonomie, die Schaffung einheitlicher Staatsgebilde und die Übernahme der politischen Macht durch ein demokratisches Bürgertum gekennzeichnet war, war das deutsche Reich - bedingt durch seine territoriale Zersplitterung seit dem Mittelalter - ökonomisch und politisch zurückgeblieben. Diese Zurückgebliebenheit hemmte die Herausbildung eines starken Bürgertums als Agent der ökonomischen Entwicklung und Träger eines fort- schrittlich demokratischen Bewußtseins. Die nationale Einheit, eine zentrale Forderung des deutschen Bürgertums - im zentralistischen Frankreich schon durch den Absolutismus Ludwigs XIV. durchgesetzt - wurde für das deutsche Reich erst im Zuge der Reichsgründung von 1871 realisiert. Diese Reichsgründung, die von den alten Eliten militärisch und gewaltsam vollzogen wurde, war zugleich der politische Sieg des ancien regime und die Niederlage des deutschen Bürgertums. Dessen Assimilationsbewegung an das Wilhelminische Reich endete in der Kapitulation: der bedingungslosen Übernahme adligantidemokratischer, militaristischgewalttätiger und antizivilisatorische Normen. Das Resultat des deutschen Sonderweg ist, wie der Soziologe Norbert Elias dies benannt hat, jene deutsche „eigentümliche Spielart des Bürgertums“, die dadurch gekennzeichnet ist, daß „bürgerliche Menschen die Lebenshaltungen und die Normen des Militäradels zu den ihren machten“. Kurz gesagt, bezeichnet also der Begriff „Sonderweg“ das völlige Versagen des deutschen Bürgertums als einer emanzipatorischen geschichtlichen Kraft. Bücher zum Thema Peter Glotz beschäftigt sich zunächst mit diesem Begriff, weil er neuerdings von nationalkonservativen Kreisen in die Diskussion gebracht worden ist. Allerdings in einer spezifischen, umgedeuteten Form: Der Begriff wird von der sachlichen Beschreibung faktischer geschichtlicher Entwicklung abgezogen und auf Bewußtseinsformen und bewußte, willentliche Entscheidungen übertragen. Glotz referiert diesen neuen Sprachgebrauch: Verstanden wird unter diesem Begriff jetzt das „Sonderbewußtsein des deutschen Kaiserreiches, mit dem sich seine traditionellen, vormodernen Führungsgruppen vom 'Westen' abschotteten“ (34), und „der Sonderweg deutscher Tiefe und deutscher Gemeinschaft, der gegen die Oberflächlichkeit westlicher Zivilisation und westlicher Gesellschaft gesetzt worden war“ (37). Diesem umgedeuteten Sprachgebrauch scheint sich leider auch Glotz anzuschließen, wie dies vor allem in seiner Frage zum Ausdruck kommt: „Muß die Linke eigentlich in die semantische Falle tappen, besondere Lernschritte, die die Deutschen aus ihrer Geschichte folgern, mit dem zu recht verabscheuten Begriff 'Sonderweg' zu belegen?“ (40). Man möchte antworten: Sie muß nicht. Aber statt die semantische Falle zu umgehen und den beschreibenden Gehalt des Begriffs aufzugeben, könnte man die Falle als Scheinfalle entlarven. Dies vor allem dann, wenn man das Interesse, das sich in der Umdeutung artikuliert, so klar durchschaut, wie Glotz dies tut. Der so verstandene „Sonderweg“ soll alles Beharren auf (womöglich auch noch geschichtlich begründete) 'Besonderheiten' deutscher Politik (z.B. der Verzicht auf Atomwaffen und Rüstungsexporte) prinzipiell und von vorneherein diskreditieren, indem der Eindruck erweckt wird: Wer heute für Besonderheiten und Abweichungen deutscher Politik vom europäischen Standard redet, steht in der direkten Linie und der Tradition des elitären 'Sonderbewußtseins' wilhelminischer Prägung. Eine offensivere Argumentation täte dem Anliegen Glotz' keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil: Sein Anliegen besteht ja gerade in einem Plädoyer gegen die 'Normalisierung' deutscher Politik am Maßstab der europäischen Nationalstaaten und für eine Politik der bewußten und reflektierten, sich auf die Geschichte beziehenden Besonderheit. Glotz neigt der Sache nach mit vorsichtigen Einschränkungen der Ansicht zu, der deutsche Sonderweg sei nach 40 Jahren der Einübung in demokratische Traditionen und einem demokratischen Bürgertum als „tragender Schicht“ (18) der Bundesrepublik jetzt zu Ende gegangen. Auf dem Boden dieser - durch die hohe Arbeitslosigkeit nach der Vereinigung - zwar nicht ungefährdeten, aber doch zivilisierten Normalität, die nur besagt, daß Deutschland zum Niveau der westlichen Demokratien aufgeschlossen hat, und gegen die Verfechter einer nationalen 'Normalisierung', entfaltet Glotz sein alternatives Konzept einer Zivilund Technologiemacht Deutschlands, das ausdrücklich an die Erfahrungen der deutschen Geschichte anknüpft: „Die Alternative zur 'Normalisierung' wäre ein durchdachtes Konzept der historischen Lernfähigkeit und der internationalen Arbeitsteilung. Die Deutschen, die sich in diesem Jahrhundert in zwei schreckliche Kriege verwickelt haben (mindestens einen davon brachen sie selber vom Zaun), die ein anderes Volk - das jüdische - vom Erdboden tilgen wollten und am eigenen Leib erfahren mußten, zu welchen Katastrophen die Pest des Nationalismus führt, verfolgen mit Billigung ihrer Partner eine antitraditionelle Politik: kein Waffenexport, keine Militäreinsätze out of area, keine Kriegsfinanzierung mehr, keine logistische Hilfe für Kriegsparteien; aber Verteidigung der eigenen Region, ein wirksames Friedenscorps mit hohem technischen Bildungsstand und modernstem Gerät, große Investitionen zum Wiederaufbau und zur ökologischen Stabilisierung dieser gefährdeten Welt, eine besondere Aufgeschlossenheit für internationale Organisationen und eine internationale Rechtsordnung“ (92 f.). Aus der Besonderheit der geschichtlichen Erfahrung von jahrzehntelanger Teilung läßt sich statt einer Behinderung ein „Erkenntnisvorsprung“ (40) ableiten: „Deutschland besteht darauf, aus der Geschichte der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts etwas Besonderes gelernt zu haben“ (147). Glotz' Stellungnahme hinsichtlich des Prozesses der europäischen Vergemeinschaftung setzt gerade diese Forderung um. Denn aus den Erfahrungen seiner Geschichte und der Teilung habe Deutschland ein besonderes, gesteigertes Interesse an einem ökonomisch und politisch vergemeinschafteten Europa: „Das Bücher zum Thema vereinigte Deutschland dürfte nach sechs oder acht Jahren ernster Beanspruchung durch die Integration seiner östlichen Länder als stärkste ökonomische Macht Europas wieder handlungsfähig sein. Entweder ist es dann als separierbare historische Gestaltung, sozusagen als 'Staatskerl', der sich mit anderen 'Staatskerlen' mißt, verschwunden, weil integriert. Oder es wird zur regionalen Vormacht Europas, was auf dem Hintergrund deutscher Schuld selbst beim besten Willen aller Beteiligten - der kaum vorauszusetzen ist - zu endlosen und altvertrauten Verwicklungen (wenn auch in neuen Verkleidungen) führen dürfte“ (172 f.). Vor diesem Hintergrund absehbarer Komplikationen entfaltet Glotz sein Plädoyer für die Besonderheiten einer deutschen Politik, die sich durch ein besonderes europäisches Engagement auszeichnet und am Konzept eines vertieften Kerneuropas ausrichtet. gemeinschaftung weit hinausgeht, ist entscheidend von den Voraussetzungen und Bedingungen Nachkriegseuropas geprägt. Der Versuch, dieses Konzept auf ein, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks 1989 nach dem Osten hin geöffnetes Europa zu übertragen, müsse scheitern. Das dabei zu überwindende nationalstaatliche Prinzip habe gerade durch die Renationalisierung der Staaten Osteuropas wieder an Bedeutung gewonnen. Wer diese Staaten nicht nur in eine ökonomischen Gemeinschaft einbeziehen will (was bei den Unterschieden der Produktivkraftentwicklung problematisch genug wäre), sondern sie darüberhinaus in eine Politische Union Gesamteuropas integrieren möchte, verlangsamt den Vereinigungsprozeß bis zum Stillstand. Insofern ist die Öffnung des Ostens, wie Glotz bedauert, für den europäischen Einigungsprozeß 10 Jahre zu früh gekommen. Glotz Kritik am europäischen Vereinigungsprozeß bei grundsätzlicher Bejahung zielt immer auf denselben Punkt: das Konzept einer Politischen Union Gesamteuropas, also einer Union mit gemeinsamer Außen- und Sicherheitspolitik, das über eine bloß wirtschaftliche Ver- Die Alternative, die sich jetzt, nach 1989, stellt, lautet kurz zusammengefaßt: Entweder die Europäische Gemeinschaft wird vertieft, und das heißt, sie wird auf ein supranationales, wirtschaftlich und politisch vergemeinschaftetes Kerneuropa (etwa Frankreich, Deutschland, Italien und die Benelux-Staaten) beschränkt, da nur in solch einem beschränkten Kerneuropa eine Währungsunion und eine übernationale Vergemeinschaftung der Außenund Sicherheitspolitik in absehbarer Zeit umsetzbar wäre; oder aber, so sieht es der jetzt eingeschlagene Kurs vor, die Gemeinschaft wird vor allem nach Osten hin erweitert, was eine drastische Verlangsamung des Vereinigungsprozesses mit sich brächte, und, wenn überhaupt, lediglich auf einen vereinheitlichten Wirtschaftsraum Gesamteuropas hinausliefe - unter Beibehaltung des nationalstaatlichen Prinzips. Dessen Überwindung liege aber im besonderen, geschichtlich begründeten Interesse Deutschlands, da nur sie die Konflikte, die sich aus der deutschen Vergangenheit und einer zukünftigen 'konventionellen' Großmachtpolitik Deutschlands für Europa ergäben, entschärfen könne. Gegen das Konzept der europäischen Föderalisten hat nun aber vor kurzem - zu Glotz' großem Bedauern - das deutsche Verfassungsgericht die Idee eines europäischen „Zweckverbandes“ mehr oder weniger festgeschrieben. Setzt sich diese Idee eines Zweckverbandes souveräner Staaten durch, wäre die Folge in jedem Fall der Verzicht auf die ursprünglich einmal angestrebte Politische Union Europas. Die Verwicklungen und Querelen, die sich aus der Beibehaltung des nationalen Prinzips und der ökonomischen Vorherrschaft Deutschlands für Europa ergeben, sind aufgrund von Glotz' Analysen bereits jetzt absehbar. Wolfgang Thorwart Raul Hilberg Unerbetene Erinnerung. Der Weg eines Holocaust-Forschers aus dem Englischen von Hans Günter Holl, Frankfurt/Main 1994 (Fischer-Verlag), 175 S., 34.- DM. Alles, was Raul Hilberg, einer der ersten und bedeutendsten Historiker der Vernichtung der europäischen Juden, schrieb, war unerwünscht, stieß auf Ablehnung und offene Feindseligkeit oder schlimmer noch: es wurde, nicht nur hierzulande, mißachtet und totgeschwiegen. Als der junge Student 1948 seinen Doktorvater mitteilte, er wolle seine Dissertation über „das ungeheure Thema“ (12) schreiben, lautete die Antwort: „Das Bücher zum Thema ist Ihr Untergang.“ So schlimm kam es zwar nicht - zum Glück des Autors, zum Gewinn der Geschichtsschreibung und zum Nutzen der Leser -, aber in welche Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit sich begibt, wer sich mit dem monströsen, ganz unsinnig als „Holocaust“ bezeichneten Verbrechen der Deutschen befaßt, das erfährt man in bedrückender Deutlichkeit aus dem soeben bei S. Fischer erschienenen Buch Raul Hilbergs, das im amerikanischen Manuskript „The Politics of Memory“ heißt, in der deutschen Erstveröffentlichung den Titel „Unerbetene Erinnerung“ trägt. Damit liegen nicht die voluminösen Memoiren eines allgemein anerkannten emeritierten Gelehrten vor, der mit Stolz und Eitelkeit auf ein umfangreiches Werk und erfülltes Leben zurückblicken kann, sondern der Leser ist mit einem schmalen, kühlen Erfahrungsbericht konfrontiert, aufgezeichnet in einem präzisen parataktisch-schmucklosen Stil, den die Übersetzung, die bemerkenswerter Weise vor dem Originaltext publiziert wurde, nicht immer gerecht wird. Das Buch gewährt erhellende Einblicke in das Entstehen und mühevolle Gelingen einer großen Lebens- leistung. Jahrzehnte lang in vielen Archiven forschend, versuchte Hilberg, die einem einzelnen eigentlich unzumutbare Aufgabe zu bewältigen, den ganzen von der nazistischen Gesellschaft gnadenlos vorangetriebenen, durch seine „gegenrationale“ Logik höchst komplexen Prozeß der Ausgrenzung und Vernichtung zu dokumentieren und die Täter aus Partei, Staat, Wirtschaft und Wehrmacht zu benennen. Dem Forscher war von Anfang an klar, daß sein historischer Gegenstand sich grundlegend von allen anderen unterschiedet, und wir wissen, daß er gegenwärtig bleiben wird in unabsehbarer Zeit. Mit „trüben Tröstungen“ (126) hatte Hilberg nie etwas im Sinn: er wollte tiefer blicken. Nicht Mahnung oder der Wunsch, das kollektive Gewissen zu verkörpern, treiben ihn, sondern die Zeitgenossen und Nachgeborenen, wenn sie denn irgendwann Abwehr und Widerstand überwänden, sollten aus seinen Büchern das notwendige Wissen erfahren und erkennen, was geschah. Wissen aber bedeutet noch nicht, die absolute Sinnlosigkeit des millionenfachen Mordes zu verstehen. Dem resümierenden Autor war das stets bewußt, was sein Leben nicht leichter machte. Die Täter dagegen quälte nie, was sie verbrochen hatten. Hilberg wurde 1926 in Wien geboren. Lakonisch, fast sarkastisch erzählt er auf wenigen Seiten die Geschichte seiner Eltern und Verwandten - viele von ihnen verschwanden spurlos in den deutschen Todeslagern. Eher beiläufig, scheinbar ohne Zorn und Haß, die Trauer hinter kargen Worten versteckt, wurde die Flucht der dreiköpfigen Familie über Kuba in die USA erwähnt. Kurze Zeit diente Hilberg in der amerikanischen Armee, und nach seiner Entlassung begann er, unter anderem bei Rosenberg und Neumann politische Wissenschaft zu studieren. Er gehörte zu den ersten, die mit den in amerikanische Archive überführten deutschen Akten aus der Zeit des Nationalsozialismus arbeiten durften. Bis zu seiner Emeritierung 1991 lehrte Raul Hilberg Politologie an der Universität Burlington in Vermont. Mit seinem Entschluß, die Verbrecher aus der Perspektive der Täter zu beschreiben - „Die Judenvernichtung war ein deutsches Werk, ausgedacht in deutschen Amtsstuben, in einer deutschen Kultur“ (54) - begannen Jahre der Isolation, allein mit Tausenden von Dokumenten, die gesichtet, zugeordnet und bewertet werden mußten, wahrlich „ein einsames Projekt“. Und außerhalb der geschlossenen Welt der Akten herrschte der Kalte Krieg und das kalte Vergessen. In einem der wenigen politischen Kommentare des Buches heißt illusionslos: „In einer Atmosphäre, die das Augenmerk der amerikanischen Juden auf Israel und Araber richtete, während die breite Masse der Amerikaner hauptsächlich den Kalten Krieg mit der Sowjetunion verfolgte, wurde mein Thema rigoros in die Vergangenheit verbannt. Damals riet man allen, die von Erinnerungen geplagt wurden wie die Überlebenden -, möglichst schnell zu vergessen, was geschehen war. So wurden die Nürnberger Prozesse weniger geführt, um die deutsche Geschichte aufzuarbeiten, als um etwas Unerledigtes abzuschließen, damit man Deutschland angesichts der kommunistischen Bedrohung als „ehrbares“ Mitglied des nordatlantischen Bündnisses wiederaufbauen konnte.“ (61) Ausführlich beschreibt Hilberg all die Schwierigkeiten und Enttäuschungen, die ihm die Publikation Bücher zum Thema seines nach vielen Jahren fertiggestellten Typoskripts bereitete. Nervenkraft und Lebenszeit kostete die Suche nach dem richtigen Verlag, auch um die Finanzierung der Druckkosten mußte der Autor sich selbst bemühen, und noch die Gestaltung des gewichtigen Bandes trug die Male der Nachlässigkeit und Indifferenz. Aber das erwies sich geradezu als harmlos gegen den - wie der Autor es nennt - „dreißigjährigen Krieg“, der nach dem Erscheinen seines Buches „The Destruction of the European Jews“ von Seiten jüdischer Kritiker gegen ihn ausbrach. Nicht daß er sich auf die Täter, den von ihnen entfesselten Prozeß der Vernichtung konzentriert hatte, rief Befremden und oft genug polemische Ablehnung hervor, sondern daß er, scheinbar herzlosunbeteiligt, den ins Zentrum des Unvorstellbaren führenden, äußerst diffizilen Komplex der Beteiligung der Opfer an ihrer Entmenschlichung und Ermordung aufrührte. Er hatte das Verhalten der jüdischen Gemeinden in seine Schilderung aufgenommen, weil er sie als verlängerten bürokratischen Apparat des nazistischen Deutschlands ansah. Schmerzhaft war auch die nüchterne Feststellung, „daß es so gut wie keinen jüdischen Widerstand und so gut wie keine Opfer auf deutscher Seite gab“ (110). Diese Kontroverse hat sich bis heute nicht beruhigt; immer noch mußte sich Hilberg Gefühlskälte und Gleichgültigkeit gegenüber den Ermordeten vorwerfen lassen. Aber wenn auch ein Unterton der Verbitterung nicht zu überhören ist, so versucht er doch weiterhin, auch in diesem Buch, mit Hinweisen auf Fakten und Argumente zu reagieren. Besonders scheint ihm die Kritik Hannah Arendts verletzt zu haben, die seinen Arbeiten so viele Einsichten verdankt und doch mehrfach, etwa in Briefen an Karl Jaspers, geringschätzig über den Autor urteilte. Hilbergs böser Kommentar zu ihren Schriften ist zweifellos ungerecht und nur aus der zugefügten Kränkung zu erklären. Ein besonderes und wahrlich deprimierendes Kapitel bildet der Bericht über den Versuch, in den 60er Jahren eine deutsche Ausgabe seines Hauptwerks erscheinen zu lassen. Jahrelang zogen sich die Verhandlungen mit namhaften westdeutschen Verlagen hin, die schließlich alle mit fadenscheinigen Begründungen absagten. Erst 1982 veröf- fentlichte ein kleiner Berliner Verlag, der längst nicht mehr existiert, das Buch. Inzwischen gibt es bei S. Fischer, dem Verlag, der sich ernsthaft um Hilbergs Werk und seine Verbreitung bemüht hat, eine überarbeitete dreibändige Taschenbuchausgabe - die zweite deutschsprachige Fassung also: vielleicht ein Durchbruch und mit ihren zahlreichen Ergänzungen die wohl endgültige Version. Seine „unerbetene Erinnerung“ beschließt der Autor mit einem kurzen Bericht vom Wiedersehen seiner Geburtsstadt Wien nach mehr als 50 Jahren; in der Wohnung seiner Eltern leben noch jene, die sie 1938 daraus vertrieben. Ohne Erregung wird es mitgeteilt; Hilberg zielt nicht auf Verständnis, sondern auf den Verstand des Lesers. Und doch werden wie im Vorwort so auch auf den letzten Seiten die Erschöpfung und Leere spürbar, die diese ungeheuere Anstrengung des Forschens und Erklärens stets begleiten. Selbst in solchen Momenten hält Hilberg seine Gefühle unter Kontrolle, weist er jede wehleidige Regung und falsche Einfühlung ab. Indirekt nur läßt er einen Blick in sein „innerstes Wesen“ zu, indem er eine längere briefliche Äußerung von H.G. Adler zu seiner Person und seinem Buch aus dem Jahre 1964 zitiert. Die Schlußpassage lautet: „Am Ende bleibt nichts als die Verzweiflung über alles und der Zweifel an allem, denn für Hilberg gibt es nur ein Erkennen, vielleicht auch noch ein Begreifen, aber bestimmt kein Verstehen.“ Norbert Hofmann Niklas Luhmann/Frederick D. Bunsen/Dirk Baecker Unbeobachtbare Welt. Über Kunst und Architektur Bielefeld 1990 (Haux-Verlag), 104 S. Beim Beobachten, schreibt Luhmann in dem zentralen Aufsatz „Weltkunst“ des Bandes, werden stets Unterscheidungen gehandhabt. Beobachten stelle eine Unterscheidung zwischen Beobachtetem und Unbeobachtetem her. „Welt“, äußere und innere, erweise sich als unbeobachtbar, wenn und weil sie in ihr beobachtet wird. Unterscheidungen setzten sich über die Resultate, die Unterschiede, selbst voraus. Paradoxerweise müßten sie sich aus dem kontingenten Unterschiedenen Bücher zum Thema ausschließen, aus dem, was sie gerade unterscheiden können (vgl. Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt/M. 1992, S.526). Seit der Renaissance, so Luhmann reagiert die Malerei auf das Paradoxon der Unbeobachtbarkeit von Welt: durch die Beschäftigung mit der Zentralperspektive wird die Wahrnehmung zum Gegenstand von Malerei, seit der klassischen Moderne auch die Beobachtung von Kunst als Beobachterin, und bereits mit der Romantik lasse sich ein Übergang von einem dingbezogenen zu einem weltbezogenen Formbegriff verzeichnen: „Das Kunstwerk erscheint nun als unterscheidbare Form, die aus Formen besteht“ (16). Luhmanns Begriff der Form ist an den von George Spencer Brown angelehnt: Form als Zwei-SeitenForm des Beobachteten und des Unbeobachteten, deren Einheit vorausgesetzt werden muß, und die beobachtend nicht einzuholen ist[1]. Vor dem Hintergrund dieser Formauffassung markiere ein Kunstwerk - als fiktional Reales unter Realem zwei Realitätsebenen und entziehe die 'reale Realität' dem Blick. „Die Kunst hat es mithin mit dem Paradox der Beobachtbarkeit des Unbeobachtbaren zu tun, und ihre Bemühung um Form löst dieses Paradox auf... Aber die Auflösung läßt das Paradox intakt, sie invisibilisiert es nur und läßt ihm die Möglichkeit, in anderen Umständen andere Formen zu kreieren“ (20). Die Kunstbetrachtung macht also eine ansonsten, auch für ästhetische Theoriebildung, latent bleibende Erfahrung möglich: die des Paradoxon der Unbeobachtbarkeit von Welt. Diesen Zusammenhang nennt Luhmann, im Unterschied zu einer „Objektkunst“, „Weltkunst“. Von seiner Analyse einer Kunstbetrachtung erhofft sich Luhmann Erträge für „einen ausreichenden Begriff der Modernität der Gesellschaft und ihrer Funktionssysteme“ (42). Hierzu fehlt jedoch eine genauere Konstruktion. Es bleibt unklar, ob er Erträge für eine soziologische Theoriebildung oder allgemeiner eine Kunstbetrachtung in Erkenntnisfunktion meint. Beides scheint gemeint zu sein, und über beides läßt sich streiten. Auch bleibt offen, an welche Objekte mit welchen Charakteristika zu welcher Zeit der Wahrnehmung ge- dacht wird, wenn von „Weltkunst“ im Gegensatz zur „Objektkunst“ die Rede ist. Die zeitgenössischen Werkbezüge des Bandes jedenfalls beschränken sich auf Arbeiten des Malers F.D. Bunsen (46 ff; 51 ff), und der systemtheoretische Aufsatz von D. Baecker (67 ff) befaßt sich anwendend mit dem allgemeineren Thema von Innen und Außen in der Architektur. So fehlt Exemplarisches, obwohl es Luhmann doch um Beschreibungen geht. Ein verallgemeinernder Bezug auf 'Kunst' muß mit dem binären Form- und Beobachtungskonzept in Zusammenhang gebracht werden. Im folgenden einige Überlegungen zum Verhältnis von Beobachtung, Betrachtung, Wahrnehmung, Erfahrung und Sprache. Von einer Ebene unreflektierten Beobachtens ausgehend unterscheidet Luhmann kybernetische Ordnungsebenen: Beobachten, Beobachten des Beobachtens, Beobachten des Beobachtens des Beobachtens. So wird eine Unterscheidung zweier Unterscheidungshinsichten möglich. Mit der zweiten Ebene, der des Beobachtens von Beobachten und Beobachtern, wird die Position eines partiell unbeobachtbaren Beobachtens selbstbezüg- lich. Diese Selbstbezüglichkeit prägt Luhmanns Beschäftigung mit der Beschäftigung mit Kunst in der ästhetischen Theoriebildung: die systemtheoretische Reduktion, die mit der binären Codierung von Beobachtetem/Unbeobachtetem arbeitet, ermöglicht eine genaue Ebenenanalyse sogenannter ästhetischer Diskurse. Stets geht es Luhmann um das sozusagen erscheinende Paradoxon der Beobachtbarkeit eines Unbeobachtbaren. Welche aber sind die virtuellen Bezüge der ästhetischen Diskurse und der sprachlichen Kommunikation über Kunst und Kunstbetrachtung? Der reduktive Terminus des Beobachtens ist, trotz der Beschränkung auf die zwei Seiten einer Form, ambivalent angelegt. Es geht um Wahrnehmungsereignisse und damit um Erfahrungen. Trifft Luhmanns Konstruktion überhaupt die jeweils im Spiel befindlichen Betrachtungsereignisse? Wie etwa soll eine Rückkehr von einer Betrachtung des Betrachtens zum betrachteten Betrachten stattfinden können? Es wird unterstellt, ein kategorial Gleiches wieder vorfinden zu können. Luhmann ist der Ansicht, ein erstes Beobachten ließe sich sozusagen in methodischer Einstel- Bücher zum Thema lung trivialisieren und zurückholen. Das Moment 'Zeit' aber läßt Wiederholungen im strengen Sinne nicht zu. So bleibt das Verhältnis von Naivität und Reflexion klärungsbedürftig und damit das mit der Theoriesprache des systemtheoretischen Ansatzes Beschriebene. Luhmann würde ein Entschwinden von Betrachtungsereignissen, im Sinne der Bestätigung der Paradoxie, unter die Beobachtung eines Unbeobachtbaren einordnen. Aber was beobachtet die nach Ebenen operierende Anwendung der Theorie nicht? Und womit gibt sie sich zufrieden? Was wäre z.B. über Erfahrungen in der Betrachtung von Bildern des Malers Francis Bacon auszumachen? Gemeint ist ein häufiger bekundetes Changieren von Erregung und Distanzierung vor den Bildern, keineswegs einsinnig und sukzessive aber, sondern diskontinuierlich im Wechsel von Affektion und Beschäftigung mit dem eigenen Betrachten. Müßten nicht solche aus kybernetischer Sicht eher ungeordneten Erfahrungsereignisse den funktionalen Blick auf Welterkenntnis verstellen und irritieren, nur weil die Theorie die Ereignisse nicht einholt, und die Folge der Beobachtungsebenen durcheinandergerät? Hat man es da noch mit „Weltkunst“ zu tun? Mit diesen Fragen zum Verhältnis von ästhetischer Erfahrung einerseits und Sinnkonstruktionen und Kohärenzbemühungen in der Theoriebildung andererseits eröffnet sich ein Spannungsverhältnis zur sog. „Ästhetik des Erhabenen“. Für Luhmann ist „das Erhabene ein Abwehrbegriff für Beliebigkeit“, der „die Selbstkompositionsleistung eines Kunstwerks“ verfehle (66); damit aber auch die Anbindung der Kunstbetrachtung an die Funktionssysteme einer Gesellschaft. Wenn J.F. Lyotard etwa die Ausdruckslosigkeit von Betrachtern einer Ästhetik des Geschmacks oder einer interpretierenden Bemühung um Kohärenz gegenüberstellt, dann tut er dies mit dem Akzent der Verweigerung einer Systemeinbindung. Deskriptiv einbezogen sind für Lyotard die Ausdruckskulturen des Alltags sowie die systemischen Einbindungen der Theoriebildung. „Wir sind alle, ob wir wollen oder nicht, im Dienste von ..., im Dienste einer Verbreitung der Leistung des Systems“, so Lyotard im Juni 1994 auf dem Symposion „Die Deutsch- Französischen Dialoge in der Philosophie“ der Universität Düsseldorf. Gerade daher sei es „konstitutiv falsch, abstrakte Einheiten gegen die Singularitäten romantisch zu ersehnen.“ „Ein offenes System“, so Lyotard, „braucht Träume, weiße Flecken, um der Entropie zu entgehen... Wahrheit funktioniert nicht; ein schrecklicher Ausdruck: á marche, es funktioniert.“ Eine Erörterung des Spannungsverhältnisses zwischen den Ebenen hätte es nicht nur mit auseinandergehenden Dispositionen der kunstsoziologischen Betrachtung Luhmanns und der philosophischen Ästhetik Lyotards zu tun. Zumindest dürfte sie nicht bei einer Gegenüberstellung von Erklären und Erfinden stehenbleiben. Klärungsbedürftig ist, wie oben umrissen, Luhmanns reduktive Auffassung der Kunstbetrachtung. Zu erörtern wäre die Anwendung und Anwendbarkeit des anderweitig, etwa in epistemologischen Zusammenhängen, ausgearbeiteten Unterscheidungsmodells der Systemtheorie Luhmanns auf ästhetische Erfahrungen, die Luhmann gewiß nicht so bezeichnen würde. Ignaz Knips Niklas Luhmann Die Wissenschaft der Gesellschaft Frankfurt/Main 1992 (Suhrkamp), 732 S., 34.- DM. Wir glauben immer noch an „Natur“-Wissenschaften, an sie sogar in erster Linie. Wir sprechen immer noch von Entdeckung“. Aber eigentlich ist alles Konstruktion eines Beobachters für andere Beobachter.“ (151) Mit einer Flut von Veröffentlichungen bietet Niklas Luhmann die Funktionsweise sozialer Systeme aus einem konstruktivistischen Verständnis heraus dar. Die Botschaft lautet, da die Konstitution der menschlichen Struktur die Voraussetzung jeglicher Erkenntnis ist. Diese individuelle menschliche Voraussetzung wird transferiert in die sozialen Systeme der Welt, der Begriff Intersubjektivität ausgeschlossen und das jeweilige System entlang menschlicher Konstitution personifiziert. Religion, Pädagogik, „Weltkunst“ und in diesem Band Wissenschaft werden als selbstreferentielle Funktionssysteme innerhalb der Bücher zum Thema Gesellschaft oder auch Welt denn Gesellschaft ist zu verstehen als Weltgesellschaft gesehen und ihre Botschaften und Erkenntnisfähigkeit relativiert. In diesem Buch beschreibt Niklas Luhmann, als Beobachter von Beobachtungen, eine Gesellschaftstheorie, in der er die Wissenschaft als ein besonderes Funktionssystem innerhalb anderer sozialer Systeme herausarbeitet. Die Funktionsweise von Wissenschaft (wie auch der Systeme, die Gegenstand anderer Veröffentlichungen sind) innerhalb des sozialen Systems Gesellschaft wird im wesentlichen durch zwei Ansätze beschrieben: 1. Luhmann bezieht sich auf die konstruktivistische Erkenntnistheorie des chilenischen Biologen Humberto Maturana (H. Maturana, F. Varela: Der Baum der Erkenntnis, Bern, München, Wien 1987). Das Phänomen des blinden Flecks, durch zahlreiche Versuche, insbesondere mit Farben belegt (nicht das Spektrum des einfallenden Lichts bestimmt unsere Farbwahrnehmung, sondern „die individuelle Struktur jeder Person“. Maturana), läßt darauf schließen, daß die menschliche Konstitution die Be- dingung aller Erkenntnis sein muß. Wie ist es möglich, daß dennoch für eine mögliche Erkenntnis die Welt als Ganzes gegeben ist? Der Begriff der Beobachtung wird für Luhmann zum entscheidenden Kriterium für die Erkenntnisfähigkeit von Systemen (Niklas Luhmann u.a., Beobachter. Konvergenz der Erkenntnistheorie, München 1992; Unbeobachtbare Welt. Über Kunst und Architektur. Bielefeld 1990). Da die Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis systemimmanent angelegt ist, müssen die vom System vollzogenen Operatio-nen (Erkennen und Handeln) beobachtet werden und dieses Beobachten kann wiederum beobachtet werden. Durch Beobachten von Beobachtung wird eine Differenz erzeugt. Es kann unterschieden werden zwischen systeminterner und systemexterner Erkenntnis. Auch die Wissenschaft versteht sich nicht als „weltexterner Weltbeobachter“, sondern Wissenschaft ist ein in sich geschlossenes spezifisches Funktionssystem innerhalb der Gesellschaft: „Da die Wissenschaft ein Funktionssystem der Gesellschaft ist, also in allem, was sie tut immer auch Gesellschaft vollzieht und folglich nicht anders operieren kann als durch Kommunikation, ist und bleibt sie durch Sprache in die Gesellschaft eingebettet“ (388). 2. Von diesem erkenntnistheoretischen Ansatz, angewandt auf eine Gesellschaftstheorie, kommt Luhmann in seiner Argumentation zum zweiten Ansatz, nämlich den Problemen von Zirkularität und Paradoxie selbstreferentieller Systeme. Die Grundlage dieses Ansatzes bildet die Logik von George Spencer Brown (Laws of Form, New York 1977). Es geht hier um die Form der Form. Dabei darf Form nicht als ontologischer Status aufgefaßt werden, sondern als Zwei-SeitenForm, die den Unterschied des Beobachtens markiert, denn gerade dieser wird durch Beobachtung explizit: es wird möglich, zwei Seiten zu sehen, die eine, die eliminiert wird, und die andere, die für weitere Optionen relevant wird. Beide Seiten bilden eine Einheit. Durch den Zeitfaktor soll die Paradoxie aufgehoben werden. Beobachtet man nun die Wissenschaft mit Luhmann auf der Beobachtungsebene zweiter Ordnung, also als Beobachter von Beobachtungen, stellt sich die Wissenschaft in zwei Formen dar, als selbstreferentielles und fremdreferentielles System. Die Wissenschaft ist zum einen ein selbstreferentielles System, wenn man voraussetzt, daß die Bedingungen der Erkenntnis die strukturellen Gegebenheiten des Systems sind. Dies bedeutet eine Umstellung von asymmetrischen Begründungsannahmen auf Zirkularität. Das hat Auswirkungen auf die Wahrheitswerte „wahr und „unwahr“, die nur im Wissenschaftsystem entscheidbar sind. Ist andererseits der Druck der Gesellschaft zu groß, reagiert die Wissenschaft mit einer „Inflationierung des Wahrheitsmediums“. Luhmann beschreibt zwei Extrempole: es entwickelt sich entweder eine unverständliche Eigensprache oder es kann alles erklärt werden. Ein konstruktivistisches und differenztheoretisches Selbstverständnis des Wissenschaftssystems bedeutet, so Luhmann, einen Verzicht auf Autorität oder führt zum Autoritätsverlust. Eine erhöhte Unsicherheit im gesellschaftlichen Alltag, der seine Erwartungen nach gesichertem Wissen, nach dem „Richtigen“ und „Vernünftigen“ seitens der Wissenschaft nur noch in der funktionierenden Technik erfüllt sieht, ist die Folge. Dieser auf konstruktivistischer Erkenntnis basierenden Funktionsweise von Wissenschaft wird Referenzverlust oder auch Bücher zum Thema Sinnverlust vorgeworfen. Luhmann fragt nun nach der anderen Seite der Form von Referenzverlust: was ist Referenz? In der zweiwertigen Logik gibt es einen einzigen Wert für Wahrheit, der damit auch Sein artikuliert und Referenz bezeichnet. Der differenztheoretische Ansatz designiert ein zweistufiges Referenzproblem. Referenz ist die Bezeichnungsleistung einer Beobachtung und bezeichnet damit das Objekt oder die Operation. Differenziert man nun, so Luhmann, zwischen der Beobachtung und der Operation, so entscheidet man zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz. „Real ist das, was als Unterscheidung praktiziert, durch sie zerlegt, durch sie sichtbar und unsichtbar gemacht wird: die Welt“ (707). Luhmann sieht ein Problem zwischen dem Wirklichkeitsbild der Wissenschaften und dem Wirklichkeitsbild des gesellschaftlichen Alltags, welches ontologisch und im „Eins-zu-eins-Denken“ geblieben ist. Ein „polykontexturales“ Weltbild, welches anerkennt, da die Realität der Welt nur die Konstruktion eines Beobachters ist und sich durch Unterscheidungen und Limitationen konstruiert, führt zu Ver- unsicherungen und einer Zunahme von Wahrscheinlichkeitsaussagen statt Bestimmtheitsaussagen. Eine Reduktion komplexer Strukturen vermittelt Überschaubarkeit und damit Sicherheit. Während Luhmann die Funktionsweise von sozialen Systemen beschreibt und psychische Systeme (Individuen) untergeordnet sieht, begründet er dieses Problem in der Wahrnehmungsfähigkeit des Individuums. Es ließe sich folgern, psychische Systeme sind sozialen Systemen in ihrer Konstitution unterlegen, aber gleichzeitig ist deren Konstitution Grundlage für soziale Systeme, ohne daß dabei der Aspekt der Intersubjektivität thematisiert wird. Die Systeme nach ihren erkenntnistheoretischen Voraussetzungen zu befragen, enthebt sie eines absoluten Wahrheitsanspruchsdenkens und entideologisiert und entmystifiziert sie. Luhmann öffnet dabei den Blick für den daraus resultierenden Unsicherheitsfaktor, der im gesellschaftlichen Alltag entsteht, wenn verschiedene Erkenntnisvoraussetzungen kollidieren. An dieser Stelle sollte gefragt werden, wie sich die menschliche Konstitution entwickelt, um entweder ein ontologisches oder ein konstruktivistisches Weltbild zu entwerfen. Erheben wir uns mit Luhmann auf eine MetaMeta-Beobachtungsebene und fragen, was die andere Seite konstruktivistischer Erkenntnistheorie ist. Gesina Stärz Jean-Francois Lyotard Die Analytik des Erhabenen. Kant-Lektionen Aus dem Französischen von Christine Pries, München 1994 (FinkVerlag), kart., 273 S., 48.- DM. Immer wieder kann man in letzter Zeit die Ansicht vernehmen, daß der Zeitgeist die Philosophie der sog. Postmoderne verabschiedet habe. Dies betrifft insbesondere auch die Theorie Jean-Francois Lyotards, der sich in den 80er Jahren als Vordenker der „postmodernen“ Strömung auch hierzulande einen Namen machte. Möglicherweise ist ja auch seine Philosophie des „Dissens“ in einem philosophisch wie politisch zum harmonisierenden Konsens und zu homogenisierender Identität neigenden Deutschland nicht mehr willkommen. Keineswegs eine quantité negliable sind die „linken“ Motive des Lyotardschen Denkens, umfaßt doch seine Verwerfung einer totalisierenden Vernunft gleichermaßen die in ihr gegründeten Systeme politischer, nationaler wie globaler Herrschaft, ideologisches Hegemoniestreben, wie den Universalismus einer Rationalität der Ware, die sich auch in der Nivellierung der sprachlichen und kulturellen Diskurse festschreibt. Die Schwierigkeiten in der Auseinandersetzung mit dem Denken Lyotards entspringen der philosophischen Umsetzung dieses Anspruchs. Dies läßt sich vielleicht am Unterschied des Lyotardschen Ansatzes zu dem der älteren Kritischen Theorie aufzeigen. Für diese ist jene prozeßhaft-dialektische Spannung unverzichtbar, die in bestimmter Negation der transzendentalphilosophischen Konstitution einerseits, des systemphilosophischen Identitätsbegriffs andererseits zwar das „Offene“ der Kantischen Philosophie aufhebt, jedoch im Begriff der Wahrheit den historisch und gesellschaftlich vermittelten „Zeitkern“ reflektiert. So enthält das „NichtIdentische“ immer das Moment der bestimmten Negation des gesellschaftlich Bestehenden, wie Kunst als „gesellschaftliche Anti-Thesis zur Gesellschaft“ zu begreifen ist. Bücher zum Thema Für Lyotard steht jedoch eine derartige geschichtsphilosophische Konstruktion mit ihrer - wie dialektisch auch immer universalemanzipatorischen Ausrichtung unter dem Verdacht der metaphysischen „großen Erzählungen“ der Moderne, deren Unhaltbarkeit er sowohl in wissenschaftstheoretischer Hinsicht, als auch eingedenk ihrer katastrophischen Folgen auszuweisen bestrebt ist. Da Lyotards Denken andererseits nicht einem radikalen Skeptizismus verfallen will (als einer Form „umgekehrter“ Metaphysik), versucht er gewissermaßen auf der Ebene (sprachlicher) Intentionalität in paradoxalen Konstellationen ein Allgemeines anzuvisieren, dessen Kern eben jene (abstrakte) Negativität, des „Widerstreits“ ist. (Daß auch dieser „regulativer Ideen“ bedarf, ist sich Lyotard bewußt; rekurriert er doch in seinen Überlegungen auf Versatzstücke der „großen Erzählungen“ wie die Idee der „Gerechtigkeit“.) Lyotards sich als work in progress entwickelnde Philosophie läßt sich vielleicht am zutreffendsten als ein kritisch gewendeter transzendentalphilosophischer Idealismus charakterisieren. Da ein derartiger Denkansatz keine Vermittlung von „Sol- len“ und geschichtlichgesellschaftlichem „Sein“ zuläßt, ließen sich Lyotards Konzepte als „Modelle“ begreifen, deren Gültigkeit sich beispielsweise in der Sphäre des Politischen zu erproben hätte. Die Essenz des „Widerstreits“ beschreibt Lyotard als den „instabile(n) Zustand und (das) Moment der Sprache, in dem etwas, das in Sätze gebracht werden muß, noch darauf wartet ... Was diesen Zustand anzeigt, nennt man normalerweise Gefühl ... Es bedarf einer anstrengenden Suche, um die neuen Formations- und Verkettungsregeln für die Sätze aufzuspüren, die dem Widerstreit, der sich im Gefühl zu erkennen gibt, Ausdruck verleihen zu können ... Für eine Literatur, eine Philosophie, sogar eine Politik geht es darum, den Widerstreit zu bezeugen, indem man ihm ein entsprechendes Idiom verschafft.“ Auch in dieser stark verkürzten Darstellung sind die Momente erkennbar, die die Affinität zur Ästhetik in Lyotards Denken andeuten. Denn um in der Analyse von Diskursarten und der zu herausarbeitenden Heterogenität die Momente des Widerstreits aufzudecken, be- darf es einer zu entwickelnden spezifischen „Empfänglichkeit“ (aisthesis). Zunächst von dieser Elementarfunktion von aisthesis ausgehend, sucht Lyotard in seiner spezifischen Deutung des Erhabenen eine ästhetische Fundierung seines Ansatzes. In seinem in den 80er Jahren Furore machenden Essay über „Das Erhabene und die Avantgarde“ konzipiert Lyotard in der Auseinandersetzung mit einem Selbstverständnis der Avantgarde, wie er es vor allem in der amerikanischen Malerei der Nachkriegszeit vorfindet, einen Begriff des Erhabenen, bei dem das Undarstellbare nicht auf ein metaphysisches „übersinnliches Substrat“ verweist, sondern auf ein schlechthin Unbestimmbares. Entsprechend wäre die spezifische „Angstlust“ des erhabenen Gefühls beim Rezipienten als das Gefühl einer Irritation zu verstehen, die der paradoxe Versuch auslöst, dieses Nicht-Darstellbare transparent zu machen. Daß einerseits Lyotard in seiner Argumentation den Heideggerschen Terminus des „Ereignis“ gebraucht, andererseits auf den kunsthistorischen Kontext bezogen das „Nicht-Darstellbare“ als der Akt des Zeigens selbst zu verstehen wäre, hat ebenso zur Verwirrung beigetragen, wie die Merkwürdigkeit, daß sich Lyotard dezidiert auf die Avantgarde der klassischen Moderne bezieht, um sich gleichzeitig von der sog. „postmodernen“ Kunst abzugrenzen. Schon Burghart Schmidt hat darauf aufmerksam gemacht, daß Lyotards Versuch der Verbindung der Erhabenheitsansicht mit der Moderne etwas willkürliches anhaftet. Denn habe Hegel, so Schmidt, „die Intentionalität der Kunst“, nicht gerade „in der klassischen Kunstform erfolgreich am Werk gesehen, wo die Idee ganz zu ihrem sinnlichen Scheinen gekommen sei und als Idee gar nicht mehr ausgesprochen werden müsse - solche Bildhaftigkeit ringt ja auch um Darstellen des Undarstellbaren.“ Interessant wäre beispielsweise auch die Frage, warum Lyotard nicht unter dem Gesichtspunkt des Dynamisch Erhabenen, das in seinen Überlegungen kaum Raum einnimmt, nicht auch jene Avantgarde betrachtet, die das Groteske, Absurde, Obszöne und „Trashige“ thematisiert. Mit dem vorliegenden Buch über Die Analytik des Erhabenen scheint Lyotard nicht nur der Forderung der Kritik gefolgt zu sein, seinen schillernden Begriff des Erhabenen in der Auseinandersetzung mit der Theorie Kants zu präzisieren, son- Bücher zum Thema dern auch ein Beispiel seiner Methode liefern zu wollen, verfestigte Denk- und Wahrnehmungsformen zu verflüssigen, um die Aufmerksamkeit auf Unbeachtetes, Übersehenes zu lenken. So ist vielleicht die Herausgabe eines Buches zu rechtfertigen, das nicht in der Form einer strukturierten geschlossenen Abhandlung erscheint, sondern als eine Art Provisorium Einblick in das Laboratorium des Denkens gewährt. Daß damit allerdings, zumindest an diejenigen, die keine Experten der Kantischen Philosophie sind, hohe Anforderungen gestellt werden, sollte nicht verschwiegen werden. Lyotard selbst räumt einleitend ein, daß es sich bei den vorliegenden Notizen „um einen Zettelkasten mit Vorbereitungsnotizen zur mündlichen Erklärung“ handle, wie andererseits um einen Zwischenschritt zu einem sich in Arbeit befindlichen Buch. Das Publikum muß nicht nur mit den „Schwerfälligkeiten“ eines nicht durchformulierten Textes zurecht kommen, sondern sollte auch umfassende Kenntnisse der Kantischen Philosophie mitbringen, da Lyotards „Kant-Lektionen“ sich nicht auf eine bloße Texterklärung beschränken - auch wenn Lyotard weitgehend dem Text folgt - sondern einen Deutungsansatz präsen- tieren, der auf Umwegen das gesamte Kantische Ouevre mit einbezieht. Hinsichtlich der oben genannten Unklarheiten in Lyotards Konzeption des „Erhabenen“ sollte man sein Buch unter der Perspektive einer wechselseitigen Erhellung lesen. Lyotard legt eine Deutung der Theorie Kants vor, die als Kritik einer Lesart zu verstehen ist, „die der Sorge um das System verpflichtet ist“, wie sie die Einleitung der Kritik der Urteilskraft nahelegt. Lyotards „Lektionen“ zielen hingegen darauf ab, „in Kants Text die Analyse eines Widerstreits im Gefühl zu isolieren, die zugleich Analyse eines Gefühls des Widerstreits ist“. Diesen neuralgischen Punkt, der in Kants Theorie des Schönen und insbesondere des Erhabenen aufscheint und die Instabilität, die „Zerbrechlichkeit“ der transzendentalen Einheit transparent macht, erblickt Lyotard im Vermögen der ästhetischen reflexiven Urteilskraft, „weil sie im Rahmen der Ästhetik die reflexive Manier des Denkens offenbart, die im ganzen kritischen Text am Werk ist.“ Lyotards gewissermaßen als ent-hierarchisierend zu charakterisierende Sichtweise versucht so eine Art sensitiver Grundstruktur, ein sich in den ästhetischen Kriterien von „Lust“ und „Unlust“, „fühlendes Denken“ auszuloten, wie er weiterhin den „tautegorischen“, „heuristischen“ und „produktiven“ modus ästheticus (Manier) gegenüber dem „domizilierenden“ modus logicus (Methode) nicht nur aufzuwerten, sondern als die heimliche vereinigende Kraft auszuweisen bestrebt ist. Als die durchgängige Argumentationslinie von Lyotards Interpretationsverfahren könnte man den Versuch beschreiben, diesen subkutanen „Widerstreit“ zwischen den Vermögen, wie die Modi und die Strategien seiner Vermeidung aufzudecken. Was in der Sphäre der Moral im Gefühl der „Achtung“ oder im Bereich des Schönen durch das Zusammenspiel von Verstand und Einbildungskraft unter dem Aspekt der „subjektiven Zweckmäßigkeit“ noch gelingt - das Herstellen der Einheit - muß sich unter dem Gesichtspunkt des „Erhabenen“, so Lyotard, als „eine Art Spasmus“ enthüllen in dem Versuch der Vernunft, den Menschen sich über die jegliche Form der Einbildungskraft übersteigenden schrecklichen und bedrohenden Phänomene innerlich als moralisches Wesen erheben zu lassen. Lyotard erblickt hierin ein „Prinzip des Mitgerissenseins des Denkens. Herausforde- rung seiner eigenen Endlichkeit. Begehren nach Grenzenlosigkeit, die es im erhabenen Zustand fühlt: Glück und Unglück. ... Es verbietet sich das Absolute gerade deshalb, weil es das Absolute noch immer will. Daraus resultiert eine Art Spasmus im Denken, und die Analytik des Erhabenen skizziert diesen Spasmus ...“ Gleichzeitig erblickt Lyotard in der „Negativität“ der Analytik des Erhabenen einen Bruch, der den Ursprung moderner Ästhetik markiert, „weil sie von einer naturlosen Ästhetik kündet ..., also das moderne Denken der Kunst den Platz einer von nun an unmöglich gewordenen Poetik der natürlichen Ordnung eingenommen hat“, denn „unter dem Namen der 'Analytik des Erhabenen' zerbricht eine denaturierte Ästhetik oder besser eine Ästhetik der Denaturierung die schickliche Ordnung der natürlichen Ästhetik ...“. Wie weit es Lyotard nun gelungen ist, einen Deutungsansatz der Kantischen Philosophie vorzulegen, der Neuland erschließt und ob dieser en detail strenger philologischer Überprüfung stand hält, wird sicher noch Bücher zum Thema diverse Oberseminare und Kongresse beschäftigen. Im Gesamtkontext seiner eigenen Philosophie gesehen bleibt Lyotards Ansatz mehrdeutig. Trotz seiner dezidierten Metaphysikkritik scheint sich Lyotard in seinem Bestreben den Zwängen der „Repräsentation“ zu entkommen in den Netzen der Intentionalität, der Selbstreflexivität und Selbstreferentialität des Denkens zu verstricken. Wie sich sein Philosophieren so als Chiffre der Suche nach dem verlorenen philosophischen Gegenstand lesen läßt, so enthält dies einen „dunklen“ Zug, dem das kritische Denken selbst zum Opfer fallen könnte. Andererseits bietet seine Konzeption des „Erhabenen“ bedenkenswerte Erklärungen zur Philosophie der modernen Kunst, wie darüber hinausgehend sein Versuch, das durch die Dominanz der instrumentellen Vernunft unterdrückte und verdrängte „ Gefühl“ - den „Widerstreit des Gefühls/im Gefühl“- zu beleuchten und die dadurch aufgeworfene Frage nach einem anderen Subjekt, ernst genommen werden sollte - eine Problematik, um die sich übrigens hierzulande Alexander Kluge seit Jahren bemüht. Georg Koch Christoph Menke Die Souveränität der Kunst Frankfurt/Main 1991 (SuhrkampVerlag), 311 S., 24.- DM. Es ist ein ehrgeiziges Projekt, das Christoph Menke verfolgt. Nichts weniger als eine ästhetisch begründete Kritik der Vernunft steht auf dem Programm, wobei sich der Autor nicht mit Kleinigkeiten abgibt. Es geht um große Fragen der Ästhetik, um das prekäre Verhältnis zwischen Autonomie- und Souveränitätsanspruch der modernen Kunst, um Negative Dialektik und Dekonstruktion, und schließlich um die subversive Wirkung der ästhetischen Diskurse - und das alles hat System, soll es zumindest haben, und Menke bietet auch eine Menge Geduld und Akkuratesse auf, um schrittweise systematisch vorwärtszukommen, bis er die ästhetische Erfahrung dort hat, wohin er sie haben will: als zersetzenden Virus im Zentrum der Vernunft. Auf dem Weg dorthin folgt er eine große Strecke den Spuren Adornos, läßt die Hermeneutik links liegen, überholt Derrida, und gegen Ende zweigt er noch kurz Richtung Ha- bermas ab, zu einer Ehrenrunde gewissermaßen. Es ist ein artistisches Buch, weil Menke einen Drahtseilakt wagt über den Abgründen der Metaphysik. Wie es scheint, fällt er nicht ganz herunter und doch ist nicht ganz sicher, ob es gut gegangen ist. Am Schluß ist man eigentümlich ernüchtert, und die Frage drängt sich auf: War's das, oder muß da nicht noch 'was kommen? Die moderne Kunst und vor allem ihr theoretischer Diskurs haben, so Menke, ein Problem: Da ist einerseits die Autonomie, auf die die Kunst pocht: Sie folgt eigenen Gesetzen und findet doch Platz im ausdifferenzierten Gefüge der modernen Vernunft, wo sie ein Moment neben anderen, nichtästhetischen ist. Und da ist andererseits die Souveränität, die das Ästhetische beansprucht. Die Kunst drängt dazu, das Gefüge der pluralen Vernunft hinter sich zu lassen, es notfalls zu sprengen; sie lockt mit dem Versprechen, in ihr „sei das Absolute präsent“ (Adorno). Wir haben also eine Antinomie, und zwar eine, die grundlegend für die moderne Ästhetik ist. „Auf keine der beiden Seiten der Antinomie zu verzichten, sondern sie in ihrer ungemilderten Spannung zur Geltung zu bringen, definiert die Modernität der ästhetischen Reflexion“, schreibt Menke (10). Schön und gut, aber wie? Menke orientiert sich zunächst an Adornos Ästhetik. Dabei tastet er sich behutsam vor zum Begriff der ästhetischen Negativität, dessen präzise Entfaltung mit Adorno allein freilich nicht gelingt, nicht zuletzt deshalb, weil ästhetische und gesellschaftliche Negativität in Adornos Theorie gelegentlich durcheinander geraten, was wiederum die Autonomie des Ästhetischen gefährdet. Besser glückt die Reformulierung der ästhetischen Negation, wenn man sich aus Bergsons begrifflichem Fundus bedient und vor allem Derridas dekonstruktive Theorien in den Dienst stellt. Menkes Überlegungen führen zur Bestimmung des ästhetischen Verstehensvollzugs als „Zaudern zwischen Laut und Bedeutung“ (R. Jakobson; 52). Das Zaudern tritt ein, weil im ästhetisch vollzogenen Verstehen das bedeutungsverbürgende Verknüpfen mißlingt; das wiederum hat seine Ursache im Scheitern des selegierenden Identifizierens der Signifikanten. „Der Signifikant erzittert ästhetisch zwischen den beiden Polen, die er als automatisch gebildeter Bücher zum Thema zusammenhält: dem Material und der Bedeutung“ (55). Die Bewegung zwischen den Polen ist prinzipiell unendlich, der ästhetische Erfahrungsprozeß findet kein Ziel. Die ästhetische Erfahrung „negiert genau das automatische Verstehen, das wir in der Identifizierung ästhetischer Signifikanten versuchen, indem sie es in seine Prozessualität freisetzt“ (64). Ästhetische Erfahrung ist eine Negation, ist die Erfahrung des Scheiterns des automatischen Verstehens, ist „Selbstsubversion der Signifikantenbildung“ (65). Die Hermeneutik sieht das natürlich ganz anders. Sie ist darauf aus, das ästhetisch vollzogene Verstehen als gelingendes zu beschreiben, weshalb sie gegen die Negativitätstheorie mit starken Argumenten antritt. Menke benötigt zwei Kapitel, um im Gegenzug eine immanente Kritik der hermeneutischen Ästhetik zu zelebrieren sowie ein Gegenmodell zu ihrer Theorie ästhetischer Interpretation und Bewertung zu entwerfen. Letztlich muß sich die Hermeneutik sagen lassen, einer „latenten Heteronomie“ anzuhängen, weil sie den ästhetisch verstandenen Sinn als verändernde Wiederholung von bereits vorweg, außerästhetisch erfah- renem Sinn begreift“ (128). In der Auseinandersetzung mit der Hermeneutik entwickelt Menke eine Bestimmung des Schönen, „das wir als Grund wie Abgrund unserer ästhetischen Verstehensversuche erfahren“ (184). In der Erfahrung ästhetischer Negativität ist das Material des schönen Gegenstands befreit von seiner Funktion als Bedeutungsträger. Gleichzeitig erlangt es „eine von keinem Verstehen mehr einholbare Überschüssigkeit“ (186). Noch befindet sich Menke im Hoheitsbereich, den das moderne Postulat ästhetischer Autonomie absteckt. Auch der Begriff der ästhetischen Negativität, wie ihn Menke im Anschluß an Adorno reformuliert hat, läßt die Grenzen dieses Hoheitsbereichs vorerst unangetastet. Die Subversion des Verstehens gilt nur innerhalb der ästhetischen Wertsphäre; was Gegenstand unseres nicht-ästhetischen Erfahrens ist, bleibt davon unberührt. Als vernunftkritisches Potential taugt das Ästhetische nur intern. In diesem Moment läßt Menke Derrida zu Wort kommen. Der dekonstruktiven Theorie zufolge „verrät die Negativitätsästhetik ihre eigenen Einsichten in die Logik der Negativität, indem sie Ästhetik bleibt“ (190). Souveränität kann die Kunst laut Derrida aber erst beanspruchen, wenn die Erfahrung ihrer Negativität auch die Negativität nichtästhetischer Diskurse aufdeckt. Dazu müssen die ästhetischen Zeichen zu „Texten“ werden, muß ihre Lektüre „textuell“ erfolgen. „Im Prozeß der souverän gewordenen, nicht mehr ästhetischen, sondern textuellen Lektüre des Ästhetischen werden ästhetische und nichtästhetische Diskurse zu 'Gattungen' eines allgemeinen Textes“ (194). Die Souveränität, die Derrida damit für die Kunst gewinnt, möchte Menke zwar auch, aber nicht so. Menke zufolge passiert der dekonstruktiven Theorie das „romantische Mißverständnis“ (15), die Kunst sei selbst die Instanz der Vernunftkritik. Also kehrt Menke wieder zu Adorno zurück. Die Aufgabe bleibt, analog zur ästhetischen Negativitätserfahrung einen selbstsubversiven Prozeß im Funktionieren anderer Diskurse aufzuspüren. Der könnte in Gang kommen, wenn die Vernunft unendliche Ansprüche erhebt. Mit begrenztem Vermögen unbegrenzte Ansprüche zu erfüllen - arme Vernunft! Sie käme gewaltig ins Schleudern. Die von Ador- no/Derrida beschworene Krise wäre da. Und genau dafür läßt Menke wieder die Negativitätsästhetik in Aktion treten, freilich anders als Derrida. Die Wirkung der Kunst ist entscheidend, jene Wirkung, die sich zur ästhetischen Haltung verdichtet. „Es ist der Blick des nur noch ästhetisch erfahrenden Ästheten, der die Gültigkeit dieser Welt vernichtet“ (268). Wird der ästhetische Einstellungswechsel verallgemeinert und nichts kann dies verhindern -, stürzen die Diskurse in eine Krise, weil die ästhetische Erfahrung das Gelingen automatischen Verstehens negiert, das die nicht-ästhetische Verwendung von Zeichen zur Voraussetzung hat. Um sich resistent zu machen gegen den ästhetischen Zerfall, erhebt die Vernunft absolute Ansprüche - und scheitet an ihren endlichen Leistungen. Die negative Dialektik der Vernunft triumphiert; die Souveränität der Kunst ist gerettet. Irgendwie wird man am Ende das Gefühl nicht los, einem Taschenspielertrick aufgesessen zu sein. Alles scheint logisch und plausibel, und doch steht man am Ende vor einem Ergebnis, das verblüffend Bücher zum Thema und enttäuschend zugleich ist. Der ästhetische Einstellungswechsel soll zersetzend auf die nichtästhetischen Praktiken und Diskurse wirken, soll die Vernunft der Moderne in die Krise stürzen? Nun ja, die Begründung ist schon kompliziert, aber so ganz überzeugen will sie nicht. Wie ist das mit der ästhetischen Haltung? Soll der Begriff einen Sinn ergeben, muß immer jemand da sein, der diese Haltung hat: ein Subjekt also. Von der Vernunft ist in diesem Kontext freilich nicht im Sinne einer mehr oder weniger kontingenten Einstellung die Rede, sondern sie soll ja gerade in ihrer begrifflichen Gestalt, als universelles Konzept der Moderne, die eine bestimmte Haltung zur Welt impliziert, attackiert und in Frage gestellt werden. Warum aus einem subjektiv vollzogenen Einstellungswechsel die Krise aller begrifflich davon nicht tangierten, vernünftigen Diskurse notwendig hervorgehen soll, weiß man auch nach der Lektüre von Menkes Buch noch immer nicht so recht. Gleichwohl vermittelt es einen guten Eindruck, worum es geht in der aktuellen Ästhetik. Zweifelhafte Antworten auf schwierige Fragen können ja auch aufschlußreich sein - hier sind sie es. Wolfgang Görl Zur Verteidigung der Vernunft gegen ihre Liebhaber und Verächter. Hg. von Christoph Menke und Martin Seel, Frankfurt/Main 1993 (Suhrkamp-Verlag), 417 S., 27.80 DM. Das Anliegen der Aufsatzsammlung ist es, eine „Kritik der Vernunftkritik“ zu thematisieren. Diese Kritik entfaltet sich dabei von zwei Seiten: auf der einen im Namen der Vernunft, auf der anderen Seite im Namen eines „Anderen der Vernunft“, im Sinne einer Metakritik. Daß auch diese Metakritik ihrerseits im Namen der Vernunft argumentiert, also zwangsläufig auf das Instrumentarium rationaler Argumentation rekurriert, bezeichnet, wie Martin Seel und Christoph Menke es formulieren, den „schmalen Grat“, auf dem sich jede Vernunftkritik konstituiert: in der Intention der Vernunft gegen ihre „Liebhaber und Verächter“ zu verteidigen. Die Beiträge gliedern sich in vier Kapitel, die Bereiche theoretische und praktische Philosophie, als auch Politik und Ästhetik umfassend. Gerade die ersten beiden Kapitel sind dabei erwähnenswert, da mit ihnen der argumentative Faden der heterogenen Aufsätze am deutlichsten wird, i.e. die Konfrontation der zwei erwähnten Vernunftbegriffe. Hinsichtlich der theoretischen Philosophie ergibt sich das Schisma einer sog. „konstruktiven Vernunftkritik“ gegenüber einer „subversiven Vernunftkritik“, resp. eines „Anderen der Vernunft“: Der konstruktive Vernunftbegriff versteht sich dabei, in der Tradition Kants stehend, als Explikation der immanenten Bedingungen von Erkenntnismöglichkeiten, während der subversive Vernunftbegriff, in der Tradition Nietzsches stehend, gerade eine Abkehr von der Valutierung der Vernunft als basaler konstitutiver Erkenntnisinstanz propagiert (das Andere der Vernunft als Machtdynamik, Tradition, Lebensform, Einbildungskraft oder Zeichenspiel). In beiden Fällen nun erscheint das vernunftkritische Unterfangen als Antinomie: von Seiten der konstruktiven Vernunftkritik wird eingewandt, daß das subversive Vernunftmodell, trotz der Motivation, gegen das Vernunftprinzip opponie- ren zu wollen, dennoch Grundregeln des vernünftigen Diskurses anzuerkennen habe. Von Seiten der subversiven Vernunftkritik erscheint wiederum das konstruktive Modell als Zirkel: die Begriffsstrategien, auf die rekurriert würde, setzten bereits die allgemeine Begründungsinstanz voraus, die erst legitimiert werden sollte. Hinsichtlich der praktischen Philosophie findet sich eine Distinktion bezüglich eines algorithmischen versus hermeneutischen Vernunftkonzepts. Das algorithmische Modell deriviert sich aus dem Desiderat, allgemeine Kriterien argumentativer Aussagen hinsichtlich der Möglichkeit konsensuellen Vernunftgebrauchs zu evaluieren. C. Pereda beschreibt diese algorithmische Vernunft „als kriteriales Rekonstruktionsmodell mit feststehenden und allgemeinen Kriterien, nach denen sich jede gerechtfertigte Annahme auf eine andere ebenso gerechtfertigte Annahme stützt, bis man endlich auf letzte Annahmen stößt, die sich selbst rechtfertigen“. Auf die praktische Philosophie angewandt, entspricht dem algorithmischen Vernunftkonzept ein universalistisches Moralmodell, wie es der Bücher zum Thema Utilitarismus verkörpert; dem hermeneutischen Vernunftmodell hingegen ein „reflektierendes Rekonstruktionsmodell“ mit unterschiedlichen Arten von Regeln Verfahrensregeln und Maximen, mit denen sich keinerlei System konstituieren läßt, da die Beziehungen unter diesen Regeln vielfältig und oft ungewiß sind, und ihre Bedeutung von den Praktiken abhängt, innerhalb derer sie angewandt werden: wir sprechen somit von einem Skeptizismus, resp. Relativismus. Wie schon das subversive Vernunftmodell auf epistemologisch theoretischem Gebiet, konstituiert sich auch das hermeneutisch skeptizistische Vernunftmodell auf dem Gebiet der praktischen Philosophie metakritisch: Moralisches Verhalten läßt sich somit nur nachträglich unter Bedingungen der Vernunft bringen. In diesem Sinne holt die Vernunft in der universalistischen Moral, ebenso wie in der theoretischen Philosophie, ihre eigenen Grundlage ein: „Daß eine Letztbegründung der Moral nicht möglich ist,“ schreibt Martin Seel, „hängt damit zusammen, daß wir die Unmöglichkeit, ein gutes Leben zu führen, in letzter Instanz nicht begründen, sondern nur hinnehmen können.“ Cyrus Achouri Lutz Rathenow Die lautere Bosheit. Satiren, Faststücke, Prosa Remchingen 1993 (MaulwurfVerlagsgesellschaft), 19.80 DM. In der guten alten Zeit der DDR, als es noch einen Sinn hatte, sinnlos zu sein, schrieb Lutz Rathenow die Satiren über Staat und Stasi, die wir heute in Die lautere Bosheit lesen können. Inwiefern sprechen diese Texte uns heute noch an? Ein Kritiker einer renommierten bundesdeutschen Zeitung befand sie kürzlich als 'historisch obsolet' und bescheinigte Rathenow nur, das Spiel mit Spitzeln und Publikum virtuos betrieben zu haben. Wenige Sätze später kommt der Vorwurf einer 'etwas billigen Oppositionsgaukelei'. Was denn nun? Virtuos oder billig? Rathenow entsprach nie dem Klischee eines leidenden Dissidenten. Sein geglückter Versuch, in der DDR auf sehr eigene Art gegen das System zu leben, eckt bei der FAZ noch heute an. Solche Rollen, die der Ostberliner lebte und spielte, sind im Weltbild manches Altbundesbürger nicht vorgesehen. Im Westen wurde es in den 80er Jahren Mode, staatskritische Texte aus dem Ostblock als 'propagandistisch' abzutun. In solcher Kritik sehe ich mindestens eine gewisse Faulheit. Geschrieben in den USA wären solche Texte vielleicht propagandistisch gewesen. Rathenows eigentlich politischen Texten standen in Zeitungen, sie fehlen in diesem Band. Ein Fehler. Kein anderer Schriftsteller reflektierte die Auswirkungen der Mauer derart intensiv wie Rathenow in 'Fluchtbewegungen' 1985 in der 'Zeit'. Die im Band versammelten Prosastücke gehen eher von den Konditionen marxistischer Literatur aus, auch wenn sie staatskritisch wirken. Sie sind nicht die kompliziertesten Texte von Rathenow - und nicht immer seine besten. Sie sind eben diejenigen, die er bei Lesungen in Wohnungen und Kirchen vor einem staaatsablehnenden - oft jungen Publikum vorgetragen hat. Die Rhetorik und die Erwartungen des Staates werden parodistisch zurückgespiegelt. Auffällig ist, daß Menschen nur sehr selten beim Namen genannt werden. Die meisten Charaktere geben sich durch Berufe oder ihre Stellung in der Gesellschaft preis: „Ein Minister“, „Der Regierer“, „Ein Polizist“... Wir stehen hier vor einem fast brechtschen Verfremdungseffekt. Die linientreue Dichtung zeigte Individuen, die doch wie Typen handeln. Rathenow dreht das um: Seine Typen handeln wie Menschen, seltsam und unberechenbar. Ein Hauptthema der ganzen Literatur der DDR, von Brecht bis Christa Wolf, von Biermann bis Rathenow, war immer die Stelle des „Ich's“, des Individuums in der Gesellschaft. Ständig begegnen wir Menschen, die versuchen, ihre Identität zu erkennen. Ein Spitzel wechselt seine Erscheinung, um als Stuhl oder als Tisch zu arbeiten. Ein Mann verschickt leere Seiten in Briefen, damit sich die Postüberwacher entspannen. Diese Menschen versagen und triumphieren zugleich, sie offenbaren ihr „Ich“ auch dann, wenn sie es überwinden wollen. So war es im Ostblock, so scheint es Geschichte geworden zu sein. Heute leben wir in einer aufgeklärten Gesellschaft, die Satire überflüssig Bücher zum Thema macht. Ein amoralischer Zynismus sucht verzweifelt nach den letzten möglichen Geschmacklosigkeiten. Der hilflose Wettbewerb um die bösartigste Gesellschaftskritik wird nicht verhindern, daß der abrupte Zusammenbruch des Kommunismus uns daran erinnern sollte, wie plötzlich das eigene System verschwinden kann. Boria Sax Wolfgang Welsch (Hg) Die Aktualität des Ästhetischen München 1993 (Wilhelm FinkVerlag), 443 S., 48.- DM. Der vorliegende Band faßt die Beiträge zusammen, die auf dem gleichnamigen Kongreß im Herbst 1992 in Hannover gehalten wurden. Die Vielfalt der Themenbereiche, die von der Ästhetik der Lebenswelt und Politik, der Neuen Medien und des Designs, der Wissenschaften, Kunst und Philosophie reicht, bündelt die These von Wolfgang Welsch, Mitinitiator des Kongresses, die Ästhetisierung sei ein Trend der Gegenwart und „das Ästhetische“ eine „Schlüsselkategorie unserer Zeit“. Für diese These führt Welsch einleuchtende Belege an: In der Produktion verlagere sich der Schwerpunkt von der gebrauchswertorientierten Herstellung zur Produktgestaltung nach ästhetischsymbolischen Gesichtspunkten. Diese Verlagerung thematisiert auch Andrea Branzi. Während sie jedoch in einer solchen Funktionalisierung der Kunst bloß einen „Niedergang der ästhetischen Standards“ erkennt, denkt hier Francois Burckhardt hier weiter und will in der „dem Verfall geweihten Welt“ dem „Neuen Design“ der Produktgestaltung eine bedeutende Rolle in der Formierung einer demokratischen und fortschrittlichen Massenkultur zuerkennen. Nach Welsch veränderten sich über die Art der Produktion hinaus auch die Muster, die die soziale Lebenswelt und die Selbstinszenierung der Individuen organisieren: an die Stelle kulturell vorgegebener moralischer Standards treten mehr und mehr spielerisch-ästhetische Muster der Kommunikation und Selbstbeurteilung. Thomas Ziehe stellt diese Ästhetisierung der Lebenswelt sehr anschaulich anhand der Entwicklung der Bundesrepublik von den 50er bis zu den 80er Jahre vor, wo die Hollywood-Schaukel und Os- wald Kolle den Einbruch der Laszivität und Frivolität in die Sittsamkeit der Lebenswelt markiert, der dann durch Rock'n'Roll und Beat-Musik in den 70er Jahren zu einer kulturellen Pluralität und Flexibilität der Lebensstile geführt habe. Als die „fundamentalste aller Ästhetisierungen“ (44) nennt Welsch jedoch die epistemologische. Als Wissen bzw. Wissenschaft gelte nicht mehr das nach festen methodologischen Standards organisierte Ganze der Vorstellungen, sondern, wie Paul Feyerabend schreibt: „Wahrheit ist, was der [jeweilige] Denkstil sagt, daß Wahrheit sei.“ (Implizit hat Feyerabend Welschs Feststellung widersprochen; denn er klagt in einem seiner letzten, gewohnt spritzigen und polemischen Statements gegenüber den „harten“ Naturwissenschaften die Ästhetisierung erst ein, von der Welsch meint, sie sei schon da.) Diesem „Terror“ der Akzeptanz des Ästhetischen widerspricht nun KarlHeinz Bohrer auf das entschiedenste. Die dadurch platzgreifende Entgrenzung des Ästhetischen führe zu einer Banalisierung, die den Kern des Ästhetischen auflöse. In einer doch recht altbacken-elitären Weise will Bohrer gegen eine „hedonistisch entleerte Moderne“ am Eigensinn des Kunstwerks festhalten, das sich vom Alltag abgrenze und seinen Sinn in sich fände. Kunst verhübsche nicht, sondern ereigne sich und berge in sich die Kraft der Irritation (63). Man wird jedoch nicht recht klug, wen Bohrer als „Terroristen“ ausmacht: die Designer und Modellschneider, die PopMusiker und Life-Styler, oder die, die diese Akzeptanz nur beschreiben? Schlägt er auf den Esel ein, oder auf den Sack? Wen Bohrer auch immer meint, Welsch' These und Bohrers Gegenthese zeichnen den Hintergrund, auf dem sich die Frage nach der Funktion der Kunst im Zeitalter des Ästhetischen stellt. Spielen die Kunst und der Künstler heute die Rolle, neue Muster, Formen und Anordnungen zu kreieren, die die Produktgestaltung, die Konsumtionsweisen und insgesamt den Fluß der Waren je neu beleben, oder bietet die Kunst das Refugium, wo das Authentische und Ursprüngliche, das Selbst und das Jetzt, ihre Heimat haben? Machen sich, wie Stephan Schmidt-Wulffen in seinem Beitrag „Vom Außenseiter zum Agenten“ schreibt, die Künstler etwas vor, wenn sie auf Bücher zum Thema vor, wenn sie auf Originalität beharren? Dies Insistieren wirke mittlerweile fadenscheinig. „Vom Anspruch auf Ursprünglichkeit ist in den Augen jüngerer Künstler und Theoretiker nur noch eine Rhetorik übrig geblieben, die sich gegen das zeitgemäße Denken sperrt“ (343). Was aber ist so schlimm, ließe sich entgegnen, wenn der Künstler sich dem Zeitgeist versperrt, wenn seine Praxis die „der Freisetzung von allen anderen Formen der Teilnahme an den Dingen der Welt ist“ (Martin Seel, 412)? Gottfried Böhm macht geltend, daß die Kunst den abgegrenzten Ort bildet, wo sich „die Lust Totalitäten zu sehen“ verwirklicht, wo Geschichten erzählt und Bilder betrachtet werden (368). Und Armin Wildermuth sieht für die Kunst erst jetzt die Chance, aus der traditionellen Bevormundung durch Theologie und Philosophie auszusteigen, um autonom zu werden. Trübsinnig hält diesem EntwederOder allerdings Dietmar Kamper entgegen: was aber ist, wenn die Kunst, je notwendiger sie ist, sich desto überflüssiger macht? (340) So bedauerlich es ist, daß diese Debatte, zu der die teils exzellenten Beiträge provozieren, nicht geführt worden ist, und sie der Leser folg- lich selbst führen muß bzw. darf, ein Gesichtspunkt wurde allerdings unterschlagen. Ihn hat nur Paul Feyerabend kurz erwähnt (286). Wo herrscht der „Terror des Ästhetischen“, den Bohrer fürchtet? In Afrika, in Jugoslawien oder in Mexiko? Liest man die Artikel auf dem Hintergrund dieser Frage, so relativiert sich die Aktualität. Ja, es könnte sein, daß uns andere, schon überwunden geglaubte Bewußtseinsformen erneut „terrorisieren“. Insofern stellt der Kongreß den Höhepunkt der Diskussion um die Beurteilung postmoderner Ästhetik dar, die trotz der markanten und bleibenden Beiträge ein historisches Interesse verdient. Alexander von Pechmann