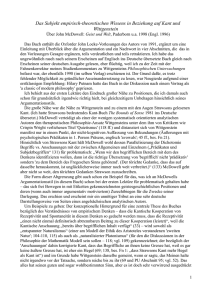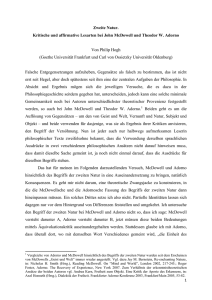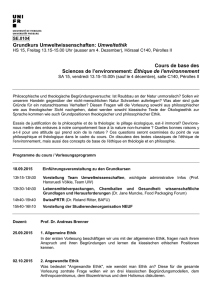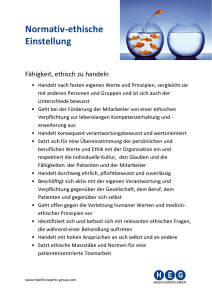Wert und Wirklichkeit - ReadingSample - beck
Werbung

suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1921 Wert und Wirklichkeit Aufsätze zur Moralphilosophie Bearbeitet von John McDowell 1. Auflage 2009. Taschenbuch. 238 S. Paperback ISBN 978 3 518 29521 2 Format (B x L): 10,8 x 17,6 cm Gewicht: 146 g Weitere Fachgebiete > Philosophie, Wissenschaftstheorie, Informationswissenschaft > Metaphysik, Ontologie > Ethik, Moralphilosophie schnell und portofrei erhältlich bei Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte. Suhrkamp Verlag Leseprobe McDowell, John Wert und Wirklichkeit Aufsätze zur Moralphilosophie Mit einer Einleitung von Axel Honneth und Martin Seel Aus dem Englischen von Joachim Schulte © Suhrkamp Verlag suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1921 978-3-518-29521-2 suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1921 John McDowell zählt seit dem Erscheinen seines aufsehenerregenden Buches Geist und Welt zu den einflußreichsten Autoren innerhalb der angelsächsischen Philosophie. Während sein Hauptwerk sich primär mit erkenntnistheoretischen Fragen beschäftigt, hat er in einer Reihe von Abhandlungen auch einen bedeutenden Beitrag zur Moralphilosophie entwickelt. Der Band versammelt die wichtigsten Aufsätze, die McDowell in den letzten zwei Jahrzehnten zum Entwurf einer Moralphilosophie verfaßt hat. Sie geben einen höchst originellen Ansatz zu erkennen, der aus der Widerlegung festgefahrener Alternativen in der Ethik zur Wiederbelebung eines Wertrealismus gelangt. Eine Einleitung situiert McDowells moralphilosophischen Entwurf im Kontext seines Werks und der gegenwärtigen Debatte. John McDowell ist Professor für Philosophie an der Universität von Pittsburgh. Im Suhrkamp Verlag ist von ihm erschienen: Geist und Welt (stw 1528). John McDowell Wert und Wirklichkeit Aufsätze zur Moralphilosophie Mit einer Einleitung von Axel Honneth und Martin Seel Aus dem Englischen von Joachim Schulte Suhrkamp Titel der Originalausgabe: Mind, Value & Reality © 1998 by the President and Fellows of Harvard College Der vorliegende Band stellt eine Auswahl aus Teil I und Teil II dar. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1921 Erste Auflage 2009 © der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2002 Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt Druck: Druckhaus Nomos, Sinzheim Printed in Germany ISBN 978 -3-518 -29521-2 1 2 3 4 5 6 — 14 13 12 11 10 09 Inhalt Axel Honneth und Martin Seel Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. Zwei Arten von Naturalismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2. Tugend und Vernunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3. Die Rolle der eudaimonia in der Aristotelischen Ethik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 4. Sind moralische Forderungen hypothetische Imperative ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 5. Interne und externe Gründe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 6. Ästhetischer Wert, Objektivität und das Gefüge der Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 7. Werte und sekundäre Qualitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Nachweise der Erstveröffentlichung . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Axel Honneth und Martin Seel Einleitung Mit gutem Grund gilt John McDowell heute als einer der produktivsten und interessantesten Philosophen der Gegenwart. Wie nur wenige andere seiner philosophischen Zeitgenossen unterläuft er spielerisch die etablierten Grenzziehungen zwischen theoretischer und praktischer Philosophie, entdeckt in Fragestellungen der Erkenntnistheorie den Schlüssel für eine Beantwortung moralphilosophischer Probleme und macht umgekehrt die Ethik für eine Auflösung von Aporien in der Philosophie des Geistes fruchtbar; in der antiken Philosophie scheint er ebenso zu Hause zu sein wie in den avanciertesten Strömungen der Sprachanalyse, mit den Werken Kants oder Hegels ebenso vertraut wie mit der ganz anders gelagerten Tradition des englischen Empirismus. Bei all dieser beeindruckenden Breite in der philosophischen Orientierung ist es freilich nicht so, daß seine bisherigen Arbeiten direkt auf den Entwurf eines eigenständigen, positiv formulierten Ansatzes zielen; seine Studien und Abhandlungen, zumeist Auseinandersetzungen mit zeitgenössischen Interpretationen klassischer Texte, besitzen vielmehr häufig den eher destruktiven Charakter einer Kritik eingespielter Begriffsalternativen. In diesem Versuch eines Aufbrechens von Oppositionsbildungen, die für die gegenwärtige Situation der Philosophie charakteristisch sind, besteht sicherlich der produktive Kern des Werkes von McDowell; wie Hegel, wie John Dewey, um nur die Prominentesten zu nennen, scheint er der Überzeugung zu sein, daß in solchen konzeptuellen Entgegensetzungen die Keime von gedanklichen Blockierungen stecken, deren Überwindung der erste, wesentliche Schritt in der Entwicklung eines philosophischen Neuentwurfs darstellt. Mit dieser höchst indirekten Strategie, eine eigene Position nur auf dem Weg einer Auflösung von festgefahrenen Oppositionen zu entwickeln, ist John McDowell schon bald nach dem Erscheinen seines Buches Mind and World1 zum Mittelpunkt ei1 John McDowell, Mind and World. 7 ner weitverzweigten Debatte geworden. Kaum jemand, der heute in der angelsächsischen Philosophie von Bedeutung ist, hat in den letzten Jahren nicht zu dem dort entwickelten Versuch Stellung bezogen, durch den Entwurf eines »minimalen Empirismus« zu einer Neuvermittlung von Geist und Welt beizutragen.2 Es ist daher kaum verwunderlich, daß es nur vier Jahre gedauert hat, bis dieses Buch in einer deutschsprachigen Übersetzung veröffentlicht wurde.3 Auch hierzulande zeichnen sich gegenwärtig schon die Tendenzen einer umfassenden Diskussion ab, in die »kontinental« orientierte Philosophen in der gleichen Weise einbezogen sind wie die Verfechter der »analytischen« Ausrichtung.4 Was der philosophischen Öffentlichkeit in Deutschland allerdings noch weitgehend verborgen bleiben mußte, ist der Umstand, daß McDowell seit nunmehr dreißig Jahren eine Vielzahl von hochbrisanten Aufsätzen geschrieben hat, die weit über das begrenzte Thema von »Mind and World« hinauszielen; das Spektrum seiner Interventionen, allesamt dem Prinzip einer Unterwanderung von irreführenden Entgegensetzungen verpflichtet, reicht von der griechischen Philosophie über die Metaphysik und Sprachphilosophie bis hin zur Epistemologie und Ethik. Vor vier Jahren ist eine Auswahl dieser Beiträge in zwei umfassenden Aufsatzbänden bei Harvard University Press erschienen, deren erster primär auf Fragen der Ethik, deren zweiter vor allem auf Probleme der Erkenntnistheorie zugeschnitten ist.5 Die vorliegende Aufsatzsammlung stellt ihrerseits eine Auswahl aus jenem ersten Band dar und rückt somit das moralphilosophische Werk von John McDowell in den Mittelpunkt. Bei der Zusammenstellung haben wir uns maßgeblich von dem Interesse leiten lassen, der deutschsprachi2 Nicholas H. Smith (Ed.), Reading McDowell: On Mind and World. Wie McDowell in seinen Abhandlungen bedienen wir uns im folgenden einer abgekürzten Zitierweise; die vollständigen Angaben sind in der Literaturliste am Ende dieses Buches zu finden. Seitenzahlen im Text dieser Einleitung verweisen auf die vorliegende Übersetzung. 3 John McDowell, Geist und Welt. 4 Vgl. etwa den Schwerpunkt: »Die Rationalität der zweiten Natur. John McDowells ›Geist und Welt‹ in der Diskussion«, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie. 5 John McDowell, Mind. Value and Reality; ders., Meaning, Knowledge and Reality. 8 gen Öffentlichkeit einen möglichst repräsentativen Ausschnitt aus den ethischen Arbeiten von McDowell vorzulegen. Dabei sind wir insofern von der Gliederung des englischsprachigen Sammelbandes abgewichen, als wir die beiden Studien an den Anfang gestellt haben, die bei aller Zurückhaltung des Autors einen geradezu programmatischen Charakter besitzen. Die übrigen Beiträge, die als eine Ausarbeitung der dort entfalteten Motive gelesen werden können, folgen dann in der chronologischen Reihung, in der sie auch in der ursprünglichen Aufsatzsammlung erschienen sind. 1. Geist und Welt John McDowell ist philosophisch im geistigen Milieu der Oxford University in England großgeworden, das schon immer dafür berühmt war, die Ausbildung in der sprachanalytischen Philosophie nur in Verschränkung mit einer systematischen Aneignung der klassischen Philologie zu betreiben; eine solide Kenntnis der Werke von Platon oder Aristoteles gilt gewissermaßen als der Königsweg, um sich mit zeitgenössischen Problemen in der Erkenntnistheorie, Metaphysik oder Ethik zu befassen. Es kann daher nicht überraschen, daß McDowell seine ersten Veröffentlichungen einerseits Deutungsproblemen der griechischen Klassiker, andererseits hochspeziellen Fragestellungen in der modernen Sprachphilosophie gewidmet hat; bis heute ist diese doppelte Ausrichtung ihm so selbstverständlich, daß seine Texte häufig nahtlose Übergänge zwischen der antiken Philosophie und den fortentwickelten Positionen unserer Tage herstellen. Berühmt geworden über den engen Kreis Oxfords hinaus ist McDowell aber erst mit seinen John-Locke-Lectures, die 1994 unter dem Titel Mind and World in monographischer Form veröffentlicht wurden; darin sind fast alle Motive, die den Autor fortan in seinem Werk beschäftigen, bereits wie in einer Zusammenschau versammelt, weil als Ursache für eine Vielzahl von Mißverständnissen in der zeitgenössischen Philosophie die Entgegensetzung ausgemacht wird, die heute zwischen »Geist« und »Welt«, zwischen »Gründen« und »Wirklichkeit« herrscht. Den Ausgangspunkt der überaus komplexen Argumentation stellt die Diagnose dar, daß wir uns mit derjenigen Rückzugspo9 sition nur schwerlich abfinden können, die nach Sellars’ berühmtem Angriff auf den »Mythos des Gegebenen« in den Hauptsträngen der analytischen Philosophie entstanden ist: Hier ist nämlich aus der Einsicht, daß uns die Welt in unseren Erfahrungen nicht unmittelbar gegeben ist, weil diese ihrerseits stets schon theoretisch imprägniert sind, die Schlußfolgerung eines »Kohärentismus« gezogen worden, dem zufolge sich die Wahrheit unserer Aussagen nur noch an ihrer internen Kohärenz bemißt. Mit einer solchen kohärentistischen Position aber, die im Buch stellvertretend durch die Theorie Donald Davidsons repräsentiert wird, ist nach McDowell endgültig zerrissen, was bereits bei Kant aufgrund seiner Anpassung an den Szientismus seiner Zeit nur noch halbherzig als Einheit zusammengehalten worden war: Auf der einen Seite steht nun die »Welt«, gedacht als naturgesetzlicher Raum kausaler Abhängigkeiten, auf der anderen Seite hingegen der »Geist«, der als der »Raum« rationaler Gründe vorgestellt wird, in dem wir uns nach Maßgabe unserer Überzeugungen diskursiv bewegen. Nicht anders als Kant in seiner Zwei-Welten-Lehre, so ist daher heute die Philosophie im allgemeinen von den pragmatischen Gewißheiten des Alltagsverstandes denkbar weit entfernt, weil sie die menschliche Rechtfertigungspraxis sich unabhängig von einer rationalen Forderung der Welt vollziehen läßt; zwar wird noch eine kausale Einflußnahme der Welt auf unsere geistige Tätigkeit eingeräumt, aber von einer sinnlich vermittelten Aufnahme der Wirklichkeit in unseren Geist ist nicht länger die Rede. Den Ausweg aus dieser erkenntnistheoretischen Sackgasse erblickt McDowell nun in dem Versuch, einen Begriff der menschlichen Erfahrung zurückzugewinnen, der die Idee einer sinnlichen Erfassung von rationalen Forderungen der Welt nicht gänzlich aussichtslos erscheinen läßt. Allerdings schlägt er den damit umrissenen Weg nicht direkt ein, sondern verlagert seine Fragestellung zunächst eine Ebene tiefer, indem er die ontologischen Voraussetzungen für die philosophische Abkoppelung unserer geistigen Vermögen von der Welt ausfindig zu machen versucht. Schon bei Kant, so ist McDowell überzeugt, tritt zu Tage, daß die Sinnlichkeit und damit die rezeptiven Fähigkeiten des Menschen deswegen nicht mehr als rationale Organe verstanden werden können, weil sie einer szientistisch verstandenen 10 Natur zugeordnet werden. In dieser Tradition erscheint die Erfahrung des Menschen als Teil einer gesetzmäßig verfaßten Natur, während nur noch seine begriffliche Spontaneität einem Vernunftbereich zugeschlagen wird, in dem allein rationale Gründe gelten. Ist die menschliche Erkenntnis aber erst einmal derart in zwei ontologische Sphären zerlegt, so kann unsere rationale Aktivität gar nicht mehr »bis ganz hinaus selbst zu den Eindrücken unserer Sinnlichkeit«6 reichen, da dort ja bloß kausale Abhängigkeiten herrschen; vielmehr muß von nun an das am Menschen, was sinnlich und rezeptiv ist, ohne jede Funktion für seine Rechtfertigungspraxis bleiben, so daß die Beglaubigung von Überzeugungen letztlich auf ein operatives Verfahren im »logischen Reich der Gründe« zusammenschrumpft und ohne die Mitarbeit der »Welt« auskommt. Wenn diese ontologische Aufspaltung von Sinnlichkeit und Begriff vor allem dafür verantwortlich ist, daß heute »Geist« und »Welt« so entschieden entgegengesetzt werden, dann bedarf es zur Überwindung der Entgegensetzung einer vorsichtigen Renaturalisierung der rationalen Aktivitäten des Menschen. Wenn nämlich deutlich gemacht werden kann, daß wir in unseren begrifflichen Fähigkeiten ein Stück unserer eigenen Natur verwirklichen, muß die Sinnlichkeit nicht länger als der Kausalität unterworfen vorgestellt werden, sondern läßt sich als ein Medium unserer Rationalität begreifen. Bei McDowell sollen »Geist« und »Welt« dadurch wieder angenähert werden, daß von unseren begrifflichen Operationen gezeigt wird, inwiefern sie auf ein sinnliches Erfassen von Wirklichkeit angewiesen sind. Daraus würde folgen, daß bei einer solchen Reintegration von Vernunft und Sinnlichkeit die Welt nicht mehr ihrerseits als ein Inbegriff von kausalen Einflüssen, sondern als ein Residuum von rationalen Forderungen aufgefaßt werden muß. Nun verlangt allerdings eine derartige Renaturalisierung der menschlichen Rationalität zunächst nach einer Uminterpretation dessen, was bislang in der Tradition des Szientismus unter »Natur« verstanden worden ist. Während unter dem Einfluß dieses Denksystems nämlich gelten mußte, daß die Natur nichts anderes als einen Raum von kausalen Abhängigkeiten darstellt, muß jetzt plausi6 John McDowell, Mind and World, S. 96 (dt. S. 94). 11 bel gemacht werden können, daß zur Natur auch jene rationalen Fähigkeiten des Menschen gehören, die ihr zuvor als ein Raum der Gründe, als ein »space of reason«, entgegengesetzt worden waren. John McDowell bemüht sich um eine solche Uminterpretation, indem er eine zweite, für unser Denken zentrale Oppositionsbildung aufzulösen versucht: der Gegensatz, der bislang zwischen der »ersten« und der »zweiten« Natur behauptet wurde, soll dadurch aufgelöst werden, daß beide in eine Art von Kontinuitätsverhältnis gebracht werden. Weil McDowell diesen Schritt seiner Argumentation vornehmlich an der Ethik von Aristoteles exponiert, bewegen wir uns damit schon inmitten der Voraussetzungen seiner Moraltheorie. 2. Erste und zweite Natur Aus der Art der Denkblockade, die McDowell für die mißliche Entgegensetzung von »Geist« und »Welt« in der zeitgenössischen Philosophie verantwortlich macht, haben sich durch Rückschluß die therapeutischen Mittel ergeben, die er zum Zweck ihrer Beseitigung einzusetzen versucht. Wenn innerhalb der Epistemologie die Möglichkeit einer »Reibung« (»friction«) mit der Wirklichkeit deswegen aus dem Blick geraten ist, weil der empirischen Erfahrung selber kein rationaler Gehalt mehr zugebilligt werden kann, so muß im Gegenzug eine Vorstellung von unserer »begrifflichen Spontaneität« zurückgewonnen werden, die auch »Zustände und Ereignisse der Sinnlichkeit als solche zu charakterisieren«7 erlaubt. Eine solche Synthetisierung von Begriff und Erfahrung ist aber nur unter der Bedingung eines nicht-szientistischen, »erweiterten« Naturalismus zu erlangen, in dem die »Natur« zwar nicht durch Aufladung mit Bedeutungen wiederverzaubert, aber doch in eine Art von Kontinuitätsverhältnis mit unserer, der menschlichen Vernunftnatur gebracht wird. Nur dann nämlich, wenn wir in der Rationalität des Menschen die Fortsetzung natürlicher Prozesse vermuten dürfen, können wir uns die natürliche Ausstattung unseres Sinnesvermögens zugleich als eine Befähigung zum rationalen Er7 John McDowell, Mind and World, S. 76 (dt. S. 102). 12 fassen von Wirklichkeit vorstellen.8 Die These, die einem derartigen Naturalismus zugrunde liegt, faßt McDowell nun in dem einen entscheidenden Satz zusammen, daß es die »Ausübungen der Spontaneität« sind, die die Lebensweise charakterisieren, durch die sich der Mensch als Tier verwirklicht.9 Was mit diesem Gedankengang gemeint sein könnte, erläutert er sowohl in seinem Buch als auch im ersten der hier abgedruckten Aufsätze anhand einer Darstellung der Aristotelischen Ethik. Für McDowell hat Aristoteles bei seinem Entwurf einer Ethik alles andere im Sinn gehabt, als aus den objektiven Gegebenheiten der menschlichen Natur einen Katalog von moralischen Tugenden herzuleiten. Seine Absicht war vielmehr darauf gerichtet, das Wissen um ethische Forderungen als eine Ausübung von Fähigkeiten und Kräften vorzustellen, die in Verlängerung von Naturprozessen als »natürlich« verstanden werden müssen. McDowell setzt bei seiner Interpretation am Begriff der »Tugend« an, um zunächst zu zeigen, daß er bei Aristoteles eine Mittelstellung zwischen der bloßen Gewohnheit und der rationalen Deliberation einnehmen soll. Von einer bloßen Gewohnheit unterscheidet sich diese Tugend, weil sie eine bestimmte »Einsicht« enthalten soll, von der rationalen Überlegung ist sie andererseits unterschieden, weil sie einen geformten, habitualisierten Zustand des menschlichen Charakters darstellen soll. Die Schwierigkeit ergibt sich mithin aus der Aufgabe, etwas als eine geradezu leibgewordene, spontan ausgeübte Routine begreifen zu müssen, was zugleich eine intellektuelle Operation des Geistes ist. Die Lösung kann nur so aussehen, daß die ethische Tugend als das Ergebnis eines Sozialisationsprozesses aufgefaßt wird, durch den der praktische Intellekt des Menschen, sein Moralbewußtsein, die dauerhafte Gestalt einer charakterlichen Gewohnheit erhält, die im »Vertrautsein« mit moralischen Forderungen besteht. Von dieser so begriffenen Tugend versucht McDowell nun darüber hinaus zu zeigen, daß sie für Aristoteles gewissermaßen den hermeneutischen Horizont bildet, innerhalb 8 Vgl. zu diesem Anspruch die erhellende Analyse von Michael Williams, »Exorcism and Enchantment«; vgl. Axel Honneth, »Zwischen Hermeneutik und Hegelianismus. John McDowell und die Herausforderung des moralischen Realismus«. 9 John McDowell, Mind and World, S. 87 (dt. S. 103). 13 dessen wir uns bei der Bewältigung moralischer Probleme immer schon bewegen müssen: Bereits die bloße Tatsache, eine bestimmte Situation als moralisch konfliktreich zu erfassen und rational bewältigen zu wollen, besagt nichts anderes, als daß wir uns von einem ethischen Vorverständnis leiten lassen, das wir bei der kognitiven Lösung auch nur zirkelhaft zur Anwendung bringen können. Die Brücke zu seiner Ausgangsfrage schlägt McDowell freilich erst mit dem Vorschlag, diese hermeneutische Auffassung der »ethischen Tugenden« mit dem Begriff der »zweiten Natur« zu belegen.10 Gemeint ist damit zunächst nicht mehr, als daß jene Tugenden intellektuelle Gewohnheiten bilden und insofern quasi-natürliche Verhaltensstrebungen darstellen, die das Ergebnis von kulturellen Sozialisationsprozessen sind. Würde der Ausdruck sich allerdings auf ein solches Minimum beschränken, so wäre nicht genau klar, ob er mehr als eine Umformulierung dessen repräsentiert, was wir gemeinhin als »Kultur« bezeichnen; um die Verbindung zur »ersten« Natur herzustellen, die in der Idee eines erweiterten Naturalismus doch vorgesehen ist, muß McDowell dem Ausdruck daher eine stärkere Bedeutung geben.11 Hier kommt jener Gedanke zum Zuge, der darauf abgehoben hatte, daß sich der Mensch in Form einer Orientierung an Gründen als tierisches Lebewesen verwirklicht. Offenbar möchte McDowell diese Formulierung in dem Sinn verstanden wissen, daß sie den Hinweis auf eine Kontinuität zwischen erster Natur und menschlicher Lebensweise enthält: daß wir im Hinblick auf die sozialisatorisch erworbenen Tugenden von einer zweiten »Natur« sprechen, muß dann bedeuten, sie als eine Verlängerung von Potentialen zu begreifen, die im »normalen menschlichen Organismus«12 angelegt sind. In leichter Abwandlung läßt sich derselbe Gedankengang auch so interpretieren, daß in der ersten Natur des Menschen, seinen körperlichen Eigenschaften, die Möglichkeit vorgesehen ist, moralische Handlungsgewohnheiten zu entwickeln, die durch Gründe vermittelt sind. 10 John McDowell, Mind and World, S. 84 (dt. S. 109). 11 Das betont Michael Williams in »Exorcism and Enchantment«, bes. S. 104. 12 John McDowell, Mind and World, S. 84 (dt. S. 109). 14 Es ist nicht schwer zu erkennen, warum in dieser Form von Naturalismus eine Alternative zum szientistisch geprägten Naturverständnis angelegt sein soll. Denn die ethischen Tugenden als eine Verwirklichung von organisch angelegten Potentialen zu verstehen bedeutet, die Natur gerade nicht auf einen Bereich von kausal wirksamen Abhängigkeiten zu reduzieren, sondern sie als einen Prozeß der stufenweisen Ermöglichung von gattungsspezifischen Lebensweisen zu interpretieren. Was innerhalb eines solchen erweiterten Naturalismus mithin als »Moral« bezeichnet werden soll, ist zunächst nichts anderes als jenes Netz aus tugendhaften Verhaltensweisen, in das wir durch erzieherische Umformung unserer »ersten« in eine »zweite« Natur jeweils hineinsozialisiert werden. Keinen Maßstab, kein Prinzip scheint es zu geben, von dem aus sich jenseits der eingespielten Handlungspraktiken noch einmal beurteilen ließe, ob es sich angesichts eines gegebenen Falls tatsächlich um die moralisch »richtige« Antwort handelt. Insofern muß sich für McDowell das Problem ergeben, mit seiner hermeneutischen Konzeption der »zweiten Natur« eigentlich das zu verfehlen, was in der Tradition Kants doch stets als das Spezifische der Moral angesehen worden ist, nämlich die unbedingte, kategorische Sollgeltung ihrer Prinzipien oder Pflichten. Es macht sicherlich eine der interessantesten Wendungen der Moraltheorie von McDowell aus, daß er auch diese Schwierigkeit wieder auf dem Weg der Überwindung einer eingefahrenen Oppositionsbildung zu lösen versucht; denn sein eigenes Konzept stellt er als das Resultat eines Aufbrechens des Gegensatzes dar, der heute gewöhnlich zwischen einer Tugendethik und einer Pflichtmoral behauptet wird. 3. Bedingte und unbedingte Moral In seinen moraltheoretischen Schriften hat McDowell im Prinzip nur das im Detail entwickelt, was als normative Grundidee bereits in den Ausführungen zur Aristotetelischen Ethik in Mind und World angelegt ist. Allerdings geben die Aufsätze viel besser zu erkennen, daß die Pointe der Idee der »zweiten Natur« auf moraltheoretischem Gebiet darin bestehen soll, der Tugendethik mit Hilfe eines Wertrealismus eine kognitivistische Fas15 sung zu geben. Den Begriff der »Tugend« hatte McDowell bislang unter Verweis auf Aristoteles im Sinne einer naturalistischen Version der Hermeneutik Gadamers interpretiert. Unter den »Tugenden« oder einem »tugendhaften Charakter« ist demnach ein holistisch verknüpftes Netz von Verhaltensweisen zu verstehen, deren moralische Qualität jeweils nur aus der Binnenperspektive einer »Tradition« zu erkennen ist, die ihrerseits als das Resultat der intellektuellen Umformung der »ersten« zur »zweiten« Natur des Menschen aufgefaßt werden muß (vgl. Zwei Arten, S. 60, Die Rolle, S. 126 f.). Ist ein Subjekt erst einmal erfolgreich in eine solche moralische Kultur hineinsozialisiert worden, so erschließt sich ihm fortan das, was ethisch gefordert ist, nur durch die zirkelhafte Anwendung jenes Traditionswissens auf die jeweils neue Situation. »Neu« kann hier stets nur relativ gemeint sein, weil uns die zur »zweiten Natur« gewordenen Verhaltensweisen mit einem Vorverständnis ausgestattet haben, in deren Licht sich uns die Umstände immer schon als moralisch bedeutungsvoll präsentieren. Insofern darf auch moralisches Wissen nicht nach dem Muster einer Deduktion aus obersten, allgemeinen Moralprinzipien vorgestellt werden, wie es Kant vor Augen hatte, weil das bedeuten würde, die Tatsache des Vorvertrautseins mit einer Lebenspraxis zu überspringen. Vielmehr können wir uns an die Idee Wittgensteins halten, der zufolge wir auch moralische Regeln nur zu erkennen vermögen, indem wir durch Eingewöhnung mit einer entsprechenden Handlungspraxis vertraut werden.13 Allerdings wären wir bei einer solchen relativistischen Zurückhaltung gar nicht dazu in der Lage, »moralische« Verhaltensweisen von anderen Praktiken in der sozialen Welt zu unterscheiden; insofern bedarf es trotz aller Betonung des hermeneutischen Vorverständnisses doch eines Versuchs, zumindest in groben Zügen zu bestimmen, worin die Einheit all jener Handlungsformen bestehen soll, die wir als »moralisch« bezeichnen. McDowell löst dieses Problem nun nicht auf pragmatistischem Wege, also etwa durch die Angabe von Aufgaben oder Zwecken, die wir mit Hilfe der Moral zu bewältigen versuchen; vielmehr besteht seine Lösung hier in dem überraschenden Vorschlag, der 13 John McDowell, »Wittgenstein on Following a Rule«, in: ders., Meaning, Knowledge and Reality, S. 221-262. 16 Kantischen Idee des kategorischen Imperativs dadurch eine realistische Wendung zu geben, daß sie als Hinweis auf den besonderen Status moralischer Tatsachen gedeutet wird (Sind moralische, S. 146 -150). In unserer Wahrnehmung besitzen dementsprechend diejenigen Sachverhalte, die wir als moralisch bedeutungsvoll erfahren, die außergewöhnliche Qualität, alle anderen Gesichtspunkte unseres praktischen Handelns zum »Schweigen« bringen zu können. Unter den Normalitätsbedingungen einer erfolgreich abgeschlossenen Sozialisation üben die als moralisch wahrgenommenen Tatsachen insofern eine kategorische Wirkung auf uns aus, als wir gar nicht umhinkönnen, uns gemäß den Imperativen zu verhalten, die den rationalen Gehalt unserer Wahrnehmung ausmachen. Daher kann McDowell all die Verhaltensweisen, die aufgrund derartiger Wahrnehmungen zustande kommen, im engeren Sinn als »moralisch« bezeichnen. Der Vorteil einer solchen Lösungsstrategie besteht natürlich darin, daß sie es McDowell erlaubt, der Moral im Rahmen seines hermeneutischen Naturalismus die starke Bedeutung einer Instanz der unbedingten Sollgeltung zu belassen. Während Aristotelische Erwägungen im allgemein in die Richtung zielen, moralische Urteile evaluativen Besinnungen auf konstitutive Lebensziele anzugleichen, sind sie hier mit der Kantischen Vorstellung vereinbar, daß die Moral im Widerstreit der Perspektiven einen Geltungsvorrang besitzt, weil sie kategorische Pflichten nach sich zieht. Nun läßt ein solches Bild der Moral natürlich schnell die Frage entstehen, wie es im Horizont der jeweils eingespielten, wahrnehmungsgestützten Moralgewißheiten um die Bedeutung von Reflexion und rationaler Argumentation bestellt sein soll. In einem ersten Schritt versucht McDowell auch dieses Problem wieder in Form der Unterwanderung einer eingespielten Oppositionsbildung aufzulösen, indem er den Gegensatz von internen und externen Gründen einer kritischen Prüfung unterzieht. 17 4. Interne und externe Gründe Es kennzeichnet die menschliche Lebensform, daß verläßliche Orientierungen in ihr mit der Ansprechbarkeit durch Gründe verbunden sind. Der Mensch handelt so und so, weil er dieses und jenes für wert und wichtig hält. »Durch den Erwerb der zweiten Natur – also durch den Erwerb des Logos – hat man gelernt, bestimmte Handlungsweisen besonders erfreulich zu finden, und hat zugleich das begriffliche Rüstzeug erworben, das zur Kennzeichnung jener spezifischen Werthaftigkeit taugt, die man in solchen Handlungen zu sehen gelernt hat; man hat damit gelernt, einen bestimmten Bereich von Gründen anzuerkennen, die für derartige Handlungen sprechen.« (Zwei Arten, S. 59 f.) Die Gründe, von denen McDowell hier spricht, sind praktische Gründe. Deren Status ist seit langem umstritten. In einer groben Übersicht stehen sich hier kognitivistische und non-kognitivistische Auffassungen gegenüber. Aus der Sicht eines Non-Kognitivismus – wie er exemplarisch von David Hume vertreten wird – gehen alle unsere Handlungsgründe letztlich auf Motive zurück, die wir kontingenterweise haben, die also nicht selbst einer Begründung fähig sind. Aus der Sicht des Kognitivismus hingegen – wie er auf sehr unterschiedliche Weise in der antiken Ethik, in der Moraltheorie Kants oder den Werttheorien G. E. Moores oder Max Schelers entwickelt wurde – basieren unsere besten Handlungsgründe auf Einsichten (in Tugenden, Werten oder Verfahren), die unsere subjektiven Motivlagen überschreiten. Auch dies aber ist eine Alternative, die McDowell so nicht stehen lassen will. Zwar ruft er explizit zu einem »Widerstand gegen den Nonkognitivismus« auf (Tugend, 104), jedoch ohne sich einer der bekannten Spielarten des ethischen »Kognitivismus« anzuschließen. Vielmehr sucht er nach der Möglichkeit, »eine Entscheidung zurückzuweisen, bei der wir vor folgender Wahl stünden: Entweder man glaubt, die richtige Sicht der Handlungsgründe eines Akteurs werde (…) von seinen ›Affekten‹ in ihrer gegebenen Form bestimmt (…), oder man meint, diese Sicht werde von der leidenschaftslosen VERNUNFT bestimmt.« (Interne, 178) Die Trennung des »Appetitiven« von dem »Kognitiven« – der Motive von den Gründen des Wollens 18 und des Glaubens –, so heißt es an anderer Stelle, »kann einfach nicht richtig sein« (Sind moralische, 140). Um hier einen Ausweg zu finden, wendet sich McDowell der mittlerweile schon klassischen Abhandlung über »Interne und externe Gründe« von Bernard Williams zu.14 Williams ergreift Partei für eine »internalistische« Auffassung von Rationalität, die praktische Gründe in subjektiv vorgegebenen Wünschen verankert sein läßt. Er verwirft die umgekehrte, »externalistische« Auffassung, der zufolge sich tragfähige ethische Gründe allein aus der Einsicht in den einen subjekt-unabhängigen Wert von Handlungsweisen ergeben. Wie solche nicht im faktischen Wünschen und Wollen verankerten Gründe je eine praktische Bedeutung erlangen können, bleibt für Williams unerfindlich. In dieser Kritik an einem ethischen Objektivismus, der Werte von ihrer Einbettung in die tatsächliche Lebenspraxis der Handelnden befreit, ist sich McDowell mit Williams einig. Praktische Überlegungen, so stimmt er zu, bewegen sich notwendigerweise vor dem Hintergrund einer komplexen Motivlage, die durch diese Überlegung zugleich bearbeitet wird. In solchen Überlegungen gestalten wir unsere Bestrebungen und Bindungen aus, wobei bestimmte Wünsche kritisiert, zurückgestellt oder auch zum Schweigen gebracht werden können. Die Basis dieser Überlegungen aber, so macht McDowell geltend, sind nicht allein die faktischen Bestrebungen, die bestimmte Handelnde nun einmal leiten, sondern die normativen Erfahrungen, die sie, angeleitet durch Erziehung und Sozialisation, im Laufe ihres bisherigen Lebens gewonnen haben. Diese Erfahrungen aber können die Motivlage und mit ihr die normativen Festlegungen eines Subjekts transzendieren. Dies geschieht in der Erschließung von Handlungsmöglichkeiten, deren Wert bis dahin nicht absehbar war. Für eine solche Umbildung normativer Einstellungen aber gibt es in einer strikt internalistischen Deutung keinen Raum. Diesen Raum möchte McDowell für die praktische Philosophie zurückgewinnen, indem er ethische Orientierungen auf ihrer ganzen Breite als einen Ausdruck von Werterfahrungen versteht, die man bereits gemacht oder bislang versäumt haben 14 Bernard Williams, »Internal and External Reasons«. 19 kann. Beispielsweise könnte es sein, daß eine Person niemals des Werts von Versprechen innegeworden ist. Wer auf diese Weise »durch das Netz« der moralischen Erziehung gerutscht ist, kann gleichwohl zu einem angemessenen Verhalten »bekehrt« werden. Eine solche Person, sagt McDowell, befindet sich in der Situation von jemandem, dem Zwölftonmusik ein Greuel ist, weil er es versäumt hat, sich ernsthaft auf die Eigenheiten dieser Musik einzulassen. Es fehlt ihr das Gespür für etwas, dessen Wert sie erst erkennt, wenn sie dieses Gespür auf dem Wege einer neuartigen Wahrnehmung gewonnen hat. Erst jetzt geht ihr der Wert einer bestimmten Verhaltensweise – sich durch Versprechen binden, sich von Disharmonien tragen zu lassen – auf. McDowell zögert nicht zu sagen: Erst jetzt erkennt sie den Wert der Situationen und Objekte dieses Verhaltens. Dadurch aber gewinnt die Person zugleich einen Grund und ein Motiv, sich um etwas zu kümmern, was ihr zuvor gleichgültig blieb. Die neue Motivation wird dabei nicht isoliert erworben, sondern bildet sich mit der Umstellung einer Sichtweise, mit der bisher unverfügbare Möglichkeiten der Wertschätzung verbunden sind. Mit der Erkenntnis dessen, was lohnend ist, ergibt sich die Anerkenntnis, ihm im eigenen Verhalten zu entsprechen. Dieses transitorische Moment der ethischen Erfahrung klagt McDowell gegenüber Williams ein. Im richtigen Verständnis der Umbildung evaluativer Sichtweisen sieht McDowell einen Ausweg aus der Opposition zwischen einem ethischen Diktat entweder der Affekte oder der Vernunft. Die Richtigkeit des Handelns in einem jeweiligen Bereich ist eine Sache der angemessenen Wahrnehmung von Situationen, wie sie den Handelnden zur Verfügung stehen oder noch fehlen kann. Sie ist darüber hinaus eine Sache des »im Prozeß der Reflexion durchgehaltenen Vertrauen(s) in die Werte« (Interne, 175), zu denen eine jeweilige Wahrnehmung Zugang gefunden hat. Entsprechend sind die Gründe, die sich im Prozeß der ethischen Erfahrung bilden (und dort immer wieder auf der Probe stehen), wo immer sie wirksam sind, notwendigerweise »interne« Gründe; dennoch sind es evaluative Annahmen, die den Bestand des bisherigen motivationalen Haushalts der Handelnden überschreiten und insofern einen »externen« Status haben können – dann nämlich, wenn sie einigen oder allen noch nicht zugänglich sind. 20