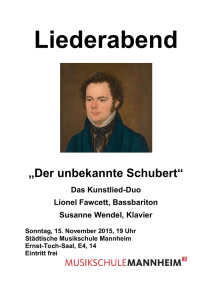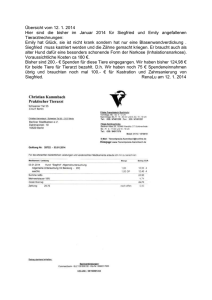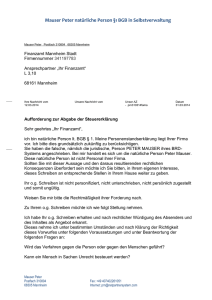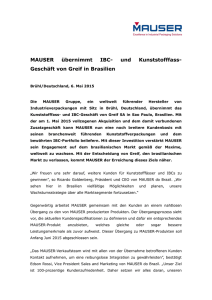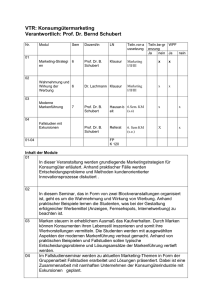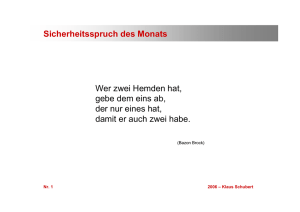FREMDE UND HEIMAT
Werbung

1 FREMDE UND HEIMAT Musik & Mensch Konzert- und Kolloquiumsreihe Zyklus 2007/2008 – „HEIMAT“ Pädagogischen Hochschule FHNW, Kasernenstraße 20 (ehemalige Reithalle), Aarau Donnerstag, 27. September 2007 Heimat – ein psychoakustisches Phänomen? Eine dialogische Erörterung von Peter Sloterdijk, Rektor der Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe und Siegfried Mauser, Rektor der Hochschule für Musik und Theater, München (Transkription: Eliane und Markus Cslovjecsek, redigiert im Oktober 2013 von Siegfried Mauser) Begrüßung und Einführung durch Markus Cslovjecsek Peter Sloterdijk: Herzlichen Dank für die perspektivenreiche Einführung. Wir haben uns vorgenommen, das Thema des heutigen Abends auf eine dialogische Weise miteinander zu entwickeln, wobei es von meiner Seite her, wie es meinem Metier entspricht - einen monologischen Input geben muss. Siegfried Mauser, der hier sozusagen als mein besseres musikalisches Selbst anwesend ist, wird eine ganz eigenständige Art und Weise des Zugangs zu den Themen entwickeln, so dass Sie auf gar keine Weise nur eine These und ihr Beispiel erleben werden, sondern Zweistimmigkeit in jedem möglichen Sinn des Wortes. Siegfried Mauser: Ein zweistimmiger Kontrapunkt PS: Kontrapunkt, wo man gar nicht mehr weiss, wo die Hauptstimme liegen soll. Also wir werden auf keinen Fall eine Art von Übung ausführen, die nur den Diskurs wie einen bezifferten Bass ausspielen wird. Das hat damit zu tun, dass wir eine langjährige Kooperation entdeckt haben, dass es tatsächlich so eine Art intermediale Resonanz gibt, die sich in einer Form entfalten lässt, für die Siegfried Mauser seit 2 vielen Jahren den Begriff des Gesprächskonzert verwendet, der von manchen missverstanden wird, als würde da sozusagen Musik mit Keilerei verbunden. Ganz so schlimm soll es ja nicht kommen. Heimat ist ein Affekt einer Form von moderner Heimatdichtung. Dass Heimat ein Konstrukt ist, muss heute nicht mehr mühsam nachgewiesen oder mit dekonstruktiven Künsten aufgezeigt werden. Dass Heimat aber auch eine Vertonungsdimension hat, nicht nur Heimatdichtung darstellt im weitesten Sinn des Wortes, sondern dass es in dieser poietischen Dimension eben eine akustische, eine psychoakustische, eine sonore Schicht gibt, diesen Gedanken zu entfalten, darin wollen wir heute miteinander kooperieren. Überlegungen zu musikalischen Gegenständen eröffne ich stereotyp mit der Bemerkung Thomas Manns, der in seinem Doktor Faustus nicht müde wurde zu betonen, dass Musik dämonisches Gebiet sei. Ich glaube, wir haben gute Gründe uns ihnen heute als ein Team vernünftiger Dämonologen vor Ihnen zu präsentieren, mit der Absicht fast so etwas wie eine demokratische Dämonologie des tönenden Lebens zu entwickeln. Und wenn ich Thomas Mann zitiert habe, komme ich nicht umhin einen zweiten Grossmeister des Reflektierens über modernes in der Welt sein zu erwähnen, nämlich den französischen Philosophen Maurice Merlau-Ponty, der in seiner gross angelegten Phänomenologie der Wahrnehmung, einige Gedanken Heideggers über das "in der Welt sein", oder der Perspektive des verkörperten Daseins aufgenommen und fortgeführt hat. In diesem Buch finden wir einen aufhorchen machenden Satz, den ich versuchen möchte im Folgenden ein wenig zu interpretieren. Wir lesen da: "le corps n'est pas dans l'espace, il l'habite." Der deutsche Übersetzer hat, wie ich glaube sehr glücklich, wiedergegeben: "Der Körper ist nicht im Raum, er wohnt ihm ein." Hier hätte er, die deutsche Sprache bietet das an, eine Nuance trivialer übersetzen können, und hätte sagen können: "Der Körper ist nicht im Raum, er bewohnt ihn." Er hat sich für die etwas anspruchsvollere, vielleicht sogar die einwenig theologischere Übersetzungsvariante entschieden und spricht von Einwohnung. Da kommt nun ein leicht, fast schon wieder dämonologischer Akzent mit hinein, über dessen besondere Machart wir uns hier verständigen sollten. Was kann denn eine solche These bedeuten? Der Körper wäre dann im Raum - lassen sie uns zuerst mal den ersten negierten Teil des Satzes betrachten - er wäre dann im Raum, wenn er ganz von Raum umschlossen wäre und wenn 3 man über seine Lage im Raum alles gesagt hätte, wenn man ihn nach den konventionellen dreidimensionalen Koordinaten umschrieben hätte. Der Körper ist aber nicht im Raum hören wir, er wohnt ihm ein - aber wo ist er dann? Wo ist man, wenn man einem Raum einwohnt? Wir werden in unserem trivialen Raumverständnis angegriffen, durch eine scheinbar so harmlose Formulierung wie diese, und werden dazu gezwungen uns an eine Stelle des Raumes zu denken, die nur dadurch existiert, dass der Einwohnende sich an ihr befindet und dort einen neuen Ort aufmacht, den es sonst nicht gäbe, wenn der Existierende sich nicht an ihm befände. Die Leiche ist im Grab - man kann auch sagen, sie wohnt im Grab, aber sie wohnt ihm nicht mehr ein in der Weise einer Existenz. Im Sarge sein hat ganz offenkundig nicht mehr dieselben Raum eröffnenden, raumschöpferischen Qualitäten, wie sie dem menschlichen wohnen eigentümlich sind. Also dieses Wort "wohnen" gehört zum Grundwortschatz der heideggerschen Existentialphilosophie und deutet auf eine Subversion des gewöhnlichen Raumverständnisses durch eine Art Lehre von der konstitutiven Ekstase. Wir sind , wenn wir in der Welt sind, an einer Raumstelle zu der die absolute Unheimlichkeit des Daseins gehört, denn wenn man in der Welt ist, dann sind wir, wie Heidegger im Frühwerk zu betonen nicht müde wurde, Geworfene. Wir sind in einer ungeheuerlichen Weise ausgesetzt und aus dieser Ausgesetztheit heraus entsteht die Bemühung des Menschen um Einwohnung, beziehungsweise um die Einhausung, die Verwandlung der Welt in das Haus. Am Anfang jeder philosophischen Reflexion über das Heimatproblem, muss man einen Hinweis darauf geben, dass es ursprünglich die Griechen gewesen sind, die diesen ausserordentlichen Versuch unternommen haben (Parallelphänomene hat die indische Mythologie hervorgebracht) eine Art strenge Gleichung zwischen Welt oder Kosmos und Eukos (Haus, Herd, Umwelt) durchzusetzen. Wenn die Welt ein Haus ist, dann können wir in ihr beheimatet sein. Wenn die Welt insgesamt nur die Summe des unbewohnbaren, des unheimlichen bleibe, würde diese Gleichung von Weltlichkeit und Häuslichkeit entfallen und die Eukoesis müsste in letzter Instanz misslingen. Das gehört übriges zu den tragischen Gedanken des 20. Jahrhunderts, dass die Philosophie dieser Zeit den Menschen als ein Wesen zu beschreiben und begreifen begonnen hat, dessen Bemühungen um Einwohnung, dessen Bemühungen um heimisch und häuslich werden in der Welt zum Scheitern verurteilt sind, da haben wir nach 1945 namentlich in Europa unter existentialistischen Vorzeichen eine Fülle von Philosophien des „unbehausten Menschen“ gehört. Hans Egon Holthusen hat eines der bekanntesten Bücher der 4 deutschen Nachkriegszeit unter diesem Titel publiziert und in diesem Titel haben sich sehr viele Menschen wiedererkannt. Heidegger ist die Explikation des Gedankens zu verdanken, dass das Einwohnen selber von ekstatischer Qualität ist. Aber was bedeutet hier Ekstase? Selbstverständlich ist nicht dieses höhere Aussersichsein, das als psychischer Zustand beim Benutzen von Drogen oder beim Durchführen von psychoaktiven Übungen auftritt, gemeint. Ekstase ist hier ein ontologischer Terminus technicus und zwar bedeutend, dass ein Dasein in der Weise da ist, dass es an sich selber das Merkmal der Weltoffenheit an den Tag legt. Heidegger hat in seiner bedeutendsten Vorlesung „Grundbegriffe der Philosophie: Welteinsamkeit/Sterblichkeit“, die er Herbst 1929 / 1930 in Freiburg gehalten hat, eine kleine Skizze zu einer Naturphilosophie gezeichnet, wo er versucht, eine Art Naturgeschichte unter dem Gesichtspunkt des Weltzuwachses zu zeichnen. Er sagt am Anfang, der Stein – mit dem alle grossen Erzählungen über die Natur beginnen – der Stein ist weltlos. Weltlosigkeit bedeutet, dass der Stein nicht die Möglichkeit besitzt, Nachbar von etwas zu sein. Selbst wenn er neben einem anderen Stein lebt, ist er nicht sein Nachbar. Er kann nicht den Nachbarstein anstossen und sich zu ihm in ein Verhältnis setzen. Weltlosigkeit bedeutet auch Verhältnislosigkeit. Diese Steine haben daher auch die Metaphysiker fasziniert. Vor allem dieses steinerne Individuum, diese steinerne Einzelheit sind philosophisch faszinierend, weil sie sozusagen unbezüglich Individualität voranstellen. Manchmal träumt ja auch der Mensch davon, unbezüglich in Stein werden zu wollen, wenn die eigene Weltoffenheit zu sehr nervenstrapazierend wird. Das Tier, sagt Heidegger im zweiten Abschnitt seiner Reflexion, das Tier ist weltarm. Aber es hat bereits einen ungeheuren Schritt Richtung Weltoffenheit getan. Es ist gewissermassen so, als hätte der Stein in seinem Übermut angefangen, die Welt um ihn herum überhaupt das was um ihn herum ist - auf sich wirken zu lassen. Er hat sich Nerven zugelegt, er hat sich geöffnet, er hat eine Haut ausgebildet, er hat sich in eine Membran verwandelt. Er spiegelt etwas wieder, nimmt etwas auf und denkt, was ihn umgibt. Was für ein Leichtsinn, aber gleichzeitig auch was für eine grandiose evolutionäre Verwandlung eines Beziehungslosen in etwas Beziehungshaftes. Für den Menschen zeichne sich nun noch darüber aus, dass er weltbildend ist. Indem er weltbildend ist, legt er gewissermassen dieses Erbe an steinerner Idiotie ab und verwandelt sich in ein Ekstasewesen, das bis in sein Innerstes auf Nachbarschaftlichkeit mit seinem 5 hin angelegt ist. Und sei es auch um dieses wahrhafte Risiko der Sterblichkeit, der Verletzbarkeit und der Begegnung mit dem Ungeheuren, das die Fassungskraft eines blossen Nervenwesens übersteigt. Das heisst, deswegen wird das Bewohnen so bedeutsam in dieser modernen Existenzphilosophie, weil Weltoffenheit als solche unerträglich wäre, wenn es nicht geschützte Weltoffenheit wäre, die in einer speziellen Weltdichtung dem überweltoffenen, dem überausgesetzen Wesen die Möglichkeit des Daseins überhaupt erst zurückgibt. Hätten wir alle Zeit der Welt, könnten wir jetzt natürlich viele Bereiche hindurch dieses Motiv der geschützten Weltoffenheit durchbuchstabieren. Ich selber favorisiere auf diesem Gebiet ein Thema: Der Mensch und die Nacht. Das soll jetzt keine erotische Digression ergeben, sondern ganz im Gegenteil. Es soll zeigen, dass der Mensch selber mit seiner nächtlichen Seite eine Neigung hat, so etwas wie Weltlosigkeit wieder herzustellen – wenn auch nur auf Zeit. Der Schlaf ist eine Weltlosigkeit auf Zeit. Und zu den Dimensionen, in denen diese Weltoffenheit sich besonders manifestiert, gehört nun die Öffnung dessen, was wir unter einem Vorbehalt den akustischen Kanal nennen möchten. Die Ausbildung des akustischen Kanals in einem Organismus, der ursprünglich ja nicht gehört und nicht gesehen hat. Die Audiovisualität ist auch evolutionär spät gegenüber der olfaktorischen und taktilen Weltorientierung. 99 % aller Lebewesen orientieren sich in der Welt über vibratorische und olfaktorische oder chemische Signale. Die Audiovisualität gehört sozusagen zu den „Abenteuern der höheren Nervlichkeit“. Und innerhalb dessen ist die Eröffnung des akustischen Kanals besonders erregend. Man kann zum einen ja von der Existenz von Ohren her eine Art von akustischem Weltbeweis führen: Wenn es nichts zu hören gäbe, gäbe es auch die Ohren nicht. Die Ohren sind eigentlich Immunsystem. Man müsste sie auch anders rubrizieren, denn sie sind „Gefahrendetektoren“, die in einer sicherer werdenden Welt sekundär besetzt werden und dann erotisiert und ästhetisiert werden. Das ist in hochkulturellen Kontexten der normale Lauf der Dinge: Organe, die ursprünglich streng funktional eingesetzt waren, gehen irgendwann in ein Luxurie an Gebrauch über. Wenn wir wiederum viel Zeit hätten, könnte ich dies Ihnen an einem Beispiel vom weiblichen Körper her erläutern, wo sozusagen Unbrauchbarkeit in einem Direktverhältnis mit Erotisierung auftritt. 6 Aber diese akustische Welteröffnung hat für den Homo sapiens deswegen so eine besonders tiefe Bedeutung, weil die Einhausung des Menschen in der Welt (das was Historiker Eukoesis genannt haben) anthropologisch auf einer sehr tief angesetzten Ebene beginnt. Die Öffnung zur Welt beginnt bei den Säugetieren wie man weiss ja schon während der Tragzeit des werdenden Individuums und es entsteht das pränatale Bonding, wie es die Psychologen nennen. Weil das Ohr sich als das erste Organ am noch Ungeborenen entwickelt, geht die Welt und der Weltbezug, wenn er auch noch durch das mütterliche Milieu modifiziert ist, allen anderen Weltbezügen voraus. Bereits Ungeborene hören. Sie hören in erster Linie sozusagen das mütterliche Milieu. Dies ist das erste Phonoton und die erste Einschleifung des Ohrs in ein akustisches Weltverhältnis und wäre sogar der erste Beheimatungsversuch, die erste Tonspur, die im Ohr gezogen wird. Dass die Welt eigentlich am Meisten dann heimatlich ist, wenn sie so klingt, wie das klingt, was wir gehört haben, als wir das mütterliche Instrument bewohnt haben, liegt aufgrund dieser Betrachtungen geradezu auf der Hand. Auch wenn es selten ausgesprochen worden ist, aber hier ist ein Moment nochmal daran zu erinnern: Musik ist dämonisches Gebiet und als vernünftige Dämonologen muss man auch ein stückweit vernünftige Musikgynäkologie mit anbieten. Ich springe jetzt einfach über viele Stichworte hinweg, die ich mir notiert hätte - wir können manches auch mitten im Gespräch miteinander entwickeln. Ich glaube es genügt, wenn ich diese tiefenakustischen oder protomusikologischen Überlegungen vorausschicke. Eines sei abschließend klargestellt: Musik schliesst in all ihren Formen eine Stellungnahme zu diesen Grundtatsachen ein. Das meiste von dem, was ich jetzt gesagt habe, ist vormusikalisch relevant. Es ist allgemein. Akustik und Musik sind ja nicht dasselbe und die Welt der psychoakustischen Weltkonstruktion ist ein sehr viel breiteres Phänomen als das, was im musikalischen Feld als solchem auftritt, aber es ist beruhigend und bestätigend zugleich zu sehen, dass es von der Musik her eine starke Antwort geben kann auf Anregungen dieses Typs. Daher denke ich, sollten wir versuchen, jetzt die „Antwort des Musikers“ zu hören – wir werden dann vielleicht nach dem ersten Beispiel nochmals in eine biologische Passage eintreten. SM: Diese psychoakustischen Phänomene, die beschrieben wurden, sind natürlich für die Musik auch so etwas wie nicht hintergehbare apriorische Möglichkeitsbedingungen, die in der Kunstmusik und ihrer abendländischen Werkgeschichte zu unterschiedlichen Reaktionen, Stellungnahmen, Strategien geführt haben. Wenn Musik als Kunstform beheimatend wirken soll und kann, so muss sie in irgendeiner Weise 7 die Dimension des Räumlichen erreichen. Sowie der Körper in den Raum einwohnt, so der hörende Mensch in die Musik. Er kann sich in ihr nur einwohnen, wenn sie etwas ist, das dieses „rezeptive Platznehmen“ im Klang, in irgendeiner Kontinuitätsvorstellung von Klang anbietet. Das ist nicht einfach, da der Grundbaustein von Musik als Kunst etwas ist, das gerade durch seine radikale Zeitlichkeit/ Zeitgebundenheit – nämlich dem verklingenden Ton – nicht unbedingt geeignet ist, so etwas wie Räumlichkeit zu entfalten. Der Ton ist etwas, das verschwindet. Töne und Musik verklingen, das eigentliche Ziel ihres Erklingens. Die Kompositionsgeschichte könnte man weitgehend als strategisches Verhalten mit unterschiedlichen Ausprägungen sehen, gegen dieses Verklingen anzugehen und innerhalb dieser Reaktionsformen Techniken zu entwickeln, die stärker auf Räumlichkeit ausgerichtet sind, um damit wiederum ein stärkeres Beheimatungspotenzial zu ermöglichen. Einen qualitativen Sprung gibt es meiner Meinung nach hier in der Musik der Frühromantik zu sehen. In dem Programm dieses Kolloquiums ist die Winterreise von Schubert zu finden; dies ist natürlich kein Zufall, sondern quasi eine Bestätigung und auch eine Anregung für mich: Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus im ersten Lied „Gute Nacht“, da ist introitus exodus der Impuls, der zum Verlöschen führt. Hier das Setzen, das gleichzeitig ein Verschwinden darstellt, direkt programmatisch im wunderbaren Text von Wilhelm Müller akzentuiert und das Ergebnis, das vielleicht so eine Art Utopie von Beheimatung ex negativo sein könnte, endgültig dann im Leiermann am Schluss: Formeln des in sich selbst kreisenden Melodiebogens, das Unausweichliche einer radikalen, nicht mehr zielgerichteten Entwicklung. Ein kleiner Exkurs sei an dieser Stelle erlaubt: Wenn man die Kompositionsgeschichte des Abendlandes unabhängig von den stilistischen, ästhetischen und kompositionstechnischen Unterschieden Revue passieren lässt, kann man sich kaum der Einsicht erwehren, dass zwei grundsätzliche Tendenzen des Komponierens festzumachen sind, die mit diesen Beheimatungsversuchen zu tun haben. Gerade die beiden Zeitgenossen Beethoven und Schubert wären Prototypen für diese beiden Grundtendenzen: Entweder man tritt dem Verklingen des Tones und der Musik - sozusagen der Entkörperlichung, der Enträumlichung - dadurch entgegen, dass sie in eine radikale, zielgerichtete Prozessualität überführt wird. Das wäre bei Beethoven der Fall. Es ist die prozessgesteuerte Musik, die es wohl gibt in der Musikgeschichte, die jederzeit Strategien des Durchbruchs, der Zielgerichtetheit, der Teleologie entwickelt. 8 Der andere Typus ist der, der weniger mit zielgerichteter Verarbeitungstechnik verbunden ist, der umgekehrt das Möglichste festhält, der Tonkonstellationen umschreibt, Fixierungsstrategien entwickelt, Flächenbildungen, Räumlichkeitsillusionen mit den Tönen suggeriert – um dadurch direkt eine Behausung, eine Beheimatung im Raum (zumindest imaginär) möglich zu machen. Die Heimatsuche ist etwas, das das Werk Schuberts durchzieht, zwar in einer besseren Welt – wie es im berühmten Lied von der holden Kunst heisst – aber dennoch eine Beheimatung als eigentliches Ziel. Eine Heimat, die mit Melancholie, mit Unerreichbarkeit durchtränkt ist, aber dennoch die Sucht nach ihr im Medium des Klanges vollzieht – vor allem im Spätwerk Schuberts, wozu natürlich auch die Winterreise zählt. Ein schönes Beispiel für diese intendierte Räumlichkeit als akustisches Beheimatungsangebot – wobei gleichzeitig der Modus des Scheiterns eingeschrieben ist und mitgesetzt wird – wäre die letzte Klaviersonate in B-Dur, die – das passt natürlich auch sehr gut zur Winterreise – einen spezifischen Wander-Geh-Tonfall entfaltet, der mehr ein Umkreisungstonfall ist denn einer, der ein Ziel hat – bereits im Thema und in den ersten drei Sätzen prototypisch entwickelt. Da zeigt sich Heimatsucht, Heimatsehnsucht, aber auch Beheimatungsangebot – allerdings im Modus des sehnsüchtig Angestrebten, nicht für realisierbar Gehaltenen, sozusagen im Modus des Scheiterns. Ich werde dies ganz kurz am Thema exemplifizieren. Hier wird besonders deutlich, wie so etwas wie Räumlichkeitsentwicklung in der Musik als Beheimatungsangebot erscheint. Und dies trotz der Kategorie des Verklingens und der Flüchtigkeit in der Zeit – Musik ist ja sozusagen Luftvibrationskunst, die ein Grad an Manifestheit vortäuschen, imaginieren muss, eine Suggestionskraft entwickeln muss, um so etwas wie Klangraum, in dem man einwohnen kann, überhaupt möglich zu machen. Es ist ein sehr schönes, einfaches, liedhaftes Thema, das durchaus auch als Melodie mit Text existieren könnte, das auch vom Duktus her dem ersten Winterreise-Lied nicht unähnlich ist. Diese Klangräumlichkeit, dieses Einwohnungsangebot, das immer gleichzeitig die Unmöglichkeit einer tatsächlichen Erfüllung mitformuliert – mit das Bedeutsamste in der späten Schubertschen Musik – das kann man hier, ohne dass man viel Musiktheorie betreiben muss, einfach phänomenologisch nachvollziehen… Siegfried Mauser spielt das Thema auf dem Klavier. 9 SM: Eine relativ gleichförmige, in Vierteln verlaufende Melodie: man könnte sagen, eine Art „dahinsingen“. Vielleicht bei einem Gang durch die Natur. Der Wanderduktus, das langsame Schlendern, ist hier eingeschrieben. Aber es ist kein Gehen, das zielgerichtet ist, sondern ein Gehen, das in sich kreist. Dies zeigt schon die erste Phrase, die sozusagen nicht über sich hinaus kommt: Siegfried Mauser wiederholt die erste Phrase. Hier ist ein Spitzenton erreicht, der sofort zurückgenommen wird und zum Ausgangston zurückkehrt. Eine kreisförmige Bewegung, die weder Teleologie, noch Fortschritt, noch Ziel kennt. Verstärkt wird dieser Eindruck merkwürdige Tonfixierungen, die räumliche Markierungen einzuschlagen scheinen. Es handelt sich um die beiden wichtigsten Töne, die eine Tonart bestimmen, nämlich den Grundton, das B, und die Quinte das F wie Pol und Gegenpol. Das ganze Thema hält diese beiden Töne über die ersten vier Takte fest. Dies wäre für den Zeitgenossen Beethoven undenkbar! Diese Töne bilden Klangpflöcke, konstituieren einen Raum, der sich anbietet und den die Melodie gewissermassen kreisläufig durchschreitet. Sie sind festgehalten, wie in einer gewissen Manie festgeschrieben. Siegfried Mauser wiederholt das Thema und betont die „Klangpflöcke“ B und F. In diesen beiden Tonpflöcken vollzieht sich der melodische Kreis. Dadurch gelingt es tatsächlich, so etwas wie Bewegung aus dem Raum heraus zu konstituieren. Am Ende des Prozesses wird nämlich die Dominante, die harmonische Gegenkraft zur Tonart in der sich die Musik bewegt, mehr oder weniger beiläufig erreicht. Da ereignet sich etwas völlig Extraterritoriales, eine Art Gefährdung des Klangraumes, des Beheimatungsangebots, in dem man sich bewegte… …Siegfried Mauser spielt das Thema erneut. Spielt weiter… …Gefährdung der Konstitution eines heimatlichen Klangraumes erzeugt ein plötzlich mitgesetztes Ges. Dieses Ges, das eine schärfste Dissonanz darstellt, nicht wie Irritation und Störfaktor, ist so etwas wie der Inbegriff der Gefährdung von Heimat. Das Ineinander und Miteinander von Angebotsstruktur einer Beheimatung in einem sich entfaltenden Klangraum und der gleichzeitig mitgesetzten, in der Sache selbst bereits als begründet anzusehenden Irritation, Störung, ja Verstörung, stellt meiner Meinung einen Kernpunkt der grossen Kunst des späten Schubertschen Komponierens dar. 10 „Spät“ ist eine merkwürdige Kategorie bei einem Komponisten, der nur 31 Jahre alt geworden ist. Aber die Entwicklung ist sicher – wie bei Mozart auch – in einer Art Zeitbeschleuniger abgelaufen. Das heisst, dass da in fünf Jahren wahrscheinlich so viel passiert ist wie bei manchem anderen Komponisten in zwanzig Jahren. Insofern ist es legitim, von einem „Spätstil“ zu sprechen, der sich mit diesen weiträumigen und gleichzeitig gefährdeten Beheimatungsangeboten – die Schuberts eigene Utopien, seine Versuche widerspiegeln – in eine nahezu existentialistische Dimension begibt. Nach dem Störfaktor beginnt Schubert nochmal von vorne, als ob nichts gewesen wäre - vielleicht geht’s jetzt. Dann kommt am Ende kein Störfaktor, aber die Weiterführung und das weitere Ausschreiten des Klangraumes sinkt um eine Terz herab. Das ist auch völlig ungewöhnlich – und für Beethoven kaum denkbar – dass ein Thema bis zu fünfmal hintereinander erklingt und quasi nur verrutscht. Und zwar immer wieder unter Kategorien eines klangräumlichen Angebots, in das wir eintreten können, und der gleichzeitigen Irritation und Gefährdung desselben. Dies gilt für das zweite Thema – in melancholischer Form – auch: Töne und Klänge werden festgehalten und die Melodik versucht, diese Pflöcke, die räumlich-körperlichen Markierungen der verklingenden Töne, die durch die Wiederholung und Insistenz die reine Zeitlichkeit zu überwinden scheinen zu umspielen. Es entwickelt sich eine Art KlangraumGewebe, das unentwegten Gefährdungen ausgesetzt ist. Siegfried Mauser spielt das zweite Thema auf dem Klavier. PS: Das war eine sehr eindrucksvolle Übersetzung einiger der Motive aus dem ersten Exposé in ein völlig anderes Register. Mir selber fiel bei deinen Ausführungen ein, dass gerade Schubert von seiner Kompositionstechnik her eine ganz besonders ausgeprägte Möglichkeit besitzt, „Heimaten als ob“ herzstellen, weil er – gerade als Liedkomponist – starke Neigungen zum Strophenlied hat. Das Strophenlied bietet ja gerade das Element an, was für den psychoakustischen Beheimatungseffekt das stärkste ist, nämlich die Wiederholung. Schubert ist schon in der zweiten Strophe der ersten zu Hause. Das heisst er bietet das erste Gefäss an und darin ist es in ein grosses trostvolles Programm gesetzt. Und dass das eben kein Kitsch und keine Heimatmusik im trivialen, bösen Sinne des Wortes sind, zeigt sich daran, dass die Musik nicht lügt, weil sie ihre Gefährdung nicht verschweigt. Der Bruch kommt sofort. 11 Und da kommt die zweifache Verarbeitung: einmal in dieser fast katastrophischen Andeutung durch die scharfe Dissonanz, zum anderen auch in der Form der melancholischen Verarbeitung. Schubert wechselt das Tongeschlecht gerne. Durch den Wechsel des Tongeschlechts wird die Zerstörung der Homöostase verarbeitet. Eine Art Trauerarbeit, die in Strophenform abgeleistet wird. Wenn alles gut geht, gibt es so etwas wie eine schwebende, nicht gelogene Rückkehr in die Stimmung, in der man ursprünglich hat beginnen wollen. Im Grunde ist das, was du zeigst auch ein Hinweis auf die kreisenden Bewegungen, die mir ganz fundamental erscheinen. Sie sind wie ein Element einer allgemeinen Theorie der Strophe. Oder umgekehrt ist eine Strophe vielleicht eine allgemeine Theorie der kreisförmigen Figur im musikalischen Raum… SM: Es gibt ja ein berühmtes Zitat, das für Luigi Nono so wichtig geworden ist und an die Klostermauer in Toledo geschrieben wurde: „Wanderer, du musst gehen, doch es gibt keinen Weg.“ Damit ist abstrakt der Prototyp solcher Umkreisungsbewegungen erfasst. Der Weg beschreibt letztlich das Insichkreisen, das dort endet, wo es begann. Die Ambivalenz des Angebots bei Schubert ist das Erstaunliche, das was vor Kitsch bewahrt: die Gefährdungen sind eingeschrieben konstitutiver Bestandteil. All das ist beispielsweise auch im Streichquintett und den grossen späten Liedern zu finden. Ungebrochenheit tritt nur dort auf, wo das Angebot selbst schon katastrophisch ist, wo das wüste Land von vornherein die einzig mögliche Heimat zu sein scheint. Das wäre im zweiten Satz sehr schön zu sehen: dort gibt es keine derartigen Störfaktoren, weil die Nichterreichbarkeit in der räumlichen Setzung selbst bereits stattfindet. Das ist einer der grossartigsten langsamen Sätzen Schuberts – in cis-Moll – und man sieht auch nochmal die bedrängenden Klangbeheimatungsstrategien des späten Schubert. Siegfried Mauser zeigt am ersten Teil des Satzes, wie dessen räumlicher Charakter als ein Angebot an den Zuhörenden, in eine melancholisch durchwobene, letztlich nicht erreichbare Heimat einzutreten, verstanden werden kann. PS: Ich glaube, du wirst zugeben, hiergegen hilft nur noch Dämonologie…Was hört man, wenn man das hört? Es ist ja doch ein Tongewebe, bei dem der Eindruck des Durchscheinens auf etwas ganz Unheimliches, Unabweisliches … 12 SM: Genau! Diese existentielle Dimension der Schubertschen Musik ist ja spät entdeckt worden, weil natürlich diese Dinge in dem Biedermeierkontext, indem er gesehen wurde und der auf ihn projiziert wurde, keinen Raum hatten. Man kann schon sagen, dass es sich um einen von Melancholie und Todesvision durchdrungenen Klangraum handelt. PS: Ich wollte jetzt auch versuchen, mit einer vormusikalischen Impression zu einem Neuanfang zu kommen. Dies kann natürlich kein Kommentar zu dem Stück sein, aber es kann einen allgemeinen Raum innerhalb dessen eröffnen, der ein musikalisches Gespräch über das Gehörte möglich macht. Um nochmal zurückzugehen zu diesen Unheimlichkeiten des menschlichen „zur Welt kommens“. Wenn es richtig ist, dass das menschliche Ohr aus einem Rhythmuskontinuum kommt, das durch das mütterliche Instrument mit all seinen Rhythmusschwankungen (der mütterliche Herzton ist, wenn man so will, der primäre Beat auf dem die menschliche Existenz in ihren verschiedenen rhythmischen Regungszuständen gestimmt ist) dargestellt wird – was passiert, wenn ein solches Ohr nach der Geburt die Welt entdeckt? Was hört es da? Da sind zwei wesentlich differente akustische Dimensionen. Das eine macht die Erfahrung der Direktheit. Kleinkinder haben ja eine ungeheure Fähigkeit über scharfe Geräusche zu erschrecken. Diese Schrecksamkeit gegenüber dem direkten Klang ist auch manchen Erwachsenen (in ermüdeten, regressiven Zuständen) noch gegeben. Dass der Ton plötzlich nackt ans Ohr dringt, ist etwas Irritierendes. Die zweite Unheimlichkeit besteht darin, dass man als Geborenes zum ersten Mal die Möglichkeit hat, dass man nichts hat. Silencium ist eine postnatale Entdeckung. Die Welt ist ein Ort, an dem etwas wie eine ganz unermessliche, unheimliche Stille herrschen kann. Die Stille eines Wiener Wohnhauses um 1800. Da möchte ich nicht drin sein. Aber der grosse Künstler schwingt von dort her. Wenn er häufig solche Tonarten des Heimwehs anschlägt, dann ist es zugleich eine Art von Nostalgie nach etwas, wonach er eigentlich gar kein Heimweh haben kann, weil es dort auf keinen Fall besser sein kann. Also ist es eine ganz merkwürdige, utopische Form von Suchbewegung. Es spricht alles dafür, dass dann die einzige Beheimatungsmöglichkeit, die überhaupt gefunden wird, im Kunstgeschehen selber liegt. Indem das Werk in sich kreist, indem es sich seine eigene wärmende Resonanz ergibt, erzeugt es die Möglichkeit einer vorübergehenden Heimkehr in das Nicht-Neue. Das ist ja das, was man an der Heimat schätzt, dass man dort wieder idiotisch werden darf. Eine nicht kritisierbare Form von Idiotie. Das ist das Menschenrecht auf Innovationsentlastung, um es übertrieben auszudrücken. 13 SM: …auch Entlastung vom Lebenskampf. PS: Ja, man hört ja auch so etwas wie Vertonung der Utopie einer Müdigkeit, die gut ist. Nicht die Müdigkeit eines Besiegten, sondern Kompositionsgewebe ist da, und selbst bei scheinbar fröhlichen Liedern hört man etwas Mitternächtliches… SM: Der Bruder Ferdinand übermittelte folgende Anekdote – wenn sie nicht wahr sein sollte, ist sie zumindest sehr gut erfunden: Schubert wurde in der späten Zeit in der Kettenbrückenstrasse, also in der sogenannten „Vorstadt“, bei ihm aufgenommen. Die fortschreitende Krankheit zwang ihn immer mehr dazu, im Zimmer zu bleiben und nicht mehr auszugehen. Er sei da immer wieder mit der Brille (seiner berühmten Nickelbrille) eingeschlafen, weil er mehrfach in frühen Morgenstunden, in denen er erwachte – die Trinkgelage im Freundeskreis waren bereits reduziert – die Brille nicht fand. Er erachtete aber den somnambulen Zustand des Noch-nicht-Wachseins, aber auch Nicht-mehr-Schlafens, als den eigentlich notwendigen Impuls fürs Komponieren. Deswegen ist er lieber mit der Brille eingeschlafen, damit er in der Frühe nicht suchen musste und sofort in diesem halbwachen Zustand in seine Klangräume eingetreten ist. Bei diesem cis-Moll-Satz leuchtet mir das sofort ein. PS: Also ganz am anderen Pol im Vergleich zu einem Autor wie etwa Honoré de Balzac, von dem überliefert ist, dass er, um zu schreiben, nicht nur fünfzig Kannen Kaffee zu sich nehmen musste, sondern sich sogar bevor er sich an seinen „Schreibaltar“ gesetzt hat, umzog. Er hat seine gewöhnliche Kleidung ausgezogen und ein weisses Priestergewand angelegt, um dem Hochamt der Poesie nachgehen zu können. Wenn hier ein veränderter Bewusstseinszustand im Spiel ist, hat er nicht mehr somnambulen Wert, sondern versteht sich als Zustand der Hyperluzidität, der auch mit einer unerhörten Schnelligkeit und Sicherheit des Schreibens zusammenhing. Das ist übrigens auch bei Schubert beobachtet worden, allerdings ist bei ihm eher eine magische Überbeschleunigung zu bemerken. Dies beweist, dass Können auf seinem höchsten Punkt in einer Weise bei sich ist, dass es vom Probieren und Suchen entlastet wird. Jede Setzung, die gemacht wird, ist intern so anschlussfähig, dass immer eine gelingende Figur entsteht. 14 SM: Übrigens ist der Kern der Klanghülle, die die wehmütige Terzmelodie in den Eckteilen unseres langsamen Satzes umgibt, eigentlich der Herzpuls: tam-ta-tam-ta – wie ein schlagendes Herz. PS: Wir haben im vorigen Gespräch gelegentlich mit so einer Art Pulsation, also einer Art Dialektik musikalischer Grundgebärden gearbeitet, die ich einmal in einem Aufsatz vor rund 20 Jahren (Wo sind wir, wenn wir Musik hören?) entwickelt habe. Darauf gab es verschiedene Antworten und die eine davon war: In dieser Pulsation zwei Grundstrebungen, Heimkehr oder Einkehr, zu erkennen, die die musikalische Bewegung prägt. Dies hat man hier auch deutlich gehört. Es gibt noch einer andere Setzungsdynamik, eine, die nicht mit diesem wohlgeordneten Rückzug des musikalischen Subjekts vom Weltstress zu tun hat; eine Bewegung, die übrigens Schubert auch sehr geläufig ist, beispielsweise im „Mut“ in der Winterreise. „Bläst der Wind mir ins Gesicht“, wiederzufinden wo der Exodus als Gebärde vorwiegt. Mit anderen Worten: das abgetrotzte Glück, Boden unter den Füssen zu haben und gehen zu können und sich vorwärts zu bewegen. Quasi ein Exodus mit grossem Orchester. Man nimmt sämtliche Instrumente mit, um im musikalischen Raum eine Entdeckung zu machen. Mit den Mitteln einer Kompositionskunst, die eine Zeitlang eine Art Parallelbewegung zu dem geworden ist, was die Neuzeiteuropäer ohnedies getan haben, nämlich, dass sie sich als Agenten des Zeitalters der Forschung und Entdeckung verhalten. Die Welt ist in der Ära nach Kolumbus das schlechthin zu Entdeckende. Auf ihre Weise haben die Musiker nach dem Vorgang der Maler dieses „entdecken Können“ ebenfalls entdeckt. Nachdem das „entdecken Können“ in der Musik entdeckt war, kam das eigentliche Komponieren erst auf. SM: Der Künstlertypus des Pioniers. PS: Der Pionier wird hier positiv besetzt. Deswegen ist auch der Künstler von einem bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr nur Handwerker / nicht mehr nur artigiano, sondern er wird wirklich Artist. Er wird Virtuose, ein Trainer der höchsten Tugend, der Kraft (virtu). Und er macht vor allem Neues, dies ist das Entscheidende. In dem Stück, das wir eben gehört haben, ist der erste Pol, die Heimkehrbewegung ausgeprägt. Nichtsdestoweniger spürt man an diesem innovationsträchtigen, virtuosen Apparat des musikalischen Satzes, dass Schubert seine Exodus-Fähigkeit zu keinem Augenblick vergisst. In dieser Doppelbewegung 15 ist ja das angesiedelt, was man den eigentlich musikalischen Moment nennen muss. Es ist wiederum auch nicht nur eine Form, die irgendwann einmal gefunden worden ist, sondern „un moment musical“ ist eine Gattung, die zugleich das Gattungshafte transzendiert, weil in ihm gewissermassen so eine Art vertonte Musikphilosophie stattfindet. Es ist meistens ein „moment musical“, ein Moment, in dem etwas sichtbar gemacht wird von der Tatsache, dass Musik etwas mit „finden“ zu tun hat. Entweder mit dem Wiederfinden - „music à retrouver“ lautete der Titel einer Rede, die ich vor zwei Jahren einmal hier in der Schweiz, bei der Eröffnung der Luzerner Festspiele, halten durfte – es ist aber auch „music trouvé“, nicht nur „retrouvé“, also eine Musik, die selber findet, einen Charakter an den Tag legt. Und die führt dann die Heimkehrbewegung in einer ganz anderen Art und Weise aus, nämlich indem sie Musik mit dem Prinzip des Utopischen zusammenschliesst – bei Beethoven wohl deutlicher erkennbar als bei Schubert. So wird es sinnvoll, daran zu denken, dass man sich durch musikalische Arbeit an ein Ziel begeben kann. An ein Willensziel und an ein Menschheitsziel. Wir machen Musik dann eben nach dem Lärm. Eine Position, die mit der Heimkehrbewegung korrespondiert. Heimkehr in das „nicht Neue“, das aber, weil es „gutes Altes“ ist, anknüpfungsfähig bleibt. Aber wohin kehren wir heim, wenn wir kein gutes Altes haben? Der ganze Horror unserer Heimatambivalenz steckt ja in dieser entscheidenden Fragestellung. SM: Das kann nur ein Abstraktum, gleichsam auf einer Metaebene sein. Die ausserordentliche Denkfigur der „Weltfremdheit“, die du entwickelt hast: dass letztlich die akustische Urerfahrung, in die man in eine offene Unbewusstheit des pränatalen Zustands hineinwächst, die eines weltfremden Kontinuums ist, man als substantielle Ersterfahrung mitnimmt. Und dass Diskontinuierliche (Umweltgeräusche oder Sprechakte der Mutter) akzidentell sind. Somit akustische Grunderfahrung die des Kontinuums ist: der Puls und das viszerale Rauschen. Und akzidentell die nicht kontinuierliche Hörerfahrung. Das dreht sich dann genau um. Das ist also eigentlich das akustische Trauma der Geburt: Dass jetzt das Diskontinuierliche – auch die absolute Stille, die auf den (schockhaften) Impuls folgt – die substantielle Grunderfahrung ist. Und die akzidentelle Grunderfahrung vielleicht als Beheimatung, als Suche nach Geborgenheit, nach Aufgehobenheit letztlich nach Kontinuitätserfahrungen dasteht. Ich scheu mich nicht, die Theorie zu vertreten, dass die abendländische Kompositionsgeschichte in ihrer Abfolge von bedeutenden Werten nichts anderes als ganz unterschiedliche Strategieversuche sind, diese Kontinuitätserfahrung wieder her zu stellen. Und dies in der gelingenden ästhetischen Erfahrung des jeweiligen Kunstwerkes – völlig abgelöst von Stil, Technik und von Zugehörigkeit zu einer Epoche. 16 Vielleicht ist die gelingende ästhetische Grunderfahrung im Medium des Akustischen genau dieses Grundgefühl einer Kontinuitätswahrnehmung, die als substantielles Element des Hörens in der Alltagswelt letztlich nicht mehr existiert, das ein peripheres, akzidentielles Phänomen geworden ist, und nur noch in der ästhetischen Wahrnehmung des gelungen musikalischen Werks möglich ist. PS: Mir geht manchmal ein Bild durch den Kopf, das ich vor einigen Monaten aufgeschnappt habe: bei den Geburtstagsfeierlichkeiten für Benedikt XVI, hat ja ein Baden-Württembergisches Sinfonieorchester die Ehre gehabt, im Vatikan zu spielen. Da sah man Benedikt XVI. Gespielt wurde, weil es sein Geburtstag war, ein Violinkonzert von Mozart. Er ist, wie man weiss, ein Mozartliebhaber. Das haben wir uns alle angesehen. Die Kamera hat unbewusst subversiv gearbeitet, möchte ich mal behaupten. Man sah das geistliche Oberhaupt der katholischen Kirche, man sah die junge hübsche Geigerin, man sah das Orchester, man hörte Mozart. Wo ist die Botschaft? Es war eigentlich ziemlich klar, dass das apostolische Amt auf die Musik übergegangen ist. Benedikt macht einen Anfängerfehler, er fühlt sich als Hörer eines anderen Evangeliums. Als Oberhaupt der katholischen Kirche hat er kein Recht, Mozart zu hören. Dies aus einem ganz einfachen Grund: Wegen des Kontinuumproblems. Er ist ja selber eine unerhörte, ständig sprudelnde Quelle mikroevangelischer neuer Intensität. Das heisst am Ende, ständig neue gute Botschaften zu formulieren, die es an Erhabenheit gelegentlich durchaus mit dem, was in alten Dokumenten gesagt ist und was in Jahrtausend alten Ritualen bekräftigt wird, aufnehmen können. Was hört überhaupt ein 80-jähriger, was ist die Erfahrung des Hörens mit Achtzig? Ich finde generell, dass man Menschen beim Hören nicht zuschauen soll, weil es eine intime Tätigkeit ist. Jemand beim Hören zu Fotografieren ist eigentlich indezent. SM: Ja, das Musikmachen selber soll man meistens sehen können. Beim Hören beobachtet zu werden, das ist indiskret. PS: Es ist aber auch nicht schön, einen Posaunisten oder einen Bläser zu filmen. Der Atemstrom gehört dem Bläser und nicht in die Öffentlichkeit… SM: Stravinsky war der Meinung, dass man Musikerzeugung sehr wohl sehen sollte, weil damit so etwas wie ein visuelles Korsett mitgeliefert wird. Durch Impuls, durch Bewegung im Moment… 17 PS: Gut, in einer Zeit, in der das Ohr selber schon auf alle möglichen Angebote reingefallen ist, sind solche visuellen Hilfen vielleicht sogar wieder ganz gut: Wenn man nicht hören kann, so soll man dem Pianisten auf die Finger schauen. Aber wenn man hören kann, soll man es besser lassen. Die Augen nehmen so viel vom Ohr weg. Man soll sich fragen „wie macht der das nur?“ Da ist schon wieder eine heteronome Dimension mit eingedrungen... Worauf ich hinaus will: was für ein Gesichtspunkt, dass, sagen wir diese ständige Arbeit am Kontinuum, die mit dem musikalischen Prozess als solchem intim verbunden ist, etwas ist, das es verträgt, von der Ferne mit so protoevangelischen Prozess verglichen zu werden. Diejenigen Äusserungen, die von ihrer semantischen Ladung her, von ihrer Vektorkraft her, die gute Nachricht tragen. Die gute Nachricht, die lautet, dass der klingende Faden des Lebens nicht gerissen ist, obwohl eigentlich alles dafür spricht. Wir, als Bewohner des Lernens, haben zunächst einmal ein realistisches Ohr. Das heisst, ein Lern-Ohr, ein semantisches Ohr, ein Gefahren-Ohr, ein Alarm-Ohr, ein Arbeits-Ohr. Und dann kommen diese Musiker und spielen uns solche Sachen vor. Das kann man eigentlich einem arbeitenden Menschen gar nicht zumuten. Der langsame Satz von Schubert – ich meine, wenn ich die Konsequenzen ziehe, dann lass ich mich vierzehn Tage krankschreiben. Wenn das stimmt, was da passiert, was mach ich denn dann in meinem Lernleben? SM: Ich nehme es darin auf! PS: Na gut, ich meine, deine Heimat ist es ja dadurch geworden, dass du die Darstellung des damit Bezeichneten professionalisiert hast. Du hast als Pianist die Möglichkeit, diese „Krankschreibung“ zu vermeiden, indem die Darstellung als solche, dich sehr mit dem Prinzip des forschenden, des könnenden, des extrovertierten Lebens weiterhin verbunden ist… SM: …Dennoch verliert man diese „Krankschreibung“ nie ganz. Denn dies ist bei der Ausübung ganz besonders wichtig: weil derartige Musik an die Grenzen der Selbstaufgabe geht, muss man sie trotz aller professionalisierten Darstellung doch immer auch nacherleben. Ich würde gerne nochmal den Gedanken des Subversiven aufgreifen. Am Beginn der musikalischen Moderne gibt es eine Musik, die die Klangräumlichkeit/Körperhaftigkeit sogar direkt und konzeptionell umsetzt. Erik Satie hat ein Konzept entwickelt, das die Illusionsbeheimatungen der musikalischen, vor allem deutschen Romantik des 19. Jahrhunderts konterkariert, dekonstruiert, persifliert und sie trotzdem auf eine gewisse Weise neutral restituiert. Es ist das Konzept einer musique d’ameublement, das er vor 18 gut hundert Jahren entwickelte. Pariser Zeitungen bietet er sie für alle möglichen Familienfeste, für Hochzeiten etc. an. Für jede neu einzurichtende Wohnung, empfiehlt er neben Schreibtisch und Bett, natürlich auch musique d’ameublement, die man kaufen kann und die dann als akustisches Möbel eingestellt wird und den Raum wie ein Schreibtisch funktionalisiert. Das Paradestück der musique d’ameublement hat schon den verhängnisvollen Titel „Vexations“. Es handelt sich um einen verfremdeten Choral, der 840mal zu wiederholen ist, was zwischen elf und zwölf Stunden dauert – eine radikale Form eines Konzepts der Klangraumbeheimatung. Es hat insofern einen Realitätsbezug – was sehr weitsichtig war – als wir ja die Klangmöblierung von Kaufhäusern über Gaststädten bis hin zu Toiletten alle kennen. Die Wiederholungen erzeugen totale Vergegenwärtigung, das war das Kennzeichen für diese Idee der musique d’ameublement, wo also tatsächlich Körper und Raum als Beheimatungsphänomene dem Menschen im Medium des Klangs entgegentreten. Natürlich ist die Musik stereotyp langsam, stereotyp gleichbleibend und sich wiederholend, im Verlauf an die Grenze der Indifferenz gerückt. SM spielt auf dem Klavier aus der ersten, zweiten und dritten „Gymnopédie“ von Eric Satie… SM: Akustisches Besteck wie: Messer, Gabel, Löffel, Tische, Stühle, etc… PS: Ich hatte eine andere Assoziation. Um beim Konzept des Möbels, des akustischen Sofas, das nach dem Geschmack des Raumbesitzers bezogen wird, zu bleiben: Da ist ein Element der Individualisierung mit vorgesehen. Sowie auch heute die grossen Raumausstatter ihren Kunden die frohe Botschaft von der vollkommenen Individualisierung der Wahl vortragen. Es gibt hier eine Fülle von aussermusikalischen Anschlüssen in dem gleichzeigen Kunstsystem, das sich vorbereitet auf diese funktionalistische Wende. Später tritt Le Corbusier (schweizerisch-französischer Architekt/Möbeldesigner) auf und programmiert an Stelle von Wohnungen die Maschinenhabité. Das heisst, man begreift, dass auch solche unvordenklichen menschlichen Grundtätigkeiten wie das „Wohnen“ von der modernen, funktionalistischen Denkweise miterfasst werden. Funktionalisten gehen ja immer von der Frage aus: Welche Leistungen hat eine bestimmte Funktion zu erbringen und welche Variablen könnte man einführen? Funktionalismus ist immer das Denken in Varianten. Funktionen beschreiben ja Funktionsbereiche. Ein akustisches Möbel ist offenkundig ein musikalisches Objekt, ein sphärisches Produkt, das sich insofern für Wohnungen eignet, als Wohnungen – das wissen wir erst seit der funktionalistischen Revolution – eigentlich Maschinen zur Erzeugung von lebensförderlicher 19 Regeneration sind. Das heisst, es sind gewissermassen Gewöhnungsanlagen. Wenn ich in einer gut funktionierenden Gewöhnungsmaschine beheimatet bin, dann kann ich von dort aus originell werden, weil der triviale Hintergrund gesättigt ist. Die Entdeckung der Notwenigkeit der Erinnerungssättigung. So hat Le Corbusier auch argumentiert: Wir brauchen Wohnungen, in denen diese Regenerationsleistung, die Regressionsleistung, die Stabilisierung der Lebensfunktionen hundertprozentig gesichert ist. Dann kann von dort aus ein Leistungsträger einen rationellen Wert durchführen, vom Basislager aus. Alles, was Leistung ist, beginnt nicht bei null, sondern beginnt bei einem Basislager. Die Wohnung ist ein Basislager für Höchstleistungen. Je nachdem, wie hoch die Wohnung angesetzt wird, desto höher ist das Niveau der Razzia, die von der Wohnung aus durchgeführt wird. Rationelle Leistungswelt, die Kunst wie ein Erwerbsfeld… Das Interessante ist, dass man dann von den 10er-/20er-Jahren aus Wohnungen tatsächlich ganz bewusst von vornherein so gebaut hat. Dass man „zweite Gemütlichkeit“ hergestellt hat, aber nicht mehr im Sinne des alten Miefs, sondern, indem man eine neue funktionale Gemütlichkeit herstellt, als ein Angebot eines gut funktionierenden und zuverlässig vernachlässigbaren Hintergrundes. Das ist eigentlich der Grund. Musik sagt ja bei jedem Akkord, hör doch nicht schon wieder hin. SM: Absichtsvolle Redundanz. PS: Jaja. Sie sagt, warum hörst du zu? Hör weg. SM: Und von dort führt der Weg zu Cage. Cage mit seiner Ästhetik der Intentionslosigkeit, hat als einer seiner wenigen historischen Bezugspunkt Satie gelten lassen. Weil das natürlich auskomponierte Intentionslosigkeit ist, die bei Cage das Komponieren selbst noch aufs Spiel setzt, beziehungsweise ausser Acht lässt. PS: Aber dann ist das Hören auch eine viel zu intentionale, viel zu saugende, viel zu voraussetzungsvolle Tätigkeit. Dann muss man auch vom Hören ablassen. Die Musik ist wirklich als akustisches Möbel an seinem Platz. Und Möbel sind Dinge, die uns das Recht geben, sie nicht zu beachten. Es gehört zu jedem guten Möbel, dass, wenn ich es mal hingestellt habe, es für den Rest meines Lebens nicht mehr sehen muss. Nur so ein paar überdrehte Antiquitätsbesitzer, die tun so, als würden sie sich jeden Tag freuen und machen dann so sinnige Betrachtungen von Holzmaserungen ihrer Kommode, usw. Aber dies ist eigentlich gegen den Geist des Wohnens im Sinne dieser le-corbusier-artigen, rekonstruierten Aufenthaltsmaschine, in der ein Leistungsträger ein Basislager hat für seine Evasionen in die Leistung 20 zurück. Ich denke, diese Musik von Satie fühlt sich in gewisser Weise so an, weil sie dieselbe Art hat… Die sieht man einem müden Menschen an, der in einem Glaskubus hin und her geht, in Gedanken versunken, und sich für einen neuen Tag an der Börse vorbereitet... SM: Dass dies auch neutrale Raumerfüllung im akustischen Sinne sein kann, zeigt, dass entsprechende Stücke von Satie statistisch gesehen am häufigsten für filmmusikalische Zwecke genutzt wurden. Sie sind durch diese (Raum) Neutralität, die sie aufweisen, anpassungsfähig für verschiedenste Szenerien. Sie markieren Raum in gleichsam ahistorischer Neutralität. PS: Aber sie zeigen sogar noch mehr: Im Zuge der funktionalistischen Abstraktion und funktionalistisch fortschreitenden Explikation, wird Atmosphäre wie eine Sache für sich darstellbar. Das ist etwas ganz Neues: dass das Jahrhundert mit bisher unsichtbarsten Dingen in die Explikation eingezogen ist. Und dass Atmosphäre als Gegenstand einer aparten Produktion popularisiert werden kann. In Treibhäusern, in den „Hothouses“ der britischen Oberschicht der 10er-, 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts hat man begonnen, Häuser zu errichten, die eigentlich nur des Klimas Willen, das dort drin herrschen soll, aufgestellt werden. Dies ist in der Geschichte des Bauhauses eine relative Neuigkeit. Man hat die Dampfheizung erfunden für die Pflanzentreibhäuser. Nicht für die Menschen in England - die waren das Frieren gewöhnt – aber die Pflanzen aus den Kolonien wie zum Beispiel die berühmte victoria regia (die Schönste der Seerosen), die Palmen … die sollten auch in England beheimatet werden. Also hat man Gesetze der atmosphärischen Gastfreundschaft für Pflanzen zu respektieren gehabt. Und weil dies in den guten Kreisen Grossbritanniens und Nordeuropas tatsächlich auch respektiert wurde, hat man dann versucht, eben Häuser zu bauen, die dann als Klimasimulatoren ihre Dienste tun. Von den Gedanken des Treibhauses her wird dann auch die Abstraktion des Atmosphärischen als eine architektonische Grundgrösse per se um eine Qualifikationsstufe weitergetrieben. Natürlich haben die Architekten immer gewusst, dass ein gutes Haus im Winter wärmt und im Sommer kühlt. Aber über diese Elementardinge hinaus ist eine ganze Technologie entstanden… Wenn Sie sich heute Schwierigkeiten beim Häuserbauen vergegenwärtigen wollen, dann denkt man in erster Linie eben an das Atmosphärendesign, das um das Gebäude herum zu betreiben ist. Und das gilt nun auch für die metaphorische Interpretation des Begriffs Atmosphäre. 21 Der „tonale Atmosphäre – Marker“ hat eine eigene Kraft. Und diese Transponierbarkeit der Musik hat offenbar damit zu tun, dass sie von vornherein auch wie ein Spray in die Luft entsandt werden kann. Und unabhängig vom Himmelsstrich funktioniert das offenbar überall. SM: Möbel-tauglich…Übrigens, dieser „Transfer“ von Atmosphäre, in diesem Fall von exotischem „Spray“ – dafür gibt es ein schönes Beispiel in der französischen Tradition. Und zwar bei dem Komponisten, der die klanginnovativen, konzeptionellen Elemente Saties in Werk-Komplexe gegossen hat: Claude Debussy. Das entsprechende Stück heisst Pagodes aus dem Jahr 1903. Die Atmosphäre ist die Klangwelt javanischer Gamelan Orchester. Da gibt es diese tiefen Gongs, die immer durchklingen. Es ist eine durch und durch klangräumliche Musik. Ein exotisches Raumangebot für Heimatfindung. So wie die Palmen oder die exotische Architektur… PS: Aber es ist sehr wichtig zu wissen, dass der Exotismus oder Funktionalismus beide dieselbe Passion reflektieren, dass nämlich Heimat disponibel geworden ist, dass wir neonomadische Atmosphärenpluralisten werden und daher mit einer einzelnen Heimat nicht mehr durchkommen. Dass man auch die Dummheit, die Regression wechseln muss, selbst die Elementarfunktionen werden pluralisiert. Das ist ein Teil der Moderne. Das heisst…es ist ja nicht so, dass Manager sich nicht entspannen. Und dass nicht ein Manager auch in der Heimattracht herumlaufen könnte. Aber die Identitätsfindung kann nicht mehr auf diesem Weg geschehen. Wir haben über diese agrarromantische Dimension des Heimatproblems heute noch gar nichts gesagt. Das gehört zu den grössten Vorzügen unseres Gesprächs, glaube ich… Siegfried Mauser spielt abschliessend Debussys „Pagodes“ auf dem Klavier.