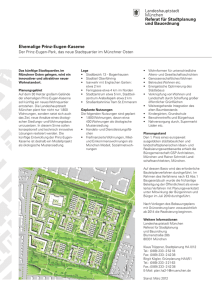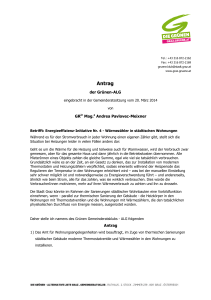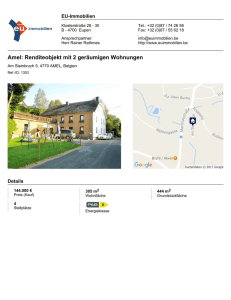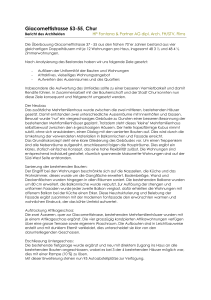Ausgabe 4/2014
Werbung

RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:35 Seite 1 werte entwickeln 04.2014 Das Fachmagazin für die Wohnungswirtschaft Der Druck steigt o-ton Sozialwohnungsbau löst keine Wohnungsknappheit . fallbeispiel Energetischer Selbstversorger . technik Die sechs Kriterien der WDVS-Wahl . weltweit Wohnturm 2.0 RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:35 Seite 2 Angeleh fokussiert 02 RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:36 Seite 3 * Als „Hamburger Perle“ wurden die 92 neuen Eigentumswohnungen am Grindelberg 59–69, im Stadtteil Harvestehude, erfolgreich vermarktet. Tatsächlich wirkt das 8-geschossige Gebäude an der Hauptstraße hell und freundlich und doch nicht wie ein typischer schlichter Neubau. „Hier haben wir uns mit der Gliederung an die Gründerzeitbebauung angelehnt, wie sie im sogenannten ‚weißen Hamburg‘ typisch ist“, erläutert Stefan Fleischhaker, Büroleiter bei Schenk+Waiblinger Architekten. Das ist nicht nur an den in der Stadt häufig zu findenden mehrstöckigen Fenstererkern zu erkennen, an die hier sogar noch seitlich Balkone angesetzt wurden, sondern auch an der Gliederung der Putzfassade durch horizontale Bänder. Den Sockel des Hauses gestalteten die Architekten mit Natursteinplatten, die zum Straßenraum hin robuster sind. Das Staffelgeschoss ist zudem in einem dunkleren Farbton gehalten, sodass daraus eine klassische Dreiteilung der Fassade entsteht. Zudem wurde auf dem Grundstück auch noch ein Hinterhaus mit drei Maisonette-Wohnungen errichtet, das durch zwei Toreinfahrten zugänglich ist. Die Bebauung auf dem 3.400 Quadratmeter großen Grundstück, auf dem zuvor ein Autohaus und andere Gewerbebauten standen, sei erheblich verdichtet worden, sagt Fleischhaker. Im Erdgeschoss sind aufgrund der zentralen Lage vier neue Gewerbeflächen geschaffen worden. Die jeweils obersten der zwei bis fünf Zimmer umfassenden Wohnungen verfügen über Dachterrassen mit Blick über die Stadt. Bauherr: HOCHTIEF Solutions, Hamburg Standort: Grindelberg 59–69, Hamburg Architekt: Schenk+Waiblinger Architekten, Hamburg Sto-Leistungen: Fassadendämmsystem (StoTherm Vario) Fachhandwerker: Kurt Glöckler GmbH, Oberthulba Bildquelle: Christoph Gebler, Hamburg * ehnt fokussiert 03 RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:36 Seite 4 inhalt 18 06 06 20 schwerpunkt Wen es gegenwärtig in eine der deutschen Metropolen zieht, der hat es mitunter schwer, eine Bleibe zu finden. Das trifft zumindest auf diejenigen zu, die aufgrund ihrer Einkommenssituation dafür nur ein vergleichsweise kleines Budget zur Verfügung haben. Die Rufe nach einer neuen Wohnungspolitik werden deshalb immer lauter. Brauchen wir ein Mehr an sozialem Wohnraum? Die Meinungen gehen auseinander. 11 o-ton „Der Wohnungsmarkt kann nicht alle sozialen Probleme lösen“, sagt Dr. Reiner Braun, Vorstand der empirica AG. Gleichwohl sei es „ein Skandal“, dass die Bundesregierung die Erhöhung des Wohngelds vertagt habe. 14 fallbeispiel Der Münsteraner Architekt Jörg Petzold hatte den Ansporn, Gutes noch besser zu machen. Und weil er dafür keinen Mitstreiter fand, hat er sich im Alleingang an die Arbeit gemacht. Das Ergebnis: die erste und größte Klimaschutzsiedlung Europas, die ihren gesamten Energiebedarf durch die Sonne bezieht. 18 immobilienporträts Karl-Tauchnitz-Straße/Wächterstraße, Leipzig: Bronze, Silber und Gold sind sehr begehrt Königsberger Straße, Schleswig: Sonnenhäuser mit System 20 gestaltung „Neue Gebäude können als Stadtbausteine einem Umfeld neue Impulse geben und ein Quartier aufwerten“, sagen die Freiburger Architekten Joachim Franz und Heinz Geyer. Am Stadtwald in Offenburg gibt es ein Beispiel der GEMIBAU, das aufzeigt, wie man Ergänzungsbebauung intelligent und im Interesse der Bewohner umsetzen kann. 23 technik Jedes Gebäude ist anders. Deshalb werden je nach Lage und bauspezifischen Besonderheiten unterschiedliche Anforderungen an eine Dämmung gestellt. Die gute Nachricht: Inzwischen ist die Angebotsbreite bei Dämmsystemen derart ausdifferenziert, dass es für jeden Fall das passende System gibt. Man braucht nur die sechs entscheidenden Kriterien zu kennen, um die richtige Wahl treffen zu können. 26 weltweit Auch mehr als 40 Jahre alte Hochhäuser lassen sich zukunftsfähig trimmen. Das spanische Architektürbüro Amajic Arquitectos hat in San Sebastián ein Exempel statuiert. 04 14 impressum Herausgeber Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 DE-79780 Stühlingen T 07744 57-0 F 07744 57-2178 [email protected] www.sto.de Redaktion Sabine Börchers Markus Gerharz Christian Hunziker Jörg Klaus Alexandra May Till Stahlbusch Franziska Trenkle Verlag Alexandra May Investor + Public Relations Strohschnitterweg 1f DE-65203 Wiesbaden www.alexandra-may.com Diese Veröffentlichung sowie alle in ihr enthaltenen Artikel und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Herausgeberin, Redaktion oder Verlag übernehmen keine Verantwortung für unverlangt eingesandte Manuskripte oder Illustrationen. Printed in Germany 26 RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:36 Seite 5 editorial Während im Jahr 2000 ein Liter Diesel im Schnitt noch 81 Cent gekostet hat, wurden 2013 an den deutschen Tankstellen durchschnittlich 1,42 Euro je Liter aufgerufen. Das entspricht einer Preissteigerung um mehr als 75 Prozent. Gleichwohl gibt es keine Demonstrationen, die „Mobilität muss bezahlbar bleiben!“ oder aber „Senkt die Spritpreise!“ fordern. Vielmehr entwickelt jeder seine eigene Strategie, seine Mobilitätskosten nicht ausufern zu lassen. Die älteren Semester scheinen die Benzinpreise jedenfalls nicht abzuschrecken: Mit zunehmendem Alter zieht es die Menschen nämlich wieder raus aus der Stadt. Stadt- und Landflucht finden somit gleichermaßen statt. „Und wer fordert, dass Mobilität bezahlbar bleibt?“ Wer die Schlagzeilen der letzten Wochen und Monate aufmerksam verfolgt hat, dem könnte beinahe schon angst und bange werden. Auf der einen Seite werden Horrorentwicklungsszenarien von Regionen beschrieben, aus denen es die Menschen wegzieht. Auf der anderen Seite ist von exorbitanten Preissteigerungen bei den Wohnungsmieten und einer drohenden Wohnungsknappheit die Rede – vor allem in den Städten, die Menschen anziehen. Doch ist dem tatsächlich so? Verschiedene Untersuchungen, die sich mit den Zu- beziehungsweise Abwanderungsströmen näher beschäftigt haben, zeichnen ein differenzierteres Bild, als es uns die plakativen Berichte glaubhaft machen wollen. Zunächst mag es wenig überraschen, dass Städte insbesondere für junge Menschen eine Sogwirkung entfalten. Das liegt zweifelsohne an den Ausbildungs- und Arbeitsplatzangeboten. Es kommt jedoch noch ein ganz wesentliches Kriterium hinzu: Sie wollen auch ihre Mobilitätskosten reduzieren! Jeder Besitzer eines Autos weiß, dass insbesondere die Kosten für die Unterhaltung eines Pkws nicht zuletzt aufgrund der stark gestiegenen Rohstoffpreise in den vergangenen Jahren enorm in die Höhe geklettert sind. Preisentwicklungen haben immer eine Signalwirkung. Bezogen auf die Immobilienmärkte bedeutet das: Dort, wo sie steigen, lohnt es sich mitunter, zu investieren. Die Botschaft, die sich daraus insbesondere für die Ballungsräume ableiten lässt, lautet deshalb: „Baut, baut, baut!“ Ob der benötigte Wohnraum zwingend im geförderten Segment entstehen muss, wird auch innerhalb der Wohnungswirtschaft kontrovers diskutiert. Viele Unternehmen haben ihre Lehren aus den Fehlallokationen der Vergangenheit gezogen und setzen inzwischen effizientere Instrumente ein, so das Ergebnis der Recherchen zum Schwerpunktthema der vorliegenden Ausgabe. Ein spannendes Immobilienjahr neigt sich dem Ende zu und ich bin sicher, dass das kommende Jahr für uns alle nicht minder interessant sein wird. Bis dahin wünsche ich Ihnen jedoch erst einmal viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe und eine schöne Adventszeit. Kommen Sie gesund ins neue Jahr! Herzlichst Ihr Michael Keller Leiter Inlandsgeschäfte / Generalbevollmächtigter Sto SE & Co. KGaA editorial 05 RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:36 Seite 6 schwerpunkt Der Druck steigt Bildquelle: GEWOBA Bildquelle: BMUB Bildquelle: .artundwork designbüro Die Mieten in den deutschen Ballungsräumen steigen und die Konkurrenz um günstige Wohnungen ist vielerorts groß. Als Reaktion auf diese Entwicklung intensivieren Bundesländer und Kommunen den Bau von Sozialwohnungen. Doch ist das Instrumentarium der Wohnraumförderung überhaupt geeignet, das Problem des knappen und teuren Wohnraums zu lösen? Ist möglicherweise die Subjektförderung die bessere Alternative? Und welche Hebel haben Kommunen und Länder eigentlich sonst noch in der Hand, um den stetigen Anstieg der Wohnungspreise in Metropolregionen zu bremsen? Gunther Adler, Staatssekretär Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Peter Stubbe, Vorstandsvorsitzender GEWOBA Soziale Wohnraumförderung Auch kleine Bauvorhaben können eine große Bedeutung haben. Gerade einmal 32 Wohnungen entstehen derzeit in der Ewaldstraße im Berliner Ortsteil Altglienicke – doch diese 32 Einheiten sind die ersten öffentlich geförderten Wohnungen, die seit 13 Jahren in der Hauptstadt errichtet werden. Damit stehen sie für einen Paradigmenwechsel in der Wohnungspolitik. Jahrelang verzichtete der Berliner Senat unter Verweis auf den entspannten Wohnungsmarkt darauf, den Bau von Wohnungen zu verbilligen. 2014 aber gab er 320 Millionen Euro frei, mit denen in den nächsten fünf Jahren die Errichtung von jährlich tausend Wohnungen mit einer Anfangsmiete von 6 bis 7,50 Euro pro Quadratmeter gefördert werden soll. Berlin brauche Neubau für Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen, sagt Christoph Beck, Vorstand der landeseigenen degewo, die das Bauvorhaben in Altglienicke realisiert. „Durch den Einsatz der Fördermittel sind die Wohnungen auch für diese Menschen bezahlbar.“ So wie der Berliner Senat und die degewo argumentieren immer mehr Politiker, Wohnungswirtschaftler und Fachleute: Deutschland brauche mehr sozialen Wohnungsbau, heißt es fast unisono. „Wir 06 Die klassische Wohnungsbauförderung in der Bundesrepublik basiert auf dem Ersten und Zweiten Wohnungsbaugesetz aus den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts. Ziel war es damals, breite Schichten der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum zu versorgen. Dies änderte sich mit Inkrafttreten des Wohnraumförderungsgesetzes Anfang 2002: Dieses definierte als Zielgruppe der sozialen Wohnraumförderung Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind. Mit der Föderalismusreform 2006 ging die Zuständigkeit für die soziale Wohnraumförderung vom Bund auf die Länder über. Für die Erfüllung dieser Aufgabe erhalten die Länder vom Bund sogenannte Kompensationsmittel. Diese betragen bis 2019 jährlich 518,2 Millionen Euro. Die Länder sind jedoch bisher nicht verpflichtet, diese Mittel für die Förderung des Neubaus von Mietwohnungen einzusetzen. Mit öffentlichen Mitteln gefördert werden können neben dem Bau von Mietwohnungen auch die Modernisierung von Bestandswohnungen und die Bildung von selbst genutztem Wohneigentum. RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:36 Seite 7 schwerpunkt müssen den sozialen Wohnungsbau wiederbeleben“, betont Gunther Adler, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. „Der Bau neuer Sozialmietwohnungen muss Vorrang vor Eigentumsmaßnahmen haben“, bekräftigt Dr. FranzGeorg Rips, Präsident des Deutschen Mieterbundes. Und Gerhard A. Burkhardt, ehemaliger Präsident des vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen, schlägt den Bogen zur Mietpreisbremse: „Wer bezahlbaren Wohnraum verspricht, muss auch etwas für den sozialen Wohnungsbau tun, das heißt ihn stärker fördern.“ Die Forderung nach mehr Sozialwohnungen gewinnt ihre Brisanz daraus, dass die Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen seit Jahren rückläufig ist. Eine aktuelle Statistik existiert zwar nicht, doch die Tendenz ist eindeutig: Es gibt immer weniger Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindung. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadtund Raumforschung (BBSR) zählte im Jahr 2012 bundesweit 1,54 Millionen gebundene Mietwohnungen, davon 1,18 Millionen in den alten Ländern und 355.000 in den neuen Ländern (einschließlich Berlins). 2002 waren es 2,57 Millionen gewesen – innerhalb von zehn Jahren sank der Bestand also um nicht weniger als 40 Prozent. Diese Tendenz bestätigt der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen: Während seine Mitgliedsunternehmen 2002 noch fast 1,9 Millionen Wohnungen mit Mietpreisoder Belegungsbindung verwaltet hatten, waren es 2013 nicht einmal mehr halb so viele. „Jedes Jahr fallen wesentlich mehr Sozialwohnungen aus der Bindung, als neu gebaut werden“, klagt Xaver Kroner, Verbandsdirektor des Verbandes bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW Bayern). Das liegt am Prinzip der Wohnungsbauförderung: Die öffentliche Hand subventioniert – in der Regel über vergünstigte Darlehen, manchmal auch über Zuschüsse – den Bau von Wohnungen. Im Gegenzug verpflichtet sich der Eigentümer, diese Wohnungen zu vom Subventionsgeber festgelegten Mieten an bestimmte Einkommensgruppen zu vergeben. Wenn das Darlehen getilgt ist, erlischt die Bindung – und das ist jetzt bei vielen Sozialwohnungen der Fall. Länder und Kommunen werden aktiv Doch dem rückläufigen Trend stemmen sich nicht nur Berlin, sondern auch andere Bundesländer entgegen. Zum Beispiel Nordrhein-Westfalen: Das rot-grüne Kabinett in Düsseldorf stellt für die Jahre 2014 bis 2017 jährlich 800 Millionen Euro für die soziale Wohnraumförderung zur Verfügung. Für die Darlehen der landeseigenen NRW.Bank werden Zinsen zwischen null und 0,5 Prozent fällig; in bestimmten Fällen (zum Beispiel bei energetischer Sanierung und der Aufbereitung von Brachflächen) lockt zusätzlich ein Tilgungsnachlass. „Wir wollen auf Dauer den Wohnungsmarkt ankurbeln“, sagt dazu Wohnungsbauminister Michael Groschek (SPD). „Wir lassen die Mieter nicht im Regen stehen, das Land ist ein verlässlicher Partner der Wohnungswirtschaft.“ Wichtig für die Wohnungswirtschaft ist jedoch nicht nur die Höhe der Förderung, sondern auch deren Ausgestaltung. Zu den Ländern, die ihre Förderrichtlinien überarbeitet haben, gehört Niedersachsen. Das im April 2014 in Kraft getretene Wohnraumförderprogramm Bildquelle: Nassauische Heimstätte Immer weniger Sozialwohnungen Das Apfel-Carré in Frankfurt-Preungesheim umfasst unterschiedlich geförderte Wohnungen für verschiedene Einkommensschichten. Ziel ist es, eine sozial gemischte Wohnanlage zu schaffen. Bestand an gebundenen Wohnungen Deutschland neue Länder alte Länder 2002 2.570.605 627.950 1.942.655 2012 1.538.742 355.409 1.183.333 Quelle: Zahlen des BBSR zur Zahl der Sozialwohnungen sieht eine Förderung über eine Laufzeit von 20 Jahren in Form zinsloser Darlehen vor. Dabei berücksichtigt das Programm die jeweiligen regionalen Bedürfnisse: Die Höhe der Fördermittel bemisst sich an den tatsächlichen Baukosten und an den Einkommen der Wohnraumberechtigten. Doch nicht nur Länder, sondern auch Kommunen bringen sich in die Förderung mit ein – zumal dann, wenn ihre Einwohnerzahl steigt. So haben zum Beispiel Köln und Münster eine Zielvereinbarung mit dem Land Nordrhein-Westfalen unterzeichnet, mit der sich die beiden Kommunen verpflichten, jährlich 1.000 beziehungsweise 300 preisgünstige Mietwohnungen zu errichten. Dafür erhalten sie vom Land ein jährliches Globalbudget in Höhe von 75 Millionen Euro (Köln) beziehungsweise 25 Millionen Euro (Münster). „Es gibt zielführendere Instrumente“ In die allgemeine Begeisterung über die Renaissance des sozialen Wohnungsbaus mischen sich jedoch auch kritische Stimmen. Dr. Reiner Braun, Vorstand des Beratungsunternehmens empirica 07 RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:36 Seite 8 Bildquelle: SAGA GWG schwerpunkt Die SAGA GWG in Hamburg baut derzeit Hunderte von öffentlich geförderten Wohnungen, unter anderem im Kesselflickerweg in Langenhorn … (siehe o-ton), ist nicht der einzige Experte, der die Wirksamkeit der sozialen Wohnraumförderung grundsätzlich infrage stellt. „Um zu garantieren, dass jeder eine Wohnung findet, gibt es zielführendere Instrumente als den sozialen Wohnungsbau“, sagt beispielsweise Professor Dr. Michael Voigtländer, Leiter des Kompetenzfelds Immobilienökonomik beim Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW). In der Tat finden sich Argumente, die am Erfolg des sozialen Wohnungsbaus zweifeln lassen. Zum Beispiel in Berlin: Dort erzielten zu Mauerzeiten private Anleger, die ihr Geld in geschlossene Immobilienfonds mit Sozialwohnungen steckten, hohe Renditen. „Bei der Objektförderung besteht immer die Gefahr, dass die Förderung in falsche Kanäle fließt“, stellt Andreas Schulten fest, Vorstand des Analysehauses bulwiengesa. Günstiger Wohnraum entstand an der Spree dabei nur bedingt: Nach Angaben des Verbandes BerlinBrandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) betrug die Durchschnittsmiete öffentlich geförderter Wohnungen Ende 2012 in 08 Berlin 5,47 Euro pro Quadratmeter – sieben Prozent mehr, als frei finanzierte Mietwohnungen der BBU-Mitgliedsunternehmen im Durchschnitt kosteten. Ein zweites Argument: Der soziale Wohnungsbau ist den Kritikern zufolge auch deshalb nicht zielgenau, weil in vielen Sozialwohnungen Menschen wohnen, die gar keinen Anspruch auf eine subventionierte Wohnung mehr haben. Genaue Angaben zur Fehlbelegungsquote gibt es laut empirica-Vorstand Braun zwar nicht. Er schätzt sie aber auf 30 bis 50 Prozent. Dies erklärt Braun damit, dass im Lauf der Zeit das Einkommen der Bewohner gestiegen ist oder die Kinder ausgezogen sind. Hinzu kommt – immer laut den Kritikern –, dass der soziale Wohnungsbau dem Streben nach sozialer Durchmischung widerspricht, weil sich die Bedürftigen in bestimmten Häusern und Stadtteilen konzentrieren. Besser als die Objekt- sei deshalb die Subjektförderung. Gemeint ist damit das Wohngeld, also eine staatliche Unterstützung, auf die Haushalte Anrecht haben, die zwar ein geringes RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:36 Seite 9 schwerpunkt … und im Stadtparkquartier in Barmbek-Nord. Einkommen beziehen, aber nicht von Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe leben. Das Wohngeld, argumentiert Michael Voigtländer vom IW Köln, habe den Vorteil, dass die Empfänger sich ihre Wohnung überall suchen könnten. Die Bedeutung dieser Unterstützungsleistung hat im Übrigen auch die Bundesregierung erkannt: Sie will das Wohngeld 2015 erhöhen und durch die 2011 gestrichene Heizkostenkomponente ergänzen. Soziale Durchmischung angestrebt Dass der soziale Wohnungsbau klassischer Prägung kein Allheilmittel ist, bleibt Kommunen und Wohnungsunternehmen nicht verborgen. Um beispielsweise der sozialen Segregation entgegenzuwirken, setzen sie auf den Ankauf von Belegungsrechten und das Instrument der mittelbaren Belegung. „Die mittelbare Belegung gibt uns bei der Vermietung der Wohnungen mehr Flexibilität, ohne dass wir das Ziel, geförderten Wohnraum zu schaffen, vernachlässigen müssen“, erläutert Jens Duffner, Leiter Unternehmenskommunikation der Nassauischen Heimstätte in Frankfurt am Main. „Sie trägt zu einer besseren ökonomischen und sozialen Mischung der Mieterschaft und damit zu stabileren Nachbarschaften bei.“ Umgesetzt wird diese mittelbare Belegung zum Beispiel im ApfelCarré, einer 2014 fertiggestellten Wohnanlage in Frankfurt-Preungesheim. Dort funktioniert das Instrument wie folgt: 40 Wohnungen werden zwar mit Mitteln für den sozialen Wohnungsbau gefördert, dürfen aber frei zur ortsüblichen Miete vermietet werden. Zum Ausgleich stellt die Nassauische Heimstätte Sozialwohnungen in anderen Mietshäusern zur Verfügung, in die keine öffentlichen Mittel geflossen sind. Innovative Ansätze verfolgt auch die städtische GEWOBA AG in Bremen. Ihr Programm „ungewöhnlich wohnen“ verfolgt das Ziel, durch standardisierte Planungs- und Bauprozesse und den Einsatz vorgefertigter Bauteile die Kosten beim Bau geförderter Wohnungen zu senken. „Deutschland lernt den sozialen Wohnungsbau wieder 09 RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:36 Seite 10 Bildquelle: GEWOBA schwerpunkt Innovative Wege im sozialen Wohnungsbau beschreitet die Bremer GEWOBA mit ihrem Projekt „Neue Perspektiven in Huchting“. Die Visualisierung zeigt das Gebäudepaar, das zum Programm „ungewöhnlich wohnen“ gehört. Bei der Grundsteinlegung waren unter anderem GEWOBA-Vorstandsvorsitzender Peter Stubbe (Mitte), GdW-Präsident Axel Gedaschko (2. v. l.) und Bausenator Dr. Joachim Lohse (2. v. r.) dabei. neu“, sagt dazu GEWOBA-Vorstandsvorsitzender Peter Stubbe. „Bezahlbar, energieeffizient und generationengerecht soll er sein.“ Angebote für mittlere Einkommensschichten Doch all das reicht nicht, findet bulwiengesa-Vorstand Andreas Schulten: Er kritisiert die Fokussierung der sozialen Wohnraumförderung auf Menschen mit sehr wenig Geld. Seiner Ansicht nach braucht es günstige Neubauwohnungen auch für Haushalte, die ordentlich verdienen, in den Metropolen aber trotzdem nur schwer eine für sie bezahlbare Wohnung finden. „Wir müssen den sozialen Wohnungsbau breiter anlegen als bisher“, fordert Schulten. Genau dies tun jetzt schon einige Länder und Kommunen, indem sie Förderprogramme entwickeln, die Beziehern von mittleren Einkommen zugänglich sind. Das zeigt sich ebenfalls beim Frankfurter ApfelCarré: Ein Teil der dortigen Wohnungen wird im Frankfurter Mittelstandsprogramm gefördert, woraus Mieten von bis zu 8,37 Euro pro Quadratmeter resultieren – deutlich mehr als bei der klassischen Förderung, bei der die Nassauische Heimstätte lediglich fünf Euro verlangen darf. Um Menschen, die keine Spitzenverdiener sind, die Chance zu geben, eine Wohnung in der Stadt zu finden, hat auch die – bekanntlich besonders teure – Stadt München eine Reihe von Instrumenten entwickelt. Dazu gehört neu der konzeptionelle Mietwohnungsbau. Dabei handelt es sich nicht um ein Förderprogramm, sondern um den Versuch, durch die Vergabe von städtischen Grundstücken zum Verkehrswert (also nicht zum Höchstgebot) den Bau von relativ günstigen Wohnungen zu ermöglichen. Beteiligt an diesem Modellvorhaben ist die städtische GEWOFAG, die im Rahmen des konzeptionellen Mietwohnungsbaus drei Grundstücke übernommen hat. „Wir erwarten uns davon die Möglichkeit, Wohnungen für Menschen mit unterschiedlichen Einkommen zu bauen und so eine lebendige Mischung in einem Wohnviertel zu erreichen“, sagt GEWOFAG-Sprecherin Sabine Sommer. Grundstücksvergabe als Hebel Auch andere Kommunen knüpfen den vergünstigten Verkauf von Baugrundstücken an Vorgaben bezüglich der Miethöhe und die Belegung der geplanten Wohnungen. Selbst bei privaten Liegenschaften mehren 10 sich die Versuche, im Rahmen allgemeiner Verpflichtungen oder städtebaulicher Verträge Einfluss auf die Zahl günstiger Wohnungen zu nehmen. In Köln etwa gilt seit Kurzem das Kooperative Baulandmodell: Sobald ein Vorhaben mindestens 25 Wohnungen vorsieht, muss der Anteil öffentlich geförderter Einheiten mindestens 30 Prozent betragen. „Dieses Modell greift nicht nur bei der Schaffung neuen Baulands, sondern auch bei der Umnutzung von bereits genutztem Bauland“, erläutert der Kölner Baudezernent Franz-Josef Höing. Vorbild dieser Modelle ist die Sozialgerechte Bodennutzung (SoBoN), die in München seit zwanzig Jahren Investoren bei der Schaffung von neuem Baurecht dazu zwingt, auch geförderte Wohnungen zu errichten. Oft kooperieren dabei private Bauträger mit kommunalen Wohnungsbaugesellschaften – nicht nur in München, sondern auch in Hamburg, wo der städtische Konzern SAGA GWG mehrere solcher Kooperationen eingegangen ist. „In Hamburg erhalten Projektentwickler bei der Realisierung neuer Projekte von den Bezirken die Auflage, ein Drittel öffentlich geförderten Wohnungsbau zu integrieren“, erläutert SAGA-GWG-Pressesprecher Dr. Michael Ahrens. Projektentwickler aber wollten in aller Regel entweder Eigentumswohnungen oder aber frei finanzierte Wohnungen errichten und hätten deshalb „ein hohes Interesse daran, einen Partner mit aufzunehmen, der den öffentlich geförderten Wohnungsbauanteil übernimmt“. SAGA GWG realisiert derzeit nach diesem Modell den Bau von 570 Wohnungen. Grundsätzlich allerdings ist der soziale Wohnungsbau keineswegs städtischen Gesellschaften und Genossenschaften vorbehalten, sondern steht auch privaten Investoren offen. Zu den wenigen privaten Gesellschaften, die sich tatsächlich in diesem Segment betätigen, gehört das in Greven (Nordrhein-Westfalen) ansässige Unternehmen Sahle Wohnen. Schon in den Siebzigerjahren habe Unternehmensgründer Paul Sahle erkannt, dass es in diesem Bereich „eine gesicherte Finanzierung, eine feste Rendite und eine große Vermietungssicherheit“ gebe, sagt Unternehmenssprecherin Jutta Morrien. Bis heute sei der soziale Wohnungsbau ein wichtiges Geschäftsfeld geblieben, da Sahle Wohnen auf ein langfristiges Engagement setze. „Der Philosophie“, so Morrien, „die gesellschaftliche Bedeutung des Wohnens zu missachten und Wohnraum einzig auf die Funktion als Kapitalanlage zu reduzieren, erteilt das Unternehmen eine klare Absage.“ RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:36 Seite 11 Bildquelle: GEWOFAG/Roland Weegen o-ton In der Orffstraße in München-Neuhausen hat die GEWOFAG 29 Wohnungen errichtet, die nach dem Kommunalen Wohnungsbauprogramm B gefördert werden. Bildquelle: empirica AG „Man kann auf den Markt vertrauen“ In der politischen Debatte herrscht weitgehend Einigkeit, dass Deutschland mehr günstige Wohnungen braucht. Doch Dr. Reiner Braun, Vorstand des Berliner Beratungsunternehmens empirica AG, kritisiert die klassische Wohnungsbauförderung. Stattdessen fordert er eine Intensivierung des Wohnungsbaus im gehobenen Segment und die Einführung eines Umzugswohngelds. 11 RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:36 Seite 12 Bildquelle: degewo o-ton Kleines Bauprojekt mit großer Wirkung: In der Ewaldstraße in Berlin-Altglienicke entstehen die seit 13 Jahren ersten öffentlich geförderten Wohnungen Berlins. Herr Dr. Braun, Sie beurteilen die Wirksamkeit von öffentlich geförderten Wohnungen skeptisch. Warum? Dr. Reiner Braun: Das grundsätzliche Problem von klassischen Sozialwohnungen ist, dass die Miete weitgehend unabhängig von der Qualität der Wohnungen ist. Vor allem die Lage geht nicht in die Miete ein: Der Mieter der einen Sozialwohnung schaut auf einen Park, der Mieter einer anderen, identischen Wohnung blickt auf eine Fabrik – aber beide zahlen gleich viel Miete. Außerdem löst der Bau von Sozialwohnungen das aktuelle Problem der Wohnungsknappheit nicht. In Berlin und Hamburg haben mehr als die Hälfte aller Haushalte Anrecht auf eine Sozialwohnung. So viele Sozialwohnungen können unmöglich gebaut werden. Wenn aber der eine gering verdienende Haushalt eine Sozialwohnung bekommt und der andere nicht, ist das ungerecht. Ist die Subjektförderung besser als die Objektförderung? Die Subjektförderung hat zwei große Vorteile. Zum einen kriegen Haushalte, die gleich bedürftig sind, die gleiche Transferleistung in Form von Wohngeld. Zum anderen trägt die Subjektförderung zum Erhalt der sozialen Mischung bei. Wenn Geringverdiener über Sozialwohnungen versorgt werden, konzentrieren sie sich zwangsweise in bestimmten Quartieren, die dann schnell stigmatisiert sind. Wer hingegen Wohngeld bezieht, kann sich überall eine Wohnung suchen. Damit ist die soziale Durchmischung leichter zu realisieren. Besteht beim Wohngeld nicht die Gefahr, dass der Vermieter die Miete um diesen Betrag erhöht? 12 Nein. Der Vermieter weiß gar nicht, dass der Mieter Wohngeld bezieht. Das ist anders als bei den Kosten der Unterkunft für Arbeitslosengeld-II-Empfänger. Dort beobachten wir in der Tat, dass die Wohnungen oft genauso viel kosten wie der zulässige Höchstbetrag. Die Anzahl der Haushalte, die Wohngeld in Anspruch nehmen, ist in den letzten Jahren gesunken. Müsste die öffentliche Hand nicht viel mehr Geld in die Hand nehmen? Es ist wirklich dringend notwendig, das Wohngeld zu erhöhen. Die letzte Wohngelderhöhung war 2009, also deutlich vor dem massiven Mietanstieg der letzten Jahre. Wir von empirica sind eigentlich immer vorsichtig, wenn es um das Verteilen von Subventionen geht, aber das Wohngeld muss unbedingt erhöht werden. Es ist ein Skandal, dass die von der Bundesregierung geplante Erhöhung auf 2015 verschoben wurde. 2013 haben Sie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung die Studie „Wohnungsangebot für arme Familien in Großstädten“ vorgelegt. Darin haben Sie aufgezeigt, wie schwer es Familien mit geringem Einkommen fällt, eine günstige Wohnung zu finden. Reicht die Erhöhung des Wohngelds aus, um dieser Gruppe zu helfen? Nein, es braucht weitere Maßnahmen, insbesondere ein Umzugswohngeld. Das Problem ist, dass manche Haushalte, die keinen Anspruch auf Wohngeld haben, nach Abzug der Warmmiete weniger Geld zur Verfügung haben als Haushalte mit niedrigerem Einkommen, die Transferleistungen beziehen. Für diese Gruppe – insbesondere RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:36 Seite 13 o-ton Familien in beengten Wohnverhältnissen – schlagen wir ein solches Umzugswohngeld vor. Denn wenn diese Haushalte umziehen, müssen sie in der jetzigen Marktphase selbst für eine gleich kleine neue Wohnung deutlich mehr zahlen als für die alte. Dass die Zahl der Sozialwohnungen drastisch sinkt, ist in Ihren Augen kein Problem? Es ist auf jeden Fall nicht das Kernproblem. Wichtig für die Versorgung der Einkommensschwächeren ist, dass es genügend preiswerte Wohnungen gibt. Das müssen aber nicht notwendigerweise Sozialwohnungen sein. Wir sollten nicht vergessen, dass manche Sozialwohnungen teurer sind als frei finanzierte Wohnungen. Das bedeutet: Es braucht neue Wohnungen, aber nicht neue Sozialwohnungen? Genau. Das aktuelle Problem lösen wir nur, indem wir ganz viele Wohnungen bauen, und zwar im oberen und mittleren Segment. Dann greift der Sickereffekt: In die Neubauten ziehen Haushalte mit überdurchschnittlichem Einkommen, wodurch Wohnungen für Haushalte mit geringerem Einkommen frei werden. Bis Haushalte mit sehr niedrigem Einkommen von dieser Entwicklung profitieren, dauert es in einem angespannten Markt allerdings eine Weile. Genau deshalb brauchen wir ein höheres Wohngeld und ein zusätzliches Umzugswohngeld. Und noch eine grundsätzliche Bemerkung: Das Hauptproblem ist die Verfügbarkeit von Bauland. Viele baureife Grundstücke werden gehortet, weil die Eigentümer auf weiter steigende Preise spekulieren. Eine Grundsteuer, die den Wert des Bodens und nicht den Wert der darauf stehenden Immobilie besteuert, würde Bewegung in den Markt bringen. Kritiker beklagen, dass durch das hohe Mietenniveau in den Innenstädten Geringverdiener an den Stadtrand verdrängt werden. Ist das tatsächlich so? Geringverdiener finden nun mal hauptsächlich in bestimmten Stadtteilen außerhalb der Innenstadt passende Wohnungen. In München ist es schon lange normal, dass die Krankenschwester eine Stunde mit der S-Bahn zur Arbeit fahren muss. In die Innenstadt ziehen vor allem finanzkräftige Zuwanderer. Diese Entwicklung lässt sich nicht ändern. Auch nicht durch den Bau von öffentlich geförderten Wohnungen? Ich sage es ganz klar: Günstige Wohnungen zu bauen ist zum einen nicht nötig und zum anderen langfristig töricht. Es ist nicht nötig, weil sich der Markt entspannt, wenn im mittleren und oberen Segment gebaut wird. Und es ist töricht, weil die Nachfrage nach Wohnungen in Deutschland langfristig sinkt. Einfache Wohnungen haben wir zur Genüge. Weitere einfache Wohnungen zu bauen ist vor dem demografischen Hintergrund nicht sinnvoll. Denn diese Wohnungen werden bei einer Entspannung des Marktes als Erste leer stehen. Immer mehr Kommunen setzen auf die vergünstigte Abgabe von Grundstücken, sofern der Investor darauf preiswerte Wohnungen baut. Halten Sie das für zielführend? München setzt mit seiner Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) ja schon lange auf dieses Modell und lobt sich selbst für die dabei erzielten Erfolge. Ich frage mich nur, warum München dann bundesweit die mit weitem Abstand höchsten Mieten hat. Das Fördersystem in München ist sehr fein ziseliert und im Ergebnis ist es völlig unklar, welches der finanzielle Nutzen für die Stadt und für die Mieter ist. Das betrifft auch die Vorgabe, dass ein bestimmter Anteil der Neubauwohnungen dem günstigen Preissegment angehören muss. Der Investor will seine Rendite haben und legt die Kosten in diesem Fall einfach auf die restlichen Wohnungen um, sodass aus diesen Maßnahmen kein positiver Gesamteffekt auf das Mietenniveau resultiert. Hatte der soziale Wohnungsbau wenigstens früher seine Berechtigung? In der Bundesrepublik gab es nach dem Zweiten Weltkrieg eine gewaltige Wohnungsnot, die nach dem Einsatz öffentlicher Mittel verlangte. Heute aber investieren zahlreiche Investoren Geld in Wohnungen. Und die Neubautätigkeit zieht ja auch bereits an. Das beweist: Man kann auf den Markt vertrauen. Herr Dr. Braun, vielen Dank für das Gespräch. Strategien und Instrumente Eine Übersicht über die Instrumente, mit denen deutsche Großstädte den Bau günstiger Mietwohnungen fördern, bietet die Publikation „Kommunale Strategien für die Versorgung einkommensschwächerer und sozial benachteiligter Haushalte“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Sie ist kostenlos zu beziehen unter [email protected]. Um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen, haben wir folgenden Kurzlink für Sie angelegt: http://goo.gl/0EIOXb Wer sich über die unterschiedlichen Ansätze der sozialen Wohnraumförderung in den sieben größten deutschen Städten informieren will, findet eine Zusammenfassung in der Fachstudie „Aktuelle Lösungsansätze für Wohnquartiere in dynamischen Wohnungsmärkten“ des Analysehauses bulwiengesa (Seiten 36–48). Im Internet zu finden unter Kurzlink: http://goo.gl/J5JSN7 Im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg hat das Beratungsunternehmen empirica AG das Gutachten „Wohnsituation der Niedrigeinkommensbezieher in Hamburg“ verfasst. Darin begründet es seine Forderung nach einem Umzugswohngeld. Kurz- und Langfassung stehen auf der Website der empirica AG zur Verfügung: Kurzlink: http://goo.gl/5uKATD 13 RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:36 Seite 14 Bildquelle: Guido Erbring, Köln fallbeispiel „Das Solarhaus“ ist Bestandteil der ersten Klimaschutzsiedlung in Münster. 14 RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:36 Seite 15 fallbeispiel Komplett autark: das Solarhaus In Münster steht die erste Solarsiedlung Europas, die komplett ohne Fremdenergie auskommt. Damit die Bewohner auch im Winter warmes Wasser und warme Füße haben, mussten die Planer technisch und baulich neue Wege gehen. Der eingeschlagene Kurs erwies sich als richtig und gut: Nachrichten über stetig steigende Energiepreise lassen die Bewohner kalt. Die Wohnanlage besteht überwiegend aus dreigeschossigen Gebäuden mit Staffelgeschoss. Die Pkw-Stellplätze sind in einer Tiefgarage untergebracht. 15 RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:36 Seite 16 fallbeispiel Bauherr: Die Solarhaus GmbH, Münster Standort: Dieckmannstraße 41–47, Münster-Gievenbeck Architekt: ajp architekt jörg petzold, Münster Sto-Leistungen: Fassadendämmsystem (StoTherm Classic) Fachhandwerker: Prasse Malerbetrieb GmbH, Rheda-Wiedenbrück Aufgrund der energieeffizienten Bauweise wird für den Heizbedarf und die Warmwasserbereitung keine zusätzliche Energie mehr benötigt. Für das Solarhaus wurde eigens ein 50.000 Liter fassender Vakuumspeicher entwickelt. 87 Prozent. Mehr als diese Zahl braucht Architekt Jörg Petzold eigentlich gar nicht zu sagen, wenn er jemanden für seine Solarsiedlung begeistern möchte. Denn um 87 Prozent ist der Strompreis in Deutschland zwischen den Jahren 2000 und 2013 gestiegen. Kostete eine Kilowattstunde zur Jahrtausendwende noch 15 Cent, schlug sie im vergangenen Jahr mit 28 Cent zu Buche. Beim Öl und Gas sieht es auch nicht viel besser für die Verbraucher aus. Ein Ende? Nicht in Sicht. Für Petzolds Vorzeigeprojekt im Münsteraner Stadtteil Gievenbeck, fünf Kilometer westlich der Innenstadt, sind diese Zahlen die besten 16 Argumente gewesen. Denn die Solarhaussiedlung spart mehr als 80 Prozent der üblicherweise benötigten Energie ein. In einem normalen Einfamilienhaus lassen sich gerade einmal 20 bis 30 Prozent der Energie für Heizung und Warmwasser durch eine Solarthermieanlage decken. Das Projekt mit dem Namen „Das Solarhaus“ besteht aus fünf Gebäudeteilen mit insgesamt 34 Wohneinheiten und 3.100 Quadratmetern Wohnfläche. Damit war es zum Zeitpunkt der Fertigstellung im Sommer 2012 europaweit das größte seiner Art. RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:36 Seite 17 fallbeispiel Unkonventionell und unbeirrt Seine Vorstellung von einem sich energetisch selbstversorgenden Haus Wirklichkeit werden zu lassen, war für Petzold nicht ganz einfach. Mit Bauträgern ließ sich seine Vision nicht umsetzen. „Die sind leider nur schwer zu überzeugen, wenn man mit seinen Plänen von der Norm abweichen möchte“, sagt er. Also blieb ihm nur, selbst ins Risiko zu gehen. Er gründete ein eigenes Unternehmen und machte sich an die Arbeit. Das Solarhaus ist die Weiterentwicklung des Vorgängerprojektes „Das Passivhaus“. Petzold musste für seine Solarsiedlung in der Dieckmannstraße zwei Komponenten zusammenbringen: ein fortschrittliches Energiekonzept und eine hochgedämmte Außenhülle. Ersteres sieht die Nutzung regenerativer Energiequellen vor: in erster Linie Sonne und Erdwärme. Rund 350 Quadratmeter Solarkollektoren auf den Dächern gewinnen den Strom für die aufwändige Anlagentechnik der Häuser. Wichtiges Puzzlestück ist dabei ein Unikat: der Langzeitwärmespeicher. Er fasst 50 Kubikmeter und ist mit einem Durchmesser von 2,50 Metern und einer Höhe von stattlichen 14 Metern einzigartig in Europa. Dass der 15-Tonnen-Koloss in das Gebäude integriert ist, hat einige bizarre Blüten im Genehmigungsverfahren getrieben. Denn obwohl der Speicher ausschließlich mit Wasser gefüllt ist, lag für die Behörde ein Heizraum vor. Und der unterliegt in Deutschland besonderen Brandschutzauflagen. „Aber was soll in dem Raum eigentlich brennen?“, kann sich Petzold nicht verkneifen zu fragen. Die 50 Kubikmeter Wasser sicher nicht. Die Gebäude sind drei- und viergeschossig, teilweise mit Staffelgeschoss. Sie sind komplett barrierefrei und in U-Form angeordnet. An den Eckgebäuden hat Petzold Luftgeschosse vorgesehen, wie er sie nennt. Dort, wo eigentlich das Erdgeschoss liegen würde, hat er einen Freiraum gelassen und die Gebäude um 1,5 Geschosshöhen nach oben versetzt. Die Bauteile wirken so nicht nur weniger massiv, es entstehen Durchblicke und Gemeinschaftsflächen, zum Beispiel für Fahrradstellplätze. Im Innern der Solarsiedlung können sich die Bewohner auf 70 bis 125 Quadratmetern ausleben. Die Wohnungen wurden mit möglichst wenigen tragenden Innenwänden geplant, sodass die Bewohner flexibel ihre eigenen Vorstellungen umsetzen konnten. In Europa ist der Energiespeicher einzigartig Ungewöhnliche Wege ging Petzold auch bei der Versorgung der einzelnen Wohneinheiten. In den einzelnen Zimmern sorgen Fußbodenheizungen für Wärme. Die kommt zu etwa 90 Prozent von den Solarkollektoren, die das Wasser im Vakuumspeicher auf 95 Grad Celsius erhitzen. Der Speicher besteht aus einer Innen- und einer Außenhülle mit 20 Zentimetern Abstand. Der Hohlraum ist mit einem Gesteinsmehl aufgefüllt und unter ein hohes Vakuum gesetzt. So funktioniert der Speicher wie eine große Thermoskanne. In dieser Größe ist der Speicher ein Novum. Üblich sind Stahlspeicher, die aber bei den benötigten Ausmaßen 50 Zentimeter dick gedämmt werden müssten und zugleich Speicherverluste in der Größenordnung vom Jahreswärmeverbrauch eines Einfamilienhauses gehabt hätten. Zusätzlich gibt es drei Wärmepumpen, die eine 12-kWp-Fotovoltaikanlage antreibt. Sie heizen zwei separate Pufferspeicher auf, einen für die Warmwasserbereitung und einen für die Heizung. Weil das Warmwasser nicht auf langen Leitungswegen durch die Gebäude gepumpt wird, sondern dezentral über Frischwasserstationen direkt in die Wohnungen gelangt, muss es lediglich auf die Zieltemperatur von 55 Grad erwärmt werden. Hohe Wärmeverluste bleiben so aus und zusätzliche Energie kann gespart werden. Auch deshalb benötigt das Solarhaus keinerlei Fremdenergie für Heizung und Warmwasser. Zwischen März und Oktober reicht die Solarthermieanlage aus, um die erforderliche Wärme für Heizung und Warmwasser zu liefern. Die Wärmepumpen bleiben ausgeschaltet. In den restlichen Monaten sorgen dann die Pumpen für warmes Wasser unter der Dusche, während die Solarenergie ausschließlich zum Heizen verwendet wird. Jede Wohnung verfügt über eine eigene Lüftungsanlage mit 90prozentiger Wärmerückgewinnung. Dadurch wird das Lüften über die Fenster überflüssig und senkt den Energieverbrauch. Allerdings hebelt der Faktor Mensch an dieser Stelle immer wieder die Vorzüge des Systems aus – so auch im Solarhaus – wenn die Fenster trotzdem geöffnet werden. „Die Luft im Passivhaus ist relativ trocken“, zeigt Petzold Verständnis, formuliert aber zugleich einen Wunsch: „Die Hersteller der Lüftungsanlagen sollten das noch verbessern.“ Je besser die Lüftungsanlagen, desto angenehmer für die Bewohner, desto weniger geöffnete Fenster. Und das käme wiederum der Energiebilanz zugute. Ganz nebenbei würde sich auch ein Problem für musikalische Bewohner der Passivhäuser lösen. Denn mit der aktuellen Technik sorgen die Luftverhältnisse noch dafür, dass sich Klaviere schneller verstimmen. Das Energiekonzept der Solarsiedlung sieht auch vor, dass es nicht mehr die sonst übliche Einzelraumregulierung gibt. Stattdessen wird jede Wohnung als Ganzes reguliert. „Das würde eigentlich eine wohnungsweise Abrechnung sinnvoll machen“, erklärt Petzold. Zumal der Verbrauch externer Energie ohnehin gegen null tendiert. Allerdings sind die behördlichen Vorgaben so weit noch nicht. Jeder Raum benötigt deshalb einen Zähler, obwohl die letztlich teurer sind als der eigentliche Verbrauch. Schneller Vermarktungserfolg Baulich ist die gesamte Solarhaussiedlung eine Kombination von Massivbau mit 30 Zentimeter dickem Wärmedämm-Verbundsystem und Holzrahmenbau. Die Fassaden sind weiß verputzt, die Versprünge in den Gebäuden und die Balkone farbig abgesetzt. Die Fenster sind dreifach verglast. Gerade Balkone sind aus energetischer Sicht häufig problematisch, denn sie stellen Wärmebrücken dar. Es treten hohe Wärmeverluste und niedrige raumseitige Oberflächentemperaturen auf. Tauwasser und Schimmelpilze können sich bilden. „Für unser Konzept war es wichtig, dass wir frei von Wärmebrücken bauen“, erklärt Petzold. „Deshalb haben wir Schöck Isokörbe® an den Balkonen eingesetzt.“ Die eignen sich besonders für Passivhäuser und sind für den wärmebrückenfreien Bau zertifiziert. Käufer für die Wohnungen in der Dieckmannstraße hatte Petzold schnell gefunden. Die zahlten im Durchschnitt 2.300 Euro pro Quadratmeter und sind davon überzeugt, ein gutes Investment getätigt zu haben. Zum einen haben sie eine energetisch nachhaltige Immobilie gekauft. Zum anderen geht die Rechnung auch wirtschaftlich auf. Denn durch den Verzicht auf Fremdenergie können die Wohnnebenkosten minimiert werden. Das eröffnet Kapitalanlegern Spielraum: Je niedriger die zweite Miete ausfällt, desto mehr Luft bleibt für die erste Miete – die Zahl, die jedem Vermieter besonders am Herzen liegt. 17 RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:36 Seite 18 immobilienporträts Karl-Tauchnitz-Straße/Wächterstraße, Leipzig Sehr begehrt: Bronze, Silber und Gold Bildquelle: Günther-Fotodesign, Leipzig Im Leipziger Musikviertel, direkt am Johannapark, stehen drei Wohnhochhäuser aus den Siebzigerjahren. Die 16-Geschosser in der KarlTauchnitz-Straße 15 und 17 und in der Wächterstraße 36 sind markante Elemente des Stadtbildes. Aus diesem Grund entschied die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, im Zuge der anstehenden Sanierung auch die Fassaden besonders aufzuwerten. In einem Wettbewerb setzten sich die Dresdner Architekten Knerer und Lang durch, die die Außenhülle der drei Plattenbauten in ihrem Entwurf in edle, metallisch schimmernde Farbtöne tauchten. „Diese sind dezent und zurückhaltend, womit sie keinerlei Kontrast zur umgebenden gründerzeitlich geprägten Situation des Musikviertels erzeugen“, betont die Architektin Eva Maria Lang. Bei der Sanierung zwischen 2009 und 2013 erhielten die Gebäude daher einen Metallicanstrich in den Tönen Bronze, Silber und Gold. „Sie wirken wie Skulpturen im Park“, beschreibt der Projektleiter der LWB, Heiko Schröder, die Veränderung. Das darunter verwendete Wärmedämm-Verbundsystem überdeckt zudem die typischen Fugen der Plattenbauten und wertet die Fassade weiter auf. Die Hauseingänge erhielten ein zur jeweiligen Farbe passendes Vordach und eine großzügigere Treppenanlage. Auch die Bäder wurden saniert, die Versorgungsleitungen in den Häusern erneuert sowie die Eingangstüren ausgetauscht. „Früher wurde die Frischluft über die Gebäudeflure zugeführt, das haben wir geändert und eine Wärmerückgewinnung eingebaut“, betont Schröder. Die rund 12 Millionen Euro teure Sanierung hat sich für die LWB gelohnt. Den Leipzigern haben sich die Bronze-, Silber- und Gold-Häuser ins Gedächtnis eingeprägt und bei Mietinteressenten sind sie begehrt. Bauherr: Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Leipzig . Standort: KarlTauchnitz-Straße 15 und 17; Wächterstraße 36, Leipzig . Architekt: Knerer und Lang Architekten GmbH, Dresden . Sto-Leistungen: Fassadendämmsystem (StoTherm Mineral), Schlussbeschichtung mit Metallic-Effekt . Fachhandwerker: Ebert Bau Berga GmbH & Co. KG, Berga; Baugeschäft Gaide GmbH & Co. Hochbau KG, Leipzig 18 RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:36 Seite 19 Bildquelle: Fotodesign Christoph Gebler, Hamburg immobilienporträts Königsberger Straße, Schleswig Sonnenhäuser mit System Für die Mieter der Mehrfamilienhäuser in der Königsberger Straße in Schleswig lacht die Sonne. Mit ihr heizen sie ihre Räume und erwärmen ihr Wasser. Insgesamt 88 Wohnungen werden mit Sonnenenergie versorgt, sodass die Bewohner eine Flatrate-Miete bezahlen, bei der Wasser und Heizung nicht extra berechnet werden. Seit Langem beschäftigt sich der Vermieter, die GEWOBA Nord, mit der Nutzung regenerativer Energien. In Harrislee, einem Ort an der dänischen Grenze, setzte sie das Konzept des Sonnenhauses erstmals für ein Mehrfamilienhaus um. Nach ihren Zielvorgaben entwickelte die Firma B&O Gebäudetechnik dort das Konzept eines 60.000 Liter fassenden Tanks, der in das Haus eingebaut ist und in dem das durch Sonnenkollektoren auf dem Dach erwärmte Wasser gespeichert wird. „Wir rechnen mit einem Ertrag von 70 Prozent der benötigten Wärme, sodass wir nur 30 Prozent durch Fernwärme zuführen müssen“, sagt der GEWOBA-Bauleiter Peter Kübel. Die 10 Meter hohen Tanks versorgen nicht nur die eigenen Gebäude, sondern auch die übrigen Mehrfamilien- und Reihenhäuser. Diese sind sehr farbig gestaltet. Die beiden Häuser mit Tank leuchten in Sonnengelb, um die neue Technologie sichtbar zu machen. Für die innovativen Häuser in Schleswig, die sich die GEWOBA rund 14 Millionen Euro kosten ließ, gewann sie den zweiten Preis im Wettbewerb „Zukunft Wohnen“ des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen. Beim inzwischen realisierten 2. Bauabschnitt in Harrislee wurde nun auch die Wirtschaftlichkeit beim Bau verbessert. „Wir haben die Sonnenhäuser als Systemhäuser gebaut und konnten sie damit in nur acht Monaten Bauzeit fertigstellen“, betont Horst Glinka, geschäftsführender Gesellschafter der B&O. Bauherr: GEWOBA Nord Baugenossenschaft eG, Schleswig . Standort: Königsberger Straße 20–50, Schleswig . Sto-Leistungen: Fassadendämmsystem (StoTherm Classic) . Fachhandwerker: BSF Bautenschutz GmbH, Niederwiesa 19 RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:36 Seite 20 gestaltung Bauherr: GEMIBAU Mittelbadische Baugenossenschaft eG, Offenburg Standort: Am Stadtwald 6 a–d Architekt: FranzundGeyer Freie Architekten BDA dwb, Freiburg Sto-Leistungen: Fassadendämmsystem (StoTherm Vario) mit Oberputz (Stolit) in zwei Körnungen Fachhandwerker: eble ausbau + fassade GmbH, Hohberg 20 RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:36 Seite 21 gestaltung Neubau einer Wohnanlage in Offenburg-Albersbösch „Schnittflächen“ in Elfenbein Um der Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg Herr zu werden, wies die Stadt Offenburg 1953 Bauland westlich der Kinzig aus. Der so entstandene Stadtteil Albersbösch wuchs rasch und bot vor allem Heimatvertriebenen erschwinglichen Wohnraum. Mehr als 50 Jahre später ist der Schwung dahin. Der Stadtteil mit seiner lockeren Bebauung aus Mehrfamilien- und Einfamilienhäusern ist überaltert, die Entwicklung stagniert, die Aussichten sind trübe. In dieser Situation ergriff Offenburg beherzt die Initiative: 2010 beauftragte sie das Stuttgarter Architektur- und Stadtplanungsbüro LEHEN drei damit, einen Rahmenplan für Albersbösch zu entwickeln. Dieser von Baden-Württemberg im Rahmen des Programms „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ geförderte Plan sollte „die kurzfristigen, aber auch mittelfristigen Entwicklungspotenziale des Stadtteils ermitteln und die Perspektiven für dessen zukünftige Nutzung aufzeigen“. Zu diesem Zweck entwickelten die Planer 35 städtebauliche Maßnahmen, die geeignet sind, defizitäre Bereiche neu zu ordnen und den Bestand zu ergänzen. Im Februar 2012 wurde die Änderung des Bebauungsplans beschlossen. Bildquelle: FranzundGeyer, Freiburg Als erste der 35 Maßnahmen wurde eine nachverdichtende Neubaumaßnahme auf dem Gelände eines ehemaligen Garagenhofes in Angriff genommen. Bauherrin der Sieben-Millionen-Euro-Investition (3.575 Quadratmeter) ist die 1951 gegründete GEMIBAU Mittelbadische Baugenossenschaft eG. Sie ließ durch die Freiburger Architekten FranzundGeyer vier Einzelgebäude (Am Stadtwald 6 a–d) mit 49 Wohneinheiten als Mietwohnungsbau inklusive einer Arztpraxis und einer Tiefgarage planen. Die vier- bis fünfgeschossigen Gebäude mit begrünten Dachflächen wurden im Effizienzhaus-70-Standard mit Abluftanlage errichtet. Sie sind hoch gedämmt und werden über ein modernes Blockheizkraftwerk, das im Rahmen eines Contracting-Modells mit dem E-Werk Mittelbaden gebaut wurde, sowohl mit Strom als auch mit Wärme versorgt. Die Neubauten bieten neun beziehungsweise dreizehn Wohneinheiten (zwei bis viereinhalb Zimmer), verfügen über Aufzüge und sind barrierefrei und behindertengerecht ausgestaltet. Sie ermöglichen älteren Einwohnern, durch einen Umzug innerhalb des Viertels in der gewohnten Umgebung zu bleiben, was durch die Arztpraxis noch unterstützt wird. Doch auch für junge Familien sind die Wohnungen interessant, da in unmittelbarer Nähe ein Kindergarten und eine Grundschule liegen. Schon früh waren nahezu alle neuen Wohnungen reserviert. Und nach einer reibungslosen Planungsund Bauphase, bei der die ansässige Bevölkerung sehr früh in den Diskussionsprozess eingebunden wurde, konnten die Gebäude 2014 bezogen werden. Bei deren Gestaltung wurde das Architekturbüro FranzundGeyer von den Farb- und Materialspezialisten der StoDesign-Studios mit Mustern und Visualisierungen unterstützt. Das Konzept reagiert einerseits auf die umliegenden (modernisierten) Bestandsgebäude und verhilft andererseits dem Neubau-Ensemble zu einer eigenständigen Identität. Hierzu „verweben“ die vier Gebäude am Kreuzungspunkt der kleinen Erschließungsstraßen die farblich komplementär (Apricot und Blau) gestalteten Nachbargebäude. Doch da sich die Neubauten in ihrer Struktur, ihrem Stil und in ihrer Anordnung vom Bestand unterscheiden, sollten sie sich auch optisch interessant und eigenständig präsentieren. Dem Eindruck einer dichten Bebauung inmitten der durchgrünten Siedlung tritt das Farb- und Materialkonzept optisch und atmosphärisch dadurch entgegen, dass Außenseiten des Ensembles dunkler (grüne Erde) und die Hofseiten heller (Elfenbein) gestaltet sind. Die vier Gebäude erinnern somit an einen dunklen Kubus, der zerschnitten und auseinandergerückt wurde und dessen „Schnittflächen“ nun hell leuchten. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die Materialwahl: Der Detailreichtum der Fassaden wurde dadurch gesteigert, dass die braungrünen Außenfassaden mit einem sehr groben Putz (K6) umgesetzt wurden, während sich die hellen Innenflächen dank einer feineren Körnung (K2) noch leuchtender abheben. Weiterführende Informationen zum Thema StoDesign erhalten Sie unter www.stodesign.de 21 RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:36 Seite 22 gestaltung Bildquelle: FranzundGeyer, Freiburg 3 Fragen an ... Joachim Franz, Dipl.-Ing. – Architekt, und Heinz Geyer, Dipl.-Ing. – Architekt, beide Partner des Freiburger Büros FranzundGeyer Freie Architekten BDA dwb. Immer mehr Menschen zieht es in die Städte. Um den Zuzüglern Wohnraum anbieten zu können, setzen Kommunen zunehmend auf Ergänzungsbebauung. Die GEMIBAU hat Ihr Büro mit dem Neubau einer Wohnanlage am Stadtwald in Offenburg-Albersbösch beauftragt. Welche Faktoren spielen eine Rolle, wenn man ein bereits bestehendes Quartier weiterentwickeln will? Der Konzeption der neuen Wohnanlage ging eine gründliche Analyse der städtebaulichen und sozialen Situation des Quartiers voraus. Die Ergebnisse wurden in einem Rahmenplan zusammengefasst, der das städtebauliche Gesamtkonzept mit einem Maßnahmenkatalog, aufgeteilt in einzelne Schritte, verbindet. Wichtige Punkte waren hierbei, ein differenziertes Wohnangebot für alle Generationen zu schaffen, die Aufwertung der öffentlichen Räume und eine aktive Beteiligung der Bürger zur Steigerung der Akzeptanz und Identifikation mit den zukünftigen Entwicklungen des Quartiers. Dazu gehören auch die Bestandssanierung und Aufwertung der Außenräume, die Neuordnung des ruhenden Verkehrs, ein Familienzentrum und vieles mehr. Alles in allem also das Zusammenwirken aller Beteiligten: Bauherren, Bewohner, Stadtplaner und Architekten – und natürlich der politische Wille! Wie gelingt es, eine Verbindung zwischen Bestandsgebäuden und den Neubauten herzustellen, damit im Ergebnis auch der Eindruck eines in sich stimmigen Quartiers entsteht? Der Rahmenplan als Leitfaden war ein übergeordnetes Steuerungsmittel. Daraus wurden die einzelnen Entwicklungsmaßnahmen abgeleitet. Die Wohnanlage der GEMIBAU ist ein neuer Stadtbau- 22 stein mit vier punktförmigen Häusern, der als Ensemble auf einem maroden Garagenhof errichtet wurde. In der sehr heterogenen Umgebung aus Zeilenbauten der Fünfzigerjahre ist dieser Baustein klar ablesbar, korrespondiert jedoch mit den großzügigen Außenräumen. Durch diese Verzahnung der Außenräume werden die neuen Gebäude mit dem Bestand verwoben. Mit der Neuordnung der Parkplätze, den neu gegliederten Aufenthaltsbereichen im Außenraum und der Erweiterung der Wohnungsangebote durch den Neubau von 48 barrierefreien Wohnungen mit zeitgemäßen Wohnungsgrundrissen wird eine differenzierte, behutsame Nachverdichtung geschaffen und das Quartier aufgewertet. Was zeichnet intelligente, zeitgemäße Architektur aus? Auf der städtebaulichen Ebene sollte die Entwicklung und Aufwertung der Quartiere im Blick behalten werden. Die vorhandenen Strukturen müssen gründlich analysiert und als Ganzes weiterentwickelt werden. Die neuen Gebäude sollen als Stadtbausteine dem Umfeld neue Impulse geben und das Gesamtquartier aufwerten. Gleiches gilt für die Sanierung der Bestandsgebäude. Gerade im Wohnungsbau steht der Nutzer im Mittelpunkt. Eine klare Organisation der Grundrisse bildet die Grundlage für eine flexible Wohnungsnutzung durch die unterschiedlichsten Bewohner mit ihren sehr differenzierten Anforderungen. Barrierefreiheit, großzügige Balkone, hochwertige Außenbereiche und geringer Ressourcenverbrauch sind wichtige Themen. Für uns ist zeitgemäße Architektur das Zusammenspiel der unterschiedlichen Maßstäbe mit ihren vielfältigen Anforderungen und deren sorgfältige Entwicklung – sowohl im Detail wie im Städtebau. RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:37 Seite 23 technik Der Klassiker: polystyrolbasiertes Wärmedämm-Verbundsystem (StoTherm Classic) – zunehmend auch im Rahmen einer Aufdoppelung auf dünne Dämmschichten der Siebziger- und Achtzigerjahre. Wie Sie das richtige System empfehlen Bildquelle: Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen Die sechs Kriterien der WDVS-Wahl Dipl.-Wirt.-Ing. Dirk Herrmann, Produktmanagement Deutschland, Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen Mineralisch oder organisch, nicht brennbarer Gesamtaufbau, besonders dünne Hochleistungsdämmstoffe: Für jede Dämmaufgabe gibt es das richtige System. Eine solch variable Auswahl ist auch notwendig, denn jedes Gebäude ist anders: Bauweise und Standortfaktoren spielen eine Rolle, das Baurecht bestimmt maßgeblich mit und nicht zuletzt sind die Vorlieben des Auftraggebers zu beachten. Sechs Kriterien entscheiden über die Wahl des Dämmsystems. 23 RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:37 Seite 24 technik Wenn ein WDVS keine Lösung ist Trotz der breiten WDVS-Lösungspalette gibt es Situationen, in denen ein geklebtes Fassadendämmsystem nicht infrage kommt, wenn die energetische Sanierung der Gebäudehülle ansteht. Gründe können der Denkmalschutz, die Randbebauung oder die fehlende Tragfähigkeit des Untergrundes sein. Darf oder kann die Fassade aus optischen, räumlichen oder technischen Gründen nicht verändert werden, kann eine Innendämmung die Lösung sein. Eine Innendämmung geht zwar zulasten der Wohnraumfläche und verschiebt den Taupunkt in die tragende Wand, dennoch verbessern auch diese Systeme das energetische Verhalten eines Gebäudes erheblich. Heute stehen für diesen Anwendungsfall ausgereifte, langlebige Systeme zur Verfügung. Sprechen bautechnische Gründe gegen die Applikation eines Wärmedämm-Verbundsystems, ist eine vorgehängte hinterlüftete Fassade oft die geeignete Alternative. Sie ist etwas kostenintensiver, lässt sich aber auch sicher auf kritischen Untergründen anbringen. In puncto Wärmeschutz, Gestaltungsfreiheit, Brandschutz und mechanischer Belastbarkeit stehen diese Lösungen einem WDVS in nichts nach. Dämmleistung, Ökologie, Wirtschaftlichkeit, Dauerhaftigkeit (beziehungsweise Sicherheit), Brandschutz und Gestaltbarkeit: Diese Faktoren beeinflussen die Wahl eines Dämmsystems. Wie sie gewichtet werden, darüber entscheiden die Norm (zum Beispiel beim Brandschutz), die bautechnische Voraussetzung des Gebäudes und der Bauherr – für den einen zählt die schnelle Amortisation, dem nächsten ist die Optik wichtiger. Wie auch immer die einzelnen Aspekte gewichtet und kombiniert werden: Die Angebotsbreite im Marktfeld WDVS ist inzwischen so ausdifferenziert, dass für jeden Fall ein passendes System bereitsteht. Das wird deutlich, wenn die einzelnen Kriterien näher betrachtet werden. Ökologie Zunächst einmal ist festzustellen, dass durchweg jedes WDVS ökologisch ist: Dämmsysteme führen systemimmanent dazu, dass wertvolle Ressourcen gespart werden. Über die Lebenszeit gerechnet, ist die Energiebilanz immer positiv. Die wenigen Gegenbeispiele, bei denen ein WDVS nach kurzer Zeit nicht mehr funktionierte oder keine nennenswerten Einsparungen erzielte, sind Einzelfälle – oft wegen nicht fachgerechter Montage durch Laien. Tatsächlich liegen die „Energie-Amortisationszeiten“ beispielsweise für EPS-Dämmsysteme zwischen fünf und 14 Monaten, Mineralwoll-Dämmsysteme sparen die Energiemenge aus der Produktion nach drei bis acht Mo- 24 naten ein. Bei einer Standzeit von mehreren Jahrzehnten – laut Fraunhofer-Institut für Bauphysik entspricht die Lebenserwartung eines WDVS der eines „konventionellen Wandbildners mit Putz“ – wird klar, dass Dämmsysteme per se ein Gewinn für die Umwelt sind. Wer Lösungen mit noch höherem ökologischem Anspruch sucht, kann auf Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen setzen. Systeme mit Holzweichfaserplatten (wie StoTherm Wood) als Alternative zu EPS-Systemen sprechen beispielsweise besonders Bauherren an, die sich für einen Holzbau entschieden haben. Wer nach einer ökologischen, nicht brennbaren Alternative sucht, kann mit StoTherm Cell auf der Basis einer Mineralschaumplatte ein Dämmsystem der Baustoffklasse A einsetzen. Ökologie gibt es auch mit Brief und Siegel: Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ wird für Systeme vergeben, die strengen Maßstäben genügen und beispielsweise keine biozidhaltigen Filmkonservierer enthalten. Noch strengere Bedingungen sind an ein natureplus-Zertifikat geknüpft, doch auch hier gibt es Systeme, die diesen Ansprüchen genügen. Sicherheit Manche Fassaden müssen mehr aushalten als andere. Fensterlose Fassaden sind beliebte „Fußballtore“. In einigen Regionen drohen höhere witterungsbedingte Lasten. In all diesen Fällen ist über Systeme nachzudenken, die solche Belastungen dauerhaft aushalten. Grundsätzlich kommen hier organische Systeme infrage: Dämmstoff EPS, beschichtet mit organischen Putzen. Dieser Systemaufbau bietet höchste Widerstandskraft gegen mechanische Lasten – im Falle von StoTherm Classic nachgewiesen durch den „Simultantest“, den bislang härtesten Test für die Widerstandskraft einer Fassade. Kommen hohe Anforderungen des Brandschutzes hinzu, gibt es nicht brennbare Alternativen wie StoTherm Classic S1. Hier sorgen Mineralwolle als Dämmstoff und Basaltfasern im organischen Putz für die Nichtbrennbarkeit und die höhere mechanische Belastbarkeit. Wirtschaftlichkeit Für Bauherren zählen üblicherweise die Summe der Gesamtinvestition und die Amortisationszeit. Für den Verarbeiter schlagen weitere Faktoren zu Buche: Verarbeitungssicherheit und -tempo, möglichst jahreszeiten- und witterungsunabhängige Verarbeitungszeiten. Systeme, die mit Maschinentechnik schneller an die Wand zu bringen sind, lassen sich mit geringeren Mannstunden kalkulieren und erlauben günstigere Quadratmeterpreise zu weiterhin auskömmlichen Margen. Außerdem gilt: Geld wird nur verdient, wenn gearbeitet wird. Damit auch in der Übergangszeit, im Frühjahr und im Spätherbst, an der Fassade sichere Arbeiten ausgeführt werden können, stellt die Industrie Lösungen bereit, mit denen auch bei niedrigen Plusgraden (ab +1 Grad Celsius) noch mit Kleber und Putz hantiert werden kann. Von Sto gibt es hier gleich zwei Verfahren: „QuickSet (QS)“ und „Fast Technology (FT)“. QS sorgt dafür, dass organische Putze zuverlässig auch bei kühler Witterung abbinden. Analog funktionieren mineralische Produkte, bei denen FT angewandt wird. Mit der Aufdopplung – WDVS auf WDVS – hat sich zudem ein sehr wirtschaftliches Verfahren für noch nicht ausreichend gedämmte Gebäude etabliert. RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:37 Seite 25 technik Qualität an der Fassade: StoTherm Classic S1 wurde als bestes Produkt des Jahres 2013 mit dem Innovationspreis „Plus X Award“ ausgezeichnet. Zudem trägt es als besonders umweltfreundliches Produkt den „Blauen Engel“. Umweltgerechter Wärmeschutz: Als Komplettsystem mit dem „Blauen Engel“ (RAL-UZ 140) ausgezeichnet, ist das WDVS StoTherm Mineral eine weitere nachhaltige Lösung, wenn es um erhöhte Umweltschutzanforderungen geht. Als erstes WDVS erhielt StoTherm Cell bereits 2005 das international anerkannte natureplus-Qualitätszeichen. Sicherer geht’s nicht: StoTherm Classic hat sich als bisher einziges System der FIBAG-Simultanprüfung unterzogen – das heißt gleichzeitige Belastung durch Starkregen, Massenhagel und Sturm. Gestaltungsvielfalt Dämmfähigkeit Immer wieder ist zu hören, durch Dämmsysteme würden Fassaden gesichtslos, ganze Quartiere verlören ihren ursprünglichen Charakter und „Architektur“ sei mit diesen Systemen kaum machbar. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus: Die Struktur- und Farbtonvielfalt von Putzen ist fast grenzenlos. Allein für StoTherm Classic stehen mehr als 800 Farbtöne zur Wahl und ungezählte Sanierungen zeigen, dass sanierte Anlagen gerade im Mehrgeschosswohnungsbau auch optisch gewinnen. Und es gibt weit mehr Gestaltungsmöglichkeiten als Putz: Klinkerriemchen, Naturstein, Architekturelemente – die gestalterische Freiheit ist auch bei der Wahl der Endbeschichtung kaum eingeschränkt. Wichtig ist allerdings die Wahl des Farbtons. Galt bis vor Kurzem der Hellbezugswert (HBZ) als das Maß, nach dem ein Farbton zu beurteilen war, richtet sich die Wahl heute nach dem Wert der Total Solar Reflectance (TSR*). Je höher dieser TSR-Wert, umso mehr solare Strahlung wird reflektiert, desto kühler bleibt die bestrahlte Oberfläche. Im Gegensatz zum Hellbezugswert lässt sich der TSRWert jedoch nicht von der Helligkeit eines Farbtons ableiten – er muss vom Hersteller für jede Farbe und den gewählten Farbton angegeben werden. Besonders dunkle Farben, bis hin zum Schwarz, bleiben weiterhin möglich – durch die NIR-Technologie. NIR steht für „Nahes Infrarot“. Farben mit dieser Eigenschaft reflektieren gerade den energiereichen Spektralbereich des Lichtes. So heizen sie weniger auf als Standardfarben, die Oberfläche bleibt vergleichsweise kühl und Spannungen treten kaum auf. In vielen Fällen ist die Rechnung für den gewünschten Wärmeschutz einfach. Überall dort, wo Platz kein Engpassfaktor ist, kann der Dämmstoff einfach in der erforderlichen Dicke appliziert werden. An Grundstücksgrenzen oder bei Gebäuden mit geringem Dachüberstand kommt es allerdings vor, dass die zusätzliche Schicht vorgegebene Grenzen nicht überschreiten darf. Dann ist die Dämmleistung des Wärmedämmstoffs gefragt. EPS-Platten der WLG 032 dämmen bereits rund zehn Prozent besser als Standarddämmstoffe der WLG 035. Mit Resol-Platten lässt sich die Dämmwirkung weiter steigern – WLG 025 erreicht mit fünf Zentimetern dieselbe Wirkung wie eine Platte der WLG 035 mit acht Zentimeter Dicke. Brandschutz Zwar ist der Brandschutz von WDVS wesentlich besser (und hundertfach geprüft), als uns das boulevardeske Medienecho der vergangenen Jahre glauben machen will. Dennoch gilt: Brandschutzmaßnahmen sind unbedingt und in voller Konsequenz einzuhalten. Standard-WDVS mit EPS-Dämmplatten sind als zugelassene B-Baustoffe kein Sicherheitsrisiko. Wichtig ist in jedem Fall, die erforderlichen Maßnahmen wie Sturzschutz oder Brandriegel systemkonform einzusetzen. Wo ohnehin nur nicht brennbare Baustoffe verbaut werden dürfen (zum Beispiel bei Gebäuden, die die Hochhausgrenze überschreiten), kommen mineralische Systeme zum Einsatz. Weiterführende Informationen zu Wärmedämm-Verbundsystemen erhalten Sie unter www.sto.de/we Eine Broschüre des IWM erläutert den TSR. Sie kann als PDF unter http://www.iwm.de/?wpdmdl=2503 angesehen werden. * 25 RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:37 Seite 26 weltweit Aufeinander abgestimmte Grau- und Beigetöne sowie anthrazitfarbene Flächen strukturieren anstelle der ehemaligen Klinkerreliefs die Fassade. Wohnturm 2.0 Hoch hinaus in San Sebastián Im äußersten Norden der iberischen Halbinsel befindet sich die baskische Wirtschaftsmetropole Donostia-San Sebastián. Der Standort ist Heimat etlicher Konzerne, die dort – nicht zuletzt aufgrund der verkehrsgünstigen Lage – bis heute eine Niederlassung unterhalten. Bereits in den Sechzigerjahren zog es zahlreiche Arbeitskräfte in die Stadt, für die entsprechender Wohnraum benötigt wurde. Da der Platz in der Stadt immer knapper wurde, verlagerte man den Wohnungsbau an den Stadtrand. Diese Viertel prägen noch heute die Silhouette, denn seinerzeit wurde nicht nur viel, sondern vor allem hoch gebaut. Das spanische Architekturbüro Amajic Arquitectos hat an einem 13-geschossigen Relikt dieser Zeit ein Exempel statuiert, wie sich die alten Wohntürme zukunftsfähig machen lassen. 26 Den fünf nahezu baugleichen Punkthochhäusern am Paseo Larratxo hat man ihr Alter immer stärker angesehen. Konstruiert wurden die Türme in Stahlbeton-Ständerbauweise mit Massivbetondecken. Kennzeichnend für das äußere Erscheinungsbild war die orangerote Klinkerfassade, die mit leicht vorspringenden Verblendungen in den Brüstungsbereichen der Fenster und Loggien eine plastische Wirkung erzeugte. Und genau darin lag eines der zentralen Probleme: Zwar befanden sich die Klinkerfassaden insgesamt in einem schlechten Zustand, aber die zahlreichen Vor- und Rücksprünge in der Fassade wiesen die größten Schäden auf und stellten die eigentliche Schwierigkeit dar, weil sie die Wärmebrückenproblematik innerhalb der ungedämmten Fassade noch verstärkten. Vor allem in den Wohnungen an der West- und Nordseite bildete sich an den Innenseiten der Außenwände regelmäßig Kondensationsfeuchte und in der Folge Schimmel. Das Büro Amajic Arquitectos löste dieses Problem schließlich durch ein vorgehängtes hinterlüftetes Fassadensystem. Mithilfe von Dämmelementen in unterschiedlicher Stärke konnte eine gleichmäßige, ebene Fassadenfläche geschaffen und gleichzeitig eine beständige Trennung von Wärme- und Witterungsschutz ermöglicht werden. Die Hinterlüftungsebene wiederum begünstigt die Abtrocknung von Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren. Insgesamt ließen sich die Wärmeverluste an dem Wohnturm um 44,6 Prozent reduzieren. RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:37 Seite 27 Bauherr: Residents association Larratxo 16, Donostia-San Sebastián, ES Standort: Paseo Larratxo, Donostia-San Sebastián, ES Architekt: Amajic Arquitectos, s.l.p., Donostia-San Sebastián, ES Sto-Leistungen: Vorgehängtes hinterlüftetes Fassadensystem (StoVentec R), WärmedämmVerbundsystem (StoTherm Classic) Fachhandwerker: Renovaciones Técnicas De Frias, s.l., San Sebastián (Guipuzcoa), ES An der neuen Südfassade werden die hellen Putzflächen durch drei vertikal verlaufende Schmuckelemente strukturiert. 27 Bildquelle: Esti Veintenillas, Donostia-San Sebastián, ES weltweit RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14_RZ we-4-2014_230x297mm_28-11-14 28.11.14 14:35 Seite 28 HÄUSER SIND WIE MENSCHEN. Sie geben uns Schutz, Wärme und Geborgenheit. Richtig gedämmt machen Sie Ihr Haus noch lebenswerter. Mehr Komfort, mehr Behaglichkeit ziehen ein. Gleichzeitig sinkt der Energieverbrauch. Dämmen lohnt sich. Art.-Nr. 09671-360 Rev.-Nr. 01/12.14 Erfahrungsberichte, Wissenswertes, Fachberatung auf dämmen-lohnt-sich.de