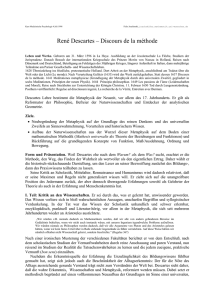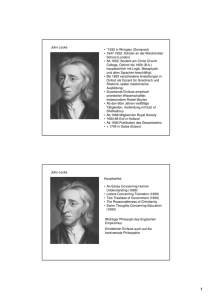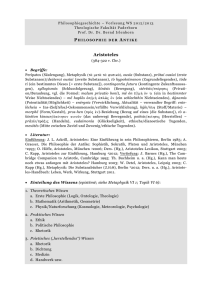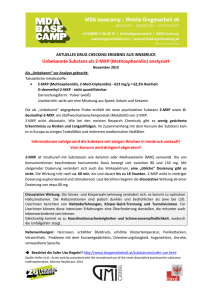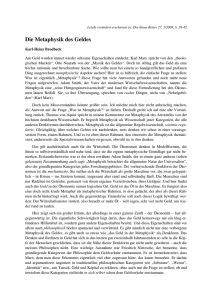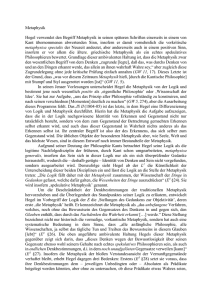Berthold Wald Die Erfindung des Selbst. Johannes Duns Scotus
Werbung

Berthold Wald Die Erfindung des Selbst. Johannes Duns Scotus – René Descartes - John Locke. I. Exposition der These Der Einfluß, den das Denken des schottischen Franziskaners Johannes Duns Scotus (1265/6 – 1308) auf die Entwicklung der abendländischen Philosophie genommen hat, ist lange Zeit kaum bemerkt worden. Inzwischen hat sich jedoch die philosophiehistorische Forschung von dem eher systematischen als historischen Interesse der Neuscholastik an der „aristotelisch-thomistischen Philosophie“ befreit. Das Interesse an Duns Scotus ist seither stetig gewachsen. So ist heute nicht bloß der Einfluß seines Denkens auf den bedeutenden frühneuzeitlichen Denker Franzsico Suarez erwiesen. Auch die Grundlegung und weitere Entwicklung der neuzeitlichen Philosophie bei Descartes, Spinoza und Kant ist ohne den insbesondere von Duns Scotus geprägten „zweiten Anfang der Metaphysik“1 historisch kaum verständlich. Mit der Kritik Kants an der rationalistischen Metaphysik des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts ist dann allerdings ein Bruch mit dieser Traditionslinie vollzogen. 2 Die Wirkung des Denkens von Duns Scotus reicht allerdings über diese Bruchlinie hinaus. Sie zeigt sich unter anderem in der scheinbaren Evidenz, mit der der Begriff der Person auch heute noch mit dem Begriff des Selbst gleichgesetzt wird. Darauf bezieht sich die etwas provokante Formulierung „Erfindung des Selbst“. Sie enthält eine doppelte Anspielung, aus welcher der 1 Vgl. Ludger Honnefelder, Der zweite Anfang der Metaphysik. Voraussetzungen, Ansätze und Folgen der Wiederbegründung der Metaphysik im 13./14. Jahrhundert; in: Philosophie im Mittelalter. Entwicklungslinien und Paradigmen, hrsg. von Jan P. Beckmann (u.a.), Hamburg 1987, S.165-186, 177ff. 2 Die philosophische und historische Tragweite unterschiedlicher Denkstrukturen in der mittelalterlichen Philosophie hat nach den frühen Arbeiten von Pierre Duhem (Le Système du Monde, Paris 1913 ff., 10. Bde.), Etienne Gilson (La liberté chez Descartes et la théologie, Paris 1914; ders. Études sur le Rôle de la pensée médiévale sur la formation de la système cartésien, Paris 1951, 2 Bde.) und Alexandre Koyré (Descartes et la Scolastique, Paris 1922) erst wieder in der neuesten Forschung Beachtung gefunden. Vgl. das 1. Kapitel von André de Muralt, L’Enjeu de la philosophie médiévale. Études thomistes, scotistes, ockhamiennes et grégoriennes, Leiden 1991. Richtungsweisend ist hier vor allem die Arbeit von Ludger Honnefelder, Scientia transcendens. Die formale Bestimmung der Seiendheit und Realität in der Metaphysik des Mittelalters und der Neuzeit. (Duns Scotus - Suarez - Wolff - Kant - Peirce), Hamburg 1990. 2 Kontext und die Absicht meines Beitrags hervorgeht. Das Wort „Selbst“ nimmt Bezug auf Charles Taylors monumentale Studie „Sources of the Self“.3 Der englische Titel wie auch der Untertitel „The Making of Modern Identity“ lassen offen, ob im Sinne Taylors eher von „Entdeckung“ als von „Erfindung“ gesprochen werden sollte. Taylor verfolgt die Spur des neuzeitlichen Selbst über ihre mittelalterlichen Quellen zurück bis hin zu Platons Unterscheidung zwischen der inneren Tätigkeit der Seele und dem äußeren Tun.4 Die philosophiehistorische Absicht meines Beitrags geht nun dahin zu zeigen, daß ein bestimmter Begriff des Selbst, nämlich der von John Locke, durch seine Abgrenzung zum Begriff des Menschen eine andere, bei Taylor nicht beachtete mittelalterliche Vorgeschichte hat, genauer gesagt: daß die zugrunde liegenden ontologischen Annahmen dieser Unterscheidung sich zurückführen lassen auf Prinzipien der scotistischen Metaphysik. Meine zweite Anspielung nimmt Bezug auf eine These des französischen Mediävisten René Antoine Gauthier. In seiner Einleitung zur „Nikomachischen Ethik“ des Aristoteles vertritt er die Auffassung, daß erst gut tausend Jahre nach Aristoteles der Wille in unserem heutigen Verständnis erfunden worden sei.5 Sowohl Taylor wie Gauthier sehen bei Augustinus den Wendepunkt in der Herausbildung der zentralen Begriffe neuzeitlicher Subjektivität. Auch gegenüber dieser Herleitung des spezifisch neuzeitlichen Verständnisses vom freien Willen sind Vorbehalte angebracht. Die entscheidende Differenz zum antiken Begriff des Willens liegt in seiner Entgegensetzung zum Naturhaften. Die Wirkungsgeschichte dieser Entgegensetzung von Wille und Natur als disjunkter Prinzipien der Verursachung beginnt nicht bei Augustinus sondern wiederum bei Duns Scotus. Er entwickelt seine zentralen Begriffe zur Abwehr einer fundamentalen Krise, die das christliche Selbstverständnis bedroht. Sie erwächst aus einer bestimmten Aristotelesdeutung in der zweiten Hälfte des 3 Harvard University Press 1989; deutsch: Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität, Frankfurt a. M. 1994. 4 Quellen des Selbst, S. 223 f. 5 „Dans la psychologie d’Aristote la volonté n’existe pas“; "il a fallu aux hommes, après Aristote, quelques onze siècles de reflexions pour inventer la volonté" (René Antoine Gauthier, L’Ethique à Nicomaque, Louvain 1959, 2 1970, Introduction, S. 266). 3 dreizehnten Jahrhunderts, die auch als „griechischer Nezessitarismus“ bezeichnet wird und die als ein Vorläufer des modernen Naturalismus gelten kann. Für den Nezessitarismus gibt es weder Freiheit noch Subjektivität. Alles Geschehen vollzieht sich naturhaft. Auch Denken und Handeln des Menschen unterliegen derselben umfassenden Naturnotwendigkeit. Zur Rettung der Freiheit scheint es nur einen Ausweg zu geben: die Umkehr der These durch die Behauptung einer radikalen Unbestimmtheit und Unabhängigkeit des Willens. Das Wesen des Willens muß in seiner Indifferenz bestehen, eine Auffassung, die in der Nachfolge von Duns Scotus eine kaum mehr bezweifelte Evidenz gewonnen hat. Meine systematische These bezieht sich auf beide Begriffe, den neuzeitlichen Begriff des Selbst wie auch den scotistischen Begriff des Willens. Beide beruhen in ihrer spezifischen Ausprägung auf der exklusiven Entgegensetzung von Natur und Freiheit, die noch weitere Entgegensetzungen nach sich zieht wie diejenige zwischen Körper (res extensa) und Geist (res cogitans) bei Descartes, aber auch zwischen Mensch (human beeing) und Person (self) bei John Locke. In allen Fällen handelt es sich bei diesen aus der Entgegensetzung zum Naturhaften gedachten Entitäten „Wille“, „Geist“ und „Selbst“ nicht um Entdeckungen, sondern um Erfindungen, um Fiktionen der Sprache oder des begrifflichen Denkens im Kontext einer rationalistischen Metaphysik, welche sich in der Abwehr des Naturalismus scheinbar besser bewährt. „Wille“, „Geist“ und „Selbst“ (das „Ich“) bestehen derzufolge nur rein faktisch zusammen mit dem Sein des Menschen. Kontrafaktisch kommt diesen Entitäten aufgrund der objektiven Unterschiedenheit ihrer Wesenheit (d.h. ihres sachlichen Gehalts) vom übrigen Sein des Menschen jedoch eine mögliche Eigenständigkeit zu. Die Formalunterscheidung sachlicher Gehalte im komplexen Sein einer Sache, die sogenannte „Formaldistinktion“, ist gewissermaßen das innovative Grundprinzip der scotistischen Metaphysik und des späteren metaphysischen Rationalismus. Man meint jetzt, in letzten begrifflichen Unterscheidungen selbständige Entitäten zu „entdecken.“ Was davon zu halten ist, soll erst im 4 letzten Abschnitt gezeigt werden. Nicht die spezifische Fassung des Personbegriffs bei Duns Scotus, wie gelegentlich behauptet wurde, sondern das darin wirksame ontologische Prinzip der distinctio formalis ist wirkungsgeschichtlich gesehen die entscheidende Innovation. II. Unterwegs zum Personbegriff der Neuzeit 1. Die scotistische Erfindung des reinen Willens Anders als in anderen Punkten seiner Lehre ist sich Duns Scotus völlig im Klaren darüber, dass er mit seinem Freiheitsbegriff neue Wege geht. Formaler Anknüpfungspunkt ist das 5. Kapitel des IX. Buches der aristotelischen „Metaphysik“.6 Die erste und grundlegende Unterscheidung der aktiven Vermögen des Menschen kann für ihn, anders als für Aristoteles, nicht diejenige zwischen den naturhaft wirkenden Vermögen und dem freien Vernunftvermögen sein. Vielmehr ist innerhalb des Vernunftvermögens selbst noch einmal zu unterscheiden zwischen dem naturhaften und dem freien Wirken des Vermögens. Die erste und grundlegende Unterscheidung der aktiven Vermögen besteht zwischen der Natur auf der einen und dem Willen auf der anderen Seite.7 Im Sinne des aristotelischen Unterscheidungskriteriums, sich zu Entgegengesetztem verhalten zu können, ist einzig der Wille frei; die Vernunft ist es gerade nicht. Sie ist im Erkenntnisakt durch die Natur des erkannten Objekts „festgelegt auf Eines“, ganz so, wie das Wahrnehmungsvermögen durch das Wahrgenommene festgelegt ist.8 Die Vernunft gehört also zusammen mit den irrationalen Vermögen auf die Seite der Naturnotwendigkeit, während allein der Wille auf die Seite der Freiheit 6 Ich zitiere den Text der Quaestiones subtilissimae super libros metaphysicorum Aristotelis (Lib. IX, qu. 15) nach der zweisprachigen Ausgabe von Allan B. Wolter, Duns Scotus on the Will and Morality, Washington 1986. Vgl. Fernando Inciarte, Natura ad unum – ratio ad oppositum. Zur Transformation des Aristotelismus bei Duns Scotus; in: J. P. Beckmann (Hrsg), Philosophie im Mittelalter, S. 259-273 (Anm. 1). 7 „Unde prima divisio principiorum activorum est in naturam et voluntatem.“ (Lib. IX, q. 15; Wolter, S. 150). 8 „Intellectus hoc modo non habet rationen potentiae activae propiae dictae. […] Immo, praecise sumptus […] est irrationalis, solum secundum quid rationalis, inquantum praeexigitur ad actum potentiae rationalis." (Lib. IX, q. 15 ; Wolter, S. 156). Nur insofern die Vernunft in der freien Entscheidung des Willens durch die Präsentation der Objekte vorausgeht, ist sie Teil des rationalen Vermögens, aber nicht von sich her. 5 gehört.9 Anders gesagt: die Vernunft ist selbst ein Stück Natur, der Wille hingegen steht außerhalb der Natur.10 Der Wille ist nur der Wille, sonst nichts, und das wegen seiner Unabhängigkeit und Eigenständigkeit gegenüber allem, was sonst noch im und außerhalb des Menschen existiert. Der Wille ist so das eigentliche Selbst des Menschen.11 Was der Mensch sonst noch ist, gehört auf andere Weise zu ihm als sein Wille. Man kann Kant vorwegnehmend sagen: Der Mensch ist Naturwesen und Freiheitswesen zugleich. Er ist nicht als Freiheitswesen ein Naturwesen, sowenig wie er als Naturwesen ein Freiheitswesen ist. Vielmehr vereint er in sich die Gegensätze von Natur und Freiheit, die einander äußerlich bleiben.12 In dieser Verdoppelung im Sein des Menschen sind alle Probleme angelegt, die bereits vor der cartesianischen Fassung des Dualismus in der Notwendigkeit einer Verbindung heterogener Seinsbereich zum Austrag kommen. Kants Transzendentalphilosophie kann als ein Versuch verstanden werden, die Folgelasten des bei Duns Scotus grundgelegten Dualismus einer doppelten Kausalität, einer Kausalität des naturhaft Wirkenden und einer Kausalität aus Freiheit, zu bewältigen. Dafür muß Kant den metaphysischen Dualismus des Descartes in einen Perspektivendualismus verwandeln: Naturkausalität herrscht dann in der phänomenalen Erscheinungswelt, Kausalität aus Freiheit in der noumenalen Welt der Dinge an sich, wobei die Realität der Freiheit dadurch gerettet sein soll, dass der in sich geschlossene Zusammenhang der Naturkausalität nur ein - allerdings nicht zu hintergehendes - Produkt der menschlichen Verstandeskategorien sein soll. 9 „Voluntas est proprie rationalis, et ipsa est oppositorum. […] et non oppositorum modo naturae, sicut intellectus non potest se determinare ad alterum, sed modo libero potens se determinare. Et ideo est potentia, quia ipsa aliquid potest, nam potest se determinare.” (Lib. IX, q. 15; Wolter, S. 156). 10 „Intellectus […] cadit sup ‚natura’“. (Ebd.) 11 Bei Duns Scotus und weniger bei den Magistern des 12. Jahrhunderts, scheint mir die geschichtliche Wurzel für jene „Metaphysik der Freiheit“ zu liegen, aus der das moderne Menschbild hervorgegangen ist. (Vgl. dagegen Theo Kobusch, Die Entdeckung der Person. Metaphysik der Freiheit und modernes Menschenbild, Freiburg i. Brsg. 1993, S. 23-54). 12 Vgl. Axel Schmidt, Natur und Geheimnis. Kritik des Naturalismus durch moderne Physik und scotische Metaphysik, Freiburg/München 2003, § 6 Die unableitbare Freiheit, S. 308 – 357, besonders S. 319 ff. 6 2. Die scotistische Formaldistinction als Prinzip aller „Erfindungen“13 Die Grundlage der scotistischen Metaphysik ist die These, daß Sein im univoken Sinn von allen Gegenständen der Erkenntnis prädiziert werden muß, um die Objektivität der Erkenntnis zu sichern. Dies gilt dann nicht allein für ein Seiendes im ganzen genommen, also zum Beispiel für das Prädikat „Mensch“ in der Aussage „Sokrates ist Mensch“. Auch dessen Eigenschaften als Mensch kommt eine Art von objektiv gegebenem Sein zu, sofern diese in ihrem Sachgehalt als voneinander unabhängig erkannt (primo diversa) werden und daher auch nicht aufeinander rückführbar sind. Sofern Sokrates als Mensch zwar ein Sein zukommt im Sinne der aktualen Existenz, sind doch die dieses Sein konstituierenden Sachgehalte voneinander unterschieden: Die Körperlichkeit des Sokrates ist sachlich etwas anderes als seine Lebendigkeit und diese wiederum etwas anderes als seine Intellektualität. In analoger Weise gilt das auch für den menschlichen Willen, der als Ganzes genommen in sich zwei unterschiedene Eigenschaften vereint: das naturhafte Begehren nach Glückseligkeit und die freie Selbstbestimmung. Dabei werden „naturbestimmt“ und „selbstbestimmt“ ebenfalls als primo diversa, das heißt nicht aufeinander rückführbare, fundamental unterschiedene Sachgehalte aufgefasst, denen jeweils auch ihr eigenes Sein zukommen muß. Andernfalls wären es keine objektiven Unterscheidungen in der Natur der Sache, sondern bloß subjektiv vorgestellte Unterschiede, welche auf die Tätigkeit des Verstandes zurückzuführen sind. Damit objektiver Erkenntnis und reale Sachverhalte korrespondieren können, muß es für Duns Scotus objektiv-sachliche Unterschiede geben, welche in der Mitte zwischen bloß gedanklichen Unterscheidungen und realen Unterscheidungen liegen, weshalb sie auch mit beiden etwas gemeinsam haben. Mit der bloß gedanklichen oder begrifflichen Unterscheidung (distinctio rationis) kommt die Formaldistinktion darin überein, dass den formal unterschiedenen Sachgehalten keine aktuale Existenz zukommt, also die Körperlichkeit von 13 Im folgenden halte ich mich an André de Muralt, der im II. und III. Kapitel seines Buches „L’Enjeu de la philosophie médiévale“ (Anm. 2) eine ausführliche Darstellung der scotischen Lehren von der Formaldistinktion und dem „esse objektivum“ der erkannten Sachgehalte gegeben hat. 7 Sokrates nicht außerhalb von Sokrates als solche existiert. Gleichwohl haben für Duns Scotus formal unterschiedene Sachgehalte einen eigenen Realitätsstatus; sie haben ein esse objectivum, das vor aller unterscheidenden Tätigkeit des Verstandes in der Natur der erkannten Sachverhalte begründet ist. Und in dieser Hinsicht gleichen die formal unterschiedenen Sachgehalte wiederum den real existierenden Unterschieden, die nicht von den Unterscheidungsakten der Vernunft erzeugt, sondern diesen vorgegeben sind, wie beispielsweise der menschliche Körper real verschiedene Teile hat (Herz, Lunge, Arme, Beine usw). Was vom menschlichen Verstand „clare et distincte“ erfasst und unterschieden wird, muß auch einen eigenen Seinstatus haben, wenn sachhaltige begriffliche Unterschiede nicht „leer“, das heißt ohne Wirklichkeitsbezug bleiben sollen. III. Neuzeitliche Dualismen Die Anwendung dieser Prinzipien führt bei Descartes und später bei John Locke zu einem neuen Verständnis von Personalität. Dabei steht der kartesianische Dualismus dem traditionellen Personbegriff noch insofern nahe, als Descartes an der Identität von Menschsein und Personsein festhalten will, während bei John Locke die notwendige Identität von Mensch und Person explizit durch eine bloß kontingente Identität ersetzt wird. 1. René Descartes: Die menschliche Person als Einheit zweier Substanzen Für Descartes ist der Mensch die reale Einheit aus zwei Substanzen, die allerdings nicht nur begrifflich distinkt, sondern objektiv real voneinander verschieden sind.14 Diese Verschiedenheit beruht ganz im Sinne der scotistischen Formaldistinktion auf der primären Unterschiedenheit zweier Attribute des Menschen: dem Selbstbewusstsein und der körperlichen Ausdehnung. Als denkendes Wesen ist der Mensch res cogitans und als Körperwesen ist er res extensa. Allerdings ist auch für Descartes zunächst einmal fraglich, woher wir die Gewissheit nehmen, dass den begrifflich verschiedenen 14 Belege dafür finden sich in allen Hauptschriften von Descartes (In der Ausgabe von Adam und Tannery (AT) vgl. Discours , AT VI, 32f.; Meditationes, AT VII, 78; Principia, AT XI, 330). 8 Attributen „Denken“ und „Ausdehnung“ auch eine vom Denken unabhängige Realität zukommt. Ein erster Weg zur Vergewisserung der Realität und Substantialität des Denkens ist der in der zweiten Meditation beschrittene Weg des methodischen Zweifels. Er führt zu der Einsicht in den Vorrang des Ich oder der denkenden Substanz vor allen andern Erkenntnisinhalten. Ich bin mir selbst in den Akten des Selbstbewusstseins auf andere Weise gegeben wie mein Körper, weil auch der Zweifel an meiner Existenz als ein Akt meines Selbstbewusstseins die Gewissheit meiner Existenz verbürgt. Nicht in gleicher Weise gesichert ist dagegen die Realität und Existenz der ausgedehnten Substanz meiner Körperlichkeit, weil mein Bewusstsein hierüber einer Täuschung unterliegen kann. Der methodische Zweifel sichert also nur die Gewissheit der geistigen Substanz und dies allerdings auch nur für die Dauer der Selbstreflexion. Die reflexiv gesicherte Substantialität des denkenden Ich ist daher außerhalb der Akte der Selbstreflexion keineswegs gewiß. „Denn vielleicht könnte es sogar geschehen, dass ich, wenn ich ganz aufhörte zu denken, alsbald auch aufhörte zu sein.“15 In diesem Stadium der Untersuchung ist es daher noch verfrüht, von der Gewißtheit des Gedachten auf die Existenz des gedachten Sachverhalts zu schließen. Die oft unter Namen von Descartes zitierte Formel für die Selbstvergewisserung des Ich lautet darum auch nicht „cogito ergo sum“ sondern: „sum […] quamdiu cogito“.16 Ein aus der Sicht von Descartes tragfähiges Argument für die Substantialität von denkendem Ich und dem Sein des Körpers findet sich erst in der dritten und der sechsten Meditation. Die Gewissheit der Existenz von Körper und Geist dort klarerweise nicht mehr erkenntnispsychologisch, sondern ontologisch begründet unter der Voraussetzung, dass alles, was „clare et distincte“ als 15 Meditationes, AT VII, 27. Ebd.: „ego sum, ego existo, certum est. Quamdiu autem? nempe quamdiu cogito; nam forte etiam fieri posset, si cessarem ab omni cogitatione, ut illico totus esse desinerim“. 16 9 unterschieden erkannt ist, auch real unterschieden sein muß.17 Diese keineswegs selbstevidente Korrelation zwischen begrifflicher Unterschiedenheit und realer Unterschiedenheit wird in der sechsten Meditation damit begründet, dass das begrifflich Unterschiedene von Gott ohne Widerspruch auch als real existent hätte gesetzt werden können.18 Faktisch existiert zwar nur die Einheit von denkender und ausgedehnter Substanz als Einheit von Geist und Körper im Sein des Menschen. Dennoch sind Ausgedehnt-sein und Denkend-sein real verschiedene Sachverhalte, wovon keiner des anderen bedarf, um existieren zu können. Eine denkende Substanz könnte auch ohne einen Körper existieren und darum real getrennt von einer ausgedehnten Substanz geschaffen sein. Hier sieht man deutlich den Einfluß und die Wirkung der scotistischen Formaldistinktion. Für die substantiale Verschiedenheit und objektive Realität der Erkenntnisinhalte ist nur ihre Trennbarkeit, aber nicht reale Getrenntheit erforderlich, die zumindest Gott ohne Widerspruch hätte wirklichen können. So ist der Mensch zwar real die Einheit von zwei Substanzen. Doch es ist dies nur eine kontingente Einheit, sofern die eine Substanz nicht notwendig mit der anderen Substanz verbunden ist. Da ein echter Dualismus zweier Substanzen nur eine kontingente Einheit erlaubt, ist der Mensch zwar die von Gott gewollte Einheit der Substanzen Körper und Geist, die jedoch von sich her nur akzidentell auf einander bezogen sind. Descartes hatte jedenfalls Veranlassung seinem Schüler Regius in einem Brief dringend zu raten, bei jeder „Gelegenheit“ öffentlich zu bekunden, „dass du glaubst, der Mensch sei ein wahres ens per se, nicht ein ens per akzidens, und der Geist sei real und substantiell mit dem Körper vereint.“19 Allerdings ist ein bloßes Versichern der realen Einheit kein tragfähiges Argument, wenn das vorausgesetzte Unterscheidungsprinzip der Formaldistinktion einer solche Einheit per se die Begründung entzieht. 17 Vgl. Meditationes, AT VII, 13 (Synopsis 3): „daß alle die Dinge, die man klar und deutlich [clare et distincte] als verschiedene Substanzen begreift, wie das für Geist und Körper zutrifft, in der Tat substantiell verschiedene Dinge sind.“ 18 Vgl. Meditationes, AT VII, 77: „so genügt es, eine Sache [una rem= Sachgehalt] ohne eine andere klar und deutlich [clare et distincte] einzusehen, um mir die Gewissheit zu geben, dass die eine von der anderen [real] verschieden ist, da wenigstens Gott sie getrennt setzen kann.“ 19 AT III, 493; zitiert nach Dominik Perler, René Descartes, München ²2006, S. 213. 10 2. John Locke: Differenz von Mensch und Person Wie Descartes beruft sich auch John Locke für die Unterscheidung des Mentalen vom Körperlichen sowohl auf die Verschiedenheit der Sachgehalte (different ideas) wie auf den unterschiedlichen Gewißheitsgrad unserer Erkenntnisquellen und deren korrespondierende Objekte. „Denn während ich durch Sehen, Hören usw. erkenne, daß außer mir ein körperliches Wesen, das Objekt jener Wahrnehmung (sensation), besteht, erkenne ich mit noch größerer Sicherheit, daß in mir ein geistiges Wesen ist, das sieht und hört.“20 Das Körperliche und das Geistige sind nicht bloß der erkannten Sache nach, sondern auch in ihrem Gewißheitsgrad nach objektiv verschieden. Sofern zwischen objektiv verschiedenen Sachgehalten kein definitorischer Zusammenhang besteht, bestreitet John Locke die notwendige Identität zwischen dem Sein als Mensch und dem Sein als Person. Dann gibt es auch keinerlei Gewißheit darüber, ob eine bestimmte Person mit einem bestimmten Menschen nicht bloß faktisch identisch ist. Wir wissen nämlich nicht mit Bestimmtheit, was die substantielle Identität des Menschseins begründet, und folglich auch nicht, was ein personales Selbst mit diesem menschlichen Individuum verbindet. Erfahrungszugang haben wir nur in zwei unterschiedlichen Bereichen: Zum einen sind uns nur die Eigenschaften der Körperdinge durch Vermittlung der äußeren Sinne gegeben, während die zugrundeliegende Substanz als Träger dieser Eigenschaften lediglich hinzugedacht wird: „Unsere Idee der Substanz [...] ist nur etwas, ich weiß nicht was, das angenommen wird, um die Ideen, die wir Akzidentien nennen, zu tragen.“21 Zum anderen kennen mittels des inneren Sinns nur unsere eigenen Bewusstseinszustände. Locke definiert den Personbegriff dann in einer Weise, die auf den ersten Blick wie eine Präzisierung der frühmittelalterlichen Persondefinition des Boethius 20 John Locke, Versuch über den menschlichen Verstand, Hamburg 1981, Bd. I, S. 380; An essay concerning human understanding Ed. P. H. Nidditch), Oxford 1975, II, 23, § 15, S. 306 (Herv. von mir). 21 Ebd. 11 aussehen mag, tatsächlich aber eine grundsätzliche, erkenntnistheoretisch begründete Abkehr von dem substanzontologischen Personbegriff des Mittelalters impliziert.22 Der Ausdruck “Person” steht zwar für „a thinking intelligent Being, that has reason und reflection, and can consider it self as it self, the same thinking thing in different times und places.“23 Doch die an Boethius erinnernde Bezugnahme auf ein „intelligentes Wesen“ bzw. ein „denkendes Ding“ impliziert bei Locke gerade keine Substanzannahme mehr, da das Sein der Person ausschließlich in ihrer Bewußtheit bestehen soll, die untrennbar mit den Akten des Denkens verbunden ist: „only by that consciousness, which is inseparable from thinking“.24 Locke läßt den Substanzbegriff nicht einmal als Seinsprinzip des menschlichen Individuums gelten, geschweige denn im Hinblick auf die ontologische Grundlegung der Person. „Denn ‘dieselbe Substanz sein’, ‘derselbe Mensch sein’ und ‘dieselbe Person sein’ sind drei ganz verschiedene Dinge, da Person, Mensch und Substanz Bezeichnungen für drei verschiedene Ideen sind.“25 Das Kriterium der Identität von Personen fällt mit dem Kriterium der Selbstbewußtheit zusammen, sofern das Bewußtsein des je eigenen Selbst das Sein von Personen nicht bloß anzeigt, sondern unmittelbar konstituiert. „Personal identity consists not in the identity of substance, but [...] in the identity of consciousness.“26 “Denn wenn die Identität des Bewußtseins es bewirkt, daß jemand ein und derselbe ist, so beruht die Identität der Person offenbar allein hierauf.“27 Der Umfang des bewußtseinstheoretischen Personbegriffs ist damit enger und weiter zugleich als im substanzontologischen Begriff der Person des Mittelalters. Er ist enger, weil das Menschsein nicht schon das Selbstsein impliziert. Nicht die menschliche Natur, auch nicht ein Bewußtseinsvermögen, sondern allein die 22 Boethius definiert das Sein der Person substanz-ontologisch : „Persona est rationabilis naturae individua substantia“ (De duabis naturis Christi V, 4, 21 f.). Vgl. zum ganzen: Berthold Wald, Substantialität und Personalität. Philosophie der Person in Antike und Mittelalter, Paderborn 2005. 23 Essay, II, 27, § 9; S. 335 (Anm. 20) 24 Ebd. 25 Versuch, Bd. 1, S 416; Essay, II, 27, § 7; S. 332 (Herv. im Original). 26 Essay, II, 27, § 19; S. 342 (Herv. im Original). „Die Identität der Person erstreckt sich also nicht weiter als das Bewußtsein.“ (Versuch, Bd. 1, Kap. 27, S. 425; Essay II, 27, § 14, S. 339). 27 Versuch, Bd. 1, S. 421; Essay II, 27, § 10, S. 336. 12 erinnerte wie prospektiv erwartete Abfolge bewußter Akte der Selbstwahrnehmung konstituiert das Sein der als ein Selbst. Der schlafende Sokrates ist dann als Person nicht bloß verschieden vom wachenden Sokrates; er ist strenggenommen keine Person, solange er schläft. Der Umfang des bewußtseinstheoretischen Personbegriffs ist weiter, insofern alles, was ein Selbstbewußtsein hat, auch Person genannt werden kann, gleichgültig, wer oder was jetzt oder künftig als Inhaber dieses Bewußtseins auftreten mag: Tiere ebenso wie intelligente Maschinen. IV. Das „Selbst“ als ontologische Fiktion Abschließend sollen die beiden wichtigsten Einwände kurz in Erinnerung gerufen werden, die verstehen lassen, weshalb der Versuch, sich auf dem Weg über objektiv unterschiedene Gehalte der Erkenntnis auch der Realität des so Erkannten zu vergewissern ein Irrweg ist. Dabei liegt der Akzent bei Kant auf der systematischen Kritik des cartesianischen Rationalismus, während die sprachphilosophische Kritik von Hobbes an den Irrtümern des (vermeintlichen) Aristotelismus zugleich die scotistische Wurzel der ontologischen Fiktionen offenlegt. 1. Immanuel Kants Kritik der rationalistischen Metaphsik Wie Kant in seinem Aufweis der „Paralogismen der reinen Vernunft“ gezeigt hat, folgt aus der skeptischen Reduktion des Wissens auf die Unbezweifelbarkeit des cogito nur die Notwendigkeit einer alles Denken begleitenden IchVorstellung, aber keine Gewißheit bezüglich der Substantialität eines denkenden Ich.28 „Das Bewußtsein seiner selbst [...] bei der inneren Wahrnehmung ist bloß empirisch, jederzeit wandelbar, es kann kein stehendes oder bleibendes Selbst in diesem Flusse innerer Erscheinungen geben.“29 Gemeint ist: Es kann kein 28 Kritik der reinen Vernunft, B 131. Vgl. dazu Manfred Frank, Gérard Raulet, Willem van Reijen (Hrsg.), Die Frage nach dem Subjekt, Frankfurt a.M. 1988 (insbesondere die Beiträge von Georg Mohr und Jacob Rogozinski). 29 Ebd., A 107 mit Bezug auf David Humes Bemerkung: „There are some philosophers, who imagine we are every moment intimately conscious of what we call our SELF. [...] But self or person is not any one impression, but that to which our several impressions and ideas are suppos’d to have a reference.“ (A Treatise of Human Nature, ed. by L.A. Selby-Bigge (P.H. Nidditch), Oxford 21980, S. 251). 13 Wissen um die Substantialität des Selbst geben, weil es auf Grund der durchgängigen Intentionalität des Erkennens eine von den jeweiligen Vorstellungsinhalten ablösbare reine Anschauung des Selbst nicht gibt. Diese wäre aber zuallererst gefordert, um Gewißheit über die Realität des „denkenden Ich“ zu erlangen.30 Daher bezeichnet auch das Wort „Ich“ „nur eine Substanz in der Idee, aber nicht in der Realität“.31 Der Fehler der Rationalisten besteht darin, nicht klar zwischen dem logischen und realen Gebrauch von ‘ich’ zu unterscheiden. „Die logische Erörterung des Denkens überhaupt wird fälschlich für eine metaphysische Bestimmung des Objekts gehalten.“32 Auch wenn „jedermann sich selbst notwendigerweise als Substanz, das Denken aber nur als Accidenzien seines Daseins und Bestimmungen seines Zustandes ansehen“33 muß, bedeutet dies nur die logische Notwendigkeit einer „Substanz im Begriffe“,34 die als Suppositum akzidenteller Bestimmungen stets mitgedacht, aber darum nicht schon als real erwiesen ist. „Man könnte auch sagen: Durch den Begriff ‘ich’ repräsentiert man sich selbst als Substanz, aber man repräsentiert dadurch nicht eine Substanz, jedenfalls ist es nicht bewiesen, daß man das tut.“35 Eine Philosophie der Person, die auch nach dem Scheitern der substantialen Deutung des Selbstbewußtseins die Selbstverhältnisse von Subjektivität und Moralität36 noch für identitätsbegründend hält, kann die Aporie der Identität dann nur durch einen Ad hoc - Perspektivismus vermeiden.37 2. Thomas Hobbes Kritik des missverstandenen Aristotelismus Eine aufschlußreiche Bemerkung von Hobbes zu der Verwechslung von logischem und realem Gebrauch eines Begriffs findet sich im vorletzten Kapitel 30 Kant hält es für ausgemacht, „daß reine Kategorien (und unter diesen auch die Substanz) an sich selbst keine objektive Bedeutung haben, wo ihnen nicht eine Anschauung unterlegt ist. [...] Ohne das sind sie lediglich Funktionen eines Urteils ohne [realen] Inhalt.“ (Kritik der reinen Vernunft, A 349). 31 Ebd., A 351. 32 Ebd., A 409. 33 Ebd., A 349. 34 Ebd., A 400. 35 Tobias Rosefeldt, Das logische Ich. Kant über den Gehalt des Begriffes von sich selbst, Berlin/Wien 2000, S. 71 (Herv. im Original). 36 So der Untertitel von D. Sturma, Philosophie der Person, Paderborn/ München/ Wien/ Zürich 2001. 37 „Die Identität der Person vollzieht sich in ontologischen, epistemologischen, epistemischen und moralischen Kontexten“ (D. Sturma, Philosophie der Person, S. 359, These 47) gemäß dem obersten Grundsatz der ganzen Abhandlung: „die Grenzen personaler Existenz und die Grenzen menschlichen Lebens fallen nicht zusammen“ (ebd., S. 357, G 1). 14 seines „Leviathan“, das man auch so überschreiben könnte: „What’s wrong with traditional philosophy“; sie lautet folgendermaßen: When we say, a Man, is, a living Body, we mean not that the Man is one thing, the Living Body another, and the Is, or Being a third: but that the Man, and the Living Body, is the same thing: because the Consequence, If he bee a Man, he is a living body, is a true Consequence, signified by that word Is. Therefore, to bee a Body, to bee Speaking, to Live, to See, and the like Infinitives; also Corporeity, Walking, Speaking, Life, Sight, and the like, that signifie just the same, are the Names of Nothing.38 In diese Liste solcher Fiktionen gehört dann auch der Begriff eines „Selbst“, das als selbständige Entität aus der formalen Unterscheidung zur Idee des Menschen gewonnen ist. Gleiches ließe sich vom Begriff des reinen Willens sagen, sofern dieser aus der begrifflichen Kontradistinktion zum Naturhaften bereits in seiner Realität erwiesen sein soll. Die sachliche Nähe seiner Kritik am Aristotelismus der Spätscholastik zu einer genuin aristotelischen Position blieb Hobbes allerdings verborgen. Als aristotelisch galt ihm jene Metaphysik, die in der von Duns Scotus herkommende Weise über formal bestimmbare Unterschiede im Sein des konkreten Einzeldinges zu den objektiven Korrelaten der Erkenntnis zu gelangen glaubte. Wie sehr diese traditionell gewordene Vorstellung von Metaphysik das Verständnis des Aristoteles verbaut (und mitfolgend das Urteil über Thomas von Aquin bestimmt) hat, zeigt die zweite Bemerkung von Hobbes. Sie zeigt jedoch zugleich, an welcher Stelle mit dem Abbau philosophischer Prinzipien begonnen werden müsste, die zu einer unhaltbaren Verdinglichung von Begriffsinhalten geführt hat. Hobbes schreibt in “De Corpore”: The abuse [of abstract names] proceeds from this, that some men seeing they can consider […] quantity, heat and other accidents, without considering their bodies or subjects (which they call abstracting, or making to exist apart by themselves) they speak of accidents, as if they might be separated from all bodies. And from hence proceed the gross errors of writers of metaphysics; for, because […] quantity may be considered without considering body, they think also that quantity may be without 38 Leviathan IV, 46 (Ed. C.B. McPherson), Harmandswort 1981, S. 691 (Herv. im Original). 15 body, and body without quantity; and that a body has quantity by the addition of quantity to it.39 „To consider without“ ist für Duns Scotus die Grundoperation der Metaphysik, sofern die Unterscheidung des formalen Gehalts unserer Gedanken tiefer in das Wesen der Dinge eindringen soll als jede Wissenschaft sonst es vermag.40 Das Resultat dieser Art von Metaphysik ist ein Begriff des Menschen, dem die Personalität als eigener Sachgehalt hinzugefügt sein kann aber nicht muß – „in addition of Corporeity, Walking, Speaking, Life, Sight, and the like, wie es Hobbes zutreffend beschrieben hat. In genauer Umkehr der ursprünglichen Absicht ist es dann nicht mehr eine Frage der Metaphysik, sondern eine empirische Frage, ob dieser konkrete Mensch eine Person ist oder nicht. Wer die Person unmittelbar in das Selbstsein oder den freien Willen setzt, und darin eine vom übrigen Sein des Menschen verschiedene Entität zu sehen glaubt, erliegt nicht bloß einer Fiktion. Er verspielt damit auch zugleich die Möglichkeit, dem Naturalismus wirksam zu begegnen. Denn was könnte er mehr vorbringen als die tautologische Folgerung: „Wenn das Selbst ist, dann ist es nur das Selbst.“ Zu erweisen wäre indes nicht die Unterschiedenheit des Selbst sondern eine nicht bloß kontingente Identität mit dem Sein des Menschen, analog zu der von Hobbes formulierten Bedingung, zwei begrifflich verschiedene Sachgehalte als sachlich identisch zu erweisen: „If hee bee a Man, hee is a living Body“. So auch: „Wenn er ein Mensch ist, dann ist er eine Person“. Thomas von Aquin hat im Festhalten an der Persondefinition des Boethius das ontologische Fundament der substantiellen Identität von Mensch und Person bewahrt. Die Substantialität des Menschen ist nicht bloß ein Kontext oder ein „Ort“, an dem das Selbst oder die Person begegnet. „Person“ (oder neuzeitlich „Selbst“) – auf den Namen kommt es nicht an – ist ein „nomen dignitatis“, ein 39 De Corpore 3, 4. The English Works of Thomas Hobbes, ed. By W. Moleswort, Darmstadt 1966, Bd. 1, 33f. (Herv. von mir) 40 Die Unterscheidung formaler Gehalte unseres Denkens gehört daher seit Duns Scotus wesentlich zur Metaphysik und nicht bloß zur Logik. So heißt es beispielsweise in der Expositio zur aristotelischen Metaphysik von Antonius Andreas (zum VI. Buch, I, 1, n. 4; (Ed. Wadding, IV, 206): „In dividendo Metaphysicus est et quoad processus rationis logicus.“ 16 Name für die Würde des Menschen. Die Person ist nicht im Menschen wie ein Teil in einem umfassenderen Sein.41 Sie selbst ist das Umfassende, dem eine bestimmte (menschliche) Natur zukommt. Darum kann auch das Sein der Seele mit dem Sein der Person nur teilidentisch, aber nicht umfangsgleich sein, denn die Seele ist wohl Prinzip des Menschen, aber nicht vollständige Substanz. Gleiches gilt für das „Ich“ oder das „Selbst“. 42 Es existiert weder real noch formal trennbar vom Seinvollzug des Menschen als individueller leiblicher Substanz. Die Begriffe „Mensch“ und „Person“ sind dagegen umfangsgleich, weshalb menschliches Leben als solches immer schon personales Leben ist. Jede am Leitfaden der Sprache gedachte Zusammensetzung führt in die Irre. Auch wenn die Bedeutungen der Worte „Mensch“, „Person“, „Selbst“ verschieden sind: das Selbst kommt menschlichen Personen zu als Mensch. 41 Vgl. die Diskussion des boethianischen Personbegriffs in De Pot. 9, 1. In I Ad Cor. XV, 9: „Anima autem cum sit pars corporis hominis, non est totus homo, et anima mea non est ego.” 42