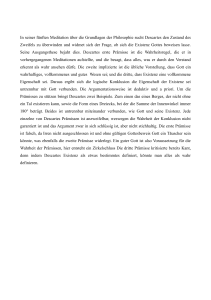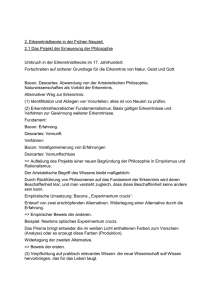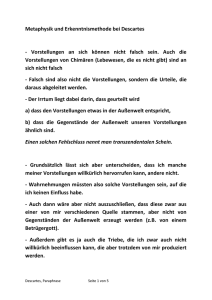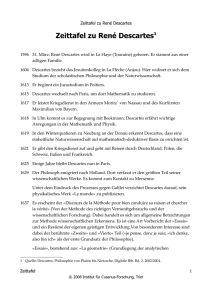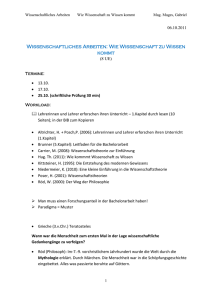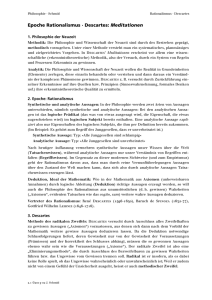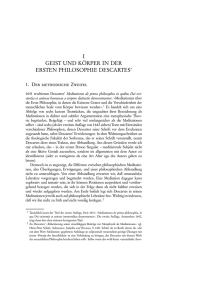Rene Descartes - Mathematik
Werbung

Kurs Medizinische Psychologie 4.Juli 1998 Felix Joachimski, [email protected] René Descartes – Discours de la méthode Leben und Werke. Geboren am 31. März 1596 in La Haye. Ausbildung an der Jesuitenschule La Flèche, Studium der Jurisprudenz. Danach Besuch der internationalen Kriegsschule des Prinzen Moritz von Nassau in Holland, Reisen nach Dänemark und Deutschland, Beteiligung an Feldzügen des 30jährigen Krieges, längerer Aufenthalt in Italien, dann mehrjährige Teilnahme am Pariser Gesellschafts- und Wissenschaftsleben. 1628 Übersiedelung ins friedliche, protestantische Holland. Dort Arbeit an der Metaphysik, anschließend am Traktat über die Welt oder das Licht (Le monde). Nach Verurteilung Galileis (1633) wird das Werk zurückgehalten. Statt dessen 1637 Discours de la méthode. 1641 Meditationes metaphysicae (Grundlegung der Metaphysik durch den universalen Zweifel, gegliedert in sechs Meditationen, Prinzipien der neuen Physik). 1644 Principia philosophiae. 1649 Les passions de l’âme (Leidenschaften und Moral); Reise nach Stockholm zur Unterrichtung der Königin Christine. 11. Februar 1650 Tod durch Lungenentzündung. Posthum veröffentlicht: Regulae ad directionem ingenii, La recherche de la Vérité, Entretien avec Burman. Descartes Lehre bestimmt die Metaphysik der Neuzeit, vor allem des 17. Jahrhunderts. Er gilt als Reformator der Philosophie, Befreier der Naturwissenschaften und Entdecker der analytischen Geometrie. Ziele. Neubegründung der Metaphysik auf der Grundlage des reinen Denkens und des universellen Zweifels an Sinneswahrnehmung, Vorurteilen und historischem Wissen. Aufbau der Naturwissenschaften aus der Wurzel dieser Metaphysik auf dem Boden einer mathematischen Methodik (Mathesis universalis als Theorie der Beziehungen und Funktionen) und Rückführung auf die grundlegenden Konzepte von Funktion, Maß/Ausdehnung, Ordnung und Bewegung. Form und Präsentation. Weil Descartes ehe nach dem Warum? als dem Was? sucht, erachtet er die Methode, den Weg, das Finden der Wahrheit als wertvoller als den eigentlichen Ertrag. Daher wählt er die historisch-rückschauende Darstellung, um den Leser an seiner Bezweiflung zunächst des Bildungs-, dann des Praxiswissens teilhaben zu lassen. Seine Kritik an Scholastik, Mittelalter, Rennaissance und Humanismus wird dadurch relativiert, daß er seine Maximen und Regeln nicht generalisiert wissen will. Er zieht sich auf die unangreifbare Position des Jedermann zurück, der aber dennoch überragende Erfahrungen sowohl als Gelehrter der Theorie als auch in der Erfahrung und Menschenkenntnis hat. I. Teil: Kritik an den Wissenschaften. Er sei durch das, was er gelernt hat, unwissender geworden. Das Wissen verliere sich in bloß wahrscheinlichen Aussagen, unscharfen Begriffen und syllogistischer Verdunkelung. In der Tat war das Wissen der Scholastik unhandlich und schwer erlernbar, enzyklopädisch, punktuell und Literatur-hörig, vor allem in der Metaphysik, die sich seit mehreren Jahrhunderten wieder an Aristoteles ausrichtete. „Wir würden z.B. niemals dadurch zu Mathematikern werden, daß wir alle von andern gefundenen Beweise im Gedächtnis behielten, wenn wir nicht auch imstande wären, mit unserm Ingenium irgendwelche Probleme aufzulösen. Wir würden niemals zu Philosophen werden dadurch, daß wir alle Argumente von Platon und des Aristoteles gelesen hätten, wenn wir kein festes Urteil über in Rede stehende Gegenstände zu fällen vermöchten. Auf diese Weise hätten wir nämlich offenbar nicht Wissenschaft gelernt, sondern Geschichte.“ (Regulae 367) Nach einer ironischen Musterung der verschiedenen Fakultäten berichtet er von dem Entschluß, nach dem scholastischen Studium der Vernunftwahrheiten durch reine Anschauung und puren Verstand, nun reisend im Studium der Realität die Tatsachenwahrheiten zu lernen und die jedem zueigene, praktische Vernunft (bon sens) einzuüben. Nachdem die Erkenntnisquelle der Erfahrung die Unzulänglichkeit des Bildungswissens fühlbar gemacht hat, zeigt sich jedoch auch die Beschränktheit der Alltagserkenntnis: Der für die Nöte des Alltags ausreichende gesunde Verstand trägt nicht zum Verständnis der Welt bei. Descartes sieht daher, daß die wahre Erkenntnis, Wissenschaften und Metaphysik, reformiert werden müssen. Dabei setzt er methodisch begründet auf einen vollkommenen Neuaufbau der Grundlagen im Sinne einer universalen, mathematischen Einfachheit. Er schränkt die Auswirkungen dieses revolutionären Umsturzes dadurch ein, daß er nur seine eigene wissenschaftliche Anschauung neu konstruieren und niemand zur Nachahmung anleiten will. III. Teil – Provisorische Moral. Voraussetzung der noch zu erläuternden Meditation ist stille Einsamkeit, Muße und Freisein von praktischen Sorgen. Auch die Befreiung von Vorurteilen, sogar die allgemeine Freiheit des Urteils ist notwendig. Bevor nun Descartes im universellen Zweifel alles Wissen und alle Moral über Bord wirft, legt er sich eine provisorische Moral zurecht, die es ermöglichen soll, seine Meditationen vom Alltag unbehelligt durchzuführen. Da Descartes nach seiner Metaphysik sein Versprechen einer umfassenden Moralanalyse nicht eingelöst hat, kann man vermuten, daß sie tatsächlich als verbindlich konzipiert wurde. Umso überraschender ist die Freiheit, die er sich dabei zugesteht: Aus eigenen Stücken entschließt er sich, die Sitten der Gesellschaft anzuerkennen. „den Gesetzen und Sitten meines Vaterlandes zu gehorchen, an der Religion beharrlich festzuhalten [...] und mich in allem anderen nach den maßvollsten, jeder Übertreibung fernsten Überzeugungen zu richten, die von den Besonnensten [...] in die Tat umgesetzt werden.“ „in meinen Handlungen so fest entschlossen zu sein wie es möglich und den zweifelhaftesten Ansichten, wenn ich mich einmal für sie entschieden hätte, nicht weniger beharrlich zu folgen, als wären sie ganz gewiß.“ „eher mich selbst zu besiegen als das Schicksal, eher meine Wünsche zu ändern als die Weltordnung und überhaupt mich an den Gedanken zu gewöhnen, daß nichts völlig in unserer Macht steht außer unseren Gedanken.“ Rolle der Religion. Da Descartes über die von ihm behandelten Inhalte frei verfügen muß, schränkt er mit den allgemeinen Dingen der Lebensführung auch die Religion in einem Tabu aus und läßt sie unberührt. Insofern ist er radikaler als die Aufklärer, welche aus der Philosophie eine Religion zu formen trachteten: Er kümmert sich nicht um die herkömmliche Rangordnung, weil die Religion nicht zu menschlichem Wissen in Konkurrenz tritt. Der Zweifel erstreckt sich nicht auf die Lebensführung und damit auf die Religion, weil er rein theoretisch, spekulativ ist. Die Wahrheitsfindung in praktischen Glaubenssachen obliegt der Kirche. II. Teil (Regulae) – die Methodik. Nachdem er sich von allen Vorurteilen, triebhaften Einflüssen und (wissenschaftlichen) Voraussetzungen abschneiden will, um nur noch dem gesunden Verstande zu folgen, legt Descartes sich für den Weg durch die Dunkelheit einige Regeln zurecht, die das Reglement der wissenschaftlichen Gesellschaft ersetzen sollen. Dabei geht er nicht von einem abstrakten Wahrheits- oder Seinsbegriff aus, sondern vom endlichen, menschlichen Ich aus, dem er strenge Auflagen erteilt, jedoch nicht, um es – wie die Logik – zu disziplinieren, sondern, um eine sichere, findige Entfaltung (Ars inveniendi) zu gewährleisten. Nach der Katharsis im Feuer des hyperbolischen Zweifels wird sich zeigen, daß diese Regeln auch hinfort Bestand und wissenschaftliche Relevanz haben. 1. „niemals eine Sache als wahr anzuerkennen, von der ich nicht evidentermaßen [évidemment] erkenne, daß sie wahr ist: d.h. Übereilung und Vorurteile sorgfältig zu vermeiden und über nichts zu urteilen, was sich meinem Denken nicht so klar und deutlich darstellte, daß ich keinen Anlaß hätte, daran zu zweifeln.“ (Regel der Evidenz) Der Philosoph nimmt sich also Zeit, bevor er ein Urteil fällt, über dessen Güte er sich selbst mit dem Zweifel Rechenschaft ablegen kann. Als Grundsatz des Erkennens gilt das Zweifel-resistente Konzipieren als Intuition (Praesens evidentia), durch die das Subjekt in perfekter Erkenntnisfähigkeit das Objekt im „natürlichen Licht“ wahrnimmt. Durch die Zeitbedingtheit und Zeithaftigkeit unterscheidet sich die menschliche Intuition von der göttlichen. Der Intuition ordnet sich die diskursive Erkenntnis nach, die ableitend (Deduktion) oder analytisch erfolgt und das Prinzip der Mathesis universalis verkörpert. Erkannt werden können äußere Dinge und Bewußtseinszustände (Ideen, Urteile, Emotionen). In seiner intuitiven Wahrnehmung nimmt der Mensch an einer (und weil es nur eine gibt: der gesamten) göttlichen Wahrheit teil, aber er wird dadurch nicht Gott-gleich. 2. „jede einzelne Schwierigkeit, die ich ergründen will, in möglichst viele Abteilungen zu zerlegen, soweit nämlich als nötig, um sie leichter aufzulösen“ (Regel der Analyse) Diese Regel greift, wenn der Gegenstand nicht mit Regel 1 klar erfaßt werden konnte. Dahinter steht die optimistische Auffassung, daß alle Wissenschaften und auch die Metaphysik einen mathematischen, einfachen Aufbau zeigen; allerdings mit einem weniger formalistischen Begriff von Mathematik. Gleichzeitig offenbart Descartes sich als Identitätsphilosoph. 3. „in der gehörigen Ordnung zu denken, d.h. mit den einfachsten und am leichtesten zu durchschauenden Dingen zu beginnen, um so nach und nach, gleichsam über Stufen, bis zur Erkenntnis der zusammengesetztesten aufzusteigen“ (Regel der methodischen Ordnung) Hier wird die sukzessive Anwendung der Vernunft auf eine Mehrzahl zu erkennender Objekte behandelt. Die aus der Erkenntniskraft des Ich entstehende Gedankenordnung durch die Relation „bekannter“ (notior) ist rational, aber nicht deduktiv und ignoriert damit die Aristotelische Seinsordnung. 4. „überall Aufzählungen der Gegenstände zu machen, die der Vollständigkeit möglichst nahekommen, und allgemeine Übersichten anzufertigen; dies soll mir Gewißheit darüber verschaffen, daß ich nichts ausgelassen habe“ (Regel der Synthese) Fortgang der Meditation Der universelle Zweifel begründet sich in der Kritik der Sinneserkenntnis: Existenz von Sinnestäuschungen; auch Träume sind wahrnehmbar, aber nicht wahr; durch das Konzept des Betrüger-Gottes (deus deceptor): Wenn Gott allmächtig ist, darf er den Menschen in seiner Erkenntnis täuschen. Es läßt sich mithin ein Dämon vorstellen, der beliebig falsche Auffassungen von der Welt vorgaukelt. Der Zweifel ist subjektiv; Ich hinterfrage die Gewißheit [die Art und den Grad] der Erkenntnis, nicht den Inhalt. Im Prozeß der Negation wird alles, was bezweifelbar, als falsch angenommen. Da beispielsweise die Güte Gottes bezweifelt werden kann, ist anzunehmen, daß er schlecht sein kann (Betrüger-Gott). Die ontologische Einsamkeit. Vom Feuer des Zweifels wird alles verzehrt, bis nur noch der Zweifel selbst bleibt. Nun wird sich das zweifelnde Individuum seiner Tätigkeit bewußt und erkennt, daß er sich seiner zweifelnden Tätigkeit gewiß ist und damit selbst existieren muß. Die Urgewißheit der eigenen Existenz ist eine intellektuelle Anschauung: „Aber es gibt einen, ich weiß nicht welchen höchst mächtigen und verschlagenen Betrüger, der mich geflissentlich stets täuscht; aber wenn er mich täuscht, bin ich also zweifellaus auch; und er täusche mich, so viel er kann, niemanls wird er dennoch bewirken, daß ich nichts bin, solange ich denken werde, ich sei etwas. Derart muß, alles genug und übergenug durchdacht, schließlich statuiert werden: dieser Satz, ich bin, ich existiere, ist notwendig wahr, sooft er von mir gesagt oder im Geise konzipiert wird.“ (Meditationes metaphysicae, 2. Meditation) Das Selbst wird seines Zweifelns gewahr und erkennt damit die unverfälschbare eigene Existenz. Sie ist faktisch und kontingent abhängig vom Denken (Cogito ergo sum) und damit zeitbedingt. Es ergibt sich sofort die wichtigste Instanz des Widerspruchsprinzips: Ich denke und bin also etwas und nicht nichts; beides zugleich kann folglich nicht sein, weil das Nichts keine Affektionen oder Qualitäten hat. Res cogitans. Was bin ich nun? Sicherlich Mir meiner bewußt, denkend (cogitans). Die Existenz des Körpers kann hingegen noch nicht gefolgert werden. Auch erkenne ich, daß ich sehe, wenngleich die Existenz des Gesehenen bezweifelt werden kann. Wenn ich etwas sehe, so habe ich also eine Idee (eine bewußte Vorstellung von Dingen) davon; deren Beziehung zur aktualen Realität ist aber nicht klar. Ideen kommt in ihrer Übereinstimmung mit der aktualen/formalen Realität Wahr- oder Falschheit im eigentlichen Sinne zu (objektive Realität). Sie werden nach ihrer Komplexität geordnet: Ideen der geistigen Substanz besitzen mehr objektive Realität, weil sie nicht wie materielle Substanz teilbar ist und Ausdehnung besitzt. Der kausale Gottesbeweis. Die Existenz Gottes als Ursache der Welt wird aus der Gottesidee bewiesen, die dem menschlichen Geist unmittelbar einsichtig ist. Als Gott(esidee) wird das schlechthin vollkommene Sein, die Fülle aller Vollkommenheiten in der objektiven Realität als absolute Wahrheit aufgefaßt. In dieser Dimension ist sie uns wesentlich unbegreiflich, z.B. weil für uns die göttliche Identität von Erkennen und Wollen unerkannt ist, sind wir doch selbst Irrtum und Zweifel ausgeliefert. Die Gottesidee muß insofern eine unvollkommene Konzeption sein. Gemäß dem Ordnungsprinzip repräsentieren die ersten Ideen mit der größten Wahrheit notwendig formales Sein. Da die formale Realität mein Denken und Wirken beeinflußt, ist sie nicht nichts. Also muß sie von einer vollkommeneren Idee verursacht sein (Kausalprinzip der Ideae adventitiae), die notgedrungen formale Realität besitzt. Nun könnte aber die res cogitans Ursache der Gottesidee sein. Weil sie jedoch endlich und unvollkommen ist und die Gottesidee das Maximum an Vollkommenheit beinhaltet, kann nur Gott in formaler Realität der zureichende Grund für die Gottesidee sein. Voraussetzungen dieses Beweises: 0. Kausalprinzip: Ursachen von Ideen besitzen eine größere formale Realität. 1. Das Kausalprinzip ist auf die Gottesidee anwendbar. 2. Die Gottesidee ist nicht die Verneinung des Endlichen (welches schon als Verneinung in der Idee des Endlichen enthalten ist), sondern die einfache Idee vollkommenen Seins. Die Gottesidee kann nicht material falsch sein. 3. Die Vollkommenheit Gottes ist nicht als grenzenlos amplifizierte Perfektion des Menschen zu denken, sondern resultiert aus der Berührung des unendlichen Seins mit dem Geiste. Leib-Seele-Dualität. Descartes kennt nur zwei sich ausschließende Attribute (Wesenheiten) von Substanz: Denken und Ausdehnung. Das Ich ist res cogitans und res extensa zugleich, aber in getrennten Substanzen: Seele und Körper. Der Leib ist für Descartes kein bloßes Hindernis beim reinen Erkennen, sondern Hilfsmittel: Er sorgt für das Gedächtnis und damit Deduktion und die Ansammlung von Wissen. Allerdings muß sich die Vernunft methodisch wappnen, wenn sie den Körper in seiner Sinnlichkeit als Erkenntnisorgan benutzt. Descartes ist sich des Problems der trotz der Unterschiedlichkeit offenbaren Einheit von Seele und Körper bewußt – im Laufe seines Lebens sucht er verschiedene Erklärungen dafür. „die Dinge schließlich, die zu der Einheit von Körper und Seele gehören, lassen sich nur dunkel durch das reine Denken erkennen, und auch nicht besser durch das von der Einbildungskraft unterstützte Denken; dagegen lassen sie sich sehr klar [nicht deutlich?] durch die Sinne erkennen. So kommt es, daß diejenigen, welche niemals philosophieren und nur ihre Sinne gebrauchen, überhaupt nicht daran zweifeln, daß die Seele den Körper in Bewegung setze und daß der Körper auf die Seele einwirke; sie betrachten dabei Körper und Seele als ein und dieselbe Sache, d.h. sie erfassen die Einheit beider.“ (Brief an Elisabeth, Pfalzgräfin vom Rhein, 28.6.1643) Alles wird gut. Weil Gott als gut erkannt ist, stirbt das Konzept des deus deceptor und wir dürfen uns (mit Gottes Hilfe) wieder auf das Konzept der Intuition verlassen; mithin erlangen die vier Regulae, die uns durch das kathartische Feuer des universalen Zweifels geführt haben, nun erst recht Geltung und wir dürfen unserer Wahrnehmung – nunmehr allerdings gewarnt vor der Tücke möglicher Täuschungen – mit dem Prinzip des Zweifels begegnen, wohlwissend daß Urteile darüber immer Gewißheit erfordern. Der Autonomie des Denkens muß sich nun die Autopsie des geschulten Erkennens beigesellen. Bewußtsein und damit Urteil ist jedoch zugleich Wahrnehmung und Willen. In der Wahrnehmung sind wir beschränkt, im Willen Gott-gleich vollkommen. Im Irrtum weichen beide Ebenen auseinander (bona mens beruht auf bona voluntas), er ist jedoch hauptsächlich ein ethischer Mangel. Daher ist die zweifelnde Prüfung allen Wissens nicht nur logisch, sondern sittlich geboten. Literatur. Bridoux, A. (Hrsg.). Descartes – Oevres et Lettres. Paris 1953. Cassirer, E.. Descartes – Lehre, Persönlichkeit, Wirkung. Hamburg 1995. Descartes, R.. Von der Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der wissenschaftlichen Forschung (1637). In: Texte für den Kursus Medizinische Psychologie II, LMU München 1998. Röd, W. Descartes – Die Genese des Cartesianischen Rationalismus. München 1982. Schmidt, G. Aufklärung und Metaphysik. Tübingen 1965. Speck, J.(Hrsg.). Grundprobleme der großen Philosophen - Philosophie der Neuzeit I. Göttingen 1979.