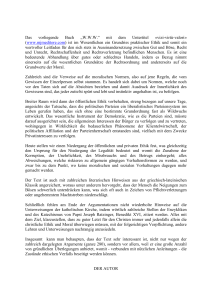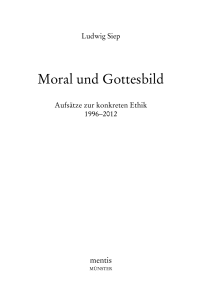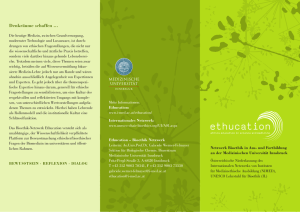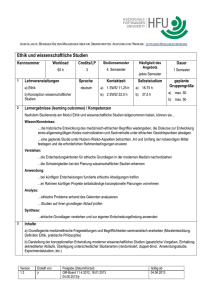ethik– report - PH Weingarten
Werbung

e t h i k– report Nr.1 Januar/Februar 2006 Zentrum für Politisch-ökonomische und Ethische Bildung Editorial • • • Informationen und Rezensionen zu ethischen Themen aus Tagespresse, Fachzeitschriften, Gremien und von Fachtagungen Presse- und Literaturspiegel • • • • • herausgegeben von Mitgliedern des Zentrums für politisch-ökonomische und ethische Bildung Leibnizstraße 3 88250 Weingarten Streit um’s Sterben: Die Debatte Spaemann vs. Gerhardt Uniklinik lässt Sterbehilfe zu Strafrechtler für Legalisierung der Sterbehilfe Biopolitik der großen Koalition 1000. Hinrichtung in den USA Rezensionen • Markus Dederich: Menschen mit Behinderung zwischen Ausschluss und Anerkennung Tagung • Tel.: 0751/5018377 e-mail: [email protected] Neuer Arbeitsrahmen Treffen des Kooperationskreises Schwerpunkte der Ausgabe Bildung – Subjekt – Ethik. Bildung und Verantwortung im Zeitalter der Biotechnologie. Tagung des Instituts für Bildung und Ethik an der Pädagogischen Hochschule Weingarten, Weingarten 27.29.10. 2005 Editorial Liebe Leserin, lieber Leser, mit der ersten Ausgabe des ethik-reportes im Jahr 2006 beginnt eine neue Ära unserer Arbeit, die durch veränderte Rahmenbedingungen gekennzeichnet ist. Neu ist zunächst – wie Sie schon auf dem Titelblatt sehen können – das Dach unter dem unsere Forschungsarbeit stattfindet. Es ist nicht mehr das Institut für Bildung und Ethik, sondern das Zentrum für politisch-ökonomische und ethische Bildung, das nun als „Firmenschild“ fungiert. Neu sind damit auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Politologie, Soziologie und Ökonomie und deren Forschungsvorhaben. Wir sind mitten in der Kennenlernphase und freuen uns auf die erweiterten Möglichkeiten interdisziplinärer Zusammenarbeit! Noch nicht abschließend geklärt sind allerdings einige Fragen der Binnenorganisation: Nicht alle Mitglieder des Zentrums arbeiten zu ethischen Fragen, und die Bezeichnung der Herausgeber des ethik-reportes als „Mitglieder des Zentrums für politisch-ökonomische und ethische Bildung“ erscheint uns unbefriedigend. Um eine bessere Identifizierbarkeit unserer Forschungsarbeit zu gewährleisten, bemühen wir uns um die Etablierung einer Substruktur innerhalb des Zentrums. Im Gespräch ist etwa eine „Forschungsgruppe Ethik“. Von diesen Fragen unberührt bleiben die Inhalte unserer Arbeit. Wir werden weiterhin etwa 9 Ausgaben des ethik-reportes pro Jahr herausgeben und Sie auf dem aktuellen Stand ethisch relevanter Themen halten. Wir sind – die tatkräftige Unterstützung des Rektorates der PH Weingarten vorausgesetzt – zuversichtlich, auch die nächsten Forschungsschritte in bewährt anerkannter Weise zu tun. Ein Stück dieser Anerkennung war auf der letzten Sitzung des Kooperationskreises, der am 18. Januar in der PH Weingarten tagte, zu verspüren. Vorstände bzw. deren Vertreter von acht namhaften Sozialunternehmen aus Deutschland gaben dem Institut für Bildung und Ethik positive Rückmeldungen für die bisherige Arbeit am ethikreport und für die 2005 erschienenen Studien zur Patientenverfügung und zur Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Sie gaben der Hoffnung Ausdruck, dass sich unsere Arbeit auch weiterhin so hilfreich für die Tätigkeit der Unternehmen auswirken werde. Folgende Studien wurden für 2006 in Auf- 3 trag gegeben: Ethische Grundlagen sozialunternehmerischen Handelns und Verteilungsgerechtigkeit im Sozialstaat und innerhalb von Sozialunternehmen. Für die aktuelle Nummer haben wir uns für drei Schwerpunkte entschieden. Im Literatur- und Pressespiegel wird das Thema Sterben und Tod aus unterschiedlichen Perspektiven angegangen. Die Philosophen Robert Spaemann und Volker Gerhardt haben sich in der Stuttgarter Zeitung über mehrere Ausgaben einen scharfen Streit über die Sterbehilfe geliefert. Wir zeichnen den Kern der Debatte als Impuls zum Weiterdenken nach. Die Lausanner Uniklinik lässt erstmals Sterbehilfe, genauer: den Tod auf Verlangen zu. Für eine Legalisierung der Sterbehilfe setzen sich in einem Aufsehen erregenden „Alternativ-Entwurf Sterbebegleitung“ 20 Strafrechtler aus Österreich, der Schweiz und Deutschland ein. Die Biopolitik der großen Koalition steht vor großen Herausforderungen. Wir beschreiben die bioethischen Zielkonflikte der neuen Regierung. Schließlich wurde im Dezember ein makaberes Jubiläum in den USA begangen: Die 1000. Hinrichtung seit 1973 löste erneut Diskussionen über die Zulässigkeit der Todesstrafe aus. Im Rezensionsteil widmen wir uns der lesenswerten Grundlegung einer Ethik der Anerkennung für die Behindertenpädagogik von Markus Dederich vom Fachbereich Rehabilitationswissenschaften an der Universität Dortmund. Der Titel des Buches: Menschen mit Behinderung zwischen Ausschluss und Anerkennung verweist auf das Exklusionsrisiko von Menschen mit Behinderungen. Sein vorwiegend normativ-moralisch angelegter Ansatz erlaubt Vorüberlegungen zu einer Ethik und Politik der Anerkennung, die nicht nur für Behindertenpädagogen interessant sein dürften. Im Bericht von der Tagung Bildung – Subjekt – Ethik. Bildung und Verantwortung im Zeitalter der Biotechnologie, die im Oktober 2005 vom IBE im Rahmen des Forschungs- und Nachwuchskollegs „Bioethik im Horizont ethischer Bildung“ veranstaltet wurde, fassen Eike Bohlken, Julia Horlacher und Christine Mann die Beiträge der Referentinnen und Referenten und die Diskussion zusammen. Für die Redaktion: Hans-Martin Brüll und Eike Bohlken 4 Presse- und Literaturspiegel Der Streit um’s Sterben: Spaemann vs. Gerhardt Im Herbst vergangenen Jahres kam es in der Stuttgarter Zeitung zu einer heftigen Kontroverse zwischen den Philosophen Robert Spaemann und Volker Gerhardt um die ethische Bewertung der aktiven Sterbehilfe. Die wichtigsten Argumentationsstränge werden im Folgenden nachgezeichnet. In diesem zum Teil hochemotional geführten Streit ging es nicht um ein Pro und Kontra in der Frage der Zulässigkeit der aktiven Sterbehilfe. Beide Autoren sprechen sich einhellig dagegen aus. Interessant ist, wie von beiden Seiten gegen die aktive Sterbehilfe argumentiert wird. Spaemann beginnt die Kontroverse mit einem Plädoyer für die Achtung des Lebens mit dem programmatischen Titel: „Sterbehilfe ist nur ein anderes Wort für Töten“. Er sieht in der Befürwortung der aktiven Sterbehilfe eine sachliche Parallele mit der kriminellen Praxis der Nationalsozialisten. In Zeiten der Knappheit von Ressourcen und angesichts des Problems der Altersversorgung besäße die aktive Sterbehilfe „den Charme einer sehr billigen Endlösung“. Auch die Nazis hätten nicht nur im Interesse des vermeintlichen Volkswohls getötet. Im damaligen Propagandafilm „Ich klage an“ sei ausdrücklich mit der individuellen Würde des Patienten und dem Mitleid mit dem Patienten für die Euthanasie geworben worden. Spaemann argumentiert gegen die Euthanasie mit der grundgesetzlich geforderten Achtung des Menschen vor dem Menschen. Als „einziges Kriterium“ gegen das Töten sieht er die Abstammung von Menschen. Andernfalls dürften auch Schlafende oder Bewusstlose schmerzlos getötet werden. Die Anerkennung des Menschen werde nicht per Mehrheitsbeschluss aufgrund bestimmter Merkmale „verliehen“, sondern sei eine unhinterfragbare Voraussetzung. Der Mensch sei Freiheitssubjekt. Die Freiheit lasse auch die Möglichkeit des individuellen Selbstmordes zu. Allerdings habe der Suizidierende nicht das Recht, von einem anderen die Worte: „Du sollst nicht mehr sein“ erbitten. Wenn er dieses Recht hätte, könnte daraus eine Pflicht abgeleitet werden. Aus der rechtlichen Möglichkeit der Tötung auf Verlangen wird nach Spaemann mit zwingender Logik das Verlangen nach Tötung produziert. Dem Argument, Tötung auf Verlangen sei ein Akt der Selbstbestimmung, wirft Spaemann Zynismus vor. Erfahrungsgemäß würden Tötungswünsche nicht aus Gründen des Schmerzes sondern aus Angst vor Verlassenheit geäußert. Doch statt Zuwendung, Solidarität und Linderung zu erfahren, werde eine „fiktive Selbstbestimmung“ unterstellt, um sich persönlich und gesell- 5 schaftlich der Solidarisierungspflicht zu entziehen: „,Du sollst nicht mehr sein‘ ist mithin der krasseste Ausdruck der Entsolidarisierung“. Spaemanns Fazit lautet: Gegen die Wiederbelebung des Euthanasiegedankens müssen die neuen Praktiken der Lebensverlängerung und die Explosion der Kosten kritisch hinterfragt werden. Eine Lebensverlängerung um jeden Preis müsse ebenso ausgeschlossen werden wie die aktive Sterbehilfe, „ein anderes Wort für Töten“. „Die Hospizbewegung nicht die Euthanasiebewegung ist die menschenwürdige Antwort auf unsere Situation.“ Der Diskussionseröffnung folgte eine scharfe Entgegnung von Volker Gerhardt unter dem Titel: „Sturmangriff auf eine offene Tür“. Er konzidiert zwar Einigkeit in der ethisch begründeten Ablehnung eines Rechtes auf Tötung auf Verlangen. Gegen Spaemanns „paternalistisches“ Verdikt gegen einen selbst bestimmten Umgang mit dem eigenen Tod betont Gerhardt den Vorrang der Selbstbestimmung. Der Mensch werde nicht zum Menschen, weil er vom Menschen abstammt. Die Würde des Menschen ergäbe sich stattdessen aus der Selbstbestimmung des Menschen, die im Gebrauch der menschlichen Freiheit besteht. Dieser „Grundbegriff der alteuropäischen Ethik“ hebe eine von Bevormundung freie Lebensführung hervor. Selbstbestimmung „schließt Fürsorge und Solidarität nicht aus, gibt der Freiheit aber den Vorrang“. In der Replik wehrt sich Spaemann gegen den Paternalismusvorwurf. Die Überzeugung, nicht töten zu dürfen, hätte nichts mit paternalistischer Bevormundung zu tun. Vielmehr sei die liberale holländische Euthanasiepraxis paternalistisch, „bei der sich Menschen anmaßen zu beurteilen, ob ein Todeswunsch eines Patienten gerechtfertigt ist oder nicht“. Spaemann weiß sich zwar eins mit Gerhardt, dass die Würde des Menschen mit seiner Fähigkeit zur Selbstbestimmung zusammenhängt. Allerdings hätten alle Menschen an der Gattungsnatur teil, auch die, die der Selbstbestimmung noch nicht, nicht mehr oder nie fähig sind. „Die Menschenwürde gründet zwar nicht in der Abstammung, aber die Abstammung umschreibt den Kreis derer, denen diese Würde zukommt“. Gerhardt beendet die Debatte mit einem Plädoyer für die Selbstbestimmung, das er in zehn Punkten zusammenfasst. Um das Sterben müsse in einer liberalen Gesellschaft gestritten werden dürfen. Gerhardt sieht in dem Vorrang der Betreuung vor der Selbstständigkeit eine paternalistische Denkhaltung und plädiert für eine Selbstbestimmung, die sich mit der Solidarität mit den Sterbenden, z.B. in der Hospizbewegung verbindet. Dabei gelte die grundsätzliche Pflicht zur Lebenserhaltung. Für den 6 Suizid gebe es keinen vernünftigen und moralischen Grund. Deshalb gelte eine Beistandspflicht von Freunden, Nachbarn und Angehörigen, vor allem bei alterslebensmüden Menschen. Dennoch gebe es Situationen, die für den Betroffenen ausweglos erscheinen. Deswegen sei es auch richtig, dass der Suizidversuch nicht unter Strafe gestellt wird. Da er straffrei ist, ist es nach Gerhardt auch konsequent, dass man von dem der Beihilfe leistet, nicht verlangt, er habe dem Todgeweihten das Leben zu retten. Dies müsse auch für Ärzte gelten. Tötung auf Verlangen stelle eine schwere moralische Zumutung dar. Niemand dürfe genötigt werden, ihr zu entsprechen. Gerhardt plädiert an den Gesetzgeber, Kriterien zu benennen, wie das Eingehen auf den Todeswunsch des Patienten zu werten sei. Definitiv bedürfe es im Beihilfefall als Ausnahmefall einer rechtlichen Prüfung. Die aktive Sterbehilfe wertet Gerhardt als Mord. Allerdings könnte der Druck auf die Ablehnungsfront gegen die aktive Sterbehilfe noch anwachsen, wenn es zu einer Kommerzialisierung der Sterbehilfe komme. Um so notwendiger ist für Gerhardt die juridische Anerkennung der Patientenverfügung, die „den geschäftstüchtigen Todesengeln Wind aus den Flügeln nehmen“ könnte. Quellen: Stuttgarter Zeitung Robert Spaemann: Sterbehilfe ist nur ein anderes Wort für Töten vom 26.10.05, Volker Gerhardt: Sturmangriff auf eine offene Tür vom 5.11.05, Robert Spaemann: Töte mich – dieser Satz muss tabu bleiben vom 11.11.05, Volker Gerhardt: Der Streit um’s Sterben – das Leben ist der Grund! vom 18.11.05 Uniklinik lässt Sterbehilfe zu Das Universitätshospital Lausanne hat als erste von fünf Schweizer Unikliniken Sterbehilfe durch die Sterbehilfeorgansiation „Exit“ akzeptiert. Bisher war „Exit“ nur in Privathäusern tätig. Sie darf nun auch im Lausanner Krankenhaus aktiv werden, wenn der Patient nicht mehr nach Hause zurückkehren kann. Voraussetzung für die Sterbehilfe ist allerdings der wiederholt geäußerte Wille des Patienten zu sterben. Auch die Bedingung einer unheilbaren Krankheit oder des unmittelbar bevorstehenden Todes muss erfüllt sein. Das Klinikpersonal darf nicht gezwungen werden, bei der Sterbehilfe aktiv mitzuwirken. Ebenso ist eine Mitwirkung der Ärzte innerhalb ihrer Dienstzeit ausgeschlossen. In der Freizeit ist den Ärzten eine Mitwirkung erlaubt. 7 Quelle: Südkurier Friedrichshafen vom 19.12.06 Die Biopolitik der großen Koalition Im Koalitionsvertrag hält die neue Regierungskoalition an zwei Zielen fest: Sie möchte Gesetze für Bio- und Gentechnologien „innovationsfreundlich“ gestalten und will diese mit ethischen Prinzipien „weiter in Einklang bringen“. Dabei sollen die Möglichkeiten der regenerativen Medizin genutzt werden, allerdings mit einer deutlichen Priorität der Forschung mit adulten vor embryonalen Stammzellen. Der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen soll erleichtert werden, zugleich soll allerdings der Verbraucher die Chance auf eine Wahl zwischen konventionellen und ganz oder teilweise gentechnisch veränderten Lebensmitteln erhalten. Zielkonflikte sind in der Regierungsarbeit nicht ausgeschlossen. Sie gleicht einer Gratwanderung: Einerseits steht die Bundeskanzlerin Merkel für eine forschungsfreundliche Entwicklung der Biound Gentechnik, um künftige Marktchancen nicht zu verpassen. Andererseits darf die Regierung die genindustrielle Revolution nicht zu weit treiben, um das Vertrauen einer skeptischen Bevölkerung nicht zu verspielen. Neben den beiden Reizthemen Embryonenforschung und Gentechnik-Lebensmittel stehen laut Schwägerl noch weitere Aufgaben im Spannungsfeld zwischen Innovationsförderung und ethischer Grenzziehung an: Das Auffinden und Festlegen von Regeln für Gentests. Die klinische Erprobung moderner, gentechnisch produzierter Medikamente. Die Bekämpfung altersbedingter Krankheiten als Teil der Vorbereitung auf demografische Umbrüche. Schließlich die Fragen einer synthetischen Biologie, die bereits an der Schaffung künstlicher Organismen arbeitet. Quelle: Christian Schwägerl: Schwierige Gratwanderung. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 01.12.06 1000. Hinrichtung in den USA 8 Die 1000. Hinrichtung seit 1973 in Kalifornien/USA löste ein enormes Pressecho aus und fachte die Diskussion um die ethische und rechtliche Legitimation der Todesstrafe an. Weltweit werden zwar in immer weniger Ländern Todesstrafen verhängt. Dennoch ist es in 74 von 122 Ländern möglich und üblich , sie bei besonders schweren Delikten anzuwenden. In den Ländern der EU ist die Todesstrafe verboten. In Deutschland heißt es im Artikel 102 des Grundgesetzes lapidar: „Die Todesstrafe ist abgeschafft.“ Hinter diesem verfassungsrechtlichen „Nein“ stand die Erfahrung der nationalsozialistischen Justizmorde. Die DDR hob die Todesstrafe erst 1987 auf. 2004 wurden 3797 Menschen in 25 Staaten hingerichtet. Zum Tod verurteilt wurden laut amnesty international 7400 in 64 Ländern. Allein in China wurden 3500 Menschen hingerichtet, im Iran waren es 159, in Vietnam 64. Mit 59 Exekutionen befindet die USA sich, wie Stefan Geiger schreibt „in denkbar schlechter Gesellschaft“. Zur Zeit sitzen in den Todeszellen US-amerikanischer Gefängnisse 3300 Menschen. Die Zahl der Todeskandidaten ist wegen der niedrigsten Mordrate seit 40 Jahren leicht zurückgegangen. Auch die Todesurteile waren rückläufig und sind in einigen Staaten in lebenslange Strafen ohne Bewährung umgewandelt worden. Allerdings lässt die Zustimmung der Bevölkerung in den USA zum Rechtsinstrument der Todesstrafe deutlich nach: Waren es 1994 noch 80 Prozent, die dem staatlich legalisierten Töten positiv gegenüberstanden, so waren es im Jahr 2005 nur noch 64 Prozent. Die Gründe für diese Abnahme liegen zum einen in einem hohen Risiko, dass der Staat unschuldige Menschen zum Tode verurteilt. Immerhin konnte in 122 Fällen die Unschuld der Exekutierten – vor allem durch die neuen kriminaltechnische Möglichkeiten wie z.B. der DNA-Analyse – nachgewiesen werden. Abschreckend wirkt sich zudem die Grausamkeit der Tötungsmethode. In einigen Fällen mussten die Gefangenen nach Giftspritzen und Stromstößen minutenlange Todeskämpfe durchstehen. Inzwischen kann auch überzeugend nachgewiesen werden, dass die Todesstrafe kriminalpolitisch unwirksam ist. Sie schreckt die Täter nicht ab. In mit den USA vergleichbaren Ländern gibt es in etwa gleich viele Tötungsdelikte. Nirgends ist die Senkung der Schwerkriminalität durch das Androhen der Todesstrafe belegt. Bewiesen ist hingegen die rassistische Dimension staatlicher Exekutionen in den USA. Schwarze und Arme haben ein wesentlich höheres Risiko von weißen Staatsanwälten zum Tode verurteilt zu werden, als weiße, reiche Mörder. Inzwischen werden auch Kostengründe gegen die Todesstrafe angeführt. Sie kommen den Steuerzahler wegen der langen Revisionsverfahren teurer als lebenslange Haftstrafen. Dagegen 9 machen Befürworter der Todesstrafe geltend, dass das Leben des Opfers mehr wert sei als das Leben des Täters, der seine Tat durch den eigenen Tod, also sein eigenes Leben sühnen müsse. Damit solle Gerechtigkeit gefördert werden. Das zentrale Argument gegen die Todesstrafe bleibt jedoch das menschenrechtlich begründete Verbot, anderen Menschen das Leben zu nehmen. Da es universell gilt, muss sich auch der Staat daran halten. Verstößt er gegen das Tötungsverbot, begibt er sich auf die Ebene von Mördern. Stefan Geiger erweitert dieses Argument mit dem Hinweis auf die Gefahr einer Legitimierung von Folter als Vernehmungsinstrument: „Wer das Töten legalisiert, nimmt das Risiko in Kauf, eines Tages auch zu foltern, beispielsweise in Abu Ghreb, oder foltern zu lassen, indem er seine Feinde in Folterstaaten ausfliegen lässt, oder andere Menschenrechte mit Füßen zu treten, beispielsweise in Guantanamo“. Quellen: N.N.: Wenn die Wahrheit zu spät kommt. In: Der Tagesspiegel vom 10.01.06 Stefan Geiger: Wer das Töten legalisiert, tötet die Freiheit. In: Stuttgarter Zeitung vom 03.12.05 Mattias B. Krause: Killer oder Friedensengel, Todeszelle oder Preis. In: Stuttgarter Zeitung vom 07.12.05 Katja Gelinsky: Nur noch eine Chance. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 05.11.05 Jürgen Koar: Der tausendste Tod durch Hinrichtung. In: Stuttgarter Zeitung vom 30.11.05 Friedemann Diedrichs: In der Todeskammer von San Quentin. In: Südkurier vom 14.12.05 Uli Fricker: China führt die schwarze Liste an. In: Südkurier vom 14.12.05 Thomas Spang: Der Gouverneur lässt im Fall Lovitt Gnade walten. In: Schwäbische Zeitung vom 30.11.05 Barbara Munker: Schwarzenegger kennt keine Gnade. In: Schwäbische Zeitung vom 14.12.05 Rezension Markus Dederich: Menschen mit Behinderung zwischen Ausschluss und Anerkennung, Klinkhardt Verlag Bad Heilbrunn 2001 „Pädagogik ist angewandte Ethik“(15). So lautet die Ausgangsthese des Dortmunder Heilpädagogen Markus Dederich. Er begründet sie, indem er auf die Normativität der Gestaltung von Erziehungs- und Bildungsprozessen verweist. Normative Vorstellun- 10 gen, was der Mensch sein soll, um ein guter Mensch zu sein, sind für Dederich handlungsleitend. Deutlich werde die Ethikbezogenheit von Erziehung auch in der Haltung und dem Ethos des Pädagogen. Und schließlich sei der Mensch als entwicklungsoffenes Wesen zur Beurteilung seiner Handlungen ständig auf Ethik und Moralität angewiesen. Behindertenpädagogisch plädiert Dederich für die Legitimität pädagogischer Eingriffe in das Leben von Menschen mit Behinderungen in advokatorischer Absicht. Die Asymmetrie oder auch Andersheit im erzieherischen Bezug (z.B. zwischen Behinderten und Nichtbehinderten) ist in der „Grundstruktur des Seins markiert“, bedarf aber einer Ethik, die sowohl die Integrität des Anderen als einzigartiges Wesen als auch die jeweiligen Anforderungen und Erwartungen der Gesellschaft berücksichtigt. Auf der Suche nach einer erkenntnistheoretischen Fundierung von Behindertenpädagogik kritisiert Dederich einen radikalen Konstruktivismus, den Funktionalismus und die Systemtheorie als mögliche Grundlage, weil bei diesen ein normatives Vakuum für die kommunikativ Handelnden entstehe. Er bewertet allerdings den Konstruktivismus als einen wichtigen Beitrag gegen eine Naturalisierung und Kategorisierung von „Behinderung“. Deshalb versucht er Behinderung zwischen Normierung, Dekategorisierung und Andersheit zu fassen und konstatiert einen Zwiespalt zwischen negativen, ausgrenzenden und inkludierenden positiven Aspekten des Behindertenbegriffes. Eine möglichst vorurteilsfreie Beschreibung des Adressatenkreises bleibe notwendig, „um die Unterprivilegierung bestimmter Gruppen benennbar zu machen, Solidarität zu ermöglichen, ethische Schutzbereiche zu errichten, ausgleichende Gerechtigkeit zu gewährleisten und den Anspruch auf Hilfe und Ressourcen rechtlich zu sichern und bereitzustellen“(122). In einem ganzen Kapitel weist Dederich nach, dass Menschen mit Behinderungen wegen sozialer Benachteiligung in Schule und Erwerbsarbeit nach wie vor ein hohes Ausgrenzungsrisiko tragen. Die Kompensation dieses Risikos sei sozialstaatlich zwar einigermaßen abgesichert, allerdings nur solange, wie auch die ökonomischen Grundlagen gegeben sind. Werde diese Grundlage brüchig, komme es zu einer „Ökonomisierung sozialer Qualität“ (172f). Gegen eine einseitige ökonomische Sicht der Dinge plädiert Dederich daher stattdessen für eine Ethik der Verantwortung vor dem Anderen, die hochsensibel auf den Verlust von Achtung und die Verletzung von Integrität reagiert. 11 Die Perspektive der Integrität, Achtung und Verantwortung vor dem Anderen dient Dederich als archimedischer Punkt, von dem aus die soziale Qualität der Dienstleistung an Menschen mit Behinderungen beurteilt werden kann. Mit Axel Honneth unterscheidet er drei Ebenen der Integrität: Die leibliche, die normativ-rechtliche und die Ebene der Lebensweise von Individuen und Gruppen. Wo Integrität verletzt werde, entstehe ein negatives Motiv für verantwortliches Handeln, das auch von moralisch relevanten Affekten und Emotionen bestimmt sei. Um eine generalisierbare Ethik zu begründen, bedürfe es des Zusammenspiels von Empathie und Achtung. Mit einem Rückgriff auf Honneths Buch „Kampf um Anerkennung“ eröffnet Dederich ein Spektrum von verschiedenen Formen der Anerkennung, um auf dieser empirischen Basis Elemente einer Ethik der Anerkennung zu konstruieren (210ff). Auf einer ersten Ebene geht es um emotionale Zuwendung, der eine kontextsensible, auf Differenz beruhende Ethik der Fürsorge entspricht. Dieser Zuwendung entsprechen Missachtungsformen menschlichen Seins wie Misshandlung, Gewalterfahrung, Isolation und Deprivation. Die zweite Anerkennungsform ist rechtlich geprägt. Sie korreliert mit einer universalistischen, von Gleichheit ausgehenden Gerechtigkeitsethik. Ihr entsprechen die Missachtungsformen Entrechtung und Ausschließung. Die letzte Anerkennungsebene beinhaltet die solidarische Zustimmung. Sie wird begleitet von einer kommunitären, auf Solidarität fokussierenden Sozialethik. Sie kann durch Nichtanerkennung und der Herabstufung sozialer Wertschätzung missachtet werden. Dederich ist mit seinen Vorüberlegungen zu einer Ethik der Anerkennung eine wichtige und für leitende MitarbeiterInnen in der Behindertenhilfe lesenswerte Grundlegung gelungen. Diese ist wichtig in einer Zeit, die vorschnell, meist aus ökonomischen Motiven handelt. Der Ansatz Dederichs kann so als eine Einladung zur Entschleunigung von unreflektierten Prozessen in der Behindertenhilfe gelesen werden. Er enthält auch wertvolle Hinweise für die Themen der Altenhilfe (Umgang mit Dementen, Sterbehilfe, Sterbegleitung, Autonomie im Alter etc.), sofern sie sich um eine ethische Grundlegung ihres Handelns müht. Neu an Dederichs Anliegen ist der Versuch, die emotionale Dimension moralischen Berufshandelns in den ethischen Diskurs zu integrieren. Er macht dabei auf das Problem der Asymmetrie, der Abhängigkeit und des Machtgefälles aufmerksam, das durch eine modische Selbstbestimmungsrhetorik in der Behindertenpädagogik verdrängt zu werden droht. Inwieweit ein solcher Versuch gelingen kann, wird von der Beschreibung von Gütekriterien abhängen, die als ethische Maßstäbe mittlerer Reichweite Orientierung für sozialberufliches 12 Handeln liefern können. Diese wären eine notwendige Ergänzung der deduktiven Denkrichtung Dederichs. Für Sozialethiker und Praktiker wartet so noch viel Vermittlungsarbeit, um dem Anliegen einer Ethik der Anerkennung auch in den Praxisfeldern der Alten- und Behindertenhilfe zum Durchbruch zu verhelfen. Hans-Martin Brüll Tagung Bildung – Subjekt – Ethik. Bildung und Verantwortung im Zeitalter der Biotechnologie Tagung des Instituts für Bildung und Ethik an der Pädagogischen Hochschule Weingarten, Weingarten 27.-29.10. 2005 Vom 27. bis zum 29. Oktober 2005 veranstaltete das Institut für Bildung und Ethik an der PH Weingarten im Rahmen des Forschungs- und Nachwuchskollegs „Bioethik im Horizont ethischer Bildung“ die interdisziplinär angelegte Tagung „Bildung – Subjekt – Ethik. Bildung und Verantwortung im Zeitalter der Biotechnologie“. Angesichts der Entwicklungen im Bereich der sogenannten Lebenswissenschaften und der daran anknüpfenden biotechnologischen Anwendungen sollten die Grundlagen eines zeitgemäßen Begriffs von Bildung herausgearbeitet werden. Gegen Bestrebungen der Politik, der viel beklagten Bildungs- und Wirtschaftsmisere durch eine Konzentration auf natur-, technik- und wirtschaftswissenschaftliche Inhalte zu begegnen, wurde dabei die Bedeutung eines ethisch-kulturellen Wissens unterstrichen, dessen es bedarf, um die Tragweite neuer Technologien für Natur und Gesellschaft zu ermessen. Die Tagung führte in drei thematischen Schritten von der gesellschaftspolitischen Kontroverse um den Begriff Bildung (I) über das Problem der Entstehung und Entwicklung von Subjektivität und personaler Identität im Zeitalter der Biotechnologie (II) hin zu den Konsequenzen, die sich hieraus für die Bioethik und das bioethische Lernen in der Schule ergeben (III). I Bildung in der gesellschaftspolitischen Kontroverse Der erste Teil der Tagung thematisierte die gesellschaftspolitische Kontroverse um den Begriff und die Ziele der Bildung aus dem Blickwinkel von Pädagogik, Politik, 13 Wirtschaft und Ethik. Die Kontroverse wurde bereits im Selbstverständnis der mit Erziehung befassten Disziplinen greifbar: In seinem Vortrag „Reformpädagogik versus Unterrichtsforschung“ diagnostizierte der Pädagogikprofessor Winfried Böhm (Würzburg) eine Pendelbewegung in der Diskussion zwischen reformpädagogischen und erziehungswissenschaftlichen Ansätzen. Ein pädagogischer Fortschritt sei in dieser Bewegung nicht auszumachen – sie habe sich lediglich beschleunigt. Die gegenwärtige Situation sei durch eine weitgehende Trennung von Theorie und Praxis gekennzeichnet. Auf der einen Seite stehe die Reformpädagogik als Erziehungskunst, die sich einer wissenschaftlichen Überprüfung ihrer Konzepte verweigere. Auf der anderen Seite eine Forschung, die trotz ihrer empirischen Ausrichtung den Bezug zur Praxis verloren habe. Während die Pädagogik ein Bekenntnis darstelle und sich selbst als engagierte und normative Lehre begreife, die um Kontinuität bemüht sei, verstehe sich die Erziehungswissenschaft als eine um Erkenntnis bemühte, wertneutrale und distanzierte Disziplin, die Forschung um der Forschung willen betreibe und Brüche und Diskontinuitäten aufweise. Notwendig sei jedoch eine enge Verbindung von Theorie und Praxis. Pädagogik müsse, einen Terminus Flitners zitierend, eine Reflexion engagé sein. In der anschließenden Diskussion wurde die Spannung von wertneutraler Forschung und normativen Voraussetzungen weiter problematisiert. Um wissenschaftlich redlich zu sein, müssten letztere benannt und expliziert werden. Der Workshop „Bildung in der gesellschaftspolitischen Kontroverse“ weitete die Debatte auf das Spannungsverhältnis von Bildung und Pluralität, von Universalität und Partikularität aus. Dieses Spannungsverhältnis wurde in drei Arbeitsgruppen anhand der Aspekte Sprache, Schlüsselqualifikationen und Geschlecht konkretisiert. Dabei zeigte sich, dass das Verhältnis von Partikularität und Universalität in Zeiten massiven gesellschaftlichen Wandels (Immigration, Globalisierung, Emanzipation) neu austariert werden muss. Entscheidende Fragen sind, wie hoch der Grad an Partikularität in der Bildung sinnvoller Weise sein kann, was angesichts der genannten Pluralitäten als Allgemeines gelten kann und soll und wie die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen an diesem Prozess beteiligt sind. Die anschließende Zusammenführung verdeutlichte insbesondere, dass in der gesellschaftspolitischen Kontroverse um (Allgemein)Bildung geklärt werden muss, inwieweit Partikularinteressen in den Status gleichberechtigter Legitimität gesetzt werden, wenn es um die Erhebung des Kernbestands des Allgemeinen in einer pluralen Gesellschaft geht. 14 Der Philosoph Professor Hans Joachim Werner (PH Karlsruhe) schloss in seinem Vortrag „Bildung, Lernen und Erziehung im Horizont bioethischer Kontroversen“ an diese Überlegungen an. Er fragte, ob die moderne Gesellschaft, die als plurale notwendig eine Konfliktgesellschaft sei, über ein ausreichendes Konsenspotential zur Lösung dieser Kontroversen verfüge und reflektierte dieses Problem anhand der Pluralität in der Bioethik. Die biotechnologischen Entwicklungen verliehen nicht nur der Interdependenz von Selbst- und Weltverhältnis eine neue Präsenz und Dimension; sie seien auch dazu angetan, schwere anthropologische Träume (J. Mittelstraß) zu verursachen. Die Pädagogik dürfe die dadurch evozierte Kontroverse um Möglichkeiten der Selbstgestaltung und Gefahren des Selbstverlustes nicht ignorieren. Bioethische Diskurse wiesen zahlreiche Bildungsbezüge auf. So müsse z.B. Wissen in Beziehung zur eigenen Person gesetzt werden können. Bioethische Kontroversen seien in besonderer Weise dafür geeignet, weil sie letztlich auf das Menschen- und Selbstbild zielten. Die Person des Erziehers sei in diesem Kontext möglicher existenzieller Verunsicherungen unersetzbar für den Aufbau eines „Vertrauens in die Welt, weil es diesen Menschen gibt“ (M. Buber) als Grundlage der Persönlichkeitsbildung. In der Diskussion über die Konstitution einer (Bio)Ethik unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen, die sich an den Vortrag anschloss, stellte Werner fest, dass ein deduktiv eindeutiges Ergebnis in diesem Bereich nicht möglich sei. Die argumentierende Vernunft sei jedoch in der Lage, Schneisen zu schlagen und habe deshalb keineswegs ausgedient. Der bildungspolitisch ausgerichtete öffentliche Abendvortrag von Professor Daniel Troehler (PH Zürich) lieferte ein Plädoyer für einen größeren Einfluss der Kommunen auf Schulen und Hochschulen. Die Argumente für einen solchen Wandel wurden über einen historisch fundierten Vergleich zwischen dem deutschen Bildungssystem auf der einen und dem schweizerischen sowie dem amerikanischen Bildungssystem auf der anderen Seite entwickelt. Auch Troehler machte eine Dialektik von reformpädagogischen Bemühungen und deren Krisen aus. Im Gegensatz zu Böhm verdeutlichte er diese über eine Klärung des Wissensbegriffs: In der deutschen Diskussion schwinge oft ein problematischer Dualismus von Bildung und Wissen mit. Bildung werde als höherwertig, ganzheitlich und nicht messbar betrachtet. Wissen gelte im Unterschied dazu als einseitig, messbar und minderwertig. Ein zweiter wichtiger Strang des Vortrags bestand in der Forderung nach einer Demokratisierung der Schulaufsicht. Troehler orientierte sich in diesem Punkt an dem schweizerischen und 15 dem amerikanischen Modell und bezeichnete die öffentliche Kontrolle der Schule durch kommunal gewählte Schulkomitees als einzig effektive und angemessene Organisationsform. Troehlers bildungspolitische Vorschläge stießen jedoch nicht auf einhellige Zustimmung. Zum einen wurde beklagt, dass einzelne gesellschaftliche Gruppen in einem kommunalen System das Curriculum einseitig beeinflussen könnten. Zum anderen wurde auf Gefahr der Benachteiligung strukturschwacher Gemeinden hingewiesen, wenn auch die Einstellung und Besoldung der Lehrkräfte sowie die Ausstattung der Schulen kommunal geregelt würden. Alexander Dehio, Geschäftsleiter des Standortes Biberach des Pharma- Unternehmens Boehringer-Ingelheim, formulierte Erwartungen der Wirtschaft an das Bildungswesen. Diese Erwartungen seien heute nicht mehr auf möglichst praxisnahe Fachkenntnisse beschränkt. Gefragt seien Berufseinsteiger mit einem weit gefassten Bildungsprofil, das auch den Anforderungen von Globalisierung bzw. kultureller Vielfalt, Informatisierung, prozessorientierten Denk- und Arbeitsvorgängen und Teamarbeit gerecht wird. Entgegen dem vorherrschenden Tenor zeichnete Dehio dabei ein positives Bild des deutschen Schulsystems. Sowohl die duale Ausbildung in den Berufsschulen als auch das dreigliedrige Schulsystem hätten sich bewährt. Gerade für die Pharmaindustrie als einer forschungs- und wissensbasierten Branche stelle der „Rohstoff Bildung“ die wichtigste Ressource dar. Sein Unternehmen gehe daher unter anderem mit einem mobilen Biolabor auf die Schulen zu. Die Zusammenarbeit könne jedoch verbessert werden, wenn die Schulen ihrerseits auch stärker den Kontakt zu Unternehmen suchen würden. Dehio lobte das leistungs- und bildungsfreundliche Gesamtklima gerade in Baden-Württemberg, kritisierte aber die in Deutschland vorherrschende Technikfeindlichkeit. In diesem Punkt forderte er mehr Vertrauen in die technologisch basierte Forschung. Die Unternehmen seien sich ihrer ethischen Verantwortung bewusst, und mit einer „Weltmarktführerschaft“ in Sachen Bioethik sei niemandem gedient. Persönlichkeitsbildung könne nur aus einer Kombination von Fach- und Orientierungswissen erwachsen. Hinsichtlich der Erziehung unterstrich Dehio dabei die Notwendigkeit der Wertevermittlung im Elternhaus. Nur hier könne die „menschliche Wärme“ gegeben werden, auf deren Basis sich eine fest im Leben stehende, ethisch urteilsfähige Persönlichkeit zu entwickeln vermöge. 16 II Bedingungen der Konstitution des Subjekts In den Vorträgen des zweiten Teils der Tagung wurde das im ersten Teil benannte Bildungsziel einer gefestigten und urteilsfähigen Persönlichkeit aufgegriffen und aus der Perspektive der Moralpsychologie, der Pädagogischen Psychologie und der Philosophie auf seine theoretischen Voraussetzungen und praktischen Verwirklichungsbedingungen befragt. Die Moralpsychologin Gertrud Nunner-Winkler (Professorin am Max-Planck-Institut München) begann ihren Vortrag über „Identitätsbildung in Zeiten raschen Wandels und normativer Vielfalt“ mit einem Tableau identitätsstiftender und -stabilisierender Faktoren für traditionelle Gesellschaften, Moderne und Zweite Moderne. Die gegenwärtige Situation sei durch eine Individualisierung der Identitätsbildung und eine Pluralisierung der Möglichkeiten gekennzeichnet. Prägend für postmoderne Identitätstheorien seien Vorstellungen eines pluralen Selbst mit einer Art Patchwork-Identität, die als Befreiung vom Identitätszwang verstanden werde. Mit den Versuchen einer Rückkehr zur Konsistenz und einem Setzen auf narrative Kompetenz gäbe es aber auch Gegenbewegungen. Der These, dass die in den meisten westlichen Gesellschaften vorherrschende normative Vielfalt zu einem Verlust der Moral führe, hielt Nunner-Winkler entgegen, was als Verlust von Moral wahrgenommen werde, sei lediglich ein rascher Wandel in der Einschätzung dessen, was Moral ist. Es käme nicht zu einer Auflösung von Normen, sondern nur zu einem systematischen Wandel in der Begründungsstruktur. Das Identitätsproblem bleibe allerdings insofern virulent, als in fast allen Lebensbereichen immer mehr identitätsbezogene Entscheidungen gefällt werden müssten. Hinsichtlich der Entwicklungsbedingungen einer moralischen Persönlichkeit verwies Nunner-Winkler als Einwand gegen die Theorie Kohlbergs auf die Möglichkeit eines Auseinanderfallens von Begründung und Motivation. So gebe es etwa fünfjährige Kinder, die durchaus wüssten und begründen könnten, dass Stehlen moralisch falsch sei, es aber im gleichen Atemzug für „toll“ hielten, so lange man unentdeckt bliebe. Die Motivation zu moralischem Handeln werde von Kindern selbst aufgebaut. Dieser Prozess könne aber z.B. dadurch gefördert werden, dass insbesondere die Eltern sich selbst als moralisch verstünden und entsprechend handelten. Das Fazit hätte daher lauten können: Eine gerechtere Gesellschaft erleichtert das Lernen gerechter Regeln bzw. gerechten Handelns. 17 Der Vortrag „Zur Entstehung und Entwicklung einer moralischen Persönlichkeit im Zeitalter des Klonens – Konsequenzen für die Pädagogik“ des Pädagogen und Philosophen Martin Heinrich (Linz) setzte sich ebenfalls kritisch mit Kohlbergs Theorie der moralischen Entwicklung auseinander. Dabei konnte Heinrich auf die Ergebnisse eigener empirischer Untersuchungen zurückgreifen, die sich mit der Frage beschäftigten, wie Kinder mit Widersprüchen zwischen moralischen Geboten und einsozialisierten Regeln erfolgsorientierten Handelns umgehen. Der Bogen der vier herausgearbeiteten Reaktionsformen reiche von einer „vornormativ-präfunktionalen“ Reaktion, die die Logik des Szenarios ignoriere und damit zu sprengen suche, bis zu Versuchen einer theoretischen Distanzierung, die auf der Handlungsebene teils zu einem aufbegehrenden, teils zu einem pragmatisch-resignativen Verhalten führten. Die Ergebnisse stellten einerseits eine an Altersstufen gekoppelte Logik der moralischen Entwicklung in Frage. Andererseits verwiesen sie auf die Gefahr einer „moralischen Desensibilisierung“ durch die Gewöhnung an derartige Widersprüche, wie sie auch in der bioethischen Debatte anzutreffen seien. Heinrich empfahl abschließend, die von ihm herausgearbeiteten Reaktionsformen von Schülern für Unterrichtsentwürfe zur moralischen Urteilsbildung heranzuziehen, um ein besseres Verständnis von Schülerhaltungen zu ermöglichen. Die Philosophin Beate Herrmann (Graduiertenkolleg Bioethik, Tübingen) plädierte in ihrem Vortrag „Körperlichkeit und moralisches Subjekt. Zum normativen Status des menschlichen Körpers in ethischen Personentheorien“ dafür, die körperliche Verfasstheit des Menschen in die Begründungsstruktur des Personbegriffs mit einzubeziehen. In den klassischen Theorien der Person von Locke und Kant bleibe die körperliche Verfasstheit des Menschen ohne Bedeutung. Auch das Singersche Personalitätskriterium, Wünsche hinsichtlich der eigenen Zukunft haben zu können bzw. ein selbstbewusstes Wesen mit Vergangenheit und Zukunft zu sein, schenke der Körperlichkeit des Menschen kaum Beachtung. Der Körper sei jedoch nicht nur ausführende Instanz, sondern unmittelbare Verkörperung der Person, das Verhältnis zwischen Personen nicht erst diskursiv, sondern immer schon körperlich vermittelt. Zum einen bestehe zwischen Person und Körperlichkeit eine interne Beziehung, die sich als „metaphysical ownership“ bezeichnen lasse. Zum anderen verfüge der Mensch durch seinen Körper über ein nichtreflexives, aber persönlichkeitsbezogenes Handlungswissen (embodied skills), das dem Körper eingeschrieben sei. Eine die Körperlichkeit als konstitutives und normatives Merkmal berücksichtigende Theorie 18 der Person habe unmittelbar medizinethische Konsequenzen, da sie eine Kritik objektivierender Eigentumstheorien des Körpers nach sich ziehe. Auch für die Bewertung der biotechnischen Selbstgestaltung des Menschen zwischen den Polen von Selbstbestimmung und manipulativer Verfügbarkeit könne sie sich als bedeutsam erweisen. Die anschließende Diskussion drehte sich vor allem um das Verhältnis von „Leib“ und „Körper“. Dem Einwand, dass sie sich mit der Verwendung des Körperbegriffs von Ergebnissen der philosophischen Anthropologie Schelers und insbesondere Plessners abkoppele, hielt Herrmann entgegen, dass der Leibbegriff zu weit vom medizinethischen Diskurs entfernt sei, um dort Wirkung zu entfalten. III Ethik und ethisches Lernen im biotechnischen Kontext Das Interesse des dritten Tagungsabschnitts galt einerseits den Prinzipien der Bioethik andererseits konkreten Bildungsprozessen zu bioethischen Themenfeldern in der Schule. Zu einem fruchtbaren Gegenüber wurden hierbei die Vorstellung eines länderübergreifenden Schulprojektes sowie kritische Reflexionen zur Didaktik und Methodik der Bioethik. Der Philosoph Nikolaus Knoepffler, Professor am Ethikzentrum der Universität Jena, gab zunächst einen klärenden und strukturierenden Überblick über unterschiedliche Ansätze in der Bioethik, den er durch seinen eigenen integrativen Ansatz ergänzte. Die Basis dieses Ansatzes bildeten die drei Prinzipien der Menschenwürde als das zentrale Kriterium einer prinzipiellen Gleichheit aller Menschen, der Nachhaltigkeit in sozialer, ökologischer und ökonomischer Hinsicht sowie der Integration der Eigenwertigkeit nichtmenschlicher Lebewesen, die aber der Ungleichheit zwischen Mensch und Tier Rechnung trage. Ihre Konkretisierung fanden diese Prinzipien in der Formulierung eines Sets von Regeln, das strukturell an der Berücksichtigung einer sozialen, ökologischen und ökonomischen Dimension sowie formaler Richtlinien einer ethischen Güterabwägung ausgerichtet war. Neben der Individualverträglichkeitsregel und der Sozialverträglichkeitsregel umfasste es beispielsweise Regeln zur Regeneration, Substitution, Optimierung, Reversibilität, zum Tierschutz und zu den Gesamtkosten. Im folgenden Austausch mit dem Referenten entspann sich ein lebhafter Disput sowohl über die dargebotene Begründung des Prinzips der Menschenwürde als auch 19 über das integrative Moment des Ansatzes sowie die Möglichkeiten, die Synthese der dargestellten Prinzipien und Regeln weiterzuentwickeln. Mit der Vorstellung eines sehr engagierten Drei-Länder-Projekts mit Schülerinnen und Schülern aus Deutschland, Lettland und Luxemburg lieferten die Lehrer HeinzHermann Haar (Meinerzhagen) und Jean-Louis Gindt (Luxembourg) einen anschaulichen Bericht aus der Unterrichtspraxis. Mit dem Ziel, Schülerinnen und Schüler zur Urteilsfähigkeit in ethisch relevanten Fragen zu qualifizieren, wurde in einer knappen Woche ein Projekt durchgeführt, das sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Klonen auseinander setzte. Angeregt durch die Beschäftigung mit Charlotte Kerners Jugendroman „Blueprint“, durch Expertenvorträge aus unterschiedlichen Fachbereichen, Filmdokumentationen, Diskussionsrunden und die Möglichkeiten des Elearnings legten die Beteiligten ihren Weg der Urteilsbildung über die Grenzen der unterschiedlichen Nationen hinweg gemeinsam zurück. Als Mitglieder einer Ethikkommission formulierten die Schülerinnen und Schüler über die eigentliche Projektdauer hinaus Empfehlungen zum therapeutischen Klonen mit embryonalen Stammzellen. Den Tagungsteilnehmern wurde mit diesem bemerkenswerten Projekt eine Vielzahl von Möglichkeiten der schulischen Auseinandersetzung mit bioethischen Fragen vor Augen geführt. Die Reflexionen der Philosophin Julia Dietrich (Tübingen) zur Didaktik und Methodik der Bioethik lenkten den Blick der Tagung abschließend auf die Rolle der Bioethik für die Ethikdidaktik sowie auf die im Ethikunterricht anzustrebenden Kompetenzen. Dietrich äußerte ein Unbehagen an der zentralen Rolle der Bioethik für die Ethikdidaktik. Sie stellte zur Diskussion, ob die bioethische Frage nach den Grenzen des Selbstverständnisses allgemein als Paradigma der Ethik gelten könne oder ob nicht eher ein Betreiben der Ethik von den vorhandenen Ressourcen der gelebten Moral her zu befürworten sei. Hinterfragt wurden des Weiteren die Implikationen der Zukunftsgerichtetheit bioethischer Probleme: Wird mit der Bioethik nicht einer „self fulfilling catastrophy“ Vorschub geleistet? Werden durch den Blick auf eine ungewisse biotechnologische Zukunft nicht Probleme vernachlässigt, die gegenwärtig viel dringender nach einer Lösung verlangen? Zu diesen Fragen gesellten sich kritische Anmerkungen zur Individualisierung, Kontextualisierung und Prozeduralisierung bioethischer Problemfelder, die sowohl zu einer Entmoralisierung als auch zu einer Übermoralisierung des Individuums führen könnten. Als alternatives systematisches Konzept einer Ethikdidaktik präsentierte Dietrich Überlegungen zur „Didaktik einer Ethik 20 des Selbstverständlichen“. Sie skizzierte ein hierarchisches Modell unterschiedlicher Kompetenzen, das die ethische Kompetenz im eigentlichen Sinne als Teilkompetenz der moralischen Kompetenz fasste und in dem der Fundierung in einer Moralitätskompetenz, verstanden als der Fähigkeit, überhaupt ein Subjekt sein zu können, tragende Bedeutung zugeschrieben wurde. Fazit Die Tagung war geprägt von anregenden Vorträgen und lebhaften Diskussionen, die sich durch einen erfreulich konstruktiven Charakter auszeichneten. Auch wenn man sich am roten Faden – vom gesellschaftlichen Streit um Form und Inhalt der Bildung über das sich in Bildungsprozessen als gefestigt und moralisch entscheidungsfähig konstituierende Subjekt zu Prinzipien der Bioethik und einer bioethischen Didaktik im Schulunterricht – orientiert, fällt es jedoch nicht leicht, ein Fazit zu ziehen oder gar eine Synthese aller Vorträge und Diskussionen zu bilden. Gleichwohl scheint mit dem Aspekt einer integrativen Verbindung ein Ansatzpunkt dafür auf. Durchweg abgelehnt wurde ein äußerlicher Begriff von Bildung, der ohne Verbindung zu einer Entwicklung der Persönlichkeit bleibt. Die damit geforderte Verflechtung von Wissenserwerb und Persönlichkeitsbildung konnte gerade an bioethischen Debatten demonstriert werden, in denen die zu diskutierenden Fragen einer biotechnisch erweiterten Selbstgestaltung des Menschen unmittelbar das menschliche Selbst- und Weltverhältnis betreffen. Eine ganzheitliche oder integrative Orientierung zeigte sich ebenfalls in den Versuchen, den Begriff der Person um das Moment der Körperlichkeit zu erweitern und in der Theorie der Moralentwicklung eine Engführung auf kognitive Aspekte zu vermeiden. Auch in den Vorträgen, die sich im engeren Sinne mit bioethischen Fragen der Theorie und der Unterrichtspraxis beschäftigten, war das Bestreben nach einer Verbindung von bioethischen Prinzipien, einem Zusammenspiel verschiedener Unterrichtsmethoden sowie einer Rückbindung einer Didaktik der Bioethik an die allgemeine Ethikdidaktik zu beobachten. Bei allen Unwägbarkeiten, ob und wie ein Allgemeines in der Bildungsdebatte und in der Bioethik hergestellt werden könnte, offenbarte sich damit ein Komplexitätsbewusstsein, das sich nicht mit Einseitigkeiten zufrieden geben will. Eike Bohlken, Julia Horlacher, Christine Mann